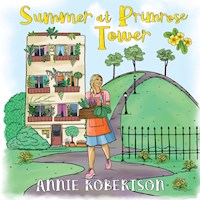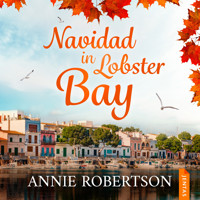8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Herz Ja sagt, kann der Kopf einpacken
Nina liebt Kuchen, den kleinen Buchladen
Love Books und ihren Freund Will. Vor allem aber liebt sie den Film
Harry und Sally. Die sympathische, tollpatschige junge Frau hat sich deshalb in den Kopf gesetzt, die Fortsetzung zu ihrem Lieblingsfilm zu schreiben. Als sie herausfindet, dass Will sie betrügt und verlassen will – und ihr dabei noch an den Kopf wirft, sie könne nie etwas zu Ende bringen –, ist klar: Jetzt erst recht! Doch dann wird ihr ein professioneller Drehbuchschreiber zur Seite gestellt, Hipster Ben, den sie auf Anhieb nicht leiden kann. Aber ihr bleibt gar nichts anderes übrig, als sich mit ihm zu arrangieren und natürlich fliegen bald die Funken in jeder Hinsicht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die etwas tollpatschige, aber umso sympathischere Nina liebt den kleinen Buchladen Love Books, in dem sie aushilft, ihren Freund Will, und sie kommt an keinem Stück Kuchen vorbei. Vor allem aber liebt sie Nora Ephron und den Film Harry und Sally. Nur mit dem Ende ist sie nicht ganz zufrieden und hat deshalb begonnen, eine Fortsetzung zu schreiben. Immerhin hat sie ein Diplom im Drehbuchschreiben. So richtig voran kommt sie damit aber nicht. Doch das ändert sich schlagartig, als sie Will mit einer anderen im Bett erwischt und er ihr auch noch an den Kopf wirft, sie könne ja nie etwas zu Ende bringen. Jetzt erst recht, denkt Nina. Sie schreibt ihr Skript zu Ende und traut sich endlich, es an die Produzenten von Harry und Sally zu schicken. Die sind wider Erwarten sehr begeistert, stellen ihr aber einen professionellen Drehbuchschreiber, Ben, an die Seite, den Nina auf Anhieb nicht leiden kann. Keine guten Voraussetzungen, doch es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit ihm zu arrangieren, und natürlich fliegen bald die Funken in jeder Hinsicht …
Autorin
Annie Robertson hat in London eine Ausbildung zur klassischen Musikerin gemacht und danach als Assistentin für verschiedene Prominente gearbeitet. Ihre wahre Leidenschaft, das Schreiben, entdeckte sie während ihres Medizinstudiums – daraufhin entschloss sie sich, den Master in Creative Writing zu machen, und bestand diesen mit Auszeichnung. Annie Robertson lebt nun mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Schottland.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ANNIE ROBERTSON
Roman
Aus dem Englischen von Melike Karamustafa
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright des Originals © 2016 by Annie Robertson
Titel des Originals: »I Heart Nora«
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018
by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
LH ∙ Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-21784-6V001
www.blanvalet.de
1
»Wir haben heute früher geschlossen«, rufe ich, während ich meine Jacke an die Garderobe hänge und den Schlüssel neben Wills auf das kleine Brettchen, das im Flur an der Wand befestigt ist, lege. »Irgendwas mit Astrids Katze, der Waschmaschine ihrer Mutter und der Northern Line, die weshalb auch immer gerade nicht fährt.« Will antwortet nicht. »Hoffentlich ist die Katze nicht in den Schleudergang geraten«, füge ich hinzu und lausche in die Wohnung hinein, wo er sein könnte.
Nicht dass die Möglichkeiten besonders vielseitig wären – zur Auswahl stehen Küche/Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad, die alle von dem sargähnlich schmalen Flur in unserer Mietwohnung in Brixton, London abgehen. Will behauptet gern, dass wir in Clapham leben, aber das tun wir nicht. Wir wohnen in Brixton, nur ein paar Gehminuten von dem McDonald’s entfernt, in dem vor Kurzem ein Mann erschossen wurde, weil er sich in der Schlange vorgedrängelt hatte. Ich höre Rumoren und Murmeln aus dem Schlafzimmer.
»Will?« Als ich die Tür aufstoße, sehe ich ihn neben unserem schmalen Boxspringbett stehen und hektisch seine Jeans zuknöpfen, während eine Frau mit deutlich größeren Titten als meine eigenen ihren Tanga hochzieht.
»Nina!«
Ich starre. Überrascht. Verwirrt.
Will verpasst meinem Halloweenkostüm – Sally Albright in ihrer Annie-Hall-Phase – eine imaginäre Ohrfeige. Die Krempe meines Hutes scheint auf einmal viel zu eng zu sitzen, und ich habe das Gefühl, vom Kragen meiner Bluse erwürgt zu werden. Mit aller Macht versuche ich zu vermeiden, sie anzusehen.
Ich drehe mich auf dem Absatz um und gehe ins Badezimmer, schließe die Tür von innen ab und lasse mich auf den schief sitzenden, wackligen Toilettendeckel fallen. Um nicht länger mit anhören zu müssen, wie sie eilig ihre Sachen zusammensuchen, presse ich mir die Hände auf die Ohren, doch es hilft nichts.
»Ich ruf dich an«, höre ich Will sagen, und sie antwortet: »Es tut mir leid«, bevor die Haustür hinter ihr ins Schloss fällt.
Ohne mich von der Stelle zu rühren, lausche ich, wie Will leise über den Flur geht und nach mir Ausschau hält. Die Wohnung wirkt genauso still und leer wie an dem Tag, an dem wir die Schlüssel bekommen haben. Als wir noch am Anfang standen – ohne Möbel und ohne Erinnerungen –, und bevor wir herausfanden, dass in der Etage unter uns ein Bordell logiert.
Ich höre, wie Will in der Küche den Wasserkocher anstellt, und starre auf die Handtücher, die er achtlos auf den schwarz-weiß karierten Linoleumboden im Bad fallen lassen hat. Auf die Deoroller, Eau de Toilettes und Shampooflaschen, die überall herumstehen. Mir ist schlecht. Tränen laufen mir die Wangen hinunter. Ich wische sie mit dem Handrücken weg.
Im Spiegel über dem Waschbecken starre ich auf meine Achtzigerjahre-Frisur, meine blonden Locken sind ganz verstrubbelt. Das Sally-Albright-Make-up hat schwarze Schlieren in meinem Gesicht hinterlassen. Energisch schminke ich mich ab und rede mir ein, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss.
Atme! Das hier passiert nicht wirklich. Alles wird wieder gut.
Auf meiner Seite des Betts, die dem Fenster am nächsten ist, neben der Kleiderstange, wo eben noch sie stand, ziehe ich mein Kostüm aus und schlüpfe in meinen Pyjama und meinen Lieblingscardigan. Den Cardigan, den Will mir vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat und den ich immer dann anziehe, wenn ich müde bin und mir nach etwas Kuschligem zumute ist. Ich versuche, nicht auf das zerwühlte weiße Laken und die wunderschöne Häkeldecke meiner Granny zu sehen, die wie ein buntes Bonbonpapier achtlos auf den Boden geworfen wurde. Auf einmal verspüre ich vor allem Wut darüber, dass Will sich noch nicht einmal die Mühe gemacht hat, das Chaos zu beseitigen, das die beiden veranstaltet haben.
Als ich in die Küche komme, sehe ich, dass er Tee aufgebrüht hat. Er reicht mir stumm eine der Mr.-und-Mrs.-Tassen, die wir irgendwann mal geschenkt bekommen haben.
Ich starre darauf und dann ihn an, mit einem Gesichtsausdruck, der sagt: Ist das etwa dein beschissener Ernst?
Er stellt die Tasse zurück auf die Buchenholzarbeitsplatte. »Wir haben uns beim Job kennengelernt. Sie arbeitet im zweiten Stock«, bricht er das Schweigen, als ob die Erklärung in irgendeiner Weise dazu beitragen könnte, meine Gefühle für nichtig zu erklären. Tut sie natürlich nicht.
»Wie lange schon?«, frage ich.
Ich lehne mich gegen das Sofa, das die Grenze zwischen Küche und Wohnbereich markiert, an der das verschrammte Laminat auf den fadenscheinigen grauen Teppichboden trifft, und verschränke die Arme. Früher einmal musste sich hier das Schlafzimmer des kleinen viktorianischen Reihenhäuschens befunden haben.
»Wie lange sie schon im zweiten Stock arbeitet?«, fragt er zurück, eine Hand gegen die weiße Front einer der Kücheneinbauschränke gestützt, und trinkt laut schlürfend einen Schluck Tee.
Ich verdrehe die Augen und starre ihn wütend an. Will hatte schon immer den Hang, bestimmte Situationen ohne den nötigen Ernst zu betrachten. Das war die einzige Sache, die ich witzig an ihm gefunden habe, als wir noch Freunde waren. Jetzt, fünf Beziehungsjahre später, bringt es mich nur noch auf die Palme genau wie seine nervige Schlürferei.
»Wie lange schläfst du schon mit ihr?«, frage ich in einem Ton, der deutlich macht, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt für seinen Bullshit ist.
»Ich weiß nicht genau«, sagt er und lässt sich auf den scheußlichen Wassily Chair vor dem Erkerfenster fallen, den uns die Vormieter für einen Wucherpreis verkauft haben.
»Du weißt nicht genau?«
»Nicht länger als sechs Monate«, sagt er und fährt sich mit einer Hand durch das widerspenstige blonde Haar, das so gerade nach oben wächst wie Kresse in einem Eierbecher.
Sechs Monate!
Verwundet werfe ich mich aufs Sofa.
»Warum?«, frage ich und umarme das Kissen mit den beiden applizierten Turteltauben darauf – ein Andenken an ein langes Wochenende in L’Isle-sur-la-Sorgue, an dem wir tagsüber gemeinsam die Flohmärkte nach billigen Raritäten durchforstet und nachts dunklen Rotwein zu Steaks getrunken haben. Will antwortet nicht. »Ich verdiene eine Antwort«, sage ich und starre auf den viktorianischen Kamin, der als Podest für Wills absurd großen Fernseher dient, während ich versuche, gegen die Tränen anzukämpfen.
»Wahrscheinlich weil wir angefangen haben, uns voneinander zu entfernen.«
»Und du bist kein einziges Mal auf die Idee gekommen, dass es unsere Beziehung eventuell wert sein könnte, das zu besprechen, bevor du jemand anderen flachlegst?«
»Ich hab den Sinn darin nicht gesehen.«
»Du hast keinen Sinn darin gesehen, mit mir darüber zu sprechen, dass unsere fünfjährige Beziehung aus deiner Sicht den Bach runtergeht?«
»Nein«, sagt er und versucht vergeblich, mit seinem langen, schlanken Körper eine komfortable Position in dem Designersessel zu finden. »Es kam mir wie Zeitverschwendung vor.«
»Und das soll heißen?«
»Das soll heißen, dass du immer glaubst, dass alles rosarot ist. Dass auf jeden ein Happy End wartet, genau wie in einem deiner beschissenen Nora-Ephron-Filme.« Angesichts seiner blasphemischen Äußerungen schnappe ich erschrocken nach Luft. »Happy Ends existieren nicht, Nina.«
»Doch, das tun sie.«
»Nicht auf die Art, wie du sie dir vorstellst.«
»Du glaubst also, ich stecke mit dem Kopf in den Wolken?«
»Ich glaube, dass du dir vorgenommen hast, zu einem Charakter aus einem Nora-Ephron-Film zu werden. Du weigerst dich, in der Realität anzukommen.«
»Die Realität wird vollkommen überbewertet«, sage ich trotzig.
Ich pfeffere das Kissen in eine Sofaecke und ziehe den Cardigan fester um meine Schultern. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich ihn auf links angezogen habe. Konzentriert zupfe ich an einem Faden, der sich aus der Naht gelöst hat.
»Du bist eine talentierte Autorin, aber du machst nichts daraus«, fügt er hinzu. Er klingt jetzt sanfter, beinahe taktvoll, was durchaus überraschend ist, wenn man bedenkt, dass ich ihn gerade dabei erwischt habe, wie er es mit einer anderen Frau in unserem Bett getrieben hat. »Du hast einen Abschluss in Drehbuchschreiben, einige deiner Hörfunkstücke wurden produziert, und dann hast du diese geniale Fortsetzung von Harry und Sally geschrieben und sie niemals beendet. Ich finde das frustrierend.«
»Ich weiß noch nicht, wie ich es enden lassen will«, murmle ich eingeschnappt und füge dann hinzu: »Ich wette, sie ist vollkommen in der Realität angekommen und bringt alles, was sie anfängt, auch zu einem erfolgreichen Ende.«
»Carmen ist das genaue Gegenteil von dir. Sie ist ehrgeizig, zielorientiert, und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie es auch durch.«
Carmen!
Ihr Name bohrt sich wie ein Messer in meine Eingeweide. »Klingt nach einer beeindruckenden Persönlichkeit«, erwidere ich trocken.
Er ignoriert meinen Kommentar.
Ungläubig schweige ich. Will macht nicht einmal den Versuch, mir die bittere Pille, die er mir da serviert, ein wenig zu versüßen.
Als die Türklingel die unangenehme Stille durchbricht, springe ich auf und laufe zur Gegensprechanlage, die in der Küche an der Wand hängt.
»Hallo?«
Ein undefinierbares Gemurmel ertönt aus dem knisternden Lautsprecher.
»Falsche Wohnung«, knurre ich aggressiver als notwendig. »Erdgeschoss.« Dann knalle ich den Hörer der Gegensprechanlage zurück in die Aufhängung und warte auf das Klingeln im Erdgeschoss.
Ein schwaches Summen ertönt, und ich höre eines der osteuropäischen Mädchen zur Haustür stöckeln, um den nächsten Kunden für eine Stunde Rubbeln, Blasen, Auspeitschen, oder was auch immer er sonst gebucht hat, hereinzulassen.
»Wir müssen unbedingt mit denen reden. Das ist das dritte Mal diese Woche«, sage ich und starre wütend aus dem Fenster.
Ich hasse die Tatsache, dass Tag und Nacht bei uns geklingelt wird, nur weil irgendwelche besoffenen Typen auf der Suche nach billigem Sex sind.
Als ich einen Blick über die Schulter werfe, sehe ich Will vage nicken. Und auf einmal wird mir klar, dass er gehen wird. Ich werde mich allein mit Mrs. Tang, unserer dämonischen Vermieterin, herumschlagen müssen, der das Haus gehört.
Ich richte den Blick wieder auf die Straße und betrachte konzentriert das Herbstlaub, das sich zu matschigen braunen Haufen im Rinnstein zusammengeklumpt hat und die Gullys verstopft. In Nora Ephrons Welt wären die Blätter leuchtend gelb und rot und würden von einer leichten Brise in die Luft gewirbelt. Und das alles im Licht eines perfekten sonnigen Herbsttags.
»Liebst du sie?«, frage ich. Ein klassischer Ephron-Satz. Sofort bereue ich, die Frage gestellt zu haben. Ich will die Antwort gar nicht hören.
Bevor ich sie zurückziehen kann, antwortet er. »Ja.«
Ich setze mich wieder, starre auf meine Zehen. Wackle ein wenig mit ihnen. Der blassrosa Nagellack beginnt abzublättern.
»Liebst du mich nicht mehr?«
Ich sehe auf und blicke in seine stechend blauen Augen. Eine Farbe, die so intensiv ist, dass ich jedes Mal aufs Neue von ihr fasziniert bin.
»Vielleicht. Ich weiß es nicht«, sagt er und hält inne. »Aber die Leidenschaft ist weg, und ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es sie jemals gab. Mit Carmen dagegen …«
»Erspar mir die Details.«
»Sorry.«
Eine Weile sagt keiner von uns ein Wort.
»Wann ist dir das alles klar geworden?«, frage ich nach ein paar Minuten so leise, dass er mich wahrscheinlich kaum verstehen kann.
»Vermutlich im Laufe der vergangenen Jahre.«
Ich denke einen Moment über seine Worte nach. Kann das wahr sein? Ist es möglich, jahrelang mit jemandem zusammenzuleben, ohne dass man merkt, dass für den anderen etwas nicht stimmt? All die gemeinsamen Lagerfeuer zu Guy Fawkes am 5. November, bei denen wir uns riesige Mengen Zuckerwatte geteilt haben. Weihnachtsfeiertage, die wir miteinander am Telefon hingen. Die langen Spaziergänge am Neujahrstag, bei denen wir über die Monate gesprochen haben, die vor uns lagen. Minutiös geplante Sommerurlaube und spontane lange Wochenenden, Geburtstagsessen in der Wohnung, bei denen unsere Freunde aus dem Küchenfenster hingen, um etwas von dem anrüchigen Treiben im Erdgeschoss mitzubekommen. Wir sind wie die Truppe aus Friends, die den »Ugly Naked Guy« beobachtet, nur besser. Und Will und ich sind wie Ross und Rachel, aber eben auch besser, weil wir nie getrennt waren. Wir sind das Paar für die Ewigkeit. Jeder aus unserem Bekanntenkreis, unsere Familien gehen fest davon aus, dass wir heiraten und Kinder bekommen. Niemand würde jemals denken, dass wir Schluss machen. Niemand würde jemals denken, dass Will Carmen vögelt.
»Mum wird am Boden zerstört sein«, sage ich. »Seit wir zusammengezogen sind, geht sie fest davon aus, dass wir bald heiraten und Kinder bekommen.«
»Du weißt, was ich von der Ehe halte.« Ich brauche keine weitere Erklärung, die habe ich bereits tausendmal von ihm gehört. Aber er gibt sie mir trotzdem. »Die Ehe zerstört jede funktionierende Beziehung.«
»Jemand anderen zu vögeln tut das allerdings auch.«
Wir sitzen uns schweigend gegenüber, während ich darüber nachdenke, was ich noch sagen könnte, und Will vermutlich überlegt, was er besser nicht sagen sollte.
Ich will gerade zu etwas in der Art ansetzen wie »Verpiss dich aus meinem Leben, du Oberarschloch!«, vielleicht nur ein wenig nuancierter, als Will mir den Todesstoß verpasst.
»Es würde mich wirklich freuen, wenn wir Freunde bleiben könnten, Nina.«
2
»Freunde? Ich glaub es nicht«, platzt Astrid am nächsten Tag in der Buchhandlung empört heraus, nachdem ich ihr den vergangenen Abend in allen Farben des Regenbogens geschildert habe.
»Ich weiß, ich glaube es ja genauso wenig«, sage ich und beobachte, wie sie die Bücher im Schaufenster zu einem Scheiterhaufen für ihre Herbstgartenauslage aufschichtet.
»Was hast du ihm geantwortet?«
»Dass er ein Oberarschloch ist und sich aus meinem Leben verpissen soll.« Etwas Nuancierteres war mir in dem Moment dann doch nicht mehr eingefallen.
»Jeder hat euch für das Pärchen gehalten, dem das ewige Happy End beschieden ist. Erst Freunde, dann Liebende. Genau wie Harry und Sally. Es hätte alles so perfekt sein können.«
»Will glaubt nicht an Happy Ends.«
»Hat er das gesagt?«
»Hm. Und dass die Leidenschaft weg ist.«
»Das ist so ein ätzend typischer Männersatz. Hat er etwa noch nie was davon gehört, dass die Leidenschaft vom Anfang niemals für immer anhält? Kapiert er nicht, dass aus einer ernsthaften Bindung an eine Person etwas viel Besseres und Stärkeres entstehen kann?«
»Offenbar nicht. Er hat außerdem gesagt, dass ich noch nicht ›in der Realität angekommen‹ sei und dass ich nie etwas zu Ende brächte. Im Grunde hat er mich zur Traumtänzerin degradiert. Aber das bin ich doch nicht, oder?«
»Natürlich nicht«, versichert mir Astrid. »Du bist eine Optimistin.«
»Wie Sally?«
»Ganz genau. Wie Sally.«
Astrid verteilt Herbstlaub um die Bücherstapel und bittet mich anschließend rauszugehen, um die Deko vom Bürgersteig aus zu beurteilen.
Ich stehe vor der schäbigen Fassade und deute auf die Bücher, die sie meiner Meinung nach noch ein wenig zurechtrücken sollte. Während sie die Stapel hin und her schiebt, blicke ich zu dem schmutzigen Schild mit der Aufschrift LOVEBOOKS hinauf, das vom Ruß der vorbeifahrenden Busse auf der Brixton Road beinahe komplett schwarz verfärbt ist. Wie von selbst kommt mir der Gedanke, wie viel netter der Laden mit einem frischen Anstrich, einer gestreiften Markise über dem Eingang und einer Bank mit einem Topf frischer Blumen davor wirken würde. Im Moment ist die Buchhandlung nicht mehr als ein weiterer schmutziger kleiner Laden, eingequetscht zwischen einem Pfandleihhaus und einem Ein-Pfund-Shop. Die meisten Passanten eilen auf dem Weg zur U-Bahn achtlos daran vorbei, ohne Astrids wunderschönen Schaufensterdekorationen auch nur die geringste Beachtung zu schenken.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass ich nicht mitbekommen haben soll, wie wir uns voneinander entfernt haben«, sage ich, als ich zurück in den Laden komme. Die Eingangstür quietscht. »Vielleicht hat er recht. Vielleicht bin ich wirklich einfach nur eine von diesen nervtötend heiteren Menschen wie Sally, die von Harry gefragt wurde: Oder gehörst du zu den immer Fröhlichen, die Herzchen auf die Is pinseln?«
Astrid lacht und wirft eine Handvoll Herbstlaub in die Luft. »Und was soll daran bitte so falsch sein? Es ist ja nicht so, als wärst du weniger wert, weil du ein fröhlicher Mensch bist.«
»Du hast recht«, sage ich bestimmt. »Und außerdem bringe ich durchaus Dinge zu Ende.«
Ich halte inne und denke einen Moment nach. Mir fällt allerdings nicht wirklich ein Beispiel für meine großspurige Behauptung ein, außer dem gigantischen Brownie und dem zuckersüßen Chai Latte aus dem winzigen Café unter der S-Bahn-Brücke, die ich mir zum Frühstück geleistet habe.
»Und ob du das tust«, bestätigt Astrid. »Zum Beispiel diese unglaubliche Höhle im Garten deiner Eltern. Und das im strömenden Regen. Wir anderen waren längst ins Haus geflüchtet, um Kekse in heiße Schokolade zu tunken.«
»Da waren wir acht.«
»Ich weiß, aber du warst auch die Einzige, die im Haushaltsunterricht eine Pavlova in Form eines Schwans fertiggestellt hat. Dafür hast du sogar den Schulpreis bekommen.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Teenager-Pavlova-Backkünste ebenso wenig zählen wie die Höhle«, sage ich und reiche ihr den Korb mit Äpfeln aus ihrem Garten, den sie auf einem Stapel Kochbücher platziert.
»Du hast deinen Uniabschluss gemacht – im Gegensatz zu vielen anderen Studenten übrigens – und diese Hörfunkstücke produziert, und …« Sie bricht mitten im Satz ab. Vermutlich wird ihr in diesem Moment selbst klar, dass auch diese Taten schon eine ganze Weile zurückliegen. Während sie einen kleinen wackligen Tisch im Schaufenster positioniert, denkt sie angestrengt über aktuellere Beispiele nach. »Du stellst andauernd irgendwelche Sachen hier im Laden fertig … zum Beispiel arrangierst du immer die Lesezeichen neu, wenn ich mal wieder aufgegeben habe. Ohne deine Hilfe wäre ich verloren.«
Wir wissen beide nur zu gut, dass weder mein Teilzeitjob in der Buchhandlung im Allgemeinen noch die Lesezeichen im Speziellen zählen, aber in diesem Moment bin ich bereit zu nehmen, was ich bekommen kann.
»Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass ich ohne Will besser dran bin«, sage ich, obwohl ich eigentlich nichts lieber will, als dass alles wieder so ist wie vorher und dass Carmen niemals existiert hat.
»Das hat Sally auch gesagt, als sie sich von Joe getrennt hat. Erinnerst du dich?«
»Stimmt. Aber Sally hat sich geweigert, der Realität ins Auge zu sehen«, sage ich mit einer Überzeugung in der Stimme, die impliziert, dass bei mir das genaue Gegenteil der Fall ist.
Solange man will, dass der andere zurückkommt und zugibt, einen Fehler gemacht zu haben, ist man allerdings nicht über ihn hinweg. Und ich möchte, dass Will zu mir kommt und mir sagt, dass er niemals sie, sondern immer nur mich geliebt hat, und dass sich das niemals ändern wird. Dabei weiß ich, dass es nicht passieren wird, und selbst wenn, dass wir niemals weitermachen könnten wie bisher. Da die Auswahl an Alternativen damit ziemlich übersichtlich ist, bleibt mir also wohl nicht viel anderes übrig, als über ihn hinweg zu sein.
»Es ist okay, wenn du dich gerade noch vollkommen fertigfühlst«, beruhigt mich Astrid, während sie ein Bouquet aus getrockneten Hortensien, orangefarben leuchtenden Physalis und Disteln neben ein Buch mit Blumendekorationen legt. »Der Typ mag ja ein kompletter Schwachkopf sein, aber er war auch lange Zeit ein Teil deines Lebens.«
»Ich kann meine Zeit trotzdem nicht damit vergeuden, einem Kerl hinterherzuheulen, der eine andere liebt«, sage ich und klinge dabei genau wie eine der tragischen Gestalten aus den Nachmittagstalkshows, die Astrid und ich als Teenager mit größter Leidenschaft verfolgt haben.
»Das ist die richtige Einstellung.«
Astrid klettert aus dem Schaufenster, um ebenfalls vom Bürgersteig aus einen Blick auf ihr Werk zu werfen.
Ich beobachte, wie sie kritisch den Kopf von einer Seite auf die andere legt und mit den indischen Armbändern an ihrem Handgelenk spielt, bevor sie sich durch die Haare fährt, um einen Knoten daraus zu lösen. Ohne etwas dagegen tun zu können, kommt mir der Gedanke, wie glücklich sie sich als Tochter eines Vaters aus dem Nahen Osten und einer skandinavischen Mutter schätzen kann. Eine Mischung, die ihr lange dunkle Haare, helle Augen, beneidenswert hohe Wangenknochen, einen schwanengleichen Hals und endlos lange Beine beschert hat.
Als Teenager hat Astrid ein wenig gewirkt wie das menschliche Äquivalent einer neugeborenen Giraffe. Ihre Oberschenkel waren so spindeldürr und ihre Gliedmaßen so lang, dass ich oft Angst hatte, sie könnte vornüberfallen, vor allem in ihrer Zehn-Zentimeter-Absatz-Phase. Die Jungs haben sie Sophie genannt in Anlehnung an die französische Spielzeuggiraffe, und mich Dumbo dank meiner Statur, die an die eines Babyelefanten erinnerte und die ich von meiner Mutter geerbt habe. Will hat mich damals mit dem Spitznamen aufgezogen, auch wenn er immer behauptete, ihn »liebevoll« zu meinen. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Astrid kommt zurück in den Laden und streift sich die Schuhe auf der Fußmatte ab, die so alt und hart ist, dass man Streichhölzer daran entzünden könnte. Dann zieht sie den Gürtel ihres Kaftans fester und steigt wieder ins Schaufenster, wo sie ein kleines Rotkehlchen zurechtrückt, das sie aus einer alten Socke und einer Gabel gezaubert hat.
»Fertig!« Sie klatscht zufrieden in die Hände, als wollte sie sich selbst zu ihrem gelungenen Werk gratulieren.
»Es sieht toll aus«, versichere ich ihr aufrichtig.
Astrid hat einen Sinn für Gestaltung und Design, der mir abgeht. Was sie auch anfasst, sieht hinterher einfach umwerfend aus. Meiner Meinung nach sollte sie für das Magazin Ideal Homes arbeiten.
»Weißt du, was du machen solltest?«, fragt sie und geht hinter den Kassentresen.
Das dunkle Holz ist das gleiche, aus dem die Regale gefertigt sind, die den E-förmigen Raum säumen. Die Ausstattung, die vor dreißig Jahren, als sie ausgewählt wurde, vielleicht als modern galt, ist heute leider nicht mal mehr als retro zu bezeichnen. Sie wirkt einfach nur erdrückend. Und die Kartons mit alten Unterlagen, verblichenen Postern und unverkaufter Ware, die sich auf den obersten Regalböden stapeln, tragen nicht gerade dazu bei, das Gefühl der Klaustrophobie, das einen ergreift, sobald man durch die Ladentür tritt, zu verjagen.
»Was?«
»Du solltest proaktiv sein, um nicht in Herzschmerz und Selbstmitleid zu versinken.«
»Und wie zum Beispiel?«, frage ich, während ich den Büchertisch mit den neuesten Romanen in der Mitte des Ladens ein wenig vorteilhafter arrangiere.
»Ich weiß auch nicht.« Astrid zieht nachdenklich die Nase kraus und geht zur Kaffeemaschine hinüber, um Milch aufzuwärmen. »Irgendetwas, das beweist, dass du in der Lage bist, ein Projekt zu Ende zu bringen. Dass du erfolgreich sein kannst. Dass du besser bist als Carmen – und zwar jeden einzelnen Tag der Woche.«
Ich lasse mich auf einen der Hocker vor dem Tresen sinken, um einen Keks in den Kaffee Latte zu tauchen, den Astrid vor mich gestellt hat. »Du meinst so was, wie endlich das Ende meines Skripts fertigzuschreiben?«
»Genau!«, ruft sie begeistert aus. »Du solltest dein Drehbuch verkaufen. Das würde Will zeigen, was er verloren hat.«
»Das Drehbuch? Das ohne Ende?« Ich werfe ihr einen zweifelnden Blick zu. Astrid weiß, dass ich das Autorenäquivalent zu einer Sackgasse bin. Und das bereits seit Jahren. Sie nickt ernst, und ich denke für einen Moment keksessend über ihre Idee nach. »Du erinnerst dich aber schon noch daran, dass die Idee zu meiner Fortsetzung in dieser Art endlose Male von Hollywood abgewiesen worden ist?«, bemerke ich schließlich skeptisch. »Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Drehbuch kauft, ist ungefähr genauso hoch wie die, dass du vom Blitz getroffen wirst, eine Million gewinnst und mit Johnny Depp rumknutschst – und das alles zur selben Zeit.«
»Ich weiß, dass das Risiko groß ist«, sagt Astrid lachend und nippt an ihrem Café Mocha, bevor sie zu der flackernden Leuchtstoffröhre über unseren Köpfen hinaufblickt. »Aber du musst es wenigstens versuchen. Und wenn auch nur aus dem einen Grund, Will damit den Stinkefinger zu zeigen.«
3
Noch bevor ich die Wohnung betrete, weiß ich, dass Will ausgezogen ist. Das Geräusch des Schlüssels im Schloss klingt hohl. Wahrscheinlich hat ihm sein Kumpel Ed – der nervige Ed aus Uni-Zeiten – mit seinem Range Rover beim Umzug geholfen. Will hat nie Autofahren gelernt. Eine Tatsache, die ich bereits seltsam unattraktiv fand, als ich in den ersten Monaten unserer Beziehung kaum die Hände von ihm lassen konnte.
Sein Schlüssel befindet sich nicht auf dem Brett im Flur, seine Schuhe liegen nicht irgendwo in einer Ecke, und seine matschverkrusteten Laufschuhe sind ebenfalls verschwunden. Selbst der Tennisschläger, den er schon vor Ewigkeiten wegwerfen sollte – zumindest hab ich ihn darum gebeten –, ist nicht mehr da.
Ich stelle meine Büchertasche auf dieselbe abgewetzte Stelle Teppichboden wie jeden Tag und werfe meine Jacke über den Haken an der Wand, den ich immer benutze. Mir gefällt, wie ordentlich sie da hängt.
Der Platz auf dem Kamin ist leer. Nur noch ein einzelnes hässliches Kabel windet sich aus der kahlen Wand. Ein rechteckiges Feld aus nicht verblasster dunkelgrüner Wandfarbe deutet an, wo Wills riesiger Fernseher stand. Die tiefen Ikea-Regale, die die hintere Wand des Wohnbereichs säumen, sind zur Hälfte leer geräumt. Bücher und DVDs, die vorher von Wills Sammlung satirischer Cartoons gestützt wurden, sind zur Seite gekippt. Nach dem schrecklichen Wochenende, das wir mit dem Aufbau der Regale verbracht haben, hätte ich wissen müssen, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat – ich lese Gebrauchsanweisungen, Will nicht. Ein paarmal stand ich kurz davor, ihm einen riesigen Inbusschlüssel in den Nacken zu rammen.
Gedankenverloren rücke ich das Hochzeitsfoto meiner Schwester zurecht, die ersten Bilder von meiner Nichte und meinem Neffen und das Foto von Astrid und mir, als wir uns als Fünfjährige als Braut und Bräutigam verkleidet haben. Mein Blick fällt auf den Rahmen, in dem ein Porträt von mir und Will auf Astrids und Aidans Hochzeit steckt. Ich habe es Will vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt. Die Tatsache, dass er es nicht mitgenommen hat, erscheint mir in diesem Moment beinahe noch schmerzhafter als sein Auszug.
Die Anrichte ist so gut wie geräumt. Kaffeemaschine, Entsafter, Küchenmaschine und Toaster sind verschwunden – Gegenstände, die Will bezahlt hat, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Er hat alles mitgenommen bis auf den Wasserkocher und den Kürbis, den ich für Halloween geschnitzt habe. Er hat schon zu faulen begonnen.
»Bastard«, zische ich, als ich feststelle, dass er sogar das Waffeleisen eingepackt hat – mein Geburtstagsgeschenk an ihn aus dem letzten Jahr, das nur ich benutzt habe. Dort, wo es vorher stand, klebt ein grünes Post-it: Bin zu Dad gezogen. Rufe bald an. W., steht darauf.
Ich starre auf die kurze Notiz und versuche die Tatsache zu verkraften, dass er keinen Kuss hinter sein Initial gesetzt hat. Fünf gemeinsame Jahre und nicht mal ein gottverdammtes X bin ich ihm mehr wert. Ein wenig tröstet mich die Schadenfreude darüber hinweg, dass er offenbar gezwungen ist, ins beschissene, superspießige Reihenhaus seines Dads in Luton zurückzuziehen. Ich hoffe sehr, dass die beiden sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben.
Ich koche mir einen Tee und setze mich mit der Tasse im Schneidersitz aufs Sofa, um mir einen Moment Zeit zu geben, mich an den Raum ohne Wills Sachen darin zu gewöhnen. Einige Minuten höre ich dem lauten Ticken der Wanduhr zu, bevor ich beschließe, in die Wanne zu steigen. Wenn alles den Bach runtergeht, hat ein Schaumbad noch nie geschadet.
Das Badezimmer gefällt mir ohne Wills Kram viel besser. Keine dunklen Handtücher, die über dem winzigen Heizkörper hängen, keine schwarze Shampooflasche auf dem Wannenrand und keine Satiremagazine neben dem Klo.
Ich drehe den Kalt- und Warmwasserhahn auf und öffne das Fenster.
»Was hat er noch mal gesagt, wie lange er schon mit ihr schläft?«, frage ich mich laut, während ich den beschlagenen Spiegel mit dem Ärmel abwische und mir selbst in die Augen sehe. Paul Simons Fifty Ways to Leave Your Lover dringt leise durch die einen Spaltbreit geöffnete Badezimmertür herein. »Sechs Monate?«
Ich denke einen Augenblick darüber nach. Vergangenen April hat Will mir erzählt, dass man ihm im Job »mehr Verantwortung übertragen« habe, was bedeutete, dass sich seine Arbeitszeiten verlängerten. Irgendwann im Juni hat ihn dann angeblich ein Kollege, der »in der richtigen Position ist«, ihm eine »Beförderung zu verschaffen«, gefragt, ob er mit ihm Tennis spielen wolle. Als ich ihn irgendwann später einmal darauf ansprach, warum er nie seinen Schläger mitnähme, behauptete er, das Equipment zu benutzen, das der Klub zur Verfügung stellt. Der Will, den ich bis dahin gekannt hatte, hätte sich über Tennisklubs lustig gemacht, anstatt selbst hinzugehen.
Als ich mich ausziehe, stelle ich fest, dass ich meinen Rollkragenpullover den ganzen Tag lang falsch herum getragen habe. Sorgfältig hänge ich die Sachen an den Haken an der Tür, mit dem sicheren Wissen, dass so bald niemand mehr ein tropfnasses Handtuch darüberwerfen wird. Anschließend lasse ich mich mit einem Seufzen in das heiße Wasser sinken, um mir zu erlauben, mich wenigstens für eine halbe Stunde meinem Selbstmitleid hinzugeben.
»Was ist überhaupt so viel besser an ihr?«, frage ich die gelbe Gummiente auf dem Badewannenrand.
Die Ente starrt mich verständnislos an.
»Vielleicht ihre Familie«, mutmaße ich nach einem Moment des Zögerns. »Meine Mutter allein reicht aus, um selbst den glühendsten Verehrer in die Flucht zu schlagen. Aber ich bin nett.«
Die Ente scheint ihren Kopf ein wenig schräg zu legen, als wollte sie diese Tatsache infrage stellen.
»Okay, meinetwegen, ich habe meine Momente, in denen ich etwas kontrollsüchtig, gereizt und empfindlich bin, und ich habe die schlechte Eigenschaft, Leute nach ihrem Äußeren zu beurteilen, alles in allem bin ich trotzdem ganz okay. Ich versuche, auch an andere zu denken, entscheide im Zweifelsfall zugunsten anderer, und meistens bin ich fair. Glaube ich zumindest.«
Ich beobachte den Berg aus Schaum, der Seifenblase für Seifenblase langsam in sich zusammensinkt, und frage mich, was genau schiefgelaufen ist und wann. Will hat gesagt, dass die Leidenschaft zwischen uns verschwunden ist. Als ich versuche, mich zu erinnern, wann wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben, kann ich mich nicht erinnern.
»Vielleicht hat es gar nichts mit meinem Charakter zu tun, sondern mit etwas viel Schlimmerem …« Ich halte der Ente die Ohren zu und flüstere: »Vielleicht ging es um Sex.«
Ich denke einen Augenblick darüber nach. In den ersten beiden Jahren unserer Beziehung drehte sich alles um Sex, im dritten Jahr wurde es schon weniger, aber ich nehme an, das lag daran, dass wir zusammengezogen sind. Im vierten Jahr war vor allem ich diejenige, die den Anfang gemacht hat, Will hatte immer irgendeine Ausrede, warum er gerade nicht in Stimmung war: Er hatte zu viel Pizza gegessen, ihm gefiel mein Parfüm nicht, er war müde von der Arbeit. Und im fünften Jahr – na ja, wie ich bereits sagte, ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch nur einmal miteinander geschlafen haben, nicht mal an Silvester.
»Das war’s also«, sage ich, dieses Mal wieder lauter, als ich realisiere, dass Will ganz offensichtlich schon seit zwei Jahren kein wirkliches Interesse mehr an mir hat und mindestens seit sechs Monaten mit einer anderen schläft. »Scheiß auf die beiden!« Ich nehme die Ente und schleudere sie mit solcher Wut in die Wanne, dass das Wasser aufspritzt und auf den Badezimmerboden tropft. »Die beiden verdienen sich, und ich verdiene etwas Besseres. Ich werde darüber hinwegkommen und mein Drehbuch zu Ende schreiben.«
Langsam lasse ich mich tiefer ins Wasser gleiten. Der Schaum kitzelt an meinem Kinn, von dem heißen Wasser fühle ich mich leicht benebelt.
»Aaaaber«, murmle ich leise. »Wo soll ich nur das verdammte Ende hernehmen?«
Will hat recht – zumindest zum Teil. In gewisser Hinsicht versuche ich tatsächlich, zu einem Charakter aus einem Nora-Ephron-Film zu werden. Idealerweise zu einem aufgeschlossenen Anfang-dreißigjährigen-Mega-Ryan-Lookalike, der in einem New Yorker Sandsteinhaus wohnt und erfolgreiche Autorin ist. Wenn ich diese Person wäre, würde ich in diesem Augenblick in einem Baumwollpyjama und mit perfekt zerzausten Haaren am Schreibtisch in meinem gemütlichen, feminin eingerichteten Apartment vor der Schreibmaschine sitzen. Ich würde an etwas Gewitztem, Cleverem und ausgesprochen Veröffentlichungswürdigem schreiben und mit mir und meinem Leben – das selbstverständlich weder irgendwelche beschissenen Beziehungsenden noch aussichtslose Jobs, eine nervige Familie oder Schreibblockaden beinhalten würde – unglaublich zufrieden sein.
Stopp! Hör auf zu träumen!
Die Realität sieht nämlich so aus, dass ich in ein nasses Handtuch gewickelt, das kaum groß genug ist, um meinen Hintern zu bedecken, und mit tropfenden Haaren auf meinem Bett sitze. Auf meinem Schreibtisch befindet sich nichts weiter als ein uralter Stapel Post-its, an dem Flusen und ein wenig Glitzer von irgendeiner Bastelaktion kleben. Die Kleiderstange ist halb leer, die Zimmerpflanzen sind verschwunden, und obwohl ich das Bettlaken in der Kochwäsche hatte, scheint noch immer ein schwacher Duft von Carmens Parfüm durch den Raum zu wabern. Ich schreibe weder an etwas besonders Gewitztem noch Cleverem und kann mich schon glücklich schätzen, wenn ich noch halbwegs die Story des Drehbuchs zusammengekratzt bekomme, das ich vor so vielen Jahren angefangen habe zu schreiben, dass ich mich kaum noch daran erinnere.
»Okay, mal sehen … So viel weiß ich«, sage ich zu mir selbst und öffne die Datei auf meinem Laptop, während ich eine Handvoll Schokonüsse verschlinge.
HARRY UND SALLY
FORTSETZUNG DER GESCHICHTE
Nina Gillespie
Harry und Sally – fünfundzwanzig Jahre und eine verbitterte Scheidung später – besuchen die Hochzeit ihres einzigen Sohnes, Truman, die in New York stattfindet. Als Truman in der Nacht vor der Trauung verschwindet, wollen Harry und Sally ihn wiederfinden, bevor seine zukünftige Braut bemerkt, dass er verschwunden ist.
»Das ist gut«, murmle ich vor mich hin und öffne die Datei mit den Kurzbeschreibungen der Protagonisten. »Und meine Figuren sind auch nicht schlecht.«
PROTAGONISTEN
Harry – deprimiert, witzig, fürsorglichSally – fröhlich, optimistisch, kontrollsüchtigMarie, Sallys beste Freundin – verwitwet, Ende fünfzig, neurotisch, nettTruman, Harrys und Sallys Sohn – wie sein Vater: pessimistisch, direkt, trockener HumorAnna, Trumans Verlobte – sehr hübsche, kultivierte, gebildete Amerikanerin; für sie gibt es nichts Schöneres als den Gedanken, ihre Anwaltskarriere zugunsten eines großen Hauses und der Versorgung ihrer zukünftigen Familie aufzugebenGeorge, Trumans Trauzeuge – netter Typ, ein wenig naivJules, Annas Brautjungfer – weniger kultiviert als Anna; ehrgeizig, karriereorientiert, sexsüchtig»Und ich weiß, dass die erste Szene funktioniert«, sage ich, stehe auf und stelle den Laptop auf den Schreibtisch, um mir die Haare mit dem Handtuch trocken zu rubbeln, während ich das Treatment, die Zusammenfassung der Handlung und Hintergründe meines Drehbuchs, zu lesen beginne.
1. Akt – TAGSÜBER
Die Figuren legen letzte Hand an ihre Hochzeitsoutfits und verlassen ihre Wohnungen/Häuser.
Harry und Sally kommen getrennt in das Hotel, in dem Trumans Hochzeit stattfinden soll. Die Begrüßung zwischen den beiden fällt unbeholfen aus. Sally holt sich verlegen von Marie Unterstützung. Truman und Anna stellen Harry und Sally dem Pfarrer vor.
Während des Gesprächs mit dem Pfarrer verkündet Harry, dass er sich ein drittes Mal scheiden lassen wird. Sally ist nicht überrascht; Truman dagegen ist am Boden zerstört und geht.
Bevor er das Hotel verlässt, bittet Truman seinen Trauzeugen George, der gerade Jules tröstet, deren Beziehung am Abend zuvor zerbrochen ist, dafür zu sorgen, den Überblick über die Vorbereitungen für die Hochzeit zu behalten. George versichert ihm, sich sofort um alles zu kümmern. Er ist froh, einen Grund zu haben, von Jules wegzukommen.
Anna, die nicht ahnt, dass Truman die Flucht ergreift, nimmt Jules zur finalen Anprobe des Hochzeitskleids mit.
Sally sitzt in der Hotelbar und unterhält sich mit Marie über Harrys Scheidung. Marie schlägt Sally vor, es noch einmal mit Harry zu probieren. Sally winkt ab.
Harry überredet George, einen Drink mit ihm zu nehmen. Gemeinsam gehen sie in eine Kneipe in der Nähe des Hotels.
»Nicht schlecht«, sage ich, überrascht, wie gut es bisher läuft. »Was kam als Nächstes?«
2. Akt – ABENDS
Am Abend, kurz vor dem Probeessen, ist Truman noch immer nicht zurück. Nach einigen Telefonaten und einer Suche im Hotel ist klar, dass er verschwunden ist. Sally beschließt, dass sie und Harry nach ihm suchen müssen, bevor Anna herausfindet, was passiert ist. Zeitgleich versucht Marie, Jules zu trösten, die ihren Schmerz an der Hotelbar ertränkt.
Harry und Sally durchkämmen die Stadt nach Truman, bis sie schließlich unter dem Washington Square Arch in der Nähe von Katz’s Deli aneinandergeraten. Gleichzeitig ist ihnen nur allzu bewusst, an welchem Ort sie sich befinden (Rückblende), und welche Bedeutung er für sie hat. Sie beschließen, Truman zuliebe ihren Streit beizulegen. In dem Café, in dem Sally Harry offenbart hat, dass sie schwanger ist, trinken sie später am Abend einen Kaffee. Aus Angst, dass Truman sich etwas angetan haben könnte, fahren sie ins Krankenhaus, wo sie in Erinnerungen an seine Geburt schwelgen, bevor sie in dem italienischen Restaurant landen, in dem sie als Familie jeden Sonntag brunchen waren. Das Schwelgen in alten Erinnerungen lässt beide nachgiebiger werden, und als sie ihr Abendessen beendet haben, scheinen sie wieder gute Freunde zu sein.
Während sie die Rechnung begleichen, kommen sie darauf, dass der wahrscheinlichste Ort, an dem sich Truman aufhält, das Metropolitan Museum of Art ist, in das er sich schon als Kind oft geflüchtet hat – egal, ob gerade etwas Gutes oder Schlimmes geschehen war. Auf dem Weg zum Museum kommen die beiden an der Bar vorbei, in der Sally Harry das erste Mal zusammen mit Isabelle, der Frau, mit der er sie betrogen hat, gesehen hat, an dem Haus, in dem sie als Familie gewohnt haben, und an dem Gerichtsgebäude, in dem ihre Scheidung rechtskräftig geworden war. Sally geht sofort wieder in die Defensive.
Im Museum finden Harry und Sally Truman im Tempel von Dendur. Harry versucht, Truman dazu zu überreden, mit ihnen zu kommen, da fällt Sally ein, dass dies der Ort ist, an dem Harry ihr das erste Mal gesagt hat, dass er sie attraktiv findet und mit ihr ausgehen möchte. Gerührt über die Erinnerung, erlaubt Sally sich, ihre Gefühle für Harry vor sich selbst zuzugeben.
Mit dem Laptop in der Hand lasse ich mich wieder aufs Bett fallen und überfliege das Treatment, um zu überlegen, ob der zweite Akt so enden soll, wie ich es angedacht habe, und was genau im dritten passieren könnte.
»Gelingt es Harry, Truman zu überreden, mit zurück ins Hotel zu kommen?«, frage ich mich und ziehe unzufrieden die Nase kraus.
Dass Truman sich so schnell von Harry überzeugen lässt, nachdem er gerade erst von dessen dritter Scheidung erfahren hat, passt nicht wirklich zu seinem Charakter.
»Oder stellen Harry und Sally im Laufe des Films fest, dass sie einen Fehler gemacht haben, und heiraten zu guter Letzt wieder?«
Ich schüttle den Kopf, angewidert, den Gedanken überhaupt gedacht, geschweige denn ihn laut ausgesprochen zu haben.
»Das wird niemals passieren«, sage ich, zutiefst entschlossen, Ephrons Vision treu zu bleiben.
Ephron hatte niemals gewollt, dass Harry und Sally heiraten, aber das Ende des Drehbuchs wurde umgeschrieben, als sich Rob Reiner, der Regisseur, während der Dreharbeiten verliebte. Er heiratete die Frau später, zumindest steht es so in dem Wikipedia-Artikel, den ich gelesen habe, und es entstand einer der großartigsten Filme aller Zeiten.
»Aber wenn sie geschieden bleiben, könnte das ziemlich polarisierend wirken …«, murmle ich vor mich hin und blättere mit dem Daumen durch den Post-it-Stapel. »Und ich kann auf keinen Fall keines der beiden Paare heiraten lassen. Dann hätte der Film kein Happy End, und ohne Happy End würde er sich niemals verkaufen. Und wenn er sich nicht verkauft«, sage ich und spüre, wie ich mich von meinen eigenen Worten in einen Strudel aus Panik hineinziehen lasse, »kann ich Will nicht beweisen, dass er unrecht hat.« Ich hole tief Luft, um mich zu beruhigen. »Ich werde es ihm jedoch beweisen«, füge ich mit grimmiger Entschlossenheit hinzu, »und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich werde dafür sorgen, dass Will Masterson im Unrecht ist!«
4
»Was für ein Mistkerl!«, ruft meine Mutter zum gefühlt hundertsten Mal an diesem Tag, nachdem ich ihr und meinem Vater von Wills Auszug erzählt habe.
»Ich weiß«, sage ich und werfe noch ein Holzscheit in das Feuer, das im späten Nachmittagslicht auflodert.
»Wenn ich ihn in der Stadt sehe, schneide ich ihm sein Ding ab!«
»Mum!«
»Er hat dich für dumm verkauft.«
Erbost wedelt sie mit der Hand, um die aufstiebenden Funken von ihrem dicken dunklen Haar fernzuhalten, das sie fast jeden Morgen eine halbe Stunde lang versucht zu glätten. Die Funken werden vom Wind in Richtung der Terrassentüren der Doppelhaushälfte aus den Siebzigern getragen, in der ich mit meiner Schwester Narissa aufgewachsen bin.
Ich nicke, um ihr zu signalisieren, ja, er hat mich tatsächlich für dumm verkauft.
»Du weißt, dass ich ihn mochte, Nina. Er ist ein charmanter Junge, aber die Tatsache, dass seine Eltern geschieden sind, musste ja irgendwann Konsequenzen haben. Bei Nachkommen aus einer Familie mit geschiedenen Eltern ist die Gefahr, selbst geschieden zu werden, hundertzweiundsiebzig Prozent höher als bei solchen aus Nichtscheidungsfamilien.«
»Du warst diejenige, die mich unbedingt mit ihm verheiraten wollte«, sage ich, während ich mich frage, wo in aller Welt sie diese bescheuerten Fakten herhat.
»Nicht unbedingt.«
Offenbar leidet sie an einem akuten Anfall von Gedächtnisverlust. Als ob sie die vergangenen fünf Jahre nicht beinahe ausschließlich damit zugebracht hätte, mich bei jeder Gelegenheit zu fragen, wann sie endlich anfangen könne, sich nach dem passenden Hut für unsere Hochzeitsfeier umzusehen.
»Ist ja jetzt auch egal«, murmle ich. Obwohl ich sie am liebsten darauf festnageln würde. Aber ich weiß, dass es die Mühe nicht wert wäre, sie würde mich nur als defensiv und verletzt darstellen. »Er datet eine andere.«
»Wer?«, fragt Narissa, die in diesem Augenblick mit ihren Kindern Tilly und Henry aus der Terrassentür tritt.
»Tante Tütata, Tante Tütata«, schreien die beiden.
Ich zucke zusammen. Tütata ist der Name, den mir Narissa im zarten Alter von null Jahren verpasst hat, als sie sich für besonders witzig hielt. Ich habe den Spitznamen schon als Kleinkind gehasst und verabscheue ihn immer noch. Jetzt hat ihn auch noch ihre verdammte Brut von ihr übernommen.
Ich hebe den dreijährigen Henry hoch, der sich in meine Arme geworfen hat und ein rotes Spielzeugauto, den Lightning McQueen aus dem Film Cars, über meine Schultern, den Hals und schließlich über meine Wange und Nase fahren lässt.
»Will«, antworte ich Narissa, während das Auto auf meiner Stirn parkt.
»Ihr habt Schluss gemacht?«, fragt Narissa überrascht. »Warum?«
»Er datet eine andere«, antwortet meine Mutter an meiner Stelle und versucht, die fünfjährige Tilly davon abzuhalten, sich mit dem Schürhaken in die Flammen zu stürzen.
Narissa umarmt mich. Etwas, das sie nur äußerst selten tut.
»Ist schon okay«, wehre ich ab und schiele zu Mum, deren Gesichtsausdruck immer besorgter wird. »Ich konzentriere mich jetzt auf andere Dinge.«
»Auf was zum Beispiel?«, fragt Narissa und streicht sich eine Haarsträhne ihres perfekt frisierten glänzenden Bobs hinters Ohr. Sie scheint nicht zu bemerken, dass Tilly in den Taschen ihres leuchtend gelben Regenmantels nach Marshmallows fahndet.
»Zum Beispiel darauf, das Drehbuch zu Ende zu schreiben, an dem ich seit einiger Zeit arbeite«, sage ich und spieße für die Kinder zwei Marshmallows auf lange Stöcke.
Narissa nickt bedächtig und starrt mit ihren großen grünen Augen ins Feuer. Ich habe sie schon immer um ihre Augen beneidet. Sie hat sie von Daddy geerbt. Meine dagegen ähneln Mums. Sie sind klein und haben einen nicht näher definierbaren Braunton.
»Du solltest dir einen ordentlichen Job suchen«, sagt meine Mutter. Wie deine Schwester, forme ich die Worte stumm in Richtung Narissa, bevor Mum eine Chance hat, sie selbst auszusprechen. Wir lachen, als Mum mich bei meiner Grimasse erwischt. »Auch wenn es nur vorübergehend ist«, fügt sie an und droht mir im Spaß mit dem Schürhaken. »Und ein bisschen Farbe würde dir auch nicht schaden. Diese Gothic-Klamotten, die du zurzeit immer trägst, schmeicheln deinem Teint überhaupt nicht.«
»Das ist kein Goth, sondern schlicht, Mum. Nora Ephron hat nie was anderes getragen als Schwarz. Und wenn es für sie gut genug war, dann ist es das für mich auch.«
»Ich bin mir sicher, dass Nora Ephron einen Ehemann und Kinder hatte, bevor sie sich dem Schwarz verschrieben hat. Kein Mann will eine Schwarze Witwe.«
»Ich weiß, Mum.«
»Ich sage diese Dinge nur, weil ich mir Sorgen um dich mache.«
Sie wirft mir einen vielsagenden Blick zu, bevor sie zu dem Tisch auf der Terrasse hinübergeht, auf dem sich ein Berg gefrorener Lebensmittel stapelt, die sich schwerlich mit einem Lagerfeuer in Verbindung bringen lassen. Als wir jünger waren, nannten Narissa und ich unsere Mutter »die Auftaukönigin«, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Mum hat ihr Leben lang mehr Zeit bei Frisören und in Make-up-Shops verbracht als in Supermärkten.
»Und was auch immer das genau heißen soll – ich habe einen ordentlichen Job«, füge ich trotzig hinzu und beobachte Henry, der eine Schüssel mit Schokomuffins ansteuert.
Mum sieht mich fragend an, während sie systematisch Deckel und Alufolien von diversen Plastikbehältern entfernt.
»Die Buchhandlung«, hilft ihr Narissa auf die Sprünge.
»Ach, das.«
In Mums Augen ist ein Job in einem Buchladen etwas für Studenten und »Alternative«.
Ihre Kritik würde mir weit weniger ausmachen, wenn sie selbst eine Karriere vorzuweisen hätte. Aber das hat sie nicht. Bevor sie Dad kennenlernte, hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, jedoch nie in dem Beruf gearbeitet.
»Mit Will Schluss zu machen hat mir die nötige Motivation verschafft, endlich meine Träume weiterzuverfolgen«, sage ich.
Mum holt so erschrocken Luft, als hätte ich ihr gerade eröffnet, dass ich mich als Prostituierte in dem Bordell unter meiner Wohnung verdingen will.
»Vielleicht könnte dir eine von Narissas Freundinnen helfen, etwas Passendes zu finden. Nur für den Anfang, bis du mit dem Schreiben Geld verdienst.«
Bevor Narissa geheiratet und Kinder bekommen hat, hat sie als Pressereferentin in der Finanzbranche gearbeitet. Nichts von dem, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, kommt einem Job in dem Bereich auch nur im Entferntesten nahe. Ich betrachte meine große Schwester, die in ihren teuren Klamotten neben dem Feuer steht, während ihre Kinder um sie herumrennen, und frage mich, was so toll daran sein soll, jemanden mit Geld zu heiraten, um anschließend seine Karriere aufzugeben und sich um Haushalt und die ungezähmte Brut zu kümmern.
»Ich brauche keine Hilfe von Narissa oder ihren Freunden, vielen Dank. Ich will schreiben, nichts anderes«, sage ich fest entschlossen und reiche Narissa die beiden Stöcke mit den inzwischen verbrannten Marshmallows. »Und jetzt gehe ich rein und sehe mit Dad fern.«
»Hey, Schätzchen«, begrüßt mich mein Vater, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden.
Ich brumme und kuschle mich in den weichen pinkfarbenen Sessel neben seinem. Relikte einer der extravaganten Shopping-Trips meiner Mutter in den Achtzigern. Das Wohnzimmer würde ohne Weiteres in den Möbelkatalog eines spießigen Einrichtungshauses aus der Zeit passen – weiße Regalschränke mit Glasvitrinenelementen, genug Krimskrams und Plunder, um ein kleines Kaufhaus damit zu bestücken, und eine Sonnenuhr über dem mit Mosaiksteinchen verzierten Kamin.
»Was siehst du dir an?«
»Bomber im Zweiten Weltkrieg.«
»Nett«, sage ich und starre auf das riesige graue Ungetüm in der gegenüberliegenden Wohnzimmerecke.
»Geht’s dir gut?«, fragt er, die Augen noch immer auf die Mattscheibe gerichtet.
»Alles okay.«
»Braves Mädchen«, sagt er. Ich weiß, dass er sich trotz seiner Einsilbigkeit Gedanken darüber macht, dass Will mit seinem kleinen Mädchen Schluss gemacht hat. »Jetzt kommt eine der interessantesten Stellen.«
»Mhm«, murmle ich und tue ein paar Minuten so, als würde mich die Fernsehsendung genauso fesseln wie ihn, bevor ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe.
Auf dem Display leuchtet eine Nachricht von Will auf. Wg. der Miete: Ich bezahle noch zwei Monate weiter, damit du Zeit hast, jemand Neues zu finden. Hoffe, das ist okay. Will.
»Du spinnst doch!« Ich unterdrücke in letzter Sekunde einen Kraftausdruck.
Dad nippt an seinem Tee und sieht zu mir herüber.
Ich kann nicht anders, als mich an seiner Formulierung »jemand Neues« aufzuhängen. Was meint er damit? Einen neuen Freund? Einen neuen Mitbewohner? Einen Will-ähnlichen Ersatz, der auf seinem Platz auf dem Sofa hockt, auf seiner Seite des Bettes schläft, nie den Müll runterträgt und hartnäckige Bartstoppeln im Waschbecken hinterlässt? Ist er jetzt vollkommen durchgedreht? Hat er etwa vergessen, wie hoch die Miete ist und wie viel ich verdiene? Ist ihm plötzlich entfallen, dass er mindestens dreimal so viel verdient wie ich und dass er zurzeit auch noch umsonst bei seinem Vater wohnt?
Es handelt sich um eine Einzimmerwohnung mit einem Kleiderschrank als Schlafzimmer. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Deine Hälfte des Bettes bei eBay-Kleinanzeigen schalten?, schreibe ich, schicke die Nachricht ab und starre auf das Display meines Handys.
Das blinkende Auslassungszeichen signalisiert, dass Will zurückschreibt. Und da kommt die Nachricht auch schon. Du könntest das Wohnzimmer zu deinem Zimmer machen und das Schlafzimmer untervermieten.