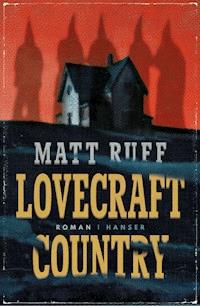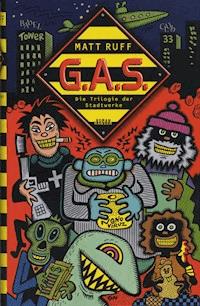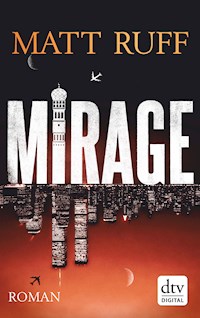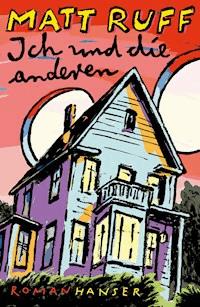
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mouse erwacht in Betten fremder Männer, ohne sich an den Weg dahin erinnern zu können. Andrew hingegen teilt seinen Körper mit einem sexbesessenen Teenager, einer tollen Tante, grummeligen Cousins und anderen Gestalten. Mit großem Einfühlungsvermögen und schrägem Humor erzählt Matt Ruff die Geschichte zweier junger Menschen mit multipler Persönlichkeitsstörung. Begleitet von jeder Menge "Personal" brechen die beiden zu einem wilden Road Trip in ihre verstörende Vergangenheit auf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 973
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Mouse – eigentlich Penny – leidet unter einer seltsamen Persönlichkeitsstörung. Wann immer eine ihrer verschiedenen »Seelen« die Herrschaft über Leib und Geist gewinnt, kommt es zu einem Blackout – nur weiß sie das nicht. Andrew Gage, der junge Kollege bei Reality Factory, einer Firma, die sich mit virtueller Realität beschäftigt, erkennt, was mit ihr los ist: Er hat die gleiche Krankheit, nur hält er die Vielzahl seiner »Seelen« – den sexbesessenen Teenager Adam, die freundliche Tante Sam, den gewalttätigen Gideon, den ängstlichen kleinen Jake und viele andere mehr – dadurch in Schach, dass er in seinem Kopf ein Haus für sie alle eingerichtet hat. Andy versucht, Penny zu helfen, die von zwei bösartigen Personen in ihrem Kopf konkret bedroht wird, doch dadurch wird eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die an Andys tiefstes Geheimnis rühren und die Stabilität seines Seelenlebens gefährden.
Hanser E-Book
Matt Ruff
Ich und die anderen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Giovanni und Ditte Bandini
Carl Hanser Verlag
Für Michael, Daniel, J. B., Scooter und überhaupt die ganze Bande
Ich bin, was es an Töchtern gibt in meines Vaters Haus; gleichfalls an Söhnen …
– William Shakespeare, Was ihr wollt
Inhalt
I Gleichgewicht
Erstes Buch: Andrew
Zweites Buch: Mouse
Drittes Buch: Andrew
Viertes Buch: Mouse
Fünftes Buch: Andrew
Sechstes Buch: Mouse
II Chaos
Siebtes Buch: In die Badlands
Achtes Buch: Lake View
Neuntes Buch: Heimkehr
Zehntes Buch: Chief Bradleys Tränen
III Ordnung
Letztes Buch: Epilog
Mein Vater rief mich heraus.
Ich war sechsundzwanzig, als ich aus dem See kam, was manche Leute wundert, die sich fragen, wie ich ein Alter haben konnte, ohne eine Vergangenheit zu haben. Aber auch ich wundere mich: Die meisten Leute, die ich kenne, können sich an ihre Geburt nicht erinnern, und – das ist das erstaunlichste – es stört sie gar nicht, daß sie sich nicht erinnern. Meine gute Freundin Julie Sivik erzählte mir einmal, ihre früheste Erinnerung sei eine »Momentaufnahme« von ihrem zweiten Geburtstag, wie sie auf einem Stuhl steht, um die Kerzen auf ihrer Torte auszupusten. Davor, sagte sie, ist nichts, aber das schien sie nicht weiter zu beunruhigen, als sei es die natürlichste Sache von der Welt, zwei Jahre seines Lebens verpaßt zu haben.
Ich erinnere mich an alles, vom ersten Augenblick an: an den Klang meines Namens in der Dunkelheit; den Schock des kalten Wassers; das Algengewirr auf dem Grund des Sees, in dem ich die Augen öffnete. Da unten ist das Wasser schwarz, aber an der Oberfläche, weit über mir, konnte ich Sonnenlicht sehen, und ich trieb darauf zu, von meines Vaters Stimme angezogen.
Mein Vater erwartete mich am Ufer des Sees, zusammen mit Adam und Jake und Tante Sam. Hinter ihnen stand das Haus, Seferis hoch oben auf der Kanzel, von wo aus er den Körper im Auge behielt; und ich spürte, daß mich die anderen – zu scheu, um sich zu zeigen – von den seezugewandten Fenstern und vom Waldrand aus beobachteten. Gideon muß auch zugeschaut haben, von der »Wüste« aus, aber damals wußte ich noch nichts von ihm.
Wahrscheinlich sollte ich das mit dem Haus erklären. Tante Sam sagt, ein guter Geschichtenerzähler verrät wichtige Informationen nur stückchenweise, nach und nach, damit seine Zuhörer das Interesse nicht verlieren, aber ich fürchte, wenn ich nicht schon jetzt alles erkläre, werden Sie nichts verstehen, und das ist noch schlimmer, als das Interesse zu verlieren. Sehen Sie es mir also nach, und ich verspreche, darauf zu achten, Sie später nicht zu langweilen.
Haus, See, Wald und »Wüste« befinden sich alle in Andy Gages Kopf, beziehungsweise in dem, was Andy Gages Kopf gewesen wäre, wenn er noch lebte. Andy Gage wurde 1965 geboren und nicht lange danach von seinem Stiefvater, einem sehr bösen Menschen namens Horace Rollins, ermordet. Es war kein normaler Mord: die Mißhandlungen und Schändungen, die ihn töteten, waren zwar real, sein Tod aber nicht. Tatsächlich starb nur seine Seele, und als sie starb, zersplitterte sie. Dann wurden die einzelnen Fragmente zu eigenständigen Seelen, den gemeinsamen Erben von Andys Leben.
Damals gab es noch kein Haus, lediglich einen dunklen Raum in Andy Gages Kopf, in dem alle Seelen gemeinsam hausten. In der Mitte des Raums ragte eine Säule aus gleißendem Licht auf, und jede Seele, die in das Licht trat oder hineingezogen wurde, fand sich draußen wieder, in Andy Gages Körper, ohne jede Erinnerung daran, wie sie dorthin geraten oder was seit ihrem letzten Ausstieg geschehen war. Wie Sie sich vorstellen können, war das ein beängstigendes, schreckliches Dasein, um so schrecklicher, als die Übergriffe des Stiefvaters keineswegs aufhörten. Von den sieben ursprünglichen Seelen, die von Andy Gage abstammten, wurden fünf später ebenfalls ermordet, und selbst die zwei überlebenden sahen sich gezwungen, sich aufzuspalten, um mit der Situation fertig zu werden. Als sie endlich von Horace Rollins freikamen, lebten in Andy Gages Kopf bereits über hundert Seelen.
Da erst begann der eigentliche Kampf. Im Laufe vieler Jahre gelang es den zwei überlebenden ursprünglichen Seelen – Aaron, meinem Vater, und Gideon, meines Vaters Bruder –, sich immerhin ein ausreichendes Gefühl von Kontinuität zusammenzustückeln, um zu begreifen, was mit ihnen geschehen war. Mit Hilfe einer guten Ärztin namens Danielle Grey arbeitete mein Vater daran, Ordnung zu schaffen. Anstelle des dunklen Zimmers konstruierte er in Andy Gages Kopf einen geographischen Raum, eine sonnige Landschaft, in der die Seelen sich sehen und miteinander sprechen konnten. Er erschuf das Haus, so daß sie eine Wohnung hatten; den Wald, damit sie einen Ort hätten, an den sie sich zurückziehen konnten; und das Kürbisfeld, damit die Toten anständig begraben werden konnten. Gideon, eine selbstsüchtige Seele, wollte mit alldem nichts zu tun haben und tat alles in seiner Macht Stehende, um die Landschaft zu zerstören, bis mein Vater sich schließlich gezwungen sah, ihn in die Wüste zu schicken.
Die Anstrengung, das Haus zu vollenden, erschöpfte meinen Vater so sehr, daß er kaum noch Lust hatte, sich mit der Außenwelt abzugeben. Irgend jemand mußte aber den Körper steuern; und so ging mein Vater an dem Tag, als die letzte Schindel festgenagelt war, an den See hinunter und rief meinen Namen.
Was mich an anderen Menschen ebenfalls verwundert, ist die Tatsache, daß viele gar nicht wissen, was Sinn und Zweck ihres Lebens ist. Das macht ihnen in der Regel schon zu schaffen – jedenfalls mehr als ihre Unfähigkeit, sich an ihre Geburt zu erinnern –, aber ich kann es überhaupt nicht nachempfinden. Zu wissen, wer ich bin, ist gleichbedeutend damit, zu wissen, warum ich bin, und ich habe schon immer gewußt, wer ich bin, vom ersten Augenblick an.
Mein Name ist Andrew Gage. Als ich aus dem See stieg, war ich sechsundzwanzig Jahre alt. Ich wurde mit meines Vaters Kraft geboren, doch ohne seine Müdigkeit; mit seiner Beharrlichkeit, doch ohne seinen Schmerz. Ich wurde dazu aufgerufen, das Werk zu Ende zu führen, das mein Vater begonnen hatte: eine Aufgabe, die er sich vorgenommen hatte, für die ich aber geschaffen worden war.
I Gleichgewicht
Erstes Buch
Andrew
1
Penny Driver lernte ich zwei Monate nach meinem achtundzwanzigsten Geburtstag kennen – oder zwei Monate nach meinem zweiten, je nachdem, wie man rechnen will.
Jake war an dem Morgen, wie an fast jedem Morgen, als erster auf: Er stürmte bei Sonnenaufgang aus seinem Zimmer, polterte die Treppe hinunter ins Gemeinschaftszimmer, und der Lärm seiner Sprünge löste unter den übrigen Seelen des Hauses eine Aufwach-Kettenreaktion aus. Jake ist fünf Jahre alt, und zwar schon seit 1973, als er aus den Trümmern einer toten Seele namens Jacob hervorging; er ist ein erwachsener Fünfjähriger, aber im Grunde seines Herzens noch immer ein Kind, und Rücksichtnahme gehört nicht eben zu seinen Stärken.
Jakes Getrampel riß Tante Sam aus dem Schlaf, und sie fluchte sofort los; Tante Sams Fluchen weckte Adam im Zimmer direkt nebenan; und Adam, der zwar durchaus alt genug wäre, um auf anderer Leute Schlafbedürfnis Rücksicht zu nehmen, sich aber oft dagegen entscheidet, stieß mehrere Variationen von indianischem Kriegsgeheul aus, bis mein Vater gegen die Wand hämmerte und ihm befahl, die Klappe zu halten. Spätestens da waren alle wach.
Ich hätte versuchen können, das alles zu ignorieren. Im Gegensatz zu den anderen schlafe ich nicht im Haus, sondern im Körper, und wenn man im Körper ist, sind selbst die lautesten Hausgeräusche lediglich ferne Echos in Andy Gages Kopf, und sie lassen sich beliebig ausblenden – es sei denn, sie kommen von der Kanzel. Aber Adam weiß das natürlich, und jedesmal, wenn ich versuche, den Wecker zu überhören, ist er in Null Komma nix draußen auf der Kanzel und kräht wie ein Hahn, bis ich den zarten Wink verstanden habe. An manchen Tagen lasse ich ihn krähen, bis er heiser wird, nur damit er nicht vergißt, wer hier der Boß ist; aber an diesem bestimmten Morgen klappten meine Augen auf, sobald Jake den Fuß auf die Treppe gesetzt hatte.
Das Zimmer, in dem ich schlief – in dem der Körper schlief –, befand sich in einem renovierten Haus aus der Jahrhundertwende in Autumn Creek, Washington, vierzig Kilometer östlich von Seattle. Das Haus gehörte Mrs. Alice Winslow, die meinen Vater schon 1992 als Pensionsgast aufgenommen hatte, als es mich noch gar nicht gab.
Wir hatten einen Teil des Erdgeschosses gemietet. Die Wohnung war groß, aber vollgerümpelt, was eine unvermeidliche Begleiterscheinung einer multiplen Persönlichkeit ist, selbst wenn man sich alle Mühe gibt, seine realen, materiellen Besitztümer nicht über ein notwendiges Minimum hinaus anwachsen zu lassen. Vom Bett aus sah ich, ohne auch nur den Kopf zu bewegen: Tante Sams Staffelei, Pinsel und Farben und zwei unbemalte Leinwände; Adams Skateboard; Jakes Plüschpanda; Seferis’ Kendoschwert; meine Bücher; meines Vaters Bücher; Jakes kleines Regal mit Büchern; Adams Playboy-Sammlung; Tante Sams Stapel von Reproduktionen; einen Farbfernseher mit Fernbedienung, der früher meinem Vater gehört hatte, aber mittlerweile in meinen Besitz übergegangen war; einen Videorecorder, der zu drei Fünfteln mir, drei Zehnteln Adam und einem Zehntel Jake gehörte (lange Geschichte); einen CD-Player, der zur Hälfte mir, zu einem Viertel meinem Vater, einem Achtel Tante Sam und je einem Sechzehntel Adam und Jake gehörte (noch längere Geschichte); ein Gestell mit CDs und Videokassetten unterschiedlicher Provenienz und Zugehörigkeit; und einen Rollkorb voll schmutziger Wäsche, auf die niemand Anspruch erheben wollte, die aber größtenteils meine war.
Das alles konnte ich sehen, ohne auch nur die Augen zu bewegen; und außer dem Schlafzimmer gab es noch ein Wohnzimmer, einen großen begehbaren Schrank, ein Bad, das durchaus die Bezeichnung »Vollbad« verdient hätte (wenn Sie den Kalauer verzeihen), und die Küche, die wir uns mit Mrs. Winslow teilten. Die Küche war allerdings nicht so vollgerümpelt; Mrs. Winslow kochte uns die meisten Mahlzeiten und achtete streng darauf, daß unsere persönlichen Lebensmittelvorräte nicht mehr Platz beanspruchten als ein Kühlschrankfach und zwei Regale in der Speisekammer.
Ich stand auf und verfügte uns ins Bad, damit das Morgenritual beginnen konnte. Als erstes kamen die Zähne dran. Aus unerfindlichen Gründen macht es Jake richtig Spaß, sie zu putzen, also laß ich ihn immer: Ich zog mich auf die Kanzel zurück und überließ ihm solange den Körper. Ich blieb allerdings wachsam. Wie schon gesagt, ist Jake ein Kind; Andrew Gages Körper aber ist erwachsen, eins siebzig groß, und er hängt auf Jakes Seele wie ein viel zu großer Anzug. Jake bewegt sich darin ziemlich unbeholfen und hat oft Schwierigkeiten, die Entfernung zwischen seinen Extremitäten und der Außenwelt richtig einzuschätzen; und da wir nun mal nur den einen Schädel haben, wäre es für uns alle tragisch, wenn er sich bücken müßte, um einen heruntergefallenen Zahnpastatubenverschluß aufzuheben, und sich dabei den Kopf am Waschbecken einschlüge. Also ließ ich ihn nicht aus den Augen.
An diesem Morgen lief die Sache ohne Unfälle ab. Er putzte uns die Zähne mit gewohnter Gründlichkeit: hin und her, rauf und runter, ohne einen einzigen Zahn auszulassen, nicht mal einen von den problematischen ganz hinten. Ich wünschte, er könnte die Prozedur mit der Zahnseide auch gleich übernehmen, aber das ist denn doch ein bißchen zu schwierig für ihn.
Ich nahm den Körper wieder an mich und absolvierte eine kurze Sitzung auf dem Klo. Das ist meistens meine Aufgabe, gelegentlich bittet mein Vater allerdings, sie übernehmen zu dürfen – sich genüßlich auszukacken, sagt er, gehört zu den wenigen Dingen von draußen, die er wirklich vermißt. Adam stellt sich manchmal ebenfalls zur Verfügung, gewöhnlich unmittelbar nachdem der neuste Playboy gekommen ist; aber alles in allem lasse ich ihn nicht häufiger als ein-, zweimal im Monat ran, weil die anderen sich aufregen könnten.
Nach dem Stuhlgang kam die Morgengymnastik. Ich legte mich auf die Badematte und übergab an Seferis, damit er sein Training absolvierte: zweihundert Sit-ups, gefolgt von zweihundert Liegestützen, davon die letzten hundert abwechselnd mit dem rechten und dem linken Arm. Als ich von der Kanzel zurückkehrte, empfingen mich schmerzende Muskeln und schweißnasse Haut, aber ich beklagte mich nicht. Der Körper hat einen richtigen Waschbrettbauch, und ich kann schwere Lasten heben.
Als nächstes ließ ich Tante Sam und Adam je zwei Minuten lang unter die Dusche. Früher hatten sie sich darin abgewechselt, wer zuerst durfte, aber Tante Sam mag das Wasser viel heißer als Adam, und Adam »vergaß« ständig, die Temperatur entsprechend zu regulieren, bevor er den Körper abgab, also heißt es jetzt jeden Morgen: erst Tante Sam, dann Adam, dann ich – und Adam weiß ganz genau: wenn er mir Eiswasser oder Seife in den Augen hinterläßt, kann er sich sein Duschprivileg für eine Woche abschminken.
Als ich an die Reihe kam, seifte ich mich rasch ein (die anderen geben sich eher selten mit richtigem Waschen ab), spülte und trocknete mich ab und ging dann ins Schlafzimmer zurück, um mich anzuziehen. Mein Vater kam auf die Kanzel heraus, um mir bei der Kleiderwahl zu helfen. Außerhalb der Wohnung ist der Körper ausschließlich mir unterstellt, also müßte es eigentlich in meiner alleinigen Verantwortung liegen, was tagsüber getragen wird, aber Tante Sam meint, ich hätte, was Kleidung anbelangt, nicht den geringsten Geschmack, und ich glaube, mein Vater hat deswegen irgendwie Schuldgefühle.
»Nicht das Hemd«, riet er, nachdem ich die Sachen aufs Bett gelegt hatte.
»Beißt es sich mit der Hose?« fragte ich und versuchte, mich an die Faustregel zu erinnern. »Ich dachte, Bluejeans passen zu allem.«
»Tun sie auch«, sagte mein Vater. »Aber manche Sachen beißen sich mit allem, sogar mit Bluejeans.«
»Du findest es häßlich?« Ich hob das Hemd hoch und sah es mir kritischer an. Schottenkaro: rot und grün auf knallgelbem Grund. Ich hatte es mir nebst ein paar anderen Schnäppchen im Winterschlußverkauf besorgt, und ich fand, daß es fröhlich aussah.
»Es ist häßlich«, sagte mein Vater. »Wenn es dir wirklich gefällt, kannst du es ja in der Wohnung tragen, aber ich würde dir nicht empfehlen, es der breiteren Öffentlichkeit zuzumuten.«
Ich war unschlüssig. Das Hemd gefiel mir tatsächlich, und ich kann es nicht ausstehen, auf etwas zu verzichten, bloß weil es einen schlechten Eindruck auf andere Leute machen könnte. Andererseits habe ich ein starkes Bedürfnis, einen guten Eindruck zu machen.
»Es ist deine Entscheidung«, sagte mein Vater geduldig.
»Na gut«, sagte ich, immer noch widerwillig. »Dann zieh ich eben was anderes an.«
Wir zogen uns fertig an. Schließlich band ich mir die Uhr um und verglich die Uhrzeit mit dem Wecker auf meinem Nachttisch. 7:07, sagte der Wecker, MON 21. APR. Was Wochentag und Datum betraf, war meine Uhr derselben Meinung, was die Uhrzeit anging, weniger.
»Zwei Minuten auseinander«, stellte mein Vater fest.
Ich zuckte die Achseln. »Die Armbanduhr geht nach«, erinnerte ich ihn.
»Dann solltest du sie reparieren lassen.«
»Ist nicht nötig. Sie ist gut so, wie sie ist.«
»Die Uhr vom Videorecorder solltest du auch in Ordnung bringen.«
Das war ein ewiger Zankapfel zwischen uns beiden. Mein Vater hatte früher Dutzende von Uhren gehabt, die verhindern sollten, daß er Zeit verpaßte; mir bereitete das allerdings weniger Kopfzerbrechen, da mir meines Wissens nie auch nur eine einzige Sekunde entgangen war, und deswegen hatte ich den Bestand auf eine Uhr pro Zimmer reduziert. Diese Entscheidung hatte Anlaß zu erheblichen Auseinandersetzungen gegeben – ebenso die Tatsache, daß es mir nicht gelang, die verbleibenden Uhren exakt aufeinander abzustimmen. Insbesondere meine unbekümmerte Einstellung zur Uhr des Videorecorders trieb meinen Vater zum Wahnsinn: Wenn mal der Strom ausgefallen war oder jemand das Gerät vom Netz getrennt hatte, konnte sie tagelang »12:00:00« blinken, ehe ich mich dazu aufraffte, sie wieder einzustellen.
»So wichtig ist das nun wirklich nicht«, sagte ich, barscher als eigentlich beabsichtigt. Die Sache mit dem Hemd hatte ich noch immer nicht geschluckt. »Ich mach’s schon noch.«
Mein Vater antwortete nicht, aber ich spürte, daß er sich ärgerte: Als ich mich weigerte, das Videogerät direkt anzusehen, merkte ich, daß er es aus dem Augenwinkel zu fixieren versuchte.
»Ich mach es schon noch«, wiederholte ich und verließ das Schlafzimmer. Ich ging durch das Wohnzimmer – dessen Uhr im Vergleich zum Wecker um sage und schreibe eine Minute vorging – und dann den Flur entlang in die Küche, wo Mrs. Winslow uns schon mit dem Frühstück erwartete.
»Guten Morgen, Andrew«, sagte Mrs. Winslow, noch ehe ich auch nur den Mund aufgemacht hatte. Sie wußte immer sofort Bescheid. Meistens kam ich als erster, aber selbst wenn ich den Körper heute jemand anderem überlassen hätte, wäre es Mrs. Winslow nicht entgangen. In der Hinsicht war sie wie Adam: eine fast übersinnlich begabte Menschenkennerin. »Haben Sie gut geschlafen?«
»Ja, danke.« Normalerweise ist es ein Gebot der Höflichkeit, die Gegenfrage zu stellen, aber Mrs. Winslow litt unter chronischer Schlaflosigkeit. Sie schlief schlechter als alle, die ich kannte – ausgenommen Seferis, der überhaupt nicht schläft.
Sie war bestimmt schon seit fünf Uhr auf und hatte sich an den Herd gestellt, sobald sie die Dusche gehört hatte. Es war zugleich ein Beweis ihrer Gutherzigkeit und ihrer Zuneigung zu uns, daß sie das so bereitwillig auf sich nahm; wie alles andere auch, was am Morgen geschah, war das Frühstück eine Gemeinschaftsaktion, und die Vorbereitung erforderte nicht wenig Arbeit. Ich setzte mich nicht zu einer Mahlzeit an den Tisch, sondern zu einer Folge von mehreren, jeweils sorgfältig portionierten Imbissen, beginnend mit einem halben Teller Rührei und einem Becher Kaffee für mich. Ich aß mich satt und räumte dann den Körper für die übrigen Seelen, die ihrerseits nacheinander Mrs. Winslow begrüßten.
»Guten Morgen, meine Liebe«, sagte Tante Sam hoheitsvoll. Tante Sams Frühstücksanteil bestand aus einer Tasse Kräutertee und einer Scheibe Weizentoast mit Pfefferminzgelee; früher hatte sie dazu eine halbe Zigarette geraucht, aber mein Vater überredete sie, im Austausch gegen ein bißchen zusätzliche Zeit draußen darauf zu verzichten. Sie nippte an ihrem Tee und knabberte zierlich an ihrem Toast, bis Adam ungeduldig wurde und sich auf der Kanzel laut räusperte.
»Guten Morgen, schöne Frau«, sagte Adam in gespielt schäkerndem Ton. Adam gibt gern vor, ein großer Frauenheld zu sein. Tatsächlich machen ihn Frauen im Alter zwischen Zwölf und Sechzig nervös, und wäre Mrs. Winslows Haar nicht grau gewesen, hätte er wohl kaum den Mut gehabt, ihr gegenüber so forsch aufzutreten. Während er sein Frühstück verschlang – ein halbes frisch gebackenes Toastbrötchen und eine Scheibe Bacon –, bedachte er sie mit seiner Vorstellung eines verführerischen Zwinkerns; aber als Mrs. Winslow zurückzwinkerte, bekam Adam einen Schreck, Bacon in die falsche Röhre und einen ausgewachsenen Hustenanfall.
»Guten Morgen, Mrs. Winslow«, sagte Jake, seine kindlich hohe Stimme noch heiser von Adams Gewürge. Er machte sich unbeholfen über das Schälchen Cheerios her, das für ihn bereitstand. Sie goß ihm außerdem ein Gläschen Orangensaft ein, und er streckte die Hand zu schnell danach aus. Das Glas (eigentlich ein Plastikbecherchen; das war schon häufiger passiert) flog auf den Boden.
Jake erstarrte. Bei jedem anderen hätte er augenblicks den Körper geräumt. So aber krümmte er die Schultern, ballte die Fäuste, spannte alle Muskeln an und machte sich auf einen Schlag auf die Knöchel oder eine schallende Ohrfeige gefaßt. Mrs. Winslow achtete darauf, nicht zu schnell zu reagieren; anfangs tat sie sogar so, als habe sie gar nichts bemerkt, um dann, ganz beiläufig, zu sagen: »Ojemine, ich muß das Glas zu nah an den Tischrand gestellt haben.« Dann stand sie langsam auf, ging an die Spüle und feuchtete einen Lappen an, um die Pfütze aufzuwischen.
»Tut mir leid, Mrs. Winslow«, stammelte Jake. »Ich –«
»Jake, Liebes«, sagte Mrs. Winslow, während sie den Tisch abwischte, »du weißt doch, daß Florida ein riesiger Staat ist, nicht? Die haben dort Unmengen von Orangensaft; da gibt’s noch mehr als genug.« Sie füllte seinen Becher auf und hielt es ihm diesmal direkt hin; er umklammerte es mit beiden Händen. »So«, sagte Mrs. Winslow. »Nichts passiert. Es sieht nur aus wie Gold.« Jake kicherte, aber richtig entspannte er sich erst, als er wieder im Haus war.
Seferis grüßte lediglich mit einem Kopfnicken. Sein Frühstück war das einfachste: ein kleiner Teller gesalzene Radieschen, die er sich einzeln in den Mund steckte und wie Bonbons zerknabberte. Mittlerweile hatte sich auch Mrs. Winslow an ihr Frühstück gesetzt: aufgebackene kleine Brötchen mit Marmelade. Als sie das Marmeladenglas nicht aufbekam, reichte sie es Seferis.
Seferis’ Größenverhältnis zum Körper ist das genaue Gegenteil von Jakes: Seine Seele ist zwei Meter siebzig groß, und in Andy Gages unscheinbarer Gestalt eingezwängt, strahlt er eine unbändige Kraft und Energie aus. Er bekam den Deckel mit einer schlichten Drehung von Daumen und Zeigefinger auf – ein Kunststück, das ich, obwohl ich dieselben Muskeln benutze, niemals zustande gebracht hätte.
»Efcharistó«, sagte Mrs. Winslow, als Seferis ihr das Glas mit einer schwungvollen Bewegung zurückgab.
»Parakaló«, erwiderte Seferis und steckte sich ein weiteres Radieschen in den Mund. Als alles aufgegessen war, schaltete Mrs. Winslow den kleinen Schwarzweißfernseher auf der Anrichte an und goß meinem Vater, der jetzt noch ein Weilchen bei ihr sitzen würde, einen frischen Kaffee ein. Sie sahen sich gern zusammen die Nachrichten an. Mrs. Winslow hatte das früher mit ihrem Mann getan, und ich könnte mir denken, daß die Gesellschaft meines Vaters sie irgendwie daran erinnerte; umgekehrt verschaffte dieses zwanglose Beisammensein mit Mrs. Winslow meinem Vater eine Ahnung von dem normalen Familienleben, das er sich immer gewünscht hatte. Dieser Morgen verlief allerdings weniger erfreulich als sonst. Die wichtigste Nachricht der Halb-acht-Sendung war das Neuste über die Lodge-Tragödie; der Bericht nahm meinen Vater sogar noch mehr mit als die falsch gehende Uhr des Videorecorders, und sie drückte auch beträchtlich auf Mrs. Winslows Stimmung.
Vielleicht erinnern Sie sich ja an die Lodge-Story; da zur gleichen Zeit auch ein ähnlicher Fall die Medien beschäftigte, fand sie landesweit nicht soviel Beachtung, wie man unter anderen Umständen hätte erwarten können, aber sie machte durchaus Schlagzeilen. Warren Lodge war ein Platzwart aus Tacoma, der mit seinen beiden Töchtern im Olympic National Park zelten gefahren war. Zwei Tage nach Beginn des Campingurlaubs sah die Staatspolizei Mr. Lodges Jeep auf der Route 101 Schlangenlinien fahren und hielt ihn an. Mr. Lodge – er schien völlig außer sich zu sein und hatte eine tiefe Kratzwunde am Kopf – behauptete, ein Puma sei in ihr Lager eingedrungen und habe ihn angegriffen, worauf er das Bewußtsein verloren habe. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er das Zelt seiner Töchter völlig zerfetzt vorgefunden, ihre Schlafsäcke seien zerrissen und blutbeschmiert gewesen, und die Mädchen selbst – Amy, zwölf, und Elizabeth, zehn – verschwunden und trotz mehrstündiger Suche unauffindbar.
Es konnte die Wahrheit sein. Angriffe von Pumas sind im Nordwesten der Staaten keine Seltenheit, und Mr. Lodge sah stark genug aus, um mit etwas Glück einen Ringkampf mit einer Raubkatze überlebt zu haben. Aber als ich ihn im Fernsehen sah – am Tag nachdem die Polizei ihn angehalten hatte, hielt er eine Pressekonferenz ab, in der er um freiwillige Helfer für die Suche nach seinen Mädchen bat –, verspürte ich ein zunehmend unbehagliches Gefühl. Mr. Lodges Geschichte konnte stimmen, aber irgend etwas an der Art, wie er sie erzählte, stimmte nicht. Erst Adam, der von der Kanzel aus in Mr. Lodges tränenüberströmtes Gesicht blickte, faßte meine dumpfe Ahnung in Worte: »Er ist der Puma.«
Seit diesem Augenblick – also seit mittlerweile fast einer Woche – warteten wir darauf, daß die Polizei zu demselben Schluß kommen würde. Bislang war in der Öffentlichkeit zwar nicht die leiseste Andeutung eines Verdachts ausgesprochen worden, aber Adam meinte, wenn die Bullen nicht völlig inkompetent waren, mußten sie sich ihren Teil denken. Mein Vater seinerseits hatte gelobt, er würde, sollte Mr. Lodge nicht bald festgenommen werden, selbst bei der Staatsanwaltschaft von Mason County anrufen – oder mich das machen lassen.
»Glauben Sie wirklich, daß er sie getötet hat?« fragte Mrs. Winslow jetzt, als Mr. Lodges Bitte um freiwillige Helfer noch einmal übertragen wurde; der Bericht war ein bloßer Zusammenschnitt früherer Sendungen, dem lediglich die Meldung folgte, die Suchtrupps hätten praktisch jede Hoffnung aufgegeben, die Mädchen noch lebend zu finden.
Mein Vater nickte. »Und ob er sie getötet hat. Und das ist noch nicht alles, was er ihnen angetan hat.«
Mrs. Winslow schwieg einen Augenblick lang. Dann sagte sie: »Glauben Sie, daß er wahnsinnig ist? Seine eigenen Kinder umzubringen?«
»Geisteskranke versuchen nicht, ihre Verbrechen zu vertuschen«, sagte mein Vater. »Er weiß, daß das, was er getan hat, falsch war, aber er will sich nicht den Konsequenzen stellen. Das ist nicht wahnsinnig. Das ist selbstsüchtig.«
Selbstsüchtig: das schlimmste Attribut, das mein Vater zu vergeben hatte. Die naheliegende nächste Frage stellte Mrs. Winslow nicht – die Frage, die mich von jeher beschäftigt hat, nämlich: Warum? Selbst wenn man vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohl anderer voraussetzte – was brachte jemanden dazu, das, was Mr. Lodge seinen eigenen Töchtern angetan hatte, einem anderen Menschen antun zu wollen? Mrs. Winslow stellte diese Frage nicht, weil sie wußte, daß mein Vater darauf keine Antwort hatte – obwohl er den größten Teil seines Lebens damit zugebracht hatte, danach zu suchen. Sie stellte auch sonst keine Fragen, sondern saß nur zornig schweigend da, während mein Vater seinen Kaffee austrank und der Nachrichtensprecher sich anderen Themen zuwandte. Bald darauf wurde es für uns Zeit, zur Arbeit zu gehen; mein Vater küßte Mrs. Winslow auf die Wange und übergab mir wieder den Körper.
In der Eingangshalle hing ein Familienfoto: eine jüngere, noch dunkelhaarige Mrs. Winslow mit ihrem verstorbenen Mann und ihren zwei Söhnen, alle nebeneinander auf dem Rasen vor dem – damals noch nicht renovierten – Haus. Seit mein Vater mir erzählt hatte, was geschehen war, verlangsamte ich immer den Schritt, wenn ich an diesem Bild vorbeikam; heute blieb ich sogar stehen, bis Mrs. Winslow von hinten herankam und mich vorwärts stupste und durch die Haustür hinausbugsierte.
Draußen war der Himmel für die Jahreszeit ungewöhnlich heiter; nur um den Mount Winter, drüben im Osten, drängten sich ein paar Wolken. Mrs. Winslow händigte mir ein Lunchpaket aus (diesmal eine vollständige Mahlzeit; das Mittagessen wird nicht gemeinsam eingenommen). Sie wünschte mir einen schönen Tag und setzte sich dann auf die Schaukelbank auf der Veranda, um auf die Morgenpost zu warten. Der Briefträger kam zwar erst in ein paar Stunden, aber sie würde trotzdem warten, so wie sie es immer tat, und wenn es zu kalt werden sollte, würde sie sich in einen alten Quilt wickeln.
»Kann ich Sie allein lassen, Mrs. Winslow?« fragte ich, bevor ich ging. »Brauchen Sie noch irgend etwas?«
»Es ist gut, Andrew. Kommen Sie nur gesund wieder, das ist alles, was ich brauche.«
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte ich. »Wenn mir jemand blöd kommt, bin ich ja in der Überzahl.« Das ist ein uralter Witz unter Multiplen und bringt einem in der Regel wenigstens ein höfliches Lächeln ein, aber heute klopfte mir Mrs. Winslow lediglich auf den Arm und sagte: »Na, dann geht mal. Sonst verspätet ihr euch noch.«
Ich ging los. Auf dem Bürgersteig sah ich mich noch einmal um; Mrs. Winslow hatte eine Illustrierte aufgeschlagen und las – oder tat so, als ob. Sie sah vor der Front des viktorianischen Hauses sehr klein aus, sehr klein und sehr allein – wirklich allein, auf eine Weise, die ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Ich fragte mich, wie es wohl sein mochte und ob es leichter oder schwerer war, als ständig von anderen Seelen umgeben zu sein.
»Mach dir ihretwegen keine Sorgen«, sagte Adam von der Kanzel aus. »Sie kommt schon klar.«
»Ich glaube, diese Nachricht hat ihr wirklich zu schaffen gemacht.«
»Sie hat ihr nicht zu schaffen gemacht«, sagte Adam spöttisch. »Stinkwütend hat sie sie gemacht. Und das ist auch richtig so. Wenn du dir schon Sorgen machen willst, dann mach sie dir über Leute, die nicht wütend werden, wenn sie so etwas erfahren.«
Ich winkte Mrs. Winslow noch ein letztes Mal zu und zwang mich dann loszugehen. Als wir die nächste Querstraße erreichten und das Haus weit genug hinter uns lag, fragte ich: »Glaubst du, daß sie ihn erwischen? Warren Lodge, meine ich.«
»Das hoffe ich«, sagte Adam. »Ich hoffe, daß er seine Strafe bekommt – ob sie ihn nun schnappen oder nicht.«
»Wie meinst du das?«
»Das passiert einfach manchmal. Manchmal glaubt jemand, er sei ungeschoren davongekommen, er habe alle erfolgreich für blöd verkauft, und dann stellt sich irgendwann raus, daß er sich getäuscht hat. Er bekommt zu guter Letzt doch seine Strafe.«
»Wie?« fragte ich. »Durch wen?«
Aber Adam hatte keine Lust mehr, sich über das Thema auszulassen. »Wir wollen einfach hoffen, daß ihn ein Polizist erwischt«, sagte er. Dann kehrte er ins Haus zurück und kam erst wieder heraus, als wir schon fast an der Fabrik angelangt waren.
2
Ich arbeitete in der Reality Factory auf der East Bridge Street. Meine Chefin, Julie Sivik, war gleichzeitig der allererste Mensch, mit dem ich persönlich, auf eigene Faust, Freundschaft geschlossen habe.
Als mein Vater mich herausrief, arbeitete er noch als Regalauffüller im Bit Warehouse, einem großen Computerfachgeschäft an der Interstate 90, zwischen Autumn Creek und Seattle. Ursprünglich hatte ich dort seinen Posten übernehmen sollen, genauso wie ich alle übrigen Aspekte des Körperbetriebs übernommen hatte, aber es klappte nicht. Von einem guten Regalauffüller wird erwartet, daß er weiß, wo die verschiedenen Waren hinkommen, weiß, wie er sie anschließend wiederfindet, und – zumindest im Bit Warehouse, dessen Kundendienstpolitik dem Motto »Sie können jeden fragen« gehorchte – weiß, wozu sie eigentlich gut sind. Nachdem er drei Jahre dort gearbeitet hatte, verfügte mein Vater über all diese Kenntnisse, ich allerdings nicht.
Das ist eines dieser metaphysischen Probleme, die Nichtmultiple nur schwer nachvollziehen können. Als mein Vater mich ins Leben rief, stattete er mich natürlich mit einer großen Menge praktischen Wissens aus. In dem Augenblick, als ich aus dem See stieg, konnte ich bereits sprechen. Ich hatte einen Begriff von der Welt und wenigstens eine Ahnung davon, was sich darin befand. Ich wußte, was Katzen, Schneeflocken und Fähren waren, ohne je eine reale Katze, Schneeflocke oder Fähre gesehen zu haben. Damit läge die Frage nahe: Wenn mein Vater mir all das mitgeben konnte, warum nicht auch das nötige Know-how, das einen Meister-Regalauffüller ausmacht? Ja, wenn wir schon dabei sind – warum konnte er mir nicht Tante Sams Französischkenntnisse, Seferis’ Meisterschaft in den fernöstlichen Kampfkünsten und Adams Begabung, Lügen zu durchschauen, schenken?
Ich wollte, ich wüßte es, denn es gibt durchaus Gelegenheiten, zu denen mir diese Fähigkeiten zupaß kämen. Natürlich kann ich immer Tante Sams Dolmetscherdienste anfordern; Seferis ist allzeit bereit, zur Verteidigung des Körpers einzuspringen, und Adam treibt sich ständig auf der Kanzel herum und fährt Schwindlern und Angebern (wenn auch nur für mich hörbar) unaufgefordert über den Mund; aber das ist alles nicht das gleiche, wie wenn ich die entsprechenden Fähigkeiten selbst besäße. Erstens helfen einem andere Seelen nicht unentgeltlich – sie erwarten im Gegenzug irgendwelche Gefälligkeiten, und manche ihrer Wünsche sind nicht eben leicht zu erfüllen. Es wäre viel einfacher, und billiger dazu, wenn ich mir einfach ihre Talente ausborgen könnte.
Daß das nicht möglich ist, hängt nach Auffassung meines Vaters mit dem qualitativen Unterschied zwischen Information und Erfahrung zusammen. Wenn man mich am Tag meiner Geburt gefragt hätte, was Regen ist, hätte ich mit der Definition aus dem Wörterbuch geantwortet. Fragt man mich heute, antworte ich noch immer mit dieser nüchternen Definition – aber während ich es tue, denke ich an diesen Augenblick an einem bewölkten Morgen, wenn man sich entscheiden muß, ob es ratsam ist, den Schirm mitzunehmen (worauf die Antwort in unseren Breiten meist ja lautet). Oder ich denke an die kopfstehende Welt, die sich in den Pfützen spiegelt, oder an das widerlich klebrige Gefühl eines durchnäßten Wollpullovers, oder an den Geruch von nassem Laub im Lake Sammamish State Park. Die Erfahrung hat den Wortlaut meiner Antwort nicht allzusehr verändert, aber die Bedeutung hat sich dadurch von Grund auf gewandelt.
Die Erinnerung macht den Unterschied aus. Es gibt Tatsachen, die jedem bekannt sind, aber Erinnerungen – und die Gefühle, die sie auslösen – gehören ausschließlich der einzelnen Seele. Erinnerungen kann man beschreiben, aber eigentlich mitteilen lassen sie sich nicht; und Wissen, das mit besonders starken Erinnerungen verwoben ist, läßt sich ebensowenig mit anderen teilen. Wie zum Beispiel Tante Sams Französischkenntnisse: sie sind mehr als nur eine Ansammlung von Grammatikregeln und Vokabeln, sie sind die Erinnerung an ihren High-School-Lehrer Mr. Canivet, den ersten Erwachsenen in ihrem Leben, der sie nicht auf die eine oder andere Weise verriet, der sie immer freundlich behandelte und ihr niemals weh tat. Ich habe Mr. Canivet nicht kennengelernt und kann ihn deswegen auch nicht so lieben, wie Tante Sam ihn liebt. Was für Gefühle ich auch für ihn empfinden mag – sie sind vermittelt, aus zweiter Hand, und all die Dinge, die Tante Sam von ihm gelernt hat, werde ich ebenfalls immer aus zweiter Hand erhalten.
Die berufliche Erfahrung meines Vaters hatte ebenfalls diese private, unveräußerliche Qualität. Sie ließ sich nicht mitteilen; sie konnte nur persönlich erworben werden. Ein paar Wochen lang versuchte ich mich als Lehrling, wobei mein Vater mich von der Kanzel aus Schritt für Schritt anleitete und tausend Fragen über RAM-Chips und SCSI-Ports und Null-Modem-Kabel beantwortete, aber der Lernstoff war einfach zu gewaltig und die Zeit zu knapp. In sechs Monaten hätten wir es vielleicht geschafft, aber am Ende der dritten Woche war meines Vaters Arbeitsleistung – meine Arbeitsleistung – so miserabel geworden, daß wir ernsthaft Gefahr liefen, gefeuert zu werden.
Daß mein Vater keinem seiner Arbeitskollegen was von mir erzählte, machte die Sache auch nicht besser; ich glaube nach wie vor, daß er offen hätte zugeben sollen, daß er einen Nachfolger einarbeitete. Aber nach zwei unfreiwilligen Einweisungen war er kaum noch bereit, anderen von seiner Multiplizität zu erzählen, und wenngleich er sich Mrs. Winslow anvertraut hatte, wußte im Bit Warehouse niemand über seinen Zustand Bescheid. Und da es so war, wußten sie auch nicht, was sie davon halten sollten, als Andy Gage begann, sich wie ein ganz anderer Mensch zu verhalten – wie einer, der ständig zerstreut ist und selbst mit den simpelsten Aufgaben nicht zu Rande kommt. Mr. Weeks, mein unmittelbarer Vorgesetzter, zeigte sich besonders besorgt; als sich herausstellte, daß ich versehentlich die Festplatte des zentralen Lagerrechners neu formatiert hatte, fragte er sich – für alle Umstehenden gut hörbar –, ob ich wohl unter Drogen stünde.
»Wir könnten ihm doch die Wahrheit sagen«, schlug ich vor. »Wir könnten allen die Wahrheit sagen.«
»Nicht alle würden sie verstehen«, erwiderte mein Vater. »Es ist eine komplizierte Wahrheit, und die Leute mögen keine Komplikationen. Besonders Leute in verantwortlichen Positionen nicht. Du wirst es schon noch lernen.«
Du wirst es schon noch lernen. Das war die Standardentgegnung meines Vaters, wenn ich mal wieder eine Frage gestellt hatte, die nur die Erfahrung beantworten konnte. Ich bekam sie damals ziemlich häufig zu hören, und es war ganz schön frustrierend – und zwar für ihn nicht weniger als für mich. Er hatte gedacht, mit dem Bau des Hauses den anstrengenden Teil hinter sich gebracht zu haben; mir alles zu überantworten hatte er sich einfach vorgestellt. Aber er lernte selbst noch immer aus seinen Erfahrungen.
Eine Lektion, die wir beide gelernt hatten, war, daß ich nicht einfach so in das bisherige Leben meines Vaters schlüpfen konnte. Ich mußte mir schon mein eigenes aufbauen: mir meinen eigenen Job suchen, eigene Freunde finden – und selbst entscheiden, wem ich vertrauen konnte und wem nicht.
Ich ging zu Mr. Weeks und sagte ihm, daß ich kündigen wolle. Er nickte, als habe er nichts anderes erwartet, und sagte nur, er hoffe, ich würde mir ernsthaft überlegen, ob ich mich nicht einer Drogentherapie unterziehen sollte. Ich sagte, daß ich darüber nachdenken würde – eine weitere Standardantwort, die ich von meinem Vater übernommen hatte –, und kehrte in den Verkaufsraum zurück, um meinen letzten Arbeitstag zu Ende zu bringen. Und da lernte ich Julie Sivik kennen.
Als sie mich ansprach, stand ich auf einer Leiter in Gang 7 und war dabei, Kartons auf dem Speicherregal umzusortieren. Auch wenn ich gekündigt hatte, lag mir weiterhin daran, möglichst viel über Computer zu lernen, und mein Vater und ich waren in eine ziemlich komplizierte Diskussion über graphische Benutzeroberflächen vertieft, so daß Julie mehrmals »Verzeihung« sagen mußte, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Hallo«, sagte ich, als ich sie endlich bemerkt hatte. Ich rutschte die Leiter hinunter und wischte mir die Hände am Hemd sauber. »Kann ich Ihnen helfen?«
Auf den ersten Blick wirkte sie ziemlich einschüchternd. Sie war eine Handbreit größer als ich und hatte auch entsprechend breitere Schultern. Sie trug eine dunkelbraune Lederjacke über einem schwarzen T-Shirt und dunklen Jeans; ihr Haar war ebenfalls dunkel, sehr glatt und streng, kragenlang geschnitten. Und ihr Gesicht drückte Ärger aus, als sei sie bereits zu dem Schluß gelangt, daß ich schwer von Begriff war. Ich hatte diesen Ausdruck auch schon bei anderen Kunden gesehen, aber Julie war ganz besonders gut darin, Ärger mimisch auszudrücken, als ob irgend etwas an ihren Gesichtszügen ihr gestattete, Ungeduld besonders deutlich, unmittelbar herüberzubringen.
»Ich suche ein Steuererklärungs-Programm«, sagte sie und hielt einen kleinen Stapel von folienverschweißten Schachteln in die Höhe, »und wollte fragen, welches davon Sie mir empfehlen würden.«
»Frag sie, wofür sie es braucht«, sagte mein Vater, und ich gab die Frage weiter: »Wofür brauchen Sie es?«
Julie sah mich an, als sei ich sehr, sehr schwer von Begriff. »Um meine Steuererklärung zu machen«, sagte sie. »Wozu denn sonst.«
»Persönliche oder betriebliche Einkommenssteuer?« sagte mein Vater.
»Persönliche oder betriebliche Einkommenssteuer?« fragte ich.
»Oh …« Julies Miene wurde sanfter. »Spielt das denn eine Rolle?«
»Also …« begann ich und legte eine Kunstpause ein. Damit mein Vater mir vorsagen konnte. »Na ja«, fuhr ich fort, »wenn Sie lediglich ein Programm brauchen, das den 1040er Vordruck ausfüllen kann, dann würde ich Ihnen wahrscheinlich dieses da empfehlen.« Ich zeigte auf die oberste Schachtel des Stapels. »Denn … denn es ist das preisgünstigste, ohne besondere Features, aber mit einem guten Lernprogramm, solange Sie keine speziellen Vordrucke brauchen … Wenn Sie andererseits selbständig oder Kleinunternehmerin sind, dann brauchen Sie wahrscheinlich etwas Anspruchsvolleres … Farmerin sind Sie doch nicht, oder?« Noch während ich die Frage meines Vaters weitergab, rätselte ich, was an den Steuern von Bauern so besonders sein mochte. Aber Julie machte nicht in Landwirtschaft, also erfuhr ich es nie.
»Aber ich bin dabei, ein eigenes Geschäft aufzubauen«, sagte sie. »Gleichzeitig muß ich für letztes Jahr einen normalen 1040er ausfüllen, also brauche ich vermutlich –«
»Warten Sie«, unterbrach ich und hob einen Finger in die Höhe. Mein Vater erklärte mir gerade etwas anderes.
»Warten?« sagte Julie.
»Nur einen Moment …«
In Julies Gesicht tauchte wieder der ärgerliche Ausdruck auf. »Worauf zum Teufel soll ich denn warten?« fragte sie aggressiv.
»Auf meinen Vater«, erklärte ich.
»Ihren Vater?«
»Oh, stark«, sagte Adam, der sich zu meinem Vater auf die Kanzel gestellt hatte. »Das dürfte jetzt interessant werden.«
»Auf Ihren Vater?« wiederholte Julie.
»Ja, auf meinen Vater.«
Sie tat so, als wollte sie sich vergewissern, ob jemand hinter mir stand: guckte erst rechts und links an mir vorbei, stellte sich dann auf die Zehenspitzen und spähte über meinen Kopf hinweg. »Wo ist er?« fragte sie schließlich.
»Auf der Kanzel«, erklärte ich, nachdem ich meinerseits einen Blick nach hinten geworfen hatte.
»Kanzel?«
»Das ist so eine Art Balkon, vorne am Haus. In meinem Kopf.«
»Was sind Sie, schizophren?« sagte Julie.
»Nein, ich bin eine multiple Persönlichkeit. Schizophrenie ist etwas anderes.«
»Eine multiple Persönlichkeit. Sie haben weitere Persönlichkeiten, die an Ihrem Körper teilhaben.«
»Weitere Seelen.« Dann erinnerte ich mich daran, was mein Vater gesagt hatte, und fügte hinzu: »Es ist eine komplizierte Wahrheit.«
»Das glaube ich Ihnen unbesehen.« Dies war der Augenblick, vertraute mir Julie später an, da sie zu dem Schluß kam, daß ich entweder aufrichtig war oder einer der besten Lügner, die ihr jemals untergekommen waren – also so oder so ein interessanter Fall. »Was war das eben mit dem Haus?«
Es endete damit, daß sie mich fragte, ob ich nicht nach Feierabend mit ihr was trinken gehen wollte, und ich war so aufgeregt, daß ich ja sagte, ohne vorher meinen Vater zu fragen. Aber ihm war es mehr als recht, daß ich etwas Eigeninitiative entwickelte, und Adam erklärte Julie offiziell für ungefährlich: »Sie ist jedenfalls keine Axtmörderin … Obwohl sie sich wahrscheinlich fragt, ob du nicht möglicherweise einer bist.«
Und so traf ich mich an dem Abend um Viertel nach acht mit Julie auf dem Parkplatz des Warehouse. Normalerweise war ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, aber Julie hatte ein eigenes Auto und erbot sich, mich zu fahren. Als sie hörte, daß ich in Autumn Creek wohnte, schlug sie eine Bar auf der Bridge Street vor, nur ein paar Blocks von Mrs. Winslows Haus entfernt. »Ich selbst wohne direkt um die Ecke«, fügte Julie hinzu.
Das Auto war ein 57er Cadillac Sedan de Ville, »ein Klassiker aus der zweiten Riege«, sagte Julie; sie habe ihn ihrem Onkel abgekauft und gedenke, ihn mit Gewinn weiterzuverkaufen, sobald sie ihn in Ordnung gebracht habe.
»Was ist denn daran nicht in Ordnung?«
»So ziemlich alles.« Julie betete eine Liste der Mängel herunter, und Adam wies auf ein paar weitere hin, die sie nicht genannt hatte; als wir den Parkplatz verließen, knallte irgend etwas, was vom Fahrgestell herunterhing, gegen das Pflaster und zog eine Funkenspur hinter sich her. »Da muß ernsthaft was dran gemacht werden.«
»Wird das nicht eine Stange Geld kosten?«
»Ein paar der nötigen Ersatzteile schon. Aber ich glaube, die meisten Arbeiten kann ich selbst erledigen … Würden Sie eben mal das Fenster runterkurbeln und den Arm rausstrecken? Wir müssen hier rechts abbiegen.«
Vielleicht um vom Thema Autoreparatur abzulenken, fing Julie an, von sich selbst zu erzählen. Sie war vierundzwanzig und stammte aus Rhode Island, hatte aber, seit sie mit sechzehn zu Hause ausgezogen war, schon an recht unterschiedlichen Orten gewohnt. Sie hatte ein paar Jahre an der Uni Boston studiert – nacheinander Physik, Maschinenbau und Informatik –, ohne allerdings in irgendeinem Fach einen Abschluß zu machen; danach hatte sie hier und da gejobbt: als Labortechnikerin, Maschinenschlosserin, Tankwartin, Museumsführerin, Bühnenbildnerin bei einem Low-Budget-Horrorfilm, Brandwächterin, Schnellimbißköchin, Kartengeberin in einem Spielkasino, Schildermalerin für das Bauamt von Eugene, Oregon, und zuletzt als Assistentin eines Physiotherapeuten in Seattle. »Allerdings noch nie auf einer Farm«, sagte sie und grinste.
Jedenfalls, fuhr sie fort, da es mit der Physiotherapie nicht mehr so besonders lief, habe sie entschieden, es sei an der Zeit, mit dem Rumgemurkse aufzuhören und ihr Leben in Ordnung zu bringen, ernsthaft mit einem Beruf anzufangen. Mit Hilfe des Onkels, der ihr den Cadillac verkauft hatte, habe sie ein Existenzgründungsdarlehen aufgenommen und in Autumn Creek ein Gebäude angemietet, um eine Firma für Software-Design zu eröffnen.
»Was für Software wollen Sie denn designen?«
»Virtual-Reality-Software«, sagte Julie. Sie sah mich dabei so an, als müßte ich wissen, was das bedeutete, aber der Ausdruck war mir völlig neu.
»Was ist Virtual Reality?«
»Sie arbeiten im Bit Warehouse und wissen nicht, was Virtual Reality ist?«
»Ich arbeite hier noch nicht sehr lange.«
»Mann, das würde ich aber auch sagen.«
»Also, was ist das?«
Anstatt zu antworten, wechselte sie wieder das Thema – dachte ich jedenfalls. »Erzählen Sie mir von diesem Haus in Ihrem Kopf.«
Mittlerweile saßen wir in der Bar auf der Bridge Street, in einer Nische direkt neben der Juke-Box. Julie hatte für uns beide das »Saturday Night Special« bestellt, womit, wie ich zu spät feststellte, ein Dreieinhalbliterkübel Schwarzbier gemeint war. Alkoholtrinken verstieß gegen die Regeln meines Vaters, und ich hatte eigentlich einen Sprudel bestellen wollen, aber da ich meinen Fehler nicht eingestehen wollte, ließ ich zu, daß Julie mir einschenkte, rührte dann aber, während wir weiterredeten, das Glas nicht an.
Ich erzählte ihr vom Haus: vom dunklen »Zimmer« in Andy Gages Kopf und von meines Vaters Bemühungen, dort statt dessen einen geographischen Raum zu erschaffen. Meine Ausführungen fielen nicht so klar aus, wie ich es mir gewünscht hätte; zum erstenmal erzählte ich jemandem eine Geschichte, und ich war nervös, wußte nicht so recht, welche Details ich einbeziehen und in welche Reihenfolge ich sie bringen sollte. Daß ich einen ständig dazwischenquatschenden Kritiker hatte, machte die Sache auch nicht einfacher. Mein Vater war so diskret gewesen, die Kanzel zu verlassen, aber Adam stand noch immer da oben. Er fand, ich sei dieser wildfremden Frau gegenüber viel zu offen.
»Aber was spricht dagegen? Du hast doch selbst gesagt, daß sie ungefährlich ist.«
»Ich hab gesagt, daß sie keine Axtmörderin ist. Das heißt noch lange nicht, daß es okay ist, ihr alles über uns zu erzählen.«
»Ich erzähl ihr –«
»Horace Rollins ist also Ihr Vater?« fragte Julie, ohne zu merken, daß sie uns unterbrochen hatte.
Ich schreckte zusammen. »Nicht mein Vater«, antwortete ich. »Andy Gages Vater. Andy Gages Stiefvater. Mit mir ist er überhaupt nicht verwandt. Mit Andy Gage genaugenommen auch nicht.«
»Ihr wirklicher Vater ist also gestorben?«
»Andy Gages Vater«, korrigierte ich. »Silas Gage. Er ist ertrunken.«
»Andy Gages Vater … Wenn Sie also von Ihrem Vater sprechen, meinen Sie nicht Silas Gage, Sie meinen auch nicht Horace Rollins, sondern eine andere Persönlichkeit. Eine andere ›Seele‹.«
»Aaron«, sagte ich nickend. »Mein Vater.«
»Der, der Sie aus dem See herausgerufen … Der Sie erschaffen hat.«
»Richtig.«
»Und wann war das genau?« wollte Julie wissen. »Daß er Sie herausgerufen hat?«
Ich hatte gehofft, daß sie diese Frage nicht stellen würde. Im Gegensatz zu dem, was Adam mir vorwarf, hatte ich Julie durchaus eine Reihe von Dingen verschwiegen. In den meisten Fällen waren diese Auslassungen instinktiv erfolgt, und ich hätte damals nicht sagen können, von welchen unbewußten Erwägungen ich mich hatte leiten lassen. Warum ich aber mein eigentliches Geburtsdatum verschwiegen hatte, wußte ich durchaus: Es war mir peinlich. Julie hatte so viel Lebenserfahrung und ich so wenig, daß ich befürchtete, sie würde an einer Freundschaft mit mir nicht weiter interessiert sein, sobald sie wüßte, wie unreif ich in Wirklichkeit war. Aber jetzt konnte ich mich nicht mehr drücken.
»Vor einem Monat«, gestand ich. »Ich bin vor einem Monat aus dem See gestiegen. Mir ist klar, daß ich wahrscheinlich ziemlich naiv wirke –«
»Moment mal«, sagte Julie. »Sie sind einen Monat alt?«
»Nein«, sagte ich verwirrt. »Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt. Ich wurde vor einem Monat geboren.«
Julie schüttelte den Kopf. »Wie kann beides gleichzeitig wahr sein?«
»Es ist eben so«, sagte ich. »Wo liegt das Problem?«
»Dann ist also Ihr Körper sechsundzwanzig?«
»Nein, der Körper ist neunundzwanzig.«
»Was von Ihnen ist denn dann sechsundzwanzig?«
»Meine Seele.«
Julie schüttelte wieder den Kopf. Ich rief Adam zu Hilfe.
»Also gut … Adam sagt, da Ihr Körper und Ihre Seele von jeher miteinander zusammenhängen, sind sie praktisch Spiegelbilder voneinander. Sie sind wie Zwillinge.«
»Sie meinen damit, sie sehen gleich aus? Seelen haben ein Aussehen?«
»Natürlich.«
Julie lachte. »Dann hat meine Seele also schiefe Zähne?«
»Wahrscheinlich«, sagte ich mit einem Blick auf ihren Mund. »Wenn Ihr Körper welche hat … Und sie hat dieselbe Augenfarbe und dieselbe Statur und dieselbe Stimme – und dasselbe Alter. Bei uns liegt die Sache aber anders. Keiner von uns ist ständig im Körper, deswegen besteht nicht dieselbe enge Beziehung. Adam sagt –«
»Wer ist Adam?«
»Mein Cousin.«
»Sie meinen, eine weitere Seele? Wie Ihr Vater?«
»Ja.«
»Und wie alt ist Adam?«
»Adam ist fünfzehn.«
»Ist er schon immer fünfzehn gewesen, oder ist er älter geworden?«
»Er ist ein bißchen älter geworden.«
»Wieviel ist ›ein bißchen‹?«
»Na ja, das ist schwer zu sagen. Es hängt davon ab, wieviel Zeit er draußen verbracht hat. Adam hat sich immer wieder mal Körperzeit gestohlen – wie die anderen übrigens auch. Wenn man all diese gestohlene Zeit addierte und die Zeit hinzuzählte, die ihm offiziell eingeräumt wurde, seit mein Vater die Verantwortung übernommen und mit dem Bau des Hauses begonnen hat, dann wüßte man, um wieviel älter er tatsächlich geworden ist. Mein Vater schätzt, es müßte ungefähr ein Jahr sein, aber Adam will es nicht sagen.«
»Er möchte nicht, daß Ihr Vater erfährt, wieviel Zeit er tatsächlich gestohlen hat«, vermutete Julie.
»Er möchte nicht erklären müssen, was er damit angefangen hat«, sagte ich.
»Seelen altern also nur, wenn sie die Kontrolle über den Körper haben?«
»Natürlich.«
»Warum?«
»Ich weiß auch nicht. Es ist eben so.«
»Was meint Adam dazu?«
»Adam meint … Adam sagt: aus demselben Grund, weswegen man beim Poker nicht besser wird, solange man nicht um echtes Geld spielt. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das heißen soll.«
»Schon okay«, sagte Julie. »Ich glaube, ich verstehe.«
Sie griff nach der Bierkanne, um sich nachzuschenken, und sah, daß ich noch nichts getrunken hatte. »Was ist los?« sagte sie. »Mögen Sie keinen Stout?«
»Eigentlich trinke ich überhaupt keinen Alkohol«, gestand ich und fühlte mich irgendwie ertappt. »Hausregel.«
»Ganz sicher?« Sie hielt die – noch immer mehr als halbvolle – Kanne in die Höhe. »Wenn ich das allein austrinke, müssen Sie mich wahrscheinlich raustragen.«
»Tut mir leid. Ich hätte es gleich sagen sollen.«
»Nein, ist schon in Ordnung. Ich hätte fragen sollen.« Sie deutete auf die Bar. »Möchten Sie was anderes?«
»Nein, wirklich, ich bin wunschlos glücklich.«
»Ganz wie Sie möchten …« Sie goß sich nach und sagte dann: »Also erzählen Sie mir jetzt von Ihrer Seele.«
»Was möchten Sie wissen?«
»Na – wie sehen Sie wirklich aus? Wenn ich Ihre Seele sehen und mit dem vergleichen könnte, was ich jetzt sehe, was wäre dann anders?«
»Och«, sagte ich. »Eigentlich nicht viel. Ich sehe meinem Vater sehr ähnlich, und mein Vater ähnelt Andy Gage mehr als jede andere Seele, ausgenommen … Also, sie sind sich jedenfalls sehr ähnlich.«
»Aber es gibt auch gewisse Unterschiede?«
»Ein paar. Ich habe dunklere Haare und ein schmaleres Gesicht – und es ist auch irgendwie ein bißchen anders zusammengesetzt.«
»Was noch?«
»Na ja, Narben.« Ich deutete auf den Schmiß über Andy Gages rechtem Auge. »Jake – das ist noch so ein Cousin von mir – hat sich das mal geholt, als er im Körper war. Er ist gestolpert und gegen die Kante eines Glastisches geknallt. Jakes Seele hat die gleiche Narbe, aber meine nicht, weil –«
»Weil das nicht Ihnen passiert ist.«
»Genau.«
»Und was ist damit?« Julie berührte eine Stelle an der linken Handfläche des Körpers, direkt unterhalb des Ballens. Ihre Finger waren vom Bierglas kühl und feucht und fühlten sich auf eine mir bisher unbekannte Weise gut an. Aber als mir bewußt wurde, wovon sie sprach, zog ich die Hand zurück.
»Das ist meinem Vater passiert«, sagte ich. »Er hat sich einen Bonspieß da reingerammt.« Ich glaube, Julie merkte, daß das nicht die ganze Geschichte war, aber sie bohrte nicht nach.
»Sonst noch irgendwelche Unterschiede?« fragte sie.
»Nur ein paar Kleinigkeiten. Nichts von Bedeutung.«
Auf der Kanzel stieß Adam ein verächtliches Schnauben aus. »Klar doch, nichts von Bedeutung. Nichts außer –«
»Adam!« warnte ich ihn.
»Was ist?« sagte Julie.
»Nichts«, antwortete ich. »Adam hat bloß etwas sehr Unhöfliches gesagt, das ist alles.«
Sie beugte sich neugierig vor. »Was hat er denn gesagt?«
»Es ist wirklich nichts. Adam benimmt sich wieder mal daneben.«
»Hat er die ganze Zeit zugehört?«
Ich nickte. »Zugehört und seinen Senf dazugegeben. Das macht er immer so.«
»Könnte ich mal mit ihm reden?«
Es war ein harmloser und, wie ich mit der Zeit erfahren sollte, bei Nichtmultiplen alles andere als seltener Wunsch. Wie mit vielen anderen Fragen erwischte Julie mich aber damit auf dem falschen Fuß; anstatt zu begreifen, daß sie lediglich auf Adam neugierig war, dachte ich im ersten Moment nur, sie wolle nicht mehr mit mir reden.
»Was hab ich falsch gemacht?« fragte ich Adam.
»Gar nichts hast du falsch gemacht. Sie ist nicht sauer – sie möchte bloß ein Kunststück sehen.«
»Ein Kunststück?«
»Einen Zaubertrick.«
»Möchten Sie einen Zaubertrick sehen?« fragte ich Julie, jetzt wieder verwirrt.
»Was?« sagte Julie.
»Hier«, warf Adam ein, »ich zeig dir, was ich meine. Laß mich nur einen Moment in den Körper …«
Ich hätte es ihm nicht erlauben dürfen; selbst meine einmonatige Lebenserfahrung hätte mir sagen müssen, daß Adams »Großzügigkeit« nicht zu trauen war. Aber er klang so selbstsicher, und ich war so ratlos, daß ich mich auf die Kanzel zurückzog und ihn ans Ruder ließ.
Jetzt bekam Julie einen Schrecken. Wer noch nie Zeuge eines Persönlichkeitswechsels war, erwartet oft eindrucksvolle körperliche Veränderungen, wie wenn einem Werwolf im Licht des Vollmonds ein Pelz und Reißzähne sprießen. In Wirklichkeit aber geht es viel weniger spektakulär zu – der Körper verändert sich nicht, nur die Körpersprache, aber das kann auf den Betrachter eine weit beunruhigendere Wirkung haben. Ich bin ein eher schüchterner Typ, und auch wenn ich mich bemühe – da es sich nun mal so gehört –, im Gespräch meinem Gegenüber in die Augen zu sehen, habe ich einen (wie Tante Sam es nennt) »höflich unaufdringlichen Blick«. Adam ist natürlich das genaue Gegenteil von unaufdringlich. Kaum hatte er den Körper von mir übernommen, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als Julie mit seinem proletenhaftesten pubertären Grinsen zu bedenken. Ich merkte es an ihrer Reaktion: Sie hörte abrupt auf zu lächeln und lehnte sich abwehrbereit zurück. Das war der erste Hinweis darauf, daß ich einen gewaltigen Fehler gemacht hatte.
»Hallo, Julie«, sagte Adam mit einer seidenweichen Stimme, die sogar mir ein wenig angst machte. »Jetzt schau genau hin.« Er hob den rechten Arm und schwenkte ihn in der Luft. »Nichts in diesem Ärmel …« Er tat dasselbe mit dem linken Arm. » …. und nichts in diesem.« Er senkte die Arme, führte sie zusammen und umklammerte mit beiden Händen den Bierkrug. »Guck …«
»O nein«, sagte ich. »Adam! Nein!«
Das Bier. Natürlich: Er hatte es auf das Bier abgesehen. Alkoholtrinken verstößt gegen die Regeln des Hauses, aber Adam schert sich nicht um Regeln – er ist schließlich Gideons Sohn. Und er zieht das Trinken sogar noch dem Playboy-Lesen vor.
Als er den Krug an die Lippen hob, versuchte ich, ihm den Körper wieder zu entreißen, aber er war fest entschlossen, dranzubleiben, bis er mit seiner Vorstellung fertig wäre. Er brauchte nicht lange gegen mich zu kämpfen. Schnellsaufen gehört zu Adams am besten ausgebildeten »Talenten«: Er legte lediglich den Kopf in den Nacken, und der Stout gurgelte ihm ohne jede Schluckpause den Schlund hinunter wie Wasser, das durch eine Regenrinne läuft.
»Aaaaaaaaahhhh –« Adam knallte den leeren Krug auf den Tisch. Dann schnappte er sich mit je einer Hand Julies und mein Glas, goß sich beide in den Hals, als wären es Schnapsgläschen, und endete mit einem Tusch: »TA-DAAA!!!« Dann beugte er sich über den Tisch, öffnete den Mund und rülpste Julie mit Donnerhall ins Gesicht.
Und das war’s. Über seinen Streich hysterisch kichernd, flitzte Adam aus dem Körper und rannte ins Haus zurück, womit es mir überlassen blieb, die Folgen auszubaden.
Julie sah so aus, als habe man sie geohrfeigt: Sie saß stocksteif da, die Hände starr an der Tischkante, als habe sie ihn von sich stoßen wollen und sei dabei schockgefroren worden. Im Haus konnte ich meinem Vater vor Wut brüllen und, davon halb übertönt, eine Tür zufallen hören, als Adam, noch immer rotzig meckernd, sich in seinem Zimmer verbarrikadierte – aber das war alles sehr weit entfernt. Mein unmittelbares Universum bestand aus Julie und ihren entsetzt aufgerissenen Augen.
Ich warf mich zurück und preßte mir die Hände vor den Mund, als könnte ich Adams Rülpser wieder zurücknehmen. Ich hätte in dem Moment sonstwas dafür gegeben, selbst den Körper verlassen zu können, ihn und die ganze Situation einer anderen Seele zu überlassen; aber das war nicht erlaubt. Ich konnte Seferis zu Hilfe rufen, wenn ich körperlich angegriffen wurde, aber mit Peinlichkeiten fertig zu werden lag ausschließlich in meiner Verantwortung – selbst wenn ich gar nichts dafür konnte. Hausregel.
»Es tut mir furchtbar leid …« Die Worte sprudelten mir, halberstickt von den Händen, die noch immer meinen Mund bedeckten, nur so heraus. »Es tut mir wirklich furchtbar leid, Julie …«
Julie blinzelte und erwachte wieder zum Leben. »Das war Adam?« fragte sie.
Ich nickte. »Das war Adam.«
»Sie hatten recht«, sagte sie. »Er ist wirklich ein Teenager.«
Der Abend war dann bald vorbei. Ich hörte nicht auf, mich zu entschuldigen, obwohl Julie versicherte, sie sei nicht beleidigt. »Nur ein bißchen erstaunt, das ist alles.« Aber sie wirkte mehr als nur erstaunt; sie wirkte mißtrauisch und reserviert. Sie stellte mir keine Fragen mehr, und das Gespräch verebbte bis zum völligen Schweigen.
So langsam fühlte ich mich komisch: mir wurde zunehmend schwummrig und übel. Adam hatte vom Rausch soviel wie möglich mitgenommen, um ihn in aller Ruhe in seinem stillen Kämmerlein zu genießen, aber fast zwei Liter Stout enthalten genügend Alkohol, um zwei Seelen beschwipst zu machen. Julie sah, daß meine Augen glasig wurden, und sagte: »Ich glaube, es wäre an der Zeit, daß Sie nach Hause gehen.«
»Nein«, sagte ich und schwenkte den Kopf hin und her. »Mir geht’s gut, ehrlich, es ist bloß –« Aber Julie war schon aufgestanden und an die Theke gegangen, um die Rechnung zu bezahlen. Ich starrte auf das bißchen Schaum am Rand des Bierkrugs, bis sie zurückkam. »Kommen Sie«, sagte sie und stupste mich an der Schulter. »Ich fahr Sie nach Hause.«
Ihre Finger fühlten sich diesmal nicht so angenehm an; als ich aufsah, war ihr Ausdruck nüchtern und kalt. »Ich kann auch zu Fuß gehen«, meinte ich.
»Darauf würde ich nicht wetten.«
»Sind Sie auch sicher, daß Sie fahren können?«
Julie stieß ein kurzes, hartes, bellendes Lachen aus. »Ja, ich denk schon«, sagte sie. »Ich hab ja nur das eine Glas getrunken, schon vergessen?«
Es war eine sehr kurze Fahrt, aber als wir Mrs. Winslows Haus erreichten, war ich schon am Einnicken. »Ist es hier?« fragte Julie, während sie mich wachstupste. »Sie sagten doch Temple Street 39, oder?«
Ich riß den Kopf hoch. Wir standen vor einem Haus aus der Jahrhundertwende, aber ob es das richtige Haus aus der Jahrhundertwende war, konnte ich auf die schnelle nicht erkennen. »Ich glaub schon, ja«, sagte ich dann. »Aber es sieht komisch aus. Alles sieht komisch aus …«
»Gehen Sie rein«, sagte Julie. »Gehen Sie ins Bett.«
»Na gut …« Aber bevor ich ausstieg, versuchte ich mich noch einmal zu entschuldigen. Julie fiel mir ins Wort: »Gehen Sie ins Bett, Andrew.«
»Na gut«, sagte ich. »Na gut.« Ich zog am Türgriff; der Riegel schien zu klemmen, also drückte ich mit Gewalt dagegen, und die Tür flog mit einem Kreischen auf, wobei die untere Kante einen breiten Streifen Lack auf dem Bürgersteig hinterließ.
Julie stieß einen Zischlaut aus. Dann fing ich wieder an, mich zu entschuldigen, und sie sagte: »Steigen Sie einfach aus. Steigen Sie aus, und lassen Sie mich die Tür schließen.«
Ich stieg aus. Um mein Gewicht erleichtert, hob sich die rechte Seite des Cadillac ein Stückchen, wodurch die Türkante vom Bordstein freikam; aber als Julie herüberrutschte, um die Tür zuzuziehen, senkte sie sich wieder. Fluchend versuchte sie mit ihrem Hintern so weit wie möglich nach links zu rutschen, ohne den Türgriff loszulassen.
»Vielleicht sollte ich das machen«, sagte ich.
»Ich schaff’s schon selbst!« bellte mich Julie an. Mit einem abschließenden Fluch gab sie die behutsame Vorgehensweise auf, riß die Tür zu und ließ dabei eine weitere Schicht Lack zurück. Mit einem lauten Klick machte sie den Türknopf zu.
»Gute Nacht!« rief ich ihr zu. »Danke für die Einladung!« Falls sie meinen Gutenachtwunsch erwiderte, hörte ich es nicht; als ich mich zur Beifahrertür hinunterbeugte, um ihr zum Abschied zuzuwinken, ließ Julie den Motor des Cadillac aufheulen und fuhr los. Schon ein paar Meter weiter knallte sie in ein Schlagloch und produzierte einen riesigen Funkenregen; diesmal klang es so, als habe sich wirklich was vom Fahrgestell gelöst, aber Julie fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter.
Am nächsten Morgen wachte ich mit quälenden Kopfschmerzen auf. Ein Geschenk von Adam: Er hatte zwar den halben Rausch mitgenommen, aber den Kater hatte er mir großzügigerweise ganz überlassen. Es war ein Gefühl, als stünde das ganze Haus in Flammen.
Als wär’s damit noch nicht genug, war mein Vater auf mich wütend: »Du hättest Adam den Körper niemals überlassen dürfen!«
»Hätte ich ja auch nicht getan«, sagte ich, »wenn ich geahnt hätte, daß er sich dermaßen aufführt.«
»Wie er sich aufgeführt hat, tut nichts zur Sache. Du bist für den Körper verantwortlich!«
»Aber Julie hatte darum gebeten, mit Adam zu sprechen.«