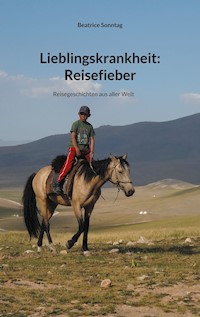Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beatrice Sonntag berichtet diesmal nicht aus fernen Ländern, sondern aus der Heimat. Sie hat sich viele Jahre lang in verschiedenen saarländischen Kneipen etwas zum Studium dazu verdient und dabei die Abgründe der menschlichen Psyche unter Alkoholeinfluß kennen gelernt. Das war ein Spaß und manchmal auch eine Zumutung. Am Ende sind diese lustigen Kneipengeschichten entstanden, die mal kurios, mal gruselig und mal einfach nur witzig sind. Immer und immer wieder fiel in der Kneipe der Satz: "Darüber könnte man ein Buch schreiben". Und das hat Beatrice Sonntag hier mit endlich getan. Die Kneipengeschichten gibt es nun in der 2. Auflage - sie sind und bleiben aktuell! Denn Beatrice Sonntag weiß, was du letzten Sonntag getan hast.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen (außer mir selbst) sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
Die Handlungen und Situationen in diesen Thekengeschichten sind frei erfunden.
(Zumindest zu einem großen Teil)
„Trunkenen Mannes Mund schwatzt aus Herzensgrund“
Isländisches Sprichwort
„Im Wein liegt Wahrheit – im Schnaps Fantasie“
Unbekannter Autor
Inhaltsverzeichnis:
Das Wort zum Sonntag
Taufsonntag
Kirmessonntag
Tierischer Sonntag
Maisonntag
Erntedank Sonntag
Wahlsonntag
Sonniger Sonntag
Adventssonntag
Turniersonntag
Ostersonntag
Fußballsonntag
Das Wort zum Sonntag
Grimmelbach ist eigentlich ein langweiliger, ganz normaler Ort, für den sich niemand im Besonderen interessiert. Das Dorf liegt irgendwo im Südwesten Deutschlands, hat etwa 800 Einwohner und ist vollkommen unauffällig. Es gibt weder Sehenswürdigkeiten noch nennenswerte wirtschaftliche Aktivitäten. Im Grunde ist es ein Kuhkaff wie jedes andere, in dem Menschen wohnen, die sich einen ruhigen und friedlichen Wohnort wünschen. Wer sich aber die Mühe macht, sich mit der skurrilen und verschrobenen Denk- und Lebensweise der hiesigen Ureinwohner zu beschäftigen, der wird die Grimmelbacher möglicherweise in sein Herz schließen und vielleicht sogar verstehen, warum manche Menschen freiwillig hier leben.
Es fällt leicht, die Bevölkerung dieses 800-Seelen-Dorfes als eigenartig abzustempeln. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre sicher ratsam, sich einer anderen, größeren, schöneren, exotischeren, gefährlicheren oder intellektuelleren Personengruppe zuzuwenden. Aus ökonomischer Sicht sind die Grimmelbacher auch nicht besonders interessant. Die Tatsache, dass ich mich für die Erforschung der Lebensweise der Bewohner von Grimmelbach entschieden habe, ist letztendlich einem unglücklichen Zufall zu verdanken. Während des Studiums brauchte ich Geld. Da ich mir damals noch nicht wirklich sicher war, wo meine fachliche Laufbahn mich hinführen würde, fiel die Wahl am Ende auf eine Tätigkeit, die jeder Idiot ausüben kann, der über zwei Dinge verfügt: Geduld und gute Nerven. Ich wurde also Bedienung in einer Dorfkneipe. Bier zu zapfen lernte ich schnell.
Im Nachhinein betrachte ich diese Zeit in der Dorfkneipe gerne als eine Lebensphase, die mich sehr viel über die Menschen, die Abgründe ihrer Psyche und die Auswirkungen von Alkohol gelehrt hat. Was ich hier an Diplomatie, Toleranz und Gelassenheit gelernt habe, hat mir mindestens genauso viel in meinem späteren Leben geholfen wie das, was ich an fachlichem Wissen in meinem Studium vermittelt bekam. Ich habe es mir außerdem zum Grundsatz gemacht, in einem Jahr nicht mehr Alkohol zu trinken als der durchschnittliche Gast dieser Kneipe an einem normalen Sonntagnachmittag. Damit fahre ich bisher sehr gut. Meine Mitmenschen und meine Leber sind mir sogar dankbar.
Für einen Liebhaber der menschlichen Natur und ihrer Eigenarten ist Grimmelbach quasi ein Paradebeispiel für Kleinbürgertum, Starrsinn und Schrulligkeit, gepaart mit einem erstaunlichen Stolz auf diese Eigenschaften. Ich habe in dieser Kneipe so viele Menschen weinen, lachen, schreien, verzweifeln, ausrasten, lieben, hassen, durchdrehen und sich erbrechen sehen, dass ich bald die Auswirkungen eines Phänomens an mir verspürte, die ich bisher nur von schlechten Seifenopern kannte. Wenn man sie regelmäßig sieht, beginnt man sich mit den Charakteren zu identifizieren und sie wachsen einem ans Herz. Egal wie durchschaubar, peinlich und schlecht gespielt die Geschichten sind – nach einer Weile kann man einfach nicht mehr wegsehen! Bei unzähligen Gelegenheiten fiel der Satz „Ey, Mann, darüber müsste man ein Buch schreiben!“ Lange Zeit war ich mir nicht sicher, ob dieses Buch wirklich jemand würde lesen wollen. Aber nun ist es soweit. Ich schreibe.
Auf den Vorschlag „Darüber müsste man ein Buch schreiben“ folgte sehr oft der Zusatz „Das glaubt uns keiner“. Das war auch meine größte Angst, dass mir niemand glauben wird. Ich schwöre hiermit feierlich, dass mindestens 83 % des hier Wiedergegebenen der Wahrheit entsprechen.
Ich habe mich also mit der Erforschung der Grimmelbacher befasst, wie es zum Beispiel die Forscher bei den vom Aussterben bedrohten Berggorillas in Uganda getan haben. Aus einem gewissen Blickwinkel ist dieser Vergleich tatsächlich passend. Ich wurde zwar wesentlich schlechter für meine Forschungsmission bezahlt, als es die Tierforscher sicherlich wurden. Zudem wurde ich in gewisser Weise von meinen Gorillas selbst bezahlt. Natürlich ist meine Arbeit kaum von Wert, denn soweit ich das bisher beurteilen kann, drohen die Grimmelbacher nicht auszusterben. Sie werden auch vermutlich nicht der Schlüssel zu einem die Menschheit bedrohenden Problem sein. Gänzlich ausschließen möchte ich Letzteres aktuell jedoch noch nicht.
Wie bei den Gorillas musste ich die Grimmelbacher zunächst an meine Gegenwart gewöhnen, was mehrere Monate gedauert hat. Zu Anfang meiner Tätigkeit dachte ich, dass die Grimmelbacher möglicherweise ein Geheimnis hüten, wie es bei den japanischen Bergbewohnern der Fall ist. Diese Japaner werden alle unheimlich alt und viele Forscher haben schon versucht, ihr Geheimnis zu ergründen. Bisher ohne Erfolg. Die Grimmelbacher hüten entweder kein Geheimnis oder sie hüten es sehr gut. Denkbar ist auch, dass es ein Geheimnis gibt, dieses aber so gut gehütet wurde, dass es mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Ich habe also sozusagen in eigenem Interesse und auf eigenes Risiko geforscht. Falls ich doch noch ein Geheimnis finde, ist mir der Ruhm sicher. Falls nicht, bin ich nur eine weitere Kneipenbedienung, die ein paar lustige Geschichten zu erzählen hat.
Jeden Sonntag arbeitete ich also in Grimmelbach in der Dorfkneipe. Zunächst war es für mich nur eine Art, mein Studium zu finanzieren, die ihre Vor- und Nachteile hat, aber nach einer Weile habe ich mich eingelebt und die vielen verschiedenen Menschen sind zu einem Teil meines Lebens geworden.
Bevor ich loslege, muss ich meinem Leser aber einiges erklären.
Die Grimmelbacher zu verstehen ist nicht leicht. Das meine ich nicht im übertragenen Sinne, sondern zunächst einmal ganz wörtlich. Ich wurde zwar nur wenige Kilometer entfernt geboren und habe doch oft Probleme, den Dialekt, der meinem angeblich sehr ähnlich ist, zu verstehen. Ich gebe einige Beispiele, um zu erklären, warum ich den Dialekt für den Leser in einer freien Übersetzung wiedergebe, ja, wiedergeben muss:
„Demorje woa aisch ährisch dabbisch.“ Das bedeutet: „Heute Morgen war ich sehr ungeschickt.“
„Awei geff nett wuscht!“ heißt frei übersetzt: „Jetzt werde bitte nicht böse!“
Grimmelbacher zu sein ist nicht einfach nur eine Angelegenheit des Wohnortes, wie der unbedarfte Beobachter vielleicht zunächst vermuten würde. Es ist vielmehr eine eigene Art, die Welt zu sehen und in ihr zu leben. Der Titel sowie die Rechte und Pflichten eines Grimmelbachers sind angeboren und vererbbar. Wirklicher und vollwertiger Grimmelbacher darf sich nur nennen, wer im Ort geboren ist oder zumindest seit spätestens dem Tag nach der Geburt hier lebt (die Regeln wurden gelockert, seit Kinder in der Regel in Krankenhäusern zur Welt kommen). Unerlässlich ist es auch, Vorfahren zu haben, die in Grimmelbach geboren wurden. Ich war oft genug erstaunt, wenn in der Kneipe die Rede von irgendwem war, den ich seit einiger Zeit kenne und, von dem ich weiß, dass er schon recht lange hier wohnt, ein Haus hat, Kinder, die in dem Haus leben und hier in den Kindergarten gehen und alles, was dazugehört. Das Bürgeramt der Gemeinde würde amtlich bestätigen, dass dieser Mensch ein Grimmelbacher im gesetzlichen Sinne ist, aber das genügt nicht.
Man wird als ‚Auswärtiger’ oder ‚Fremder’ bezeichnet, selbst wenn man vor 30 Jahren hergezogen ist. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass die Grimmelbacher durchaus sehr gastfreundlich sind und dass sie die Zugezogenen keinesfalls schlecht behandeln. Viele neue Einwohner wurden gerne und mit offenen Armen empfangen und niemand könnte sie aus dem Dorfgeschehen oder von den Festlichkeiten noch wegdenken, aber richtige Grimmelbacher werden die Zugezogenen oft auch nach vielen mühsamen Jahren nicht. Interessant und irgendwie schön ist daran auch, dass jeder, der ein gebürtiger Grimmelbacher mit Grimmelbacher Stammbaum ist, einfach akzeptiert wird, so wie er ist, sei er auch noch so schrullig oder unausstehlich. Die unangenehmen Grimmelbacher werden ähnlich einer Naturkatastrophe oder eine göttlichen Strafe hingenommen.
Auch ich werde mittlerweile toleriert und man sagte mir bereits, dass, wenn ich es anstrebte, ich sicherlich relativ schnell ein akzeptiertes Mitglied der merkwürdigen Gemeinde werden könne. Ich könnte ein Haus bauen und mich hier niederlassen, ich wäre immer gerne gesehen, aber eine Grimmelbacherin machte das aus mir auch nicht. Ich könnte eine Art Vorstufe erreichen, werde mich jedoch jetzt noch nicht darüber äußern, ob ich es als erstrebenswert erachte, Grimmelbacherin zu werden.
Für alle, die diese Existenzebene anstreben, möchte ich eine Warnung aussprechen: Es erfordert Unmengen an Geduld und ist ein langer, steiniger Weg mit ungewissem Ausgang!
Gäbe es hier noch so etwas wie eine Versammlung der Ortsältesten, die über alle Gegebenheiten Entscheidungsgewalt hätte, würde diese bestimmt nicht jede Ansiedlung erlauben. Das Ansiedlungsgesuch von Menschen, die sich ganz einfach ein Haus kaufen möchten, weil es ruhig gelegen ist und nicht weit entfernt von ihrer Arbeitsstelle oder von der Autobahn, die aber an der Dorfgemeinschaft nicht sonderlich interessiert sind, würden abgelehnt werden. Für solche Opportunisten wäre es unmöglich, die Gunst der Dorfbewohner zu erlangen. Diese Menschen wissen die Eigenheiten dieses besonderen Dorfes und seiner Bewohner nicht zu schätzen und betrachten das Dorf nur als attraktiven Wohnstandort. Die Dorfgemeinschaft und die hohen Feiertage hierzulande sehen sie eher als lästige Anlässe, die Straßen zu sperren.
Das kleine Gasthaus dient als Treffpunkt für Jung und Alt, als Beichtstuhl, als Festsaal und manchmal als Kampfarena oder Gerichtssaal für alle Dorfbewohner. Nun ja, nicht ganz für alle, aber zumindest für den männlichen Anteil der über 50-Jährigen, für alle unter dreißig und für viele zwischen dreißig und fünfzig, wobei diejenigen, die auch noch ein Familienleben oder Hobbys haben und Sport in ihrer Freizeit betreiben, sich weniger oft blicken lassen. Wenn sie sich dann blicken lassen, haben sie aber eine Menge zu erzählen, jede Menge Durst und ein dankbares Publikum auf Barhockern, die lieber darauf warten, Geschichten aus der Welt zu hören, als die Kneipe zu verlassen und selbst welche zu erleben.
Um das Innere der Kneipe ganz zu überblicken, muss man nur durch die Eingangstür treten, die einen baufälligen Eindruck macht und meistens klemmt oder knarrt. Man hat gleich eine gute Sicht auf alle Tische und die Theke. Nein, das ist falsch. Man hätte eine gute Sicht auf die Theke, wenn sie nicht von blauen Rauchschwaden getrübt wäre. Vor dieser Theke aus massivem Eichenholz stehen acht Barhocker, die genauso wenig Vertrauen erwecken wie die zuvor erwähnte Tür. Die insgesamt fünf Tische mit daran gruppierten Stühlen sind aus dunklem Holz und bezogen mit einem einst hellroten, nun in einem dreckigen Dunkelrot-Braun-Gemisch erscheinenden Stoff, der vor langer Zeit aus der Mode gekommen ist. Die gesamte Einrichtung muss einst bessere Zeiten gesehen haben, zumindest etwas bessere.
Auf den Tischen stehen fragwürdige Figuren mit Zipfelmützen oder mit Flügelchen und Geigen in den kleinen Porzellan- oder Wachshänden. Es sind in der Regel quietschbunte, anzüglich lächelnde Tierchen, Elfen oder Zwerge, denen von der Chefin das Prädikat ‚goldig’ verliehen wurde. Sie werden immer in Fünfer-oder Sechsertrupps angeschleppt, um in militärischer Gleichförmigkeit die Tische und Fensterbretter zu besetzen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Gast, egal welcher Nationalität, welchen Alters, welchen Geschlechts oder welcher Weltanschauung, diese kleinen Soldaten als angenehm empfunden hätte. Aber ich habe welche brennen sowie auf dem Boden oder an den Wänden zerschellen sehen – eines sogar an der Decke. Unzählige wurden schnell und unauffällig aus dem Sichtfeld hinter eine der dreckigen Gardinen geräumt und eine Figur aus Wachs wurde sogar zu sehr später Stunde vor meinen Augen verspeist.
Die Chefin vermutet hinter dem Verschwinden der Ungetüme jedes Mal Diebstahl, was sie in demabwegigen Glauben bestärkt, der Rest der Menschheit teile ihre Vorliebe für die grausam lächelnden Auswüchse der Kitschindustrie.
Natürlich steht auf jedem Tisch ein Aschenbecher; glücklicherweise sind sie zweckmäßig aus einfachem durchsichtigem Glas, haben keine Gesichter oder Hüte auf und besitzen kein Merkmal, das man auch nur im Entferntesten mit dem Adjektiv niedlich beschreiben könnte. Im Winter stehen Kerzen neben, auf oder in den Armen der Engel oder Schneemänner, die in der kalten Jahreszeit den Zwergen und Elfen Gesellschaft leisten. Natürlich gibt es eine Armee aus Osterhasen und Gänsen für die Frühlingsmonate und grinsende Kürbisse und Gespenster für Erntedank.
Die Theke bleibt aus praktischen Gründen von allen Elfen und Enten befreit, zumindest in den Zeiten, in denen keine hohen Feiertage anstehen.
Hinter der Theke erkennt man im schwachen Licht ein großes Regal, das fast die komplette Wand verdeckt. Darauf sind in den oberen Reihen, die niemand ohne einen Stuhl erreicht, sehr verstaubte Gläser aufgereiht. Darunter sind noch mehr Gläser aufgestellt, nach Größen oder nach Verwendungszweck geordnet, je nachdem, welche der beiden Putzhilfen sie zuletzt gereinigt hat. Diese Gläser sind selten staubig, weil sie oft benutzt werden und die Putzfrauen das Reinigen dieser Regale nie vergessen, weil sie der jeweils anderen Putzfrau ihre Art – die richtige Art – der Ordnung im Gläserregal aufzwingen wollen.
Zwischen den vielen Gläsern ist eine freie Stelle, circa 50 mal 70 cm, an der die Regale fehlen. Sie sind vermutlich heruntergefallen. Man könnte diese Stelle mit einer hölzernen Pinnwand vergleichen. Unzählige Zettel und Kärtchen sind daran mit Klebestreifen befestigt. Diese Wand ist ästhetisch gesehen ein Schandfleck, steckt aber voller Informationen und ist also einen genaueren Blick wert. Sie gibt einen guten Einblick in das alltägliche Kneipenleben.
Hier hängen fünfzehn Postkarten, acht davon aus Bayern und Tirol, vier aus Mallorca und die restlichen drei sind von mir. Zwei zeigen weibliche nackte Hintern in anrüchigen Posen und auf einer anderen ist ein Affe zu sehen, der bekleidet mit einem rot-weiß karierten Hemd, Klöße isst. Einige Karten wirken wie neu, weil an ihnen anscheinend niemand Interesse gezeigt hat, andere sind abgegriffen und an den Seiten ausgefranst, weil sie schon durch so viele Hände gewandert sind. Daneben hängt eine nach und nach mit vielen verschiedenen Handschriften und Stiften vervollständigte Liste von Telefonnummern. Man findet mehrere Taxinummern, die Nummer der Chefin, Mutter und Tochter der Chefin, der beiden Putzfrauen, der Feuerwehr, des speziellen Schnapslieferanten, der Telefonseelsorge, des Blumendienstes Fleurop für vergessene Geburtstage, der Zigarettenfirma, des nahe gelegenen Krankenhauses, des Bierlieferanten, des Bierlieferanten für Notfälle und des Pizzaservice.
Dicht neben den Urlaubskarten hängen zwei besonders peinliche Fotos von Betrunkenen, einer mit einem Adventskranz auf dem Kopf, der andere in der wenig schmeichelhaften Position in einem Auto sitzend und aus dem heruntergekurbelten Fenster kotzend. Beide, so muss man anerkennend bemerken, versuchen, in die Kamera zu lächeln. Darunter hängen zwei Bierdeckel, die jeweils mit Bleistift beschrieben sind:
„Wenn die Grünen bei der Bundestagswahl 2006 mehr als 5 % bekommen, dann gebe ich einen Kasten Bier aus!“ steht auf einem. Unterschrieben vom Autor und von zwei Zeugen. Auf dem Zweiten geht es nicht um Politik, sondern um einen Fußballverein, der aus irgendeiner Liga in irgendeine andere Liga ab- oder aufsteigen muss, um dem glücklichen Publikum an diesem Tag einen Kasten Bier zu bescheren. Der Kasten Bier ist in Grimmelbach sozusagen eine inflationsunabhängige Währungseinheit.
Darüber hinaus hängt zwischen all den Dokumenten eine Busfahrkarte, die um 9:45 in der Stadt gelöst wurde und zum Ziel die Hauptstraße in Grimmelbach hat. Der Torwart der Fußballmannschaft hatte diese Karte an einem schönen Sonntagmorgen nach einer wohl etwas wilderen und vor allem langen Nacht gelöst und war dann gegen 10:00 Uhr morgens in der Wirtschaft aufgetaucht. Dann hielt er die Karte hoch und schlief augenblicklich auf dem Tresen ein, nachdem er die magischen Worte „Ich muss heute Mittag Fußball spielen“ gesprochen hatte.
Neben der Busfahrkarte hängen einige Strafzettel und die vier Vorladungen, die die Chefin geschickt bekommen hatte, weil der verbitterte und ebenso gemeine wie hochgradig lärmempfindliche Nachbar Anzeigen wegen Ruhestörung erstattet hatte. Zum Schluss fällt einem noch ein kleines Blatt auf, das aus einem Hotelgutschein gerissen wurde. „Für die Daheimgebliebenen“ lautet die Überschrift. Darauf stehen die Adresse und Telefonnummer von einem Hotel in Mallorca. Derjenige, der dorthin gereist war, hatte wohl niemanden außer dieser Kneipe gehabt, dem er seine Urlaubsadresse hinterlassen wollte. Das ist entweder traurig oder höchst merkwürdig.
An den restlichen Wänden in der Kneipe hängen Bilder aller hiesiger Fußball- , Tennis-, Tischtennis- und Schwimmmannschaften, die jemals einen Pokal gewonnen haben oder auch nur einfach die Zeit fanden, ein Mannschaftsfoto von sich anfertigen zu lassen. Alle sind ordentlich gerahmt und das älteste ist schon über 40 Jahre alt. Man kann auf den Fotos alle erdenklichen Modetrends der vergangenen Jahrzehnte ablesen.
Dazwischen hängen Fotos von Chefin und Familie sowie ein großes altes Ölgemälde, das eine besonders hässliche Katze in einem geflochtenen Korb zeigt. Daneben prangt ein in hellblau und türkis gehaltenes gerahmtes Poster von einem Wasserfall mit zwei Delphinen davor, das der Inbegriff des Kitsch zu sein scheint. Die Zusammenstellung dieser Bilder lässt nicht unbedingt auf ein Gespür für harmonische Raumgestaltung schließen, aber letztendlich passt es auf seine paradoxe Weise fast schon wieder zusammen. In der Gesamtheit gesehen, mit den Armeen von Elfen und Zwergen, den künstlichen Blumen auf den Fensterbänken und den abgenutzten Sitzbezügen, erscheint der Raum in einer perversen Weise strukturiert. Die Plastikblumen haben die echten vor einigen Jahren ersetzt, weil außer einfachen Moosen und Farnen keine Pflanze in der Lage war, mit dem wenigen Sonnenlicht auszukommen, das sich in diesen Raum verirren kann. Auch der stets hohe Nikotin- und Teergehalt der Luft ist nicht förderlich für das Pflanzenwachstum. Der Anblick von immer neuen abgestorbenen oder braun gewordenen Blumen und Sträuchern war frustrierend, außerdem ging das Beschaffen von neuen Grünpflanzen, die ihre toten Vorgänger ersetzen sollten, mit der Zeit wirklich ins Geld. Das Einzige, was noch schlimmer sein könnte als diese hässlichen Plastikblumen, war der Anblick von toten Blumenstöcken oder von leeren Fensterbänken mit runden Wasserflecken. Weder die verdunkelten Glasscheiben noch die einst bunten, nun nikotinfarbenen Gardinen sind in der Lage, das Ambiente positiv zu beeinflussen.
Die Kneipe hat einen Nebenraum, fast ein kleiner Saal. Im Gegensatz zum Kneipeninneren wirkt dieser Raum nicht wie eine dunkle Gruft, sondern fast hell und freundlich, allein schon weil seine Wände weiß gestrichen sind. Der leichte Hauch von Nikotin verleiht den Wänden einen Touch von Sonnengelb, was zur angenehmen Atmosphäre beiträgt. Es hängen hier sogar weitestgehend kitschfreie Kunstdrucke in freundlichen Farben. In diesem Nebenraum ist Platz für 80 Personen und er wird für Beerdigungen, Vereinsversammlungen und Geburtstagsfeiern genutzt.
Die Wände der eigentlichen Kneipe waren, wie ich mir sagen ließ, vor vielen Jahren auch einmal weiß angestrichen worden, aber sie haben in der ganzen Zeit die kräftige und charakteristische Farbe einer Raucherlunge angenommen. Mit dem Nikotin, das in den Tapeten konzentriert ist, könnte man eine mittelgroße Herde Nashörner sehr krank machen.
Unter der Kneipe befindet sich ein uriger niedriger Gewölbekeller, in dem man kaum aufrecht stehen kann. Überall hängen Spinnweben, der Staub liegt zentimeterdick auf allen Flächen und es ist sogar im Sommer kühl. Die Wände bestehen aus grob behauenen Steinen und lassen vermuten, wie alt das Gebäude ist. Der Keller ist also ideal um Bier und Wein zu lagern oder auch, um sich alle Knochen zu brechen, wenn man die ausgetretene uralte Treppe unvorsichtig hinauf oder herabsteigt.
Bevor ich beginne, die Gäste vorzustellen, möchte ich einige Worte über das Gastgeberehepaar verlieren. Beide sind Mitte sechzig, klein, vollschlank und wirken in jeder Hinsicht gemütlich. Sie sehen sich sogar irgendwie ähnlich, so wie sich Menschen ähnlich sehen, die viel Zeit miteinander verbracht haben. Die beiden tragen mit Vorliebe Trachten, bayerische Lodenhemden oder Dirndl, was in unserer Gegend eher befremdlich wirkt. Hier trägt ja zum Beispiel auch niemand ukrainische Pelzmützen oder die Gewänder der Massai. Naja, zumindest nicht oft. An Selbstbewusstsein und Begeisterungsfähigkeit mangelt es ihnen nicht. Sie haben eines ihrer gemeinsamen Hobbys – den Alkohol – zum Beruf gemacht. Auf eine Weise sind sie also prädestiniert für die Gasthausbranche, auf der anderen Seite ist diese Vorliebe manchmal schlecht für die Gewinnspanne. Mit der Kneipe verdienen sie sich etwas für ihren frühen Ruhestand dazu. Da ihnen das Gebäude nicht gehört, sind sie auch nicht daran interessiert, irgendeinen Finger daran zu rühren, was man an der alten und hoffnungslos nikotinverseuchten Einrichtung deutlich erkennen kann.
Die Besitzer übernehmen während der Woche abwechselnd, oft auch gemeinsam, die Mittagschicht, um dann abends zusammen vor dem Fernseher liegen zu können. Entweder schlafen sie dort früh ein oder sie rufen in der Kneipe an, um sich zu vergewissern, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht auch, um sicherzugehen, dass sie nichts Wichtiges oder Spannendes verpassen.
Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass die beiden den Punkt überschreiten, an dem sie üblicherweise mit ihrem Couchprogramm anfangen und dann, wenn dieser kurze, aber ausschlaggebende Moment vorüber ist und mehrere Weizenbier geflossen sind, kann man davon ausgehen, dass sich ein grausiges familiäres Drama abspielt, weil einer von beiden doch nach Hause will, wohingegen der andere unbedingt ausgelassen feiern möchte. Diese Abende sind besonders nervenaufreibend für alle Beteiligten. Aber dazu später mehr.
Die beiden Chefs sind stets darauf bedacht, mit ihren Bierpreisen unter oder zumindest nicht über denen des Tennisheims zu bleiben. Um konkurrenzfähig zu sein und das Tennisheim zu überbieten, werden neben der flüssigen Nahrung Hähnchen, heiße Würstchen und belegte Brötchen angeboten. Wenn es zu hohen Feiertagen ein festliches Essen gibt, ist der Andrang groß. Viele kommen und essen mit, besonders die Nachbarn. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass alles, was aufgetischt wurde, tatsächlich auch gegessen werden konnte. Die Bedienung erhält ebenfalls eine große Portion und gerne auch mehrere – umsonst, versteht sich. Meist bleibt für die gesamte Belegschaft für mehrere Wochen etwas übrig.
Diese großzügigen Mengen bringen es mit sich, dass Teile der Mahlzeiten in der kleinen Küche gelagert werden müssen, bis schließlich nach einigen Tagen alle die Nase gestrichen voll haben von Hackbraten mit Gemüse, von Kotelett mit Rotkohl oder von Schnitzel mit Kartoffeln. Die Reste verbringen viele Tage in einem eigens dafür bereitgestellten Kühlschrank. Manches Mal sind es sehr viele Tage und so kommt es, dass sich in dem Kühlschrank Lebensmittel in verschiedenen Verwesungsstadien und in den altersbedingten verdächtigen Farben befinden. Diese will verständlicherweise niemand mehr anrühren, sei es auch nur, um sie in eine Mülltonne zu befördern.
Aus perversem Interesse an bunten Farben und fremdartigen Gerüchen werfe ich ab und zu einen Blick in diesen Kühlschrank, der schließlich alle vier bis fünf Monate komplett und rücksichtslos geleert und antibakteriell behandelt wird. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass er jedes Mal versiegelt und komplett entsorgt wird. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, dass die Kneipe einen solchen Verbrauch an Kühlschränken finanziell verkraften kann.
Vor einiger Zeit fand ich einen Erdbeerjoghurt, der sein Verfallsdatum bereits fast um ein Jahr überschritten hatte. Er muss den letzten beiden radikalen Razzien durch eine List entgangen sein.
Erwähnenswert und wichtig für das Allgemeinverständnis scheint mir die vielschichtige Vereinskultur in Grimmelbach. Es gibt nicht nur den üblichen Fußball-, Tennis- und Musikverein, den die meisten Ortschaften vorweisen können. Neben diesen Standardvereinen existieren ein Angelsportverein, ein Hundesportverein, dem auch unsportliche Menschen und Hunde beitreten dürfen, ein Tischtennisverein, ein Kindergartenförderverein, ein Förderverein für den örtlichen Fußballverein, ein Gartenbauverein mit eigener Schnapsbrennerei, ein Motorradclub, ein Männerballett, ein Theaterverein für Theaterspieler und ein Theaterverein für Theaterzuschauer, ein Fastnachtsverein, ein Pensionärsverein, ein Jazzdanceverein, ein Trachtenverein, der sich jedoch teils aus Vorlieben heraus, teils aus Mangel an ortsüblichen Trachten auf Trachten aus Tirol und Bayern spezialisiert hat, ein Verein für die Ausrichtung des Pfarrfests, ein Bouleclub, ein Mütterverein, dem seit zwei Jahren auch zwei Väter angehören, ein Wanderverein, ein Schwimmverein (obwohl das Grimmelbacher Schwimmbad bereits vor circa 20 Jahren einem Neubaugebiet weichen musste), ein Skatclub, eine freiwillige Feuerwehr, ein Junggesellenverein und ein Bürgerverein, dem alle die beitreten können, die sich durch die Aktivitäten der Vereine mit speziellerem Motto nicht angesprochen fühlen. Zu guter Letzt bleibt noch die Vereinsgemeinschaft zu erwähnen. Dabei handelt es sich um einen Verein, dem die meisten der Mitglieder aller anderen Vereine angehören und, der die Aufgabe hat, die Aktivitäten der vielen Vereine zu koordinieren. So ist es jedem wie auch immer gearteten Menschen möglich, einen Verein zu finden, in den er hineinpasst.
Möglicherweise habe ich einen wichtigen Verein vergessen, wofür ich mich in aller Form entschuldigen möchte. Ich erhebe mit meiner Liste ausdrücklich nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Ich will einen Überblick geben und meine Behauptung untermauern, dass es sehr viele Vereine gibt. Faszinierend finde ich die Existenz von Vereinen, deren Zweck auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, wie zum Beispiel der Bürgerverein. Es ist ein Verein für Bürger, aber streng genommen sind alle Bewohner von Grimmelbach Bürger. Diese Bürger verbindet nur die Tatsache, dass sie alle im selben Dorf leben. Sie treffen sich einmal im Monat und unterhalten sich, wählen einmal im Jahr einen neuen Vorstand und zahlen zwei Euro pro Person und Monat. Was mit dem Geld geschieht, entscheidet die Vorstandssitzung, der mehrere Mitglieder des Kindergarten-Fördervereins angehören und so kommt es, dass in der Regel eine Hälfte des Geldes an den Kindergarten gespendet und die andere Hälfte für die Finanzierung der Vereinsfeier verwendet wird. Böse Zungen behaupten, dass der Verein sich ohne die Vereinsfeier nicht so lange hätte halten können.
Die Akzeptanz des Schwimmvereins macht mir fast noch größere Sorgen, denn in Grimmelbach kann man, wie erwähnt, nicht schwimmen. Es ist auch kein Nostalgieverein, der dem alten Schwimmbad hinterher weint, zumindest nicht nur. Der Verein mietet für drei Stunden in der Woche das Schwimmbad des Nachbarorts und hält dort eigene Kurse ab. Eine Fusion mit dem Schwimmclub des Nachbardorfes wird allerdings strikt abgelehnt. Das Sommerfest des Schwimmvereins, bei dem kleine Planschbecken auf dem Dorfplatz aufgestellt werden, ist legendär.
Der Motorradclub besteht zu circa 70 Prozent aus Motorradfahrern oder zumindest Motorradliebhabern. Die anderen 30 Prozent setzen sich aus Sympathisanten und Fans des Motorradclubfestes zusammen. Der Motorradclub wurde von der Vereinsgemeinschaft vor einigen Jahren beinahe ausgestoßen. Grund dafür waren Vorwürfe, sein hauptsächlicher Existenzgrund sei die alljährliche Vereinsfeier und diese war wegen erhöhten Alkoholkonsums des Öfteren in die Kritik geraten. Eine nicht zu vernachlässigende Anzahl junger in Leder gekleideter Menschen mit fast ebenso vielen lärmenden Motorrädern hatte teilweise Unmut erregt. Der Motorradclub, mittlerweile auch in die Jahre gekommen, erklärte sich daraufhin bereit, die Hälfte der Einnahmen an den Kindergarten zu spenden (viele der Motorradfreunde hatten mittlerweile Kinder in die Welt gesetzt und konnten daher gut mit dieser Entscheidung leben). So wurde der Motorradclub von einem Haufen Rebellen in Lederklamotten zu einem durchaus gemeinnützigen Verein, der einmal im Jahr ausnahmsweise laute Geräusche verursachen darf (zum Wohle des Kindergartens!).
Hohe Feiertage in Grimmelbach sind Ostern und Weihnachten, wie es wohl im westlichen Europa normal ist, und außerdem das Erntedankfest, das Kirchweihfest, der erste Mai, das Kindergartenfest, das bereits erwähnte Sommerfest des Schwimmvereins, das Feuerwehrfest, Fastnacht, der Barbaratag, an dem alle Mitarbeiter der Kohlebergwerke frei haben, das Fest des Musikvereins und das Amateurfußballturnier. An diesen Feiertagen und Wochenenden und den Montagen danach nehmen alle Urlaub und eine an Verzweiflung grenzende Ausgelassenheit bemächtigt sich des Dorfes.
Fast jedes Fußballspiel und jeder Geburtstag, natürlich auch Taufen, Kommunionen und Hochzeiten werden mit ähnlicher Hingabe gefeiert und begossen. Mit etwas Phantasie findet sich fast in jeder Woche eine Gelegenheit zum Feiern. In Grimmelbach ist für jeden, der etwas für Alkohol und Kneipendiskussionen übrig hat, das Leben noch lebenswert. Die Hoffnung auf ein ereignisreiches Wochenende, die selbst den schlimmsten Job überstehen lässt, wird selten enttäuscht.
Taufsonntag
An diesem schönen Sonntag im Frühling sitzt im Nebenzimmer eine große Familie in festlicher Kleidung. Sie haben ein Kind bei sich, das ungefähr ein Jahr alt sein mag und das in einem albernen, viel zu langen Spitzenkleidchen lauthals seiner Unzufriedenheit Ausdruck verleiht. Man hat den Kleinen heute Morgen auf den nicht unumstrittenen Namen Sören Malte getauft, was möglicherweise einer der Gründe für das Geschrei ist. Voller Stolz erzählt die junge Mutter jedem, dass Sören Malte das Gotteshaus mit seinem für sein zartes Alter sehr beachtlichen Organ beinahe zum Einstürzen gebracht hätte.
„Wir haben die Predigt kaum gehört, aber ich glaube, es ging um Gott oder so was“, vermutet die offensichtlich nur sehr sporadische Kirchgängerin.
Auf den Tischen thronen fast so viele Torten, wie Gäste anwesend sind. Die kleine Ashley, die etwas genervte Schwester des Störenfriedes, wird zu mir geschickt, um mir ein Stück Torte anzubieten. Wahrscheinlich sind alle froh, wenn die hyperaktive Ashley mal für eine Minute etwas anderes zu tun hat, als ihren Eltern am Rockzipfel zu ziehen. Ich habe die Auswahl zwischen Erdbeercreme, Sahnecreme, Käsecreme, Buttercreme, Schwarzwälder Kirsch und anderen nicht minder cremigen Varianten. Ashley empfiehlt mir fachmännisch die Johannisbeercreme. Die kleine Nervensäge hat, wie es ihr Körperumfang schon vermuten lässt, Geschmack; das muss ich ihr lassen.
Diese Feier im Namen von Sören Malte ist für mich ein schöner Anlass, die Kreativität der Grimmelbacher bei der Namensgebung zu erwähnen. Ich meine nicht oder nicht nur die Taufnamen der Bewohner; hier gibt es genauso viele Helmut, Rudolf, Albert, Michael, Thomas, Stefan, Susanne, Sandra und Nicole wie auch sonst überall in deutschsprachigen Gebieten. Heute heißen die jüngeren nun mit etwas Pech eben Sören, Malte, Dustin und Ashley. Besonderes Leid werden wohl die Kinder auf sich nehmen, die der Welle der amerikanischen Seifenopernnamen zum Opfer gefallen sind. Justin (gesprochen Schastinn), Shakira, Joana (Schoääna) und Jeremy (Schärrämmi) müssen sicherlich in etwa zehn Jahren eine Therapie machen, nach Amerika auswandern oder eben darauf hoffen, dass die Grimmelbacher ihres Amtes walten und den Namen irgendwann ändern. Dies geschieht normalerweise schon im Grundschulalter und wenn nicht, dann im Jugendalter nach einem besonderen Ereignis. Diese neue Namensgebung hat etwas von afrikanischen Initiationsriten. Man kann aber auch bei dieser zweiten Runde großes Pech haben. Doch mit etwas Glück muss sogar Ashley Joane Schmitt nicht den Kopf hängen lassen. Sie bekommt allemal eine zweite Chance.
Ich beobachte schon seit Langem mit Hingabe und Neugierde die allzu menschliche Angewohnheit, andere, ob nun geliebte oder störende, Menschen mit kreativen Spitznamen zu versehen. Diese Angewohnheit ist teils aus Faulheit heraus entstanden, drückt aber auch manchmal besondere Wertschätzung, Beachtung oder Verachtung aus. Der Trend zu Verniedlichungen ist weithin bekannt: Oliver wird zu Olli oder Hans wird zu Hansi. Eine solche Namensgebung zeugt nicht gerade von besonderer Spitzfindigkeit. Genauso unspektakulär und etwas liebloser die Angewohnheit, sein Gegenüber mit dem Nachnamen anzureden. Von manchen Mitmenschen kennt man den Vornamen überhaupt nicht. Auch dies findet man in Grimmelbach, aber in der Regel sind die Spitznamen deutlich ausgeklügelter.
Diese sprachlichen und sozialen Feinheiten sind in Grimmelbach viel subtiler und wesentlich ausgeprägter als im restlichen Deutschland und auch etwas ausgeprägter, als meiner Meinung nach angemessen wäre. Man trifft kaum jemanden, der bei seinem tatsächlichen Namen genannt wird, was nicht immer daran liegt, dass die Eltern einen schlechten Geschmack hatten. Ich will einige Beispiele zur Veranschaulichung meiner These anführen und diese Gelegenheit gleichzeitig nutzen, um einige meiner Hauptpersonen vorzustellen.
Einer der angenehmeren Stammgäste heißt Nero. Mit dem Namen, den seine Eltern kurz nach der Geburt für ihn ausgesucht haben, nämlich Christian, hat das offenkundig nichts zu tun. Einige Jahre lang hieß er wirklich Christian; dann wurde sein Name geändert, als er im zarten Alter von sechs Jahren eine Dokumentation über das alte Rom sah. Dieser Film hat ihn so nachhaltig beeindruckt, dass er sich Tage und Wochen lang mit nichts anderem beschäftigte. Schließlich baute er das antike Rom mit seinen Legosteinen nach. Die Eltern unterstützten seine Begeisterung für Geschichte, indem sie ihn viele weitere Dokumentationen über die alten Römer und ihre Kaiser sehen ließen und ihm kindgerechte Literatur zu dem Thema schenkten. Er legte besondere Akribie und Liebe fürs Detail an den Tag, indem er schließlich sein Lego-Rom wie im Film durch Kaiser Nero abbrannte, und zwar bis auf die Grundmauern. Leider wurde dadurch das gesamte Stockwerk in Mitleidenschaft gezogen, bevor der Brand gelöscht werden konnte. Seither sind seine Eltern sehr vorsichtig mit Dokumentarfilmen aller Art geworden und sie fanden ein besseres Versteck für die Streichhölzer.
Dann gibt es jemanden, den alle den Doktor nennen. Nicht etwa, weil er Arzt ist oder gar einen Doktortitel hat; er ist Fußballspieler und arbeitet auf einem staatlichen Amt. Wenn er abends etwas trinken will, dann bringt er sein eigenes Glas mit, was ich zu Beginn meiner Karriere in Grimmelbach als höchst eigenartig empfand, woran ich mich aber mittlerweile gewöhnt habe. Er bestellt sich Bier, das er dann in eben dieses Glas füllt. Das schmutzige Glas nimmt er am Ende des Abends wieder mit nach Hause, um es dort einem geheimnisvollen Reinigungsritual zu unterziehen. Eine Erklärung für sein höchst eigenartiges Verhalten habe ich irgendwann von einem seiner Nachbarn erhalten. Der Doktor hat Angst vor Bakterien und will daher mit nichts in Berührung kommen, was andere Menschen schon angefasst oder im schlimmsten Fall sogar mit dem Mund berührt haben. Diese ausgeprägte Phobie, deren Behandlung sicher langwierig und kostspielig wäre, macht den Doktor also zu einer der Kuriositäten, mit denen sich Kneipenangestellte abfinden müssen. Aber er ist nicht gewalttätig und der Gast ist König; also bekommt der Doktor alles, was er sich wünscht in genau dem Glas, das er für unbedenklich hält.
Es gibt des Weiteren den Gemüsemann. Kaum jemand kennt seinen richtigen Namen und ich brauchte einige Anläufe, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Er heißt Hans Erdert und war früher Metzger. Er ist etwas über 60 Jahre alt und bereits Rentner. Seit seiner Pensionierung hat er einen Gemüsehandel ausgebaut, den er schon vorher jahrzehntelangillegal in seiner Garage unterhielt. Daher der Name. Der Gemüsehandel bietet nur Produkte aus biologischem und liebevollem Eigenanbau an. Die Tatsache, dass der Name Hans so überhaupt nicht zu dem rotgesichtigen untersetzten Mann passt und dass er der einzige Metzger ist, der sich ausschließlich von Gemüse ernährt und der zudem fast nur von Gemüse spricht, provozierte geradezu eine Umbenennung. Der Gemüsemann trinkt, wie es sich für 60-Jährige gehört, vier bis sechs Flaschen lauwarmes Bier und dazu ein Glas Mirabellenschnaps. Jeden Tag. Wenn er ausnahmsweise mal einen zweiten Mirabellenschnaps zu sich nimmt, wird er melancholisch und erzählt von Frauen und Gemüsesorten, die er in seiner Jugend einmal gekannt hat. Wenn er dann übermütig wird und sogar einen dritten Schnaps trinkt, was zum Glück nur sehr selten vorkommt, weint er um seine verstorbene Mutter oder eine bestimmte Rasse von Nashörnern, die akut vom Aussterben bedroht ist.
Dann gibt es Löffel, der seit seinem sechsten Lebensjahr diesen Namen trägt. Als er eingeschult wurde, hatte er statt einer Schultüte und einem Ranzen nur einen Kaffeelöffel bei sich. Dies ist für sich genommen schon eine kleine Anekdote Wert, aber er wich auch in den kommenden vier Schuljahren nicht von dieser Angewohnheit ab. Zwar legte er sich zwangsweise einen Schulranzen mit Stiften und Heften zu, aber der Kaffeelöffel war sein ständiger Begleiter, so wie andere Kinder ein Kuscheltier oder eine Puppe bei sich hatten. Löffel heißt, glaube ich, Jörg. Er hat das in meiner Anwesenheit bisher weder bestätigt noch dementiert. Er arbeitet in einer großen Firma, die Autozubehör herstellt. Mittlerweile, wohl aus der falsch verstandenen Auffassung heraus, er sei nun erwachsen und zu alt für solche Dinge, lässt er seinen Löffel zu Hause, wenn er ausgeht. Löffel trinkt Bier aus kleinen Gläsern, es sei denn, er hat Nachtschicht, dann trinkt er zu viel Kaffee und isst zu viele Kekse. Er gehört zu den Menschen, die ihren Heimatort noch nie für mehr als einen Tag verlassen haben. Sein weitester Ausflug ging zu einem Rockkonzert in eine Stadt, die zwei Stunden mit dem Auto entfernt liegt. Aber solch aufregende Dinge macht er nur alle Schaltjahre einmal.
Tiger ist einer der eher seltenen Gäste, seinen richtigen Namen kenne ich leider auch nicht. Er ist Mitte 30, und wenn er mal erscheint, dann schüttet er sehr viel Whisky in sich hinein, was meistens mit dem Kopf auf der Theke, zwei Stunden wenig erholsamem Schlaf, Druckstellen auf der Stirn und einer gehörigen Portion Kopfschmerzen endet. Seine Namensgebung geht darauf zurück, dass er in der Grundschule zu den weniger beliebten Kindern gehört hat. Seine reizenden Mitschüler haben ihn einmal im Sommer vor aller Augen auf dem Pausenhof ausgezogen und seine Kleider versteckt. Kinder sind grausam. Grausam waren in den 80ern aber auch Tigers Eltern, die ihm eine Unterhose mit Tigerfellmuster angezogen haben oder die ihm dies zumindest nicht streng genug verboten hatten. In seiner Jugendzeit startete er einen Versuch, sich mit seinem Namen etwas besser anzufreunden und das Tigerimage cooler zu gestalten. Da er an dem Namen Tiger nichts mehr ändern konnte, stattete er seinen Mopedsattel mit einem Tigerfellüberzug aus, damit Menschen, die ihn neu kennenlernten, seinen Spitznamen drauf zurückführen konnten. Das Trauma scheint er mittlerweile überwunden zu haben. Sein Beliebtheitsgrad hat sich im Vergleich zur Grundschulzeit deutlich gesteigert.