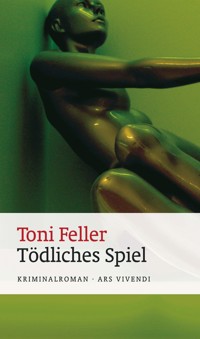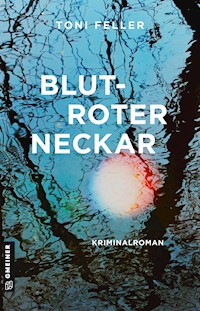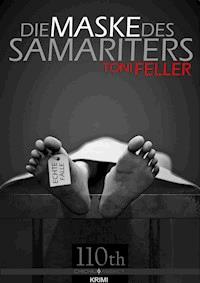Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biografien im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein Bankräuber versteckt seine Beute an einem delikaten Ort. Ein Kleinkrimineller liegt tot im Garten seiner Eltern. Eine Frau erteilt den Auftrag, ihren Ehemann zu ermorden. - Die spannendsten und tragischsten Fälle schreibt das Leben immer noch selbst. Empathisch und hautnah erzählt der Kriminalbeamte und Mordermittler a. D. Toni Feller von seinen erschütterndsten und bewegendsten Kriminalfällen und lässt seine Leser tief in die Arbeit von Polizei und Justiz blicken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni Feller
Im Dienst der Gerechtigkeit
Meine spektakulärsten Kriminalfälle
Impressum
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung von BookaBook, der Literarischen Agentur Elmar Klupsch, Stuttgart
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Isabell Michelberger
Redaktion: Anja Sandmann
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: Susanne Lutz
unter Verwendung eines Fotos von © Christian Cambeis, Germersheim
ISBN 978-3-8392-6348-8
Widmung
Dieses Buch widme ich allen Opfern von Gewaltverbrechen. Den lebenden und den toten.
Inhalt
Impressum
Widmung
Inhalt
Vorwort
Taubentod
Der Kinderschänder
Die Entführung eines Hochwürden
Das Allerschlimmste
Keinen einzigen stichhaltigen Beweis
Acht Stiche im Rücken
Schwulenmord
Entführung und Vergewaltigung
Skrupellos
Das kuriose Versteck eines Bankräubers
Am helllichten Tag
Die verschwundene Leiche
Das Grauen am Aschermittwoch
Die blinde Tote
Vergewaltigung im Knast
Silber brach ihm das Genick
Die Joggerin
Sie hassten und sie liebten sich
Tötung auf Verlangen
Geiseldrama
Die sieben Leben der Saskia Braun
Vorwort
Bis zu meiner Pensionierung war ich Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Meine Tätigkeit erstreckte sich auf die Bearbeitung und Aufklärung schwerer Gewalt- und Sexualdelikte sowie Todes- und Brandermittlungen. Parallel hierzu war ich Mitglied der Mord- und Sonderkommission Geiselnahme. In der sogenannten Verhandlungsgruppe war ich als Sprecher ausgebildet.
Dieses Buch ist das dritte Werk mit spektakulären, authentischen Kriminalfällen, die ich selbst bearbeitet oder an deren Aufklärung ich maßgeblich beteiligt war.
Wie bei den vorherigen Büchern habe ich aus datenschutzrechtlichen Gründen Datum, Orte und Namen – mit wenigen Ausnahmen – abgeändert oder erst gar nicht erwähnt, um beteiligte Personen durch die Veröffentlichung vor Nachteilen zu schützen.
Im Hinblick auf eine mögliche Publizierung der geschilderten Fälle hatte ich mir jeweils zeitnah stichwortartige Notizen gemacht, auf die ich beim Verfassen des Werkes dankbar zurückgreifen konnte. Viele Begebenheiten waren mir auch noch sehr gut in Erinnerung.
Der eine oder andere mag beim Lesen vielleicht zu der Auffassung kommen, ich würde mich als der einzige und wahre Topermittler des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervortun wollen. Das wäre ein Trugschluss. Ich lernte während meiner Dienstzeit ganz viele Polizisten kennen, die mindestens genauso gute oder noch bessere Arbeit ablieferten als ich. Aber es kreuzten auch einige wenige Beamte meinen Weg, die stinkefaul waren und sich ständig beschwerten, dass sie nicht befördert oder dass sie zu wenig Geld verdienen würden. Manche brachten es fertig, sich jahraus und jahrein von jedweder Arbeit erfolgreich zu drücken, plusterten sich aber auf, wenn sie dann doch einmal die Ärmel hochkrempeln mussten.
Im Text ist immer wieder von Kollegen die Rede. Natürlich gab es auch unzählige Kolleginnen, die den männlichen Mitstreitern in nichts nachstanden. Nur der Einfachheit wegen habe ich mich auf die männliche Variante beschränkt.
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei allen zu bedanken, die mich direkt oder indirekt motivierten, dieses Buch zu schreiben.
Besonderer Dank an Petra Neubert, Dieter Langer, Ulrike Haupt und Doris Gengel. Mit ihnen habe ich zu verschiedenen Zeiten Büros geteilt und sehr erfolgreich zusammengearbeitet.
Ulrike und mich nannte man das »Dream-Team«. Wir konnten unglaubliche Erfolge in Bezug auf Banküberfälle und schwere Sexualstraftaten verbuchen. Die bloße Missgunst eines anderen riss uns schließlich auseinander.
Danke an alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir bei der Verbrechensbekämpfung an einem Strang zogen.
Besonderen Dank gilt Herrn Oberstaatsanwalt Armbrust und vielen seiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jahrzehntelang stets in vorbildlicher und äußerst angenehmer Weise zusammenarbeiten durfte.
Ein herzliches Dankschön an die Meinen. Sie waren mir immer Stütze und Halt. Nur durch sie war es möglich, die ungeheuren psychischen Belastungen, die der Dienst sehr oft mit sich brachte, auszuhalten.
Danke auch an meinen Literaturagenten Elmar Klupsch, der mich motivierte, ein weiteres Buch mit authentischen Kriminalfällen zu schreiben.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass ich längst denen verziehen habe, die mir aus Neid auf meine Erfolge Knüppel zwischen die Beine warfen und meine Ermittlungen heimlich torpedierten.
Verziehen habe ich auch jenem unfassbar faulen Staatsanwalt, der sich trotz meines bestens begründeten Haftbefehlsantrages vehement weigerte, einen gefährlichen Vergewaltiger in Untersuchungshaft zu schicken, was zur Folge hatte, dass das 65-jährige, hilfsbedürftige Opfer seine Wohnung aufgeben und aus der Stadt wegziehen musste. Der freigelassene Täter wohnte nämlich direkt neben der gepeinigten Frau. Erinnern Sie sich noch, Herr Staatsanwalt? Einige Kollegen hatten sich bereits über Sie beschwert. Meine schriftliche Eingabe gegen Sie brachte das Fass zum Überlaufen. Sie wurden daraufhin zu einer anderen Behörde versetzt. Ich hoffe, Sie dadurch wenigstens zum Nachdenken gebracht zu haben.
Taubentod
Es ist bereits weit nach Mitternacht, als Konstantin Müller schon zum fünften Mal versucht, seinen zwei Jahre jüngeren Bruder telefonisch zu erreichen. Viktor nimmt wieder nicht ab. Wo steckt er nur? Normalerweise ist er um diese Zeit längst zu Hause. Die beiden Brüder wohnen noch in der Wohnung ihrer Mutter, die schon längst schlafen gegangen ist.
Vielleicht liegt er zugekifft irgendwo herum? Schon vor Monaten ertappte Konstantin den Heißsporn beim Haschen. Seitdem hat sich Viktor immer stärker zu seinem Nachteil verändert. Er wurde launischer, aggressiver und kümmerte sich um nichts mehr. Auch auf sein Äußeres achtet er weniger. Hinzu kommt der Umgang mit seinen neuen Freunden, die Konstantin gar nicht gefallen. Er befürchtet, Viktor könnte in den Sumpf von Drogensüchtigen abgleiten. Dann würde es schwer werden, ihn da wieder herauszuziehen. Aus diesem Grund wirft Konstantin stets ein Auge auf seinen Bruder, der jedoch auf die Ermahnungen des Älteren nicht hört. Ganz im Gegenteil! Viktor kifft nicht nur, er dealt auch. Zunächst nur, um sich das Geld für den Stoff zu verdienen, dann aber auch, um gute Geschäfte zu machen.
Die deutschrussische Familie lebt in einem Außenbezirk von Karlsruhe. Der Vater ist verstorben. Während die Tochter bei einem Freund wohnt, genießen die beiden Brüder immer noch die Vorzüge im Hotel Mama. Die Mutter weiß nichts von Viktors Sucht. Um ihr diese Sorgen weiterhin zu ersparen, will Konstantin seinen Bruder nicht verraten.
Es ist zwei Uhr in der Nacht, als Konstantin beschließt, seinen Bruder zu suchen. Zuerst fährt er zu Viktors Stammlokal, das aber schon geschlossen hat. Anschließend fährt er zum familieneigenen Schrebergarten, in dem sich Viktor mit seinen neuen Freunden in der jüngsten Vergangenheit auffallend oft aufhält. Konstantin ist sich sicher, dass die Jungs dort kiffen. Spritzen fand er zum Glück noch keine. Dann hätte er nämlich andere Seiten aufgezogen. Hätte dem Jüngeren ordentlich die Leviten gelesen, obwohl dieser ja schon 21 Jahre alt ist und sich von ihm nichts mehr vorschreiben lassen muss.
Als Konstantin die Gartenanlage betritt, überkommt ihn ein komisches Gefühl. Später sagt er aus, er habe gleich so etwas geahnt.
Im Schein seiner Taschenlampe geht er auf dem schmalen Pfad bis zum etwa 30 Meter entfernten Geräteschuppen. Mehrfach ruft er Viktors Namen. Keine Antwort. Es ist eine stockdunkle, kalte Nacht. Konstantin fröstelt. Er richtet den Lichtstrahl auf die Gartenlaube. Die Tür steht sperrangelweit offen. Ungewöhnlich, denkt er. Er leuchtet ins Innere. Seine Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt. Nichts Auffälliges. Ein Stein fällt ihm vom Herzen. Er macht die Tür zu und will den Riegel vorschieben. Dann sieht er, dass an dem Vorhängeschloss Viktors Schlüsselbund hängt.
»Viktor«, ruft er nochmal laut. Aber er erhält wieder keine Antwort. Er leuchtet die Umgebung ab. Der Lichtstrahl fällt zuerst auf eine schmutzige Hand, die sich in die feuchte Erde krallt. Konstantin erschrickt so sehr, dass er einen Schrei ausstößt und einen Schritt zurückweicht. Langsam fängt er sich. Er leuchtet wieder in die Richtung. Hier liegt ein Mensch bäuchlings in einem Gemüsebeet. Obwohl er das mit Erde teilweise bedeckte Gesicht nur von der Seite sehen kann und die Kleidung stark verschmutzt ist, erkennt Konstantin sofort seinen Bruder. Mit einem Satz ist er bei ihm. Er lässt die Taschenlampe fallen und bückt sich hinunter. Mit einigem Kraftaufwand dreht er Viktor auf den Rücken, hebt seinen Oberkörper hoch und schüttelt ihn. »Viktor, Viktor«, schreit er verzweifelt. Er sagt später aus, er habe nicht gemerkt, dass bei Viktor bereits die Leichenstarre eingetreten ist.
Als sein Bruder kein Lebenszeichen von sich gibt, lässt er ihn wieder auf den Boden sinken, nimmt die Taschenlampe und leuchtet ihm ins Gesicht. Er sieht in Viktors gebrochene Augen. Erst jetzt wird ihm klar, dass seinem Bruder nicht mehr zu helfen ist.
Konstantin kann die Tränen nicht unterdrücken. Er schluchzt hemmungslos. Irgendwann fasst er sich und ruft die Schwester an, um sie um Rat zu bitten. Sie kommen überein, sofort die Polizei zu verständigen und die Mutter zunächst nicht zu informieren.
»Die Spurenlage ist eindeutig«, sagte der Kriminaltechniker, der mit mehreren Scheinwerfern den Tatort in helles Licht getaucht hatte. »Hier muss ein heftiger Kampf stattgefunden haben. Das ganze Gemüsebeet ist zertrampelt. Viele Spinatpflanzen sind herausgerissen. Er muss sich bis zum bitteren Ende gewehrt haben. Sieh nur, auch an dem Johannisbeerstrauch sind einige Äste abgerissen. Vermutlich wollte er sich an ihnen hochziehen und flüchten. Er muss furchtbar gelitten haben, bis er starb.«
»Der Polizeivertragsarzt müsste jeden Augenblick eintreffen«, brummte Kriminalhauptmeister Lohe vom Kriminaldauerdienst (KDD).
»Bis dahin werde ich genügend Fotos von der Leiche und dem Umfeld gemacht haben. Es sind einige Schuhspuren zu sehen, die ich mit Gips ausformen muss. Das dauert aber. Die Leiche legen wir zur Untersuchung am besten auf den freien Platz vor der Hütte.«
Inzwischen war bei Viktor Müller die Leichenstarre am gesamten Körper voll ausgeprägt. Es ist immer schwierig, einen Leichnam zu entkleiden, wenn sich Arme und Beine nicht mehr bewegen lassen. Ein Toter fühlt sich dann so steif an, als ob er tiefgefroren wäre. Deshalb entschied sich Lohe in Absprache mit dem Arzt dafür, bei dem Toten nur grob nach Verletzungen zu schauen und ihn danach sofort zur Gerichtsmedizin nach Heidelberg bringen zu lassen.
Weder der Arzt noch Kriminalhauptmeister Lohe konnten bei der Leiche irgendwelche Hinweise auf die Todesursache finden. Die Schädeldecke war vollständig intakt. Am entblößten Oberkörper, den Händen und im Gesicht waren keinerlei Verletzungen zu sehen. Nicht einmal eine winzige Blutspur.
»Konstantin Müller sagte, sein Bruder sei Rauschgiftkonsument gewesen. Vielleicht hat er sich den goldenen Schuss verpasst.«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Dann gäbe es keine Kampfspuren im Gemüsebeet.
Lohe schob bei dem Toten beide Ärmel des Pullovers hoch. »Nichts! Auch keine alten Einstiche.«
»Hier ist ein Gewehr«, rief einer der Kriminaltechniker.
»Wo«, antwortete Lohe erstaunt, denn er hatte sich zuvor schon etwas umgeschaut und nichts dergleichen gesehen.
»Es ist hinter der Mülltonne versteckt. Komm her, ich zeig es dir, bevor wir es fotografieren und sichern.«
Das Gewehr lehnte, mit dem Kolben auf dem Boden, hinter einer grauen Mülltonne in einer Ecke vor dem Gartenhaus.
»Hhm, das könnte die Tatwaffe sein«, stieß Lohe nachdenkend hervor.
»Dann hat sie der Täter aber nicht besonders gut versteckt. Und warum hat er sie nicht einfach mitgenommen«, rätselte der Kriminaltechniker.
»Ist ja kein Geheimnis, dass die bösen Buben manchmal total irrationale Dinge tun, wenn sie im Stress sind. Und ein Mord zu begehen bedeutet in aller Regel Stress pur. Selbst für abgebrühte Gangster.«
Der KT-Mann runzelte die Stirn. »Habt ihr schon die Leichenschau gemacht?«
»Waren gerade dabei, als du mich gerufen hast. Aber wir haben bis jetzt keine Schusswunde bei dem Toten ausmachen können.«
Kriminalhauptmeister Lohe und der Arzt untersuchten den Leichnam nun doch genauer. Wegen der Leichenstarre mussten sie Teile der Kleidung mit einer Schere aufschneiden. Doch so sehr sie sich auch Mühe gaben, sie fanden kein Einschussloch und auch kein Blut.
Bei der Waffe handelte es sich um ein einschüssiges Repetiergewehr vom Kaliber 5,6 Millimeter Long Rifle. Im Patronenlager steckte eine entsprechende Hülse. Der Kriminaltechniker roch an der Mündung und stellte fest, dass mit der Langwaffe vor nicht allzu langer Zeit geschossen wurde.
Lohe kratzte sich hinter dem Ohr. »Ein Gewehr, eine abgeschossene Patrone, ein Toter, aber kein Einschuss. Was soll man davon halten? Bin gespannt, was die vom Fachdezernat daraus machen.«
Zur Erläuterung sei gesagt, dass Lohe beim Kriminaldauerdienst arbeitete. Diese Einrichtung ist quasi die Feuerwehr der Kriminalpolizei. Die Beamten machen den sogenannten ersten Angriff. Das heißt sie führen die ersten notwendigen und vor allem nicht aufschiebbaren Ermittlungen durch. Danach geben sie den Fall in Form einer Akte so schnell wie möglich an das jeweilige Fachdezernat weiter.
Weil ich an diesem Tag einen seitenlangen Schlussbericht zu einem schrecklichen Kindesmissbrauch schreiben wollte, war ich früher als sonst auf der Dienststelle. Gerade hatte ich meine Jacke in den Schrank gehängt, als mein Chef im Türrahmen erschien. »Sag mal, du kennst dich doch mit Schusswaffen bestens aus, oder?«
Er hätte wenigstens Guten Morgen sagen können, dachte ich. Deshalb erwiderte ich in betont herzlicher Art: »Guten Morgen, Chef. Wünsche gut geruht zu haben!« Ich sah die dünne Akte in seiner Hand und wusste, die würde gleich zu mir überwechseln.
»Sehr interessanter Fall.« Er streckte mir die paar zusammengehefteten Blätter entgegen. »Lese dich bitte mal ein, und anschließend sprechen wir darüber, okay?«
Eine wirklich sonderbare Geschichte. Beim Lesen schossen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Junge Menschen sterben nicht so leicht, ohne Verletzungen zu haben. Warum waren an der Leiche keine Spuren von Gewalt zu sehen? Ich sah mir die Fotos des Tatortes an. Zweifellos hatte hier ein Kampf auf Leben und Tod stattgefunden. Während ich noch grübelte, klingelte mein Telefon.
»Die Gerichtsmedizin«, hörte ich unsere Sekretärin sagen. »Moment, ich stelle durch.«
»Professor Barth«, meldete sich mein Gegenüber. Ich kannte den Pathologen von früheren Obduktionen. Er war eine Koryphäe auf seinem Gebiet und kam gleich zur Sache.
»Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ihr Toter hat eine Kugel im Kopf«, sagte er lakonisch. »Wir haben es eben beim routinemäßigen Röntgen festgestellt.«
»Das ist ja ein Hammer! Sind Sie sicher«, rutschte mir heraus. Eine dämlichere Frage hätte ich nicht stellen können.
»Absolut!«
»Aber weder der Arzt noch die Kollegen vom KDD haben Verletzungen, geschweige denn eine Schusswunde bei der Leiche gesehen.«
»Das ist leicht erklärbar. Am besten Sie schauen es sich selbst an, bevor wir mit der Leichenöffnung beginnen. Ich warte solange.«
Mein Chef runzelte die Stirn, als ich ihm von der Neuigkeit berichtete. »Das ist ein Fall für die Mordkommission.«
Ich war neben meiner Tätigkeit als Ermittler für schwere Gewaltdelikte schon viele Jahre Mitglied der Mordkommission (Moko) und stimmte ihm zu.
Die Moko bestand beim Polizeipräsidium Karlsruhe aus mindestens 28 BeamtInnen aus allen Dezernatsbereichen und wurde nur bei Tötungsdelikten mit unbekannten Tätern aufgerufen. Je nach Schwierigkeit des Falles konnte sie beliebig aufgestockt werden. Bei der Entführung und Ermordung eines Kindes wurden einmal über 300 Polizisten in die Sonderkommission einberufen. Nur so konnte der riesige Berg von Arbeit bewältigt und der Täter schließlich gefasst werden.
Da ich wusste, mit welch großen Umständen der Einsatz einer Moko verbunden war, machte ich den Vorschlag, das Ergebnis der Obduktion abzuwarten. Der Dezernatsleiter war damit einverstanden.
Zusammen mit einem Fotografen der Kriminaltechnik fuhr ich eiligst zum Gerichtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik Heidelberg. Während der Fahrt versuchte ich die Erinnerungen an vergangene Obduktionen zu verdrängen. Es war insbesondere der Geruch des Todes, der mir regelmäßig und heftig zu schaffen machte. Egal wie lange ein Mensch tot war, er roch von der ersten Minute an. Jedenfalls nahm ich das so wahr. Je länger der Todeszeitpunkt zurücklag, desto mehr roch er. Einmal wurde ich zu einer Leiche gerufen, deren furchtbarer Geruch vom Dachfenster eines dreistöckigen Hauses bis auf die 20 Meter entfernte Straße in einer solchen Intensität strömte, dass ich mich fast übergeben hätte.
Bei Obduktionen ist der Gestank für mich nahezu unerträglich. Insbesondere in dem Moment, wenn bei der Leiche der Bauchraum geöffnet wird. Einmal habe ich mit einem parfümbestäubten Taschentuch versucht, den Würgereiz zu unterdrücken. Das eklige Gemisch aus Parfüm und Leichengeruch krallte sich drei Tage lang in meinen Mund- und Nasenschleimhäuten fest, sodass ich kaum etwas essen und trinken konnte.
Andererseits war eine Obduktion für mich hochinteressant und meist sehr spannend, wenn sich der Obduzent langsam an die Todesursache herantastete. Wie würde es dieses Mal ablaufen?
Die Leiche von Viktor Müller lag bereits auf dem Obduktionstisch. Sie war mit einem blauen Tuch abgedeckt.
Professor Barth zog seine Handschuhe an. »Na, dann wollen wir mal.« Er diktierte Datum, Uhrzeit, Namen des Verstorbenen, die Beschreibung der Leiche und jeden seiner nun folgenden Schritte in ein kleines Aufnahmegerät. Der KT-Beamte machte fleißig Fotos.
Der Assistent von Professor Barth nahm das Tuch von dem Toten. Viktor Müller war noch bekleidet. Man hatte ihm offenbar nach der nächtlichen Leichenschau die Kleider wieder übergestreift.
»Schauen Sie sich sein Gesicht genau an und sagen Sie mir, was Ihnen auffällt«, forderte mich der Professor auf.
Ich zog Einmalhandschuhe an und machte mich fachmännisch ans Werk. Es fiel mir nicht leicht, in das blassgelbe Antlitz zu schauen. Mein Gott, wie jung er noch ist, dachte ich. An Wangen und Stirn sah ich leichte Erdantragungen. Sonst fiel mir nichts auf. Ich zog die halb geöffneten Augenlider auseinander. Nichts Auffälliges. Dann sah ich mir die Schläfen an und tastete sie ohne Ergebnis ab. Zuletzt schaute ich mir Nase und Mund genauestens an. Ich wollte mir als Leichensachbearbeiter keine Blöße geben. Aber so sehr ich mich bemühte, konnte ich kein Einschussloch erkennen.
Ich schaute Professor Barth fragend an. »Der Einschuss ist am Hinterkopf, stimmt’s?«
Der Obduzent lächelte, ging zum Röntgenbildbetrachter und schaltete ihn ein. Auf dem festgeklemmten Röntgenbild konnte ich deutlich das Geschoss im Mittelhirn des Toten ausmachen. Ich hatte mich in einem früheren Fall einmal mit dem Thema befasst und noch in Erinnerung, dass das Mittelhirn, medizinisch Mesencephalon genannt, für die Weiterleitung motorischer und sensorischer Impulse zuständig ist. Bei Verletzungen oder Erkrankung dieser Hirnstruktur können starkes Zittern, Steifheit oder unkontrollierte, krampfartige Bewegungen beim Betroffenen auftreten.
Wenn ich davon ausging, dass Viktor Müller bei Schussabgabe aufrecht stand, war das Geschoss in einem Winkel von circa 45 Grad von unten nach oben ins Gehirn eingedrungen. Das konnte ich auf dem Röntgenbild deutlich sehen.
»Unglaublich«, stieß ich hervor. »Wo ist das Einschussloch? Ich sehe keines.«
»Zugegeben, ich habe mich auch täuschen lassen«, beruhigte mich Professor Barth. »Man lernt eben nie aus.«
Er zeigte mit einer spitzen Pinzette auf ein kleines, unscheinbares Muttermal, links neben der Nasenwurzel.
»Hier ist das Geschoss eingedrungen.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Und wo ist das Blut, wo die Hautverletzung?«
»Die hat es in der üblichen Form nie gegeben. Nach dem Eindringen der Kugel hat sich die Oberhaut sofort reflexartig zusammengezogen. Was Sie hier als kleines Muttermal sehen, ist ein Blutpfropfen, der sich unmittelbar unter der Haut bildete.«
»Das konnten der Arzt und Kriminalhauptmeister Lohe unmöglich erkennen.«
»Da stimme ich Ihnen zu. Wenn wir die Leiche nicht geröntgt hätten, wäre uns das auch nicht aufgefallen. Aber spätestens bei der Sektion des Gehirns hätten wir die Kugel gefunden.«
Vorsichtig und mit aller Akribie führte Professor Barth einen langen, dünnen Edelstahlstift in das Einschussloch ein, bis er auf das Projektil stieß. Danach maß er den Eindringwinkel und die Länge des Geschosskanals. Der ganze Vorgang wurde sowohl protokollarisch als auch fotografisch festgehalten.
Anschließend entkleidete der Assistent die Leiche vollständig. Nach gründlicher Begutachtung stellte Professor Barth fest, dass Viktor Müller keine weiteren Verletzungen hatte.
Es war jedes Mal irgendwie anders. Aber immer musste ich mit aufkommender Übelkeit kämpfen. Bei dieser Obduktion setzte mir der Moment am meisten zu, als Professor Barth die Kopfhaut an der Leiche abzog und mit der Hochfrequenzsäge die Schädeldecke rundherum etwa zwei Zentimeter über den Augenbrauen mit einem dünnen Schnitt auftrennte, bis er den oberen Teil des Schädels abheben konnte. Das laute, giftige Summen der Säge und das knirschende Geräusch vom Durchtrennen der Knochensubstanz fuhren mir durch Mark und Bein.
»Das ist das Corpus Delicti, meine Herrn!« Professor Barth pulte das Projektil mit einer Pinzette aus der aufgeschnittenen Hirnmasse heraus und legte es in eine kleine, silberne Schüssel. Ich erkannte sofort, dass es sich um ein 5,6 Millimeter Kleinkalibergeschoss handelte. Daraus folgerte ich, dass das hinter der Mülltonne versteckte Gewehr mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tatwaffe war.
Bevor wir uns auf den Heimweg machten, informierte ich den Dezernatsleiter über das Obduktionsergebnis.
»Hier ist die Hölle los«, stieß er hastig hervor. »Die Angehörigen des Toten machen gehörig Druck. Sie sind fest davon überzeugt, dass Viktor Müller von einem bestimmten Konkurrenten aus der Rauschgiftszene umgebracht wurde. Da sind schon Verwandte unterwegs, die den Verdächtigen suchen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn die jetzt noch erfahren, dass ihr Angehöriger durch eine Kugel gestorben ist, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Dann gibt es Mord und Totschlag.«
»Wir müssen unter allen Umständen so schnell wie möglich herausfinden, von wem die Waffe stammt. Sie ist der Schlüssel zur Aufklärung der Tat«, antwortete ich. »Befragt schon mal den Bruder und die Freunde des Toten, von wem das Gewehr stammen könnte. Wir müssen auch die Rauschgiftszene aufmischen. Ich bin sicher, dass wir da weiterkommen. Bestimmt befinden sich Finger- oder DNA-Spuren auf der Waffe, mit denen wir den Täter überführen können.«
»Aber das kann dauern. Meinst du, wir sollten nicht besser die Mordkommission aufrufen?«
»Ich glaube, der Täter ist ein Dilettant. Den kriegen wir auch ohne Moko.«
»Dein Wort in Gottes Ohr.«
Auf der Heimfahrt ließ ich nochmal alle Erkenntnisse Revue passieren. Unter anderem sah ich die Fotos des Gewehres vor mir. Plötzlich kam mir ein bestimmter Verdacht. Ich griff zum Handy und rief den Kriminaltechniker an, der die Waffe hinter der Mülltonne entdeckt hatte.
»Kannst du mit dem Gewehr in einer halben Stunde am Tatort sein?«
»Klar, kann ich. Aber was hast du vor?«
»Das sage ich dir, wenn wir vor Ort sind.«
Noch bevor wir den Schrebergarten erreichten, rief mich der Dezernatsleiter an und teilte mit, Konstantin Müller habe nach Vorlage diverser Fotos ausgesagt, dass die Waffe Viktor gehörte. Er habe damit auf Tauben geschossen, die in den Gemüsebeeten Nahrung suchten. Das Gewehr habe er sich vor längerer Zeit auf dem Schwarzmarkt besorgt.
Das passte zu meinen Überlegungen. Jetzt musste nur noch die kleine Rekonstruktion funktionieren, die ich mit der Waffe vorhatte.
Ich ließ den Kollegen der Kriminaltechnik anhand der von ihm aufgenommenen Bilder das Gewehr und die Mülltonne genauso in die Ecke stellen, wie er die beiden Gegenstände vorgefunden hatte. Den anderen bat ich, möglichst viele Aufnahmen von der Aktion zu machen. Zuvor repetierte ich die Schusswaffe, sodass der Schlagbolzen gespannt war. Es befand sich natürlich keine Patrone im Patronenlager.
Danach trat ich ein paar Schritte zurück. »Diese verfluchten Tauben sind wieder im Anflug«, zischte ich und zeigte theatralisch zum Himmel. »Na warte!«
»Ich sehe keine«, bemerkte der eine Kollege.
»Knalltüte«, antwortete ich. »Das ist eine Rekonstruktion, wenn du es noch nicht gemerkt hast.«
Ich ging zur Mülltonne und holte das dahinterstehende Gewehr hervor. Dazu musste ich meinem Oberkörper etwas hinunterbeugen. Damit hatte ich den Schusswinkel erreicht, den Professor Barth bei der Obduktion gemessen hatte. Ich zog am Lauf der Waffe. In diesem Moment streifte ich mit dem Abzug des Gewehres an der Mülltonne entlang. Das metallische Klicken des ausgelösten Schlagbolzens war deutlich zu hören.
Nun war ich mir sicher, dass Viktor Müller nicht durch einen gemeinen Mord, sondern durch einen von ihm selbst verschuldeten Unfall ums Leben gekommen war. Wie sein Bruder noch am gleichen Tag aussagte, hatte Viktor Wochen zuvor den kleinen Bügel, der den Abzug vor unabsichtlichen Berührungen schützte, aus unerfindlichen Gründen abmontiert. Das war das tödliche Verhängnis.
Ich rief Professor Barth an und fragte ihn, wie lange Viktor Müller noch gelebt haben könnte, nachdem das Projektil in sein Gehirn eingedrungen war.
»Das ist schwer zu sagen. In der Literatur wird von Fällen berichtet, in denen Patienten mit solchen Schussverletzungen noch Stunden oder gar Tage lebten. Es kommt darauf an, welche Zellen wirklich verletzt wurden.«
»Ich vermute, dass Viktor Müller das Gewehr losließ, nachdem er getroffen war. Dann wankte er zurück und kam im Gemüsebeet zu Fall. In einem fürchterlichen Todeskampf wälzte er sich auf dem Boden und versuchte, sich überall festzukrallen, bis er endlich starb. Könnte ich da richtig liegen, Herr Professor?«
»Nach allem, was wir jetzt wissen, treffen Sie damit ins Schwarze. Genauso muss es gewesen sein.«
Es war eine gehörige Portion Überzeugungsarbeit notwendig, den Angehörigen und Verwandten plausibel zu erklären, wie Viktor Müller ums Leben gekommen war. Das Ergebnis der Rekonstruktion sicherte ich natürlich noch durch die Auswertung der Spuren an der Waffe ab.
Der Kinderschänder
»Sie haben einen Kinderschänder festgenommen und bringen ihn gleich hierher. Das Opfer ist in der Klinik. Kümmere dich mal um die Geschichte.«
Ich atmete tief durch, weil ich eigentlich überhaupt keine Zeit hatte und in diesen Tagen an 14 Fällen parallel arbeitete. »Warum ich? Kann das nicht ein anderer übernehmen?« Ich konnte nicht umhin, meinem Chef einen vorwurfsvollen Blick zuzuwerfen. Er hob beide Hände entschuldigend hoch, bevor er sich umdrehte und ohne weiteren Kommentar mein Büro verließ.
Meine Schläfen mit den Fingerkuppen reibend saß ich da und überlegte mal wieder, was bei Sexualdelikten zu tun ist, bei denen Kinder die Opfer sind.
Ich durfte nicht den gleichen Fehler machen, der mir schon einmal zu Beginn meiner Tätigkeit als Sexualsachbearbeiter unterlaufen war, schoss es mir durch den Kopf. Damals hatte ich in der Vernehmung nach zehn Minuten dem Täter in seine picklige Visage geschleudert, was für ein Schwein er sei und dass man Menschen wie ihn lebenslang wegsperren müsse. Nur mit Mühe hatte ich mich beherrschen können, ihm keine reinzuhauen. Das Verhör war damit natürlich beendet gewesen. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt, mich unverschämt angegrinst und kein Wort mehr gesagt.
Ich muss dieses Mal die Nerven behalten, dachte ich. Mich auf jeden Fall am Riemen reißen, egal unter welchem Arbeitsdruck ich momentan stehe und was für ein Typ diese Drecksau ist. Mir war klar, dass ich bei der Vernehmung des Täters wieder an den bewussten Punkt kommen würde. Was auch passieren sollte, ich nahm mir fest vor, meinen obersten Grundsatz nicht aus den Augen zu verlieren: Ganz gleich welch furchtbares Verbrechen ein Mensch begangen hat, er ist und bleibt immer noch ein Mensch.
Einziges Ziel musste es sein, den Täter zu einem Geständnis zu bewegen. Wenn überhaupt, bestand nur so die Möglichkeit, dem Opfer eine peinliche Befragung vor Gericht zu ersparen. Es vor den Angriffen eines schmierigen Winkeladvokaten zu schützen. Das Geständnis musste umfassend sein. Das heißt, ich musste tief in den subjektiven Bereich des Tatgeschehens eindringen. Staatsanwalt und Richter mussten später in dem Vernehmungsprotokoll klipp und klar die Gründe finden, die den Mann dazu gebracht hatten, ein Kind sexuell zu missbrauchen. Nur so konnte ein gerechtes Urteil gefällt werden.
In solchen Fällen ist es nicht schwer, die sogenannten objektiven Tatbestandsmerkmale zu ermitteln. Verletzungen, Sperma, Blut, zerrissene Kleidung, Zeugenaussagen sind Dinge, die die Tat belegen, nicht aber das Motiv erklären. Es gibt viele Kollegen, die die Meinung vertreten, die Polizei sollte eben nur diese objektiven Merkmale einer Tat beleuchten. Ausschließlich dem Gericht und den Gutachtern sei es vorbehalten, über die Psyche des Täters und über sein Motiv Nachforschungen anzustellen. Ich habe Staatsanwälte erlebt, die mir nahelegen wollten, ich solle mir nicht anmaßen, in meinen Berichten Bewertungen über die möglichen Beweggründe einer Tat abzugeben.
Einen Staatsanwalt fragte ich daraufhin, ob er sich dann selbst die Mühe machen wolle, den Täter unmittelbar nach dem Begehen seines Verbrechens eindringlich zu vernehmen. Und nicht erst ein Jahr später vor Gericht, nachdem der Angeklagte von seinem Rechtsanwalt dazu gebracht wurde, die Aussage zu verweigern oder sich mit elenden Lügen herauszureden. Er schaute mich entgeistert an und meinte, dazu hätte er keine Zeit. Das sei schließlich Aufgabe der Polizei. »Dann sind wir uns ja einig«, antwortete ich mit einem Lächeln auf den Lippen.
Zlatko Barics Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Die beiden Kollegen der Schutzpolizei hielten ihn zusätzlich an den Oberarmen fest. Ich war mir nicht sicher, ob sie auf diese Weise seine Flucht verhindern wollten oder ob sie ihn stützten, damit er sich auf den Beinen halten konnte. Der Mann hatte ein blutverkrustetes, blaurot verfärbtes Gesicht. Seine Nase war überdimensional angeschwollen, die Lippen aufgerissen. Der Bereich um das rechte Auge wölbte sich nach außen und glich einer großen reifen Pflaume. Wimpern und Auge waren nicht mehr sichtbar. Am Hals sah man deutliche Würgemale.
Ich war geschockt. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Kleidung des Tatverdächtigen stark verschmutzt und teilweise zerrissen war. Der Kragen seines Hemdes hing nur noch an einem dünnen Fetzen Stoff.
Mein Gott, dachte ich. Jetzt habe ich nicht nur ein Sexualdelikt, sondern auch noch eine schwere Körperverletzung im Amt zu bearbeiten.
Ich schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. »War das nötig?
»Das waren wir nicht. Er wurde uns so übergeben«, antwortete der eine Kollege.
»Der hat Glück, dass er noch lebt«, sagte der andere. »Wir sind gerade noch rechtzeitig dazugekommen. Ich musste einen Warnschuss abgeben. Die hätten ihn sonst gelyncht.«
Ich überflog den kurzen Bericht der Kollegen. Eine Anwohnerin hatte über Notruf mitgeteilt, dass ein junger Mann im Treppenhaus eines Wohnsilos brutal zusammengeschlagen werde. Als die Polizei eintraf, sahen sie auf der Straße einen Pulk von Menschen, die auf den Mann einschlugen.
Der Mann soll kurz davor einen kleinen Jungen im Keller des Hauses vergewaltigt haben. Vater und Onkel des Buben suchten und fanden das Kind schließlich weinend und mit entblößtem Unterkörper in einem Kellerverschlag. Der Tatverdächtige wollte sich gerade aus dem Staube machen. Nach kurzer Flucht stellten sie ihn im Treppenhaus, wo er die ersten Prügel bezog. Er konnte sich auf die Straße schleppen. Dort versammelte sich in Minutenschnelle ein Mob, der auf den Mann wahllos einschlug.
Wie ich dem Bericht entnehmen konnte, war Baric 23 Jahre alt und zusammen mit seiner Mutter erst vor ein paar Tagen in das Haus eingezogen. Ich sehe ihn noch wie heute vor mir: ein schmaler, drahtiger Typ mit dünnem, spärlichem Oberlippenbart, langen, bis zur Schulter reichenden, dunkelblonden Haaren, die leicht gewellt, fettig und zum Teil blutverklebt waren. Er war gut 1,80 Meter groß und hatte eine sportliche Figur. In seinem linken, noch offenen Auge spiegelte sich blanke Angst.
So hart es klingen mag. Ich musste die Gunst der Stunde nutzen. Entsprechend gestalteten sich meine Fragen. In höflicher, fast mitfühlender Form sprach ich ihn an.
»Herr Baric, benötigen Sie einen Arzt oder können Sie noch etwas durchhalten? Ich möchte gerne wissen, was Sie zu sagen haben.«
Damit spielte ich ihm den Ball zu. Das war eine bewährte Methode, einen Tatverdächtigen zum Reden zu bringen. Er sollte das Gefühl haben, das Heft in die Hand zu bekommen, um seine Version erzählen zu können. Ich gab ihm dadurch die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, aber auch zu lügen, dass sich die Balken biegen.
Baric fing den Ball sofort auf. »Der Junge wollte Geld von mir. Ich habe ihm welches gegeben. Dann hat er seine Hose heruntergemacht.«
»Herr Baric, ich muss Sie an dieser Stelle belehren, dass Sie das Recht haben, die Aussage zu verweigern oder vor Ihrer Befragung einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens hinzuzuziehen.«
Die Belehrung ist immer der schwierigste Teil einer Beschuldigtenvernehmung. Leider benutzen sie viele Kollegen als willkommene Gelegenheit, sich ein umfangreiches Verhör zu ersparen. Diese, gelinde gesagt, trägen Beamten formulieren dann die Belehrung in etwa so: »Herr Soundso, bevor Sie sich jetzt selbst reinreiten, können Sie Ihren Rechtsanwalt anrufen.« Diskret wird dann dem Beschuldigten ein Telefon zugeschoben. Die meisten antworten sinngemäß:
»Ich habe aber keinen Rechtsanwalt.«
»Dann suchen Sie sich einen raus. Sie brauchen in Ihrer Lage einen Rechtsbeistand, glauben Sie mir.«
Ich habe erlebt, dass ein Kollege dem Tatverdächtigen im Branchenverzeichnis die Seite mit den Kanzleien herausgesucht hat, nur um sich die durchaus anstrengende Arbeit einer Vernehmung zu ersparen. Man muss wissen, dass die Befragung eines Beschuldigten in schwierigen Fällen höchste Konzentration erfordert und sich oft über Stunden hinauszieht.
Bei Baric ging ich so vor, dass ich die nach dem Strafprozessrecht zwingend vorgeschriebene Belehrung mit äußerst zurückhaltender und monotoner Stimme vortrug. Ich wollte keine schlafenden Hunde wecken. Sicher wusste er, dass ihm die Tat unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte. Es war jedoch eminent wichtig, ihn in dem Glauben zu lassen, dass es ein Vorteil für ihn wäre, wenn er das Geschehen aus seiner Sicht schildern durfte.
Ein äußerst wichtiger Faktor in einem Verhör ist der Moment, in dem der Vernehmungsbeamte dem Tatverdächtigen die Fesseln abnehmen lässt. Im Laufe meiner Dienstjahre habe ich daraus ein regelrechtes Ritual gemacht, bei dem ich zum einen als absolut dominanter, die Lage beherrschender Ermittler auftrete, und zum anderen als Wohltäter des Delinquenten.
Die Handschließen bereiten in den meisten Fällen Schmerzen an den Gelenken. Außerdem schränken sie die Bewegungsfreiheit in erheblichem Maße ein. Nicht zu vergessen ist die Hilflosigkeit, der sich ein gefesselter Täter ausgesetzt fühlt.
Wie immer hatte ich meine Dienstwaffe versteckt, aber griffbereit in der obersten Schublade meines Schreibtisches liegen. Daneben noch ein Pfefferspray. Baric saß etwa zwei Meter schräg vor mir; die Protokollantin außerhalb seiner Reichweite. Wenn er auf dumme Gedanken kommen sollte, würde er schneller in die Mündung meiner 9 mm Pistole schauen, als ihm lieb ist.
Ich sah Baric direkt in die Augen. »Okay Jungs, nehmt ihm die Handschließen ab. Ich bin sicher, Herr Baric ist vernünftig und macht keine Schwierigkeiten.«
Während Baric stumm seine schmerzenden Handgelenke massierte, bedankte ich mich bei den Kollegen und verabschiedete sie. Wenn man von der Protokollantin absah, war ich jetzt mit dem Tatverdächtigen alleine. Das ist eine weitere Voraussetzung, das Maximum bei einer Vernehmung herauszuholen. Wichtig dabei ist, dass sich die Protokollantin absolut unauffällig benimmt. Sie ist nur dann gut, wenn sie nicht nur schnell tippen kann, sondern bei dem Delinquenten auch den Eindruck erweckt, als wäre sie gar nicht anwesend, als spielte sie überhaupt keine Rolle in dem Zweikampf Ermittler versus Täter.
Nachdem ich die Belehrung diktiert und dabei festgehalten hatte, dass Baric nach eigener Aussage trotz seiner Verletzungen keinen Arzt verlangte und sich imstande sah, Fragen zu beantworten, stieg ich in die eigentliche Vernehmung ein. Der Trick, ihm scheinbar das Feld zu überlassen, funktionierte hervorragend. Hier ein Auszug des Vernehmungsprotokolls:
»Herr Baric, Sie haben vorhin erwähnt, der Junge habe Geld von Ihnen verlangt und vor Ihnen seine Hosen heruntergezogen. Wie muss ich mir das vorstellen?«
»Er sprach mich im Treppenhaus an und fragte, ob ich Geld hätte. Dann lockte er mich in den Keller. Dort führte er mich in eine offene Parzelle. Ich gab ihm einen Fünfeuroschein. Mehr hatte ich nicht dabei. Danach streifte er seine Hosen nach unten.«
Klar, dass Baric log. Aber ich ließ ihn gewähren. Nur so konnte ich über die eigentliche Tat etwas erfahren.
»Okay, und was haben Sie dann gemacht?«
»Na ja, ich bin erst einmal erschrocken und habe ihn gefragt, was das soll. Er drehte sich um, bückte sich und sagte, ich könne ihn ficken.«
»Haben Sie so etwas schon einmal gemacht? Ich meine, mit so einem kleinen Jungen gefickt?«
»Nein, das war das erste Mal. Ich hatte ja bis vor Kurzem noch eine Freundin, mit der ich regelmäßig geschlafen habe.«
»Und die hat mit Ihnen Schluss gemacht?«
»Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin mit meiner Mutter von Bremen hierher in diese beschissene Stadt gezogen, in der ich kein Schwein kenne. Conny blieb in Bremen.«
»Wie ging es dann weiter?«
»Der Junge lachte und fragte mich, ob ich mich nicht trauen würde. Sie müssen wissen, Conny ist sehr dünn und der Junge hat fast den gleichen Arsch wie sie. Deshalb habe ich es gemacht.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Das können Sie sich doch denken, oder?«
»Ich möchte es aber von Ihnen hören. Also, was genau haben Sie gemacht?«
»Er hat sich über eine Holzkiste gebeugt und ich habe mich hingekniet. Dann habe ich ihn von hinten genommen.«
»Ging das so einfach? Ich meine, so ein kleiner Bub muss doch ziemlich eng sein.«
»Ich habe mich auch gewundert, dass es so einfach ging. Er hat dabei sogar gelacht.«
Du Dreckschwein, lüg nur weiter, dachte ich. Dafür bekommst du ein Jahr mehr, das verspreche ich dir.
»Er hat also nicht geschrien oder sich gewehrt?«
»Nein, sonst hätte ich doch sofort aufgehört.«
»Wie lange hatten Sie mit dem Buben Analverkehr?«
»Das kann ich nicht sagen. Ich habe ja nicht auf die Uhr geschaut.«
Ich ließ nicht locker. »Schätzen Sie mal wie lange.«
»Was spielt das für eine Rolle? Er hat mich regelrecht verführt. Das ist wichtig und das nehmen Sie bitte ins Protokoll auf. Ich hätte das nie gemacht, wenn er sich nicht aufgedrängt hätte.«
»Welches Gefühl hatten Sie dabei? War es ein großer Unterschied zum normalen Geschlechtsverkehr mit einer Frau?«
»Ja, es ist ein großer Unterschied. Aber ich kann nicht sagen, warum. Und ich dachte dabei immer nur an Conny.«
»Verschaffte es Ihnen mehr Erregung als bei Ihrer Freundin?«
»Es war einfach anders.«
»Wussten Sie, dass Sie sich strafbar machen, selbst wenn der Bub Sie verführt hat?«
»Ich dachte in diesem Augenblick nicht darüber nach. Ehrlich, nachdem ich schon eine ganze Weile keinen Sex mehr hatte, war ich so geil, dass ich nicht Nein sagen konnte.«
»Sind Sie zum Samenerguss gekommen?«
»Ja.«
»Im After des Kleinen oder außerhalb?«
»Drinnen.«
»Mussten Sie ihn zu irgendeinem Zeitpunkt festhalten?«
»Ich hatte meine Hände um seine Taille geschlungen, mehr nicht. Gezwungen habe ich ihn zu nichts. Das möchte ich ausdrücklich betonen.«
»Hatten Sie auch Oralverkehr mit dem Jungen?«
»Ja, er hat es mir angeboten. Aber das habe ich nicht so lange gemacht. Hat mir nicht so gut gefallen.
»Was geschah, nachdem Sie ejakuliert hatten?«
»Ich hörte plötzlich zwei Männer nach dem Jungen rufen. Da habe ich schnell meine Hose hochgezogen und wollte wegrennen. Doch sie waren schon da. Der Junge weinte und tat so, als ob ich ihn gezwungen hätte. Seine Hose hatte er noch nicht hochgezogen. Ohne Vorwarnung schlugen die beiden auf mich ein. Ich konnte mich losreißen und auf die Straße flüchten. Aber sie holten mich ein, hielten mich fest und schrien mich an. Andere Leute kamen hinzu. Erst beschimpften sie mich und dann fielen sie über mich her. Ich bekam Schläge, Tritte und man zog mich an den Haaren. So gut es ging, habe ich mit den Händen meinen Kopf geschützt. Irgendwann hörte ich einen Schuss. Ich glaube, sie hätten mich totgeschlagen, wenn die Polizei nicht gekommen wäre.«
»Was hätten Sie gemacht, wenn Sie der Vater des Jungen wären?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich das Gleiche gemacht. Er konnte ja nicht wissen, dass der Bub sich mir für Geld angeboten hat.«
Dreckarsch, dachte ich. Für wie blöd hältst du mich? Aber ich lasse dich lügen. Damit schaufelst du dir dein eigenes Grab. Die, die über dich richten, sollen sehen, was für ein verlogenes Schwein du bist.
Er fuhr fort. »Die Leute draußen auf der Straße waren noch brutaler.«
»Es war nicht okay, was Sie mit dem Jungen gemacht haben, und das wissen Sie genau.«
»Trotzdem hatten die nicht das Recht … Der Kleine war an allem schuld, ich …«
Ich unterbrach ihn, denn ich war an dem Punkt angelangt, an dem ich ihm am liebsten einen Faustschlag auf das Pflaumenauge versetzt hätte. »Sie sind ein …« dreckiger Kinderficker, wäre mir fast herausgerutscht. Doch dann hätte ich es vermasselt. Ich wollte ihn nämlich noch so weit bringen, auf eine Strafanzeige gegen den Vater und den Onkel des Opfers sowie gegen die anderen auf der Straße wegen gefährlicher Körperverletzung ausdrücklich zu verzichten.
Keine Frage: Ich empfand tiefe Abscheu gegen Baric. Doch das durfte ich ihn nicht spüren lassen. So sah ich mir sein grün und blau geschlagenes Gesicht, die blutverkrustete, dick geschwollene Nase und das Pflaumenauge an. Und siehe da, es regte sich sogar ein Funke Mitleid in mir. Diesen kleinen Funken legte ich nun gedanklich unter ein Mikroskop mit hundertfacher Vergrößerung.
»Sie sind ein …«, wiederholte ich, atmete tief durch und fuhr fort: »… vernünftiger Mensch, scheint mir. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie den Leuten, die Sie so zugerichtet haben, nicht böse sind. Deren Reaktion ist doch durchaus nachvollziehbar, oder meinen Sie nicht?«
»Aber die hätten mich fast umgebracht«, schrie Baric.
»Umso mehr wird man es Ihnen zugutehalten, wenn Sie großzügigerweise für deren Verhalten ein gewisses Verständnis aufbringen.«
Baric rang mit sich. Es war nicht schwer, seine Gedanken zu lesen. Ihm ging es einzig und allein darum, das bevorstehende Strafmaß zu mindern. Und damit fing ich ihn.
»Okay«, presste er zwischen den Zähnen hervor.
»Was ist okay?« Ich brauchte einen kompletten Satz von ihm.
»Ich … ich, also ich denke, dass es gut wäre, wenn ich gegen die Typen keine Anzeige erstatte.«
Ich diktierte folgenden Text: »Zum Abschluss meiner Vernehmung bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich meine Angaben freiwillig und ohne jeden Zwang oder Versprechen gemacht habe, dass ich trotz meiner Verletzungen auf einen Arzt verzichtete und letztlich auch unwiderruflich davon absehen werde, gegen diejenigen, die mir die Verletzungen zugefügt haben, eine Anzeige zu erstatten. Gezeichnet Zlatko Baric.
Ich hatte mein Ziel erreicht. Nachdem ich Baric in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht hatte, musste er sich splitternackt ausziehen. Ein Kriminaltechniker verpackte jedes einzelne Stück seiner Kleidung in Tüten. Ich sah, dass Baric am gesamten Körper riesige, stark ausgeprägte Hämatome hatte, und verständigte nun doch einen Arzt, der seine Haftfähigkeit bestätigte.