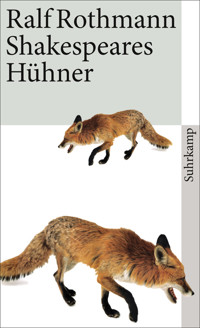Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Frühling sterben ist die Geschichte von Walter Urban und Friedrich – »Fiete« – Caroli, zwei siebzehnjährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere, Fiete, an die Front. Er desertiert, wird gefasst und zum Tod verurteilt, und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden lässt, steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund ...
In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, in dem die deutschen Offiziere ihren Männern Handgranaten in die Hacken werfen, damit sie noch angreifen, und die Soldaten in der Etappe verzweifelte Orgien im Angesicht des Todes feiern. Und wir erleben die ersten Wochen eines Friedens, in dem einer wie Walter nie mehr heimisch wird und noch auf dem Sterbebett stöhnt: »Die kommen doch immer näher, Mensch! Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste ...«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Kaum ein anderer Autor seiner Generation beherrscht die Erzählkunst eines poetischen Realismus so wie der vielfach preisgekrönte Ralf Rothmann. Auf seine Bücher warten manche Leser so inbrünstig wie früher Fans auf die neue Platte ihrer Lieblingsband.«
Hajo Steinert, Die Literarische Welt
In Im Frühling sterben erzählt Ralf Rothmann die Geschichte von Walter Urban und Friedrich – »Fiete« – Caroli, zwei siebzehnjährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere, Fiete, an die Front. Er desertiert, wird gefasst und zum Tod verurteilt, und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden lässt, steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund …
In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, in dem die deutschen Offiziere ihren Männern Handgranaten in die Hacken werfen, damit sie noch angreifen, und die Soldaten in der Etappe verzweifelte Orgien im Angesicht des Todes feiern. Und wir erleben die ersten Wochen eines Friedens, in dem einer wie Walter nie mehr heimisch wird.
Ralf Rothmann, geboren 1953 in Schleswig, aufgewachsen im Ruhrgebiet, lebt seit 1976 in Berlin.
Ralf Rothmann
Im Frühling sterben
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der zweiten Auflage der Erstausgabe, 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Eric Gauster
Umschlag: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74115-3
www.suhrkamp.de
Die Väter
haben saure Trauben gegessen,
aber den Kindern
sind die Zähne davon stumpf geworden.
Ezechiel
Das Schweigen, das tiefe Verschweigen, besonders wenn es Tote meint, ist letztlich ein Vakuum, das das Leben irgendwann von selbst mit Wahrheit füllt. – Sprach ich meinen Vater früher auf sein starkes Haar an, sagte er, das komme vom Krieg. Man habe sich täglich frischen Birkensaft in die Kopfhaut gerieben, es gebe nichts Besseres; er half zwar nicht gegen die Läuse, roch aber gut. Und auch wenn Birkensaft und Krieg für ein Kind kaum zusammenzubringen sind – ich fragte nicht weiter nach, hätte wohl auch wie so oft, ging es um die Zeit, keine genauere Antwort bekommen. Die stellte sich erst ein, als ich Jahrzehnte später Fotos von Soldatengräbern in der Hand hielt und sah, dass viele, wenn nicht die meisten Kreuze hinter der Front aus jungen Birkenstämmen gemacht waren.
Mein Vater hatte selten einmal gelächelt, ohne deswegen unfreundlich zu wirken. Der Ausdruck in seinem blassen, von starken Wangenknochen und grünen Augen dominierten Gesicht war unterlegt von Melancholie und Müdigkeit. Das zurückgekämmte dunkelblonde Haar, scharf ausrasiert im Nacken, wurde von Brisk in Form gehalten, das Kinn mit der leichten Einkerbung war immer glatt, und die vornehme Sinnlichkeit seiner Lippen schien nicht wenige Frauen beunruhigt zu haben; es gab da Geschichten. Seine etwas zu kurze Nase hatte einen kaum merklichen Stups, so dass er im Profil etwas jünger wirkte, und der Blick ließ in entspannten Momenten eine schalkhafte Menschlichkeit und eine kluge Empathie erkennen. Aber seine Schönheit war ihm selbst kaum bewusst, und falls sie ihm denn einmal aufgefallen wäre, hätte er ihr vermutlich nicht geglaubt.
Alle Nachbarn mochten ihn, den immer Hilfsbereiten, das Wort hochanständig fiel oft, wenn von ihm die Rede war; seine Kumpel in der Zeche nannten ihn anerkennend Wühler, und kaum einer stritt je mit ihm. Er trug gewöhnlich Hosen aus Cord, deren samtiges Schimmern sich schon nach der ersten Wäsche verlor, sowie Jacken von C&A. Doch die Farben waren stets ausgesucht, ließen ein kurzes Innehalten bei der Wahl erkennen, eine Freude an der geschmackvollen Kombination, und niemals hätte er Sneakers oder ungeputzte Schuhe, Frotteesocken oder karierte Hemden angezogen. Obwohl seine Körperhaltung durch die schwere Tätigkeit als Melker und später als Bergmann gelitten hatte, war er, was es kaum je gibt: ein eleganter Arbeiter.
Aber er hatte keine Freunde, suchte auch keine, blieb lebenslang für sich in einem Schweigen, das niemand mit ihm teilen wollte – nicht einmal seine Frau, die mit allen Nachbarn Kaffee trank und samstags ohne ihn zum Tanzen ging. Sein steter Ernst verlieh ihm trotz des krummen Rückens eine einschüchternde Autorität, und seine Schwermut bestand nicht einfach aus Überdruss am Trott der Tage oder an der Knochenarbeit, aus Ärger oder unerfüllten Träumen. Man schlug ihm nicht auf die Schulter und sagte: Komm, Walter, Kopf hoch! Es war der Ernst dessen, der Eindringlicheres gesehen hatte und mehr wusste vom Leben, als er sagen konnte, und der ahnte: Selbst wenn er die Sprache dafür hätte, würde es keine Erlösung geben.
Überdunkelt von seiner Vergangenheit, radelte er bei Wind und Wetter zur Zeche, und abgesehen von den vielen Verletzungen und Brüchen durch Steinschlag war er nie krank, nicht einmal erkältet. Doch die fast dreißig Jahre als Hauer unter Tage, die unzähligen Schichten und Sonderschichten mit dem Presslufthammer vor Kohle (ohne jeden Gehörschutz, wie damals üblich) hatten dazu geführt, dass er taub wurde und nichts und niemanden mehr verstand – außer meine Mutter. Wobei mir bis heute ein Rätsel ist, ob es ihre Stimmfrequenz war oder die Art der Lippenbewegung, die es ihm ermöglichte, sich ganz normal mit ihr zu unterhalten. Alle anderen mussten schreien und gestikulieren, wenn sie ihm etwas sagen wollten, denn er trug kein Hörgerät, mochte es nicht tragen, weil es angeblich Nebengeräusche und quälende Hall-Effekte erzeugte. Das machte den Umgang mit ihm sehr anstrengend, und seine Einsamkeit nahm auch innerhalb der Familie zu.
Ich hatte aber stets den Eindruck, dass er zumindest nicht unglücklich war in dieser fraglosen Stille, die sich von Jahr zu Jahr mehr um ihn verdichtete. Am Ende zerarbeitet, früh verrentet und vor Scham darüber schnell zum Alkoholiker geworden, verlangte er nicht viel mehr vom Leben als seine Zeitung und den neuesten Jerry-Cotton-Roman vom Kiosk, und als die Ärzte ihm 1987, gerade war er sechzig geworden, sein baldiges Sterben ankündigten, zeigte er sich kaum bewegt. »An meinen Körper kommt kein Messer«, hatte er schon zu Beginn der Krankheit gesagt, und weder mit dem Rauchen noch mit dem Trinken aufgehört. Er wünschte sich ein wenig öfter als sonst sein Lieblingsgericht, Bratkartoffeln mit Rührei und Spinat, und versteckte den Wodka vor meiner Mutter im Keller, unter den Kohlen. (An der Mauer hing immer noch sein Melkschemel mit dem Lederband und dem gedrechselten Bein.)
Bereits zu seiner Pensionierung hatte ich ihm eine schöne Kladde geschenkt in der Hoffnung, er würde mir sein Leben skizzieren, erwähnenswerte Episoden aus der Zeit vor meiner Geburt; doch sie blieb fast leer. Nur ein paar Wörter hatte er notiert, Stichwörter womöglich, fremd klingende Ortsnamen, und als ich ihn nach dem ersten Blutsturz bat, mir wenigstens jene Wochen im Frühjahr ’45 genauer zu beschreiben, winkte er müde ab und sagte mit seiner sonoren, wie aus dem Hohlraum der Taubheit hervorhallenden Stimme: »Wozu denn noch? Hab ich’s dir nicht erzählt? Du bist der Schriftsteller.« Dann kratzte er sich unter dem Hemd, starrte aus dem Fenster und fügte halblaut hinzu: »Hoffentlich ist der Scheiß hier bald vorbei.«
Nicht von ihm gehört zu werden machte uns auch untereinander stumm; tagelang saßen meine Mutter und ich in dem Sterbezimmer, ohne ein Wort zu sprechen. Es war bis in Kopfhöhe lindgrün gestrichen, und über dem Bett hing ein Kunstdruck nach einem Gemälde von Édouard Manet, »Landhaus in Rueil«. Ich mochte das Bild immer gern, nicht nur wegen seiner scheinbar so leichten, fast musikalischen Ausführung und des Sommerlichts, von dem es sanft durchglüht wird, obwohl man nirgends ein Stück Himmel sieht: Die ockerfarbene, von Bäumen, Sträuchern und roten Blumen umwachsene Villa mit dem Säulenportal hat auch eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Herrenhaus jenes Gutes in Norddeutschland, auf dem mein Vater Anfang der vierziger Jahre seine Melkerlehre gemacht hatte. Dort waren sich die Eltern zum ersten Mal begegnet, und in der Kindheit hatte ich ein paar glückliche Ferienwochen in der Nähe verbracht. Verwandte wohnten immer noch am Kanal.
Ein Landhaus der Seele, auf das nun die Abendsonne fiel. Der Plastikrahmen knackte in der letzten Wärme, und meine Mutter, die sich nicht anlehnte auf ihrem Stuhl und der die Handtasche in der Ellenbeuge hing, als wäre sie nur kurz mal zu Besuch beim Tod, stellte die Wasserflasche in den Schatten. Wie immer makellos und mit viel zu viel Haarspray frisiert, trug sie Wildlederpumps und das nachtblaue Kostüm mit den Nadelstreifen, das sie selbst geschneidert hatte, und wenn sie leise seufzte, konnte ich eine Likörfahne riechen.
In den knapp achtzehn Jahren bei meinen Eltern und auch später, während der seltenen Besuche an Weihnachten oder zu Geburtstagen, hatte ich kaum je eine Zärtlichkeit zwischen den beiden gesehen, keine Berührung oder Umarmung, keinen noch so beiläufigen Kuss; eher machte man sich die stets gleichen Vorhaltungen, den Alltagskram betreffend, oder zertrümmerte volltrunken das Mobiliar. Doch nun drückte sie plötzlich ihre Stirn gegen seine und strich über die Hand des zunehmend Verwirrten, flüchtig nur, als schämte sie sich vor ihrem Sohn, und mein Vater öffnete die Augen.
Vom eingewachsenen Kohlenstaub immer noch fein gerändert, waren sie seit Tagen ungewöhnlich groß und klar; wie Perlmutt schimmerten die Skleren, im dunklen Grün der Iris konnte man die braunen Pigmente erkennen, und zitternd hob er einen Finger und sagte: »Habt ihr gehört?«
Einmal abgesehen von seiner Taubheit: Es war vollkommen still, weder durch das Fenster, das auf den blühenden Klinikpark hinausging, noch vom Flur drang ein Laut herein; die reguläre Besuchszeit war zu Ende, das Abendessen längst serviert, das Geschirr vor kurzem abgeräumt worden. Die Nachtschwester hatte bereits ihre Runde gemacht, und meine Mutter schüttelte kaum merklich den Kopf und murmelte: »Ah, jetzt ist er wieder im Krieg.«
Ich fragte nicht, wie sie darauf kam. Allein die Intimität, die in diesem Wissen aufschien, sagte mir, dass es stimmte, und wirklich rief er wenig später »Da!« und blickte hilflos besorgt von einem zum anderen. »Schon wieder! Hört ihr das denn nicht?« Kreisförmig wanderten die Finger über die Brust, rafften das Nachthemd zusammen und glätteten es, wobei er schluckte, und dann sank er aufs Kissen zurück, drehte den Kopf zur Wand und sagte bei geschlossenen Augen: »Die kommen doch immer näher, Mensch! Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste …«
In der Bibel meiner Eltern, einem zerschabten Lederexemplar voller Kassenzettel von Schätzlein, hat jemand einen Vers im Alten Testament angestrichen – nicht mit einem Stift, sondern wahrscheinlich mit dem Finger- oder Daumennagel, und obwohl das in Fraktur gesetzte Buch nun schon Jahrzehnte in meinen Regalen oder Kisten liegt, sieht die Kerbe in dem Dünndruckpapier wie gerade erst eingeritzt aus. »Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben«, heißt es da. »Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.«
In der Dunkelheit hörte man von den Tieren wenig mehr als das Geräusch ihrer wiederkäuenden Kiefer oder ein Schnaufen hinter dem Fressgitter. Manchmal streifte der Lichtkreis der Petroleumlampe eine feuchte Schnauze mit schwarzen, im Innern rosigen Nüstern oder warf die Schatten der Hörner an die gekalkte Wand, wo sie zwei Schritte lang spitz aufragten, um gleich wieder zu verblassen. Die Nester der Rauchschwalben unter dem Heuboden waren noch verwaist; doch unsichtbar im Dunkeln maunzten schon junge Katzen.
Ein schwerer Urinstrahl pladderte auf den Estrich, und der süßliche Geruch nach Mais und Kleie erfüllte den hinteren Teil des Gebäudes, wo die trächtigen Kühe in Einzelboxen standen und dem Mann in dem blauen Arbeitsanzug, der für sie nur ein wandernder Lichtpunkt sein mochte, aus großen Augen entgegensahen. Dabei blieben sie völlig reglos, und erst als der junge Melker in den Kannenraum getreten war, ließ eine beinahe weiße – es gab nur einen Fleck an der Hungergrube – ein hohes Brüllen hören. Ihr Schwanz peitschte durch die Luft.
»Bleib ruhig, bin ja schon weg«, murmelte Walter und schloss die Tür. Man hatte die Rohmilchkannen, zwei Dutzend oder mehr, an der Wand aufgereiht. Außen stumpfgrau, waren sie innen sauber gespült und abgetrocknet, ein Glanz, in dem man sich spiegeln konnte. Doch die Siebtücher lagen zwischen Schürzen und Gummistiefeln auf dem Boden, und er schnalzte verärgert und hängte die Lampe an den Haken. Dann füllte er eine Blechwanne mit Wasser, in das er eine Handvoll Natron gab, und weichte die locker gewebte Baumwolle darin ein, und nachdem er noch einige Melkschemel ins Regal geräumt und eine Dose Waschsand zugeschraubt hatte, öffnete er die Tür zum Hof.
Ein Drosselschwarm stob aus der Linde; im Herrenhaus kein Licht. Motte, Thamlings alter Hund, schlief auf den Stufen. Die verkohlten Balken des Uhrturms ragten in den violetten Himmel, die Regenrinne baumelte herab. Zwar hatte man die zersplitterten Fenster inzwischen verschalt, doch lag das Wappenschild des Gutes, auf dem ein schwarzes Pferd unter gekreuzten Sicheln abgebildet war, immer noch im Vorgarten. Auch der Portikus beschädigt und schief; die Attacke der Jagdbomber hatte offenbart, dass die kannelierten Säulen, die an einen Tempel denken ließen, im Innern hohl waren, vergipste Bretter, hinter denen Mäuse lebten.
Walter überquerte den Hof, ging durch die Schmiede und öffnete die Tür zum Kälberstall. In der jähen Zugluft wirbelte das Häcksel auf dem Boden im Kreis herum. Er hob die Petroleumlampe und las den Anschlag am schwarzen Brett, einen Bescheid des Heeresversorgungsamtes. Dann schloss er die Fenster, klopfte gegen den Wassertank und warf einen Blick in die Raufen. Mehr als zweihundert Tiere hatten unter dem riesigen Reetdach Platz, doch jetzt befanden sich gerade vierzig darin, Schwarzbunte kurz vor der ersten Brunst. Er pfiff leise, ein lockender Ton, woraufhin einige an das Gatter kamen, sich die Blessen kraulen ließen und an seinem Daumen saugten.
Seit es kaum noch Schweine auf dem Hof gab, wurden zunehmend Kälber requiriert. Gut ein Drittel der Tiere trug bereits ein Kreidekreuz auf der Flanke, und er schüttete einen Eimer voll Kleie in den Futterstein, schloss die Tür hinter sich und überquerte die Chaussee. Gleich neben der Einfahrt zur Meierei, im alten Pferdestall, lebten die Flüchtlinge, jede Familie in einer Box, und in der Abendstille konnte man die Stimmen von Frauen und Kindern und ein Akkordeon hören. Obwohl es den Leuten verboten war, dort zu kochen, stieg Rauch aus den vergitterten Fenstern, und es roch nach gebratenen Zwiebeln und heißer Lauge.
Unter dem Vordach der Meierei waren Leinen voller Bettlaken und Windeln gespannt, und eine Böe wehte ihm etwas Seidiges ins Gesicht, kühle Strümpfe. Daneben hing das dünne Hemd mit den Stickereien; Elisabeth hatte es am letzten Wochenende getragen und lange nicht ausziehen wollen, auch nach dem Steinhäger nicht. Erst als es »versaut« war, wie sie das nannte, hatte sie es rasch über den Kopf gestreift und in seinem Waschbecken eingeweicht, mit angewiderter Miene. In ihrer Nacktheit war sie ihm noch zarter vorgekommen, kindlich fast, wäre da nicht die schwarz glänzende Behaarung gewesen, und er ließ die Fingerspitzen über das Muster gleiten. Doch kaum hatte er sich vorgeneigt, um daran zu riechen, sagte eine Stimme hinter den Laken: »Na, is’ schon trocken?«
Frau Isbahner saß auf der Treppe zur Futterküche und schälte im Licht einer Kerze Kartoffeln. Handschuhe ohne Finger trug sie und einen zerschlissenen Mantel; ihre grauen Haare waren zu einem Dutt geformt. Sie hatte ähnlich schmale Lippen wie ihre beiden Töchter, mit denen sie hier lebte, und wenn sie das Kinn an den Hals zog, wölbte sich der Kropf vor, ein großer, matt glänzender Auswuchs voller Besenreiser. »Ich seh nur rasch nach der Milch«, sagte Walter. »Wird Ihnen nicht kalt?«
Die Frau, auf deren Schoß eine Katze schlief, nickte. »Aber hier draußen ist die Luft besser«, murmelte sie und schnitt die Augen aus einer Kartoffel. »Nach der Milch siehst du also. Bist ein Gründlicher, oder? Wie wird sie sein, deine Milch? Weiß oder grau, vielleicht ein bisschen gelb. Kühl oder nicht so kühl, sauer oder süß. Mit Rahm obenauf oder leicht geronnen. Die Milch ist seit Adam und Eva Milch, du musst nicht nach ihr schauen.« Sie schmiss die Kartoffel in einen Topf und lächelte ihn an, wobei ihre Prothese verrutschte. »Wir stehlen nichts, Junge. Wir kommen schon zurecht. Flüchtlinge sind wir, keine Diebe.«
Er blinzelte verlegen. »Hat auch niemand gesagt, oder? Aber Thamling ist noch in Malente, da muss ich den Abendgang machen. Ist Liesel nicht da?«
»Der alte Fuchs …« Sie schnalzte leise. »Schon wieder in Malente? Wissen möcht’ ich, was der immer auswärts treibt. Sticht den noch der Hafer? Hat er was Junges zu laufen? Und die Frau liegt krank im Bett.«
Walter zog den Schlüssel hervor. »Nein, nein, es ist wegen der Trecker. Drei haben sie mitgenommen, aber auf der Liste standen nur zwei. Da muss er Eingabe machen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ach Gott, wenn’s denn hilft… Wie viele Eingaben hab ich schon gemacht, von wegen Wohnung. Pustekuchen. Soll er nur aufpassen, dass sie ihn nicht gleich dabehalten und auch an die Front schicken. Was die mal einkassieren, geben sie nicht wieder raus; alles wird jetzt zusammengekratzt. Der Iwan steht an der Oder, ist womöglich bald in Berlin, hast du gehört?«
»Nein«, sagte Walter und rieb sich den Nacken. »Ich bin Melker, ich weiß nichts von Politik. Und Feindsender schaltet hier auch niemand ein.«
Frau Isbahner kniff ein Auge zu. »Na, meinst du, ich tu’s? Die Vögelchen haben’s mir gezwitschert. Die kleinen Dinger, die ganz verrückt sind nach’m Frühling. Was die rumkommen im Leben! Setzen sich her zu mir und erzählen von unserem schönen Westpreußen, wo’s gab das beste Korn. Hast du am Ersten Brot gebacken und in die Eichentruhe getan, immer Brot, Brett, Brot, war’s am Monatsende noch knusprig frisch.«
Walter steckte den Schlüssel ins Schloss. Seit das E-Werk in Neumünster bombardiert worden war, kühlte man die Milch, den Rohquark und die Butter wie vor hundert Jahren: Man leitete Wasser der Alten Eider mittels Schleusen durch das schmale Ziegelgebäude und stellte die Kannen und Wannen in die Strömung. Moosige Bohlen an den Giebelseiten erlaubten es, den Pegel in der Rinne zu regulieren, und nachdem Walter ihn etwas herabgesenkt hatte, hob er die Lampe und blickte in die Butterfässer. Hier und da war Rahm abgeschöpft, bläulich schimmerte die magere Milch, und er schrieb seinen Namen und die Uhrzeit an die Wandtafel und trat ins Freie.
Hinter den Chausseebäumen ging der Mond auf, ein großes, orangerotes Rund. Frau Isbahner saß nicht mehr auf der Treppe, und obwohl die Tür zur Küche offen stand, klopfte er an die Zarge. Immer noch roch es nach dem Schweinefutter, das man hier früher gekocht hatte, ein säuerlicher Geruch nach Rüben- und Kartoffelschalen; er konnte ihn auch an Elisabeths Kleidern wahrnehmen. Matratzen und Strohsäcke lagen längs der schwarzschimmeligen Wände, und ihre Mutter, die am Herd stand, rührte in einem Topf. »Na«, sagte sie, und drehte sich nicht um. »Was will er denn noch, Walterchen.«
Sie rauchte ihre kurze Pfeife mit dem Bernsteinschaft, und er machte einen Schritt in den Raum und rückte ein Bild über der Anrichte gerade, einen Schutzengel, der zwei Kinder über eine morsche Brücke führte. »Ich wollte nur wissen … Ich meine …« Er schluckte. »Könnte ich Liesel heute Abend mitnehmen an den Kanal? Die vom Reichsnährstand spendieren ein Fass, und es gibt eine neue Kapelle, acht Mann. Lauter Blinde und Kriegsversehrte, aber sie spielen flott. Und ich dachte, weil sie so gern tanzt … Ich bring sie auch wieder zurück.«
Das Reisig im Herdloch knisterte, und Frau Isbahner legte einen Scheit dazu. Dann streute sie etwas Salz in den Topf. »Da musst du sie schon selbst fragen, Junge. Bald siebzehn ist sie, raucht wie ein Schlot und zigeunert wer weiß wo; der komm ich nicht bei.« Sie hob den Holzlöffel, probierte die Suppe. »Die kannst du prügeln, bis sie Lumpen kotzt, die bleibt frech. Aber wenn sie nachher dick ist, wird sie heulen, und ich bin wieder die liebe Mama.« Die Brauen gerunzelt, blickte sie sich um. »Was gab’s denn da neulich hinterm Stall, sag mal? Wieso hat sie dir Schlachtewasser über die Füße gekippt? Das war doch heiß, oder?«
Die grau getigerte Katze sprang auf den Tisch, und er nickte und bewegte die Zehen in den Stiefeln. Trotz der Salbe taten sie noch weh. »Fast kochend war’s … Sie hat gesagt, sie will mich nicht. Oder eigentlich hat sie’s ihren Freundinnen gesagt, der Ortrud und der Hedwig, so über die Schulter: Ich will den nicht. Und patsch, die ganze Schüssel! Obwohl ich doch barfuß war, vom Hackfleisch-Treten! Zum Glück hatte Thamling Verbandszeug dabei.«
Frau Isbahner zog an der Pfeife, stieß den Rauch durch die Nase; er sollte wohl ihr Schmunzeln nicht sehen. »Nu, das sagen Frauen schon mal bei dem Mond. Ist an und für sich kein schlechtes Zeichen. Sie findet dich jedenfalls nicht verkehrt, so viel kenn ich mein Gör. Weiß ja, von wem sie ist … Spendier ihr was Buntes und dreh sie ordentlich beim Tanzen, dann klappt’s.«
Sie schob den Vorhang der Anrichte beiseite, schöpfte etwas Rahm aus einem Krug und gab ihn in die Suppe; dabei blickte sie rasch zur Tür. »Was glaubst du?«, fragte sie leise, fast bang. »Was mag nu kommen? Werden sie euch auch bald holen, wie die anderen? Mensch, ihr seid doch Kinder, du und der Fiete! Ihr wisst überhaupt nichts. Da lass ich dich anbändeln mit meiner Elisabeth, weil du hübsch bist und hast ein ehrliches Gesicht, und am Ende kriegt sie einen Krüppel.«
Ihre Augen wurden feucht, doch Walter grinste. »Ich bin fast achtzehn!«, sagte er und hielt sich gerader. »Aber mich können die sowieso nicht gebrauchen, Frau Isbahner. Ich hab schon bei den Hitlerjungen danebengeschossen. Knick in der Optik. Und wir sind ja wichtig hier, unentbehrlich. Einer muss die Kühe melken und die Kälber auf die Welt ziehen. Kein Krieg ohne Milch, sagt der Thamling immer.« Er trat an den Herd und blickte in den Topf; weiße Bohnen. »Ist sowieso bald vorbei«, flüsterte er. »Die Amerikaner rücken immer weiter vor, und die Tommys sollen schon an der holländischen Grenze sein. Da kann man nur hoffen, dass sie schneller im Dorf sind als der Russe.«
»Ach so«, sagte Frau Isbahner, nun wieder lächelnd. »Wer hört denn hier Feindsender? Gib nur acht, Junge, so ein Strick ist schnell geknüpft.« Sie strich der Katze über den Rücken, hielt ihr den Löffel hin. »Und jetzt lass mich mal arbeiten. Die Liesel wird schon im ›Fährhof‹ sein, denk ich. Der Kobluhn hat sie abgeholt, dieser Sägewerker auf dem Krad. Sie und die anderen Mädels. Der sieht vielleicht schmuck aus in der Uniform! Hätten wir solche gehabt vor Danzig, wir könnten jetzt noch in Westpreußen sein.« Sie zog an ihrer Pfeife, in der es leise brutzelte, und starrte den Schutzengel an. »Warum spendiert der Nährstand euch eigentlich Bier?«
Walter hob die Schultern und verabschiedete sich. Rasch ging er durch den kleinen, von Nadelbäumen verdunkelten Park. Der Kies auf den Wegen, leicht angefroren im abendlichen Bodenfrost, knirschte kaum, ein paar Rehe huschten fast lautlos davon. Auch in den rückwärtigen Fenstern des Gutshauses brannte kein Licht, auf der Terrasse lag ein großer Haufen Kiefernzapfen, und die Küchentür – ungläubig rüttelte er an der Klinke – war verschlossen. Er hob die Lampe und blickte durch die Scheibe mit den Mattglas-Ornamenten auf den Tisch. Ein Pfefferstreuer stand darauf, und leise fluchend überquerte er den Hof.
Die Melkerstuben unter dem Dach des Kuhstalls waren seit dem Tiefflieger-Angriff nur noch über eine Leiter zu erreichen; die zersplitterten Reste der Außentreppe lagen in der Jauche. Zehn Kammern gab es hier oben, kaum mehr als Bretterverschläge, viele ohne Türen und nur wenige mit Fenstern, Fledermausgauben. Schuhe voller Heustaub standen neben den Betten, auf den Stühlen lagen Bücher und Zeitschriften, an den Wänden hingen Familienbilder oder Fotos von Marika Rökk und Magda Schneider. Doch die meisten Landarbeiter, die hier gelebt hatten, waren längst tot. Auf einem der karierten Kissen lag ein Soldbuch, auf einem anderen ein silbernes Stalingrad-Kreuz. Er hatte es einmal in der Hand gewogen und enttäuschend leicht gefunden.
Obwohl man die schmalen, mit einem Bett, einem Stuhl und einem emaillierten Waschbecken ausgestatteten Kammern nicht heizen konnte, waren sie dank der Tiere darunter immer warm, und er streifte den Arbeitsanzug ab, drehte den Wasserhahn auf und wusch sich mit dem Stück Lavendelseife, das ihm seine Mutter geschickt hatte. Dann betastete er Kinn und Wangen, legte eine neue Klinge in den Rasierer und hobelte sich die Schwielen von den Händen.
Er zog seine senffarbene Manchester-Hose an und nahm ein frisches Hemd aus dem Wandschrank. Ungebügelt war es, aber weiß, und er ließ den Kragen offen und schlüpfte in eine dicke blaue, mit zwei Knopfreihen versehene Wolljacke. Die Haare, die der Friseur in Sehestedt immer Drahtstifte nannte, brachte er mit etwas Melkfett in Form und schmierte auch die Stiefel damit ein, polierte sie blank. Schließlich nahm er sich Geld aus der Blechbüchse mit dem eingeprägten Mohr und stieg auch schon wieder die Leiter hinab, das heißt, er glitt an den Holmen hinunter, zog sein Fahrrad aus der leeren Bullenbox und fuhr ohne Licht zum Kanal.
Auf den Feldern glänzten die Spitzen der Frühsaat wie Glas unterm Mond, der immer noch nicht hoch stand. Jagdbomber glitten daran vorbei, ein kleines Geschwader Richtung Kiel, man konnte die Piloten in den Kanzeln sehen. Auf einer abgesteckten Weide längs der Straße standen Schnucken, dickwollige Tiere, um einen Haufen Heu herum, und ein Collie schoss unter dem Karren des Schäfers hervor, sprang aber nicht über den Graben. Lautlos lief er neben ihm bis zum Wald, wobei sein Fell aufschwebte bei jedem Schritt, und machte ebenso still und stolz wieder kehrt. Zwischen den hohen Buchen sah das Mondlicht diesiger aus, und die Hülsen der Eckern auf dem Weg knackten unter den Gummireifen.
Die Musik aus dem »Fährhof« kam von der Schallplatte oder aus dem Radio, Walter erkannte die Stimme von Hans Albers. In dem hart an die Böschung gebauten und rundum verdunkelten Lokal gab es meistens elektrisches Licht; Sybel Jahnson, Wirt und Fährmann, konnte den Motor seines Bootes mit wenigen Handgriffen zum Generator machen. Vor dem Giebel waren Tarnnetze gespannt, ein Baldachin auf Fichtenstämmen, unter dem ein Hanomag-Transporter und zwei staubige Mercedes 170 standen, SS-Runen auf den Nummernschildern. Die Lampen waren verhüllt.
Walter lehnte sein Rad an den Beiwagen von Kobluhns Zündapp und fuhr sich noch einmal durch die Haare, ehe er die Tür aufzog. Dicht hing der Rauch über dem Tresen mit der alten Galionsfigur, einer Windsbraut in einem goldenen Kleid, und das Singen, Lachen und Gläserklingen hallte hinter ihm über das Wasser. Fietes Freundin Ortrud zapfte mit ihrer Mutter Bier und winkte ihm zu, wies in den Saal. Glücklich sah sie aus, trotz der Fehlgeburt vor drei Wochen, und das leicht verschwitzte Gesicht ließ ihr Lächeln noch strahlender erscheinen. Niemand schminkte sich die Lippen so rot wie sie.
»Davon geht die Welt nicht unter«, schnarrte es aus dem Volksempfänger an der Wand. Daneben hing das Banner des Reichsnährstands, Schwert und Ähre. Zigaretten oder Schnapsgläser in den Händen, standen Soldaten ohne Mützen zwischen den Gästen, und unterhielten sich betont heiter und leutselig. Es waren höhere Dienstgrade der Waffen-SS in sauberem Feldgrau und gewichsten Stiefeln, und während Walter auf die Saaltür zuging, konnte er die Pomade im Haar eines Scharführers riechen. Er trug den linken Arm in einer Schlinge, und auch die gesamte linke Gesichtshälfte war versehrt, eine großflächige Narbe. Das Auge tränte.
Helme hingen am Garderobenständer. Elisabeth saß auf der Fensterbank neben der Bühne. In dem dunkelgrünen Kleid mit dem Stehkragen, das Frau Thamling ihr geschenkt hatte, wirkte sie überhaupt nicht mehr mädchenhaft, zumal sie geschminkt war und sich sehr gerade hielt. Die schwarzen Locken wurden von einem Perlmuttreif gebändigt, die Lidstriche waren ein wenig über die Augenwinkel hinausgezogen, und offensichtlich hatte sie Ortruds Lippenstift benutzt. Zu dem Seidenkleid trug sie die Gummistiefel, in denen sie aus Danzig geflohen war, sie besaß keine anderen Schuhe, und kaum nickte er ihr zu, hob sie das Kinn und sah an ihm vorbei, als erwarte sie jemand andern. Doch dann streckte sie ihm die Zunge heraus, nur die Spitze.
Ein Transparent mit der Aufschrift »Kampf bis zum Sieg! Lever dood as Slaav!« hing über der Bühne, und nun hatten auch die anderen ihn bemerkt. Hedwig, die neben ihr saß, reckte die Arme in die Luft und winkte mit beiden Händen. Fiete, im Sitzen schwankend, drehte sich eine Zigarette und griente ihn an. Immer noch trug er die Kluft, in der er täglich molk, Schuhe mit Stahlkappen, eine weite Drillichhose und einen blauen Pullover voller Mottenlöcher, und seine Hände waren schmutzig. »Da kommt ja unser Vorarbeiter«, sagte er mit verwischter Stimme. »Sieg heil, Kamerad. Alles im Schlüpfer?«
Hedwig, Ortruds Schwester, Haushälterin bei den Thamlings, rammte ihm einen Ellbogen in die Seite, und Walter schüttelte den Kopf. »Wie siehst denn du aus?«, fragte er und strich ihm einen Strohhalm aus den blonden Locken, richtete seinen Pulloverkragen. »Konntest du dich nicht mal waschen und kämmen und dir anständiges Zeug anziehen? Und wieso bist du schon so blau?«
Fiete schlug die Beine übereinander und zog an seiner Zigarette, die viel zu locker gedreht war. In seinen Lippenwinkeln, wie so oft, klebte etwas getrockneter Speichel, und schloss er die umschatteten Augen, sah er wie ein Mädchen aus; schmal das Gesicht, haarlos der Teint, und die Wimpern waren lang und geschwungen. »Melde gehorsamst, mein Führer: Anständige Sachen hab ich nicht. Noch nie gehabt. Und wir sind doch hier im Stall, oder? Es stinkt jedenfalls so. Ich sehe nur Rindviecher von der SS.«
Nun war es Walter, der ihm einen Stoß gab. »Lebensmüde, du Idiot?« Er sagte es hinter den Zähnen. »Statt dauernd große Reden zu schwingen, mach mal besser deine Arbeit! Was haben die verschissenen Stiefel und Schürzen im Milchraum zu suchen? Die Siebtücher waren nicht eingeweicht, überall lagen Schemel rum, und die Kälber standen im Zug. Kaum ist der Alte mal nicht da, lässt du alles schleifen. Auch deine Kammer sieht aus wie Sau. Ich sag dir, wenn der dir noch einen Vermerk reinwürgt, ist zappenduster. Dann kannst du deine Gesellenprüfung vergessen.«
»Uff«, machte Fiete und strich die Asche am Rand eines Pflanzenkübels ab. »Der große Häuptling Ata hat gesprochen. Alles muss immer blitzblank sein.« Er zog eine Flasche Dreistern aus der Hosentasche, trank einen Schluck. »Aber das sind die verdammten Flüchtlingsweiber, Mann! Die wissen gar nicht, wo vorne ist bei so ’ner Kuh. Die würden Besenstiele melken. Also erkläre ich denen, wie das geht, und das kostet natürlich Zeit: Schön sanft das Fett auftragen. Nicht ziehen an den Zitzen, drücken. Nicht kurz vorher aufhören, sondern gründlich ausstreichen das Tier. Und bis man wieder in den Klamotten steckt …« Er hielt Elisabeth die Flasche hin. »Stimmt’s, meine Kleine?«
Die verzog das Gesicht, tippte sich an die Stirn. »Fiete, du bist eine alte Sau, so richtig ordinär!«, sagte sie. »Kein Wunder, dass sie dich vom Gymnasium geschmissen haben.« Dann trank sie etwas von dem Schnaps, schüttelte sich und gab die Flasche an ihre Freundin weiter.
»Nein«, entgegnete Hedwig und wischte mit dem Handballen über die Öffnung. »Er ist eine junge Sau. Wo hast du eigentlich den Fusel her, du Gauner? Aus meiner Küche?«
Fiete sank gegen das Fensterkreuz, paffte den Rauch aus und schwieg, und Walter sagte: »Den hat er wahrscheinlich gegen Rahm getauscht. Ist ja egal, ob wir die Butter liefern können; ist nur Wehrkraftzersetzung. Was sind schon ein paar Jahre Lager … Und wo warst du heute Abend? Wolltest du mir nicht was zum Essen hinstellen?«
Hedwig, die sich die kastanienbraunen Haare zu Zöpfen geflochten hatte, zwei in sich gedrehte Affenschaukeln, machte große Augen. »Wie bitte? Na, hab ich doch!«, sagte sie in beleidigtem Ton und drückte den Rücken durch. »Was ist denn mit dir heute? Einen Teller voller Schinkenbrote, mit Gewürzgurke und Ei. Hatte sogar noch bisschen Kompott. Stand in der Kammer!«
Sie trug einen plissierten Wollrock und ihre BDM-Bluse, ohne Krawatte, und er wies auf die Kette mit den Schlüsseln, die in ihrem Ausschnitt hing. »Aber ich kam nicht in die Küche«, sagte er, woraufhin sie erschrocken Atem holte und sich eine Hand vor den Mund hielt.
Doch hinter den Fingern lächelte sie. »Entschuldige, Ata! Tut mir wirklich leid. Ich koch dir auch morgen dein Lieblingsgericht, versprochen! Hab noch eine Dose Spinat.«
Ernst Kobluhn, ihr Verlobter, kam aus dem Schankraum und stellte ein kleines Tablett voller frisch gezapfter Biere auf die Fensterbank. Auch er trug die Felduniform der Waffen-SS, mit einem Stern auf dem Kragenspiegel und dem schwarzen Verwundetenabzeichen in Herzhöhe. »Es lebe der Reichsnährstand!«, sagte er und schlug Walter auf die Schulter. Sie kannten sich aus dem Ruhrpott, waren Nachbarn in Essen-Borbeck gewesen. Beide hatten sie nach der Volksschule Bergmann werden wollen, wie fast alle in der Klasse, doch da die meisten Zechen wegen der Luftangriffe geschlossen waren, hatte das Arbeitsamt sie in den Norden geschickt. »Na, mein Bester, wie geht’s? Lange nicht gesehen. Was vom alten Urban gehört?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: