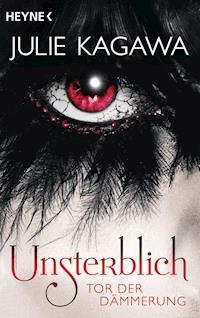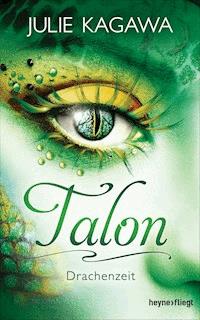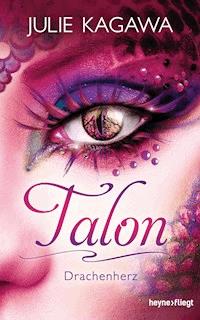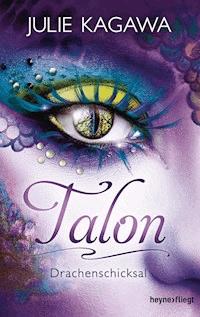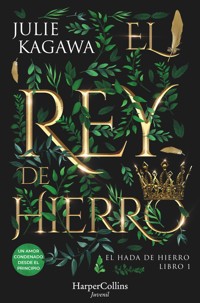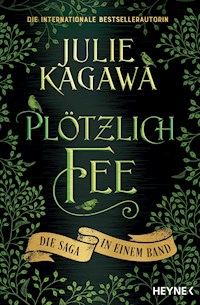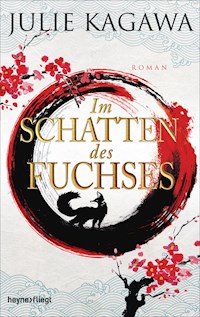
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schatten-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Vermächtnis, ein tapferes Mädchen und eine abenteuerliche Reise
Die junge Yumeko ist eine Gestaltwandlerin – halb Mensch, halb Füchsin. Im Kloster der Stillen Winde lernt sie unter der liebevollen Anleitung von Mönchen, ihre Gabe zu kontrollieren. Doch eines Nachts greifen mörderische Dämonen die Tempelanlage an und setzen sie in Brand. Yumeko gelingt es als Einziger zu fliehen, mit einem letzten Vermächtnis der Mönche in der Tasche: einer geheimnisvollen Pergamentrolle, die sie in einem Tempel in Sicherheit bringen soll. Darauf befindet sich der Teil einer uralten Beschwörung, die so gefährlich ist, dass sie einst in drei Teile zerrissen und an verschiedenen Orten aufbewahrt wurde. Unterwegs trifft Yumeko den Samurai Tatsumi, der auf der Suche nach eben jener Pergamentrolle ist. Gemeinsam setzen sie ihren Weg fort. Tatsumi weiß nicht, dass Yumeko hat, wonach er sucht. Yumeko weiß nicht, dass Tatsumi ein Geheimnis hütet, das sie beide umbringen könnte. Und beide ahnen nicht, dass sie sich niemals ineinander verlieben dürfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
JULIE KAGAWA
IM SCHATTEN DES FUCHSES
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Beate Brammertz und Ute Brammertz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel Shadow of the Fox
bei Harlequin Teen, Ontario
Copyright © 2018 by Julie Kagawa
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock.com
(CARACOLLA, Dimec, Ori Artiste, umiberry, Viktorija Reuta);
Coverdesign © HQ 2018;
Karte © Andreas Hancock
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-23605-2V002
Das Buch
»Eine einzelne Füchsin steht über allem, unberührt, in ihrem Schatten ein großer Drache. Sie heißt Yumeko, Kind der Träume, denn sie ist unsere Hoffnung gegen die heraufziehende Dunkelheit.«
Yumeko ist eine Gestaltwandlerin – halb Mensch, halb Füchsin. Im Kloster der Stillen Winde, tief im Wald verborgen, lernt sie, ihre Gabe zu kontrollieren. Doch dann greifen mörderische Dämonen die Tempelanlage an, und Yumeko ist die Einzige, die fliehen kann. Verborgen rettet sie das wichtigste Vermächtnis der Mönche: eine Schriftrolle, die sie in Sicherheit bringen soll. Es ist der Teil einer uralten Beschwörung, die den Großen Drachen und damit Finsternis und Schrecken über das gesamte Kaiserreich herbeirufen kann.
Der Weg ist unendlich gefährlich, doch mit einer List gelingt es Yumeko, einen mächtigen Gefährten zu finden: den Samurai Tatsumi. Schon bald fühlen sich die beiden unwiderstehlich zueinander hingezogen. Aber Tatsumi darf niemals wissen, wer Yumeko wirklich ist – und was sie in ihrem Besitz hat. Und er darf sich niemals in sie verlieben, sonst droht ihnen beiden der Tod …
Die Autorin
Schon in ihrer Kindheit gehörte Julie Kagawas große Leidenschaft dem Schreiben. Nach Stationen als Buchhändlerin und Hundetrainerin machte sie ihr Interesse zum Beruf. Mit ihren Fantasy-Serien »Plötzlich Fee« und »Plötzlich Prinz« wurde sie rasch zur internationalen Bestsellerautorin. Die darauffolgende Erfolgsserie »Talon« stand ganz im Zeichen der Drachen. Mit »Im Schatten des Fuchses« und »Im Schatten des Schwertes« erfüllt sich Julie Kagawa nun ihren Traum: Die Mythen Japans in einer großen Fantasy-Saga lebendig werden zu lassen. Julie Kagawa lebt mit ihrem Mann in Louisville, Kentucky.
Lieferbare Titel
Plötzlich Fee – Winternacht
Plötzlich Fee – Herbstnacht
Plötzlich Fee – Das Geheimnis von Nimmernie
Plötzlich Prinz – Das Erbe der Feen
Plötzlich Prinz – Das Schicksal der Feen
Plötzlich Prinz – Die Rache der Feen
Talon – Drachenzeit
Talon – Drachenherz
Talon – Drachennacht
Talon – Drachenblut
Talon – Drachenschicksal
Teil 1
1
ANFÄNGE UND ENDEN
Suki
An jenem Tag, als Suki im Sonnenpalast eintraf, regnete es, und es regnete auch an dem Abend, als sie starb.
»Du bist die neue Zofe, nicht wahr?«, wollte eine Frau mit schmalem, knochigem Gesicht wissen und musterte sie von Kopf bis Fuß. Suki zitterte und spürte, wie kaltes Regenwasser ihren Rücken hinunterrann und von ihrem Haar auf den erlesenen Holzboden tropfte. Die erste Hausdame rümpfte die Nase. »Na ja, eine Schönheit bist du nicht gerade, das ist mal sicher. Aber egal – Lady Satomis letzte Zofe war hübsch wie ein Schmetterling, mit halb so viel Verstand.« Sie beugte sich näher und verengte die Augen zu Schlitzen. »Sag mal, Mädchen. Es heißt, du hättest das Geschäft deines Vaters geführt, bevor du hierhergekommen bist. Hast du eine Portion Grips zwischen den Ohren? Oder ist da nur Luft, wie bei der Letzten?«
Suki kaute an ihrer Unterlippe und sah zu Boden. Sie hatte ein knappes Jahr lang im Geschäft ihres Vaters in der Stadt ausgeholfen. Als einziges Kind eines berühmten Flötenbauers musste sie sich oft um die Kundschaft kümmern, wenn ihr Vater arbeitete und zu vertieft in seine Aufgabe war, um zu essen oder mit irgendjemandem zu reden, bis sein neuestes Meisterwerk fertig war. Suki konnte so gut wie jeder Junge lesen und rechnen, doch als Mädchen war es ihr nicht gestattet, das Geschäft ihres Vaters zu erben oder sein Handwerk zu erlernen. Mura Akihito war immer noch rüstig, doch der Jüngste war er nicht mehr, und seine vormals gelenkigen Finger versteiften sich allmählich durch die unermüdliche Beanspruchung über all die Jahre. Statt Suki zu verheiraten, hatte ihr Vater seinen kläglichen Einfluss genutzt, um ihr eine Stelle im Kaiserpalast zu verschaffen, damit sie bei seinem Ableben gut versorgt wäre. Suki vermisste ihr Zuhause, und sie fragte sich verzweifelt, ob es ihrem Vater ohne sie gut ging, doch sie wusste, dass dies sein Wunsch gewesen war.
»Ich weiß es nicht, Ma’am«, flüsterte sie.
»Pffft. Na ja, das werden wir noch früh genug herausfinden. Aber für Lady Satomi würde ich mir eine bessere Antwort einfallen lassen. Ansonsten wirst du sogar noch kürzer bleiben als deine Vorgängerin. Nun«, fuhr sie fort, »mach dich etwas zurecht, geh dann in die Küche und hol Lady Satomis Tee. Die Köchin wird dir sagen, wohin du ihn bringen sollst.«
Ein paar Minuten später balancierte Suki ein volles Teetablett über die Veranda und versuchte, sich an die Wegbeschreibung zu erinnern, die man ihr gegeben hatte. Der Sonnenpalast des Kaisers war eine eigene kleine Stadt; der Hauptpalast, wo der Kaiser und seine Familie lebten, überragte alles, doch zwischen dem Bergfried und der inneren Mauer befand sich ein Labyrinth aus Bauwerken und Befestigungsanlagen, alle daraufhin angelegt, den Kaiser zu schützen und eine einfallende Armee in die Irre zu führen. Adelige, Höflinge und Samurai stolzierten auf den Wegen hin und her, gekleidet in atemberaubenden Farben und Schnitten: weiße Seide mit zarten Kirschblütenblättern oder ein leuchtendes Rot mit goldenen Chrysanthemenblüten. Kein einziger Adeliger, dem Suki begegnete, würdigte sie eines Blickes. Nur die einflussreichsten Familien residierten so unweit des Kaisers; je näher man am Hauptfried des Palastes wohnte, desto wichtiger war man.
Suki wanderte durch den Irrgarten aus Veranden, und ihr Magen verkrampfte sich immer mehr, während sie erfolglos nach dem richtigen Quartier suchte. Alles sah gleich aus. Gebäude mit grauen Dächern, Bambus und Papierwänden, und dazwischen Holzveranden, damit die Adeligen sich nicht die Kleidung mit Schmutz und Tau besudelten. Blau geziegelte Türme erhoben sich über ihr in majestätischer Pracht, und Dutzende unterschiedlicher Singvögel zwitscherten von den Ästen der perfekt gestutzten Bäume, doch die Enge in Sukis Brust und ihr rebellierender Magen machten es ihr unmöglich, irgendetwas davon zu genießen.
Ein hoher, klarer Ton durchschnitt die Luft, stieg über den Dächern empor, und Suki blieb wie angewurzelt stehen. Ein Vogel war es nicht, auch wenn eine Drossel, die in einem Gebüsch in der Nähe hockte, eine laute Antwort trillerte. Es war ein Klang, den Suki sofort erkannte, von dem sich jede einzelne Note in ihr Gedächtnis gebrannt hatte. Wie oft hatte sie ihn gehört, wenn er sich aus der Werkstatt ihres Vaters erhob? Die süße, schwermütige Melodie einer Flöte.
Verzaubert folgte sie den Klängen und vergaß kurzzeitig ihre Pflichten und dass ihre neue Herrin ganz bestimmt sehr verärgert darüber wäre, wenn ihr Tee so spät kam. Das Lied zog sie an, eine leidenschaftliche, traurige Melodie, als würde man sich verabschieden oder beobachten, wie der Herbst verblasste. Suki erkannte, dass der Flötenspieler, wer auch immer es sein mochte, tatsächlich Talent besaß; das Lied wurde mit so viel Gefühl gespielt, dass es war, als lausche sie jemands Seele.
Derart hypnotisiert war Suki vom Klang der Flöte, dass sie nicht darauf achtete, wohin sie ging. Sie bog um eine Ecke und schrie bestürzt auf, als ein junger Adeliger in himmelblauem Gewand, eine Bambusflöte an den Lippen, ihr den Weg versperrte. Die Teekanne klapperte, und die Tassen wackelten gefährlich, während sie ihm auswich und dabei verzweifelt versuchte, den Inhalt nicht zu verschütten. Der Klang der Flöte verstummte, als sich der Adelige, sehr zu Sukis Verblüffung, umdrehte und eine Hand ausstreckte, um das Tablett zu halten, bevor es auf die Veranda fallen konnte.
»Vorsicht.« Seine Stimme war hell und klar. »Bloß nichts fallen lassen – das gäbe eine schreckliche Schweinerei. Alles in Ordnung?«
Suki starrte ihn an. Er war der attraktivste Mann, den sie je gesehen hatte. Nein, nicht attraktiv, entschied sie. Schön. Seine breiten Schultern ließen das Gewand, das er trug, straff sitzen, doch seine Gesichtszüge waren anmutig und zart. Statt des Haarknotens eines Samurai trug er das Haar lang und gerade, es fiel ihm bis weit über die Schultern und war vollkommen weiß, die Farbe von Bergschnee. Noch verblüffender war, dass er sie anlächelte – nicht das kalte, amüsierte Grinsen der meisten Adeligen und Samurai, sondern ein echtes Lächeln, das bis in die Mondsicheln seiner Augen reichte.
»Verzeihung, bitte«, sagte der Mann, ließ das Tablett los und trat rasch einen Schritt zurück. Seine Miene war gelassen, keineswegs verärgert. »Es war meine Schuld, mich mitten auf den Weg zu stellen, ohne zu bedenken, dass jemand mit einem Teetablett um die Ecke geeilt kommen könnte. Ich hoffe, ich habe keine Unannehmlichkeiten bereitet, Miss …?«
Suki öffnete den Mund zweimal, bevor sie einen Ton hervorbrachte. »Bitte vergebt mir, Mylord.« Ihre Stimme war ein Flüstern. So redeten Adelige nicht mit einfachen Leuten, selbst sie wusste das. »Ich heiße Suki, und ich bin nur eine Zofe. Bitte macht Euch wegen jemandem wie mir keine Umstände.«
Der Adelige lachte glucksend. »Es sind keine Umstände, Suki-san«, sagte er. »Ich vergesse oft, wo ich bin, wenn ich spiele.« Er hob die Flöte, und ihr Herz tat einen Sprung. »Bitte verschwende keinen Gedanken mehr daran. Du darfst dich wieder deinen Pflichten zuwenden.«
Er trat beiseite, um sie vorbeizulassen, doch Suki rührte sich nicht, da sie den Blick nicht von dem Instrument in seiner schlanken Hand lösen konnte. Es war aus poliertem Holz, dunkel und gerader als jeder Pfeil, mit einem charakteristischen goldenen Ring um ein Ende. Sie wusste, dass sie nicht mit dem Adeligen reden sollte, dass er den Befehl erteilen konnte, sie auspeitschen, in den Kerker werfen, gar hinrichten zu lassen, wenn er es wünschte, aber die Worte entschlüpften ihr trotzdem: »Ihr spielt meisterhaft, Mylord«, flüsterte sie. »Verzeiht mir. Ich weiß, es steht mir nicht zu, so etwas zu sagen, aber mein Vater wäre sehr stolz.«
Er legte den Kopf schräg, und über sein schönes Gesicht huschte ein überraschter Ausdruck. »Dein Vater?«, fragte er und schien allmählich zu begreifen. »Du bist die Tochter von Mura Akihito?«
»Hai.«
Er lächelte und nickte ihr kaum merklich zu. »Das Lied ist nur so schön wie das Instrument«, erklärte er ihr. »Wenn du deinen Vater wiedersiehst, richte ihm aus, dass es mir eine Ehre ist, ein solches Meisterstück zu besitzen.«
Suki schnürte es die Kehle zu, und ihre Augen brannten, während sie gegen die Tränen ankämpfte. Der Adelige wandte sich höflich ab und täuschte Interesse an einem Kirschbaum vor, um ihr Zeit zu geben, die Fassung wiederzuerlangen. »Ach, aber du hast dich vielleicht verlaufen?«, erkundigte er sich schließlich, während er einen Schmetterlingskokon an einem der schlanken Äste inspizierte. Als er sich Suki nun zuwandte, zog er die schmalen Brauen hoch, doch sie erblickte keinen Spott in seiner Haltung oder Stimme, lediglich Belustigung, wie man sie vielleicht empfände, wenn man mit einer herumwandernden Katze redete. »Der Palast des Kaisers kann für Uneingeweihte tatsächlich überwältigend sein. Wessen Quartier bist du zugeteilt, Suki-san? Vielleicht kann ich dir den Weg weisen.«
»L-Lady Satomi, Mylord«, stammelte Suki, die angesichts seiner Güte ziemlich verdutzt war. Sie wusste, dass sie sich verbeugen sollte, doch sie hatte eine Heidenangst, den Tee zu verschütten. »Bitte verzeiht mir, ich bin erst heute im Palast eingetroffen, und alles ist sehr verwirrend.«
Ein leichtes Stirnrunzeln huschte über das Gesicht des Adeligen, sodass Suki beinahe das Herz in der Brust stehen blieb, weil sie glaubte, ihn gekränkt zu haben. »Aha«, murmelte er, hauptsächlich zu sich selbst. »Noch eine Zofe, Satomi-san? Wie viele braucht die Konkubine des Kaisers?«
Bevor Suki sich fragen konnte, was seine Worte zu bedeuten hatten, schüttelte er sich und lächelte wieder. »Nun, das Glück ist dir hold, Suki-san. Lady Satomis Gemächer sind nicht weit von hier.« Er hob einen sich bauschenden Ärmel und deutete elegant mit dem Finger den Weg hinunter. »Geh links um dieses Gebäude, dann geh ganz bis zum Ende geradeaus. Es ist der letzte Eingang auf der rechten Seite.«
»Daisuke-san!« Eine Frauenstimme hallte von der Veranda wider, bevor Suki auch nur ein Dankeschön flüstern konnte, und der Mann wandte sein schönes Gesicht ab. Im nächsten Moment stolzierte ein Trio Edelfrauen in eleganten grün-goldenen Kleidern um das Gebäude. Während sie heraneilten, bedachten sie ihn mit einem gespielten Stirnrunzeln.
»Da seid Ihr ja, Daisuke-san«, empörte sich eine. »Wo seid Ihr gewesen? Wir kommen zu spät zu Hanoe-sans Lyriklesung. Oh!«, sagte sie bei Sukis Anblick. »Was ist das? Daisuke-san, erzählt mir nicht, Ihr wart die ganze Zeit über hier und habt Euch mit einer Zofe unterhalten!«
»Und warum nicht?« Daisukes Tonfall war gequält. »Die Worte einer Zofe können so interessant sein wie die einer Adeligen.«
Die drei Frauen kicherten, als sei es das Witzigste, was sie jemals gehört hatten. Suki begriff nicht, was derart amüsant war. »Oh, Taiyo Daisuke, Ihr sagt die verwegensten Dinge«, schalt eine von ihnen hinter einem weißen, mit Kirschblüten bemalten Fächer. »Kommt schon. Wir müssen wirklich los. Du«, sagte sie und richtete den Blick auf Suki, »kümmere dich gefälligst wieder um deine Pflichten. Warum stehst du hier gaffend herum? Husch!«
Suki eilte so schnell es ging davon, ohne den Tee zu verschütten. Doch ihr Herz pochte immer noch heftig, und irgendwie kam sie nicht zu Atem. Taiyo. Taiyo lautete der Name der kaiserlichen Familie. Daisuke-sama gehörte dem Sonnenclan an, einer der mächtigsten Familien in Iwagoto, der direkten Blutlinie des Kaisers. Das komische Gefühl in ihrer Magengegend wurde stärker, und ihre Gedanken verloren sich in der Erinnerung an sein Lächeln und die Melodie der Flöte ihres Vaters.
Irgendwie fand sie den Weg zur richtigen Tür, ganz am Ende der Veranda, mit einem Ausblick auf die prächtigen Gärten des Palastes. Das Shoji-Paneel stand offen, und Suki nahm das intensive Aroma verbrennenden Räucherwerks wahr, das aus dem abgedunkelten Innern drang. Als sie in den Raum schlich, sah sie sich nach ihrer neuen Herrin um, erblickte allerdings niemanden. Trotz der Vorliebe des Adels für Schlichtheit herrschte in diesen Räumlichkeiten eine verschwenderische Unordnung. Dekorative Wandschirme verstellten die Sicht, und dicke, weiche Tatamimatten bedeckten den gesamten Boden. Überall war Papier; Origamiblätter in jeder Machart und Textur lagen stapelweise herum. Gefaltete Papiervögel spähten ihr von jeder ebenen Fläche entgegen und beherrschten den Raum. Suki schob einen Schwarm Origamikraniche vom Tisch, um den Tee abstellen zu können.
»Mai-chan?« Eine hauchzarte Stimme ertönte aus dem angrenzenden Zimmer, und sie vernahm das Rascheln von Seide, als sich jemand näherte. »Bist du das? Wo warst du? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du – oh!«
Eine Frau erschien im Türrahmen, und einen Moment lang starrten sie sich an, während Suki vor Verblüffung der Mund offen stand.
Wenn Taiyo Daisuke der schönste Mann war, dem sie je begegnet war, dann war das hier die eleganteste weibliche Schönheit im ganzen Palast. Ihre sich bauschenden Kleider waren rot mit silbernen, goldenen und grünen Schmetterlingen auf der Vorderseite. Ihr glänzendes schwarzes Haar war zu einer kunstvollen Hochfrisur gesteckt, geschmückt mit rot-goldenen Stäbchen und Elfenbeinkämmen. Dunkle Augen in einem makellosen Porzellangesicht betrachteten Suki neugierig.
»Hallo«, sagte die Frau, und Suki schloss rasch den Mund. »Darf ich fragen, wer du bist?«
»Ich … ich bin Suki«, stammelte sie. »Ich bin Eure neue Zofe.«
»Aha.« Die Lippen der Frau verzogen sich zu einem matten Lächeln. Suki war sicher, wenn ihre Zähne zu sehen wären, würden sie sie in ihrer Makellosigkeit blenden. »Komm doch bitte her, kleine Suki-chan. Bitte tritt auf nichts.«
Suki gehorchte, setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um keines der Papiergeschöpfe zu zertrampeln, und stellte sich vor Lady Satomi.
Die Frau schlug ihr mit der offenen Handfläche ins Gesicht.
Schmerz explodierte hinter ihrem Auge, und sie stürzte zu Boden, zu verblüfft, um dabei auch nur aufzukeuchen. Die Tränen zurückblinzelnd legte sie die Hand an ihre Wange und sah zu Lady Satomi hoch, die lächelnd vor ihr aufragte.
»Weißt du, warum ich das getan habe, kleine Suki-chan?«, fragte sie, und jetzt zeigte sie ihre Zähne. Sie erinnerte Suki an einen grinsenden Totenkopf.
»N… Nein, Mylady«, murmelte sie, während ihre Wange brannte.
»Weil ich nach Mai-chan gerufen habe, nicht nach dir«, erwiderte die Lady mit gnadenlos fröhlicher Stimme. »Du magst ein dummes Mädchen vom Land sein, Suki-chan, aber das entschuldigt nicht deine völlige Unwissenheit. Du darfst nur kommen, wenn du gerufen wirst, verstanden?«
»Ja, Mylady.«
»Lächle, Suki-chan«, riet Satomi ihr. »Wenn du lächelst, gelingt es mir vielleicht zu vergessen, dass du redest wie ein unzivilisierter Bauerntölpel und aussiehst wie eine Kuh. Es ist schwierig, bei deinem Anblick keinen Ekel zu empfinden, aber ich werde mein Bestes geben. Ist das nicht großzügig von mir, Suki-chan?«
Suki, die nicht wusste, was sie darauf erwidern sollte, hielt den Mund und dachte an Daisuke-sama.
»Ist das nicht großzügig von mir, Suki-chan?«, wiederholte Satomi, jetzt in schärferem Ton.
Suki schluckte heftig. »Hai, Lady Satomi.«
Satomi seufzte. »Du hast meine Kreationen zerstört.« Sie zog einen Schmollmund, und Suki senkte den Blick zu den Origamigeschöpfen, die unter ihrem Gewicht zerdrückt worden waren. Mit gerümpfter Nase wandte die Lady sich ab. »Ich werde sehr böse sein, wenn du sie nicht ersetzt. Im Winddistrikt gibt es einen hübschen kleinen Laden, der feines Lavendelpapier verkauft. Wenn du dich beeilst, solltest du es schaffen, bevor sie schließen.«
Suki sah durch einen geöffneten Schirm zu den Gewitterwolken, die sich über dem Palast zusammenbrauten. Donner grollte, während silber-blaue Fäden über den Himmel jagten. »Ja, Lady Satomi.«
Die folgenden Tage weckten in Suki eine Sehnsucht nach dem Laden ihres Vaters, nach der ruhigen, behaglichen Zeit, als sie noch kehrte, zerrissene Kleidung flickte und dreimal am Tag eine Mahlzeit kochte. Nach dem beruhigenden Geruch von Sägemehl und Holzspänen und nach den Kunden, die sie kaum eines zweiten Blickes würdigten, da es ihnen nur um ihren Vater und dessen Arbeit ging. Sie hatte geglaubt, es wäre ganz einfach, die Zofe einer herrschaftlichen Lady zu sein, ihr beim Ankleiden zu helfen, Botengänge für sie zu erledigen und sich um die profanen kleinen Aufgaben zu kümmern, die unter ihrer aristokratischen Würde waren. Vielleicht hätte es eigentlich so sein sollen – jedenfalls schienen die anderen Zofen nicht ihr Los zu teilen. Ja, sie schienen ihr sogar absichtlich aus dem Weg zu gehen, als würde man durch den Umgang mit Lady Satomis Zofe den Zorn ihrer Herrin auf sich ziehen. Suki konnte es ihnen nicht verübeln.
Lady Satomi war ein Albtraum, ein wunderschöner Albtraum aus Seide, Schminke und betörendem Parfüm. Nichts, was Suki tat, passte dieser Frau. Sosehr sie auch schrubbte und wusch, die Wäsche geriet nie zu Satomis Zufriedenheit. Der Tee, den Suki zubereitete, war zu schwach, zu stark, zu süß, immer zu irgendetwas. In Lady Satomis Gemächern konnte nie genug geputzt werden – es ließ sich immer ein Schmutzpartikel finden, eine Tatamimatte lag schief, ein Origamigeschöpf war am falschen Platz. Und jedes Versagen veranlasste die Lady zu einem kleinen Lächeln und einer kräftigen Ohrfeige.
Und natürlich kümmerte es niemanden. Die anderen Zofen wandten den Blick von ihren blauen Flecken ab, und die Wachen sahen sie überhaupt nicht an. Suki wagte nicht, sich zu beklagen; Lady Satomi war nicht nur eine bedeutende und mächtige Lady, sie war die Lieblingskonkubine des Kaisers. Schlecht von ihr zu reden wäre eine Beleidigung für Taiyo no Genjiro, den großen Himmelssohn, und würde ihr eine Auspeitschung, öffentliche Demütigung oder Schlimmeres einbringen.
Das Einzige, was Suki davor bewahrte, vollständig zu verzweifeln, war der Gedanke, wieder Daisuke-sama über den Weg zu laufen. Er war natürlich ein hoher Adeliger, standesgemäß weit über ihr, und würde sich nicht um die Schwierigkeiten einer einfachen Zofe kümmern. Doch ein einziger Blick auf ihn würde ihr genügen. Sie hielt auf den Veranden und den Wegen vor Lady Satomis Gemächern nach ihm Ausschau, doch der schöne Aristokrat ließ sich nirgends blicken. Später erfuhr sie durch Dienstbotentratsch, dass Taiyo Daisuke den Sonnenpalast kurz nach ihrer Ankunft verlassen hatte und zu einer seiner geheimnisvollen Pilgerfahrten quer durchs Land aufgebrochen war. Vielleicht, überlegte Suki, würde sie bei seiner Rückkehr einen Blick auf ihn erhaschen. Vielleicht würde sie wieder die Flöte ihres Vaters hören und ihr folgen, bis sie ihn auf einer Veranda entdeckt hatte, wo er stand und spielte, wobei ihm das lange weiße Haar den Rücken hinabfiel.
Eine schallende Ohrfeige riss sie aus ihrem Tagtraum und warf sie zu Boden. »O je! Du bist ja so ein ungeschicktes Mädchen.« Lady Satomi stand vor ihr, prächtig in ihrer atemberaubenden Seidenrobe. »Steh auf, Suki-chan. Ich habe eine Aufgabe für dich.«
In den Armen trug die Lady eine Rolle edler Seidenschnur von blutroter Farbe. Als Suki taumelnd auf die Beine kam, wurde ihr die Kordel zugeschoben. »Du bist so ein dummes kleines Ding, nicht wahr? Ich hege keinerlei Hoffnung, je eine gute Zofe aus dir zu machen. Aber selbst du wirst doch bestimmt diesen kleinen Botengang erledigen können. Bring dieses Seil zum Lagerhaus in den östlichen Gärten, dasjenige hinter dem See. Wenigstens das wirst du doch hinbekommen? Und hör auf zu weinen, Mädchen. Was sollen denn die Leute von mir denken, wenn meine Zofe überall flennend herumläuft?«
Mit pochenden Kopfschmerzen kam Suki im Dunkeln zu sich. Sie sah nur verschwommen, und in ihrer Kehle war ein seltsamer Kupfergeschmack. Über ihr grollte Donner, und ein scharfer, nach Ozon riechender Wind blies ihr ins Gesicht. Der Boden unter ihr fühlte sich kalt und hart an, kantige Steine drückten sich unangenehm in ihren Bauch und ihre Wange. Blinzelnd versuchte sie, sich hochzustemmen, doch ihre Arme reagierten nicht. Im nächsten Augenblick begriff sie, dass sie hinter ihrem Rücken gefesselt waren.
Eine Eiseskälte überkam sie. Sie rollte sich auf die Seite und versuchte aufzustehen, doch ihre Knie und Fußknöchel waren ebenfalls zusammengebunden – mit demselben Seil, das sie in das Lagerhaus gebracht hatte, wie ihr klar wurde –, und ein Lumpen war ihr in den Mund gestopft worden, festgebunden mit einem Stoffstreifen. Mit einem gedämpften Kreischen trat sie wild um sich und wand sich auf den Steinen. Schmerz schoss ihre Arme hoch, als sie am Boden entlangschrammte und sich die Haut an den Felskanten aufriss, doch die Seile hielten. Vor Erschöpfung keuchend sackte sie auf den Steinen zusammen. Schließlich hob sie den Kopf, um ihre Umgebung zu betrachten.
Sie lag mitten in einem Hof, doch es war nicht der makellose, prächtige Hof des Sonnenpalastes, mit seinen gefegten weißen Steinen und gestutzten Büschen. Der hier war dunkel, felsig, eine Ruine. Die Burg, zu der er gehörte, schien ebenfalls dunkel und verlassen und ragte bedrohlich über Suki empor wie ein gewaltiges, finsteres Untier, während zerrissene Fahnen im Wind gegen die Mauern schlugen. Totes Laub und zerbrochene Steine waren im Hof zerstreut, und einen Meter von ihr entfernt lag der verrostete Helm eines Samurai. Im flackernden Licht über ihr bemerkte sie das Glitzern von Augen auf den Mauern – Dutzende Krähen, die sie beobachteten, die Federn im Wind aufgestellt.
»Hallo, Suki-chan«, sagte eine gespenstisch gut gelaunte Stimme irgendwo hinter ihr. »Bist du endlich aufgewacht?«
Suki bog den Kopf nach hinten. Lady Satomi stand ein paar Schritte entfernt, das Haar offen und windzerzaust, und die Ärmel ihres rot-schwarzen Kimonos flatterten wie Segel. Ihr Blick war hart, und die Lippen hatte sie zu einem winzigen Lächeln verzogen. Keuchend schob Suki sich in eine Sitzposition, wollte um Hilfe rufen, wollte fragen, was vor sich ging. War das hier irgendeine schreckliche Bestrafung, weil sie ihre Herrin enttäuscht hatte, weil sie nicht zu ihrer Zufriedenheit geputzt, Dinge geholt oder serviert hatte? Sie versuchte, mit den Augen zu flehen, heiße Tränen rannen ihre Wangen hinunter, doch die Lady rümpfte nur die Nase.
»So ein faules Mädchen und so zerbrechlich. Ich ertrage dein ständiges Geheule nicht.« Lady Satomi schniefte und trat etwas zurück, ohne sie noch einmal anzusehen. »Nun, sei froh, Suki-chan. Denn heute nimmt dein Elend ein Ende. Auch wenn das bedeutet, dass ich mir schon wieder eine neue Zofe zulegen muss – was ist nur mit all diesen Dienstmädchen, die wie Mäuse weglaufen? Undankbares Pack. Nicht das geringste Verantwortungsgefühl.« Sie stieß ein lang gezogenes Seufzen aus und sah dann zu den Wolken hoch, als ein Blitz aufflackerte und der Wind an Stärke zunahm. »Wo steckt dieser Oni?«, murmelte sie. »Nach all der Mühe, die ich mir wegen einer angemessenen Entschädigung gemacht habe, würde es mich sehr ärgern, wenn er nicht vor dem Unwetter eintrifft.«
Oni? Suki musste sich verhört haben. Oni waren große, schreckliche Dämonen, die aus dem Jigoku kamen, dem Reich des Bösen. Es gab unzählige Geschichten über tapfere Samurai, die Oni erschlugen, manchmal ganze Heerscharen von Oni, aber es waren Mythen und Legenden. Oni waren die Wesen, mit denen Eltern unartigen Kindern drohten – spazier nicht zu dicht am Wald vorbei, oder ein Oni schnappt dich. Sei folgsam und hör auf ältere Menschen, oder ein Oni wird durch die Dielenbretter greifen und dich ins Jigoku hinunterzerren. Furchterregende Warnungen für Kinder und monströse Widersacher für legendäre Samurai, aber keine Wesen, die in Ningen-Do existierten, dem Reich der Sterblichen.
Es folgten ein greller Blitz, ein Donnerschlag – und ein gewaltiges Geschöpf mit Hörnern erschien am Rand des Hofes.
Suki schrie auf. Der Knebel dämpfte das Geräusch, doch sie schrie immer weiter, bis sie völlig außer Atem war und in das Tuch keuchte. Sie versuchte trotz der Fesseln zu fliehen und stürzte hart auf den Steinboden, wobei sie sich das Kinn am Fels aufschlug, doch sie spürte den Schmerz kaum. Lady Satomis Lippen bewegten sich, während sie ihr einen vernichtenden Blick zuwarf und sie wahrscheinlich für ihr schrilles Geschrei schalt. Doch Sukis Gedanken galten nur noch dem riesigen Dämon, denn dieses Wesen, was sich da in den Schein der Fackeln schob, konnte nur aus einem Albtraum sein. Das Ungeheuer, das eigentlich nicht existieren durfte.
Es war gewaltig, ragte gute viereinhalb Meter empor und war genauso furchterregend, wie die Legenden es beschrieben. Seine Haut war von einem dunklen Karmesin, der Farbe von Blut, und eine wilde schwarze Mähne ergoss sich über Rücken und Schultern. Scharfe gelbe Stoßzähne bogen sich aus seinem Kiefer, und seine Augen glühten wie heiße Kohlen, als der Dämon auf sie zustapfte, sodass der Boden erbebte. Obwohl Suki vor Angst erstarrt war, funktionierte ihr Gehirn noch so weit, dass sie sich plötzlich daran erinnerte, dass Oni in den Geschichten Lendenschürze trugen, die aus großen gestreiften Tierfellen angefertigt waren, doch dieser Dämon trug Platten aus lackierter Rüstung, die roten Schulterschoner, Beinschützer und Armschienen der Samurai, wenn sie in die Schlacht zogen. Mythengetreu hielt er allerdings einen gigantischen, mit Eisenstiften bewehrten Knüppel – einen Tetsubo – in einer Hand und schwang ihn über eine Schulter, als wiege er nicht mehr als ein Stück Stangentusche.
»Da bist du ja endlich, Yaburama.« Lady Satomi hob das Kinn, als der Oni vor ihr innehielt. »Mir ist klar, dass es im Jigoku keine Zeit gibt und es heißt, ein Tag gleiche achthundert Jahren im Reich der Sterblichen, aber Pünktlichkeit ist eine wunderbare Eigenschaft, etwas, wonach wir alle streben sollten.«
Der Oni grunzte, ein tiefes, kehliges Geräusch, das zwischen seinen Fängen hervordrang. »Belehr mich nicht, Menschenwesen«, donnerte er, und seine schreckliche Stimme ließ die Luft erzittern. »Das Jigoku anzurufen braucht Zeit, besonders, wenn man ein Heer heraufbeschwören möchte.«
Hinter dem Dämon tauchte eine Horde kleinerer Ungeheuer auf und sammelte sich um ihn herum. Nur ein paar Zentimeter größer als kniehoch und mit Haut in verschiedenen Blau-, Rot- und Grüntönen sahen sie selbst wie winzige Oni aus, abgesehen von ihren riesigen, ausladenden Ohren und ihrem irren Grinsen. Sie bemerkten Suki und begannen, sich vorwärtszuschieben, während sie gackernd lachten und sich die spitzen Zähne leckten. Suki kreischte in den Knebel und versuchte, sich wegzuwinden, kam aber nicht weiter als ein Fisch an Land.
Der Oni knurrte eine Warnung, tief wie entferntes Donnern, und die Horde wich zurück. »Ist das für mich?«, fragte der Dämon, dessen glühender blutroter Blick auf Suki fiel. »Es sieht lecker aus.« Er trat einen Schritt auf sie zu, und beinahe wäre sie auf der Stelle in Ohnmacht gefallen.
»Geduld, Yaburama.« Lady Satomi streckte eine Hand aus, um ihm Einhalt zu gebieten. Er verengte die Augen und fletschte leicht die Zähne, doch das schien die Lady nicht zu beunruhigen. »Du kannst deinen Lohn gleich erhalten«, fuhr sie fort. »Ich will bloß sicherstellen, dass du weißt, warum du gerufen wurdest. Dass du weißt, was du tun musst.«
»Wie könnte ich das nicht.« Der Oni klang ungeduldig. »Der Drache erhebt sich. Der Herold des Wandels nähert sich. Wieder einmal sind in diesem Reich aus schrecklichem Licht und Sonne tausend Jahre vergangen, und die Nacht des Wunsches steht beinahe vor der Tür. Es gibt nur einen Grund, warum mich ein Sterblicher zu diesem Zeitpunkt nach Ningen-Do rufen würde.« Er grinste verächtlich. »Ich werde dir die Schriftrolle bringen, Menschenwesen. Beziehungsweise ein Stück davon, nachdem sie nun in alle vier Winde verstreut ist.« Der brennende rote Blick glitt zu Suki zurück, und er lächelte langsam, entblößte seine Fangzähne. »Ich werde es erledigen, nachdem ich mir meinen Lohn geholt habe.«
»Gut.« Lady Satomi trat zurück, während die ersten Regentropfen fielen. »Ich zähle auf dich, Yaburama. Ich bin mir sicher, dass es auch andere gibt, die mit aller Macht die Stücke der Drachenschriftrolle an sich bringen wollen. Du weißt, was zu tun ist, falls du ihnen begegnen solltest. Nun …« Sie öffnete einen pinkfarbenen Regenschirm und schwang ihn über den Kopf. »Ich überlasse es dir. Viel Vergnügen.«
Als wahre Regengüsse auf den Hof niederprasselten, drehte Lady Satomi sich um und ging davon. Suki schrie in den Knebel und warf sich ihrer Herrin hinterher. Sie weinte und flehte, betete zu den kami und jedem sonst, der sie erhören mochte. Bitte, dachte sie in ihrer Verzweiflung. Bitte, ich kann so nicht sterben. Nicht so.
Lady Satomi hielt inne und blickte mit einem Lächeln zu ihr zurück. »Oh, sei nicht traurig, kleine Suki-chan«, sagte sie. »Das hier ist dein größter Moment. Du wirst der Auslöser sein, durch den eine neue Ära eingeläutet wird. Dieses Kaiserreich, die ganze Welt werden sich wegen deines heutigen Opfers verändern. Begreifst du das?« Die Lady legte den Kopf schräg und betrachtete sie, als wäre sie ein winselnder Welpe. »Du hast dich tatsächlich als nützlich erwiesen. Mehr kann jemand deinesgleichen doch gewiss nicht erwarten.«
Hinter Suki bebte der Erdboden, eine gewaltige Klaue schloss sich um ihre Beine, und gebogene Krallen versanken in ihrer Haut. Sie schrie und schlug um sich, zerrte an den Seilen und versuchte, sich dem Griff des Dämons zu entwinden, doch es gab kein Entrinnen. Lady Satomi rümpfte die Nase, drehte sich weg und ging weiter. Ihr Schirm wippte im Regen auf und ab, während Suki zu dem Oni gezogen wurde und die kleineren Dämonen kreischend um sie herumtanzten.
Hilfe! Bitte, helft mir! Irgendjemand! Daisuke-sama … Schlagartig richteten sich ihre Gedanken auf den Adeligen, sein schönes Gesicht und sanftes Lächeln, obgleich sie wusste, dass er nicht kommen würde. Niemand kam, denn niemanden kümmerte der Tod eines einfachen Dienstmädchens. Vater, dachte Suki in starrer Verzweiflung, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht allein lassen.
Tief in ihrem Innern flackerte Zorn auf und überdeckte kurzzeitig die Angst. Es war schrecklich ungerecht, von einem Dämon getötet zu werden, bevor sie irgendetwas im Leben erreicht hatte. Zwar war sie bloß eine Dienerin, aber sie hatte gehofft, einen guten Mann zu heiraten, Kinder großzuziehen, etwas zu hinterlassen, das von Bedeutung war. Ich bin nicht bereit, dachte Suki verzweifelt. Ich bin nicht bereit zu gehen. Bitte noch nicht.
Klauenartige Finger schlossen sich um ihren Hals, und sie wurde hochgehoben, bis sie sich dem schrecklichen, hungrigen Lächeln des Oni gegenübersah. Sein heißer Atem, der nach Rauch und verfaultem Fleisch roch, strömte ihr ins Gesicht, als der Dämon den Rachen öffnete. Gnädigerweise entschieden die Götter, endlich einzuschreiten, und Suki fiel vor Angst in Ohnmacht, ihr Bewusstsein verließ ihren Körper in dem Moment, bevor er entzweigerissen wurde.
Der Geruch nach Blut durchzog die Luft, und die Dämonen heulten vor Entzücken auf. Von Sukis zerfetztem Körper stieg, unbemerkt von der Horde und für normale Augen unsichtbar, eine kleine Lichtkugel langsam in die Luft empor. Sie schwebte über der grausigen Szene und schien zuzusehen, wie sich die kleineren Dämonen um die Fetzen stritten und sich Yaburamas dröhnendes Gebrüll in die Nacht erhob, während er nach ihnen schlug. Einen Augenblick schien die kleine Lichtkugel hin und her gerissen zu sein, ob sie in die Wolken fliegen oder an Ort und Stelle bleiben sollte. Bei ihrem ziellos schwebenden Aufstieg hielt sie über einem Blitz aus Farbe inne, der durch den Regen leuchtete, ein pinkfarbener Schirm, der auf die Tore der Burg zuhielt. Das bläulich-weiße Glühen der Kugel flackerte in einem wütenden Rot auf.
Die Lichtkugel sauste vom Himmel hernieder und flog geräuschlos über den Kopf des Oni hinweg, sank tiefer zu Boden und glitt durch das Burgtor, kurz bevor es sich knarzend schloss, wobei sie den Oni, die Dämonen und den leblosen Körper einer Dienerin hinter sich ließ.
2
DER FUCHS IM TEMPEL
Yumeko
»Yumeko!«
Der Ruf hallte durch den Garten wider, dröhnend und wutentbrannt, und ließ mich zusammenzucken. Ich hatte still am Teich gesessen und den dicken rot-weißen Fischen, von denen es unter der Oberfläche nur so wimmelte, Krumen zugeworfen, als mein Name, wie so oft im Zorn, aus Richtung des Tempels gebrüllt wurde. Rasch duckte ich mich hinter die große Steinlaterne am Rand des Wassers, da kam Denga um das gegenüberliegende Ufer marschiert, mit einer Miene so düster wie eine Gewitterwolke.
»Yumeko!«, rief der Mönch noch einmal, während ich mich an den rauen, moosbewachsenen Stein drückte. Ich konnte mir bildlich vorstellen, wie sich sein normalerweise strenges, friedfertiges Gesicht bis hin zu seiner Stirnglatze rot verfärbte. Längst hatte ich aufgehört zu zählen, wie oft ich es schon mit angesehen hatte. Sicher flatterten sein Zopf und die orangefarbenen Kleider, während er herumwirbelte, den Rand des Teiches absuchte und den Blick über die Bambusgewächse schweifen ließ, die den Garten umgaben. »Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst!«, wütete er. »Salz in die Teekanne geben … schon wieder! Meinst du, Nitoru mag es, wenn ihm der Tee direkt ins Gesicht gespuckt wird?« Ich biss mir auf die Unterlippe, um mir das Lachen zu verkneifen, drängte mich gegen die Statue und versuchte, keinen Mucks zu machen. »Elendes Dämonenmädchen!«, stieß Denga vor Wut kochend hervor, während sich das Geräusch seiner Schritte vom Teich entfernte und weiter in den Garten vordrang. »Ich weiß, dass du Närrin dir jetzt ins Fäustchen lachst. Wenn ich dich erwische, wirst du bis zur Stunde der Ratte die Böden fegen!«
Seine Stimme verlor sich. Ich spähte um den Stein und beobachtete, wie Denga dem Pfad weiter in das Bambusgehölz folgte, bis der Mönch schließlich aus meinem Blickfeld verschwand.
Aufatmend lehnte ich mich an die verwitterte Steinlaterne und empfand ein köstliches Triumphgefühl. Na, das war ein Spaß! Denga-san ist immer so angespannt; ein anderer Gesichtsausdruck wäre zur Abwechslung mal gut, sonst erstarrt seine Miene noch völlig. Bei der Vorstellung, wie der Gesichtsausdruck des armen Nitoru sich verwandelt hatte, als der andere Mönch merkte, was sich in seiner Teetasse befand, musste ich grinsen. Leider besaß Nitoru den gleichen Sinn für Humor wie Denga, also gar keinen. Höchste Zeit, mich aus dem Staub zu machen. Ich stibitze mir ein Buch aus der Bibliothek und verstecke mich unter dem Schreibtisch. Oh, Moment mal, den Ort kennt Denga schon. Schlechte Idee. Der Gedanke an all die langen Holzveranden, die gründlich gefegt werden müssten, falls ich gefunden wurde, bereitete mir Unbehagen. Vielleicht ist es ein guter Tag, um nicht hier zu sein. Jedenfalls bis heute Abend. Was wohl die Affenfamilie im Wald heute so macht?
Mich durchzuckte freudige Erregung. In den Ästen einer uralten Zeder, die alle anderen Bäume im Wald überragte, lebte ungefähr ein Dutzend gelber Affen. Wenn man an klaren Tagen bis oben in die Baumkrone kletterte, konnte man die ganze Welt sehen, von dem winzigen Bauerndorf am Fuß der Berge bis hin zum fernen Horizont. Jedes Mal, wenn ich dort oben im Baum saß und mit den Affen auf den Ästen schaukelte, schweifte mein Blick über den bunten Landschaftsteppich, der sich vor mir erstreckte, und ich fragte mich, ob heute der Tag war, an dem ich mutig genug wäre, um nachzusehen, was jenseits des Horizonts lag.
Ich war es nie, und der heutige Nachmittag würde keine Ausnahme bilden. Doch wenigstens würde ich nicht hier sein und abwarten, dass ein zorniger Denga-san mir einen Besen in die Hand drückte und mir befahl, jede Oberfläche im Tempel zu kehren. Einschließlich des Hofes.
Während ich mich von der Laterne löste, drehte ich mich um … und stand genau vor Meister Isao.
Ich jaulte auf, zuckte zurück und stieß gegen die Steinlaterne, die größer und schwerer als ich war und sturerweise nicht weichen wollte. Der uralte Mönch mit dem weißen Bart lächelte gelassen unter seinem Strohhut mit der breiten Krempe.
»Unterwegs, Yumeko-chan?«
»Ähm …«, stammelte ich und rieb mir den Hinterkopf. Meister Isao war kein großer Mann; spindeldürr und einen Kopf kleiner als ich, wenn er seine Geta-Holzschuhe trug. Doch niemand im Tempel genoss größeren Respekt, und niemand hatte sein Qi derart unter Kontrolle wie Meister Isao. Ich hatte schon mit angesehen, wie er mit einem Wink seiner Hand einen Baum in zwei Hälften spaltete und einen gewaltigen Felsblock zertrümmerte. Er war der unumstrittene Herr des Tempels der Stillen Winde und konnte allein durch sein Erscheinen einen Raum voller willensstarker Qi-Meister zum Schweigen bringen. Auch wenn er nie die Stimme erhob oder wütend wirkte; die strengste Miene, die ich je an ihm gesehen hatte, war ein leichtes Stirnrunzeln, und das war Furcht einflößend gewesen.
»Also…«, stammelte ich wieder, während er belustigt seine buschigen Augenbrauen hochzog. Lügen hatte keinen Zweck. Meister Isao wusste immer alles über alles. »Ich wollte … die Affenfamilie im Wald besuchen, Meister Isao«, gestand ich, da ich das noch für mein kleinstes Vergehen hielt. Zwar war mir nicht ausdrücklich verboten, den Grund und Boden des Tempels zu verlassen, aber die Mönche sahen es auf jeden Fall nicht gern, wenn ich es tat. Die viele Hausarbeit, das Training und die Pflichten, die sie mir auferlegten, sobald ich wach war, ließen darauf schließen, dass sie versuchten, mich möglichst ständig zu beschäftigen. Die einzige freie Zeit, die ich hatte, war normalerweise gestohlen, so wie heute.
Meister Isao lächelte nur. »Ach. Affen. Nun, ich fürchte, deine Freunde werden ein bisschen warten müssen, Yumeko-chan«, sagte er, ohne auch nur im Geringsten zornig oder überrascht zu wirken. »Ich muss einen Moment lang deine Zeit in Anspruch nehmen. Bitte folge mir.«
Er machte kehrt und begann, den Teich zu umrunden, in Richtung Tempel. Ich klopfte mir den Staub von den Ärmeln und ging hinter ihm her, den Bambuspfad entlang, der von Sonnenschein und grünen Schatten gesprenkelt war, vorbei an den singenden Steinen, wo die Brise spielerisch durch die Löcher in den verwitterten Felsen summte, und über die rote gebogene Brücke, die den Bach überspannte. Ein Vogel mit mattbraunem Gefieder flog zu den Ästen eines Wacholderbusches, schwellte die Brust und erfüllte die Luft mit dem schönen, trillernden Lied einer Nachtigall. Ich pfiff zurück, und sie warf mir einen entrüsteten Blick zu, bevor sie in den Blättern verschwand.
Die Bäume lichteten sich, und das Blattwerk verschwand, als wir an dem winzigen Steingarten mit seinem sorgfältig gerechten Sand vorbei zu den Tempelstufen gingen. Beim Betreten der düsteren, kühlen Eingangshalle erspähte ich Nitoru, der mir quer durch den Raum einen wütenden Blick zuwarf, und wagte ein freches Winken, da ich wusste, dass er sich mir nicht nähern würde, solange ich bei Meister Isao war. Wahrscheinlich würde ich die Treppen bis zum nächsten Winter fegen, doch die Miene des Mönches war es wert.
Meister Isao führte mich durch mehrere schmale Gänge, und wir kamen an einzelnen Zimmern zu beiden Seiten vorüber, bis er ein Türpaneel zurückschob und mich hineinwinkte. Ich betrat ein vertrautes Zimmer, klein und ordentlich, leer, abgesehen von einem riesigen Standspiegel an der gegenüberliegenden Wand und einer daneben aufgehängten Schriftrolle. Auf der Schriftrolle war ein gewaltiger Drache abgebildet, der über ein tosendes Meer dahinglitt, und darunter ein winziges Boot, das von den Wellen hin und her geschleudert wurde.
Ich überspielte ein Seufzen. In diesem Zimmer war ich schon ein paarmal gewesen, und das Ritual, das folgte, war immer das gleiche. Da ich wusste, was Meister Isao von mir wollte, ging ich leichtfüßig über die Tatamimatten und kniete mich vor den Spiegel, dem einzigen im ganzen Tempel. Meister Isao folgte mir und ließ sich mir zugewandt daneben nieder, die Hände im Schoß. Einen Moment lang saß er da, die Augen milde, obwohl es sich anfühlte, als dränge sein Blick direkt durch mich hindurch zur Wand hinter meinem Kopf.
»Was siehst du?«, fragte er, wie er es immer tat.
Ich betrachtete den Spiegel. Mein Spiegelbild starrte mir entgegen, ein schmales Mädchen von sechzehn Wintern mit schwarzem Haar, das ihr, ungebunden, bis zur Mitte des Rückens hinabfiel. Sie trug Strohsandalen, eine weiße Schärpe und einen kurzen purpurroten Kimono, der stellenweise zerrissen war, besonders an den langen, weiten Ärmeln. Ihre Hände waren schmutzig, weil sie am Teich gekniet und mit den Fischen gesprochen hatte, und Erde klebte an ihren Knien und im Gesicht. Auf den ersten Blick sah sie wie ein zerlumptes, aber völlig normales Landmädchen aus, vielleicht das verwahrloste Kind eines Fischers oder Bauern, das auf dem Boden des Tempels kniete.
Wenn man zufälligerweise nicht den buschigen orangen Schwanz bemerkte, der hinter ihrem Gewand hervorlugte. Und die riesigen dreieckigen Ohren mit den schwarzen Spitzen, die oben an ihrem Schädel abstanden. Und die funkelnden goldenen Augen, die sie ganz offensichtlich als nicht normal, als nicht menschlich kennzeichneten.
»Ich sehe mich, Meister Isao.« Ich fragte mich, ob es diesmal die richtige Antwort war. »In meiner wahren Gestalt. Ohne Illusion oder Abwehr. Ich sehe eine Kitsune.«
Kitsune. Fuchs. Beziehungsweise genauer gesagt Halb-Kitsune. Wilde Kitsune, die Füchse, die in den verborgenen Orten von Iwagoto umherstreiften, waren Meister des Illusionszaubers und Gestaltwandler. Obwohl es der Wahrheit entsprach, dass manche Kitsune ein Leben als gewöhnliche wilde Tiere wählten, besaßen alle Füchse magische Fähigkeiten. Kitsune waren Yokai, Geschöpfe des Übersinnlichen. Einer ihrer Lieblingstricks bestand darin, Menschengestalt anzunehmen – üblicherweise als schöne Frau verkleidet – und Männer in die Irre zu führen. Für das bloße Auge war ich ein gewöhnliches menschliches Mädchen; kein Schwanz, keine spitzen Ohren oder gelben Augen. Nur vor Spiegeln oder reflektierenden Oberflächen wurde meine wahre Natur enthüllt. Lackierte Tische, eine stille Wasseroberfläche, selbst die Kante einer Klinge. Ich musste sehr achtgeben, wo ich stand und was um mich herum war, damit ein aufmerksamer Beobachter nicht bemerkte, dass das Spiegelbild auf einer glatten Oberfläche nicht ganz mit dem Mädchen davor übereinstimmte.
Jedenfalls hatten mich die Mönche davor gewarnt. Sie wussten alle, was ich war, und riefen es mir gern ins Gedächtnis. Halbblut, Dämonenkind, Fuchsmädchen: Ausdrücke, die zu meinem täglichen Leben gehörten. Nicht dass irgendeiner unter den Mönchen grausam oder herzlos war, nur pragmatisch. Ich war eine Kitsune, etwas nicht ganz Menschliches, und sie sahen keinen Grund, so zu tun, als wäre dem nicht so.
Ich warf Meister Isao einen Blick zu und fragte mich, ob er mir diesmal etwas anderes sagen, irgendeinen Hinweis darauf geben würde, was er wirklich von mir hören wollte. Wir hatten das Was siehst du?-Spiel in der Vergangenheit unzählige Male gespielt, und keine meiner Antworten – lauteten sie nun Mensch, Dämon, Fuchs oder Fisch – schien ihn zufriedenzustellen, denn ich landete immer wieder hier und starrte die Kitsune im Spiegel an.
»Wie geht es mit deinen Lektionen voran?«, fuhr Meister Isao fort, ohne ein Anzeichen, ob er meine Antwort gehört hatte oder ob es die richtige war. Ich hegte starke Zweifel daran.
»Gut, Meister Isao.«
»Zeig es mir.«
Zögernd sah ich mich nach einem passenden Ziel um. Viele Möglichkeiten gab es nicht. Vielleicht der Spiegel. Oder die Schriftrolle an der Wand. Doch beide hatte ich früher schon verwendet, und Meister Isao würde sich nicht von den immer gleichen Tricks beeindrucken lassen. Auch dies war ein Spiel, das wir schon oft gespielt hatten.
Da erblickte ich ein gelbes Ahornblatt, das sich am Ende meines Ärmels verfangen hatte, und grinste.
Ich griff danach, drehte es zwischen Fingern und Daumen und legte es mir dann vorsichtig auf den Kopf. Kitsune-Magie brauchte einen Anker, etwas aus der natürlichen Welt, um das sie eine Illusion aufbauen konnte. Es gab Geschichten von sehr alten, sehr mächtigen Kitsune, die Illusionen aus dem Nichts weben konnten, doch ich brauchte etwas, in dem sich die Magie verankern ließ. Nachdem der magische Mittelpunkt an seinem Platz war, schloss ich halb die Augen und setzte meine Kräfte ein.
Schon seit ich denken konnte, war mir die Magie von Natur aus zugeflossen, eine Gabe von der Yokai-Seite der Familie, wie mir gesagt wurde. Selbst als Kleinkind hatte ich ein beeindruckendes Talent an den Tag gelegt und kleine Kugeln Kitsune-bi, das kalte, blau-weiße Fuchsfeuer, durch die Gänge des Tempels schweben lassen. Als ich älter wurde und meine Magie angewachsen war, fanden ein paar Mönche, Meister Isao sollte mich mit einer Fessel belegen und meine Kräfte versiegeln, damit ich niemanden verletzen würde, auch mich selbst nicht. Wilde Kitsune waren berüchtigte Unruhestifter. Zwar waren sie nicht von Natur aus niederträchtig, doch ihre »Streiche« konnten von nur ärgerlich – Essen stehlen oder kleine Gegenstände verstecken – bis hin zu wahrhaft gefährlich reichen: ein Pferd auf einem schmalen Gebirgspfad aufschrecken oder jemanden tief in einen Sumpf oder Wald führen, auf dass er nie wieder gesehen wurde. Besser, mir blieb diese Versuchung erspart, jedenfalls nach Meinung von Denga und ein paar anderen. Doch der Meister des Tempels der Stillen Winde hatte den Vorschlag entschieden abgelehnt. Fuchsmagie gehörte zum Leben einer Kitsune, sagte er, etwas so Natürliches wie schlafen oder atmen. Sie zu leugnen, würde mehr schaden als nutzen.
Stattdessen übte ich meine Magie jeden Tag mit einem Mönch namens Satoshi, in der Hoffnung, dass ich lernen würde, mein füchsisches Talent zu kontrollieren und nicht umgekehrt. Anfangs waren die Mönche skeptisch gewesen, aber da ich Meister Isaos Vertrauen in mich kannte, dass ich meine Fähigkeiten nicht für Unfug nutzte, versuchte ich, der Verlockung nicht nachzugeben. Auch wenn es an manchen Tagen sehr schwer war, die Katze nicht als Teekanne erscheinen oder eine geschlossene Tür so aussehen zu lassen, als stünde sie offen, oder einen Holzscheit vor den Treppenstufen unsichtbar zu machen. Fuchsmagie ist nichts als Illusion und Trickserei, hatte Denga-san bei mehr als einer Gelegenheit vor Wut schäumend erklärt, gewöhnlich nachdem er einem Streich zum Opfer gefallen war. Es kann niemals etwas Nützliches daraus erwachsen.
Das mag stimmen, dachte ich, als die Hitze der Fuchsmagie in mir aufstieg. Aber sie macht auf jeden Fall viel Spaß.
Eine Welle wogte durch mich hindurch, als bestünde mein Körper aus Wasser, in das jemand gerade einen Kieselstein hatte fallen lassen, und eine Wolke aus weißem Rauch schloss sich vom Boden her um mich. Während sich die Rauchzungen auflösten, schlug ich die Augen auf und lächelte dem Abbild im Spiegel zu. Meister Isao starrte mich im Spiegelbild an, eine perfekte Kopie des neben dem Spiegel sitzenden Mannes, wenn man das ziemlich selbstgefällige Grinsen in seinem verwitterten Gesicht nicht mitrechnete. Und den Schwanz mit der weißen Spitze hinter ihm.
Der echte Meister Isao lachte glucksend und schüttelte den Kopf. »Hast du das mit Satoshi geübt?«, fragte er. »Ich will mir gar nicht vorstellen, wie ›ich‹ eines Tages Denga-san vorschlage, er solle einen Affen fangen gehen.«
»Oooh, glaubt Ihr, das würde er tun? Das wäre urkomisch! Ähm, also natürlich würde ich so etwas niemals tun.« Ich griff hoch und entfernte das Ahornblatt von meinem Kopf, die Illusion zerfiel, und die Fuchsmagie löste sich in Luft auf, bis ich wieder nur ich war. Während ich das Blatt in den Fingern drehte, fragte ich mich, wie viel Ärger ich mir einhandeln würde, wenn ich mich doch als Meister Isao verkleidete und Denga befahl, in den Teich zu springen. Angesichts der fanatischen Hingabe des Mönches an seinen Meister würde er es zweifellos tun. Und mich dann wahrscheinlich umbringen.
»Sechzehn Jahre«, stellte Meister Isao mit leiser Stimme fest. Ich blinzelte ihn an. Das war neu. Normalerweise war unser Gespräch zu diesem Zeitpunkt beendet, und er wies mich an, zu meinen Pflichten zurückzukehren. »Auf den Tag sechzehn Jahre, die du nun bei uns bist«, fuhr er beinahe wehmütig fort. »Seitdem wir dich vor dem Tor in einem Weidenkorb fanden, mit nichts außer einem zerschlissenen Kleid und einer an den Stoff gehefteten Nachricht. Verzeiht mir, aber ich muss dieses Kind in Eurer Obhut lassen, stand in dem Brief. Verurteilt sie nicht, sie kann nichts für das, was sie ist, und die Straße, auf der ich wandele, ist kein Ort für ein unschuldiges kleines Mädchen. Ihr Name lautet Yumeko, Kind der Träume. Erzieht sie gut, und möge der Große Drache Eure Schritte lenken und ihre.
Ich nickte höflich, da ich diese Geschichte schon unzählige Male gehört hatte. Meinen Vater oder meine Mutter hatte ich nie kennengelernt, und ich hatte keine großen Gedanken an die beiden verschwendet. Sie gehörten nicht zu meinem Leben, und ich sah keinen Sinn darin, mir den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die ich nicht ändern konnte.
Auch wenn es eine vage Erinnerung an ein Ereignis aus meiner ganz frühen Kindheit gab, die mich immer wieder in meinen Träumen heimsuchte. An jenem Tag war ich im Wald vor dem Tempel herumgestreift, hatte mich vor den Mönchen versteckt und Eichhörnchen gejagt, da spürte ich plötzlich, dass ich von hinten beobachtet wurde. Ich hatte mich umgedreht und einen weißen Fuchs erblickt, der mich von einem umgestürzten Baumstamm aus anstarrte und dessen gelbe Augen im Schatten leuchteten. Wir hatten uns einen langen Moment gemustert, Kind und Kitsune, und obwohl ich noch ganz klein war, hatte ich eine Verwandtschaft mit diesem Geschöpf verspürt, eine Sehnsucht, die ich nicht verstand. Doch als ich einen Schritt auf den Fuchs zugemacht hatte, war er verschwunden. Ich hatte ihn nie wieder gesehen.
»Sechzehn Jahre«, fuhr Meister Isao fort, ohne etwas von meinen Gedanken zu ahnen. »Und in der Zeit haben wir dir unsere Gepflogenheiten beigebracht, dich auf den, wie wir hofften, richtigen Weg gelenkt, dir beigebracht, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Kitsune zu suchen. Du hast immer gewusst, was du bist – wir haben nie einen Hehl aus der Wahrheit gemacht. Ich habe sowohl die Schläue des Fuchses als auch menschliches Mitgefühl in dir beobachtet. Ich habe Gefühlskälte und Liebenswürdigkeit in gleichem Maße gesehen, und ich weiß, dass du im Moment auf einem schmalen Grat zwischen Yokai und Mensch wandelst. Wofür du dich auch immer entscheidest, welchen Weg du auch immer einschlagen möchtest, selbst wenn du versuchst, beide Pfade zu betreten, du musst es selbst entscheiden, und zwar bald. Die Zeit ist gekommen.«
Er gab keinerlei Erklärung, was er damit meinte. Er fragte mich nicht, ob ich ihm folgen konnte. Vielleicht wusste er, dass ich die Hälfte der Zeit seine Rätsel nicht entwirren konnte und ich die andere Hälfte nicht richtig zuhörte. Doch ich nickte und lächelte, als wüsste ich, worauf er hinauswollte, und sagte: »Ja, Meister Isao. Ich verstehe.«
Seufzend schüttelte er den Kopf. »Du hast keine Ahnung, wovon ich hier rede, Kind«, meinte er, woraufhin ich zusammenzuckte. »Aber das ist in Ordnung. Es ist nicht der Grund, weshalb ich dich heute hierhergebracht habe.« Sein Blick glitt in die Ferne, und seine Augen verdunkelten sich. »Du bist nun fast erwachsen, und die Welt da draußen verändert sich. Es ist an der Zeit, dass du von unserem wahren Zweck erfährst, davon, was der Tempel der Stillen Winde wirklich beschützt.«
Ich blinzelte, und im Spiegel stellten sich meine Kitsune-Ohren auf. »Was wir … beschützen?«, fragte ich. »Ich wusste nicht, dass wir irgendetwas beschützen.«
»Natürlich nicht«, stimmte Meister Isao mir zu. »Niemand hat es dir je gesagt. Es ist unser größtes Geheimnis. Aber es ist eines, das du kennen musst. Der Drache erhebt sich, und ein weiteres Zeitalter neigt sich dem Ende zu.«
»Vor sehr langer Zeit«, begann Meister Isao im schwärmerischen Tonfall eines begnadeten Geschichtenerzählers, »gab es einen Sterblichen. Ein junger Lord, der eine große Armee befehligte und mehr Diener hatte, als es Reiskörner auf dem Feld gibt. Sein Name ist nicht überliefert worden, aber es heißt, er sei ein arroganter, törichter Mensch gewesen, der ein unsterblicher kami werden wollte – ein Gott. Zu diesem Zweck versammelte er seine größten Krieger und befahl ihnen, ihm den Tama no Fushi zu bringen, einen Edelstein, der jedem, der ihn besaß, Unsterblichkeit verleihen sollte. Leider befand sich der Edelstein der Unsterblichkeit in der Stirn des Großen Drachen, der unter der Meeresoberfläche lebte. Doch dem Lord stand der Sinn nach Unsterblichkeit, und er befahl seinen Kriegern, Tama no Fushi zu holen, egal wie.
Seine Untertanen, die ein wenig vernünftiger als ihr Herr waren, taten nur so, als würden sie sofort zu seiner Suche aufbrechen, und der Lord war sich ihres Erfolges so sicher, dass er seine Gemächer mit Gold und Silber schmückte und Seidentücher über das Dach seines Hauses legte, wie es einem Gott geziemte.
Etliche Monate vergingen ohne Nachricht, und der junge Lord wurde ungeduldig, reiste zu den heiligen Klippen von Ryugake, wo der Drache, wie es hieß, unter den Wellen lebte. Wie sich herausstellte, hatte kein einziger Krieger des Lords ein Boot genommen, um nach dem Drachen zu suchen, sondern sie waren allesamt bei der ersten sich bietenden Gelegenheit aus der Provinz geflohen. Wütend über diese Nachrichten schlug der Lord alle Vorsicht in den Wind, heuerte einen Steuermann samt Schiff an und begab sich selbst auf die Suche.
Sobald das unglückselige Schiff den tiefen Ozean erreicht hatte, erhob sich ein heftiger Sturm, und das Meer wandte sich wie ein wütendes Untier gegen den Lord und seine Besatzung. Es kam noch schlimmer, denn den Lord ereilte eine schreckliche Krankheit, und er lag im Sterben, während das Meer um sie herum tobte und heulte. Nach vielen Tagen wurde der Sturm so heftig, und das Boot stand so kurz vor dem Kentern, dass der Steuermann rief, die Götter seien gewiss zornig auf sie und der Lord solle beten, um den Großen Kami der Tiefe zu beschwichtigen.
Als der Lord seinen Fehler endlich einsah, befolgte er bereitwillig den Rat des Steuermannes. Er betete nicht weniger als tausend Gebete, bereute seinen törichten Einfall, den Drachen zu töten, und schwor feierlich, den Herrscher der Gezeiten in Ruhe zu lassen.
Manche Legenden erzählen nun, der Lord sei in seine Heimat zurückgekehrt und es sei nichts geschehen, abgesehen davon, dass die Krähen das erlesene Seidentuch von seinem Dach stahlen, um ihre Nester damit zu bauen. Doch in einer Legende heißt es, nachdem der Lord sein tausendstes Gebet gesprochen habe, brodelte das Meer, und ein mächtiger Drache stieg von den Tiefen des Ozeans auf. Er war dreimal so lang wie das Schiff, seine Augen brannten wie Fackeln in der Nacht, und mitten in seiner Stirn war eine Perle eingebettet.
Der Lord hatte große Angst, zu Recht, denn das Untier sah zutiefst verärgert aus. Er fiel bäuchlings hin und flehte das mächtige Geschöpf an, Erbarmen mit ihm zu haben. Da stellte der Drache den Lord vor eine Wahl. Er würde dem Sterblichen einen Wunsch erfüllen, alles, was er verlangte – Reichtum, Unsterblichkeit, die Macht über den Tod selbst –, oder er würde ihm seine Seele lassen. Der Lord entschied sich, seine Seele zu behalten, und kehrte als klügerer Mann nach Hause zurück.
Jetzt erhebt sich der Drache alle tausend Jahre – ein Jahr für jedes Gebet, das der Lord sprach – für den Sterblichen, der ihn ruft. Wenn die Seele des Sterblichen unschuldig ist, wenn seine Absichten ehrenwert und sein Herz rein sind, wird der Drache ihm seinen Herzenswunsch erfüllen. Doch wenn die Seele für unlauter befunden wird, reißt der Drache sie ihm aus dem Leib und nimmt sie als Strafe für die Arroganz des Sterblichen, der vor so langer Zeit ein Gott werden wollte.«
Schweigen legte sich über uns, nachdem Meister Isao zu Ende erzählt hatte. Ich saß da und fand seine Geschichte faszinierend, hatte aber keine Ahnung, was sie mit unserem Tempel und dem Gegenstand, den wir beschützen sollten, zu tun hatte. Meister Isao beobachtete mich einen Moment lang und schüttelte dann den Kopf.
»Du weißt nicht, warum ich dir die Geschichte erzählt habe, oder?«
»Doch«, widersprach ich, und Meister Isao hob die buschigen Augenbrauen. »Es ist, damit ich … ähm … nun ja. Nein, keine Ahnung.«
Er sagte nichts, sondern wartete nur geduldig und beharrte wie so oft schweigend darauf, dass ich selbst dahinterkam. Ich zermarterte mir das Hirn bei dem Versuch, es zu verstehen. Er hatte einen Drachen erwähnt, sowohl in seiner Geschichte als auch vorhin beim Spiegel, also musste er wichtig sein. Was genau hatte er gesagt?
»Der Drache erhebt sich«, wiederholte ich und erntete ein wohlwollendes Nicken. »Und dieser Legende nach kann man ihn alle tausend Jahre rufen. Damit einem Sterblichen erfüllt wird, was auch immer er sich wünscht.« Ich hielt inne und kräuselte leicht die Stirn. »Also … warum erfüllt der Drache Wünsche? Er ist ein Gott, nicht wahr? Bestimmt hat er doch wohl Wichtigeres zu tun, als alle tausend Jahre vorbeizuschauen. Erfüllt er gern Wünsche?«
»Der Drache ist keine Wünsche erfüllende Marionette, Yumeko-chan«, sagte Meister Isao. »Er ist ein Großer Kami – der Gott der Gezeiten und der Herold des Wandels. Jedes Mal, wenn er in Erscheinung tritt, zum Guten oder Schlechten, wandelt sich die Welt und schlägt einen anderen Pfad ein.«
»Das muss also bedeuten … ist es an der Zeit, dass der Drache sich wieder erhebt?«
»Sehr gut, Yumeko-chan.« Meister Isao nickte mir feierlich zu. »Du hast recht. Die Zeit des Drachen ist beinahe gekommen. Und es gibt viele, selbst jetzt noch, die nach einer Möglichkeit suchen, ihn zu rufen. Doch der Drache wird sich nur erheben, wenn er richtig gerufen wird, und die einzige Art, das zu tun, ist, die Gebete des jungen Lords aufzusagen, Wort für Wort. Alle eintausend.«
»Eintausend Gebete?« Ich legte den Kopf schräg. Es fiel mir schon schwer, mir zu merken, welchen Wochentag wir hatten. Die Vorstellung, eintausend Gebete aus dem Gedächtnis aufsagen zu müssen, war überwältigend. »Das hört sich unglaublich schwierig an«, stellte ich fest. »Es ist wohl nicht das gleiche Gebet, immer und immer wieder? Jemand hätte sie aufschreiben sollen …«
Oh.
Da fügten sich die Puzzleteile jäh zusammen. Das Geheimnis des Tempels, die heilige Pflicht der Mönche. Ich warf einen Blick auf die hängende Schriftrolle an der Wand, den Drachen und das dem Untergang geweihte Schiff, und endlich wurde mir deren Bedeutung klar. »Das beschützen wir«, vermutete ich. »Das Gebet, um den Drachen zu rufen. Es ist … hier.«
»Ein Stück davon«, sagte Meister Isao mit ernster Stimme. »Hör zu, Yumeko-chan, vor langer Zeit benutzte jemand die Macht des Drachenwunsches zu etwas Schrecklichem. Dunkelheit und Chaos herrschten, und das Land wurde beinahe entzweigerissen. Man entschied, dass eine derartige Macht nie wieder eingesetzt werden sollte, also teilte man das Gebet in drei Teile und versteckte sie in ganz Iwagoto, damit sich solche Dunkelheit nicht zum zweiten Mal erheben konnte.«
»Aber … ich dachte, der Drache erfüllt nur einem ehrenhaften Sterblichen einen Wunsch«, warf ich ein. »Einem, ›dessen Herz rein ist‹. Wie konnte der Wunsch für Böses eingesetzt werden?«
»Der Pfad ins Jigoku ist mit ehrenhaften Absichten gepflastert«, erwiderte Meister Isao. »Und absolute Macht kann sogar das reinste Herz verderben. So töricht sind die Menschen. Wie dem auch sei, da du nun weißt, was wir beschützen, Yumeko-chan, müssen wir sehr vorsichtig sein. Deshalb leben wir hier so isoliert, deshalb empfängt der Tempel keine Besucher. Mit dem Erscheinen des Drachen wird etwas aus dem Gleichgewicht kommen. Außerhalb dieser Mauern herrscht Chaos im Land. Menschen kämpfen um Macht, unnatürliche Dinge rühren und erheben sich, angezogen von Blut und Gewalt, und die Welt verfinstert sich. Es ist unsere Pflicht sicherzustellen, dass das Drachengebet niemals wieder ausgesprochen wird, dass wir dieses Stück der Schriftrolle vor allen bewahren, die ihre Macht benutzen wollen. Das hier ist unsere größte Verantwortung, und jetzt ist es auch deine. Verstehst du das, mein Kind?«
Ein Schauder lief mir über den Rücken, doch ich nickte. »Ich glaube schon, Meister Isao.«