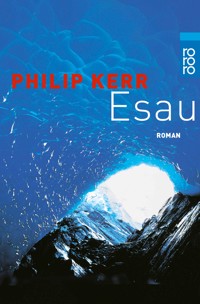9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Berlin, heißer Sommer 1938. Ein Wahnsinniger hat fünf junge Mädchen auf die gleiche bestialische Weise umgebracht. Von SS-Standartenführer Heydrich ins Prinz-Albrecht-Palais zitiert, hat Gunther keine andere Wahl: Er geht auf Mördersuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philip Kerr
Im Sog der dunklen Mächte
Ein Fall für Bernhard Gunther
Übersetzt von Hans J. Schütz
Über dieses Buch
Berlin, heißer Sommer 1938. Ein Wahnsinniger hat fünf junge Mädchen auf die gleiche bestialische Weise umgebracht. Von SS-Standartenführer Heydrich ins Prinz-Albrecht-Palais zitiert, hat Gunther keine andere Wahl: er geht auf Mördersuche.
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Für Jane
«Vieles an euren Guten macht mir Ekel, und wahrlich nicht ihr Böses. Wollte ich doch, sie hätten einen Wahnsinn, an dem sie zugrunde gingen, gleich diesem bleichen Verbrecher!
Wahrlich, ich wollte, ihr Wahnsinn hieße Wahrheit oder Treue oder Gerechtigkeit: aber sie haben ihre Tugend, um lange zu leben, und in einem erbärmlichen Behagen.»
Nietzsche: «Also sprach Zarathustra I» (Vom bleichen Verbrecher)
Teil Eins
Sie werden feststellen, daß Sie der Erdbeertorte im Café Kranzler viel mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn Ihre Diät sie Ihnen verbietet.
Seit einiger Zeit habe ich angefangen, über Frauen fast genauso zu denken. Bloß daß ich nicht auf Diät bin, sondern einfach weil ich feststellen muß, daß die Kellnerin keine Notiz von mir nimmt. Es gibt auch sehr viele hübsche darunter. Frauen, meine ich, obgleich ich eine Kellnerin ebenso leicht ficken könnte wie jedes andere weibliche Wesen. Vor zwei Jahren gab es mal eine Frau. Ich liebte sie, aber sie verschwand. Nun, das passiert mit einer Menge Leute in dieser Stadt. Doch seitdem hat es bloß flüchtige Affären gegeben.
Und wenn Sie mich nun Unter den Linden sehen, erst in die eine, dann in die andere Richtung blickend, könnten Sie glauben, ich folgte dem Pendel eines Hypnotiseurs. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Hitze. In diesem Sommer ist es in Berlin so heiß wie in einem Backofen. Oder vielleicht liegt es einfach an mir. Ich werde vierzig und kriege bei Babys zärtliche Gefühle. Aus welchem Grund auch immer, mein Drang, mich fortzupflanzen, ist geradezu bestialisch, und das lesen mir Frauen natürlich von den Augen ab und machen einen großen Bogen um mich. Trotzdem, in dem langen heißen Sommer 1938 erfreute sich die stumpfsinnige Bestialität an einer Art arischer Wiedergeburt.
1.Freitag, 26. August
«Genau wie ein verdammter Kuckuck.»
«Wer?»
Bruno Stahlecker sah von seiner Zeitung auf.
«Hitler, wer sonst.»
Meine Laune sank, als ich merkte, daß es sich wieder mal um eine tiefschürfende Analogie meines Partners handelte, die sich auf die Nazis bezog.
«Ja, natürlich», sagte ich ruhig, in der Hoffnung, ihn von einer ausführlicheren Erklärung abzuhalten, wenn ich so tat, als hätte ich vollkommen kapiert. Aber es sollte nicht sein.
«Kaum ist er den österreichischen Grünschnabel aus dem europäischen Nest losgeworden, schon fängt der tschechoslowakische an, bedenklich zu gucken.» Er schlug mit dem Handrücken gegen die Zeitung. «Hast du das gesehen, Bernie? Deutsche Truppenbewegungen an der Grenze des Sudetenlandes.»
«Ja, hab mir schon gedacht, daß du davon sprichst.» Ich schnappte mir die morgendliche Post, setzte mich und fing an, sie durchzugehen. Es waren ein paar Schecks darunter, die dazu beitrugen, meine Verärgerung über Bruno ein wenig zu mildern. Es war kaum zu glauben, aber er hatte offensichtlich bereits was getrunken. Während er in der Regel eher einsilbig ist (was ich vorziehe, weil ich selber ein wenig wortkarg bin), macht Schnaps Bruno immer so geschwätzig wie einen italienischen Kellner.
«Das Komische ist, daß die Eltern es nicht merken. Der Kuckuck schmeißt die anderen Küken raus, und die Pflegeeltern füttern ihn weiter.»
«Vielleicht hoffen sie, daß er’s Maul halten und abhauen wird», sagte ich anzüglich, aber um das zu bemerken, war Brunos Fell viel zu dick. Ich überflog den Inhalt eines der Briefe und las ihn noch einmal langsamer.
«Sie wollen es einfach nicht merken. Was ist in der Post?»
«Hm? Ein paar Schecks.»
«Gelobt sei der Tag, der einen Scheck bringt. Sonst noch was?»
«Ein Brief. Anonym. Jemand will mich um Mitternacht im Reichstagsgebäude treffen.»
«Schreibt er, warum?»
«Behauptet, er hätte Informationen über einen meiner alten Fälle. Eine verschwundene Person, die nicht wieder auftauchte.»
«Klar. Die gibt’s wie Sand am Meer. Sehr ungewöhnlich. Gehst du hin?»
Ich zuckte die Achseln. «In der letzten Zeit schlafe ich schlecht, also warum nicht?»
«Du meinst, abgesehen von der Tatsache, daß es eine ausgebrannte Ruine ist und es nicht ungefährlich ist reinzugehen. Es könnte zum Beispiel eine Falle sein. Jemand könnte versuchen, dich umzubringen.»
«Vielleicht hast du dann den Brief geschickt?»
Er lachte gezwungen. «Vielleicht sollte ich mitkommen. Ich könnte außer Sicht bleiben, aber in Hörweite.»
«Oder Schußweite?» Ich schüttelte den Kopf. «Wenn du einen Mann umbringen willst, läßt du ihn nicht an einen solchen Ort kommen, wo er natürlich auf der Hut sein wird.» Ich zog die Schublade aus meinem Schreibtisch.
Auf den ersten Blick war kein großer Unterschied zwischen der Mauser und der Walther, aber ich nahm die Mauser heraus. Die Neigung des Griffes und die ganze Form der Waffe sorgten dafür, daß sie besser in der Hand lag als die ein wenig kleinere Walther, und es mangelte ihr nicht an Durchschlagskraft. Es war eine Waffe, die mich, wie ein fetter Scheck, immer mit einem ruhigen Selbstvertrauen ausstattete, wenn ich sie in die Manteltasche schob. Ich schwenkte sie in Brunos Richtung.
«Und wer immer mir diese Party-Einladung geschickt hat, er wird wissen, daß ich eine Kanone trage.»
«Und angenommen, es sind mehrere?»
«Scheiße, Bruno, es ist nicht nötig, den Teufel an die Wand zu malen. Natürlich sehe ich das Risiko, aber das gehört nun mal zu unserem Geschäft. Journalisten kriegen Berichte, Soldaten kriegen Befehle, und Detektive bekommen anonyme Briefe. Hätte ich Briefe mit Siegelwachs gewollt, wäre ich ein verdammter Anwalt geworden.»
Bruno nickte, zupfte an seiner Augenklappe und widmete sich dann seiner Pfeife – dem Symbol des Scheiterns unserer Partnerschaft. Ich hasse das Drum und Dran beim Pfeifenrauchen: den Tabaksbeutel, den Pfeifenputzer, das Taschenmesser und das spezielle Feuerzeug. Ein Pfeifenraucher ist ein Großmeister im Herumspielen und Fummeln und für die Welt ein ebensogroßer Fluch wie ein Missionar, der mit einer Ladung Kanonenöfen auf Tahiti landet. Es war nicht Brunos Schuld, denn er war, trotz seiner Trinkerei und seiner ärgerlichen kleinen Marotten, immer noch ein guter Detektiv, den ich vor dem finsteren Schicksal bewahrt hatte, auf einem abgelegenen Kriporevier im Spreewald zu versauern. Nein, ich war’s, der die Schuld trug: Ich hatte an mir selber festgestellt, daß ich von Natur aus für eine Partnerschaft ebenso ungeeignet war wie für das Amt des Präsidenten der Deutschen Bank. Als ich ihn jedoch ansah, begann ich, mich schuldig zu fühlen.
«Erinnerst du dich noch daran, was wir im Krieg immer sagten? Wenn dein Name und deine Adresse draufstehen, kannst du sicher sein, daß du es auch bekommst.»
«Ich erinnere mich», sagte er, zündete seine Pfeife an und las im Völkischen Beobachter weiter. Ich sah ihm nachdenklich dabei zu.
«Du kannst ebensogut auf den Ausrufer warten, ehe du in diesem Blatt eine einzige wahre Nachricht findest.»
«Stimmt. Aber ich lese morgens gern eine Zeitung, selbst wenn es eine ist, mit der man sich den Hintern abwischen kann. Hab ich mir nun mal angewöhnt.» Wir waren beide eine kurze Weile still. «Da ist wieder eine von diesen Anzeigen drin: Rolf Vogelmann, Privatdetektiv, Spezialist für vermißte Personen.»
«Nie von ihm gehört.»
«Natürlich hast du. Letzten Freitag war schon mal eine Kleinanzeige drin. Ich hab sie dir vorgelesen. Erinnerst du dich nicht?» Er nahm seine Pfeife aus dem Mund und deutete mit dem Stiel auf mich. «Weißt du, vielleicht sollten wir inserieren, Bernie.»
«Warum? Wir haben so viele Aufträge, daß wir ausgelastet sind, mehr als das. Die Geschäfte sind nie besser gegangen, also warum die zusätzlichen Ausgaben? Es ist sowieso der Ruf, der in unserem Gewerbe zählt, und nicht eine kleine Anzeige in der Parteizeitung. Dieser Rolf Vogelmann hat offenbar keinen verdammten Schimmer, was er tut. Denk mal an all die Aufträge, die wir von Juden kriegen. Keiner unserer Klienten liest ein solches Mistblatt.»
«Na ja, wenn du glaubst, daß so was überflüssig ist, Bernie …»
«Wie eine dritte Brustwarze.»
«Früher glaubten manche Leute, die würde Glück bringen.»
«Und es gab eine Menge Leute, für die sie Grund genug war, dich auf den Scheiterhaufen zu bringen.»
«Das Zeichen des Teufels, wie?» Er grinste. «He, vielleicht hat Hitler eins.»
«Ebenso sicher, wie Goebbels einen gespaltenen Huf hat. Scheiße, sie kommen alle aus der Hölle. Jeder von diesem verdammten Pack.»
Ich hörte meine Schritte auf dem ausgestorbenen Königsplatz widerhallen, als ich mich der Ruine des Reichstagsgebäudes näherte. Nur Bismarck stand auf seinem Sockel, die Hand auf dem Schwert, vor dem Westeingang, den Kopf mir zugewandt, als wolle er gegen meine Anwesenheit protestieren. Doch ich erinnerte mich, daß er für das Deutsche Parlament nie sonderlich geschwärmt hatte – er hatte nicht einmal einen Fuß in das Gebäude gesetzt –, und also hatte ich meine Zweifel, daß er die Neigung verspürte, die Institution zu verteidigen, der sein Standbild, vielleicht symbolisch, den Rücken zugekehrt hatte. Nicht, daß an diesem ziemlich überladenen Gebäude im Renaissance-Stil viel gewesen wäre, das zu verteidigen gelohnt hätte. Mit seiner rauchgeschwärzten Fassade sah der Reichstag wie ein Vulkan aus, der seinen letzten und spektakulärsten Ausbruch hinter sich hatte. Doch in diesem Feuer war mehr verbrannt als bloß die Hoffnungen auf die Republik von 1918; für Deutschland war es auch die deutlichste Vorhersage dessen, was Adolf Hitler und seine dritte Brustwarze für uns auf Lager hatten.
Ich ging hinüber zur Nordseite und zu den Überresten von Eingang 5, dem Eingang für das Publikum, durch den ich bereits einmal gegangen war: vor mehr als dreißig Jahren mit meiner Mutter.
Ich ließ meine Taschenlampe in der Manteltasche. Ein Mann mit einer Laterne in der Hand und bei Nacht braucht sich bloß ein paar farbige Kreise auf die Brust zu malen, und schon ist er eine bessere Zielscheibe. Und außerdem fiel durch die Reste des Daches mehr als genug Mondlicht, um sehen zu können, wo ich hintrat. Trotzdem, als ich durch die nördliche Vorhalle schritt, die früher ein Warteraum gewesen war, zog ich den Verschluß der Mauser geräuschvoll zurück, damit jeder, der auf mich wartete, hörte, daß ich bewaffnet war. Und in der unheimlichen, widerhallenden Stille hörte es sich lauter an als eine Schwadron preußischer Kavallerie.
«Die werden Sie nicht brauchen», sagte eine Stimme von der Empore über mir.
«Trotzdem, ich werde mich noch ’ne Weile dran festhalten. Es könnte hier Ratten geben.»
Der Mann lachte spöttisch. «Die Ratten sind schon seit langem hier ausgezogen.» Ein Lichtstrahl schien mir ins Gesicht. «Kommen Sie rauf, Gunther.»
«Scheint mir so, als sollte ich Ihre Stimme kennen», sagte ich und begann, die Treppe hinaufzusteigen.
«Mir geht’s genauso. Manchmal erkenne ich meine Stimme, aber ich scheine einfach den Mann nicht zu kennen, der spricht. Das ist nichts Ungewöhnliches, oder? Nicht heutzutage.» Ich nahm meine Taschenlampe heraus und richtete sie auf den Mann, der jetzt in den vor mir liegenden Raum zurücktrat.
«Interessant, das von Ihnen zu hören. Ich würde Sie das gern auch über die Prinz-Albrecht-Straße sagen hören.» Er lachte wieder. «Also haben Sie mich doch erkannt.»
Ich holte ihn neben einer großen Marmorstatue von Kaiser Wilhelm I. ein, die in der Mitte einer großen, achteckigen Halle stand, wo der Strahl meiner Lampe schließlich seine Gesichtszüge erfaßte. Sie hatten etwas Kosmopolitisches, obwohl er mit Berliner Akzent sprach. Manche hätten sogar sagen können, daß er ein bißchen jüdisch aussah, wenn man die Größe seiner Nase betrachtete. Sie beherrschte die Mitte seines Gesichtes wie der Zeiger einer Sonnenuhr und verzog seine Oberlippe zu einem dünnen, höhnischen Grinsen. Sein graues Haar trug er kurz geschoren, wodurch die Höhe seiner Stirn unterstrichen wurde. Es war ein verschlagenes, scharfsinniges Gesicht, das vollkommen zu ihm paßte.
«Überrascht?» fragte er.
«Daß der Chef der Berliner Kriminalpolizei mir einen anonymen Brief schickt? Nein, das passiert mir alle Tage.»
«Wären Sie gekommen, wenn ich ihn unterschrieben hätte?»
«Vermutlich nicht.»
«Und wenn ich Ihnen vorgeschlagen hätte, statt hierher in die Prinz-Albrecht-Straße zu kommen? Geben Sie zu, daß Sie neugierig waren.»
«Seit wann ist die Kripo auf Vorschläge angewiesen, wenn sie Leute in ihrem Hauptquartier sehen will?»
«Sie haben es erfaßt.» Während sein Grinsen breiter wurde, zog Arthur Nebe eine Taschenflasche aus seiner Manteltasche.
«Einen Schluck?»
«Danke. Spricht nichts dagegen.» Ich nahm einen Zug von dem klaren Kornschnaps, den der Reichskriminaldirektor zuvorkommenderweise mitgebracht hatte, und zog dann meine Zigaretten heraus. Nachdem ich uns beiden Feuer gegeben hatte, hielt ich das Streichholz ein paar Sekunden in die Höhe.
«Nicht so einfach, hier ein Feuerchen zu machen», sagte ich.
«Ein Mann, der auf eigene Faust handelt – der Scheißkerl hätte ziemlich behende sein müssen. Und selbst dann, schätz ich, dürfte van der Lubbe die ganze Nacht gebraucht haben, um sein kleines Lagerfeuer anzuzünden.» Ich zog an meiner Zigarette und fügte hinzu: «Es heißt, der dicke Hermann hätte seine Hand im Spiel gehabt. In diesem Fall eine Hand, die ein Stück Zunder hielt.»
«Ich bin schockiert, Sie einen so skandalösen Verdacht über unseren geliebten Ministerpräsidenten äußern zu hören.» Auch Nebe lachte, als er das sagte. «Dem armen alten Hermann einfach so die Schuld zuzuschieben. Oh, er war mit der Brandstiftung einverstanden, aber er hat dabei nicht mitgemischt.»
«Wer dann?»
«Jupp, der Hinker. Dieser arme Scheißholländer war für ihn ein Gratisgeschenk. Van der Lubbe hatte das Unglück, daß er beschlossen hatte, dieses Gebäude in derselben Nacht in Brand zu setzen wie Goebbels und seine Jungens. Jupp dachte, er hätte Geburtstag, besonders als sich rausstellte, daß van der Lubbe ein Kommunist war. Er vergaß bloß, daß die Verhaftung eines Täters eine Verhandlung bedeutet, was wiederum die ärgerliche Formalität nach sich zieht, Beweise beibringen zu müssen. Und es war natürlich von Anfang an jedem, der ein bißchen Grips hatte, klar, daß van der Lubbe nicht allein gehandelt haben konnte.»
«Und warum sagte er dann nichts bei der Verhandlung?»
«Sie pumpten ihn mit irgendeinem Zeug voll, um ihn ruhigzustellen. Sie kennen diese Methode.» Nebe ging um einen riesigen Bronzekronleuchter herum, der verborgen auf dem schmutzigen Boden lag. «Hier. Ich will Ihnen was zeigen.»
Er ging voran in den großen Sitzungssaal, in dem Deutschland zum letzten Mal so etwas wie Demokratie erlebt hatte. Hoch über uns erhob sich das Gerippe der früheren Glaskuppel des Reichstages. Jetzt war das Glas herausgesprengt, und gegen den Mond ähnelten die Träger aus Kupfer dem Netz einer riesigen Spinne. Nebe deutete mit seiner Lampe auf die verkohlten, zersplitterten Balken, welche die Halle umgaben.
«Sie sind vom Feuer böse zugerichtet, aber diese Halbfiguren, die die Balken stützen – können Sie sehen, daß einige von ihnen auch Buchstaben des Alphabets hochhalten?»
«Wenn ich mich anstrenge, ja.»
«Ja, gut, ein paar sind unleserlich. Aber wenn Sie genau hinsehen, können Sie immer noch erkennen, daß sie sich zu einem Motto zusammensetzen.»
«Nicht um ein Uhr morgens.»
Nebe ging nicht darauf ein. «Es heißt ‹Erst das Land, dann die Partei›.» Er wiederholte das Motto fast ehrfürchtig und blickte mich bedeutsam an.
Ich seufzte und zuckte die Achseln. «Oh, da bin ich wirklich platt. Sie? Arthur Nebe? Der Reichskriminaldirektor? Ein Nazi wie ein Beefsteak – außen braun und innen rot? Ich fress’ ’nen Besen.»
«Außen braun, ja», sagte er. «Ich weiß nicht, welche Farbe ich innen habe, aber Rot ist es nicht – ich bin kein Bolschewik. Aber andererseits ist es auch nicht Braun. Ich bin kein Nazi mehr.»
«Mist, dann sind Sie ein verdammter Schauspieler.»
«Ja, bin ich jetzt. Ich muß es sein, wenn ich am Leben bleiben will. Natürlich, das war nicht immer so. Die Polizei ist mein Leben, Gunther. Ich liebe meinen Beruf. Als ich sah, wie der Liberalismus der Weimarer Jahre den Polizeiapparat unterhöhlte, dachte ich, der Nationalsozialismus würde die Achtung vor Gesetz und Ordnung in diesem Lande wiederherstellen. Statt dessen ist es schlimmer denn je. Ich war es, der half, Diels der Kontrolle der Gestapo zu entziehen, bloß um festzustellen, daß er durch Himmler und Heydrich ersetzt wurde, und …»
«… und dann kam’s wirklich knüppeldick. Ich kapiere.»
«Die Zeit kommt, wo jeder kapieren muß. In dem Deutschland, das Himmler und Heydrich sich für uns ausgedacht haben, ist kein Platz für Agnostiker. Aber es ist immer noch möglich, die Dinge von innen zu ändern. Und wenn die richtige Zeit gekommen ist, werden wir Männer wie Sie brauchen. Männer in der Polizei, denen man vertrauen kann. Darum habe ich Sie hergebeten – ein Versuch, Sie dazu zu überreden, zurückzukommen.»
«Ich? Zurück zur Kripo? Sie machen Witze. Hören Sie, Arthur, ich habe mir ein prima Geschäft aufgebaut, ich lebe inzwischen sehr gut davon. Warum sollte ich das alles wegschmeißen, für das Vergnügen, wieder bei der Kripo zu sein?»
«Sie dürften in der Sache keine große Wahl haben. Heydrich glaubt, daß Sie ihm nützlich sein könnten, wenn Sie wieder bei der Kripo wären.»
«Verstehe. Irgendein besonderer Grund?»
«Es gibt da einen Fall, und er will, daß Sie ihn übernehmen. Ich bin sicher, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß Heydrich vom Nationalsozialismus eine sehr persönliche Auffassung hat. Im allgemeinen kriegt er, was er will.»
«Was ist mit diesem Fall?»
«Ich weiß nicht, was er vorhat; Heydrich vertraut mir nicht. Ich wollte Sie bloß warnen, damit Sie vorbereitet sind, keine Dummheiten machen und ihm sagen, er solle sich zum Teufel scheren, was Ihre erste Reaktion sein könnte. Wir haben beide großen Respekt vor Ihren Fähigkeiten als Detektiv. Es ist reiner Zufall, daß auch ich jemanden in der Kripo brauche, dem ich vertrauen kann.»
«Na, kaum zu glauben daß ich so beliebt bin.»
«Sie werden darüber nachdenken.»
«Ich sehe nicht, wie sich das vermeiden ließe. Mal was anderes als Kreuzworträtsel raten, denke ich. Jedenfalls vielen Dank für die Warnung, Arthur, ich weiß das zu schätzen.» Ich wischte mir nervös meinen trockenen Mund. «Haben Sie noch ein bißchen von Ihrer Medizin? Jetzt könnte ich einen Schluck brauchen. Es passiert nicht jeden Tag, daß man so eine gute Nachricht bekommt.»
Nebe reichte mir seine Taschenflasche, und ich nuckelte daran wie ein Baby an der Brust seiner Mutter. Nicht ganz so attraktiv, aber beinahe ebenso beruhigend.
«In Ihrem Liebesbrief hieß es, Sie hätten Informationen über einen alten Fall.»
«Da war mal ’ne Frau, nach der Sie suchten. Liegt schon eine Weile zurück. Eine Journalistin.»
«Das liegt ziemlich weit zurück. Fast zwei Jahre. Ich habe sie nie gefunden. Einer meiner allzu häufigen Mißerfolge. Vielleicht sollten Sie Heydrich das wissen lassen. Es könnte ihn davon überzeugen, mich vom Haken zu lassen.»
«Wollen Sie’s hören oder nicht?»
«Ja, aber muß ich deswegen strammstehen, Arthur?»
«Es ist nicht viel, aber immerhin. Vor zwei Monaten beschloß der Vermieter der Wohnung, in der Ihre Klientin früher wohnte, einige der Wohnungen neu streichen zu lassen, darunter auch ihre.»
«Großherzig von ihm.»
«In ihrer Toilette, hinter einer Art von falscher Täfelung, fand er das Besteck eines Fixers. Keine Drogen, aber alles, was man braucht, um sich ’nen Schuß zu setzen – Nadeln, Spritzen und so weiter. Nun war aber der Mieter, der die Wohnung übernahm, nachdem Ihre Klientin verschwunden war, ein Priester, so daß es nicht wahrscheinlich ist, daß dieses Zeug ihm gehörte, richtig? Und wenn die Dame süchtig war, dann könnte das ’ne Menge erklären. Ich will damit sagen, Sie können nie vorhersagen, was ein Fixer tun wird.»
Ich schüttelte den Kopf. «Sie war nicht der Typ. Ich hätte etwas gemerkt, oder?»
«Nicht immer. Nicht, wenn sie versuchte, von dem Zeug loszukommen. Nicht, wenn sie ein starker Charakter war. Nun ja, soweit der Bericht, und ich dachte, es könnte Sie interessieren. Sie können also diese Akte schließen. Wenn sie ihre Fixerei vor Ihnen verbarg, läßt sich nicht sagen, was sonst sie von Ihnen ferngehalten haben könnte.»
«Nein, das stimmt schon. Ich hatte viel Freude an ihren Titten.»
Nebe lächelte nervös, nicht ganz sicher, ob ich ihm einen schmutzigen Witz erzählte oder nicht.
«War was dran – an ihren Titten?»
«Es waren bloß zwei, Arthur. Aber sie waren prächtig.»
2.Montag, 29. August
Die Häuser in der Berliner Herbertstraße wären in jeder anderen Stadt von ein paar Hektar mit Gebüsch gesäumten Rasens umgeben gewesen. Tatsächlich jedoch füllte jedes von ihnen sein eigenes Grundstück so sehr aus, daß wenig oder gar kein Raum für Gras oder Pflasterung blieb. Einige waren vom Bürgersteig nicht weiter entfernt, als die Eingangstüren breit waren. Architektonisch stellten sie eine Mischung von Baustilen dar, die vom Neoklassizismus zur Neogotik und zum Wilhelminismus reichten; dazu kamen einige, die so volkstümelnd waren, daß man sie unmöglich beschreiben kann. Im ganzen betrachtet, ähnelte die Herbertstraße einer Ansammlung von alten Feldmarschällen und Großadmirälen in Paradeuniformen, die man gezwungen hat, auf überaus kleinen und unangemessenen Klappstühlen zu sitzen.
Der große Hochzeitskuchen von einem Haus, in das man mich bestellt hatte, gehörte eigentlich auf eine Plantage am Mississippi, ein Eindruck, der durch das schwarze Faß von einem Hausmädchen, das mir öffnete, verstärkt wurde. Ich zeigte meine Kennkarte und sagte ihr, daß man mich erwarte. Sie starrte zweifelnd darauf, als sei sie Himmler persönlich.
«Frau Lange hat mir nichts von Ihnen gesagt.»
«Sie wird’s vergessen haben», sagte ich. «Hören Sie, sie hat erst vor einer halben Stunde in meinem Büro angerufen.»
«In Ordnung», sagte sie zögernd. «Dann kommen Sie herein.»
Sie führte mich in einen Salon, den man elegant hätte nennen können, wäre da nicht der große und nur teilweise abgenagte Hundeknochen gewesen, der auf dem Teppich lag. Ich sah mich nach dem Besitzer des Knochens um, doch ich entdeckte keine Spur von ihm.
«Fassen Sie nichts an», sagte das schwarze Faß. «Ich werd ihr sagen, daß Sie da sind.» Darauf watschelte sie, knurrend und murrend, als hätte ich sie aus der Badewanne geholt, davon, um ihre Herrin aufzusuchen. Ich setzte mich auf ein Mahagoni-Sofa, dessen Armlehnen mit geschnitzten Delphinen verziert waren. Daneben stand ein dazu passender Tisch, dessen Platte auf Delphinschwänzen ruhte. Wegen ihrer angeblich heiteren Wirkung waren Delphine bei deutschen Möbeltischlern immer beliebt, doch ich persönlich fand sogar eine 3-Pfennig-Briefmarke lustiger. Ich war etwa fünf Minuten dort, ehe das Faß wieder hereinrollte und sagte, Frau Lange werde mich jetzt empfangen.
Wir schritten durch einen langen, dämmrigen Korridor, der einer Menge ausgestopfter Fische als letzte Heimat diente. Vor einer Trophäe, einem prächtigen Lachs, blieb ich bewundernd stehen. «Hübscher Fisch», sagte ich. «Wer ist der Angler?» Sie drehte sich ungeduldig um.
«Hier gibt’s keinen Angler», sagte sie. «Bloß Fische. Dies ist ein Haus für Fische und Katzen und Hunde. Die Katzen sind am schlimmsten. Die Fische sind wenigstens tot. Katzen und Hunde kann man nicht abstauben.»
Fast automatisch ließ ich meine Finger über die Vitrine des Lachses gleiten. Daraus ließ sich nicht gerade schließen, daß hier überhaupt Staub gewischt wurde; und selbst nach meiner vergleichsweise kurzen Bekanntschaft mit diesem Haus ließ sich leicht erkennen, daß die Teppiche selten, wenn überhaupt einmal, ausgeklopft wurden. Nach dem Schlamm der Schützengräben machten mir ein bißchen Staub und ein paar Krümel auf dem Boden nicht übermäßig viel aus. Aber trotzdem, ich habe ein paar Wohnungen in den schlimmsten Elendsvierteln von Neukölln und Wedding gesehen, die sauberer gehalten waren als dieses Haus.
Das Faß öffnete ein paar Glastüren und trat beiseite. Ich betrat einen unordentlichen Wohnraum, der zugleich eine Art Büro zu sein schien, und die Türen schlossen sich hinter mir.
Sie wirkte wie eine große fleischige Orchidee. Ihr pfirsichfarbenes Gesicht und ihre Arme wabbelten vor Fett, so daß sie wie einer dieser langweiligen Hunde aussah, die man züchtet, damit sie ein Mäntelchen tragen können, das ihnen ein paar Nummern zu groß ist. Ihr eigener langweiliger Hund war alles in allem noch formloser als der schlechtsitzende Sharpei, dem sie glich.
«Es ist sehr freundlich von Ihnen, mich so kurzfristig aufzusuchen», sagte sie. Ich ließ ein paar höfliche Floskeln vom Stapel, doch sie hatte eine Art von Hochnäsigkeit, die man nur erwerben kann, wenn man eine so feine Adresse wie die Herbertstraße vorweisen kann.
Frau Lange nahm auf einer grünen Chaiselongue Platz und breitete das Fell ihres Hundes auf ihrem mächtigen Schoß aus, als wäre es eine Strickarbeit, an der sie weiterzuarbeiten gedachte, während sie mir ihr Problem erläuterte. Ich schätzte, daß sie die Fünfzig hinter sich hatte. Nicht, daß das eine Rolle spielte. Wenn Frauen die Fünfzig überschreiten, ist ihr Alter für niemanden mehr interessant, außer für sie selber. Bei Männern verhält es sich genau umgekehrt.
Sie brachte ein Zigarettenetui zum Vorschein, hielt es mir hin und fügte einschränkend hinzu: «Es sind Menthol-Zigaretten.»
Ich glaube, es war Neugier, die mich eine nehmen ließ, doch als ich den ersten Lungenzug machte, zuckte ich zusammen und begriff, daß ich bloß vergessen hatte, wie ekelhaft Menthol schmeckte. Sie lächelte über mein unübersehbares Unbehagen.
«Oh, machen Sie sie aus, um Himmels willen. Sie schmecken entsetzlich. Ich weiß nicht, warum ich sie rauche, ich weiß es wirklich nicht. Rauchen Sie eine von Ihren eigenen, sonst werden Sie mir nie zuhören.»
«Danke», sagte ich und drückte sie in einem Aschenbecher aus, der so groß war wie eine Radkappe. «Das mache ich gern.»
«Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns beiden einen Drink machen. Ich weiß nicht, wie’s mit Ihnen steht, aber ich könnte sicher einen vertragen.» Sie deutete auf einen großen Biedermeiersekretär, dessen oberer Teil mit seinen bronzenen ionischen Säulen einen griechischen Tempel im Kleinen darstellte.
«In dem Ding ist eine Flasche Gin», sagte sie. «Ich kann Ihnen nichts anderes als Limonensaft zum Mixen anbieten. Ist leider das einzige, was ich trinke.»
Es war ein bißchen früh für mich, aber trotzdem mixte ich zwei. Ich war ihr für den Versuch dankbar, mir die Befangenheit zu nehmen, wenngleich das eigentlich zu meinen eigenen beruflichen Fähigkeiten gehören sollte. Allerdings war Frau Lange kein bißchen nervös. Sie sah aus wie eine Frau, die selber über einige berufliche Fähigkeiten verfügte. Ich reichte ihr den Drink und nahm in einem ächzenden Ledersessel neben der Chaiselongue Platz.
«Sind Sie ein aufmerksamer Mann, Herr Gunther?»
«Ich kann sehen, was in Deutschland passiert, wenn’s das ist, was Sie meinen.»
«Das meinte ich nicht, aber ich bin trotzdem erfreut, das zu hören. Nein, ich meinte, wie gut sind Sie darin, etwas zu erkennen?»
«Hören Sie, Frau Lange, es ist nicht nötig, wie eine Katze um den heißen Brei herumzuschleichen. Kommen Sie am besten gleich zur Sache.» Ich wartete einen Augenblick und sah zu, wie sie verlegen wurde. «Ich werde es an Ihrer Stelle sagen, wenn Sie mögen. Sie wollen wissen, ob ich ein guter Detektiv bin.»
«Leider verstehe ich sehr wenig von solchen Dingen.»
«Warum sollten Sie auch.»
«Wenn ich mich Ihnen jedoch anvertrauen soll, sollte ich nach meinem Gefühl eine gewisse Vorstellung von Ihren Referenzen haben.»
Ich lächelte. «Sie werden verstehen, daß mein Geschäft keines von der Art ist, daß ich die Empfehlungsschreiben zahlreicher zufriedener Klienten vorweisen könnte. Vertraulichkeit ist für meine Klienten ebenso wichtig wie für die, die im Beichtstuhl sitzen. Vielleicht noch viel wichtiger.»
«Wie soll man dann aber wissen, ob der Mann, den man engagiert, sein Geschäft versteht?»
«Ich verstehe mein Geschäft sehr gut, Frau Lange. Mein guter Ruf ist wohlbekannt. Vor zwei Monaten hatte ich sogar ein Angebot für meine Firma. Ein ziemlich gutes Angebot, nebenbei bemerkt.»
«Warum haben Sie nicht verkauft?»
«Erstens, weil meine Firma unverkäuflich ist. Und zweitens, weil ich zum Arbeitnehmer ebensowenig tauge wie zum Arbeitgeber. Trotzdem es ist schmeichelhaft, wenn so was passiert. Natürlich ist das überhaupt nicht der springende Punkt. Die meisten Leute, welche die Dienste eines Privatdetektivs wünschen, brauchen die Firma nicht zu kaufen. In der Regel fragen sie ihren Anwalt, um einen Detektiv zu finden. Sie werden feststellen, daß ich von zahlreichen Anwaltskanzleien empfohlen werde, darunter auch die, denen meine Aussprache oder meine Manieren nicht passen.»
«Verzeihen Sie, Herr Gunther, aber nach meiner Meinung wird der Beruf des Anwalts stark überschätzt.»
«Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ich bin noch keinem Anwalt begegnet, der sich zu fein gewesen wäre, seiner Mutter den Sparstrumpf zu stehlen, samt der Matratze, unter der sie ihn versteckt hat.»
«In fast allen geschäftlichen Dingen habe ich mich auf mein eigenes Urteil viel besser verlassen können.»
«Was genau ist Ihr Geschäft, Frau Lange?»
«Ich besitze und leite einen Verlag.»
«Den Lange Verlag?»
«Wie ich sagte, hat mich mein eigenes Urteil nur selten getäuscht, Herr Gunther. Im Verlagsgeschäft dreht sich alles um Geschmack, und um zu erfahren, was sich verkaufen läßt, muß man den Geschmack der Leute, an die man verkaufen will, richtig einschätzen. Nun, ich bin eine echte Berlinerin und glaube diese Stadt und ihre Bewohner so gut wie jeder andere zu kennen. Ich komme also noch einmal auf meine ursprüngliche Frage zurück, nämlich ob Sie aufmerksam hinschauen, und bitte Sie, mir auf Folgendes zu antworten: Wenn ich in Berlin fremd wäre, wie würden Sie mir die Berliner beschreiben?»
Ich lächelte. «Was ist ein Berliner, wie? Das ist eine gute Frage. Bis jetzt hat mich noch kein Klient aufgefordert, durch ein paar Reifen zu springen, um festzustellen, ob ich ein schlauer Hund bin. Wissen Sie, ich bin eigentlich für Kunststückchen nicht zu haben, aber in Ihrem Fall will ich eine Ausnahme machen. Berliner haben es gern, wenn Leute Ausnahmen für sie machen. Ich hoffe, Sie passen jetzt gut auf, weil ich meine Vorführung begonnen habe. Ja, sie haben gern das Gefühl, daß man sie für eine Ausnahme hält, obwohl sie gleichzeitig den Schein wahren möchten. Im wesentlichen bevorzugen sie dieselbe Art von Kleidung. Ein Hut, ein Schal, ein Paar Schuhe, mit denen sie bis nach Shanghai laufen könnten, ohne Hühneraugen zu kriegen. Dazu paßt, daß Berliner gern zu Fuß gehen, und darum haben so viele von ihnen einen Hund: einen bösartigen, wenn sie männlichen, einen niedlichen, wenn sie anderen Geschlechts sind. Die Männer kämmen ihr Haar mehr als die Frauen, und sie lassen sich auch Schnurrbärte wachsen, in denen man Wildschweine jagen könnte. Touristen glauben, daß eine Menge Berliner Männer sich herausputzen wie Frauen, aber es sind bloß die häßlichen Frauen, die ihnen diesen schlechten Ruf verschaffen. Nicht, daß es heutzutage viele Touristen gäbe. Unter den Nationalsozialisten sind sie ein ebenso seltener Anblick wie Fred Astaire in Knobelbechern.
Die Einwohner dieser Stadt nehmen Sahne zu fast allem, Bier eingeschlossen, und Bier ist etwas, das sie tatsächlich ernst nehmen. Die Frauen haben es gern, wenn eine 10-Minuten-Blume drauf ist, genau wie die Männer, und es macht ihnen nichts aus, ihr Bier selber zu bezahlen. Fast jeder, der ein Auto besitzt, fährt viel zu schnell, aber es würde keinem im Traum einfallen, bei Rot durchzufahren. Sie haben kaputte Lungen, weil die Luft so schlecht ist und sie zuviel rauchen, und eine Art von Humor, der sich grausam anhört, wenn man ihn nicht versteht, und noch grausamer, wenn man ihn versteht. Sie kaufen teure Biedermeierschränke, solide wie Blockhäuser, und dann hängen sie die Glastüren von innen mit Vorhängen zu, um zu verbergen, was sie darin aufbewahren. Es ist eine typische idiosynkratische Mischung von Protzerei und Heimlichtuerei. Wie mache ich meine Sache?»
Frau Lange nickte. «Von der Bemerkung über Berlins häßliche Frauen abgesehen, machen Sie Ihre Sache ganz gut.»
«Das war eine sachliche Feststellung.»
«Da irren Sie sich, machen Sie keinen Rückzieher, sonst höre ich auf, Sie zu mögen. Sie waren unsachlich. Sie werden gleich sehen, warum. Wie hoch ist Ihr Honorar?»
«Siebzig Mark pro Tag, plus Unkosten.»
«Und was wären das für Unkosten?»
«Schwer zu sagen. Fahrtkosten. Bestechungsgelder. Alles, was dazu dient, an Informationen zu kommen. Sie bekommen Quittungen über alle Unkosten, ausgenommen die Bestechungen. Was die betrifft, müssen Sie sich leider auf mein Wort verlassen.»
«Nun, hoffen wir, daß Sie den Wert gut einzuschätzen wissen.»
«Habe noch keine Klagen gehört.»
«Und ich nehme an, daß Sie einen Vorschuß wünschen.» Sie reichte mir einen Umschlag. «Darin werden Sie tausend Mark finden. Reicht Ihnen das?» Ich nickte.
«Natürlich will ich eine Quittung.»
«Natürlich», sagte ich und unterschrieb ein Blatt Papier, das sie vorbereitet hatte. Sehr geschäftstüchtig, dachte ich. Ja, sie war bestimmt eine richtige Dame.
«Da fällt mir ein, wie sind Sie gerade auf mich verfallen? Sie haben Ihren Anwalt nicht gefragt, und», setzte ich nachdenklich hinzu, «ich inseriere natürlich nicht.»
Sie stand auf und ging, ihren Hund noch immer auf dem Arm, zum Tisch.
«Ich hatte eine Ihrer Visitenkarten», sagte sie und gab sie mir. «Oder zumindest mein Sohn hatte sie. Ich nahm sie vor etwa einem Jahr aus der Tasche eines alten Anzuges, bevor ich ihn zur Winterhilfe schickte. Ich behielt sie, um sie ihm zurückzugeben. Aber als ich ihm davon erzählte, sagte er mir, so leid es mir tut, ich solle sie wegwerfen. Bloß, daß ich’s nicht tat. Ich schätze, daß ich dachte, sie könne zu einem anderen Zeitpunkt von Nutzen sein. Nun, ich habe mich nicht geirrt, stimmt’s?»
Es war eine meiner alten Visitenkarten, die noch aus der Zeit vor meiner Partnerschaft mit Bruno Stahlecker stammte. Auf die Rückseite hatte ich sogar meine private Telefonnummer geschrieben.
«Ich frage mich, woher er sie hatte», sagte ich.
«Ich glaube, er sagte, sie gehöre Dr. Kindermann.»
«Kindermann?»
«Ich werde gleich auf ihn zu sprechen kommen, wenn Sie nichts dagegen haben.» Ich fingerte eine neue Karte aus meiner Brieftasche.
«Ist nicht wichtig. Aber da ich inzwischen einen Partner habe, ist es vielleicht besser, wenn Sie die neue haben.» Ich reichte ihr die Karte, und sie legte sie auf den Tisch neben das Telefon. Als sie sich setzte, nahm ihr Gesicht einen ernsten Ausdruck an, als hätte sie in ihrem Kopf etwas ausgeschaltet.
«Und jetzt erzähle ich Ihnen besser, warum ich Sie hergebeten habe», sagte sie grimmig. «Ich will, daß Sie herausfinden, wer mich erpreßt.» Sie machte eine Pause und rückte verlegen auf dem Sofa hin und her. «Tut mir leid, das ist nicht leicht für mich.»
«Lassen Sie sich Zeit. Erpressung macht jeden nervös.» Sie nickte und nahm einen Schluck von ihrem Gin.
«Also. Vor etwa zwei Monaten, vielleicht ein bißchen früher, bekam ich einen Umschlag, der zwei Briefe enthielt, die mein Sohn an einen anderen Mann geschrieben hatte. An Dr. Kindermann. Natürlich erkannte ich die Handschrift meines Sohnes, und obwohl ich sie nicht las, wußte ich, daß sie intimer Art waren. Mein Sohn ist ein Homosexueller, Herr Gunther. Ich wußte seit einiger Zeit davon, so daß die Enthüllung für mich nicht so schrecklich war, wie der Erpresser beabsichtigt hatte. Das ging aus seinem Schreiben deutlich hervor. Er schrieb auch, es befänden sich noch zahlreiche andere Briefe in seinem Besitz, die er mir schicken würde, wenn ich ihm die Summe von tausend Mark zahle. Sollte ich mich weigern, bleibe ihm keine andere Wahl, als sie der Gestapo zu schicken. Ich bin sicher, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, Herr Gunther, daß diese Regierung gegenüber diesen unglücklichen jungen Männern eine weniger aufgeklärte Einstellung hat, als das in der Republik der Fall war. Jede Verbindung zwischen Männern, und sei sie noch so harmlos, wird heutzutage als strafbar angesehen. Hätte man Reinhard als einen Homosexuellen entlarvt, hätte das unzweifelhaft zur Folge gehabt, daß man ihn für zehn Jahre in ein Konzentrationslager steckte.
Also bezahlte ich, Herr Gunther. Mein Chauffeur deponierte das Geld an dem Ort, den man mir genannt hatte, und eine Woche oder zwei später erhielt ich nicht, wie ich gehofft hatte, ein Päckchen Briefe, sondern nur einen. Ein weiteres anonymes Schreiben lag bei, das mich davon in Kenntnis setzte, der Absender habe seine Meinung geändert, er sei arm, und ich müsse die Briefe einzeln zurückkaufen, und er habe noch zehn weitere Briefe in seinem Besitz. Seitdem habe ich vier Briefe zurückbekommen, was mich beinahe fünftausend Mark gekostet hat. Er verlangt jedesmal mehr als beim letzten Mal.»
«Weiß Ihr Sohn von dieser Sache?»
«Nein. Und wenigstens im Augenblick sehe ich keinen Grund, warum wir beide leiden sollten.» Ich seufzte und war gerade im Begriff, ihr zu widersprechen, als sie mir Einhalt gebot. «Ja, Sie werden sagen, das mache es schwieriger, diesen Verbrecher zu fangen, und Reinhard könne vielleicht Informationen haben, die Ihnen helfen können. Sie haben natürlich vollkommen recht. Aber hören Sie sich meine Gründe an, Herr Gunther. Erstens, mein Sohn ist ein impulsiver Bursche. Höchstwahrscheinlich wäre seine erste Reaktion, diesem Erpresser zu sagen, er solle sich zum Teufel scheren, und nicht zu zahlen. Das würde mit ziemlicher Sicherheit auf seine Verhaftung hinauslaufen. Reinhard ist mein Sohn, und als seine Mutter habe ich ihn von Herzen lieb, aber er ist ein Narr, der nichts davon versteht, nüchtern zu denken. Ich vermute, daß der Erpresser, wer immer er sein mag, über vorzügliche Kenntnisse der menschlichen Psyche verfügt. Er weiß, was eine Mutter, eine Witwe, für ihren einzigen Sohn empfindet – besonders, wenn sie so reich und ziemlich einsam ist wie ich.
Zweitens, ich selber kenne mich in der Welt der Homosexuellen ein wenig aus. Der verstorbene Dr. Magnus Hirschfeld schrieb verschiedene Bücher über dieses Thema, von denen ich eines, wie ich mit Stolz sagen darf, selber verlegte. Es ist eine geheimnisvolle und trügerische Welt, Herr Gunther. Ein ideales Gebiet für einen Erpresser. Also ist es durchaus möglich, daß diese bösartige Person tatsächlich mit meinem Sohn bekannt ist. Selbst zwischen Männern und Frauen kann Liebe einen guten Grund für Erpressung liefern – um so mehr wenn Ehebruch ins Spiel kommt oder Rassenschande, um die sich diese Nazis so besorgt zeigen. Aus diesen Gründen werde ich Reinhard erst einweihen, wenn Sie die Identität des Erpressers ermittelt haben, und dann wird es bei ihm liegen, was getan werden soll. Jedoch bis dahin wird er nichts von der Sache erfahren.» Sie sah mich fragend an. «Sind Sie einverstanden?»
«Ich habe an Ihrer Argumentation nichts auszusetzen, Frau Lange. Sie scheinen diese Angelegenheit gründlich durchdacht zu haben. Darf ich die Briefe Ihres Sohnes sehen?» Nach einer Mappe greifend, nickte sie, zögerte dann jedoch.
«Ist das nötig? Daß Sie diese Briefe lesen, meine ich?»
«Ja», sagte ich entschieden. «Und haben Sie die Schreiben des Erpressers noch?»
«Hier ist alles drin», sagte sie. «Die Briefe und die anonymen Schreiben.»
«Er hat keines seiner Schreiben zurückverlangt?»
«Nein.»
«Das ist gut. Das bedeutet, daß wir es mit einem Amateur zu tun haben. Jemand mit etwas Erfahrung in diesem Geschäft hätte bei jeder Zahlung seinen Brief zurückverlangt. Um Sie daran zu hindern, Beweise gegen ihn zu sammeln.»
«Ja, ich verstehe.»
Ich warf einen Blick auf das, was ich mit einiger Übertreibung Beweise nannte. Die Begleitschreiben und die Umschläge waren alle mit der Schreibmaschine auf Papier von guter Qualität geschrieben, wiesen keine besonderen Kennzeichen auf und trugen die Poststempel verschiedener Bezirke im ganzen Berliner Westen – W 35, W 40, W 50 –, die Briefmarken waren allesamt Sondermarken zum fünften Jahrestag der Nazi-Machtergreifung. Das war immerhin etwas. Dieser Jahrestag war am 30. Januar gewesen, und es sah also nicht so aus, als ob Frau Langes Erpresser sehr oft Briefmarken kaufte.
Reinhard Langes Briefe waren auf schwerem Papier geschrieben, das sich nur Verliebte leisten – die Sorte, die so viel kostet, daß man sie einfach ernst nehmen muß. Die Handschrift war sauber und penibel, fast sorgsam, was man von den Inhalten nicht gerade sagen konnte. Der Besucher eines Türkischen Bades hätte daran vielleicht nichts sonderlich Anstößiges gefunden, doch im Nazi-Deutschland reichten Reinhard Langes Liebesbriefe mit Sicherheit aus, ihrem unverschämten Verfasser eine Reise ins KZ und einen Rosa Winkel einzubringen.
«Dieser Doktor Lanz Kindermann», sagte ich und las den Namen von dem nach Limonen duftenden Umschlag. «Was genau wissen Sie über ihn?»
«Es gab eine Phase, da war Reinhard davon überzeugt, er müsse sich wegen seiner Homosexualität behandeln lassen. Zuerst probierte er es mit allerlei endokrinen Präparaten, doch die erwiesen sich als unwirksam. Die Psychotherapie schien eine bessere Erfolgschance zu bieten. Ich glaube, zahlreiche hochrangige Parteimitglieder und Jungens aus der Hitlerjugend haben sich derselben Behandlung unterzogen. Kindermann ist Psychotherapeut, und Reinhard lernte ihn kennen, als er sich wegen einer Behandlung in Kindermanns Klinik in Wannsee begab. Statt dessen fing er mit Kindermann, der selber homosexuell ist, eine intime Beziehung an.»
«Verzeihen Sie meine Unwissenheit, aber was ist das eigentlich, eine Psychotherapie? Ich dachte, so etwas wäre nicht mehr erlaubt.»
Frau Lange schüttelte den Kopf. «Ich bin nicht ganz sicher. Doch ich glaube, der Schwerpunkt liegt darauf, daß man Geistesstörungen als Teil des gesamten körperlichen Gesundheitszustandes betrachtet. Fragen Sie mich nicht, wodurch sich das von den Theorien dieses Doktor Freud unterscheidet, außer, daß Freud ein Jude und Kindermann ein Deutscher ist. Kindermanns Klinik nimmt ausschließlich Deutsche auf. Wohlhabende Deutsche mit Alkohol- und Drogenproblemen, für die die ausgefallene Seite der Medizin einen gewissen Reiz hat – Chiropraktik und dergleichen. Oder solche, die sich lediglich kostspielig erholen wollen. Zu Kindermanns Patienten gehört auch Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers.»
«Sind Sie Doktor Kindermann je begegnet?»
«Einmal. Ich mochte ihn nicht. Er ist ein ziemlich arroganter Österreicher.»
«Sind sie das nicht alle?» murmelte ich. «Können Sie sich vorstellen, er wäre der Typ, es mal mit ein bißchen Erpressung zu versuchen. Immerhin waren die Briefe an ihn gerichtet. Wenn’s nicht Kindermann ist, dann muß es jemand sein, der ihn kennt. Oder zumindest jemand, der die Gelegenheit hatte, ihm die Briefe zu stehlen.»
«Ich gestehe, daß ich Kindermann aus dem einfachen Grund nicht verdächtigt habe, weil die Briefe beide betreffen.» Sie dachte einen Augenblick nach. «Ich weiß, es hört sich albern an, aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie die Briefe in den Besitz einer anderen Person gekommen sein könnten. Aber jetzt, wo Sie darauf zu sprechen kommen, schätze ich, daß man die Briefe gestohlen haben muß. Ich würde meinen, man stahl sie Kindermann.»
Ich nickte. «So weit, so gut», sagte ich. «Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die ein bißchen schwieriger ist.»
«Ich weiß, was Sie sagen wollen, Herr Gunther», sagte sie mit einem schweren Seufzer. «Habe ich die Möglichkeit in Betracht gezogen, mein eigener Sohn könne vielleicht der Täter sein?» Sie blickte mich kritisch an und fügte hinzu: «Ich habe mich in Ihnen nicht geirrt, nicht wahr? Es ist genau die zynische Frage, von der ich hoffte, Sie würden sie stellen. Jetzt weiß ich, daß ich Ihnen trauen kann.»
«Ein Detektiv braucht seinen Zynismus wie ein Gärtner seinen grünen Finger, Frau Lange. Manchmal bringt er mich in Schwierigkeiten, aber meistens hält er mich davon ab, Leute zu unterschätzen. Sie werden mir also hoffentlich verzeihen, wenn ich unterstelle, das könnte der wahre Grund sein, warum Sie ihn nicht in die Untersuchung hineinziehen wollen, und daß Sie das bereits bedacht haben.»
Ich sah, wie sie ein wenig lächelte, und fügte hinzu: «Sie sehen also, daß ich Sie nicht unterschätze, Frau Lange.» Sie nickte.
«Könnten Sie sich vorstellen, daß er Geldschwierigkeiten hat?»
«Nein. Als Mitglied des Verwaltungsrates des Lange Verlages bezieht er ein stattliches Gehalt. Er hat darüber hinaus Einkünfte aus einer Stiftung, die sein Vater für ihn eingerichtet hat. Es ist wahr, er spielt gern. Aber was für mich viel schlimmer ist, er ist der Besitzer eines Blatts namens Urania.»
«Eines Blatts?»
«Eine Zeitschrift. Über Astrologie oder ähnlichen Quark. Seit dem Tag, da er sie kaufte, hat sie ihm nichts als Verluste gebracht.» Sie zündete sich eine neue Zigarette an und sog mit gespitzten Lippen daran, als wolle sie eine Melodie pfeifen. «Und er weiß, daß er, wenn er mal wirklich knapp an Geld ist, bloß zu mir zu kommen braucht.»
Ich lächelte wehmütig. «Ich weiß, ich bin nicht das, was Sie hübsch nennen würden, aber haben Sie je daran gedacht, jemanden wie mich zu adoptieren?» Darüber mußte sie lachen, und ich fügte hinzu: «Scheint ein sehr vom Glück verwöhnter junger Mann zu sein.»
«Er ist sehr verzogen, das stimmt. Und so jung ist er auch nicht mehr.» Sie starrte in den Raum. «Für eine reiche Witwe wie mich ist Reinhard das, was man im Geschäftsleben ein ‹Verlustgeschäft› nennt. Es gibt im Leben keine Enttäuschung, die sich annähernd mit der vergleichen ließe, die einem der einzige Sohn bereitet.»
«Wirklich? Ich habe sagen hören, Kinder seien ein Segen, wenn man älter wird.»
«Wissen Sie, für einen Zyniker werden Sie ganz schön sentimental. Ich wette, daß Sie selber keine Kinder haben. Also lassen Sie sich von mir über einen Irrtum aufklären. Kinder sind das Spiegelbild des eigenen Alters. Sie sind die beste Methode, rasch alt zu werden, die ich kenne. Der Spiegel des eigenen Verfalls. Vor allem des meinen.»
Der Hund gähnte und sprang von ihrem Schoß, als habe er das schon viele Male gehört. Auf dem Boden streckte er sich, rannte zur Tür und warf einen auffordernden Blick auf seine Herrin. Sie ließ sich durch dieses Schauspiel hündischen Hochmuts nicht aus der Ruhe bringen, erhob sich und ließ das Scheusal hinaus.
«Und was soll jetzt geschehen?» fragte sie und kehrte zur Chaiselongue zurück.
«Wir warten auf einen neuen Brief. Die nächste Geldübergabe werde ich übernehmen. Doch es wäre keine schlechte Idee, wenn ich mich bis dahin für ein paar Tage in Doktor Kindermanns Klinik begeben würde. Ich möchte gern etwas mehr über den Freund Ihres Sohnes erfahren.»
«Ich schätze, das haben Sie unter Unkosten verstanden, oder?»
«Ich werde versuchen, mich nur kurze Zeit dort aufzuhalten.»
«Geben Sie sich Mühe», sagte sie im Tonfall einer Lehrerin. «In der Kindermann-Klinik kostet ein Tag hundert Mark.»
Ich stieß einen Pfiff aus. «Sehr beachtlich.»
«Und jetzt muß ich mich entschuldigen, Herr Gunther», sagte sie. «Ich habe mich auf eine Sitzung vorzubereiten.» Ich steckte meinen Vorschuß ein, wir schüttelten uns die Hände, ich nahm die Mappe mit den Briefen und zupfte an der Tür meinen Anzug zurecht.
Ich ging zurück durch den Korridor und die Halle. Eine Stimme bellte: «Sie sind ja immer noch da. Ich muß Sie rauslassen. Frau Lange mag es nicht, wenn ich ihre Besucher nicht selber zur Tür bringe.»
Ich legte meine Hand auf den Türknauf und stieß dort auf etwas Klebriges. «Ihre warmherzige Persönlichkeit, ohne Zweifel.» Ich riß verärgert die Tür auf, während das schwarze Faß durch die Halle watschelte. «Sparen Sie sich die Mühe», sagte ich und roch an meiner Hand. «Machen Sie einfach weiter, was immer Sie in dieser Staubwüste auch tun.»
«Bin schon lange bei Frau Lange», knurrte sie. «Sie hatte nie Klagen.»
Ich fragte mich, ob Erpresserbriefe überhaupt hier reinkamen. Schließlich muß man einen guten Grund haben, sich einen Wachhund zu halten, der nicht bellt. Außerdem konnte man zwischen den beiden Frauen wohl kaum von Zuneigung sprechen – nicht bei diesem Faß. Es war wahrscheinlicher, daß man sich mit einem Krokodil anfreundete. Wir starrten einander einen Augenblick an, und dann sagte ich: «Raucht die Dame des Hauses immer so viel?»
Das schwarze Faß dachte eine Sekunde nach, ob das eine Fangfrage war oder nicht. Sie kam zu dem Schluß, das sei nicht der Fall.
«Sie hat immer ’nen Sargnagel im Mund, das ist ’ne Tatsache.»
«Aha, das muß die Erklärung sein», sagte ich. «Ich wette, bei all dem Zigarettenrauch hier weiß sie nicht mal, wo Sie sind.»
Sie unterdrückte einen bitterbösen Fluch und schlug mir die Tür vor der Nase zu.
Ich mußte über viele Dinge nachdenken, während ich über den Kurfürstendamm zur Stadtmitte zurückfuhr. Ich dachte an Frau Langes Fall und an die tausend Mark in meiner Tasche. Ich dachte an einen kurzen Urlaub in einem hübschen komfortablen Sanatorium, auf ihre Kosten, und an die Gelegenheit, die sich mir bot, wenigstens für eine Weile, Bruno und seiner Pfeife zu entfliehen; ganz zu schweigen von Arthur Nebe und Heydrich. Vielleicht wurde ich sogar meine Schlaflosigkeit und meine Depressionen los. Aber am intensivsten dachte ich darüber nach, wie ich wohl auf die Idee gekommen war, meine Visitenkarte und meine private Telefonnummer einem österreichischen Schwulen zu geben, von dem ich noch nie gehört hatte.
3.Mittwoch, 31. August
Im Gebiet südlich der Königstraße in Wannsee liegen alle Arten von Privatkliniken und Krankenhäusern – Häuser von der eleganten, blankgeputzten Sorte, wo man an die Fußböden und Fenster ebenso viel Äther verschwendet wie an die Patienten selbst. Was die Behandlung angeht, so ist sie überall die gleiche. Ein Mann konnte über die Konstitution eines afrikanischen Elefantenbullen verfügen, und doch behandelte man ihn mit Freuden, als leide er an einer Bombenneurose, und ein Paar geschminkter Schwestern half ihm, wenn ihm die Zahnbürste und das Klopapier zu schwer waren, immer vorausgesetzt, er konnte dafür bezahlen. In Wannsee zählte das Bankkonto mehr als der Blutdruck.
Kindermanns Klinik befand sich abseits einer ruhigen Straße, in einem ausgedehnten gepflegten Garten, der zu einem kleinen Ausläufer des Hauptsees abfiel und neben zahllosen Ulmen und Kastanien einen überdachten Bootssteg, ein Bootshaus und eine Art von gotischem Pavillon aufwies, der so akkurat gebaut war, daß er einem kaum noch albern vorkam. Er sah aus wie ein mittelalterliches Telefonhäuschen.
Die Klinik selber war ein Konglomerat aus Giebeln, Fachwerk, Mittelstreben, zinnenbewehrten Türmen und Türmchen, so daß sie eher einer Burg am Rhein als einem Sanatorium glich. Als ich sie betrachtete, rechnete ich fast damit, daß auf dem Dachfirst ein paar Galgen auftauchen würden oder in einem fernen Verlies jemand schreien würde. Aber alles blieb still, und niemand war zu sehen. Nur vom See hinter den Bäumen waren die Rufe der Ruderer eines Vierers zu hören und forderten die Krähen zu einem heiseren Kommentar heraus.
Als ich durch die Eingangstür schritt, kam ich zu dem Schluß, daß die Chance, ein paar draußen herumschleichende Insassen anzutreffen, vermutlich um die Zeit besser war, in der die Fledermäuse daran dachten, sich ins Zwielicht zu wagen.
Mein Zimmer lag im dritten Stock und hatte einen vorzüglichen Blick auf den Küchentrakt. Es kostete achtzig Mark pro Tag und war das billigste Zimmer, das sie hatten, und als ich darin herumhüpfte, konnte ich mich bloß noch fragen, ob ich für zusätzliche fünfzig Mark pro Tag nicht Anspruch auf etwas größeres hätte als einen Wäschekorb. Aber die Klinik war voll belegt. Mein Zimmer sei alles, was sie noch frei hätten, sagte mir die Schwester, als sie mich herführte.
Sie war ein echter Schatz. Wie ein baltisches Fischweib, aber ohne den anheimelnden ländlichen Umgangston. Bis sie mein Bett aufgedeckt und mir gesagt hatte, ich solle mich ausziehen, war ich vor Erregung beinahe atemlos. Zuerst Frau Langes Hausmädchen, und dann diese Fee, der ein Lippenstift so fremd war wie einem Flugsaurier. Dabei gab’s hier hübschere Schwestern genug. Ich hatte unten jede Menge gesehen. Das wenigste, was sie angesichts des sehr kleinen Zimmers für mich tun konnten, müssen sie sich gedacht haben, war, mir zum Ausgleich eine große Schwester zuzuteilen.
«Wann öffnet die Bar?» sagte ich. Ihr Sinn für Humor war nicht weniger erfreulich als ihre Schönheit.
«Hier drin ist kein Alkohol erlaubt», sagte sie und schnippte mir die unangezündete Zigarette aus dem Mund. «Und Rauchen ist streng verboten. Doktor Meyer wird in Kürze Visite machen.»
«Ich höre wohl nicht recht. Ist er der Mann für die zweite Klasse? Wo ist Doktor Kindermann?»
«Der Doktor ist auf einer Konferenz in Bad Nauheim.»
«Was treibt er da, ist er in einem Sanatorium? Wann kommt er zurück?»
«Ende der Woche. Sind Sie ein Patient von Doktor Kindermann, Herr Strauß?»
«Nein, bin ich nicht. Aber ich hatte gehofft, für achtzig Mark pro Tag wär ich’s.»
«Doktor Meyer ist ein sehr fähiger Arzt, das kann ich Ihnen versichern.» Sie runzelte ungeduldig die Stirn, als sie bemerkte, daß ich noch keine Anstalten gemacht hatte, mich zu entkleiden, und spitzte die Lippen zu einem mißbilligenden Geräusch, das sich anhörte, als wolle sie nett zu einem Kakadu sein. In die Hände klatschend, sagte sie mir, ich solle mich beeilen und ins Bett hüpfen, da Doktor Meyer mich untersuchen wolle. Da ich es durchaus für möglich hielt, daß sie selber Hand an mich legen würde, beschloß ich, keinen Widerstand zu leisten. Meine Krankenschwester war nicht bloß häßlich, sondern sie mußte ihre Art, mit Kranken umzugehen, in einer Handelsgärtnerei erworben haben. Nachdem sie gegangen war, machte ich es mir im Bett bequem, um zu lesen. Es war nicht die Art von Lektüre, die man als spannend bezeichnen konnte, sie war eher unglaublich. Ja, das war das passende Wort: unglaublich. Es hatte in Berlin immer verrückte okkultistische Zeitschriften gegeben, wie Zenith und Hagal, doch von der Maas bis an die Memel gab es nichts, was mit den Raffkes vergleichbar war, die für Reinhard Langes Zeitschrift Urania schrieben. Nachdem ich bloß eine Viertelstunde darin geblättert hatte, war ich vollkommen davon überzeugt, daß Lange vermutlich ein ausgemachter Spinner war. Es gab Artikel mit Titeln wie «Wotanismus und die wahren Ursprünge des Christentums», «Die Übermenschlichen Kräfte der verschollenen Bürger von Atlantis», «Kurze Darstellung der Welt-Eis-Theorie», «Esoterische Atemübungen für Anfänger», «Spiritualismus und Rassengedächtnis», «Antisemitismus als theokratisches Erbe» usw. Für einen Mann, der derartigen Unsinn veröffentlichte, dachte ich, war die Erpressung eines Elternteils vermutlich die weltliche Tätigkeit, die ihn zwischen den ariosophischen Enthüllen in Anspruch nahm. Sogar Doktor Meyer, selbst kein augenfälliger Beweis für das Gewöhnliche, sah sich zu einer Bemerkung über die Wahl meiner Lektüre veranlaßt.
«Lesen Sie öfter solche Sachen?» fragte er und drehte die Zeitschrift zwischen seinen Händen, als handle es sich um eine Art von sonderbarer Versteinerung, die Heinrich Schliemann in den Ruinen Trojas ausgegraben hatte.
«Nein, eigentlich nicht. Ich habe sie mehr aus Neugier gekauft.»
«Gut. Ein abnormes Interesse am Okkulten deutet oft auf eine instabile Persönlichkeit hin.»
«Wissen Sie, das habe ich mir auch gerade gedacht.»
«Natürlich würde in diesem Punkt nicht jeder mit mir übereinstimmen. Aber die Visionen vieler neuzeitlicher religiöser Gestalten – Augustinus, Luther – sind höchstwahrscheinlich in ihren Ursprüngen neurotisch.»
«Wirklich?»
«Ja.»
«Was denkt Doktor Kindermann?»
«Oh, Doktor Kindermann hat einige sehr ungewöhnliche Theorien. Ich bin nicht sicher, ob ich seine Arbeit verstehe, aber er ist ein glänzender Mann.» Er ergriff mein Handgelenk. «Ja, wirklich ein überaus glänzender Mann.»