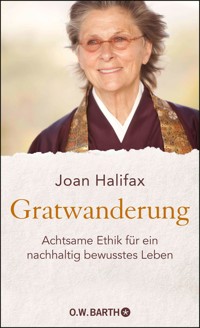Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kamphausen Media
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Eine bewegende Meditation über die Palliativpflege ... ein äußerst lesbares Buch, das Leser aller Glaubensrichtungen anziehen wird, die Joan Halifax' Klarheit und Mitgefühl schätzen werden sowie die Aussagekraft der Geschichten über ganz normale Menschen, die ihren letzten Stunden mit stillem Mut entgegensahen." Publishers WeeklyDie buddhistische Annäherung an den Tod kann für Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen von Nutzen sein – was Zen-Meisterin Joan Halifax über Jahrzehnte in ihrer Arbeit mit Sterbenden und ihren Begleitern immer wieder gezeigt hat. Dieses von traditionellen buddhistischen Lehren inspirierte Buch ist eine Quelle der Weisheit für alle, die einen sterbenden Menschen begleiten, ihrem eigenen Tod entgegensehen oder das transformierende Potenzial des Sterbeprozesses erforschen und betrachten wollen. Ihre Unterweisungen bestätigen, dass wir uns für unsere innere Stärke öffnen und allen, die leiden, helfen können, das auch zu tun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOAN HALIFAX
Im Sterbendem Leben begegnen
Mut und Mitgefühl im Angesichtdes Todes
Aus dem Amerikanischen vonBernd Bender
THESEUS VERLAG
Für Francisco Varela(1946–2001)
»Im Tod wirst du zu dem, was du erfahren hast.«
Die amerikanische Originalausgabe Being with Dying ist erschienen bei
Shambhala Publications Inc.
Horticultural Hall
300 Massachusetts Avenue,
Boston, Massachusetts 02115
© 2008 by Joan Halifax
Übersetzung ins Deutsche: Bernd Bender
Copyright der deutschen Ausgabe © 2011 Theseus
in J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, Bielefeld
Layout/Satz: Ingeburg Zoschke, Berlin
Lektorat: Susanne Klein
Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld, www.mbedesign.de
Umschlagfotos: © Joan Halifax / Hildegard Morian
E-Book Gesamtherstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt a. M.
www.weltinnenraum.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN Print 978-3-89901-395-5ISBN E-Book 978-3-95883-115-5
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe, sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Inhalt
Vorwort
Einführung: Die Trennung heilen
ERSTER TEIL. UNBEKANNTES TERRAIN
1. Pfad der Entdeckung: Beglückende Dunkelheit
Meditation: Wie wollen Sie sterben?
2. Das Herz der Meditation: Sprache und Stille
Meditation: Starker Rücken, weicher Bauch
3. Den »Stachelschwein-Effekt« überwinden: Die Angst in Sanftmut verwandeln
Meditation: Barmherzigkeit – Das Ich mit dem anderen austauschen
4. Holzpuppe und Eisenmann: Selbstloses Mitgefühl, radikaler Optimismus
Meditation: Was ist wirklich wichtig?
5. Zuhause im Grenzenlosen: Verweilen in den Unermesslichen Geisteszuständen
Meditation: Unermessliche Geisteszustände für Leben und Sterben
6. Sie sterben bereits: Einsicht in Unbeständigkeit, Selbstlosigkeit und Freiheit
Meditation: Die neun Betrachtungen
ZWEITER TEIL. FURCHTLOSIGKEITSCHENKEN
7. Fiktionen, die hindern und heilen: Der Wahrheit ins Gesicht sehen
Meditation: Zwei Wahrheiten bezeugen
8. Zwei Pfeile: »Ich habe Schmerzen« und »Ich leide nicht«
Meditation: Begegnung mit dem Schmerz
9. Furchtlosigkeit schenken: Gifte in Medizin verwandeln
Meditation: Geben und Nehmen in der Tonglen-Praxis
10. Sich um das eigene Leben kümmern, sich um die Welt kümmern: Den eigenen Grenzen mit Mitgefühl begegnen
Meditation: Grenzenlose Fürsorge
11. Das Juwelen-Netz: Gemeinschaften der Anteilnahme
Meditation: Kreis der Wahrheit
12. Verletzte Heiler: Die Schattenseite der Fürsorge
Meditation: Vier tiefgründige Überlegungen
DRITTER TEIL. DEN RISSIM GEWEBEFLICKEN
13. Durchgang zur Wahrheit: Aus der Furcht zur Befreiung
Meditation: Gehmeditation
14. Die Straße betreten: Wie wir uns erinnern und ausdrücken, bewerten und Sinn finden
Meditation: Durch den Atem loslassen
15. Zwischen Leben, zwischen Menschen: Wie wir vergeben, uns aussöhnen, Liebe und Dankbarkeit ausdrücken
Meditation: Unermessliche Geisteszustände für die Verwandlung von Beziehungen
16. Die große Angelegenheit: Den richtigen Weg gibt es nicht
Meditation: Begegnung mit dem Tod
17. Zerbrochener Kiefernzweig: Tod, Akzeptanz, Befreiung
Meditation: Auflösung der Elemente im Sterben
18. Dankbarkeit für die sterbliche Hülle: Sorge für den Körper nach dem Tod
Meditation: Leichenfeld-Betrachtung
19. Strom des Verlustes: In die Trauer eintauchen
Meditation: Begegnung mit der Trauer
Nachwort: Einssein mit dem Sterben
Danksagung
Über die Autorin
Vorwort
»Sein mit dem Tode«, der amerikanische Titel dieses Buches, ist eine Wendung, die unsere menschliche Grundsituation treffend beschreibt. Wir sind vielleicht die einzigen Wesen, die sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind. Obwohl die Fähigkeit, den Tod in Erwägung zu ziehen, eine unserer grundlegenden Eigenschaften ist, vermeiden es die meisten Menschen, darüber nachzudenken, wie ihr Leben enden könnte.
Während die Kultur des Westens den Tod mehr oder weniger verdrängt, haben sich Buddhisten in den letzten 2500 Jahren mit der Frage beschäftigt, wie es sich in der Gegenwart des Todes am besten leben lässt. In gewisser Hinsicht macht eine lebensgefährliche Verletzung oder Erkrankung uns alle zu Buddhisten, indem sie uns plötzlich und ab diesem Zeitpunkt dauerhaft aus unserer Illusion der Unsterblichkeit aufweckt. Vom Moment der Diagnose an wird die Gewissheit des Todes zu einer Glocke, die nicht aufhört zu schlagen. Wir können ihrem Klang natürlich ausweichen, wie einem unangenehmen Telefonat, doch das Geräusch wird ab jetzt immer da sein. Wir können uns mit medizinischen Informationen und fieberhafter Aktivität ablenken. Wir können trinken und Drogen nehmen, um das Dröhnen abzudämpfen, aber in stillen Momenten werden wir den Schlag der Glocke immer hören. Letztendlich, und doch meist nur zögerlich, werden wir herausfinden, dass wir das bedrängende Geräusch in uns nur zum Schweigen bringen können, indem wir seinem Ruf folgen.
Eine lebensbedrohliche Erkrankung ruft uns an einen Ort – metaphorisch gesprochen eine Wüste oder einen Berggipfel –, an dem wir uns niederlassen, damit der scharfe Wind der Wirklichkeit alles Überflüssige in unserem Leben, wie zu viel Kleidung, Make-up und Accessoires, wegreißt. Wir sind dann nackt, nur noch dieses »Ich«, das in diesem Moment ein- und ausatmet, hier und jetzt. Eine Erkrankung zeigt uns, dass wir jeden Tag, jeden Moment nur einen Herzschlag von unserem Tod entfernt sind – und immer schon entfernt waren. Diese unumstößliche Tatsache muss uns nicht deprimieren. Im Gegenteil: Wie Joan Halifax Roshi in ihrem bemerkenswerten Buch so eloquent beschreibt, kann unsere Bereitschaft zu sterben unser Leben und unsere Beziehungen zu anderen lebendiger gestalten.
Indem wir einfach nur mit unserem Atem sitzen, finden wir vielleicht heraus, dass wir ein neues Leben in uns entdecken – roh, elementar und rein –, wenn wir alles verlieren, was wir bis dahin mit dem Leben verbunden haben. Das ist jedoch nicht einfach. Der Einschnitt einer Erkrankung kann uns in tiefen Schrecken versetzen. Da sind die Anleitungen von Joan Halifax Roshi, die sich auf diesem schicksalsschweren Terrain auskennt, sehr willkommen. Aber auch wenn wir ganz alleine sind, gibt es die Weisheit unseres Körpers. Unser Einatmen verschafft uns ganz wortwörtlich eine Inspiration, während unser Ausatmen, so wie der Klang »Aahhhhh«, uns hilft, uns still in dieser neuen Wirklichkeit niederzulassen.
Wenn wir es zulassen, lehrt uns die Sterblichkeit in der Tat sehr viel über das Leben. Menschen, denen ich als Patienten begegnet bin, berichteten mir, dass ein schweres, lebensbedrohliches Leiden sie zwang – oder ihnen die Chance gab –, ihre Prioritäten zu überdenken. Fragen Sie jemanden, der auf einer Warteliste für eine Herz- oder Lebertransplantation steht, oder jemanden mit Krebs, der zum vierten oder fünften Mal einer Chemotherapie entgegensieht: »Was ist das Wichtigste?«, und zweifelsohne wird die Antwort aus den Namen der Menschen bestehen, die diese Person liebt. Nach einer schwerwiegenden Diagnose beenden viele Menschen schnell ihre Arbeitsprojekte oder geben sie ab. Die meisten verbringen dann mehr Zeit mit ihrer Familie oder mit guten Freunden. Es ist auch üblich, dass Menschen sich dann mehr mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen: Gutes Essen (falls sie es noch genießen können), der Natur, Kindern, Musik und Kunst.
Es wäre falsch, den Eindruck zu erwecken, Menschen müssten den Tod mit offenen Armen begrüßen oder passiv werden, wenn sie sich darauf vorbereiten, »sanft in jene Gute Nacht zu gehen«1. Tatsächlich gibt es meiner Erfahrung nach selbst in der Akzeptanz von Leben und Tod oft ein Element des Widerstandes. Vielleicht stellt die Liebe zwischen zwei Menschen den stärksten Akt dieses Widerstandes dar. Die Liebe ist ein bewusster Schöpfungsakt und ein Ja zum Leben. Im Erleben einer progressiven, unheilbaren Erkrankung ist die Liebe eine Erklärung an die höheren Gewalten, dass wir, auch wenn wir bestimmte Dinge, wie den Tod, nicht ändern können, einander wichtig sind.
Immer wieder habe ich erlebt, wie bemerkenswerte Menschen auf die große Ungerechtigkeit und Unannehmbarkeit des sich ankündigenden Todes reagierten, indem sie in jedem Moment noch lebendiger wurden. Das war kein Leugnen, sondern eine weise Reaktion auf eine unerwünschte, schwierige Situation. Einer dieser Menschen, ein Mädchen im Teenageralter, sagte über sein schwindendes Leben: »Es ist, was es ist.« Sie wusste, dass sie nur noch begrenzt Zeit hatte, aber sie gab dem Tod nicht mehr Gewalt über ihr Leben als nötig. Stattdessen war sie entschlossen, in der Zeit, die ihr blieb, das Leben mit noch größerer Intensität zu genießen.
Die Anteilnahme am Sterben ist keine philosophische oder metaphysische Angelegenheit, die von der Wirklichkeit des Lebens getrennt wäre, sondern eine Praxis von tiefer und pragmatischer Bedeutung. Dieses Buch vermittelt uns Weisheit und eine praktische Anleitung zum Leben.
Dr. med. Ira Byock2
Einführung
Die Trennung heilen
In vielen spirituellen Lehren ist die tiefe Trennung von Leben und Tod in einer ganzheitlichen Energie aufgehoben, die nicht geteilt werden kann. Aus dieser Sicht ist die Verneinung des Todes zugleich eine Verneinung des Lebens. Wir müssen Alter, Krankheit und Tod nicht mit Leiden gleichsetzen; wir können in einer Art und Weise leben, die das Sterben zu einem natürlichen Übergang macht, zu einer Vollendung des Lebens, ja sogar zur absoluten Befreiung.
Die wunderbare und auch schwierige Arbeit, sterbenden Menschen spirituelle Begleitung anzubieten, ist eine Reaktion auf die von Furcht erfüllte amerikanische Version eines »guten Todes« – ein Tod, der nur allzu oft lebensverneinend, antiseptisch, betäubt, hinter Schläuchen versteckt und institutionalisiert ist. Der eklatante Mangel an sinnstiftenden Ritualen, Lehrbüchern und Materialien für ein bewusstes Sterben hat mittlerweile einer Fülle von Literatur Platz gemacht. Obwohl diese Ansätze der mitfühlenden Begleitung speziell für Sterbende und ihre Betreuer entwickelt wurden, wenden sie sich aber auch an »gesunde Abenteurer«, Suchende, die nicht nur alle Aspekte des Lebens erforschen, sondern sich ganz praktisch mit der einzigen Gewissheit unseres Lebens auseinandersetzen wollen.
Nach vier Jahrzehnten, in denen ich Sterbende und ihre Betreuer begleitet habe, denke ich, dass die Erforschung der Prozesse, die uns den Tod annehmen lassen, auch für all jene von Wert ist, die noch viele Jahre vor sich haben. Natürlich sind Menschen, die krank sind oder leiden, die am Alter oder an einer tödlichen Erkrankung sterben, vielleicht offener dafür, sich mit der großen Angelegenheit des Sterbens auseinanderzusetzen, als junge und gesunde Menschen oder all jene, die noch an ihre eigene Unzerstörbarkeit glauben. Doch je eher wir den Tod annehmen können, umso mehr Zeit haben wir, vollständig zu leben und in der Wirklichkeit zu sein. Wenn wir den Tod annehmen, beeinflusst das nicht nur unsere Erfahrung des Sterbens, sondern auch unsere Erfahrung des Lebens. Leben und Tod sind zwei Seiten desselben Kontinuums. Man kann nicht – was so viele von uns versuchen –, zugleich ein erfülltes Leben haben und sich das Unvermeidliche vom Leibe halten wollen.
In unserem Unbehagen machen wir oft Witze über den Tod, der genauso endgültig ist wie die Steuern. Woody Allen hat diese Haltung, die die meisten von uns amüsant und normal finden, auf die Spitze getrieben: »Ich habe keine Angst vor dem Tod; ich will nur nicht dabei sein, wenn’s passiert.«3 Ja, das ist lustig, aber die tragische Verzerrung besteht darin, dass wir auch das Leben vermeiden, wenn wir den Tod vermeiden. Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich will bei allem dabei sein.
Wenn Menschen sich zu einem Meditations-Retreat zusammenfinden, können wichtige Veränderungen im eigenen Geist und im eigenen Leben eintreten. Ich denke oft an ein bestimmtes Retreat, weil damals etwas geschah, das mit erbarmungsloser Deutlichkeit aufzeigte, wie zerbrechlich unsere menschlichen Körper sind und wie ernst die »Große Angelegenheit von Leben und Tod« ist, von der Buddhisten sprechen.
Das Retreat fand in den 1970er Jahren auf Cortez Island in Kanada statt, in einem idyllischen Zentrum, das damals Cold Mountain Institute hieß. Es war gerade der Beginn des Morgenprogramms; wir hatten gerade unsere erste Meditationsrunde abgeschlossen. Ein leiser Glockenschlag beendete die Runde; wir streckten unsere Beine und standen zur Gehmeditation auf – ein Mann jedoch blieb sitzen.
Ich erinnere mich an ein Gefühl der Beunruhigung, als ich mich umdrehte und ihn ansah: Wieso stand er nicht auf? Er saß immer noch mit perfekt gekreuzten Beinen in der Lotushaltung; seine Füße ruhten auf den Oberschenkeln. Doch dann bekam ich einen Schreck, als ich sah, wie sich sein Körper zur Seite neigte, zusammensackte und schließlich zu Boden fiel. Er war auf der Stelle tot. Mehrere Ärzte und Krankenpfleger, die an dem Retreat teilnahmen, versuchten, ihn mit Sauerstoff wiederzubeleben, aber es war zu spät. Hinterher erfuhren wir, dass seine Hauptschlagader geplatzt war, während wir alle in Meditation saßen.
Der Mann hatte gesund gewirkt – er war in seinen späten Dreißigern. Als er zu dem Retreat kam, hatte er sicher nicht gedacht, dass er in dieser Zeit sterben würde. Und dennoch: sechzig Leute setzten sich an diesem Tag in Meditation – aber nur neunundfünfzig standen wieder auf.
Für viele von uns, die wir durchs Leben gehen und uns verhalten, als wären wir unsterblich, ist das eine verstörende Geschichte. Wir spulen dann gekonnt Wahrheiten darüber ab, dass der Tod eben ein Teil des Lebens sei, eine natürliche Phase im Kreislauf der Existenz – und doch handeln wir nicht aus dieser Einsicht heraus. Die Verdrängung des Todes breitet sich in unserer Kultur immer stärker aus, und wir sind gänzlich unvorbereitet, wenn unsere Zeit gekommen ist oder wir anderen beim Sterben helfen sollen. Meist sind wir dann nicht offen für diejenigen, die uns brauchen, sondern reagieren mit Angst und Verdrängung – wir sind dann noch nicht einmal offen für uns selbst.
Als eine, die mit Sterbenden arbeitet, dachte ich in der Vergangenheit manchmal, ich müsse mich dafür entschuldigen, eine Buddhistin zu sein. Ich dachte, meine Praxis könne sektiererisch oder unangemessen wirken. Über die Jahre habe ich jedoch erfahren, wie sehr die Lehren Buddhas den Lebenden und Sterbenden jeglicher Glaubensrichtung helfen konnten, und meine Vorbehalte sind verschwunden. Es ist äußerst wichtig, dass wir im Westen eine Vorstellung vom Tod entwickeln, die das Leben wertschätzt. Die Begegnung zwischen Ost und West hat uns Einsichten in Liebe und Tod geschenkt, und jetzt sehen wir, dass es sich dabei um zwei Seiten derselben Medaille handelt. Ich hoffe, dieses Buch, in dem sich vierzig Jahre meiner Arbeit in der Sterbebegleitung widerspiegeln, lässt Sie einige der erstaunlichen Möglichkeiten entdecken, die uns das Leben schenkt, wenn wir dem Tod offen begegnen.
Was ich hier schreibe, ist keine Theorie, sondern beruht auf meiner Arbeit mit Sterbenden und den vielen Jahren, in denen ich das Privileg hatte, professionelle und ehrenamtliche Betreuer zu schulen. Geprägt ist es auch durch meine Freundschaft mit Bernie Glassman Roshi, der die »Drei Grundsätze« für friedensstiftendes Handeln entwickelt hat. Die drei Grundsätze sind: Nicht-Wissen, Teilhabe und liebevolles Handeln. Sie beschreiben meine Erfahrungen mit Sterbenden, Trauernden und Betreuern. Diese Grundsätze leiten mich in meiner Praxis, am Sterben Anteil zu nehmen.
Der erste Grundsatz, Nicht-Wissen, hält uns an, unsere starren Vorstellungen über uns und andere aufzugeben und uns dem spontanen Geist des Anfängers zu öffnen. Der zweite Grundsatz, Teilhabe, lädt uns ein, mit dem Leiden und der Freude dieser Welt gegenwärtig zu sein, so wie sie sich zeigen, ohne Urteil und ohne Anhaften an einem Resultat. Der dritte Grundsatz, liebevolles Handeln, ermutigt uns, uns der Welt mit der Verpflichtung zuzuwenden, andere und uns selbst vom Leiden zu befreien. Ich habe die drei Grundsätze in meiner Arbeit mit Sterbenden angewendet, seit Glassman Roshi sie vor Jahren mit mir teilte; in diesem Buch tauchen sie als Anleitung dazu auf, darüber nachzudenken, wie wir mit Leben und Sterben umgehen können.
Wie Sie sehen werden, mache ich in diesem Buch keinen großen Unterschied zwischen Leben und Sterben. Normalerweise denken wir in einer falschen Dichotomie über Leben und Sterben nach, obwohl es in der Realität keine Trennung zwischen ihnen gibt, sondern nur wechselseitige Durchdringung und Einheit. Die Meditationen und die Praktiken, die ich hier beschreibe, können Sie, mit kleinen Veränderungen, selbst ausprobieren, falls Sie krank sind oder vielleicht bald sterben müssen, oder Sie schlagen sie Angehörigen eines Sterbenden vor. Sie können sie aber auch für sich anwenden, falls Sie ein Betreuer sind, oder Sie praktizieren sie für alle Wesen oder einfach nur, weil sie das Leben lebendiger und weicher machen.
Nach jedem Kapitel mache ich Vorschläge für Meditationen, in denen Sie praktisch erfahren können, wie es ist, die »Große Angelegenheit« in einer ganzheitlichen, konzentrierten Art und Weise zu betrachten. Diese Praktiken sind upaya, oder – übersetzt aus dem Sanskrit – »geschickte Mittel«, Techniken oder Methoden, die wir einsetzen können, um in unserem Leben und Sterben geschickter und in gewisser Weise effektiver zu werden, indem wir Herz und Geist schulen. Es sind Tore, die wir immer wieder durchschreiten, bis wir sie uns durch die Erfahrung vollständig angeeignet haben.
In unserem Kloster in Santa Fe, sage ich manchmal, sollten wir ein Motto über dem Eingang hängen haben: »Sei da!«. Das ist alles, was es zu tun gilt, wenn wir meditieren – da zu sein. Wir kommen mit all unseren Gedanken und Gefühlen zur Praxis, um mit dem zu sein, was gerade geschieht, ganz gleich, ob wir müde sind, wütend, ängstlich, in Trauer oder ob wir einfach nur Widerstand spüren und keine Lust haben. Es ist egal, was wir fühlen; wir kommen einfach ins Zentrum und setzen uns hin. Experimentieren Sie also mit allem, was in Ihnen auftaucht – es ist der Stoff der Praxis: »Na, schau mal, wer da auftaucht – Widerstand. Wie interessant!« Oder vielleicht: »Heute bin ich verzagt. Dann werde ich eben damit sitzen.«
Unsere Haltung der Offenheit und Annahme von allem, was geschieht, ist grundlegend dafür, mit Sterben, Tod, Fürsorge und Trauer umzugehen. Der einzige Weg, Offenheit in jeder Situation, so wie sie gerade ist, zu entwickeln, besteht darin, Präsenz und Akzeptanz zu praktizieren. Wir tun unser Bestes, alles so vollständig wie möglich zu erfahren, und weichen nicht vor der Intensität einer Erfahrung zurück, auch wenn sie uns anfangs Angst macht.
Tatsächlich ist das ein ganz natürlicher Zustand. Ich nenne es »No-Big-Deal-Dharma« – etwas ganz Alltägliches, nichts Besonderes. Mit dieser Art von offener, umfassender Bewusstheit sind wir vollständig – und dieser Moment ist vollständig. Es gibt nichts Besonderes, das wir erkennen müssten, keine transzendente Wirklichkeit, die es zu erreichen gilt, nichts außerhalb dessen, was gerade geschieht.
Kontemplative Praxis ist eine durch und durch natürliche Aktivität. Es ist eine direkte Art und Weise, mit den Dingen zu sein, genau so, wie sie sind. Obwohl es sicherlich hilft, sich in diesem Prozess durch Sitzmeditation zu üben, müssen wir keine bestimmte Zeit, keinen bestimmten Ort reservieren, keinen besonderen Geisteszustand haben, um so zu sein. Wir können diese Erfahrung auch nicht erzwingen. Wenn es mühsam und anstrengend wird, wenn ungewöhnliche Geisteszustände auftauchen, dann betrachten Sie diese einfach, entspannen Sie sich und lassen Sie sie los. Wahrnehmen, entspannen und loslassen – die drei zentralen Aspekte der Achtsamkeit. Der Geist des Nicht-Wissens ist einfach, direkt, offen und frisch. Er ist wie die Wolken am Himmel, wie fließendes Wasser, eine leichte Brise: Nichts behindert ihn.
Seien Sie, wenn Sie denken, schreiben, gehen oder in Stille sitzen, offen dafür, alle Aspekte des Lebens, so wie sie sich Ihnen zeigen, zu betrachten. Ich versichere Ihnen, wie bereits Rilke schrieb: »Kein Gefühl ist das fernste.«4
Wie unerträglich gewisse Beschwerden auch sein mögen, letztendlich ist alles, was wir erfahren, nicht von Dauer. Und bitte, bemühen Sie sich, für Ihr Leben da zu sein, Moment für Moment, in diesem Moment – denn er ist vollkommen, so wie er ist.
ERSTER TEILUNBEKANNTES TERRAIN
Für die meisten von uns beginnt die Reise in die Anteilnahme am Sterben mit einer Diagnose, entweder der eigenen oder der eines Freundes oder Verwandten: Alzheimer, Krebs, Diabetes, Herzschwäche. Für andere ist es der Verlust eines Sohnes im Krieg, die Erschießung einer Tochter auf dem Schulhof, der Tod eines Minenarbeiters unter dem Druck von Erde und Stein. Plötzlich werden wir in unbekanntes Terrain geworfen; wir lassen alles, was uns vertraut ist, hinter uns und betreten das Unbekannte. Buddhistisch ausgedrückt: Wir werden in den Bereich des »Nicht-Wissens«, des »Anfänger-Geistes« gerufen.
In unserer Anteilnahme am Sterben werden wir diesem Nicht-Wissen immer wieder begegnen, egal wie sehr wir auch versuchen, alles zu planen und kontrollieren. Wir fragen uns: »Wie wird das sein, wenn ich sterbe? Werde ich leiden? Werde ich alleine sein? Wohin gehe ich nach dem Tod? Wird man mich vermissen? Ist der Tod schmerzvoll? Ist er eine Erleichterung? Aus diesen Fragen wird Nicht-Wissen geboren, denn in Wirklichkeit werden wir sie nie beantworten können.
Der erste Grundsatz, Nicht-Wissen, mag uns merkwürdig erscheinen. Konzeptuelles Wissen wird in unserer Welt sehr geschätzt. In vielen Kulturen wird jedoch Weisheit nicht mit Wissen, sondern mit einem offenen Herzen gleichgesetzt. Wie können wir überhaupt wissen, was im nächsten Moment passiert? Der Anthropologe Arnold van Gennep beschreibt den Prozess des Heraustretens aus dem Vorhersagbaren und Gewohnten als »Trennung«, als erste Phase eines Initiationsrituals, das uns in das Unbekannte einführt.5 In dieser ersten Phase der Trennung öffnen wir uns dem Geist des Nicht-Wissens und erkennen ihn. Diese Bereitschaft, inmitten der Ungewissheit offen zu sein, wird in dem alten buddhistischen Lehrgedicht Lied vom Juwelenspiegel-Samadhi als das »Betreten der Straße« beschrieben.6
Weisheit, sagte einmal ein Zen-Lehrer, ist ein Geist, der bereit ist. Ein frischer, offener Geist, der sich nicht auf Fakten, Wissen oder Konzepte verlässt. Er ist tiefer als unsere Konditionierungen. Es ist der Geist, der nicht an festen Vorstellungen vom Selbst und von anderen festhält. Es ist ein mutiger Geist, der die bekannte Landschaft der mentalen Geschäftigkeit hinter sich lässt und in einer stillen Wirklichkeit verweilt, in der die Dinge das sind, was sie sind, und nicht das, was wir von ihnen erwarten. Im Nicht-Wissen spiegelt sich das Potenzial eines klaren und offenen Geistes, den alle Wesen besitzen – der Weisheits-Geist der Erleuchtung, der zugleich substanzlos, vertraut, klar, ungreifbar und allumfassend ist.
Die wahre Natur unseres Geistes ist wie ein großer Ozean: grenzenlos, vollkommen und natürlich, so wie er ist. Damit wir uns sicher fühlen und einen vertrauten Orientierungspunkt haben, entscheiden sich die meisten von uns, auf einer kleinen Insel inmitten dieses Ozeans zu leben. Dabei vergessen wir, den Blick aus der scheinbar sicheren und beständigen Landschaft auf die unermessliche Weite zu richten, die wir in Wirklichkeit sind.
Wenn wir sterben, werden die Taue, die uns an das Ufer des Lebens binden, gekappt. Wir treiben dann in unbekannte Gewässer hinaus, jenseits des uns vertrauten Terrains. André Gide erinnert uns daran, dass wir kein Neuland entdecken können, wenn wir nicht für längere Zeit den Blick auf das Ufer hinter uns lassen7. So ist auch die Wirklichkeit des Sterbens: ein Loslassen in das Unbekannte hinein; wir verlieren den Boden unter den Füßen und öffnen uns für die Weite dessen, der wir sind.
1. Pfad der Entdeckung
Beglückende Dunkelheit
Ich bin in den Südstaaten aufgewachsen, und meine Großmutter stand mir als Mädchen sehr nahe. Ich genoss es, die Sommer in Savannah zu verbringen; dort arbeitete sie als Steinmetzin und Künstlerin und fertigte Grabsteine an für die Leute in der Gegend. In ihrem Dorf war sie eine außergewöhnliche Frau; sie ging ganz natürlich mit Krankheit und Tod um und diente der Gemeinschaft, indem sie sterbende Freunde begleitete.
Als sie jedoch selbst erkrankte, konnte ihre Familie ihr nicht die gleiche mitfühlende Anteilnahme zukommen lassen. Meine Eltern waren gute Menschen, doch wie so viele in dieser Zeit waren sie nicht darauf vorbereitet, sie in ihren letzten Tagen zu begleiten. Als meine Großmutter zuerst an Krebs erkrankte und dann auch noch einen Schlaganfall erlitt, wurde sie in ein Pflegeheim gebracht und dort größtenteils alleine gelassen. Ihr Sterben war langwierig und schwer.
Das war in den frühen 1960er Jahren, als die Schulmedizin das Sterben, so wie auch das Gebären, als Krankheit betrachtete. Der Tod wurde meist in einer Klinik außerhalb des eigenen Heims »abgewickelt«. Ich besuchte meine Großmutter in einem sterilen Saal des Pflegeheims, voll gestellt mit Betten, in denen Menschen lagen, die gedankenlos von ihren Verwandten im Stich gelassen worden waren – und ich werde niemals vergessen, wie sie meinen Vater anflehte, sie sterben zu lassen und ihr dabei zu helfen. Sie verlangte nach unserer Anwesenheit, aber wir wandten uns im Angesicht ihres Leidens ab.
Als sie schließlich starb, fühlte ich in mir einen tiefen Zwiespalt, Trauer und Erleichterung. Im Bestattungsinstitut blickte ich in ihren Sarg und sah, dass die tiefe Enttäuschung, die sich in ihr Gesicht eingegraben hatte, verschwunden war. Am Ende schien sie Frieden gefunden zu haben. Als ich dort stand und ihr friedliches Gesicht betrachtete, wurde mir bewusst, wie sehr ihre Not mit der Furcht der Familie, auch meiner eigenen, vor dem Tod zu tun hatte. In diesem Moment nahm ich mir selbst das Versprechen ab, für andere in ihrem Sterben da zu sein.
Obwohl ich protestantisch erzogen worden war, wendete ich mich kurz nach dem Tod meiner Großmutter dem Buddhismus zu. Seine Lehren gaben dem Leiden meiner Jugend eine Perspektive, und die Botschaft des Buddha war klar und direkt – Befreiung vom Leiden findet sich im Leiden selbst; dabei liegt es an jedem Einzelnen, seinen oder ihren eigenen Weg zu finden. Und dennoch: Der Buddhismus gibt uns einen Weg vor, der uns durch unsere Entfremdung hindurch zur Befreiung führt. Der Buddha lehrte, anderen zu helfen, während wir zugleich tiefe Konzentration, Mitgefühl und Weisheit entwickeln. Er lehrte auch, dass Erleuchtung keine mystische, transzendente Erfahrung ist, sondern ein andauernder Prozess, der auf drei grundlegenden Qualitäten beruht: Furchtlosigkeit, Vertrautheit, Offenheit – und dass unser Leiden abnimmt, wenn Verwirrung und Angst sich in Offenheit und Stärke verwandeln.
In meinen Zwanzigern begab ich mich in die »Höhle des blauen Drachen«8, an den dunklen Ort, wo sich der ganze Morast meines jungen Lebens angesammelt hatte. Instinktiv war mir klar, dass ich Heilung durch meine eigene Erfahrung erlangen musste, dass ich die tiefen Muster, mit denen ich meinem Leiden begegnete, nur auflösen konnte, indem ich mich vollständig mit ihnenkonfrontierte. Ich spürte, dass ich mich mit der Nacht, mit der Dunkelheit verbinden musste, um zu überleben, und intuitiv verstand ich auch, dass nur darüber nachzudenken keine Lösung war. Ich musste mit dem Leiden praktizieren – das heißt, ich musste stillsitzen, mich betrachten und meiner eigenen Weisheit erlauben, aufzutauchen.
Durch die Bürgerrechtsbewegung und Proteste gegen den Vietnamkrieg hatte ich auch verstanden, dass der Rest der Welt ebenfalls litt. Bis in meine Knochen hinein spürte ich, dass buddhistische Lehren und Praktiken die Grundlage dafür sein konnten, mit sozialer und persönlicher Entfremdung umzugehen und sie zu transformieren. So entstand in mir ein tiefes Engagement für soziales Handeln. Meine eigenen Schwierigkeiten wurden durch die Arbeit mit Menschen, die größere Probleme hatten als ich, ins rechte Licht gerückt.
Der Tod meiner Großmutter veranlasste mich, in einem großen städtischen Krankenhaus in Dade County, Florida, auf dem Feld der medizinischen Anthropologie zu arbeiten. Der Tod wurde mein Lehrer, als mir immer wieder vor Augen geführt wurde, wie sehr spirituelle und psychologische Fragen plötzlich für alle drängend werden, die mit dem Tod konfrontiert sind. Ich entdeckte die Sterbebegleitung als spirituellen Weg, aber auch als Schulung darin, die tief in mir und meiner Kultur verankerten Muster der Abwehr abzulegen. Sterbende zu begleiten, auch das lernte ich, zwingt uns förmlich dazu, still zu sein, loszulassen, zuzuhören und sich dem Unbekannten zu öffnen.
Die Marginalisierung von Sterbenden beschäftigte mich sehr – die Angst und Einsamkeit, die sterbende Menschen erfuhren; die Empfindungen der Scham und Schuld, die in Ärzten, Pflegekräften, Sterbenden und Familien auftauchten, wenn die Wellen des Todes das Leben überfluteten. Ich spürte, dass spirituelle Begleitung Angst und Stress lindern konnte. Außerdem reduziert sie den Bedarf an bestimmten Medikamenten und teuren Behandlungen, Rechtsstreitigkeiten und die Zeit, die Ärzte und Pfleger damit verbringen, Menschen Mut zu machen. Sie hilft professionellen und familiären Betreuern, Leiden, Tod, Verlust, Trauer und Fragen nach der Bedeutung von Leben und Tod anzunehmen.
Während ich mit Sterbenden, Betreuern und Menschen, die ein Unglück erlitten hatten, arbeitete, praktizierte ich Meditation, um meinem Leben ein starkes Rückgrat der Praxis sowie ein offenes Herz zu verleihen, mit dem ich über das hinausblicken konnte, was ich zu wissen glaubte. Ich war dankbar, im Buddhismus so viele Praktiken und Einsichten zu finden, um achtsam und mitfühlend mit Leiden, Schmerz, Sterben, Versagen, Verlust und Trauer umzugehen – dem Stoff, den Johannes vom Kreuz die »beglückende Dunkelheit« genannt hat9. Dieser bedeutende christliche Heilige hat erkannt, dass Leiden eine große Chance sein kann, denn ohne Leiden gibt es keine Möglichkeit der Entwicklung. Über all die Jahre verlieh die beglückende Dunkelheit meinem Leben Klarheit – ein Leben, in dem ich den Tod als Feind betrachtet hatte, begann, den Tod als Lehrer und Begleiter zu entdecken.
Als junge Anthropologin erforschte ich den Tod auch anhand der archäologischen Spuren der Menschheitsgeschichte. Durch die Jahrtausende und über Kulturen hinweg hat der Tod Furcht und Transzendenzerfahrungen, pragmatisches Umgehen und spirituelle Annäherung hervorgebracht. Die Grabstätten und die Höhlenmalerei jungsteinzeitlicher Menschen versuchen, das Mysterium in Knochen, Steinen, Körpern, die in fötaler Haltung niedergelegt wurden, sowie durch Abbildungen von Tod und Trance auf Höhlenwänden einzufangen.
Selbst heutzutage, egal ob Menschen naturnah oder in Wolkenkratzern leben, ist der Tod eine tiefe Quelle. Für die meisten von uns ist diese Quelle ihres Mysteriums beraubt. Und dennoch haben wir alle eine Ahnung davon, dass zum Zeitpunkt unseres Todes ein Splitter der Ewigkeit in uns befreit wird. Diese Intuition ruft uns zur Anteilnahme auf – dazu, einen Teil unseres Selbst zu betrachten, der vielleicht verdeckt war und lange schwieg.
Wenn der Tod näher rückt, vernimmt ein sterbender Mensch vielleicht eine leise innere Stimme, die ihn in die Freiheit ruft. Diese leise innere Stimme konnte auch ich hören, als ich Sterbende begleitete, in Meditation saß, mich im Einflussbereich von Kulturen aufhielt, die anders waren als meine eigene. Sie spricht zu uns allen, wenn wir ihr nur den stillen Raum geben, um gehört zu werden.
Meditation:
Wie wollen Sie sterben?
Vor ein paar Jahren las mir eine sterbende Freundin ein paar Zeilen aus dem hinduistischen Epos Mahabharata vor. Ich musste lächeln. Der edle König Yudhisthira (Sohn Yamas, des Herrn des Todes) wurde gefragt: »Was ist das Merkwürdigste in dieser Welt?« Yudhisthira antwortete: »Das Merkwürdigste in dieser Welt ist, dass überall um uns herum Menschen sterben, aber wir nicht glauben, dass es uns auch passieren kann.«
Wenn ich Menschen in Sterbebegleitung schule, beginne ich meist damit, nach unseren Geschichten über den Tod zu fragen, einschließlich unserer ererbten kulturellen und familiären Erzählungen. Es ist hilfreich, wenn wir uns diese bewusst machen, denn so lernen wir zu verstehen, wie wir unser Sterben begreifen, und öffnen uns dadurch neuen Vorstellungen.
Wir beginnen mit einer einfachen, direkten Frage: Was ist Ihre schlimmste Vorstellung davon, wie Sie wohl sterben werden? Die Antwort auf diese Frage lauert unter der Oberfläche unseres Lebens und prägt unbewusst viele Entscheidungen, durch die wir es gestalten. In dieser intensiven Praxis der Selbstbefragung bitte ich Sie, ohne groß nachzudenken und doch detailliert aufzuschreiben (einschließlich des Wie? Wann? Woran? Mit wem? Wo?), wie Sie sich den schlimmsten vorstellbaren Tod ausmalen. Schreiben Sie alles unzensiert auf, ohne sich zu korrigieren, und erlauben Sie den unkontrollierten Anteilen Ihrer Psyche, beim Schreiben aufzutauchen. Nehmen Sie sich dafür fünf Minuten Zeit.
Fragen Sie sich danach bitte, wie Sie sich fühlen, was Sie in Ihrem Körper spüren und was für Sie auftaucht. Schreiben Sie diese Reaktionen ebenfalls auf. An diesem Punkt ist es wichtig, dass Sie sich ganz offen und ehrlich selbst betrachten. Was teilt Ihr Körper Ihnen mit? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und schreiben Sie auf, wie Sie sich fühlen, wenn Sie sich Ihren schlimmsten vorstellbaren Tod ausmalen.
Nehmen Sie sich dann weitere fünf Minuten, um eine zweite Frage zu beantworten: »Wie möchten Sie sterben?« Schreiben Sie auch diesmal wieder alles so detailliert wie möglich auf. Was ist die ideale Zeit, der ideale Ort und die ideale Art Ihres Todes? Wer wird bei Ihnen sein? Und auch diesmal wieder: Achten Sie am Ende darauf, was in Ihrem Körper und Geist geschieht, und notieren Sie diese Beobachtungen ebenfalls.
Machen Sie diese Übung, wenn möglich, mit einer zweiten Person, um zu sehen, wie unterschiedlich Ihre Antworten sein werden. Erstaunlicherweise teilt Ihr Gegenüber nicht unbedingt Ihre schlimmsten Ängste, aber auch Ihre Vorstellungen über einen idealen Tod sind nicht unbedingt die des anderen. Meine eigenen Antworten auf diese Fragen haben sich über die Jahre verändert. Heute denke ich, dass es schlimmer wäre, einen sinnlosen, gewaltsamen Tod zu sterben. Ein schleichender Tod würde mir vielleicht die Zeit geben, mich besser vorzubereiten. Außerdem wäre mein Sterben vielleicht hilfreich für andere.
Als ich an einem theologischen Seminar mehrere Kurse über Tod und Sterben gab, sagten ein Drittel der Studenten, dass sie im Schlaf sterben wollten. In anderen Situationen, in denen ich diese Fragen stellte, wollten mehr Leute allein und in Frieden sterben, als ich angenommen hatte. Viele wollten in der Natur sterben. Unter mehreren Tausend Antworten, die ich auf diese Frage erhielt, gab es nur wenige von Menschen, die im Krankenhaus oder Pflegeheim sterben wollten – auch wenn viele von uns genau dort sterben werden. Und fast jeder wünschte sich, dass der Tod eine spirituelle Erfahrung sein wird. Ein gewaltsamer, plötzlicher Tod wurde als eine der schlimmsten Arten des Sterbens betrachtet. Schmerzfrei zu sterben, spirituell begleitet, und einen Tod zu erfahren, der einen Sinn hat, wurde von vielen als die beste aller Möglichkeiten angesehen.
Nachdem Sie darüber nachgedacht haben, wie Sie sterben möchten, stellen Sie sich bitte noch eine dritte Frage: »Was sind Sie bereit dafür zu tun, um so zu sterben, wie Sie es sich wünschen?« Wir nehmen vieles auf uns, um uns für unseren Beruf auszubilden und zu schulen. Die meisten von uns verwenden viel Zeit und Energie darauf, sich um den eigenen Körper und die eigenen Beziehungen zu kümmern. Darum fragen Sie sich bitte: Was tun Sie dafür, sich auf einen harmonischen, sanften Tod vorzubereiten? Und wie können Sie sich für die Möglichkeit öffnen, Unsterblichkeit der Erleuchtung zu erfahren, sowohl im gegenwärtigen Moment als auch wenn Sie sterben?
2. Das Herz der Meditation
Sprache und Stille
Vor Jahren begegnete ich einem alten tibetischen Lama, der glücklich darüber zu sein schien, dass sein Tod näher rückte. Ich fragte ihn, ob er so froh wirkte, weil er alt und bereit sei zu sterben. Er sagte, er fühle sich wie ein Kind, das zu seiner Mutter zurückkehrt. Dann erklärte er, wie seine lange Vorbereitung auf den Tod ihm überhaupt erst sein Leben gegeben habe. Jetzt, dem Tod ganz nahe, öffne sich sein Geist endlich seiner wahren Natur.
Spirituelle Praxis kann eine Zuflucht sein, ein geschützter Raum, in dem wir Einsichten über das gewinnen können, was außerhalb von uns, aber auch über das, was in unserem Herzen und unserem Geist geschieht. Sie kann Stabilität verleihen, die für Betreuer genauso wichtig ist wie für Sterbende. Durch sie lassen sich heilsame Geistesqualitäten wie Mitgefühl, Freude und Nicht-Anhaftung entwickeln – Qualitäten, die uns das Durchhaltevermögen dafür geben, dem Leiden zu begegnen und es möglicherweise zu verwandeln. Spirituelle Praxis kann auch der Ort sein, an dem Ungewissheit und Zweifel, also das, was Keats als »negative Befähigung« bezeichnete, sich in eine Zuflucht der Wahrheit verwandeln.
Eine sterbende Frau beschrieb ihre Meditationserfahrung so, als würde sie in den Armen ihrer Mutter gehalten werden. Sie erklärte, dass sie durch Meditation nicht versuche, ihrem Leiden zu entfliehen, sondern dass in ihr liebevolle Zuwendung und Stärke auftauchten. Indem sie sich für den Schmerz und die Ungewissheit öffnete, erkannte sie in ihrem Loslassen die Wahrheit des Nicht-Wissens. Diese Erfahrung verlieh ihr größeren Gleichmut.
Wenn wir still bei einem sterbenden Menschen sitzen, wenn wir an der Trauer von Familienangehörigen teilhaben, wenn wir darum ringen, mit der Furcht und Wut, dem Kummer und der Verwirrung von Menschen, deren Leben sich radikal verwandelt, ganz präsent zu sein, tauchen in uns möglicherweise starke und verstörende Empfindungen auf. Wir suchen dann vielleicht nach einen Weg, die Hitze oder Kälte unserer eigenen Geisteszustände zu akzeptieren und zu verwandeln. Falls wir in dieser Situation aus einer kontemplativen Praxis schöpfen können, kann uns das helfen, Stille, Offenheit und Geduld inmitten des Sturms zu finden – einschließlich des Sturms unserer eigenen Probleme, die wir mit dem Sterben haben.
Buddhisten bezeichnen ihre Meditationsübung oft als Praxis – da wir praktizieren, gegenwärtig zu sein. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen einfach nur da sein. Eine regelmäßige Meditationspraxis macht uns das doppelte Geschenk von Sprache und Stille, Geschenke, die oftmals zusammen auftauchen, um uns zu helfen. Sprache vermittelt uns wichtige Einsichten über Herz und Geist; Stille ist wesentlich für die Entwicklung tiefer Konzentration, Ruhe und geistiger Stabilität. Kontemplative Ansätze, die mit diesem doppelten Geschenk arbeiten, bereiten uns sowohl auf unser Sterben als auch auf die Begleitung Sterbender vor. Einige setzen dazu Stille, Konzentration und Offenheit ein, während andere damit arbeiten, eine positive Einstellung und heilsame Geistesqualitäten zu entwickeln.
Manchmal denken wir vielleicht, dass Schweigen und Stille im Angesicht des Leidens nicht genügen.Wir fühlen, wir sollten etwas »tun« – sprechen, trösten, aktiv werden, putzen, uns bewegen –, »helfen« eben. Doch in der gemeinsamen Meditation halten Begleiter und Sterbende sich gegenseitig in einer stillschweigenden Vertrautheit, die jenseits von Trost oder Unterstützung ist. Wenn ich einen sterbenden Menschen begleite, frage ich mich bewusst, welche Worte hilfreich sind. Muss in diesem Moment wirklich etwas ausgesprochen werden? Kann ich mich mit ihr oder ihm in eine tiefere Vertrautheit begeben, eine Gemeinschaft jenseits von Worten und Handlungen? Kann ich mich entspannen und darauf vertrauen, einfach nur da zu sein, ohne mich mit meiner Person in die zarte Verbindung, die wir ohnehin teilen, einzumischen?
Ein Mann, der im Sterben lag, erzählte mir: »Ich erinnere mich, wie ich bei meiner Mutter war, als sie starb. Sie war alt, wie ich jetzt, und bereit, zu gehen. Ich saß einfach bei ihr, hielt ihre Hand … würdest du jetzt meine halten?« Und so saßen wir in Stille beieinander, und die Berührung vereinte unsere Herzen.
Worte können, wie die Stille, ebenfalls hilfreich sein. Wir können der Gabe der Sprache vertrauen – im Gebet, als Poesie, Gespräch oder in geführter Meditation –, um die Bedeutung von Erfahrungen und Dingen deutlich zu machen. Wenn wir einem Sterbenden oder einem trauernden Familienmitglied einfach nur zuhören, hilft das der Person, die spricht. Dabei hängt alles davon ab, wie wir zuhören. Vielleicht können wir die Worte und Empfindungen so zurückspiegeln, dass der Sprecher zum ersten Mal wirklich hört, was er sagt. In dieser Weise Anteil zu nehmen, kann uns, den Zuhörenden, Einsicht und Inspiration verleihen. Sprache kann den Knoten lösen, der einen Menschen fest an die Angst bindet, und ihn Mitgefühl und ein offenes Herz spüren lassen. Wohlwollende Worte oder eine geführte Meditation können eine positive Haltung bewirken und hilfreiche Mittel auftauchen lassen, mit denen wir den Problemen begegnen können.
Achtsamkeit, das Herz unserer Anteilnahme am Sterben, ist die Praxis, allem, was im gegenwärtigen Moment geschieht, tiefe Aufmerksamkeit zu schenken – allem, was im Körper und im Geist des Betrachters geschieht, aber auch allem, was in unserer Umgebung geschieht. Dabei können wir Achtsamkeit des Körpers, des Atems oder auch der physischen Veränderungen, einschließlich Krankheit und Schmerz, praktizieren. Ebenso können wir achtsam gegenüber unseren Reaktionen sein – den Gefühlen des Wohlbefindens und Unbehagens – und betrachten, wie sie auftauchen und vergehen. Und schließlich können wir dann unsere Geisteszustände betrachten, wie zum Beispiel Begehren, Wut, Verwirrung, Konzentration, Klarheit oder Zerstreutheit. Dies sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit: der Körper, Empfindungen, der Geist und die Objekte des Geistes.
Vertrauen und Geduld in Verbindung mit Offenheit und Akzeptanz – Eigenschaften, die durch Achtsamkeitspraxis gefördert werden –, unterstützen uns darin, mit dem Sterben zu sein. Diese Eigenschaften helfen uns, ein ausgewogenes Verhältnis von Mitgefühl und Gleichmut zu entwickeln und aus dem heraus zu reagieren, was tiefer liegt als unsere Persönlichkeit und unser konzeptueller Geist. Mit Gleichmut und Mitgefühl als untrennbaren Begleitern unserer Arbeit werden wir weniger werten oder auf Resultate fixiert sein. Für mich ist Achtsamkeitspraxis das Fundament meines Lernens und meiner Arbeit in der Betreuung. Durch sie haben viele von uns einen Zugang zu dem stillen inneren Raum gefunden, aus dem wir unsere Kraft und Weisheit ziehen.
Durch Achtsamkeitspraxis können wir Körper und Geist stabilisieren. Sie hilft uns, weniger zu reagieren als aufzunehmen und flexibel zu sein. Sie baut Stress ab und lässt uns Zugang zu unseren intuitiven Kräften finden.
Achtsamkeitspraxis gewinnt durch den Wunsch, anderen zu helfen, an Kraft. Engagement, das auf einem altruistischen Geist beruht, hilft uns dabei, uns von unserer Selbstanhaftung zu lösen. Der Wunsch, hilfreich zu sein, verleiht unserer Praxis Kraft und Tiefe und lässt sie empfänglich und offen sein.
Ob wir beten oder ob wir meditieren, wir müssen es mit unserem ganzen Wesen tun, damit unsere Praxis sich wirklich entfalten kann. Der Entschluss, zu praktizieren, um anderen zu helfen, unser Engagement, die Ernsthaftigkeit und der Einsatz für unsere Praxis haben einen großen Einfluss auf die Qualität und das Resultat unserer Meditation. Wenn wir uns verlieben, versuchen wir ja auch, uns dem Geliebten von unserer besten Seite zu zeigen. Wenn wir schwer erkranken, bemühen wir uns ja auch von ganzem Herzen darum, Heilung zu finden. Unsere spirituelle Praxis erfordert das gleiche Maß an Engagement und Bemühen.
Wir sollten uns dabei auch bewusst machen, dass unrealistische Erwartungen ein Problem sein können. Meditation kann tief verwurzelte Muster, die Leiden verursachen, nicht über Nacht auflösen. So wie wir unseren Körper nach und nach dehnen und flexibel machen, so braucht es Zeit, den Geist zu schulen. Wir können nicht gleich am ersten Tag schwere Gewichte stemmen, wenn unser Körper nicht darauf vorbereitet ist. Wir können uns nicht sofort in großen Höhen aufhalten, sondern müssen uns zuerst akklimatisieren. Wenn wir zu hohe Erwartungen haben und Probleme auftauchen, kann es sein, dass wir unsere Praxis aufgeben.
Sogenannte »Probleme« sollten wir sogar erwarten, denn sobald wir in unserer gewohnten geistigen und körperlichen Aktivität innehalten und still sitzen, sind unsere Schwierigkeiten deutlicher zu erkennen. Möglicherweise werden wir dadurch erst für das Leiden sensibilisiert und haben den Eindruck, dass wir auseinanderfallen könnten. Doch was da möglicherweise auseinanderfällt, ist unser Ego – unsere Identität eines kleinen, abgetrennten Selbst –, doch der gesunde Teil von uns sollte das begrüßen. Meist ist es jedoch nicht so einfach, die rohen und schwierigen Emotionen, die die Dekonstruktion des Ego begleiten, anzunehmen. Haben Sie Geduld und machen Sie sich bewusst, dass alle meditativen Praktiken, die Sie in diesem Buch finden, über lange Zeit durch systematisches Ausprobieren entwickelt wurden. Es braucht Zeit, bis sie wirken – haben Sie also Geduld. Schwierigkeiten in Ihrer Praxis können sogar ein Anzeichen dafür sein, dass sie wirkt. Auch wenn Ihnen das Geduldigsein und Loslassen schwerfallen sollten, warten Sie mit Ihrem Urteil und erinnern Sie sich an diese Geistesqualitäten, sobald Ihr Widerstand auftaucht. Wir müssen die Bereitschaft haben, alles loszulassen, insbesondere das, woran wir uns mit aller Kraft klammern.
Letztendlich sollten Sie nicht vergessen, wie wichtig Engagement, Beständigkeit und Motivation sind – doch um all das müssen wir uns bemühen. Es geht nicht darum, einfach still zu sitzen und darauf zu warten, dass etwas Magisches passiert. Bringen Sie sich ganz in Ihre Meditation ein, auch Ihr Herz, das selbst dann alles annehmen kann, wenn es keinen Grund mehr zu geben scheint, weiterzumachen. Nehmen Sie dieses Gefühl an und gehen Sie weiter. Wenn wir mit unserem Widerstand arbeiten, gewinnt unsere Meditationspraxis an Kraft und Tiefe – was letztendlich die gleichen Qualitäten sind, die uns zu einer offenen Begegnung mit dem Tod befähigen.
Seien Sie bitte auch achtsam, wenn Sie nicht meditieren, und bleiben Sie im gegenwärtigen Moment. Was auch immer wir in der Arbeit mit Sterbenden tun – jemanden waschen, die Bettpfanne wechseln, still bei einer kranken Freundin sitzen, still mit uns selbst sitzen –, wir verpflichten uns dazu, es achtsam zu tun. Formale Achtsamkeitspraxis stellt uns einen weiten, kraftvollen Raum bereit, um diese Bewusstheit zu entwickeln – und wir brauchen diese tiefe Konzentration, denn in der Anteilnahme am Sterbeprozess wird unsere Achtsamkeit regelmäßig durch diverse komplexe Situationen herausgefordert: die Begegnung mit Familien, die in tiefem Schmerz, wütend oder frustriert sind; in der Begegnung mit Sterbenden, die unerträgliche Schmerzen und Angst erleiden, alles verdrängen oder sich gänzlich abschotten; wenn wir mit einem lieben Freund zusammensitzen, dessen Geist allmählich in Alzheimer versinkt, oder mit einer Mutter, deren Sohn tödlich verunglückt ist. Konzentrierte Bewusstheit harmonisiert Körper, Sprache und Geist, sodass wir uns mit voller Aufmerksamkeit der direkten Situation widmen, ohne dieser Situation etwas hinzuzufügen.