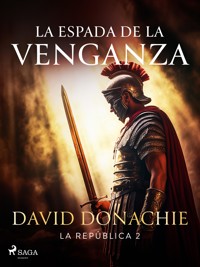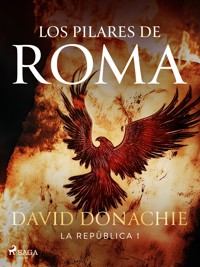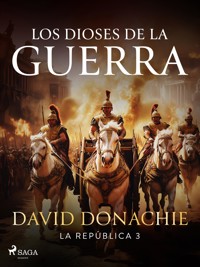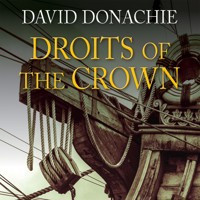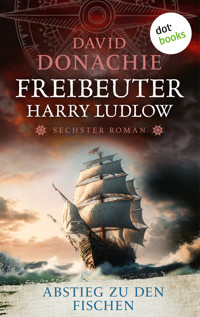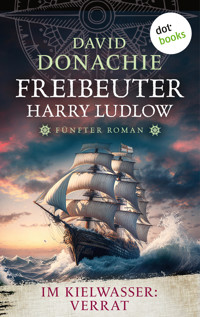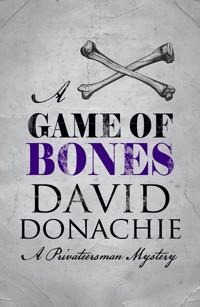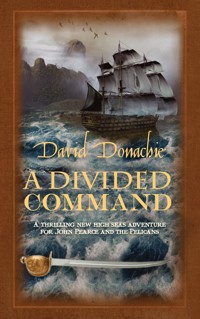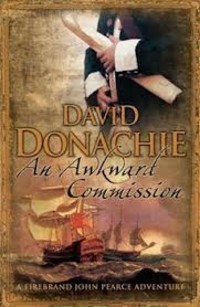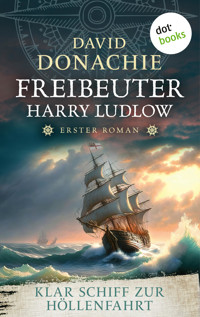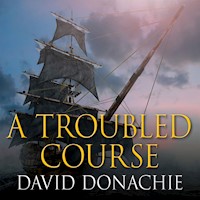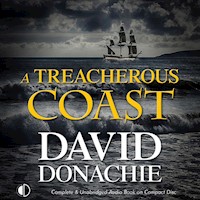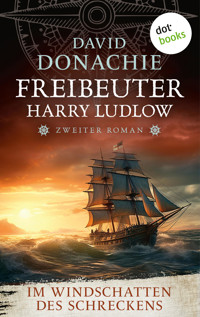
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Freibeuter Harry Ludlow
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt wie ein Pulverfass: Der Seefahrerroman »Freibeuter Harry Ludlow: Im Windschatten des Schreckens« von David Donachie als eBook bei dotbooks. Die ligurische Küste im Jahre 1794: Eigentlich sollte es ein einfacher Botendienst werden – doch als Harry Ludlow, der sich als »Detektiv der Meere« einen Namen gemacht hat, und sein Bruder James, der als Künstler zu Ansehen gekommen ist, im schmutzigen Hafen von Genua ankommen, sind schon bald ihre ungleichen Fähigkeiten gefragt: Der gewaltsame Tod eines britischen Kapitäns hat die Stadt in Aufruhr versetzt, die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt. Aber haben ihn wirklich die französischen Seeleute auf dem Gewissen, die den Engländern nur zu gerne an die Kehle gehen würden? In diesem politischen Pulverfass, in dem ein einzelner Funken einen Krieg auslösen könnte, muss Harry unter Hochdruck ermitteln – aber bringt er dabei nicht nur sich, sondern auch seinen Bruder in tödliche Gefahr? »Abenteuer pur voller Spannung und Wagemut … Historische Unterhaltung vom Feinsten.« Historical Novels Review Online Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der nautische Kriminalroman »Freibeuter Harry Ludlow: Im Windschatten des Schreckens« von David Donachie wird Fans von C.S. Forester und Patrick O'Brian begeistern; das Hörbuch ist bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die ligurische Küste im Jahre 1794: Eigentlich sollte es ein einfacher Botendienst werden – doch als Harry Ludlow, der sich als »Detektiv der Meere« einen Namen gemacht hat, und sein Bruder James, der als Künstler zu Ansehen gekommen ist, im schmutzigen Hafen von Genua ankommen, sind schon bald ihre ungleichen Fähigkeiten gefragt: Der gewaltsame Tod eines britischen Kapitäns hat die Stadt in Aufruhr versetzt, die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt. Aber haben ihn wirklich die französischen Seeleute auf dem Gewissen, die den Engländern nur zu gerne an die Kehle gehen würden? In diesem politischen Pulverfass, in dem ein einzelner Funken einen Krieg auslösen könnte, muss Harry unter Hochdruck ermitteln – aber bringt er dabei nicht nur sich, sondern auch seinen Bruder in tödliche Gefahr?
Über den Autor:
David Donachie, 1944 in Edinburgh geboren, ist ein schottischer Autor, der auch unter den Pseudonymen Tom Connery und Jack Ludlow Bekanntkeit erlangte. Sein Werk umfasst zahlreiche Veröffentlichungen; besonders beliebt sind seine historischen Seefahrerromane.
David Donachie veröffentlichte bei dotbooks bereits seine Serie historischer Abenteuerromane um den Freibeuter Harry Ludlow mit den Bänden »Klar Schiff zur Höllenfahrt«, »Im Windschatten des Schreckens«, »Kurs ins Ungewisse«, »Die zweite Chance«, »Im Kielwasser: Verrat« und »Abstieg zu den Fischen«.
Der Autor im Internet: www.facebook.com/daviddonachieauthor/
***
eBook-Neuausgabe Juli 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »The Dying Trade« bei Macmillan, London
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 David Donachie
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998, Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/Abstractor, Vector Tradition, paseven und AdobeStock/S...
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-685-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Windschatten des Schreckens« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Donachie
Im Windschatten des Schreckens
Roman – Freibeuter Harry Ludlow 2
Aus dem Englischen von Uwe D. Minge
dotbooks.
Prolog
Er mochte betrunken sein, trotzdem war sich William Broadbridge darüber im klaren, daß er im falschen Teil des Hafens war. Das einzige Licht, das er wahrnahm, war ein fahler Streifen am Nachthimmel direkt über seinem Kopf. Der Mond war noch nicht weit genug aufgegangen, um diese dunkle, stinkige carruga zu erleuchten, ein Gasse, die so eng war, daß zwei Männer Mühe haben würden, aneinander vorbeizukommen. Aber gerade diese Enge erlaubte es ihm, einen Halt zu finden, während er herauszubekommen versuchte, wo er war und was hier vorging.
Er starrte in die Dunkelheit und bemühte sich, die Quelle für die Geräusche eines Handgemenges zu lokalisieren. Während er vorwärts stolperte, hörte er ein unterdrücktes, ihm merkwürdig bekanntes Lachen, das geisterhaft körperlos aus der Finsternis klang. Alles mußte Einbildung sein, denn es war niemand zu sehen. Dann hörte er das Ächzen einer Leine, die unter Spannung stand, gefolgt von einem erstickten Gurgeln; beides ließ ihn aufblicken. Füße traten hektisch in die Luft, aber sie zielten nicht nach ihm. Doch es lag nicht nur an dem Tritt gegen seinen Kopf mit einem glänzend polierten Schuh, daß er zusammenbrach. Dazu kamen seine Trunkenheit und die Anstrengung, in diesem Zustand nach oben geschaut zu haben. Er fiel schwer gegen die Steinwand und rutschte an ihr herab, bis er nur noch ein kleines unordentliches Häuflein Elend war.
Broadbridge war nicht lange bewußtlos, doch gerade lange genug, um es dem Mond zu erlauben, so weit über den Himmel zu wandern, daß er einen silbernen Lichtstrahl auf die vor Schmutz starrende Wand werfen konnte. Das Licht und die Flüssigkeit, die auf seinen Dreispitz tropfte, beschleunigten seine Rückkehr zu den Lebenden. Broadbridge schnaufte laut, denn ihm stach der atemberaubende Gestank menschlicher Exkremente in die Nase, der sogar für einen so verkommenen Hafen wie Genua außergewöhnlich streng war. Er war wirklich schlecht beraten, nach oben zu blicken, denn gerade in dieser Sekunde löste sich wieder ein Urintropfen von dem glänzenden Schuh, der diesmal seinen Hut verfehlte und ihn vierkant ins Auge traf. Sein ärgerlicher Ausruf echote zwischen den Wänden der Gasse, während er sich auf die Füße quälte. Wieder blickte er in die Höhe, aber diesmal vorsichtiger. Er war jetzt diesem Körper näher, und das Mondlicht beleuchtete ihn voll. Die Leiche trug die Ausgehuniform eines Offiziers der Britischem Marine, und zwar die eines Kapitäns zur See, wenn man den beiden Epauletten glauben konnte. Sie schwang leicht in der sanften Brise hin und her, drehte sich in die eine oder andere Richtung, so als könne sie sich nicht entscheiden. Die Augen schienen aus den Höhlen zu quellen, die Zunge, die zwischen den Zähnen klemmte, war im Todeskampf durchgebissen worden. Blut floß heraus und vermischte sich mit den anderen Flüssigkeiten, die sich auf der festgestampften Erde sammelten. Der Mann war mausetot, und während des Todeskampfs hatte er sich entleert, wie das alle Menschen zu tun pflegen, die man am Halse aufhängt.
Broadbridge drehte sich um und wollte verschwinden, dabei stieß er gegen den mit goldenen Litzen verzierten Hut. Mit einer schnellen Bewegung hob er ihn auf und rannte unsicher auf das Ende der Gasse zu, die auf den hell erleuchteten Kai hinausführte. Krampfhaft bekämpfte er den heftigen Brechreiz, der von seinem Magen aufstieg. Vage registrierte er die Nähe der drohenden Wälle des Zollforts, sein Unbehagen verstärkte sich noch weiter, als er daran dachte, daß er sich keinesfalls in der Nähe ausgerechnet dieses Ortes aufhalten sollte. Er schaffte es noch, seinen Kopf über die niedrige Hafenmauer zu strecken, bevor er sich übergab. Lautstark erbrach er sich, die Wachen, die unter den Fackeln an den Toren der Festung standen, ignorierten ihn.
Schließlich richtete er sich auf, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund, dabei verfluchte er den brennenden Schmerz in seinem Schlund. Er blickte auf den Hut, den er noch immer in der Hand hielt. Seine Finger glitten über das Gold, das den Rand zierte. Dann drehte er ihn um und entzifferte den Namen Howlett, der deutlich auf einem eingenähten Namensschild zu lesen war. Mit einer schnellen Handbewegung warf er den Hut in den Hafen. William Broadbridge wollte nichts mit der Navy zu tun haben, nichts mit einem Mord und schon gar nichts mit einem Mann mit dem Namen Howlett.
Das verdammte Zollfort. Er wußte, daß er den falschen Weg eingeschlagen hatte, nachdem er Mutter Thomas’ Taverne verlassen hatte. Er war durchaus nicht gerne aufgebrochen. Viel lieber wäre er in dem überhitzten, verräucherten Schankraum geblieben, vor sich einen vollen Becher mit Bier, auf dem Schoß eine willige Mieze und mit einer Siegwette auf den Kampf, der am anderen Ende des Raumes in einem Ring stattfand. Doch er hatte kein Glück. Sein Becher würde so leer bleiben wie die Taschen seiner blauen Wolljacke. Lautlos fluchte er vor sich hin, verdammte Gott, den Teufel, seine Mitmenschen und fragte sich, woher in aller Welt sein nächster Penny kommen würde.
Der Kai wurde belebter und heller auf dem Weg nach Norden, weg vom Zollfort, hin zum Scheitelpunkt der Bucht, die Madalena genannt wurde, wo sich die überfüllten Bordelle und Kneipen befanden. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, den ihm die warme Nachtluft aus den Poren trieb. Dann versuchte er seine Augen so zu justieren, daß er alle Umrisse wieder nur einfach und nicht doppelt sah, wie das im Augenblick noch der Fall war. Anschließend verfluchte er die gesamte Bevölkerung von Genua in Bausch und Bogen, als ob seine Armut und seine Unfähigkeit klar zu sehen einzig allein ihre Schuld wäre.
Während er seinen Weg weitertorkelte, kreisten seine Gedanken um das Problem, daß dieser verfluchte Ort voll mit Banken war, die die halbe bekannte Welt kreditierten; Genua war bis zum Bersten mit Gold gefüllt, aber Broadbridge bekam davon keinen lausigen Denar in die Hand. Ein Stadtstaat, ein pulsierender Hafen und eine sogenannte Republik, die nichts anderes als ein großer ausgemachter Schwindel war, mit dem die Reichen den Armen die Augen vernebelten. Die Wohnhäuser am Hafen ragten aus den engen Gassen bis in den Himmel und schienen sich oben fast zu berühren. Sie bildeten mit den Lagerhäusern ein fast undurchdringliches Labyrinth, durch das der Verkehr kaum noch abfloß. Aber neben einem Haus, das mit zerlumpten, hungrigen und schmutzigen Bewohnern überfüllt war, mitten zwischen dem Gestank einer überbevölkerten, von den primitivsten Bedürfnissen ausgeschlossenen Gesellschaft, befand sich eine kompliziert geschnitzte Holztür, die in einen versteckten, geräumigen Palazzo führte. Hinter den Gebäuden, die an den Hafen grenzten, wetteiferten die neuen Paläste dicht an dicht in strahlender Zurschaustellung des Reichtums mit den zahlreichen Kirchen und Kathedralen aus vergangenen Zeiten.
Die Leute sprachen von Revolution; sie wollten es ihren französischen Vettern nachmachen und eine Guillotine vor der Kathedrale auf der Piazza San Domenico errichten, damit die Aristokraten und Bankiers, die für ihre elenden Lebensverhältnisse verantwortlich waren, der Gerechtigkeit zugeführt werden konnten. Aber das Aufkommen der Jakobiner war nur eine Facette von vielen in dem ständigen Konflikt dieser Stadt, die sich in einem anhaltenden Krieg mit sich selbst befand. Die Menschen trugen uralte Blutfehden zwischen den Welfen und Waiblingern aus, sie waren immer bereit, aus Loyalität zum Papst oder Kaiser zu den Waffen zu greifen, sogar wenn die wahren Beweggründe im Laufe der Zeit längst in Vergessenheit geraten waren. Die Logen der Freimaurer blühten, trotz – oder gerade wegen der Anstrengungen der Mönchsorden und Jesuiten, sie auszurotten. Alles das wurde überdeckt von geschäftlichen Rivalitäten; die einzelnen Familien bekämpften sich bis aufs Blut in einer ständigen Folge von wechselnden Allianzen. Nur wenige reiche Männer wagten sich ohne bewaffnete Leibwächter auf die Straße. Sie legten großen Wert darauf, daß ihre Häuser und Palazzi in den unteren Etagen vergitterte Fenster hatten, die einen Überraschungsangriff verhindern sollten.
Broadbridge verfluchte noch immer die Stadt und sein Schicksal, gleichzeitig schob er die Menschen, die ihm im Weg standen, zur Seite. Er befand sich jetzt in der Soparipa, den Arkaden unter der Kaimauer. In jedem dieser Bögen befand sich eine Verkaufsbude oder ein Laden, die Händler priesen lautstark ihre Waren an. Der Geruch exotischer Gewürze füllte seine Nase, was seinen brennenden Durst noch verstärkte. Die Hungrigen, Erwachsene wie Kinder, schlichen herum und hockten lustlos auf dem Boden. Einige, die sicher mehr im Magen hatten als er, versuchten ihn anzubetteln. Vielleicht würden sie sogar versuchen, ihn auszurauben. Der Engländer lachte bei dem Gedanken laut auf, daß ihm ein Taschendieb die Börse ziehen würde. Nur zu, nur zu! Das einzig Wertvolle an ihr war das Leder.
Für dieses Lumpenpack fiel nur wenig von den enormen Reichtümern Genuas ab, die Proleten konnten von jeder Art revolutionären Aufruhrs nur profitieren. Zur Abwechslung verfluchte Broadbridge auch sie, denn als echter Engländer hatte er mit keiner Art von Aufruhr etwas im Sinn, außer natürlich, wenn es nach einem satten Profit roch. Broadbridge sog die Luft gierig ein, als er wieder auf dem Kai angelangt war. Allerdings konnte man sie nur als frisch bezeichnen, wenn man den vielfältigen Gerüchen des Hafens keine Beachtung schenkte. Er schwankte durch die Menschenmasse, die sich widerwillig vor ihm teilte, um einen Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden, und er richtete seinen verschwommenen Blick starr auf den Eingang von Mutter Thomas’ Kneipe. Sein Mund war staubtrocken, und sein Schlund brannte, er erwog, ob er nicht auf sein Schiff zurückkehren sollte. Aber die Probleme, die ihn dort erwarteten, waren noch schlimmer, falls so etwas möglich war, als die, die er hier bekommen konnte.
Die Taverne war voller Menschen. Männer mit Geld in den Taschen, das ausgegeben sein wollte. Vielleicht war einer von ihnen zu dieser späten Stunde schon so weit hinüber oder durch eine gewonnene Wette so freigebig, daß er ihm einen Drink spendieren würde? Man konnte nie sicher sein, ob es nicht eine Seele von Kamel gab, die nur darauf brannte, ihr Geld in William Broadbridge zu investieren. Schließlich hatte er hier schon einmal Glück gehabt. Vielleicht gelang es, daß ihm die Göttin des Glücks ein zweites Mal zulächelte. Geübt durch langes Training, überzeugte er sich selbst, daß für William Broadbridge irgend etwas herausspringen würde. Irgend etwas ergab sich immer!
Kapitel 1
Es war ein Fehler der Brüder Ludlow gewesen, an dem Ball teilzunehmen, der zu Ehren von Admiral Hood veranstaltet wurde. Doch welche Entschuldigung hätten sie bei einem so engen Freund der Familie vorbringen können? Nicht, daß man sie ignoriert hätte, denn die guten Manieren wurden auf das strengste beachtet, und die Offiziere der kurz zuvor eingelaufenen Flotte, die nicht auf dem laufenden waren, wollten unbedingt etwas über das Gefecht erfahren, an dem die beiden Brüder vor wenigen Tagen teilgenommen hatten. Die Magnanime mit 74 Kanonen hatte zwei Franzosen der gleichen Stärke in eine Seeschlacht verwickelt. Allerdings verschwiegen die beiden Ludlows geflissentlich die anderen Vorgänge, die zu einer Reihe von Leichen an Bord des Schiffes geführt hatten.
Aber die hier stationierten Offiziere hielten sich gut frei von ihnen, schon aus der Sorge heraus, daß andere denken mochten, sie hätten Partei ergriffen. Gibraltar war in jeder Hinsicht eine Garnisonsstadt. Der Gouverneur war ein Armeeoffizier; alle Stellen in der Verwaltung, die nicht mit Offizieren der Armee oder der Marine besetzt waren, wurden ausschließlich von Zivilisten eingenommen, deren nackte Existenz vom Militär abhing, und im Bewußtsein des Ärgers, der ins Haus stand, und der voraussichtlichen Folgen, vermieden die Zivilisten jeden Konflikt mit den Uniformierten.
Der Admiral hatte kurz mit den Ludlows gesprochen, für einen Augenblick hatten sie im Zentrum des geschäftigen Gedränges gestanden. Aber man konnte vom Ehrengast nicht erwarten, daß er seine Zeit mit ihnen verbrachte, also war Hood weitergegangen. Er umrundete den Raum in Begleitung des Gouverneurs und wechselte mit jedem Gast einige Worte. Ein paar Damen blickten in ihre Richtung, denn die Brüder Ludlow waren ein ansehnliches Gespann. Aber auf ausdrückliche Anweisung ihrer Ehemänner oder Väter wagte sich keine näher als zehn Fuß in ihre Nähe.
James wandte sich seinem Bruder zu, der gerade eben das Gefecht zum zwanzigstenmal erläutert hatte. »Wir könnten jetzt dezent verschwinden, glaubst du nicht auch?«
Harry nahm ein Glas Punsch vom Tablett eines Dieners. »Laß uns abwarten, bis der Admiral geht. Es wird nicht lange dauern. Er ist kein Freund derartiger Veranstaltungen.«
James runzelte leicht die Stirn. »Glaubst du, daß er etwas weiß?«
»Das bezweifle ich. Falls er Bescheid wissen sollte, würde er es wahrscheinlich verbieten«, bemerkte Harry.
»Aber er kann es dir nicht untersagen.«
»Duelle sind illegal, ganz besonders für aktive Offiziere. Er kann ganz sicher Clere zurückhalten.«
»Ich denke, daß es eine ganze Reihe von Leuten in diesem Raum gibt, die Clere davon zurückhalten könnten.«
James hatte seine Stimme so erhoben, daß ihn mehrere der Personen hören mußten, die in der Nähe standen, einschließlich einer dichtgedrängten Gruppe von Offizieren, die sich vor einem der großen Fenster aufhielt. Einige drehten sich beim Klang seiner Stimme scharf herum und erröteten ärgerlich.
Harry wußte, daß James seiner Sorge freien Lauf gelassen hatte. James hatte die letzten beiden Tage dem Versuch gewidmet, Harry davon zu überzeugen, daß er ein Narr sei, daß sein Gegner die Anstrengung nicht wert war. Aber Harry nahm James’ letzte Äußerung für bare Münze und fügte mit einem kleinen Lachen hinzu: »Ruhig, James, wir können uns nicht mit allen schlagen.«
Hood verabschiedete sich am anderen Ende des Saales vor der großen Doppeltür. Als der Admiral schließlich verschwunden war, löste sich ein Leutnant aus der Gruppe am Fenster und kam auf die Brüder zu.
»Mr. Ludlow«, begann er, blieb vor ihnen stehen und wandte sich an James, »mein Vorgesetzter wünscht, daß ich Ihnen mitteile, daß eine Entschuldigung noch immer möglich ist.«
James schüttelte den Kopf. Er machte sich noch nicht einmal die Mühe, seinen Bruder zu fragen. Auch wenn er verzweifelt war, würde Harry sich nicht entschuldigen, dafür kannte James seinen Bruder zu gut.
»Dann muß ich Sie davon informieren, daß Kapitän Clere sich für Degen entschieden hat.«
»Danke, Leutnant«, erwiderte James steif, »wir werden Sie dann morgen früh treffen.«
Der Mann drehte sich auf dem Absatz um und ging fort. Mit einem plötzlich aufwallenden Ärger schüttete Harry sich den Rest des Inhalts seines Drinks in den Hals und ging steif aus dem Raum. Sein Bruder folgte ihm.
Im Morgengrauen war die Spitze des Felsens ein wunderschöner Ort. Die Sonne würde im Osten aufgehen, über tausend Meilen freier See, den Gipfel des Berges erreichen und ihn in ihr Licht tauchen, während unten an seinem Fuße die Stadt noch im Dunkeln lag.
Sie waren schweigend in der Dunkelheit aufgestiegen, denn es war bereits alles gesagt. Harry hätte das Duell vermeiden können, ohne ernsthaften Schaden an seiner Ehre zu nehmen, denn Kapitän Clere, der diese Herausforderung provoziert hatte, war zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen. Es kam Harry vor, als ob Oliver Carter, der verstorbene Kommandant der Magnanime und sein alter Widersacher, dessen Leichnam jetzt auf dem Friedhof lag, ihm im Tode noch genauso viele Schwierigkeiten bereitete wie zu Lebzeiten.
Clere und sein Sekundant zeichneten sich als Silhouetten gegen das erste schwache Leuchten am Morgenhimmel ab. Es war die Zeit der scheinbaren Dämmerung, wenn die Sonne sich erst noch über die Kimm schieben muß. So entsteht dieses graue morbide Licht. Der Chirurg stand abseits; er hantierte ziellos herum, denn er war nicht sicher, ob er seine Instrumente bereitlegen sollte oder die beiden Degen, die er unter den Arm geklemmt hatte. Der Himmel erhellte sich schnell, da sich die junge Sonne nur noch knapp unter dem Horizont befand. Die Männer sahen dem Sonnenaufgang zu, der den nächtlichen Himmel von einem dunklen Blau zu einem hellen Grau verfärbte. Der rote Rand des aufgehenden Gestirns fügte im Osten einen schmalen Streifen von hellem Orange hinzu.
»Ich vermute, daß ein letzter Appell an die Vernunft reine Zeitverschwendung wäre?« erkundigte sich James leise.
»Das würde nur diesen Tag retten, James. Wenn ich jetzt diese Herausforderung ablehne, lade ich jeden anderen geradezu ein, mich wieder zu fordern.«
»Das tust du ohnehin, Bruderherz. Es ist nicht gut, wenn einem der Ruf eines Heißsporns anhängt. Es gibt Männer, die so etwas lieben und dich aus reinem Nervenkitzel fordern werden.«
»Eins nach dem anderen. Laß mich erst das hier überleben, und ich verspreche dir, daß ich mir dann um die anderen Sorgen machen werde.«
James redete weiter, und das Licht im Osten war jetzt kräftig genug, um den Ärger in seinem Gesicht zu zeigen. »Jemand hätte ihn abhalten sollen, Harry.«
»Das ist das Gute beim Dienst im bunten Rock, James. Er mag sich wie ein besoffener Laffe aufgeführt haben. Es mag sein, daß keiner seiner Offizierskameraden viel von ihm hält. Aber wir sind bei keinem seiner Kameraden beliebt. Du kannst es zu einem guten Teil Neid nennen. Aber während sie sich selbst nicht stark genug fühlen, uns herauszufordern, sind sie völlig damit einverstanden, daß Clere sein Glück versucht. Außerdem, sollten sie sich einmischen, könnte ihnen dasselbe wie mir drohen. Clere ist ziemlich berüchtigt für sein aufbrausendes Temperament, glaube ich. Man kann ihn schwer zügeln. Das ganze Gerede, daß Carter sein Freund war, ist nur dummes Geschwätz.«
»Noch ein guter Grund, das Duell abzusagen«, argumentierte James.
»Haben Sie die Flasche, Pender?« Harry nutzte diese Frage an seinen Leibburschen, um sich um die Antwort zu drücken.
Pender reichte ihm die Taschenflasche, die Kaffee mit einem reichlichen Schuß Brandy enthielt.
Harry gönnte sich einen kleinen Schluck, bevor er sie an James weiterreichte. »Du wirst das vielleicht dringender als ich brauchen, Bruder. Einem Duell zuzusehen ist aufregender als daran teilzunehmen.«
James schüttelte nur den Kopf, und Harry gab die Flasche Pender mit einer Geste zurück, die bedeutete, daß sich dieser bedienen möge. Der Bursche machte davon dankbar Gebrauch, danach schüttelte er sich nachdrücklich.
Die Formalitäten begannen, nachdem sich der obere Rand der Sonne über die Kimm geschoben hatte. Der Schiffsarzt ging zu beiden Parteien und gab ihnen die Möglichkeit zurückzutreten. Nachdem diese abgelehnt hatten, legten sie die Jacken und Umhänge ab. Die weißen Hemden nahmen die Farbe der blutroten Sonne an, die sich gerade vom Horizont löste und langsam aber stetig golden verfärbte. Die beiden Kombattanten näherten sich dem Chirurgen, der in der Mitte eines offenen Platzes wartete. Sachlich forderte er sie auf, sich den üblichen Regeln zu unterwerfen.
»Zum letztenmal, Gentlemen«, fragte er, »es gibt wirklich keinen Weg, diesen Zweikampf zu vermeiden?«
Beide schüttelten den Kopf. Harry blickte Clere an; er sah ihn zum erstenmal ohne Perücke und Uniformjacke. Sein Haar war lang, mausfarben, zottelig und dünn, sein Gesicht trug die Narben vieler körperlicher Auseinandersetzungen, dazu gehörte auch eine Nase, die offensichtlich auf der Empfängerseite gewesen war, als schwere Faustschläge ausgeteilt worden waren. Seine blauen Augen wirkten undurchsichtig und leblos, die Lippen, um die normalerweise ein überhebliches Lächeln zu spielen schien, waren jetzt fest zusammengepreßt, ein Zeichen für die Anspannung, unter der Clere stand. Seine Schultern schienen ohne die Stütze der Epauletten zu hängen. Im ganzen gesehen, war Clere jetzt alles andere als eine imponierende Gestalt.
Harry spürte, daß er sich entspannte. Jetzt, da es endlich in den Kampf ging, verflog die Angst, die immer während der Wartezeit wie ein Knoten sein Herz umspannte. Er fühlte sich sehr lebendig, er konnte mit aller Klarheit sehen und denken. Das Grinsen, das er Clere zuwarf, als sie die En-garde-Position einnahmen, ließ einen ängstlichen Schatten über das Gesicht des anderen Mannes huschen.
Harry wußte plötzlich, daß ihm ein Gegner gegenüberstand, der von guten Kämpfen nur schwadronierte, der andere mit plötzlichen Temperamentsausbrüchen und seiner kraftvollen Sprache einschüchterte, der aber jetzt Angst hatte; denn diesmal hatte ihn seine Leidenschaftlichkeit in ein echtes Duell getrieben, und das auch noch mit einem wirklich gefährlichen Gegner. Er wollte dieses Duell ebensowenig wie Harry Ludlow, aber er konnte aus Angst, sein Gesicht zu verlieren, keinen Rückzieher machen.
Die Sonne war jetzt ganz aufgegangen, sie tauchte die Grasnarbe, die die Bergspitze bedeckte, in gleißendes Licht. Der langflorige grüne Teppich funkelte, als sich die Strahlen in den Tropfen des Morgentaus fingen. Unter ihnen hatte sich die Farbe des Meeres von Schwarz in Grau gewandelt. Schon bald, wenn es das Sonnenlicht reflektierte, würde es blau schimmern. Die Degen klapperten aneinander, als der Arzt das Kommando gab, mit dem Duell zu beginnen. Clere versuchte einen Bogen zu schlagen, um Harry zu zwingen, in die tiefstehende blendende Sonne zu blicken. Harry wich zurück und schlug in Richtung der ungeschützten Seite. Clere parierte und wollte dem Gegner mit seinem Degen einen Hieb verpassen. Aber Harry Ludlow war nicht da. Unter Vernachlässigung aller Regeln der Fechtkunst sprang er an Clere vorbei und verpaßte ihm mit der flachen Seite des Degens einen gewaltigen Schlag auf den Hintern. Clere stieß einen überraschten Schrei aus und wirbelte schnell herum. Harrys Degen schnitt glatt durch sein wehendes Hemd und drehte in einer bogenförmigen Bewegung Cleres Waffe zur Seite, bevor er wieder an ihm vorbeischoß und ihm einen weiteren mächtigen Streich auf den Hintern verabreichte.
Clere stolperte durch die Wucht des Schlages nach vorn, Harry folgte ihm und schlug ihn wieder und wieder, trieb ihn vor sich her wie ein Lastentier. Immer wenn Clere versuchte, sich umzudrehen, um ihm Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, unterband Harry das, indem er die Klinge seines Gegners nach unten schlug und ihn auf diese Weise kontrollierte, bis er wieder in seinem Rücken stand. Mit einem Auge registrierte er die Überraschung auf den Gesichtern von Cleres Begleitern, während er abwechselnd seinen Gegner mit der flachen Plempe verdrosch oder ihm das zerfetzte Hemd ein um das andere Mal weiter aufschlitzte. Sie stöhnten auf, als ihr Mann anfing, Schmerzensschreie in die frische Morgenluft auszustoßen.
Harry zweifelte keine Sekunde daran, daß Clere in einem sauberen Kampf nach den üblichen Regeln eine gute Figur gemacht hätte. Ohne Zweifel hätte der Mann eine Verwundung hingenommen und dann weitergekämpft. Er wäre sogar lieber gestorben, ehe er sich einen Feigling hätte schelten lassen. Für Harry war die Wahl einfach. Entweder mußte er ihn töten oder ihm seinen Nimbus nehmen. Für die erste Möglichkeit sah er keine Notwendigkeit, denn das würde seiner Ansicht nach einem Mord gleichkommen. Seine Methode mochte nicht sonderlich elegant sein, aber sie war immer noch besser, als sinnlos ein Leben zu beenden.
Wieder folgte ein Schlag auf den Achtersteven, dann ein Tritt in die Kniekehlen, der Clere zu Boden sinken ließ. Harry wartete, bis er sich wieder aufgerappelt hatte, bevor er ihn erneut angriff. Die Schreie wurden lauter, wurden zum Gebrüll, wenn ein kräftiger Hieb des Degens eine Stelle traf, die schon gezeichnet war. Die Luft hallte wider vom Klatschen des Metalls auf die schmerzende Fläche, gelegentlich nur noch traf Metall auf Metall.
Clere stürzte wieder, er atmete stoßweise. Harry trat zurück, erlaubte ihm, sich zu erheben. Clere bewegte sich jetzt wie ein alter Mann, und der Schmerz, den er fühlte, spiegelte sich in seinen Augen wider.
»Verdammt, Ludlow. Stehen Sie endlich still und kämpfen Sie«, keuchte er.
Harry machte einen Ausfall. Clere hob seinen Degen und schaffte es, ein paar Schläge zu parieren, bevor Harry seine Deckung durchbrochen hatte, seine Degenspitze deutete auf die Brust des Mannes. Clere zeigte einen Ausdruck von Trotz im Gesicht, forderte Harry geradezu auf, die Angelegenheit zu beenden und ihn zu durchbohren. Doch Harry sprang wieder an ihm vorbei und begann aufs neue mit seiner Taktik des Prügelns. Clere ging mehrmals zu Boden, jedesmal kam er mühsamer wieder auf die Füße. Er atmete röchelnd und stoßweise. In seinen Augen war jetzt Verzweiflung. Sie spiegelte sich auch in den Gesichtern seiner Begleiter wider, als sie sich eingestehen mußten, wie frisch sein Gegner noch war. Harry schwitzte kaum, während er um Clere herumtanzte, immer gerade außerhalb der Reichweite von Cleres nutzlos geschwungenem Degen.
Es konnte so nicht weitergehen, und Harry, dem klar wurde, daß Clere niemals aufgeben würde, stieß mit Leichtigkeit vorwärts und durchbohrte das Fleich im oberen Bereich des Waffenarms des Mannes. Aus der Wunde schoß ein kräftiger Blutstrom, und Clere ließ seine Waffe fallen. Er griff mit der anderen Hand über seine Brust und versuchte den Blutstrom zu unterbinden. Dabei blickte er Harry herausfordernd an.
»Machen Sie weiter, Sir. Bringen Sie es zu einem Ende!«
Clere war bis zum Schluß ein Opfer seiner Zunge. Er sah keine Möglichkeit einzulenken und würde nicht zustimmen, daß der Ehre Genüge getan worden war. Harry stieß wieder nach vorne, seine Degenspitze zielte genau auf einen Punkt unterhalb des Rippenbogens seines Kontrahenten. Er sah das Entsetzen in den Augen des Gegners, dann wurden sie glasig und ausdruckslos.
Der Chirurg, der hinter Clere stand, eilte nach vorne, als der Mann zu Boden glitt; er drehte ihn um und suchte die Wunde, denn er wollte die Blutung in der Brust stillen. Verwundert wirbelte er herum, blickte Harry an, der nun gleichmäßig atmend im vollen goldenen Sonnenlicht des Morgens daneben stand. Als er sprach, wäre es für den Arzt ein leichtes gewesen, das Ziel der Worte zu verwechseln, denn der Widerwille war nicht zu überhören. Aber nicht dem bewußtlosen Seeoffizier galten sie, sondern Harry Ludlow, der ärgerlich auf sich selbst war. Erstens, weil er sich an diesem Ort befand, und zweitens über die Art, wie er sich verhalten hatte.
»Versorgen Sie seinen Arm, Doktor. Ich habe seine Brust nicht angekratzt. Er ist ganz einfach vor Angst ohnmächtig geworden.«
Harry ging weg, dorthin, wo sein Bruder und Pender standen. Er nahm die Flasche, die ihm sein Bursche hinhielt, und gönnte sich einen langen Schluck, bevor er sagte: »Ich dachte immer, Bruder, daß das letzte Wort, das man nach Beendigung eines Duells sagt, etwas mit Befriedigung zu tun haben müsse.«
Kapitel 2
»Verdammter Quatsch und Unsinn«, schnarrte der alte Mann und sah Harry Ludlow direkt unter seinen buschigen grauen Augenbrauen hervor an. »Ich darf mir gar nicht ausmalen, was Ihr Vater sagen würde, wenn er Sie so reden hörte.«
»Vielleicht wäre es besser, darüber überhaupt nicht zu diskutieren, Sir.«
James Ludlow, Harrys jüngerer Bruder, beobachtete die beiden Männer und versuchte ein Lächeln zu unterdrücken. Beide Gesichter zeigten einen Ausdruck höflich maskierten Unbehagens. Der ältere Mann saß am Kopfende des langen Tisches, der die ganze Breite der Staatskabine der Victory einnahm; die beiden Brüder saßen zu seiner Rechten und Linken. Sein dunkelblauer Uniformrock war mit glitzernden Orden bedeckt, die rote Schärpe des Bath-Ordens lief über seine schneeweiße Weste. Sie war die Belohnung für einen Erfolg, der schon viele Jahre zurücklag, als er noch regelmäßig auf Schiffen kämpfte. Trotz der vielen inzwischen vergangenen Jahre an Land, sowohl bei der Admiralität wie im Oberhaus als auch im Kreis der Höflinge am Hof König Georgs, hatte Hoods Sprache nie ihren derben Seemannsklang verloren. Er war ein Mann, der daran gewöhnt war, Opponenten zum Schweigen zu bringen, sei es auf einem Achterdeck oder in einem mit Eichenholz verkleideten Kabinett.
Harry Ludlow, der natürlich das Alter von Admiral Hood und seine Reputation achtete, liebte es gar nicht, wenn man ihn einfach zum Schweigen bringen wollte. Er hatte zu viele Jahre seine eigenen Schiffe kommandiert, um diesen Ton onkelhafter Zurechtweisung zu akzeptieren, der ein ständiger Teil seines Lebens geworden war, seitdem sie ihre Reise auf dem Flaggschiff begonnen hatten.
»Ich werde an meinem Tisch jedes Thema diskutieren, das mir paßt.« Vielleicht war Hoods Ton ein wenig schärfer, als es der Höflichkeit entsprach. Er versuchte Harry mit einem starren Blick einzuschüchtern.
»Dann werden Sie sicher bald feststellen, daß Sie allein dinieren«, schnappte Harry und erwiderte den starren Blick und den scharfen Ton im vollem Umfang.
Auf Hoods Gesicht begann sich echter Ärger auszubreiten, der Mund wurde hart, seine Nasenflügel bebten, und seine Augenbrauen schienen noch dichter zu werden, als sie sich drohend über der Nasenwurzel zusammenschoben. Aber plötzlich lehnte er sich in seinem Sessel zurück und lachte laut auf. Er war ein großer Mann mit einem langen knochigen Gesicht, einer großen Nase und einer hochroten Gesichtsfarbe, von der sich buschige graue Augenbrauen abhoben. In seiner Jugend war er ein hübscher Bursche gewesen, aber er war in Ehren gealtert und erschien viel jünger als er tatsächlich war. Dazu verfügte er noch immer über ein herzliches dröhnendes Gelächter, das zusammen mit seinem roten Teint dafür sorgte, daß man sich Sorgen über seine Gesundheit machte.
»Sie waren schon immer ein Kampfhahn, Harry, sogar schon als Hosenscheißer. Ich erinnere mich daran, daß mir Ihr Vater erzählt hat, wie oft er Sie über eine Kanone binden und verprügeln lassen mußte.« Er senkte seine Stimme zu einem deutlich vernehmbaren Flüstern. »Keiner von diesem Pack hier würde es je wagen, so mit mir zu sprechen. Sie stimmen mir immer zu, egal ob ich etwas Schlaues oder völlig Blödsinniges sage. Das macht die Überfahrt sterbenslangweilig.«
Er blickte den langen Eßtisch hinab auf die versammelten Offiziere, es waren auch altgediente Kapitäne zur See darunter. Nicht einer wagte es, seinen Blick zu erwidern.
Hood lehnte sich in seinem Stuhl zurück, auf dem roten knochigen Gesicht lag jetzt eher ein Ausdruck höflicher Neugier, als er sich nach links wandte, um mit seinem zweiten zivilen Gast zu sprechen.
»Wie ist es mit Ihnen, junger Herr James, haben Sie auch das Temperament der Ludlows geerbt, oder schlagen Sie eher der Mutter nach?«
»Ich denke, Mylord, daß die letzte Person, die man nach einer Einschätzung ihrer Persönlichkeit fragen sollte, diese Person selbst ist. Denn wenn dabei eine gute Meinung herauskommt, ist es Selbstbeweihräucherung, und ist es eine schlechte, dann ist es falsche Bescheidenheit.«
Die dicken Augenbrauen zogen sich zusammen, als Hood James musterte. Er sah einen schlanken blonden Mann mit einem lebhaften hübschen Gesicht vor sich, der perfekt gekleidet war und völlig entspannt wirkte. Weder eine ranghohe Persönlichkeit noch eine elegante Umgebung würden James Ludlows Selbstsicherheit vermindern. Er war ein Mann, der in der feinen Gesellschaft zu Hause war, er war ein anerkannter Künstler, der wegen seiner Porträts sehr gefragt war. Er war aber auch für seine scharfe Zunge berüchtigt, und, wie die letzten Ereignisse zu beweisen schienen, ein Mann mit einem heißblütigen Temperament. Ein Mann, der gut auf sich selbst aufpassen konnte. Aber er hatte nicht das Temperament einer Bulldogge wie sein älterer Bruder. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war unübersehbar. Doch in Harry schien eine verborgene Stärke zu stecken, die James zu fehlen schien, eine physische Präsenz, gepaart mit der langen Erfahrung eines Seemannslebens, aber mit einem gewissen Mangel an Kultiviertheit.
Hood setzte einen milde ablehnenden Gesichtsausdruck auf, obwohl seine hellen blauen Augen, die fröhlich funkelten, ihn Lügen straften.
»Nein, ich denke nicht. Sie sind nicht aus demselben Holz wie Harry geschnitzt. Ich kann auch Ihren Vater nicht in Ihnen wiedererkennen. Um die Wahrheit zu sagen, Sie scheinen mir ein ziemlich kalter Fisch zu sein, James Ludlow.«
Sein Gast hielt dem Blick des alten Mannes stand, ohne mit der Wimper zu zucken. »Und ich wage zu vermuten, daß Sie sich als jovialen alten Burschen sehen, voller Witz und herbem Charme.«
Eine Sekunde lang herrschte Schweigen. Jetzt war es an der Reihe von Harry Ludlow, ein Lächeln zu unterdrücken. James grinste trocken, aber alle anderen starrten auf ihre Teller, den Ausbruch voraussehend, ja herbeisehnend.
»Aufmüpfiger Lümmel. Immer dasselbe mit dieser ganzen verdammten Familie«, brummte Hood leise, und auf seinem Gesicht breitete sich ein entspanntes wehmütiges Lächeln aus.
Das Tischtuch war entfernt worden, jetzt machte der Portwein die Runde. Pender saß mit Hoods Steward in der Pantry und aß genauso erstklassig wie die, die sie gerade bedient hatten. Jeder wäre ein Narr von einem Diener, der den Koch nicht anweisen würde, so viel Essen vorzubereiten, daß stets ein guter Teil übrigblieb. Genauso verhielt es sich mit dem Wein. Sie hatten an erstklassigen roten Bordeaux- und Burgunderweinen genippt, jetzt bedienten sie sich an einem dicken Hefekloß mit Rosinen und spülten ihn mit reichlichen Mengen eines ausgezeichneten Marsala hinunter.
»Du weißt nicht mal die Hälfte«, bemerkte Crane, der Steward des Admirals, während er sich den Mund wieder vollstopfte. Er war so groß wie sein Herr, aber dünn wie eine Bohnenstange, außerdem hatten ihn die Jahre in den niedrigen beengten Mannschaftsunterkünften gebeugt. Er bewegte sich auf eine sehr eigene Weise, seine knochigen Finger hantierten elegant und methodisch mit Messer und Gabel. Sein längliches trübsinniges Gesicht wurde von einer langen spitzen Nase beherrscht, neben der zwei tief eingesunkene Augen lagen. Er hatte sich leicht über sein Essen gebeugt. In dieser Haltung erinnerte er Pender an einen Futter suchenden Reiher in der Marsch.
»Dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mich aufklären würdest.«
Pender fehlte der Schliff seines Gesprächspartners. Er pflegte mit seinem Messer in sein Essen zu stechen und die Gabel dabei ungenutzt in der anderen Hand zu halten. Aber schließlich hatte er erst vor sehr kurzer Zeit die Gelegenheit bekommen, sich mit der Umgebung vertraut zu machen, während Crane mit seiner Arbeit sowohl an Land als auch an Bord schon seit Jahrzehnten vertraut war.
Der alte Diener steckte sich einen kleinen Bissen in den Mund. »Sie waren wie Pech und Schwefel und immer darauf bedacht, einander in jeder nur denkbaren Beziehung behilflich zu sein.«
Pender war fasziniert von der Familie Ludlow. Er hatte hier und da bruchstückartige Informationen über die beiden Brüder aufgeschnappt, sowohl aus Gesprächsfetzen der beiden selbst als auch aus den Gerüchten, die im Zwischendeck die Runde machten. Cranes Erinnerung jedoch reichte noch vor die Zeit zurück, als James geboren wurde, Hood und der Vater der Brüder, Admiral Sir Thomas Ludlow, noch befreundet gewesen waren.
»Es gab eine Menge guter Argumente gegen den Bastard, den er gefordert hat«, fuhr Crane beständig fort und kaute dabei gleichmäßig weiter. »Es gab Beweise, daß er den jungen Harry Ludlow zu einem Duell provoziert hat. Wenn er sich damals dazu durchgerungen hätte, sich vor dem Kriegsgericht zu entschuldigen, dann wäre dein Herr jetzt noch aktiver Seeoffizier. Immerhin hat der alte Bastard am Ende sein Teil abgekriegt, nicht wahr?«
Cranes abgeklärte Art und sein deutlich herausgekehrter Anspruch, als Ranghöherer akzeptiert zu werden, verärgerten Pender. »Er hätte es beinahe um eine verdammte Haaresbreite geschafft, es den beiden gut zu besorgen. Es war wirklich eine verflucht knappe Angelegenheit, das kannst du mir abnehmen!«
Der andere schnaufte laut. »Wenn du das sagst!«
Es war offensichtlich, daß Crane glaubte, daß der andere übertrieb. Was für eine Freude würde es ihm sein, diesem widerlichen Vogel mit seiner Pergamenthaut zu beweisen, wie sehr er sich täuschte! Ihm die ungeschminkte Wahrheit zu erzählen. Über das Leben auf der Magnanime und die Seeschlacht, ganz zu schweigen von den abartigen Vorlieben des verstorbenen Ersten Offiziers Bentley; über die ehrenrührige Weise, wie Ludlows Schiff versenkt worden war; wie die alte Feindschaft mit dem Kommandanten der Magnanime schließlich zu Morden geführt hatte; und von den Beschuldigungen, die gegen James erhoben worden waren, mit Beweisen, die so schlüssig waren, daß er kaum eine Chance hatte, dem Galgen zu entgehen. Crane würde dann nicht mehr so gleichmäßig das Essen in sich hineinschieben und auch nicht mehr so offen verachtungsvoll über seinen langen Zinken schauen, während er, Pender, ihm erzählte, welch wichtige Rolle er selbst dabei gespielt hatte. Aber Pender biß sich auf die Zunge. Die Geschichte würde dahin führen, daß er auch die Vorgeschichte erklären mußte. Er hätte gestehen müssen, daß er über ein paar Fertigkeiten verfügte, die Harry Ludlow geholfen hatten, die Unschuld seines Bruders zu beweisen. Ein Dieb, besonders ein guter, prahlt niemals herum, außer wenn er darauf aus ist, am Galgen zu enden.
Crane nahm den Blick in Penders Augen nicht wahr. Er hielt den jungen Mann für eingebildet und mißverstand die Selbstsicherheit als Tollkühnheit. Und da er selbst keinen Sinn für Humor hatte, konnte er die spaßige Art nicht nachvollziehen, mit der Pender seine Arbeit verrichtete. Für Crane war der Mann kein ordentlicher Diener. Er täuschte sich in fast allem, was er über seinen Kollegen dachte, aber in diesem speziellen Punkt hatte er recht. Denn noch vor ein paar Wochen war Pender nur ein einfacher Seemann gewesen.
»Es ist irgendwie verletzend, verstehst du, Harry. Ich bin nicht der einzige, der bereit ist, dir zu helfen. Auch andere riskieren, sich deinetwegen einen Verweis einzufangen. Du schadest dir nur mit deinen Worten und wirfst uns unsere Angebote, dir beizustehen, einfach vor die Füße.«
Nicht einmal der berühmte Lord Hood hätte es als angemessen empfunden, solche Worte in der Anwesenheit anderer auszusprechen. Er saß auf der langen Reihe der mit Samt bezogenen Bankdeckel in der Hauptkabine unter dem Hecklicht der Victory. Er trug noch immer seine Perücke, war aber wegen der Hitze des mediterranen Abends in Hemdsärmeln. Die Sonne ging im Westen unter und strahlte durch die sieben Fenster, die sich über die ganze Breite der Staatskabine erstreckten. Ihre Strahlen funkelten auf dem Silber und den auf Hochglanz polierten Möbeln. James saß etwas abseits auf einem Kapitänsstuhl auf der anderen Seite des Raumes. Er hatte seine Stirn gekraust, während er sich auf den Skizzenblock konzentrierte, den er auf übereinandergeschlagenen Beinen balancierte.
»Um meine Wiedereinsetzung kann ich nicht bitten«, knurrte Harry, dessen Augen auf die lange gerade weiße Linie des Kielwassers des Schiffes, das sich in der Ferne in der ruhigen See verlor, gerichtet waren.
»Verdammt will ich sein, Sie werden sie auch nicht bekommen, wenn Sie nicht darum nachsuchen. Ich hätte darauf bestehen sollen, selbst in diesem Kriegsgericht zu sitzen.« Hood warf Harry einen finsteren Blick zu, der die meisten altgedienten Navy-Offiziere zum Erzittern gebracht hätte. »Dann hätte ich sehen wollen, ob Sie wirklich die Stirn gehabt hätten, auch mir die Entschuldigung zu verweigern!«
Harry erlaubte sich ein leichtes Lächeln. »Ich glaube mich zu erinnern, daß Sie ziemlich beschäftigt waren.«
Hood, der zu dieser Zeit Admiral Rodneys Stellvertreter gewesen war, hatte damals gerade der französischen Flotte unter dem Kommandanten Comte de Grasse eine Niederlage beschert. Während der Schlacht bei den Saintes waren Rodney und Hood mit wichtigeren Dingen beschäftigt als mit einer Kriegsgerichtssitzung über einen jungen Offizier, der einen Vorgesetzten zum Duell gefordert hatte – was nach den Kriegsartikeln ausdrücklich verboten war. Harry konnte kaum die Aufmerksamkeit eines Mannes in Hoods Position beanspruchen, gleichgültig, wie eng die persönlichen Beziehungen sein mochten.
»Sie müssen sich entschuldigen. Dafür ist es auch jetzt noch nicht zu spät. Anschließend können wir beim König eine Petition einreichen.«
Hoods Kopf fuhr ärgerlich herum, als Harry ein entschlossenes »Nein!« hervorstieß.
James blickte um den Rand seines Skizzenblockes herum. »Ich wage zu behaupten, daß es Harry zutiefst widerstreben würde, sich wie alle anderen Offiziere an Bord verhalten zu müssen und sich des Vergnügens zu berauben, Sie beleidigen zu können, wenn er wieder des Königs Rock tragen würde ...« Hood öffnete seinen Mund zu einer Antwort, aber James, dessen Kopf wieder hinter dem Block verschwunden war, kam ihm zuvor. »Außerdem wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren Kopf stillhalten würden. Schließlich habe ich die Hoffnung, daß diese Skizze als Grundlage für ein Porträt dienen kann. Wenn Sie weiter so herumhampeln, dann wird es eher einer Karikatur von Gillray ähneln.«
Hood, dessen dicke graue Augenbrauen zitterten, blickte drohend auf die Rückseite des Blocks. »Falls Ihr Bruder einen guten Grund hat, sein Offizierspatent nicht zurückhaben zu wollen, würde ich es sehr begrüßen, wenn man mir das gütigst mitteilen würde. Schließlich ist der Mann, den er damals forderte, jetzt tot, und er ist unter Umständen verstorben, die den Fall nicht ungünstig beeinflussen können.«
»Wird das publik werden?« erkundigte sich Harry.
»Um Himmels willen, nein«, antwortete Hood nachdrücklich. Dann verdüsterte sich sein Gesicht. »Aber ohne jeden Zweifel wird der Klatsch wie immer seine Runde durch die Navy machen.«
»Dann weiß ich nicht, wie uns das helfen sollte«, entgegnete Harry. Er ließ unerwähnt, daß die Erlangung eines Offizierspatents unter solchen Umständen gleichermaßen erniedrigend wäre.
»Ich kann mich nicht mit Ihrem Pessimismus abfinden, Harry. Er ist für einen Mann Ihres Schlages absolut unnatürlich.« Hood machte eine Pause, sein rotes Gesicht nahm einen konzentrierten Ausdruck an, während er seine Gedanken ordnete.
»Ich müßte sein Andenken in den Schmutz ziehen.«
»Was ist los mit Ihnen? Sie konnten den Burschen auf den Tod nicht ausstehen, als er noch lebte. Verdammt, Mann, Sie haben eine Kugel in Carter gejagt und lieber Ihr Offizierspatent verloren, als einen Rückzieher zu machen. Sie brauchen nur auszusagen, daß er damals ein genauso schlechter Erster Offizier war, wie er jetzt ein schlechter Kommandant ist. Das rückt die Anklage, daß Sie ihn zum Duell gefordert haben, in ein anderes Licht. Glauben Sie mir, sobald man am Hof einen schlechten Eindruck von ihm gewinnt, sind Sie schon wieder so gut wie in der Marine. Darauf kann ich Ihnen mein Wort geben. Dieser Haufen von Emporkömmlingen, die um den König herumschwänzeln, lieben nichts mehr als zuzusehen, wie der gute Ruf eines Mannes beschmutzt wird.« In seinen letzten Worten schwang eine unverkennbare Bitterkeit mit. Hood war kürzlich selbst mit diesen Mächten in Konflikt geraten und hatte die Schlacht verloren. »Der König ist natürlich verrückt, also hängt eine Menge vom Prince of Wales ab. Falls man es schafft, ihn einen Moment vom Herumhuren abzuhalten, kann man sich bei ihm Gehör verschaffen.«
»Das, mein lieber Admiral, ist lèse-majestéi«, sagte James mit deutlicher Ironie und schob seinen Kopf wieder um den Rand des Blocks herum.
Die Bemerkung ließ Hoods rote Wangen in einem noch tieferen Rot erstrahlen. »Wenn Sie jemanden mit weniger Majestät als diese Familie finden, wäre ich zutiefst überrascht. Königtum! Diese Leute wären nicht in der Lage, als Hintersassen auf einem Bauernhof zu überleben.«
»Besonders ›Black Dick‹ Howe?« Amüsiert zog James eine Augenbraue in die Höhe.
»Reizen Sie mich nicht, Sie junger Laffe. Aber es könnte schon sein, daß der König seine Gewohnheit, mit Bäumen zu sprechen, dadurch angenommen hat, daß er versucht hat, mit seinem Bastardcousin eine Unterhaltung zu führen. Sind Sie mit Lord Howe persönlich bekannt, Harry?«
»Ich wurde ihm einmal vorgestellt«, lächelte Harry, »er hat nicht viel gesagt.«
»Mit ihm zu sprechen ist, als würde man sich mit einer Wand hier unterhalten.« Hood klopfte mit den Knöcheln gegen das hölzerne Schott und runzelte die Stirn. Dann schnaubte er abschließend: »Ein Fall von Korruption, ganz schlicht und eindeutig.«
Lord Howe hatte seine Stellung als Erster Seelord der Admiralität dazu benutzt, Hood als Kommandeur der Kanalflotte abzuschießen. Hood wußte, wie übrigens jeder andere auch, der einen Sinn für taktische Entwicklungen hatte, daß in diesem neuen Krieg mit dem revolutionären Frankreich das Mittelmeer nur ein Nebenkriegsschauplatz war. Die wirklich wichtigen Seeschlachten würden dichter an den heimischen Gewässern geschlagen werden. Dort würde man die wahre Ehre einheimsen können.
Harry konnte sich eine kleine Stichelei nicht versagen, quasi als Revanche für die Tracht Prügel, die er für seine Hartmäuligkeit bekommen hatte. »Ich habe gehört, daß er ein fähiger Kommandeur sein soll.«
»Das sollte er besser auch sein«, fauchte Hood mit einer dankenswert hitzigen Antwort, die ihn fast an den Rand eines Schlaganfalls brachte. »Oder Seine Britannische Majestät, Cousin George, der Dritte dieses Namens, könnte sich in sehr tiefen Gewässern wiederfinden! Zum Beispiel Tür an Tür in der Nachbarschaft seiner französischen Vettern im Exil oder auch in Hannover, von wo diese ganze Bande stammt.«
Es folgte noch einiges mehr in dieser Tonart, begleitet von heftigen Armbewegungen, als Hood seinen Gefühlen über diejenigen freien Lauf ließ, die seine Ambitionen durchkreuzt hatten. James ließ jede Hoffnung fahren, daß sein Modell ruhig sitzen bleiben würde, und nutzte die Gelegenheit, um eine ganze Reihe wenig schmeichelhafter Ausdrucksskizzen zu Papier zu bringen – einschließlich einer Karikatur, wo sich der verrückte König Georg, dick und froschäugig, mit dem Admiral unterhält, dessen Körper Teil eines wütenden knorrigen Eichenbaums ist.
Harry war nur zu froh, daß sich die Unterhaltung von seinem eigenen Problem zu den Schwierigkeiten ihres Gastgebers verschoben hatte. Es war wirklich ein großes Glück gewesen, daß der alte Freund ihres Vaters in Gibraltar eingelaufen war, bevor sie abgereist waren. Die Brüder waren gezwungen gewesen, länger zu bleiben, als sie vorgehabt hatten, denn die Navy hatte Wert darauf gelegt, daß sie während der gesamten Untersuchung, die ihrer Ankunft gefolgt war, anwesend waren. Jeder war von ihrer Geschichte geschockt gewesen, doch anstatt ihnen dankbar zu sein, weil sie die Verbrechen aufgedeckt hatten, hatten es die meisten Offiziere vorgezogen, ihnen die kalte Schulter zu zeigen. Erstens hatte die Navy ohnehin nicht viel für Freibeuter übrig; aber außerdem war man auch fürchterlich empfindlich in bezug auf die kollektive und persönliche Ehre. Harrys Verdienst war es, schwere Verfehlungen an den Tag gebracht und mehr als ein Schwerverbrechen aufgeklärt zu haben. Doch er hatte dabei eben auch das ganze Offizierskorps in ein schlechtes Licht gebracht.
Es hatte die Lage der Ludlows keineswegs verbessert, als durchsickerte, daß sie eine ansehnliche Menge Gold an Land hatten bringen lassen. Gold, das aus einem Gefecht mit einem französischen Kauffahrteischiff stammte, Gold, das dieses Schiff seinerseits von einem spanischen Schiff erbeutet hatte. Niemand auf der Magnanime hatte davon auch nur das Geringste gewußt, denn als Harry das Thema in der Offiziersmesse ansprach, waren alle davon ausgegangen, daß er das Gold mit einer seiner zahlreichen Prisen nach England geschickt hatte. Auch nachdem sie an Land waren, ließen James und Harry darüber nichts verlauten. Die Indiskretion stammte von dem Bankier, dessen Kaufangebot Harry kurzerhand abgelehnt hatte. Gold wurde in Gibraltar nämlich zum spanischen Kurs gehandelt, der traditionell niedrig war. So entschlossen sich die Brüder, das Gold per Schiff in die Heimat zu schicken. Auf diese Weise ausgebootet, brach der Bankier die üblichen Regeln seiner Schweigepflicht.
In einem kleinen Ort wie Gibraltar sprach sich so etwas schnell herum. Eine erhebliche Menge Gold zu besitzen war schlimm genug, dazu noch ein »verdammter« Kaperer zu sein war schlimmer. Reich genug zu sein, um es sich erlauben zu können, mit dem Verkauf zu warten, bis die Gewinne hoch genug waren, regte bestimmte Offiziere zusätzlich auf. Für sie war es ein leichtes, Neid und Abneigung in den weiten Mantel ihrer Liebe zum Dienst einzuhüllen. Die meisten waren auf Distanz geblieben und hoben sich ihre beleidigenden Nachreden besser für den intimen Austausch mit ihresgleichen auf, als sie in Anwesenheit der Ludlows laut auszusprechen. Aber einige Herren legten sich weniger Beschränkungen auf, besonders wenn Drinks und Prahlereien ihre Zungen gelöst und sie ihre guten Manieren hatten vergessen lassen. Die Herausforderung, die Clere inszeniert hatte, war dann die unausweichliche Folge davon.
Die Ludlows waren auf der Suche nach einer Passagemöglichkeit zur Heimreise nach England gewesen, immer vorausgesetzt, daß Harry das bevorstehende Duell mit Kapitän Clere überleben würde, als die Victory an der Spitze von zehn Linienschiffen von der Spitze des Felsens gesichtet wurde, während sie zur Bucht von Algiceras aufkreuzte. Jeder Gedanke an die Geschäfte, tödliche oder langweilige, wurde verdrängt, als alle in den Hafen strömten, um die Flotte zu begrüßen. Hood hatte Harry und James an Bord wie seine eigenen Söhne empfangen. Zum Leidwesen seiner Offiziere bot er ihnen eine Passage nach Genua an, von wo aus sie die Landroute über Österreich, Deutschland und die Niederlande nach Hause nehmen konnten. Harry hatte gezögert, weil er eigentlich die Seepassage bevorzugte. Aber James, begeistert durch die Erinnerung an seine Grand Tour und die Aussicht auf die künstlerischen Reichtümer Italiens und Wiens, hatte sich durchgesetzt.
Hoods Liebenswürdigkeit für die Ludlow-Brüder hatte zwangsläufig zur Folge, daß ihnen die Offiziere der Victory einen gewissen Respekt entgegenbringen mußten. Aber ihre Abneigung, nachdem sie im vollen Umfang über das kürzlich Geschehene aufgeklärt worden waren, war immer zu spüren. Außerdem hatte Harry durch seine unorthodoxe Handlungsweise gegen Clere nicht gerade dazu beigetragen, sein Ansehen zu verbessern. Eines Tages riß ihm der Geduldsfaden, und er fragte James in Hörweite aller Offiziere auf dem Achterdeck laut, wie die Herren sich wohl verhalten würden, wenn er den Bastard abgestochen hätte.
Zur allgemeinen Erleichterung würde es eine kurze Reise werden. Hood hatte den Kurs auf Toulon abgesetzt, um die Flotte, die dort bereits lag, zu verstärken. Die Engländer blockierten zusammen mit den Spaniern diesen wichtigen französischen Kriegshafen am Mittelmeer. Da Hood gezwungen war, außer wenn sich die Situation in der Zwischenzeit dramatisch verändert haben sollte, seine Schiffe über Genua versorgen zu lassen, würden Harry und James sich also auf das nächste Schiff begeben, das an der Reihe war, die Vorräte zu ergänzen.
Kapitel 3
Harry hielt den weißen Strumpf in die Höhe und zeigte auf die deutlich erkennbare Stopfstelle, dabei lächelte er Pender an. »Die Strümpfe sind ohne Zweifel repariert, das unterschreibe ich. Aber die Stiche sind eher für ein Segeltuch der Nr. 7 geeignet als für die Strümpfe eines Gentleman.«
»Ich fürchte, meine Talente liegen nicht gerade auf diesem Gebiet, Euer Ehren. Es scheint, ohne jeden Zweifel, alles eine Frage der Erziehung zu sein.«
Pender, der mit gespreizten Beinen auf der großen Kanone ritt, die die Hälfte des Platzes der Kabine einnahm, lächelte auch, anscheinend völlig unbeeindruckt von dem offensichtlichen Tadel. Er war ein kleiner Mann mit einem lebhaften dunklen Gesicht und immer bereit zu lächeln. Er hatte eine Art, mit seinen Vorgesetzten umzugehen, die ihre Autorität unterminierte, ohne daß sie merkten, wie ihnen geschah.
»Nein, in dieser Richtung liegen deine Fähigkeiten wahrlich nicht«, stimmte Harry zu.
Pender war ihm als Leibbursche auf der Magnanime zugeteilt worden, und es war vom ersten Tag an klargeworden, daß dieser kein Berufsseemann war. Seine Erfolge auf dem bisherigen Feld seiner Bemühungen waren allerdings derartig eindrucksvoll gewesen, daß nun eine ganze Reihe von Leuten in England darauf wartete, ihn in die Finger zu bekommen, um ihn zur Verantwortung zu ziehen.
Pender hatte deshalb den Dienst in der Marine vorgezogen, und Harry, der verzweifelt versucht hatte, seinem Bruder zu helfen, hatte alles darangesetzt, sich Penders Hilfe zu versichern, was ihm – zu bestimmten Bedingungen – auch gelungen war. Da Pender keine Erfahrungen in der Mannschaft der Marine des Königs hatte, war ihm die Rolle von Harrys Leibburschen zugefallen, der er sich nun mit großem Enthusiasmus widmete. Das einzige, was er überhaupt nicht beherrschte, war die Kunst des Nähens. Das war überraschend für einen Mann mit so flinken Fingern.
Harry hatte seine Entlassung aus dem Dienst des Königs erreicht. Außerdem hatte er seinem Schwager, Lord Drumdryan, dem Hüter des Wohlstands der Ludlows, mit dem ersten Schiff, das Gibraltar verließ, nachdem die Magnanime in den Hafen gehumpelt war, die Anweisung geschickt, Penders Angehörige ausfindig zu machen und sie unter seinen Schutz zu stellen.
»Sie brennen darauf, wieder ein eigenes Schiff zu führen«, bemerkte Pender.
Harry warf seinem Bruder einen schnellen Blick zu, um zu sehen, ob dieser die Bemerkung gehört hätte, bevor er zu Pender, wie er meinte, unmerklich den Kopf schüttelte. Da die Brüder eine Kabine teilten, war nur wenig Raum, immerhin handelte es sich um eine der Kabinen an der Seite der Offiziersmesse, so daß sie glücklicherweise über Tageslicht verfügte. James lag auf seiner Koje, mit dem Rücken zum Fenster, und war anscheinend in ein Buch von John Evelyn vertieft, der den Teil Italiens bereist hatte, der jetzt vor ihnen lag. Harry war daher überrascht, als James sich einmischte.
»Werde ich von irgend etwas ausgeschlossen?« James drehte sich zu den beiden herum. Er klappte sein Buch zu, mit dem Daumen zwischen den Seiten markierte er sich die Stelle, an der er unterbrochen worden war.
Harry Ludlow war die beleidigte Unschuld in Person. »Wie kommst du darauf?«
»Die unnatürliche Stille und der Umstand, daß Pender plötzlich so beschäftigt tut und jeden Augenkontakt mit mir vermeidet.«
»Ich habe wirklich zu tun, Mr. James.« Penders Stimme klang so verletzt, daß er damit jeden Untersuchungsbeamten der Polizei zum Narren gehalten hätte.
»Du hast Penders Frage nicht beantwortet, Harry.«
Jetzt war es an Harry, ihm einen verdutzten Blick zuzuwerfen. »Was für eine Frage?«
»Jetzt weiß ich, daß etwas im Busch ist!« Er öffnete das Buch und begann wieder zu lesen. »Übrigens hat der Sekretär von Lord Hood vor einiger Zeit nach dir gefragt.«
»Wirklich?« Harry versuchte erst gar nicht, sein Mißtrauen zu verbergen. Er sah aus wie ein Mann, der seine Taschenuhr an der Weste eines anderen entdeckt.
»Es wird wohl nichts Wichtiges sein, vermute ich«, gähnte James und verstärkte damit die Spannung in der Kabine. »Der Bursche wollte nur wissen, ob du dich nun entschlossen hättest. Wie es scheint, ist der Admiral daran interessiert.«
Harry, der sich auf der anderen Seite der Kanone befand, blickte angespannt auf den Strumpf, den er noch immer in seiner Hand hielt. »Ob ich mich entschlossen habe? Wozu denn?«
»Ein anderes Schiff zu kaufen und die Kaperfahrten im Mittelmeer fortzusetzen.« James blickte wieder von seinem Buch auf, sein Gesicht war völlig ausdruckslos. »Und nicht nach Hause zurückzukehren, wie wir es ursprünglich beabsichtigt hatten. Immerhin, mein lieber Bruder, eins muß man dir lassen, du bist immer für eine Überraschung gut!«
Schuldbewußt errötete Harry; instinktiv strich er mit einer Hand über seinen Rock, um sich zu vergewissern, daß sich da noch die wasserdichte Tasche aus ölgetränkter Leinwand befand, in der er ihre Kreditbriefe verwahrte. James beobachtete das. Ihm war bewußt, daß die Summen, die dort aufgeführt waren, den Wert ihres Goldes übertrafen.
»Nur gut, daß diese Burschen in Gibraltar nicht unsere wahren Vermögensverhältnisse kannten, sonst wären wir vermutlich wie die christlichen Märtyrer gesteinigt worden.« Er begleitete diese Bemerkung mit einem weiteren gespielten Gähnen. »Ich glaube, daß ich eine Frage gestellt hatte. Oder ist es Pender gewesen?«
Pender wuselte noch eifriger herum, als Harry eine geknurrte Erwiderung gab. »Es war nur so ein Gedanke. Nichts ist entschieden.«
»Der Sekretär hatte ein paar Seekarten des Ligurischen Meeres und war voller Geschichten über die Situation in Livorno, das sich, wenn ich mich nicht irre, gleich südlich von Genua an der Küste befindet. Ist ein ziemlich geschwätziger Bursche, dieser Sekretär des Admirals. Er hat mir alles über diese Hafenstadt erzählt. Er schien sehr gut über deine Pläne informiert zu sein, obwohl er bezweifelte, daß es dir gelingen kann, den Admiral davon zu überzeugen, deine Freistellungen vom Militärdienst wieder in Kraft zu setzen. Nur seltsam, daß du es nicht für nötig gehalten hast, mir etwas darüber zu sagen.«
»Ich lote noch immer alle Möglichkeiten aus, und dazu bin ich doch wohl berechtigt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es gibt jede Menge Hindernisse. Aber abgesehen von allen anderen, sind alle eventuellen Pläne ohnehin gegenstandslos, wenn es mir nicht gelingt, mein Schiff sicher zu bemannen. Folglich ist es von außerordentlicher und vordringlichster Wichtigkeit, diese Freistellungen zurückzubekommen.«
In Harrys Worten lag zwar ein Stück Wahrheit, aber auch eine Spur Heuchelei, denn sie erklärten nicht seinen Eifer, wieder auf eigenen Planken zur See zu fahren. Vor seiner letzten Fahrt hatte ihn sein Schwager zu überzeugen versucht, daß es töricht war, um keine stärkeren Worte zu gebrauchen, wenn ein Mann mit seinen Pflichten und seiner Verantwortung über die Ozeane hetzte und auf die Weise versuchte, Geld zu erbeuten, das er nicht benötigte. Obwohl Lord Arthur Drumdryan nur zu froh war, sich um Harrys Angelegenheiten kümmern zu dürfen, sah er es trotzdem als Teil seiner Pflichten an, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten. Er wurde dabei leidenschaftlich von Harrys Schwester unterstützt, obwohl deren Beweggründe eher emotionaler als praktischer Natur waren.
Harry aber wußte genau: Wenn er erst mal wieder zurück in England war, würde es ihn Ärger ohne Ende kosten, wieder Planken unter die Füße zu bekommen. Arthur würde sofort versuchen, ihn in die politischen und kommerziellen Geschäfte zu verwickeln. Seine Schwester würde ihn mit ihren Sorgen und Problemen bezüglich des Landgutes anöden. Es hatte auch keinen Zweck, diese Befürchtungen mit James zu besprechen, der sich für ihren Schwager keine Zeit nahm, ihn nicht im geringsten schätzte und einfach ignorierte. Er würde die Vorbehalte seines Bruders nicht begreifen.
»Pender«, meinte James lächelnd, »tun Sie mir den Gefallen und hören Sie mit dem Herumgewusel auf. Sie hören sich an wie eine Schiffsratte.«
»Entschuldigen Sie, Euer Ehren«, meinte Pender leise. Und zu Harry gewandt: »Wie es scheint, ist die Katze nun aus dem Sack.«
»Natürlich geht mich das alles im Grunde nichts an, Harry. Nach alledem, was in den letzten paar Wochen passiert ist, kann ich deine Abneigung gut verstehen, nicht mehr mit mir zusammen auf einem Schiff fahren zu wollen.«
»Das ist verdammt unfair«, fauchte Harry.
»Ich weiß.« Sein Bruder lachte und schloß das Buch wieder um seinen Daumen als Lesezeichen. »Aber es hat mir doch so großen Spaß bereitet, dich auszuspionieren. Jetzt erzähle mir endlich, was du im Schilde führst.«
Während der nächsten paar Tage verbrachte Harry viel Zeit mit Hood in der Staatskabine und versuchte den Admiral davon zu überzeugen, daß der Verlust aller seiner Männer von der Medusa, die alle vom Wehrdienst bei der Marine freigestellt gewesen waren, genauso Gegenstand einer Wiedergutmachungsleistung sein mußte wie der Verlust seines versenkten Schiffes. Harry wiederholte immer wieder sein Argument, daß – falls er für seine neue Besatzung keine Freistellung bekam – er sich gar nicht erst die Mühe zu machen brauchte, sich eine Besatzung zu suchen, da ihn jedes Kriegsschiff der Navy, dem er über den Weg lief, anhalten konnte, um ihm, da er unter der britischen Flagge segelte, so viele Seeleute von Bord zu holen, wie man es für nötig erachtete.
»Eine tolle Rechtslage für einen Engländer«, rief Harry aus und unterstrich seine Empörung mit einer dramatischen Armbewegung. »Man muß vor den Schiffen seines eigenen Flaggenstaates flüchten!«
Hood lachte nur gedämpft. Sie beide kannten alle Tricks in diesem Geschäft; zum Beispiel steckte man die Männer in abgerissene seltsame Kostümierungen und ließ sie unverständliches Zeug brabbeln, wenn jemand sie nach ihrer Vergangenheit fragte. Nach dem Gesetz konnte ein Mann nur dann von einem Schiff geholt werden, wenn er sich freiwillig zur Navy meldete oder ohne jeden Zweifel als Deserteur identifiziert wurde. Aber Hood und Ludlow wußten natürlich auch, daß das Gesetz mitten auf dem freien Meer einen rostigen Penny wert war; die einzige Autorität, die dort zählte, kam aus den Mündungen der Kanonen.
»Vieleicht haben Sie auf das falsche Pferd gesetzt, Harry«, erwiderte ihm Hood, die buschigen Augenbrauen in die Höhe gezogen und mit einem humorvollen Glitzern in den Augen.
»Heißt das, daß die Antwort negativ ist?«
Hood schüttelte seinen Kopf. »Es heißt, daß ich es mir noch überlegen muß.«