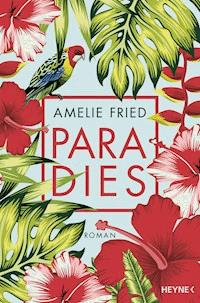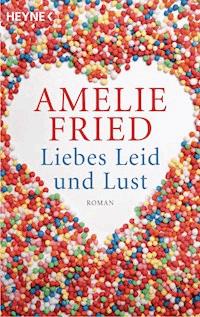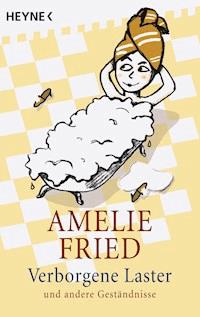7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine mitreißende und bewegende Geschichte über die schwierige Liebe zwischen Mutter und Tochter
Vor zwei Jahren ist Fredas Mann von einem Ausflug in die Berge nicht zurückgekehrt. Seither bleibt ihr nichts, als auf ein Wunder zu hoffen. Umso inniger wird die Beziehung zu ihrer einzigen Tochter Josy. Als die beschließt, für ein Jahr nach Mexiko zu gehen und bei einem Kinderhilfsprojekt zu arbeiten, ist das ein Schock für Freda. Andererseits begreift sie, dass sie dem Mädchen die Chance geben muss, eine erwachsene Frau zu werden. Gerade als Freda begonnen hat, sich in ihrem neuen Leben einzurichten, erreicht sie eine katastrophale Nachricht: Josy ist spurlos verschwunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn ihr Kind schwebt in Lebensgefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
DAS BUCH
Vor zwei Jahren ist Fredas Mann von einem Ausflug in die Berge nicht zurückgekehrt. Seither bleibt ihr nichts, als auf ein Wunder zu hoffen. Umso inniger wird die Beziehung zu ihrer einzigen Tochter Josy. Als die beschließt, für ein Jahr nach Mexiko zu gehen und bei einem Kinderhilfsprojekt zu arbeiten, ist das ein Schock für Freda. Andererseits begreift sie, dass sie dem Mädchen die Chance geben muss, eine erwachsene Frau zu werden. Gerade als Freda begonnen hat, sich in ihrem neuen Leben einzurichten, erreicht sie eine katastrophale Nachricht: Josy ist spurlos verschwunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn ihr Kind schwebt in Lebensgefahr.
»Amelie Fried erzählt einfach ganz großartig.« Bild am Sonntag
DIE AUTORIN
Amelie Fried, Jahrgang 1958, moderierte verschiedene TV-Sendungen. Von 1998 bis 2009 war sie Gastgeberin der Talkshow 3 nach 9. Seit Juli 2009 moderiert sie Die Vorleser, eine Büchersendung im ZDF. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan und Liebes Leid und Lust sind als erfolgreiche Fernsehfilme gesendet worden. Die Verfilmung von Rosannas Tochter ist abgeschlossen. Für ihre Kinderbücher erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zuletzt bei Heyne erschienen ist ihr Sachbuch Schuhhaus Pallas – Wie meine Familie sich gegen die Nazis wehrte. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.
Inhaltsverzeichnis
Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung, Kleidung,Wohnung und ärztliche Versorgung, außerdemein Recht auf Bildung und Freiheit – so steht es in derAllgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Für Millionen Kinder auf der Welt siehtdie Wirklichkeit anders aus:Sie wachsen unter menschenunwürdigenBedingungen auf, die wir nicht hinnehmen dürfen.Diesen Kindern widme ich mein Buch.
Sie versuchte zu erkennen, wo sie lag, aber es war dunkel. Sie konnte nicht sehen, wie groß der Raum war, in dem sie sich befand. Sie konnte nicht sehen, ob sie allein war oder ob im Dunkeln jemand lauerte. Diese Dunkelheit war das Schlimmste. Panik kroch in ihr hoch.
Dann drang ein wenig Mondlicht durch schmale Ritzen in den Wänden, die offenbar nur aus Brettern bestanden. Die Umrisse eines Karrens und irgendwelcher Maschinen zeichneten sich ab, vermutlich landwirtschaftliche Geräte. Ein Auto näherte sich. Der Motor wurde ausgeschaltet, Autotüren schlugen zu, Schritte näherten sich dem Schuppen. Stimmengemurmel. Sie begann zu zittern.
1
Noch bevor Freda ganz wach war, fiel ihr ein, welcher Tag heute war. Mit geschlossenen Augen blieb sie liegen und versuchte, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ihr Kind nun erwachsen war.
Vor achtzehn Jahren: Der Arzt zeigt ihr das Neugeborene, das von einer cremigen Schicht bedeckt ist und den unwiderstehlichen Wunsch in ihr auslöst, es sauberzulecken. Auch später, als ihr das Baby gewaschen und angezogen in die Arme gelegt wird, kann sie kaum dem Drang widerstehen, ihm mit der Zunge übers Gesicht zu fahren wie eine Katzenmutter.
Den ganzen ersten Tag über sieht sie es an und versucht, etwas Vertrautes an ihm zu entdecken. Nichts. Dieses Kind ist kein Teil von ihr, wie sie es sich vorgestellt hat. Es ist ein völlig eigenständiges Wesen, und es ist ihr fremd. Sie würden sich erst kennenlernen müssen, begreift Freda und ist überrascht.
Am nächsten Tag hört sie die Stimme ihrer Tochter aus einem Konzert von zwanzig Babystimmen auf der Säuglingsstation heraus. Und am übernächsten Tag blickt sie in das Gesicht der Kleinen, das sich im Schlaf unwillig verzieht, und bricht in Tränen aus bei dem Gedanken, dass dieses hilflose Baby eines Tages erwachsen sein und sie nicht mehr brauchen wird.
Als Josy größer wurde, entdeckte Freda, wie viel Spaß man mit einem Kind haben kann. Sie lag mit Josy auf dem Boden und untersuchte Staubflocken, stapelte Klötzchen zu Türmen und zeichnete Prinzessinnen, deren Kleider das Kind bunt ausmalte. Kein Spiel war Freda zu monoton, keine Unternehmung zu anstrengend. Sie organisierte Schnitzeljagden oder Mondscheinwanderungen im nahe gelegenen Park und sammelte einen Koffer voller Kleider und Kostüme zum Verkleiden bei schlechtem Wetter. Oft zog der Duft von frisch gebackenen Muffins oder Waffeln durch die Wohnung; sie konnte zwar nicht besonders gut kochen, buk aber gern. Die Nachbarskinder kamen in Scharen und waren willkommen, denn Freda fand es wichtig, dass ihr Einzelkind viele Spielkameraden hatte. Sie hatte es geliebt, Kinder um sich zu haben und selbst ein bisschen Kind sein zu dürfen.
Sie setzte sich im Bett auf und rieb sich das Gesicht. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass sie gerade mal fünf Stunden geschlafen hatte. Sie zog die hellblauen Silikonstöpsel aus den Ohren, die sie verwendete, wenn es spät geworden war und sie sicher sein wollte, dass kein Geräusch sie wieder aus dem Schlaf riss, in den sie mühsam gefunden hatte. Dann griff sie nach ihrem Handy auf dem Nachttisch. In einem von Josy bemalten Holzrahmen daneben stand ein Foto von Alex. Unwillkürlich tastete ihre Hand auf die andere Bettseite. Als sie die Kühle des unberührten Lakens spürte, zog sie die Hand schnell zurück.
Sie seufzte und schwang ihre Beine aus dem Bett. Ein Pochen in ihrer rechten Schläfe erinnerte sie an die vergangene Nacht. Ein bis zwei Gläser weniger hätten es auch getan, dachte sie. Aber schließlich feiert man nur einmal den achtzehnten Geburtstag seiner einzigen Tochter mit einer großen Party.
Punkt zwölf war Josy zu ihr gekommen, hatte sie umarmt und ihr ins Ohr geflüstert: »Glückwunsch, Mama, du hast es geschafft! Ich danke dir für alles.«
»Ach, meine Süße«, hatte Freda geantwortet und ein paar Tränen der Rührung verschluckt.
Dann hatte ihre Tochter den Kopf schief gelegt und mit ernstem Gesichtsausdruck gesagt: »Zwischen uns ändert sich nichts, okay?«
»Nein, nichts«, hatte Freda gesagt.
Aber gedacht hatte sie: Es hat sich doch schon so vieles geändert. Und beschützen kann ich dich jetzt auch nicht mehr.
Als hätte sie es bisher gekonnt. Als könnte man ein Kind überhaupt beschützen. Sie hatte immer alles getan, um Josy vor Schlimmem zu bewahren, vielleicht hatte sie es manchmal übertrieben. Besonders, seit Alex weg war. Hatte nicht jeder Mensch sein individuelles Schicksal? Sein Lebensdrehbuch, an dem man ein paar Verbesserungen anbringen, dessen Handlung aber niemand wesentlich verändern könnte? Wenn man Glück hatte, drehte man an angenehmen Orten, in schicken Kostümen und mit netten Kollegen. Aber wie der Film sich entwickelte, welche Wendungen und Höhepunkte er enthielt, war die Entscheidung eines unbekannten Regisseurs, der sich von niemandem hereinreden ließ.
Freda stopfte ihr Kissen im Rücken zurecht und zog die Knie an die Brust. Eine frühe Erinnerung kam ihr in den Sinn. Josy musste ungefähr zehn Monate alt gewesen sein, sie übte das Sichhochziehen und Stehen und entwickelte Interesse an anderen Kindern. Freda begann, regelmäßig mit ihr auf den Spielplatz zu gehen. Eines Tages beobachtete sie einen kleinen Jungen, der den Sitz einer Holzschaukel festhielt und genau in dem Moment losließ, als Josy sich gerade aufgerichtet hatte. Das Holzbrett raste auf ihren Hinterkopf zu, Freda sprang auf, die Schaukel prallte mit einem dumpfen Geräusch gegen den Kleinkindschädel, Josy fiel um. Sie schrie nicht. Sie machte nur ein kleines Geräusch, wie eine Art Japsen oder Aufstoßen, dann rührte sie sich nicht mehr. Fredas Herz blieb stehen. Sie riss Josy in ihre Arme, der kleine Körper fühlte sich schlaff an. Vor Fredas Augen schien ein schwarzer Vorhang herabzufallen. Da zuckte der Körper in ihren Armen, und Josy begann zu schreien.
Im nächsten Moment schrie auch Freda los. Sie schrie den verängstigten Jungen an, schrie sich die Panik aus dem Leib, bis die andere Mutter dazwischenging und Freda wieder zu Bewusstsein kam. Es war ihr peinlich, und sie entschuldigte sich. Der kleine Blödmann hatte es ja wohl nicht mit Absicht getan, und wenn doch, dann hatte er die möglichen Folgen seines Tuns nicht abschätzen können.
Im Krankenhaus wurden eine Prellung und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Und mit derselben Heftigkeit, mit der Josy von dem Holzbrett getroffen worden war, traf Freda die Erkenntnis, dass sie nie mehr aufhören würde, sich um ihr Kind zu sorgen. Ja, dass die ständige Angst, es könnte ihm etwas zustoßen, der Preis für das Glück war, das sie durch ihr Kind empfand.
Alex war ganz anders, er hatte nie Angst. Er warf das Baby in die Luft, schnallte es auf seinen Rücken, wenn er steile Skiabfahrten runterraste, unternahm später riskante Bergtouren mit seiner Tochter, immer nach dem Motto: »Was sie nicht umbringt, macht sie hart.« Freda nannte es Leichtsinn, er nannte es Gottvertrauen. »Das Leben ist nun mal lebensgefährlich«, erklärte er, »deshalb kannst du dich doch nicht zu Hause einsperren.«
Über die Jahre hatte sich zu Fredas Erleichterung gezeigt, dass viele scheinbar gefährliche Situationen in Wirklichkeit harmlos waren. Sie machte die Erfahrung, dass Kinder erstaunlich viel aushalten und meistens mehr können, als ihre Mütter ihnen zutrauen. Der beste Beweis dafür war schließlich, dass ihre Tochter ohne sichtbare Schäden zu einer jungen Frau herangewachsen war. Eine große Dankbarkeit erfüllte Freda plötzlich. Sie nahm das Foto von Alex in die Hand und betrachtete es.
»Du kannst stolz auf deine Kleine sein«, sagte sie leise. »Und auf mich auch.«
Beim Zähneputzen betrachtete Freda sich im Spiegel. Geschwollene Augen, müder Teint. Sonst war der Anblick nicht so übel, immerhin war sie schon dreiundvierzig. Nicht mehr jung. Noch nicht alt. Irgendwas dazwischen. Irgendwas, von dem sie hoffte, dass es ein »Noch nicht« wäre, und kein »Nicht mehr«.
Sie stellte die elektrische Zahnbürste in die Halterung zurück und zog ihren gemütlichen Hausanzug an, den Josy als »Strampelanzug« bezeichnet hatte. Egal, heute Vormittag würde niemand außer ihrer Tochter ihn zu Gesicht bekommen.
Ihre Gedanken wanderten wieder zurück in die Vergangenheit. Plötzlich blieb sie stehen und suchte angestrengt in ihrer Erinnerung, ging in ihr Zimmer, öffnete nacheinander alle Schubladen einer Kommode, durchwühlte den Inhalt und zog schließlich eine mit bunten Mandalas bedruckte Mappe hervor.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch, schob die Computertastatur zur Seite und schlug die Mappe auf, in der sich einige zusammengeheftete Blätter befanden. »Horoskop« stand in schnörkeliger Handschrift auf der ersten Seite, darunter Josys vollständiger Name und ihr Geburtsdatum.
Es war das Geschenk von Marie gewesen, einer Kollegin aus der Buchhandlung, in der sie damals gearbeitet hatte. Marie hatte sich außer als Handauflegerin, Hellseherin und Mandala-Deuterin auch als Hobby-Astrologin betätigt. Freda hatte diese Neigungen insgeheim belächelt, ihre Zweifel aber für sich behalten, weil sie ihre Kollegin mochte und nicht kränken wollte. Und so ganz genau konnte man ja nie wissen, ob nicht doch etwas dran war an dem Eso-Kram.
»Damit du weißt, was auf euch zukommt«, hatte Marie gesagt, als sie Freda drei Wochen nach Josys Geburt die Mappe überreichte und sphinxhaft dazu lächelte. Vielleicht war es dieser Satz gewesen, der Freda all die Jahre davon abgehalten hatte, das Horoskop zu lesen. Wer wollte schon so genau wissen, was auf ihn zukam?
Heute, achtzehn Jahre danach, könnte sie ja überprüfen, ob Marie mit ihren Prognosen Recht behalten hatte. Neugierig blätterte sie die zweite Seite auf. Sie zeigte die Zeichnung der Sternenkonstellation zum Zeitpunkt von Josys Geburt, ein Gewirr von Punkten und Linien, aus dem sie nicht schlau wurde. Darunter stand: »Zwilling mit Aszendent Widder, Mond im Wassermann.«
Es folgte eine Deutung der Zwillings-Persönlichkeit: »Zwillinge sind immer in Bewegung, sie lieben den Trubel und hassen Langeweile und Routine. Sie wirbeln durchs Leben und sind überall zu finden, wo etwas los ist. Durch ihre gewinnende und spritzige Art finden sie schnell Freunde, obwohl sie nicht gerade durch Zuverlässigkeit glänzen. Sie vergessen schon mal eine Verabredung oder eine Zusage, aufgrund ihres Charmes kann man ihnen aber nicht lange böse sein. Der ständige Wunsch nach Veränderung lässt sie gern Berufe wie Journalist oder Reiseleiter ergreifen. Aufgrund ihres Sprachtalentes sind sie auch gute Lehrer oder Sprachwissenschaftler. Zwillings-Frauen sind flatterhaft und kapriziös, sie wechseln ständig ihre Vorlieben und Interessen – und ihre Männer. Das Zwillings-Kind ist fröhlich und aufgeweckt; neugierig erkundet es die Welt. Zu anderen Kindern findet es leicht Kontakt und ist ein beliebter Spielkamerad. Seine Begeisterungsfähigkeit führt allerdings dazu, dass es sich leicht verzettelt, es fängt vieles an und führt wenig zu Ende.«
Verblüfft ließ Freda die Hand mit dem Blatt sinken. Diese Beschreibung traf so genau zu, als habe jemand Josy charakterisiert, der sie gut kannte. Sie griff nach der Seite, auf der die Kombination des Sternzeichens mit dem Aszendenten gedeutet wurde. »Feuer und Luft passen hier gut zusammen. Das geschickte Denken des Zwillings paart sich mit der Tatkraft des Widders und führt zu schnellen Entschlüssen und starkem Durchsetzungsvermögen. Manchmal aber werden die eigenen Kräfte überschätzt, dadurch entsteht eine gewisse Neigung zur Selbstgefährdung.«
Wie damals, als ihre Tochter noch nicht schwimmen konnte, es aber liebte, vom Beckenrand aus ins tiefe Wasser zu springen. Kaum war sie aufgetaucht, fing Freda sie ein und brachte sie wieder zum Ausstieg. Einmal hatte Josy in ihrem Eifer übersehen, dass Freda nicht im Wasser war, sondern am Beckenrand stand und mit jemandem sprach. Irgendein Instinkt hatte Freda plötzlich dazu gebracht, sich umzudrehen. Als sie Josys roten Badeanzug verschwommen am Grund sah, hechtete sie ins Becken und zog ihr Kind heraus, das bereits das Bewusstsein verloren hatte. Noch heute bekam sie Gänsehaut, wenn sie an die endlosen Sekunden dachte, die vergingen, bis Josy einen Schwall Wasser von sich gab und wieder zu atmen begann.
In der Küche kochte Freda Tee. Sie trug die Tasse ins Wohnzimmer, wo sie Josys Geschenke versteckt hatte, zog die Päckchen unter dem Sofa hervor und drapierte sie auf einem kleinen Tisch. Vom Balkon holte sie einen Strauß mit achtzehn sündhaft teuren, aprikosenfarbenen Rosen, die dort die Nacht verbracht hatten. In der Speisekammer stand die Geburtstagstorte, die sie tags zuvor heimlich gebacken hatte. Sie dekorierte sie mit achtzehn Kerzen und einem Lebenslicht und stellte sie zu den Geschenken. Zufrieden trat sie einen Schritt zurück und betrachtete ihr Arrangement. Es sah wunderschön aus, Josy würde begeistert sein! Sobald sie Geräusche aus ihrem Zimmer hörte, würde sie die Kerzen anzünden. Im CD-Player lag eine Techno-Version von »Happy birthday« bereit. Sie lauschte auf den Flur hinaus, hörte aber nichts. Wahrscheinlich würde Josy heute etwas länger schlafen, es musste sehr spät geworden sein.
Freda ging zurück in die Küche und schenkte sich Tee nach. Während sie trank, hatte sie plötzlich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Es war ganz still. Nur das Tropfen des Wasserhahns war zu hören. Nachdem sie das Tropfen abgestellt hatte, blieb sie stehen und versuchte, den Grund für ihre Unruhe zu finden. Sie ging auf den Flur hinaus – und dann begriff sie: Unter Josys Zimmertür schien Licht durch. Das hieß, die Jalousie war oben. Das hieß, Josy schlief nicht in diesem Zimmer. Das hieß, sie war nicht nach Hause gekommen.
Fredas Magen verkrampfte sich. Sofort produzierte ihr Kopf eines der vielen Katastrophenszenarien, die sie seit dem Verschwinden von Alex regelmäßig heimsuchten. Josy war auf dem Heimweg überfallen, vergewaltigt, ermordet worden. Oder sie war vor ein Auto gelaufen, hatte wie immer keinen Ausweis bei sich und lag nun bewusstlos in irgendeinem Krankenhaus. Oder … Hör auf, befahl Freda sich selbst, das bringt doch nichts. Wie oft hast du dich schon mit solchen Fantasien verrückt gemacht, immer grundlos. Bestimmt übernachtet sie bei einer Freundin. Wahrscheinlich hat sie sogar eine SMS geschickt. Josy wusste, dass ihre Mutter schnell nervös wurde, wenn sie nicht war, wo sie sein sollte, und meldete sich deshalb zuverlässig.
Keine Nachricht. Wahrscheinlich war wieder der Akku von Josys Handy leer gewesen. Oder die Prepaid-Karte abtelefoniert. Es war erstaunlich, dass Akkus und Prepaid-Karten immer gerade dann leer waren, wenn man das Handy dringend benötigte.
Freda wählte Josys Nummer. Mailbox. Sie versuchte es bei Naomi, bei Lara. Ebenfalls Mailbox. Sie hinterließ überall Nachrichten, sprach mit betont fröhlicher Stimme, um sich nicht anmerken zu lassen, dass sie besorgt war. Sie mochte sich selbst nicht in der Rolle der Panik-Mom, wie Josys Freundinnen sie hinter ihrem Rücken nannten. Es war Josy mal rausgerutscht, und zuerst war Freda wütend geworden; insgeheim hatte sie sich aber eingestehen müssen, dass die Bezeichnung durchaus zutreffend war. Andere Mütter waren viel lässiger, machten sich viel weniger Gedanken darüber, was alles passieren könnte. Josy hielt ihr oft vor, sie fühle sich kontrolliert und eingeengt. Trotzdem konnte Freda sich nicht anders verhalten, es war wie ein Zwang.
Endlich, eine weitere halbe Stunde später, klingelte das Telefon. Naomi, total verschlafen.
»Keine Ahnung, wo Josy ist«, nuschelte sie kaum vernehmbar. »Ich bin so gegen drei gegangen, da hat sie noch getanzt.«
»Kein Problem«, sagte Freda munter. »Falls sie sich meldet, sag ihr einfach, sie soll mich anrufen.«
»Geht klar.« Und nach einer Pause: »Und danke für gestern, war ’ne super Party!«
Freda lachte. »Freut mich, wenn’s dir gefallen hat!«
Die Party hatte Fredas Budget für den Jahresurlaub aufgefressen. Zum Glück besaß der Vater von Josys Schulfreund Zino eine Brauerei und hatte die Getränke spendiert, aber mit der Saalmiete, dem Essen und dem Discjockey war doch einiges zusammengekommen. Es war ihr egal, Urlaub konnte sie noch oft machen.
Nachdem sie die Spülmaschine ausgeräumt, die Küche gefegt, ihre E-Mails gecheckt und eine weitere Kanne Tee gekocht hatte, konnte sie ihre Unruhe nicht mehr bezähmen und wählte ein zweites, dann ein drittes Mal Josys Handynummer. Immer Mailbox. Inzwischen war es elf. Wo, zum Teufel, steckte ihre Tochter?
Josy erwachte aus einem unruhigen Schlaf. Ihr Kopf fühlte sich an, als wäre sie gegen eine Eisentür gelaufen. Stöhnend versuchte sie, sich auf die andere Seite zu drehen. Verdammt, wie das dröhnte! Das konnten doch nicht die paar Cola-Rum und Wodka-Orange gewesen sein, die sie gestern getrunken hatte? Mühsam öffnete sie die Augen einen Spalt. Sie blickte auf eine gelblich gestrichene Betondecke mit einer Neonröhre. Ihr Blick wanderte abwärts über die verschmutzten Wände, von denen die Farbe abblätterte, und blieb an einer massiven Gittertür aus Eisen hängen. Mit einem Ruck setzte sie sich auf und hielt sich den schmerzenden Kopf.
In diesem Augenblick kehrte ihre Erinnerung zurück. Das hier sah nicht nur aus wie eine Gefängniszelle, es war eine.
Gegen vier hatte Josy sich mit den letzten Partygästen ein Taxi genommen, um nach Hause zu fahren. Kaum saß sie im Wagen, wurde ihr schlecht. Eine Weile gelang es ihr, sich zu beherrschen, dann wurde die Übelkeit so stark, dass sie aussteigen musste. Sie verabschiedete sich hastig von ihren Freunden, und als das Taxi außer Sichtweite war, erbrach sie sich hinter einem Müllcontainer. Obwohl sie kaum stehen konnte, beschloss sie, zu Fuß weiterzugehen, vielleicht würden frische Luft und Bewegung helfen. Die Straßen waren leer, die Stadt schien wie ausgestorben. Josy schlug im Vorübergehen mit der Faust auf die Kühlerhauben und Dächer geparkter Autos; das dumpfe Dröhnen gab ihren schwankenden Schritten einen Rhythmus. Eins … bumm … zwei … bumm … Sie bemerkte nicht, dass ein Streifenwagen hinter ihr her fuhr. Erst als er sie überholte und vor ihr zum Stehen kam, hielt sie inne und lehnte sich an ein Auto.
»Na, junge Dame, wohin des Wegs?«, fragte der junge Polizeibeamte, der auf der Beifahrerseite ausgestiegen war.
»Nach Hause«, sagte sie mit schwerer Zunge. Sah eigentlich ganz nett aus, der Typ. Wenn er nur nicht diese kackgrüne Uniform anhätte. Sie überlegte, ob sie ihm das sagen sollte, aber es schien ihr zu anstrengend, die Worte zu formen.
»Und, haben wir was getankt?«
»Ich weiß nich, wie’s bei Ihnen is«, erwiderte sie schleppend, »ich habn bisschen was getrunken. Deshalb gehe ich auch zu Fuß.«
»Sehr vernünftig«, sagte der nette Bulle. »Hätten Sie denn mal Ihren Ausweis, bitte?«
»Meinn … Ausweis?«
»Genau.«
Josy wühlte der Form halber in dem Stoffbeutel, der ihr als Handtasche diente. Sie hatte nie einen Ausweis bei sich. Die Gefahr, dass sie ihn verlieren könnte, war zu groß. Sie verlor ständig irgendwas, deshalb nahm sie immer so wenig wie möglich mit.
»Tut mit leid. Vergessen.«
»Wie alt sind wir denn?«
»Ich weiß nich, wie alt Sie sind …«, fing Josy wieder an, aber plötzlich verstand der Typ keinen Spaß mehr. Vielleicht hatte er selbst gemerkt, wie blöde es war, in diesem Krankenschwestern-Ton zu sprechen.
»Wie alt Sie sind, will ich wissen!«, blaffte er sie an.
»Achtzehn.«
»Achtzehn«, wiederholte er spöttisch. »Und das soll ich Ihnen glauben?«
»Ich hab heute Geburtstag.«
»Na, so ein Zufall! Dann fahren wir jetzt zusammen auf die Wache und stoßen an.«
»Danke, sehr freundlich«, artikulierte Josy mit Mühe, »aber ich bin siemlich müde.«
Sie kniff die Augen zusammen. Der Typ schien irgendwie zu verschwimmen, mal kam er näher, dann waberte er wieder davon. Ihr war schwindelig, sie wollte sich an einem Auto abstützen, griff daneben und fiel gegen den Seitenspiegel, der knirschend aus seiner Halterung brach.
»Oje, oje«, lallte sie, »tut mir leid.«
»Sachbeschädigung«, konstatierte der Polizist und notierte das Nummernschild.
Josy wollte sich gerade in Bewegung setzen, da packte er sie am Arm.
»Lassen Sie mich!«, rief Josy und wollte sich losreißen.
Der Polizist hielt sie eisern fest und sagte: »Schluss jetzt. Sie können sich nicht ausweisen, sind vermutlich minderjährig und randalieren schwer alkoholisiert herum. Sie kommen jetzt bitte mit.«
»Schwer alko… alkollisiert«, wiederholte sie verächtlich, »so ein Quatsch!«
Im nächsten Moment fand Josy sich auf dem Rücksitz des Polizeiwagens wieder. Die Fahrt zur Wache verlief schweigend. Sie landeten in einem ungemütlichen Büro mit abgeschabter Einrichtung und scheußlich greller Beleuchtung.
»Personenfeststellung«, sagte der Polizist, der sie hergebracht hatte, und überließ sie seinem Kollegen. Josy diktierte ihm Namen, Adresse und Telefonnummer. Der Beamte, ein gutmütig wirkender, etwas älterer Mann mit einem Schnauzbart, tippte alles in den Computer. Dann griff er nach dem Telefon. »So, dann wollen wir mal deine Eltern informieren.«
»Bitte nicht … meine Mutter wecken!«, protestierte Josy vergeblich.
Er ließ es lange klingeln, aber niemand hob ab. Wahrscheinlich hat sie Stöpsel in den Ohren, dachte Josy.
»Handynummer?«, fragte der Polizist.
»Das Handy ist nachts ausgeschaltet.«
Er zuckte die Schultern und stand auf. »Dann fahren wir jetzt hin.«
Willenlos ließ Josy sich zum nächsten Polizeifahrzeug bugsieren. Kaum saß sie, schlief sie ein. Wenig später wurde sie unsanft geweckt.
»Wir sind da«, sagte ihr Begleiter und rüttelte an ihrer Schulter.
Sie griff in ihren Stoffbeutel, wühlte und suchte – kein Hausschlüssel! In ihrer Aufregung vor der Party musste sie vergessen haben, ihn einzustecken.
»Das is jetzt blöd«, nuschelte sie, »ich hab kein Schlüssel dabei.«
»Tja, dann …« Bedauernd hob der Polizist die Hand und legte den Finger auf die Klingel. Der Ton durchschnitt schrill die nächtliche Ruhe, aber niemand öffnete. »Ihre Mutter hat ja einen gesegneten Schlaf. Beneidenswert geradezu. Sonst ist niemand in der Wohnung?«
Josy schüttelte den Kopf. Ihr Magen rebellierte wieder, sie musste aufstoßen. »’tschuldigung«, murmelte sie. »Und … was jetzt?«
»Es gibt da ein nettes kleines Hotel«, sagte er, »da ist die Übernachtung kostenlos.«
Josy starrte ihn an. Dann begriff sie. »O nein.«
»O ja«, sagte er und öffnete ihr die Tür des Polizeiwagens.
Sie landete in der letzten der drei kargen Ausnüchterungszellen, die noch frei war. Resigniert rollte sie sich auf der harten Liegefläche zusammen, stopfte sich ihre Jacke als Kissen unter den Kopf und zog die widerliche, kratzige Wolldecke über sich. Inzwischen war sie so müde, dass ihr egal war, wo sie lag. Hauptsache, sie konnte endlich schlafen.
Ihr Rücken schmerzte, sie dehnte und streckte sich stöhnend. Vorsichtig stand sie auf und ging ein paar Schritte in der Zelle auf und ab, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen. Vielleicht würden dann auch die Kopfschmerzen besser werden. Pinkeln musste sie auch. Aber eher würde sie sterben, als die ekelige Kloschüssel zu benutzen.
Sie zog ihr Handy aus dem Beutel und schaltete es ein. Drei Anrufe von Panik-Mom. Josy seufzte. Wann würde Freda endlich aufhören, sich Sorgen um sie zu machen? Wie sollte sie erwachsen werden, wenn ihre eigene Mutter ihr nicht vertraute?
Sie drückte die Kurzwahltaste für zu Hause.
»Josy, endlich!«, meldete sich Freda erleichtert. »Wo warst du denn bloß?«
»Das … ist eine längere Geschichte. Kannst du mich abholen?«
»Wo denn?«
»In der Hochbrückenstraße.«
»Du meinst, auf dem Polizeirevier?«, fragte Freda ungläubig.
»Genau. Und bring bitte unbedingt meinen Ausweis mit. Der liegt in meiner Schreibtischschublade. Hoffe ich wenigstens.«
Josy drückte schnell den Aus-Knopf. Sie hatte jetzt nicht den Nerv für Diskussionen. Sie schlüpfte in ihre Jacke, dann rüttelte sie an der Eisentür, die zu einem Vorraum mit einem Waschbecken führte.
»Hallo! Sie können mich rauslassen!«
Nichts passierte.
Sie sah sich um und entdeckte einen Knopf an der Wand, den sie drückte. Wenig später wurde die Tür des Vorraums geöffnet, eine Beamtin steckte den Kopf herein.
»Sie können jetzt das Frühstück servieren«, sagte Josy. Die Frau verzog keine Miene.
Freda fuhr aus der Parklücke, kurbelte hektisch am Lenkrad und hätte fast einen Radfahrer umgelegt.
»Reg dich bitte nicht auf, Mama.«
»Ich reg mich ja gar nicht auf.«
»Die hundertfünfzig Euro für den Spiegel zahle ich zurück.«
»Und von welchem Geld?«
»Lass das mal meine Sorge sein.«
Freda schwieg. Sie war heilfroh, dass es ihrer Tochter gutging, aber dieser nächtliche Exzess hatte sie erschreckt. Neulich hatte Josy behauptet, sie würde keinen Alkohol trinken, er schmecke ihr nicht. Und nun sollte sie ›schwer alkoholisiert‹ gewesen sein? Das passte doch nicht zusammen.
»Sag mal, hast du schon öfter so viel getrunken?«
Josy verdrehte die Augen. »Mein Gott, Mama! Das klingt ja, als hätte ich ein Alkoholproblem! Ich gebe ja zu, dass ich es gestern übertrieben habe, aber das war total die Ausnahme, ehrlich.«
Freda warf ihr einen prüfenden Blick zu. Dann fragte sie: »Wie ist es überhaupt in so einer Ausnüchterungszelle?«
Josy schüttelte sich. »Scheußlich! Es stinkt, es ist dreckig, und man liegt auf dem nackten Beton. Da will ich kein zweites Mal rein, das kann ich dir versprechen.«
»Dann nimm nächstes Mal besser einen Hausschlüssel mit«, sagte Freda und lächelte.
Erleichtert lächelte Josy zurück. Sie ertrug es nicht, wenn ihre Mutter sauer auf sie war.
Beim Anblick der Geschenke, der Torte und der Rosen fiel Josy Freda um den Hals. »Du bist so lieb«, murmelte sie. »Tut mir leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast.«
»Schon okay«, sagte Freda. »Hast du Hunger? Soll ich dir was zu essen machen?«
»Bloß nicht, danke«, sagte Josy. »Ich glaube, ich leg mich lieber ein bisschen hin.«
Sie ging in ihr Zimmer und blieb den ganzen Nachmittag verschwunden. Freda kämpfte gegen die Enttäuschung an, die sich in ihr breitmachte. Sie hatte es sich so gemütlich vorgestellt, zusammen mit Josy in der Küche zu sitzen, Kaffee zu trinken, Torte zu essen und über die gestrige Party zu reden. Stattdessen wanderte sie allein durch die Wohnung.
Gegen Abend tauchte Josy auf, schob eine Tiefkühlpizza in den Ofen und ging unter die Dusche. Kaum hatte sie aufgegessen, klingelte es. Sie sprang auf und lief zur Wohnungstür.
»Wer ist das?«, rief Freda.
Josy führte Lara und Naomi in die Küche. »Wartet kurz, ich bin gleich wieder da.«
Sie verließ die Küche, ohne ihr Glas, ihr Besteck und den Teller mit dem abgenagten Pizzarand abzuräumen.
Freda kannte die beiden Mädchen seit dem Kindergartenalter. Sie waren, wie Freda es nannte, ihre »Ersatztöchter«, die ganz selbstverständlich bei ihr ein und aus gingen. Naomi war temperamentvoll und impulsiv, Lara eher nachdenklich und vernünftig. Auch äußerlich waren sie unterschiedlich, die eher knabenhafte Naomi trug ihr blondes Haar kurzgeschnitten, die weiblichere Lara hatte eine lange rehbraune Mähne, die ihr ins Gesicht fiel. Nur bei der Kleidung waren sie sich einig. Ihre Röhrenjeans waren so eng, dass Freda sich fragte, wie sie hineingekommen waren, beide trugen schmal geschnittene Pullis und modische Ankle Boots. Ihre Gesichter waren zart geschminkt und zeigten nicht die geringste Spur von Schlafmangel oder Alkoholkonsum, wie Freda mit einem Anflug von Neid feststellte. Bei ihr waren die Tränensäcke den ganzen Tag nicht weggegangen; noch jetzt spürte sie die Schwellung unter den Augen.
»Na, ihr zwei, schon wieder fit?«, fragte sie lächelnd. Die beiden nickten. »Geht so«, sagte Naomi und zog eine Grimasse.
»Wollt ihr was trinken?«
»Gern«, sagte Lara, und Freda stellte Mineralwasser und Apfelsaft auf den Tisch.
»Sicher wollt ihr euch einen gemütlichen Abend machen«, sagte Freda. »Ich habe zwei neue DVDs, ›Beim ersten Mal‹ und ›Fluch der Karibik 2‹.«
»Cool«, sagte Naomi.
»Ja, die sind beide echt gut«, bestätigte Lara.
»Das heißt, ihr kennt sie schon?«
Die Mädchen nickten.
»Ach, da finden wir schon was. Ich hab jede Menge guter Filme.«
Bei ihren letzten Worten kam Josy hereingestürmt. Sie sah aus wie das blühende Leben; die dunklen Locken absichtlich verstrubbelt, die großen, braunen Augen mit Lidschatten und Mascara zum Leuchten gebracht, die zarte Figur wirkungsvoll in Jeans und hohe Stiefel verpackt.
»Los geht’s, ich bin so weit.« Sie wedelte auffordernd mit den Armen.
Freda sah sie entgeistert an. »Ihr wollt schon wieder ausgehen?«
»Klar«, sagte Josy, »schließlich muss man diesen Tag angemessen ausklingen lassen.«
Freda biss sich auf die Lippen. »Na dann, viel Spaß.«
Josy sah sie groß an. »Du bist doch nicht sauer?«
»Ach Quatsch! Ich mache mir einen schönen, ruhigen Abend und gehe früh ins Bett.«
Josy warf ihr einen zweifelnden Blick zu. Dann sagte sie entschlossen: »Also bis morgen, Mama!«
Die Freundinnen verabschiedeten sich, und die drei verließen die Küche. Als sie schon an der Wohnungstür waren, rief Freda: »Josy, vergiss deine Jacke nicht!«
Ihre Tochter antwortete nicht. Die Tür fiel zu, und Freda hörte nur noch das gedämpfte Gelächter der Mädchen.
Sie fuhren zum »Kitchenett«, einer ziemlich angesagten Bar, in die Josy bisher nicht reingekommen war, weil am Eingang die Ausweise kontrollierten wurden. Als sie jetzt mit Lara und Naomi dort ankam, hielt sie dem Türsteher triumphierend ihren Personalausweis unter die Nase und stieg erwartungsvoll die Treppe hinunter. Was wohl an dem Laden so aufregend war, dass sie es mit der Kontrolle so genau nahmen?
Neugierig sah sie sich um. Ach Gott, es gab ein paar Tabletänzerinnen, und die Kellner trugen superenge Lederjeans mit fetten Nietengürteln und diese engen, gerippten Unterhemden. Na, wenn das alles war!
»Wart’s ab«, sagte Naomi, die Josys enttäuschten Gesichtsausdruck bemerkte hatte, »es ist echt cool hier!«
Die Mädchen setzten sich in eine Nische, bestellten Mojitos und malten sich ihre Zukunft aus. Wo sie leben wollten (Spanien, Amerika, Deutschland), wie ihre Männer sein sollten (verständnisvoll, gut aussehend, treu), welche Berufe sie ausüben wollten (Ärztin, Managerin, weiß nicht).
»Wollt ihr eigentlich Kinder?«, fragte Naomi.
»Unbedingt«, sagte Josy.
Lara schüttelte energisch den Kopf. »Auf keinen Fall. Kinder bringen dich um den Schlaf, kosten Geld und ruinieren deine Figur und deine Karriere.«
»Und wenn deine Eltern so gedacht hätten?«, fragte Josy.
»Dann wären sie vielleicht nicht geschieden«, sagte Lara. »Meine Mutter hat uns zuliebe ihren Beruf aufgegeben. Und zum Dank hat mein Vater sie sitzenlassen. Das passiert mir nicht, das kannst du mir glauben.«
Ihre Freundinnen schwiegen betreten.
»Irgendwie muss das doch auch anders gehen«, sagte Josy. »Aber ich hab echt noch keinen Plan.«
»Willst du nicht erstmal die Schule weitermachen?« Naomi sah sie fragend an.
Josy verzog das Gesicht. »Och nee, keinen Bock.«
»Aber du wolltest doch studieren!«
»Muss ich ja nicht«, sagte Josy. »Gibt ’ne Menge Jobs, für die man kein Abi braucht.«
Lara blickte zweifelnd. »Aber die meisten davon willst du nicht machen.«
»Wie wär’s mit … Dompteurin?«, fragte Naomi. »Oder Tierpflegerin?«
Josy schüttelte lachend den Kopf. »Lieber was mit Menschen.«
»Sozialarbeiterin?«
»Polizistin?«
»Politikerin?«
»Ich werde ganz einfach reich und berühmt«, sagte Josy grinsend. »Und dann rette ich die Welt.«
»Super Plan«, sagte Lara und stand auf. »Mädels, seid mir nicht böse, ich bin todmüde.« Sie suchte in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie, legte Geld für ihre Drinks auf den Tisch und verabschiedete sich.
Ein paar Minuten später kamen zwei junge Typen an ihren Tisch, stellten sich mit einer kleinen Verbeugung als Cornelius und Martin vor und fragten, ob sie sich dazusetzen dürften.
Josy und Naomi wechselten einen schnellen Blick, dann nickten sie.
»Bitte«, sagte Naomi und wies auf die zwei freien Plätze, »macht’s euch bequem.«
Josy sah sich den einen, der sich als Cornelius vorgestellt hatte, näher an. Sein halblanges, dunkles Haar fiel ihm lässig ins Gesicht, seine Klamotten waren sicher sauteuer gewesen, aber kein bisschen angeberisch. Er wirkte selbstbewusst, aber nicht arrogant, und sein Lächeln war umwerfend. In Josys Magen kribbelte es. Vielleicht wurde es ja wirklich noch ein cooler Abend.
2
Es war ein frischer Sommermorgen mit klarem, blauem Himmel. Freda genoss den Fahrtwind im Gesicht, als sie mit ihrem Rad die Isar entlangfuhr. Die Kastanien standen in voller Blüte, das Laub der Bäume war von einem satten, intensiven Grün. Das war die Jahreszeit, die sie am meisten liebte; man ahnte die kommende Hitze, aber noch war es angenehm. Abends konnte man an manchen Tagen schon draußen sitzen, und der Winter war weit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!