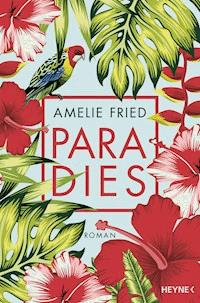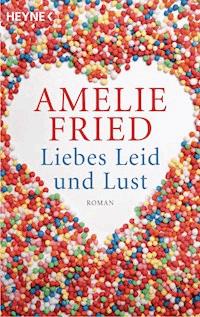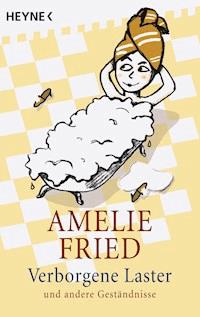6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frauen warten auf Liebe, Männer auf Frauen
Darf man Babys blöd finden? Gibt’s was Peinlicheres als Nordic Walking? Reden Frauen so viel, weil Männer eine geringere Lebenserwartung haben – oder ist es umgekehrt? Geistreich und selbstironisch erzählt die Bestsellerautorin Amelie Fried aus dem Alltag (nicht nur) von Frauen. Dabei erfährt man, warum sie Sehnsucht nach dem wilden Leben hat, tote Skorpione romantisch findet und unbedingt Mitglied im Club der hysterischen Mütter sein möchte. Ein großes Lesevergnügen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Darf man Babys blöd finden? Gibt’s was Peinlicheres als Nordic Walking? Reden Frauen so viel, weil Männer eine geringere Lebenserwartung haben – oder ist es umgekehrt? Geistreich und selbstironisch erzählt die Bestsellerautorin Amelie Fried aus dem Alltag (nicht nur) von Frauen. Dabei erfährt man, warum sie Sehnsucht nach dem wilden Leben hat, tote Skorpione romantisch findet und unbedingt Mitglied im Club der hysterischen Mütter sein möchte. Ein großes Lesevergnügen!
»Amelie Fried schreibt mit einem Augenzwinkern und führt uns viele menschliche Verhaltensweisen vor Augen, die keinem von uns fremd sind.«
Radio ND1
Die Autorin
Amelie Fried, Jahrgang 1958, präsentierte verschiedene TV-Sendungen. Von 1998 bis 2009 war sie Gastgeberin der Talkshow 3 nach 9, und von Juli 2009 bis Dezember 2010 moderierte sie das Literaturmagazin Die Vorleser. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zuletzt erschien bei Heyne ihr Sachbuch Schuhhaus Pallas – Wie meine Familie sich gegen die Nazis wehrte. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.
Als Heyne Taschenbuch liegen bereits folgende Kolumnenbände vor: Geheime Leidenschaften, Verborgene Laster und Offene Geheimnisse.
Inhaltsverzeichnis
DAS LEBEN IST EIN BÜFETT
Schwarzseher und Schönfärber
Ich rechne prinzipiell mit dem Schlimmsten. Das Gute daran ist, dass ich meistens positiv überrascht werde. Schon wenn ich morgens aufwache und feststelle, dass die Welt sich noch dreht, ich am Leben und nicht halbseitig gelähmt oder erblindet bin, freue ich mich. Wenn tagsüber weder das Haus einstürzt noch ein Krieg ausbricht oder die Katze überfahren wird, steigert sich diese Freude unaufhaltsam. Spätestens abends, wenn kein Anruf der Schule eingegangen ist, weil meine Kinder beim Koksen erwischt wurden, und mein Mann zu meiner Überraschung auch noch da ist, halte ich mich für einen absoluten Glückspilz. Ich finde, ich bin ein sehr positiver Mensch, mit dem man gut zusammenleben kann.
Mein Mann findet, ich bin die schlimmste Schwarzseherin auf Erden, und droht in regelmäßigen Abständen damit, mich zu verlassen. Er bezeichnet meine Lebenseinstellung als Pessimismus, ich als Realismus. Tatsächlich bin ich so überzeugt, dass es schlimm kommen, sich verschlechtern und schließlich böse enden wird, dass ich all meine düsteren Voraussagen bezüglich der Zukunft für absolut realistisch halte. Warum ist es denn schwarzseherisch, wenn ich einfach nur beschreibe, wie es aller Wahrscheinlichkeit nach kommen wird?
Mein Mann glaubt daran, dass unsere Gedanken Einfluss auf das haben, was geschieht. Dass die Dinge sich gut entwickeln, wenn wir daran glauben, dass sie das tun. Ich hingegen glaube, dass schiefgehen wird, was schiefgehen kann, und sich die Dinge entwickeln, ohne Rücksicht auf uns und unsere Gedanken zu nehmen.
Natürlich heißt das nicht, dass ich als Realistin die Hände in den Schoß legen und entspannt den nächsten Schicksalsschlag abwarten kann. Ich kann schon einiges dafür tun, dass etwas schiefgeht. Ich muss meiner Tochter nur lange genug einreden, dass sie unbegabt für Mathe ist – irgendwann steht sie auf einer Sechs. Oder mir selbst immer wieder vorsagen, dass ich mit dieser Kollegin einfach nicht zusammenarbeiten kann – irgendwann wird’s zum Knall kommen. Das Tolle ist: Auf diese Weise behalte ich meistens recht!
Aber, Moment mal, wenn das in die negative Richtung funktioniert, müsste es ja in die positive auch funktionieren. Das würde bedeuten, mein Mann hat recht? Nein, das kann nicht sein. Wann hat man jemals davon gehört, dass ein Mann recht hat?
Endlich frei!
Davon haben wir Monate, wenn nicht Jahre geträumt: Mann und Kinder sind weggefahren, zur Oma, zu Freunden oder sonst wohin, ist uns auch völlig egal, wichtig ist nur: Sie sind weg!
Ein ganzes, langes, herrliches Wochenende liegt vor uns, an dem wir es so krachen lassen wollen, dass wir noch lange daran denken werden!
Also: ausschlafen, frühstücken ohne zermürbenden Geschwisterstreit, die Zeitung lesen, bis wir sie auswendig können, mit der besten Freundin telefonieren und eine Verabredung zum Ausgehen für den Abend treffen. Danach ein Körperpflegeprogramm im Gegenwert eines Wellness-Urlaubs und eine Gesichtsmaske, die uns um Jahre verjüngen werden.
Wie heißt es so treffend? Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Bei mir muss Gott sich schlapp gelacht haben. Ich kam genau bis Punkt vier, Anruf bei der Freundin. »Was? Tanzen gehen?«, tönte es lustlos aus dem Telefon. »Ach weißt du, ich habe mich auf einen ruhigen Abend mit Ulf gefreut«.
Alles klar. Im Kopf überschlug ich schnell die Anzahl meiner Freundinnen, die meisten von ihnen hatten einen Ulf. (Glücklicherweise, muss man ja sagen, aber an diesem Tag standen Ulfs meiner Selbstverwirklichung auf dramatische Weise im Wege.) Also, alle aussortiert, die einen Kerl, Kinder oder beides zu Hause sitzen haben, worauf drei potenzielle Kandidatinnen übrig blieben.
Kandidatin eins lag mit Grippe im Bett. Kandidatin zwei packte gerade ihre Reisetasche, um mit ihrem neuen Lover das Wochenende zu verbringen, Kandidatin drei erklärte mir, sie habe genug vom Tanzen, von den Männern und eigentlich vom Leben überhaupt, ob wir uns nicht einfach zusammen »Tatsächlich Liebe« ansehen könnten.
Nichts gegen »Tatsächlich Liebe«, das ist einer meiner Lieblingsfilme, aber deshalb habe ich ihn auch schon ungefähr vierzehn Mal gesehen. Ich vergewisserte mich, dass Kandidatin drei nicht akut selbstmordgefährdet war, dann füllte ich meine Badewanne mit dem Inhalt von zehn Tüten Biomilch und heißem Wasser. Ich legte mich hinein, stellte mir vor, es wäre Eselsmilch, und dachte über mein Leben nach. Hieß das jetzt, dass ich alt war? Hatte ich die falschen Freundinnen? Oder hatte Gott angesichts meines Disco-Plans vor Lachen einen Herzinfarkt erlitten?
Der verjüngende Effekt des Milchbades ließ zu wünschen übrig, dafür roch die Gesichtsmaske nach Fisch und irgendwie sah ich damit auch aus wie einer. Mein Samstag endete allein vor der Glotze. »Tatsächlich Liebe«, zum fünfzehnten Mal. An diesen Abend werde ich noch lange denken.
Bloß nicht ehrlich sein!
Ehrlichkeit ist eine positive Eigenschaft, jedenfalls wenn man keinen Wert darauf legt, Freunde zu haben. Alle loben nämlich die Wahrheit, aber keiner will sie hören. Dabei heißt es immer, echte Freundschaft beruhe auf Ehrlichkeit. Nach meiner Erfahrung ist das dummes Zeug. Immer wenn ich ehrlich bin, bringt mir das nur Ärger ein.
So habe ich einer guten Freundin nach der Trennung von ihrem Mann endlich gestanden, wie unerträglich ich den Kerl immer schon gefunden hatte. Wenig später kamen die zwei wieder zusammen. Und meine Freundin ist leider nicht mehr meine Freundin.
Oder die Sache mit Olga, unserem Au-pair. Stolz zeigte sie mir ihre neuen weißen Pumps und das weiße Handtäschchen. Zu ihrem eigenen Schutz klärte ich Olga auf, dass eine solche Aufmachung hierzulande falsch verstanden werden könnte. Anstatt dankbar für die Warnung zu sein, war sie schwer gekränkt.
Nicht weniger empfindlich reagiert mein Mann, wenn ich gelegentlich erwähne, dass er einen Meter sechsundsiebzig groß sei. Das entspricht der Wahrheit, leider aber nicht seinem Selbstbild. In seiner Vorstellung ist er mindestens einen Meter achtzig, und jeder, der was anderes behauptet, ein mieser Lügner.
In echte Gewissenskonflikte stürzen mich meine Kinder. Einerseits will ich sie zu wahrheitsliebenden Menschen erziehen, andererseits habe ich ihnen beigebracht, dass sie niemanden verletzen dürfen. Leider schließen sich diese beiden Forderungen meistens gegenseitig aus. Soll meine Tochter eine Einladung zum Kindergeburtstag mit der ehrlichen Begründung absagen, sie könne das Geburtstagskind nicht ausstehen? Oder soll sie notlügen, leider müsse sie am Sterbebett ihrer Oma Klavier spielen? Soll ich sie zur sozialen Außenseiterin machen oder zur Schwindlerin? Wie soll man es als Mutter überhaupt richtig machen? Eine einzige Lüge, bei der einen die Kinder ertappen – schon ist die moralische Glaubwürdigkeit dahin.
Bleibt mir nur, wenigstens dann ehrlich zu sein, wenn ich keinen größeren Schaden damit anrichte. Aber kaum nähert sich im Restaurant der Kellner, um zu fragen, wie es geschmeckt hat, trifft mich unter dem Tisch ein gezielter Tritt meines Mannes. Er weiß, dass ich diese Frage wahrheitsgemäß beantworten werde, weil ich auf eine direkte Frage einfach nicht lügen kann. Ich werde also sagen, dass die Soße versalzen und der Salat schlaff war. Und mein Mann wird mich dafür hassen.
Nordic Walking und andere Peinlichkeiten
Ich weiß noch, wie ich mich schlapp gelacht habe, als die ersten Spaziergänger mit Skistöcken in unserer Gegend auftauchten. Was für ein albernes Seniorenvergnügen, dachte ich und joggte lockeren Schrittes an ihnen vorbei. Das ist doch kein Sport! Das ist ja peinlich! Niemals, so schwor ich mir, würde ich mich mit so etwas lächerlich machen.
Nun, inzwischen grabe ich mit meinen Nordic-Walking-Stöcken mehrmals wöchentlich den Waldboden um, immer bestrebt, niemandem zu begegnen, der mich kennt. Ich habe gelesen, dass dabei 90 Prozent aller Muskeln beansprucht werden und Nordic Walking viel wirkungsvoller gegen Cellulite ist als Joggen. Wenn es um Cellulite geht, sind wir Frauen korrupt. Wir schrecken vor keiner Peinlichkeit zurück und würden unsere Seele verkaufen, um sie loszuwerden.
Eine Freundin von mir hat sich ihre Problemzonen mit Stromstößen behandeln lassen. Einziger Effekt: Die Kosmetikerin war um 2000 Euro reicher. Eine andere Freundin sitzt mit Kompressionsmanschetten um die Oberschenkel im Büro und fällt regelmäßig in Ohnmacht, weil ihr Kopf nicht mehr richtig durchblutet wird. Eine dritte reibt Po und Schenkel täglich mit einer ätzenden Salbe ein, die bei einer unvorhergesehenen sexuellen Begegnung in das Auge des Mannes geriet und einen Notfalleinsatz nötig machte, um ihn vor dem Erblinden zu bewahren. (Immerhin hätte er dann bei meiner Freundin bleiben können – die Cellulite hätte ihn nicht mehr gestört!)
Neulich war ich im Kino. Es lief »In den Schuhen meiner Schwester«, ein Film, der im Wesentlichen daraus besteht, dass Cameron Diaz mit ihrem atemberaubenden Fahrgestell in briefmarkengroßen Bikinis durchs Bild schlendert. Mitten im Film brach in der Reihe vor mir eine Frau in Tränen aus und stammelte: »Ich würde zehn Prozent meiner Intelligenz für diese Beine geben!« Ich dachte kurz nach und sagte: »Ich biete zwanzig!«
Na ja, sagen wir mal so: In jungen Jahren hätte ich Intelligenz gegen Schönheit eingetauscht. Der Vorteil des Älterwerdens ist, dass unsere schönen, aber dämlichen Geschlechtsgenossinnen am Ende nur noch dämlich sind. Wir behalten wenigstens unseren Grips!
Lasst mir meine Vorurteile!
Das Komische an Vorurteilen ist, dass sie meistens stimmen. Blöd nur, dass man das nicht laut aussprechen darf. Aber mal ehrlich, würden Sie eine der folgenden Behauptungen ernsthaft bestreiten?
Das englische Essen ist gewöhnungsbedürftig. Die Deutschen bauen gerne Zäune um ihre Gärten und Sandburgen um ihre Strandkörbe. Wenn die Italiener nicht gerade beim Essen sind, reden sie vom Essen. Die Bayern sind maulfaul. Männer denken oft an Sex. Golf spielen ist langweilig.
Ausgerüstet mit solch gängigen Vorurteilen, kommt man in der Welt einfach besser zurecht. Man wundert sich nicht, wenn die Leute in England Lamm mit Pfefferminzsoße, Fisch aus fettigen Papiertüten und klebrigen Pudding essen. Man ist auch nicht überrascht, dass die Italiener sich mit »Ciao, hast du schon gegessen?« begrüßen (was ich persönlich übrigens sehr schätze, weil ich eigentlich immer gerade noch nicht gegessen habe). Am Strand muss man nur Ausschau halten, wo die Sandburgen stehen, um zu wissen, wo man sich nicht dazulegen will. Und natürlich gibt es jede Menge netter Bayern – trotzdem hocken am Stammtisch eines bayerischen Dorfgasthauses gerne mal sechs Männer um sechs Biergläser und schweigen sich so ausdauernd an, dass man sich fragt, ob die menschliche Sprache schon erfunden ist.
Ach ja, die Sache mit dem Sex. Ich bin überzeugt, dass Männer sehr viel an Sex denken – Frauen übrigens auch. Ich glaube außerdem, dass Männer, die vor dem Liebesakt ihre Hosen falten, keine guten Liebhaber sind, genau wie Männer, die ihre Handys in Plastikhüllen stecken. Ich habe ein unausrottbares Vorurteil gegen Tontaubenschützen, und ich stehe dazu, denn wer ein ödes Hobby hat, ist meist ein öder Mensch. Und meine Vorurteile gegen das Golfspiel sind notorisch, obwohl ich noch nie einen Schläger in der Hand hatte. Aber sonst wäre es ja auch kein Vorurteil.
Ich pflege meine Vorurteile, schließlich muss es etwas geben, woran man glaubt. Und ich bin dankbar, dass ich mein Leben nicht mit Hosenfaltern, Tontaubenschützen und Golfspielern teilen muss. Allerdings teile ich es mit Bayern. Aber da sie auf Bayerisch schweigen, macht es mir nichts aus, denn das verstehe ich sowieso nicht.
Pfeifen, Kreischen, In-Ohnmacht-Fallen
Ich schäme mich zwar ein bisschen, aber ich gebe es zu: Im Alter von zehn Jahren schwärmte ich für Heintje, diesen dicklichen holländischen Jungen, der mit durchdringender Stimme »Maaamaaa« schmetterte, bis alle Mütter in Tränen schwammen. Meine nicht, die fand Heintje grässlich und hüllte sich in nachsichtiges Schweigen. Ich klapperte nach der Schule sämtliche Supermärkte meiner Heimatstadt Ulm ab und kaufte Bananen, weil die Firma Chiquita auf die geniale Idee gekommen war, mit jedem Pfund gekaufter Früchte eine Heintje-Plakette aus Blech zu verschenken. Bei uns zu Hause sah es also bald aus wie im Affenhaus, überall Bananen, die langsam verrotteten. Und in meinem Zimmer an der Wand unzählige Heintje-Blechplaketten.
Meine Mutter atmete hörbar auf, als ich Heintje vergaß und begann, für die Beatles zu schwärmen, später für die Rolling Stones und andere Rockbands. Endlich durfte ich zu Live-Konzerten und übte verbissen, auf zwei Fingern zu pfeifen, schaffte es trotzdem nicht und beneidete meine Freundin, die so laut pfeifen konnte, dass allen Umstehenden noch tagelang die Ohren klingelten. Dafür konnte ich Kreischen wie kaum eine Zweite, und einmal (war es bei Ten Years After oder doch bei Santana?) gelang es mir fast, in Ohnmacht zu fallen. Ich stand tagelang für Karten an, reiste den von mir verehrten Bands hinterher und hörte mir Konzerte auch mehrmals an, wenn ich es mir leisten konnte. Ich war wirklich ein absolut qualifizierter, ernsthafter und leidenschaftlicher Fan, und eigentlich bin ich das auch heute noch. Leider aber bin ich nicht mehr zehn, sondern fünfzig, und in diesem Alter ist es mit dem Schwärmen für Stars wie mit bauchfreien T-Shirts: Man kann sich dafür entscheiden, aber es wirkt irgendwie peinlich.
Pfeifen, Kreischen, In-Ohnmacht-Fallen – all das sieht gut aus bei Mädels zwischen dreizehn und – wollen wir großzügig sein – dreiunddreißig. Danach wirkt es ein bisschen so, wie wenn Erwachsene mit kleinen Kindern spielen, sich dabei auf dem Boden rollen und Babysprache sprechen.
Fans ab einem gewissen Alter drücken ihre Verehrung für einen Künstler aus, indem sie absurde Preise für die Konzertkarte bezahlen. 100 Euro für Genesis, 150 für Police, oder 350 für Barbra Streisand. Letztes Jahr war ich mit drei Freundinnen bei Robbie Williams. Die Karten waren so schwer zu kriegen und kosteten so viel, dass wir mindestens das Recht erworben hätten, unsere Unterwäsche auf die Bühne zu werfen oder uns sonst irgendwie danebenzubenehmen. Pfeifen und Kreischen war auf jeden Fall okay. Von Ohnmachten während des Konzerts rät Robbie Williams seinen Fans ab: »Ihr glaubt, ihr kommt hinter die Bühne, und da bin ich. Aber ich muss euch enttäuschen: Da sind nur die Sanitäter!«
Eine meiner Freundinnen schlug vor, ein Schild mit dem Textklassiker »Robbie, ich will ein Kind von dir!« hochzuhalten. Ihre sechzehnjährige Tochter blickte sie mitleidig an und sagte: »Du meinst wohl: ›Ich will ein Enkelkind von dir!‹«
Wir sind dann lieber ohne Schild zum Konzert gegangen.
Zu blöd für diese Welt
Als Kind habe ich gelernt, dass man nicht stiehlt, niemanden betrügt und sich allzeit höflich und rücksichtsvoll verhält.
Offensichtlich hat die Erziehung meiner Eltern mich nicht ausreichend aufs Leben vorbereitet, denn immer wenn ich mich an ihre Regeln halte, komme ich mir vor wie der letzte Depp.
Ich stehe in der U-Bahn auf, um einer alten Dame Platz zu machen – schon lässt sich ein Sechzehnjähriger auf den Sitz fallen und stellt seinen iPod so laut, dass jeder Protest meinerseits ungehört verhallt. Ich zahle meine Rechnungen immer sofort nach Erhalt – muss aber manchmal monatelang warten, bis ein Auftraggeber mein Honorar bezahlt. Es kam auch schon vor, dass ich das Geld für eine Lesung nie gesehen habe, weil die Buchhandlung drei Tage später Insolvenz anmeldete. Obwohl der Buchhändler also längst wusste, dass er mich nicht würde bezahlen können, ließ er mich kalt lächelnd durch die halbe Republik anreisen und mein Programm absolvieren.
Vor vielen Jahren bin ich auf einen Vermieter reingefallen, der mir eine billige Miete anbot, wenn ich die Wohnung beim Einzug gründlich herrichten ließe. Kaum war ich fertig, begann er damit, das Haus durch Terrormaßnahmen aller Art systematisch zu entmieten. Ein Jahr später ergriff ich entnervt die Flucht – und mein Vermieter freute sich über eine generalsanierte Wohnung, die ihn keinen Cent gekostet hatte.
Wenn Sie eine gefälschte Antiquität loswerden wollen, bieten Sie mir das Stück an! Ich nehme es Ihnen sofort ab, denn niemals würde ich glauben, dass Sie mich betrügen wollen. Auch unkündbare Zeitungsabonnements mit einer Laufzeit von 120 Jahren können Sie mir mühelos andrehen, oder Aktien an einem Unternehmen für die Verbesserung der Welt. Da ich selbst nie jemanden absichtlich übers Ohr hauen würde, komme ich einfach nicht auf die Idee, dass jemand so etwas mit mir versuchen könnte. Es ist eindeutig: Ich bin zu blöd für diese Welt.
Mein Mann sagt, meine Vertrauensseligkeit grenze ans Fahrlässige und man müsse mich vor mir selbst schützen. Ich hingegen halte ihn für paranoid, weil er hinter allem und jedem Betrug wittert und den Leuten ständig böse Absichten unterstellt.
Schwer zu sagen, wer von uns beiden der Glücklichere ist. Ich falle ziemlich oft auf die Schnauze, was mein Vertrauen in die Menschen komischerweise kaum erschüttert. Mein Mann behält dagegen häufig recht, was ihn in seinem Misstrauen nur bestärkt.
Ich möchte einfach nicht in einer Welt leben, von der ich annehmen muss, dass sie voller Betrug, Gemeinheit und Rücksichtslosigkeit sei. Lieber kaufe ich hie und da einen gefälschten Jugendstil-Silberleuchter oder abonniere eine Fernsehzeitung für digitale Programme, die ich gar nicht empfangen kann, als meinen Glauben an das Gute zu verlieren. Schließlich ist der Mensch doch im Grunde gut, oder? ODER?
Das Leben ist ein Büfett
Es gibt zu viel von allem. Zu viel Elend, Dummheit und Gier. Zu viele überbezahlte Manager, zu viele Arbeitslose, zu viele Menschen ohne Perspektive. Zu viel sinnloses Zeug zu kaufen, zu viel Abfall, zu viele Abgase. Es herrscht ein Überangebot in allen Bereichen. Mein Handy kann mehr, als ich jemals werde nutzen können, von meinem Computer ganz zu schweigen.
Sogar der Wetterbericht im Fernsehen ist vollkommen übertrieben: Da gibt es Strömungsbilder und Winddiagramme, Live-Berichte vom Brocken im Harz, Bilder von zerzausten Reportern, die in pelzige Riesenmikros sprechen – wofür, zum Teufel, brauche ich das alles? Ich will einfach nur wissen, wie morgen das Wetter wird. Mehr nicht.
Man kommt sich vor wie an einem dieser Riesenfrühstücksbüfetts in großen Hotels. Da kann man zwischen fünf Eierspeisen wählen, zwischen zehn Käse- und zwanzig Brotsorten, und egal, wie viel man gegessen hat, den ganzen Tag über verfolgt einen das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es ist der Überfluss, der ein Gefühl von Mangel erzeugt. Nach dem Shopping-Bummel kann man eigentlich nur unzufrieden sein, denn den drei Teilen, die man erstanden hat, stehen die drei Millionen gegenüber, die man nicht kaufen konnte. Wenn an einem Abend im Fernsehen fünfundzwanzig verschiedene Spielfilme laufen, muss man zwangsläufig das Gefühl bekommen, gerade den falschen zu sehen. Angesichts der Auswahlmöglichkeiten verwendet man einen Großteil seiner Energie für die vielen Entscheidungen, die man täglich treffen muss. Und das erschöpft den Menschen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben: Sogar wenn das Auswählen Spaß macht, ist es eine derartige Belastung fürs Gehirn, dass die Probanden bei anschließenden Leistungstests deutlich schlechter abschneiden als andere, die vorher keine Entscheidungen treffen müssen.
Das Zuviel an Überflüssigem ist auch schuld am Zuwenig des Wesentlichen. Es frisst unsere Energie – und das Wertvollste, was wir haben: unsere Zeit. Bevor wir in den Urlaub fahren, recherchieren wir wochenlang, um nur ja das günstigste Angebot zu finden. Wir verbringen Ewigkeiten damit, unsere zahlreichen technischen Geräte zu programmieren, die uns eigentlich Zeit sparen sollen. Und wie viel Lebenszeit wir Frauen vor dem Kleiderschrank verschwenden, weil wir uns nicht entscheiden können, was wir anziehen wollen – das will ich lieber gar nicht wissen.
Nichts gegen Vielfalt – natürlich ist es schön, dass wir keine Einheitskluft tragen, keine Einheitsgerichte essen und keine Einheitsmeinungen vertreten müssen. Aber wenn das Leben ein Büfett ist, hätte ich lieber weniger Auswahl. Und dafür mehr Zeit zum Genießen.
Das große Kochen
Also, ich sehe nicht gerne zu, wenn andere Sex machen, schließlich macht man schöne Sachen lieber selbst. Genau so geht es mir mit Kochsendungen: Warum soll ich zusehen, wie andere Leckeres kochen und es dann unter »Mmmh!«- und »Wie köstlich!«-Ausrufen vor meinen Augen aufessen, während mir vor der Glotze das Wasser im Mund zusammenläuft?
Für mich sind Kochsendungen nichts anderes als eine Variation der Sexshows, bei denen uns Zuschauern mit dem erhobenen Kochlöffel vorgeführt wird, was wir alle gerne mal probieren würden, uns aber nicht trauen. Und genau wie seit der sexuellen Revolution erotische Flaute in den Betten herrscht, sitzen seit Beginn der großen Kochshow-Welle immer mehr Leute vor dem Fernseher, sehen Profiköchen bei der Zubereitung feiner Speisen zu und fressen dabei Fertiggerichte. Die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen haben sich proportional zur Zunahme von Kochsendungen drastisch verschlechtert; bald werden wir so weit sein, dass es die Gerichte aus dem Fernsehen abgepackt als TV-Dinner zu kaufen gibt – das Mälzer-Sandwich, die Wiener-Pasta, den Linster-Sauerbraten und zum Nachtisch ein bisschen süße Kerner-Creme.
Mir machen Kochsendungen auch aus anderen Gründen schlechte Laune: Wenn auf Sterne-Niveau gekocht wird, ärgere ich mich, dass ich das nicht kann und vermutlich niemals lernen werde. Wenn einer von den Showköchen Kartoffelpüree aus der Tüte anrührt und mir weismachen will, das sei ganz tolles Essen, fühle ich mich veräppelt. Und wenn manche Köche übers Kochen reden, als handelte es sich um die Kunst des Glasharfenspiels, selten und eigentlich nicht zu erlernen, dann bin ich in meiner Hausfrauenehre gekränkt. Schließlich serviere ich meiner Familie seit vielen Jahren täglich ein warmes Essen, und meine Kinder haben glaubhaft versichert, ich sei die beste Köchin der Welt (nach Rosa und Jutta, zwei Freundinnen, die wahrhaft meisterlich kochen).
Meine Empfehlung lautet deshalb: Am besten Selbermachen – beim Kochen wie beim Sex! Viel Spaß!
Weg mit der rosa Brille!
Optimismus ist schön. Das Glas ist halb voll, es wird schon gut gehen, das Leben ist schön. Sorge dich nicht, lebe, denk doch einfach positiv, think pink – wer hört nicht gerne solche Aufmunterungen? Um die Wahrheit zu sagen: Ich.
Diese ganze Positiv-Denkerei geht mir allmählich gehörig auf den Wecker. Selbst bei sintflutartigem Regen darf man nicht mehr »Das Wetter ist aber heute schlecht« sagen – schon kommt irgendein Pink-Thinker und klärt uns darüber auf, dass es gar kein schlechtes Wetter gebe, sondern nur falsche Kleidung, dass die Natur den Regen brauche, und außerdem klinge das Rauschen doch so gemütlich, und morgen scheine bestimmt wieder die Sonne. Nutzt mir wenig, wenn meine Grillparty heute stattfinden sollte.
Kaum äußert man ein zweifelndes »Sicher finde ich wieder keinen Parkplatz«, wird man belehrt, dass man so natürlich in der Tat keinen Parkplatz finden wird. Stattdessen soll man denken: »Sicher finde ich heute sofort einen Parkplatz!« – und schon tut sich angeblich eine Parklücke genau da auf, wo man sie braucht. Niemand konnte mir bislang erklären, woher die Parklücke weiß, was ich denke, und wie sie es schafft, entsprechend ihre Position zu verändern.
Aus sicherer Quelle weiß ich, dass meine Freundin auf der Fahrt in den Urlaub einen Totalschaden hatte, das Hotel laut, das Meer dreckig und das Wetter zwei Wochen lang grauenhaft war. Als ich sie fragte: »Und, wie war euer Urlaub?«, sagte sie: »Super!«
Man kann das liebenswert finden. Sie will niemanden mit ihren Urlaubskatastrophen langweilen. Aber sind wir wirklich schon so weit, dass wir nicht mal mehr zu unseren Freunden ehrlich sein dürfen, nur weil negative Äußerungen so verpönt sind?
Wenn man sich beim Skifahren den Arm gebrochen hat, tröstet einen garantiert jemand mit dem Hinweis, man hätte sich ja auch den Hals brechen können, mithin habe man allen Grund zur Dankbarkeit. Und wenn man vergessen hat, den Lottoschein mit sechs Richtigen abzugeben, muss man sich anhören, dass Geld sowieso nicht glücklich mache. So gesehen darf man sich eigentlich überhaupt nicht mehr schlecht fühlen, denn natürlich kann es immer noch schlimmer kommen.
Ich aber will mich schlecht fühlen dürfen, ich will jammern und mich beklagen, und wenn etwas so richtig beschissen ist, will ich nicht so tun müssen, als wäre es toll. Wie sagte die Mutter in der Kinokomödie »Juno«, als sie von der Schwangerschaft ihrer sechzehnjährigen Tochter erfährt: »Schwanger? Ich hatte gehofft, sie ist nur drogensüchtig!«
Irgendwie sind sie auch beneidenswert, diese unverwüstlichen Optimisten, die noch der schlimmsten Katastrophe etwas Gutes abgewinnen können. So wie bei der Beerdigung, auf der ich neulich war. Da guckte ein Freund des Verstorbenen ins Grab und sagte: »Immerhin liege ich da nicht drin.«
Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Du hast einen schönen Beruf, sagen die Leute zu mir. Schriftstellerin. Da sitzt man bestimmt unter einem Baum und wartet, bis einem was einfällt. Und dann schreibt man los. Und wenn einem nichts mehr einfällt, ist das Buch fertig. Ich gebe zu, so ähnlich habe ich mir das früher auch vorgestellt. Aber es ist ganz anders.
Es beginnt schon mit dem Baum: Der steht im Freien, und da ist es zu hell für den Computer. Also sitze ich – auch bei schönstem Wetter – drinnen am Schreibtisch. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich schreibe. Denn kaum sitze ich, klingelt das Telefon. Kaum habe ich aufgelegt, klingelt der Postbote. Kaum habe ich das Päckchen entgegengenommen, piept der Wäschetrockner. Kaum habe ich die Wäsche ausgeräumt, summt die Waschmaschine. Kaum habe ich die nasse Wäsche in den Trockner gepackt, klingelt wieder das Telefon. Gleich darauf sitze ich im Auto und hole mein Kind aus der Schule ab, weil es sich im Sportunterricht den Knöchel verknackst hat.
Kaum sind wir zu Hause, hat das Kind Hunger. Kaum habe ich ein Mittagessen gemacht, klingelt das Telefon. Dann das Handy. Dann der Getränkemann. Kaum habe ich die Getränkekisten in den Keller geschleppt, kommt der Eismann. Dann kommt die Feuerwehr, weil unser Kater auf einen hohen Baum gestiegen ist und sich nicht mehr runtertraut. Und dann klingelt noch mal der Postbote, der am Morgen einen wichtigen Brief vergessen hat. Kaum ist er weg, ruft mein Kind, weil es Durst hat. Dann schrillt eine Alarmsirene, weil die Abwasserpumpe kaputt ist und der Keller vollläuft. Gleichzeitig klingelt das Telefon. Dann kommt das andere Kind aus der Schule und hat Hunger. Kaum habe ich ein Abendessen gemacht, klingelt wieder das Telefon. Mein Mann kommt nach Hause und fragt, ob ich mit der Arbeit gut vorangekommen sei. Ich überlege, ob ich die Scheidung einreichen soll.
Manche Leute wünschen sich, dass sie nie mehr arbeiten müssen. Ich wünsche mir, dass man mich endlich arbeiten lässt! Ich arbeite gerne! Schriftstellerin zu sein ist schön! Man sitzt unter einem Baum und wartet, bis einem was einfällt. Dann schreibt man los. Und wenn einem nichts mehr einfällt, ist das Buch fertig.
Ach ja, der wichtige Brief: Mein Verleger wüsste gerne, wann das neue Buch fertig sein wird. Das wüsste ich auch gerne.
Was ist eigentlich romantisch?
Wieder mal muss ich feststellen, dass mit meiner genetischen Ausstattung etwas nicht stimmt: Obwohl ich eine Frau bin, fehlt mir das Romantik-Gen. Umfragen im Freundinnenkreis haben ergeben, dass die meisten Frauen die gleichen Sachen romantisch finden: Sonnenuntergang am Strand, Kaminfeuer im Winter, teures Essen bei Kerzenschein und Mozartmusik, unerwartet mitgebrachte Rosensträuße oder Diamantringe.
Ich hingegen glaube: Romantik gibt es nur in unserer Vorstellung, und die ist geprägt von Kinobildern und Werbebotschaften. Das Paar, das bei tropischem Regen Hand in Hand am Strand entlangläuft. Der Junge, der seiner Freundin zum Geburtstag ein Yes-Törtchen mit einer Kerze schenkt. Die Frau, die ihrem Liebsten ein Herz aus Pralinen aufs Bett dekoriert. Solche Szenen werden uns als Romantik verkauft, und wir vergleichen sie mit den Szenen, aus denen unser Leben zusammengesetzt ist. Wenn Ähnlichkeiten entstehen, glauben wir, Romantik zu erleben. Dabei sind die Bilder so abgenutzt, dass wir sie eigentlich anders nennen müssten: Kitsch.
Nichts gegen Sonnenuntergänge und Rosensträuße – beide sind natürlich schön. Aber die Erwartung, dass man bei ihrem Anblick etwas ganz Bestimmtes empfinden soll, ist für mich ein Romantik-Killer. Es ist wie mit erotischen Gefühlen: Auch die stellen sich nur ein, wenn man nicht damit rechnet, nicht darauf wartet, kurz: wenn man von ihnen überrascht wird. Erotik mit Ansage funktioniert nicht. Oder finden Sie es anregend, wenn jemand Sie an all seinen Vorbereitungen (Zähne putzen, einschlägige Körperteile waschen, Bettwäsche wechseln, Kerzen anzünden, Musik auflegen) teilhaben lässt, bevor er Sie aufs Lager zieht?
Deshalb stellen sich auch bei mir keine romantischen Gefühle ein, wenn jemand das Standard-Romantik-Programm (Candle-Light-Dinner, Schmuckschatulle, Stehgeiger) abspult. Je mehr Romantik-Klischees bedient werden, desto misstrauischer macht mich das; ich spüre die Absicht und bin verstimmt. Und wundere mich darüber, wie bereitwillig meine Freundinnen auf solchen Zinnober reinfallen und sich von ihren Typen weismachen lassen, das wäre ganz großes Kino. (Gut, wenn ein Diamantring dabei rausspringt, kann man ja mal großzügig sein. Aber ich stehe nicht auf Brillis, vermutlich ein weiterer Gendefekt.)
Echte Romantik stellt sich unverhofft ein, in Situationen, die man überhaupt nicht mit dem Begriff in Verbindung bringen würde. Zum Beispiel in dieser Strandhütte in Mexiko, als mein Mann den Skorpion erledigte, der es sich in meinem Koffer gemütlich gemacht hatte. Nachdem das Tier tot auf der Machete steckte, erfuhren wir, der Stich dieser Art sei nicht sofort tödlich, erst nach ungefähr zwanzig Minuten – das nächste Krankenhaus sei allerdings vierzig Minuten entfernt. Mein Mann als Lebensretter! Das finde ich romantisch.
Alte Bekannte
Ich weiß, ich komme Ihnen irgendwie bekannt vor, aber Sie wissen gerade nicht, woher Sie mich kennen. Verkaufe ich Ihnen vielleicht morgens die Brötchen? Arbeite ich in Ihrer Firma? Oder haben wir uns auf einer Party getroffen?
»Waren Sie nicht beim Gynäkologen-Kongress in Oldenburg?«, sprach mich kürzlich ein Mann im Flugzeug an. »Klar«, gab ich zurück. »Ihr Vortrag über Papilloma-Viren war wirklich toll!« Er wirkte irritiert, dann lief er rot an. »Ach, jetzt weiß ich, entschuldigen Sie, bitte. Sie sind übrigens viel kleiner als im Fernsehen.«
»Ich weiß«, sagte ich, denn das habe ich schon oft gehört. Ebenso oft wie: »Sie sehen ja viel jünger aus als im Fernsehen«, oder: »Sie sind ja viel netter als im Fernsehen«. Das kränkt mich dann immer etwas; ich finde mich eigentlich auch im Fernsehen ganz nett.
Die Palette zweifelhafter Komplimente lässt sich beliebig fortsetzen. So ließ sich neulich eine Frau meinen neuen Roman signieren und sagte, während ich gerade »Mit herzlichen Grüßen, Ihre Amelie Fried« schrieb, sie schätze mich eigentlich mehr für meine Moderationen. Gleich darauf fragte sie, ob ich eigentlich Familie hätte. Ich würde im Fernsehen so cool wirken, als brauchte ich niemanden, weder Mann noch Kinder. Da war ich wirklich sprachlos, denn tatsächlich bin ich eine derartige Glucke, dass meine Kinder froh sind, wenn ich zwischendurch zum Arbeiten wegfahre.
Auch im Urlaub habe ich reizende Begegnungen mit meinem Publikum. Vor einem antiken Tempel auf Sizilien brüllte eine deutsche Touristin bei meinem Anblick so laut »Dat is ja die Amelie Friiiied!«, dass ich fürchtete, das Bauwerk würde, nachdem es zweieinhalbtausend Jahre gestanden hatte, jetzt einstürzen. Ich wies darauf hin, dass die eigentliche Sehenswürdigkeit an diesem Ort nicht ich, sondern der Tempel sei, was sie nicht daran hinderte, ihre gesamte Reisegruppe auf mich aufmerksam zu machen. Aber so ist das eben mit alten Bekannten, die regelmäßig zu einem ins Wohnzimmer kommen: Man freut sich, sie zu sehen. Und so soll es ja eigentlich auch sein.
Die Kolumnen sind zuerst in der Zeitschrift »Für Sie« erschienen.
Originalausgabe 06/2011
Copyright © 2011 by Amelie Fried
Copyright © 2011 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-06454-9
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe