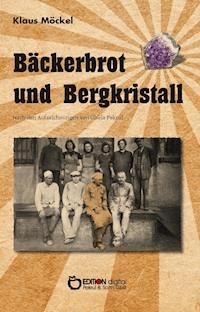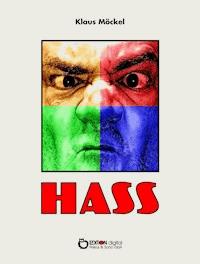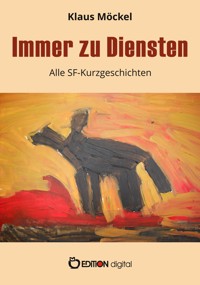
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Flusspferde eingetroffen“, Immer zu Diensten“, „Kreation Zweidrei“ – in Möckels umfangreichem Werk nehmen SF-Kurzgeschichten nur knappe 200 Seiten, dessen ungeachtet aber einen markanten Platz ein. Mit überraschenden Einfällen, erstaunlichem Weitblick, genauer Sprache und hintergründigem Humor werden Vergangenheit und Zukunft ins Bild gebracht, präsentieren sich dem Leser „Gäste aus dem All“, fantastische Apparaturen und Gestalten. Da gerät ein Junge ins schillernde Innere einer Glaskugel, wird ein Mann vom Pferd Pegasus in die Wirren griechischer Mythologie entführt, landen Außerirdische in einer höchst merkwürdigen Verkleidung auf der Erde, pendeln Menschen wie du und ich zwischen Spiegelwelten. Der Autor bietet spannende, unterhaltsame Kost. Scharfzüngig oder auch amüsant werden Bösewichte, Besserwisser, Falschspieler aufs Korn genommen, Wahrheiten pointiert ans Licht gebracht. Auf unerwartete Weise kippt immer wieder das Geschehen, überrascht Möckel den Leser mit unverhofften Pointen. Neben der Fülle von Ideen ist in diesem Band besonders zu erwähnen, dass hier alle bisher verfassten SF-Kurzgeschichten des Autors vereinigt sind. Zusätzlich gibt es aus seiner Feder einige Roboter/KI-Sprüche, zwei Gedichte und zwei knapp gefasste Essays zur phantastischen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Immer zu Diensten
Alle SF-Kurzgeschichten
ISBN 978-3-68912-086-3 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-979-3 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Motivs von Dan Möckel
Das gedruckte Buch erscheint zeitgleich bei
EDITION digital, Imprint des Geschichtlichen Büchertisches Ralf G. Jordan, Bad Salzdetfurt.
© 2024 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Zukunftsblicke
Hundert Zeilen zur SF(anstelle eines Vorworts)
Gegenwart dort finden, wo sie am fernsten scheint, Leben sprudeln lassen, wo alles mit der Herrschaft nüchterner Technik rechnet, Zeiten und Räume durcheilen, um besser über das Jetzt und Hier nachdenken zu können, Spannung ins Alltägliche bringen, mit Witz über ernste Dinge reden … Die Phantastik (die wissenschaftliche und die märchenhaft-allegorische) vermag Ungewöhnliches. In meinem kleinen Roman Die Einladung irrt sich ein Computer, der einen Schriftsteller unseres Jahrhunderts in die Zukunft einzuladen hat, um drei Jahre und schafft damit Verwicklungen, auf die ich bei realem Verlauf der Dinge nie hätte hoffen können. Begegnungen des Helden nicht nur mit Zukunft und Vergangenheit, sondern auch mit sich selbst werden möglich, die normalerweise schlicht unterbleiben müssten. Und mit ihnen eine besondere Chance, der eigenen Zeit unter den Mantel, sich aber ins Herz und bisweilen auch auf die Finger zu schauen.
Ich will gestehen, dass mich an der Phantastik vor allem das geistige Abenteuer reizt. Die philosophische Idee, die Variante eines Gedankens, den ich so noch nicht im Kopf hatte. Ich wünsche ihn mir nicht fleischlos, sondern mit Leben ausgestattet, das heißt, Literatur geworden. Schön, wenn er mit Humor gewürzt ist, mit freundlich pikantem oder solchem, der im Rachen kratzt, doch ist er mir auch ernst willkommen. Erschütternd und warnend, taub gewordene Gewohnheit zerstörend. Ich mag ihn voll herber wie weicher Poesie. Zweitrangig ist, ob er auf einem fernen Planeten oder auf der Erde, in einer künftigen, vergangenen oder parallelen Welt Gestalt annimmt. Er soll den Verstand bewegen helfen, in eine Richtung, die dem Menschen gut tut.
Dabei fühle ich mich dem Italiener Calvino verbunden, der in seinem Ritter, den es nicht gab eine Rüstung ohne Körper in den Kampf schickt, damit das Prinzip seelenloser Ordnungsfanatik und Machtausübung bloßstellend, oder im Geteilten Visconte die gute bzw. böse Hälfte eines auseinandergehackten Adligen auf die Umwelt loslässt, so die Extreme verwerfend und auf die Zusammengehörigkeit entgegengesetzter Eigenschaften pochend. Gewiss, das ist Fiktion und keine Science Fiction, es hat nichts mit Raumfahrern und Zeitmaschinen zu tun. Dennoch ist es – die technischen Belange beiseite gelassen – vom gleichen Stamm.
Der Name Calvino steht für viele; ich nenne willkürlich einige Große der Literatur: Kafka, Aymé, Bulgakow, Mary Shelley. Wie sie kann der fabulierbegabte Schriftsteller, die Effekte des im Realen nicht Möglichen nutzend, mit Kunst unterhalten, Unterhaltung zur Kunst erheben. Und weshalb nicht – wie es die SF, diese spezielle Variante des Phantastischen erlaubt – das geistige Abenteuer in den Weltraum oder ins dritte Jahrtausend verlegen? Der Vorzug des Genres besteht ja in seiner Ungebundenheit. Man kann in die Galaxien fliegen, soweit der Gedanke reicht, und doch auf der Erde bleiben. Man kann sich ins Labor eines Chemikers beamen und, ohne den Raum zu verlassen, in fernste Fernen schweifen. Dabei stehen dem SF-Autor Technik und Naturwissen zur Seite. Was ihm allerdings Mühen auferlegt, die sich der bloße Fantasy-Schreiber nicht macht. Zwar ist das Hauptinstrumentarium der Raum- und Zeitenfahrer: die Roboter, Kyber und Elektronikhirne – längst Gemeingut, aber wer seine arglistig ertüftelte Geschichte etwas windsicherer befestigen will, benötigt genauere Kenntnisse. Fein heraus ist der schreibende Genetiker, Elektroniker, Physiker, da er die Zutaten bereit hat. Er muss sich freilich vor dem zu direkten Umgang mit dem toten Material hüten. Die Literatur verlangt nach lebenden Menschen und nach Konflikten, die man nicht mit dem letzten Wort der Erzählung (oder noch eher) vergisst.
Ich ziehe vor allen modernen Jules Vernes den Hut und bekenne zugleich mein Unbehagen bei der Lektüre solcher Zukunfts- oder Raumfahrerromane, die unter Verwendung raffiniertester Technik lediglich äußere Spannung hervorbringen. Wenn überhaupt. Die mit bunter Staffage um blasse Überlegungen winken. Zaubertricks sind nur reizvoll, wenn sie nicht Selbstzweck werden, und das Brimborium macht keineswegs den Meister. Sicherlich wäre es Illusion, von jedem SF-Text eine tiefschürfende Idee zu erwarten, den großen Entwurf kommender Entwicklungen. Aber einen Funken Originalität, einen Stachel, der die Oberfläche durchstößt, sollte er haben. Und nach wie vor scheint mir in dieser Literatur auch ein Versuch über die Zukunft angebracht.
Es war der Gegenentwurf zu misslichen Zuständen, der in vergangenen Jahrhunderten Utopia, das Reich Nirgendwo, entstehen ließ. Werner Krauss, der bekannte Romanist, schilderte 1962 in einem fundierten Essay den Zickzackflug dieser Fiktion durch die Geschichte und kam zum Ergebnis: der utopischen Literatur könne trotz ihrer Beliebtheit keine günstige Prognose gestellt werden. Beweis waren ihm die realen Möglichkeiten unserer Gesellschaft. „Die Perspektive unentwegter Hoffnung“, schrieb er, „wird allein von einer unveränderlichen und unerfüllbaren Welt angesprochen. Unsere Erwartung einer besseren Zukunft ist in der machtvollen Bewegung unserer eigenen Gegenwart hinlänglich gesichert.“
Doch so logisch diese Folgerung scheint, es bleibt genügend Raum für Fragen. Wenigstens solange die gesellschaftliche Zweiteilung der Welt fortdauert, werden wir weiter um die Zukunft bangen müssen. Raketentod, Umweltzerstörung, Machtmissbrauch geben der Warnliteratur, der SF-Satire und auch dem Wunschbild eines Lebens ohne solche Gefahren ihre Berechtigung. Als Schreibender darf ich mich heute von dieser, morgen von jener Vorstellung anregen lassen. Nicht von einer antihumanen, das steht vor der Klammer, und nicht, um Voraussagen zu treffen. Um Künftiges mitzudenken!! Ich darf die Jetztzeit mit dem Vorgestern, den auf seine Normalität bedachten Bürger mit dem Spinnenmenschen von der Kassiopeia schrecken, wichtig sind nicht die sechs Beine, wichtig ist es, die Selbstzufriedenen wachzurütteln. Durch den amüsanten oder unerhörten Vergleich eine Sicht zu ermöglichen, die hier und da vielleicht zur fortwirkenden Einsicht verhilft.
Erstveröffentlichung 1984
Es gibt Leute, die leben in der Vergangenheit, ohne je von einem Zeitenfahrzeug gehört zu haben.
Anruf
Erhabener Geist der Phantastik,
schick mir ein Stück Zukunft ins Haus.
Vom Wissen der Gegenwart bin ich umgeben,
ich möchte die Klugheit von morgen erleben,
ich kenne den Kreis, ich such die Ellipse.
Erhabener Geist der Phantastik,
schick mir ein Stück Kosmos ins Haus.
Von schläfernder Nähe bin ich umgeben,
ich möchte die grenzfreie Ferne erleben,
ich kenne den Steinwurf, ich suche den Flug.
Erhabener Geist der Phantastik,
ich rufe dich an
aus dem Schallraum der Glocke.
Du gibst mir den Ton,
ich durchdringe den Mantel.
Ich breite mich aus in gewaltiger Welle.
Ich schlage den Pfad in die Nacht der Gestirne,
ich breche das Dunkel, ich greif nach dem Leben,
dem künftigen, vagen, dem unentdeckten,
dem noch nicht erprobten,
dem schwach nur erdachten,
dem harten, dem groben, dem traurigen, hellen,
das immer gefährdet ist, gleichwohl errettbar.
Und treibt mich zurück die verebbende Woge
zum trockenen Ufer,
so bleibt mir im Mund
Geschmack der unendlichen Möglichkeiten.
1985
Die Außerirdischen
Eines Tages, die Menschheit war trotz allen Geredes über UFOs und das Leben auf fremden Planeten im Grunde nicht auf eine solche Begegnung vorbereitet, landeten in Cap Canaveral Außerirdische.
Es geschah völlig überraschend. Signale der Annäherung eines unbekannten Raumfahrzeugs waren erst wenige Tage vor der Ankunft registriert und zunächst noch nicht einmal ernst genommen worden. Dann, als das Unglaubliche, noch nie Dagewesene immer wahrscheinlicher wurde, stellte man auf die Schnelle ein Begrüßungskomitee zusammen. Die berühmtesten Politiker und Gelehrten der führenden Industrienationen waren darin vertreten, daneben ein paar Diplomaten kleinerer Länder und last but not least zwei SF-Autoren.
Zugleich wurden allerlei Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Während man weniger an eine eventuell notwendige medizinische Hilfe dachte, galt der Abwehr hinterhältiger Viren und Bakterien größte Aufmerksamkeit. Vor allem aber wurde das atomare und sonstige Potential in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Man war zwar gewillt, die Abgesandten einer fremden Zivilisation herzlich und freundschaftlich zu empfangen, musste aber auch gegen jegliche Gefahr gewappnet sein.
Als das Raumschiff dann, von Licht- und Funksignalen geleitet, tatsächlich landete, hatten sich weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft eingefunden. Außerdem natürlich Medienvertreter aus aller Welt. Obwohl man versucht hatte, die Nachricht von der Ankunft der Fremden geheimzuhalten, hatte sie sich wie ein Lauffeuer verbreitet und eine unübersehbare Menschenschar angelockt. Sie war nur mühsam durch Bereitschaftspolizei und Absperrungen im Zaum zu halten.
Das Raumschiff selbst hatte etwas Vertrautes an sich. Es glich zwar genauso wenig den amerikanischen Space Shuttles wie den russischen Kosmonautenkapseln, hätte aber ohne weiteres in einen Science-Fiction-Streifen der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts gepasst. Niemanden hätte es deshalb überrascht, wenn ein Herkules mit kupfernem Stirnband, eine gut gebaute junge Dame in eng anliegendem Glitzeranzug der sich öffnenden Luke entstiegen wäre. Doch diese Vorstellungen erfüllten sich nicht. Wie erstaunt war die in Ehrfurcht und Neugier erstarrte Menge, als dem Gleiter lediglich einige in hauchdünne Skaphander gehüllte Tiere entstiegen.
Doch damit nicht genug. Wenn man die Körperformen, die Köpfe mit den langen Ohren, die Hufe und Schwänze der Tiere betrachtete, waren es sogar eindeutig Esel.
Man kann sich die Verblüffung der Menge und des Empfangskomitees vorstellen. Ein Raunen erhob sich und erfüllte das Rund. Mancher der Politiker oder Wissenschaftler musste all seinen Anstand bemühen, um nicht in ein völlig unangebrachtes, unhöfliches Grinsen oder gar in Gelächter auszubrechen.
Das Erstaunen wurde jedoch sofort durch ein noch größeres abgelöst, das diesmal sehr positiv war. Die Esel, zunächst auf räumlichen Abstand bedacht, machten sich nämlich über eine Art Mobilfunk sehr gut verständlich. Sie sprachen ein Kauderwelsch aus Englisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch, in das sich sogar ein paar deutsche Brocken mischten. Mit Hilfe von Dolmetschern konnte man ohne weiteres Kontakt zu ihnen aufnehmen.
Zur allgemeinen Erleichterung verhielten sich die Tiere auch durchaus vernünftig. Sie erklärten, sie kämen in friedlicher Absicht, waren mit einer Quarantäne einverstanden und zeigten sich insgesamt als aufgeschlossene humane Wesen, wenn man das bei Eseln einmal so nennen darf.
Eine äußerst aufregende Zeit begann für alle Beteiligten. Konferenzen wurden durchgeführt, die Gäste besichtigten Betriebe und Einrichtungen jedmöglicher Art, informierten sich über die verschiedensten Wissensgebiete, besuchten die schönsten und auch einige unwirtliche Landstriche der Erde. Dabei hatte ein Planungsbüro sorgsam darauf zu achten, dass die Vierbeiner keine Zoos oder gar Schlachthöfe zu Gesicht bekamen, nicht zufällig von grausamen Tiertransporten hörten. Überhaupt vermied man alles, was das Verhältnis zwischen Mensch und Tier berührte. Die Gäste selbst (die nebenbei gesagt, kein Heu oder Gras fraßen, sondern nur Tubennahrung zu sich nahmen) hielten sich in dieser Hinsicht übrigens zurück, berichteten mehr allgemein von ihrer fernen Galaxis und der weiten Reise, die sie hinter sich hatten.
Fast hatten sich die Erdenbewohner an das sonderbare Aussehen der Fremden gewöhnt, als die Wissenschaftler eine eigenartige Entdeckung machten. Anhand von mitgebrachten Aufnahmen aus der Heimat der Außerirdischen mussten sie erkennen, dass diese zu Hause offenbar nicht als Vierbeiner herumliefen. Vielmehr waren sie durchaus von menschenähnlicher Gestalt. Niemand konnte sich diese Tatsache erklären.
Nach einigem Zögern fasste sich einer der Begleiter ein Herz und fragte die Gäste nach den Gründen für ihr derzeit so ganz anderes Aussehen.
Die Antwort war ein langes verlegenes Schweigen. Endlich raffte sich eins der Tiere auf und erwiderte: „Nun ja, uns ist da ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Wir haben uns, bevor wir zu unserer Weltraumreise aufbrachen, natürlich über die verschiedenen Planeten informiert. Leider konnten wir nicht viel über die Erde erfahren. Die Computer sagten uns lediglich, dass dort sehr sonderbare Wesen leben müssten. Sie würden ihren Himmelskörper, der ihnen als einziger in ihrer Galaxis die Bedingungen für menschliches Leben gewährte, wider besseres Wissen in rasendem Tempo selbst zerstören. Sie würden Landschaften vernichten, die Luft verpesten, schreckliche Kriege führen und überhaupt alles tun, um künftigen Generationen eine Existenz unmöglich zu machen. Mit einem Wort, sie wären rechte Esel, denn nur so könne ihr Verhalten erklärt werden. Um es anschaulich zu machen, entwarfen die Computer dann ein Bild von diesen Tieren. Wolle man sich mit ihnen verständigen, meinten sie, wäre es wohl das Beste, auf der Erde die Gestalt solcher Vierbeiner anzunehmen.
Unser Fehler, genauer gesagt der unserer Forschungscomputer bestand also darin, dass sie diese unglaubliche Verhaltensweise den echten Eseln zuschrieben, Tieren, die völlig schuldlos daran sind. Wie hätten wir aber auch – verzeihen Sie – annehmen können, dass die Menschen hier so etwas Dummes, Zerstörerisches, Verbohrtes tun.
Und der Gast schloss höflich mit den Worten: „Bitte verübeln Sie uns die Offenheit nicht, wir wissen ja alle: Die Wahrheit tut oft weh. Nehmen Sie aber gleichzeitig freundlichst zur Kenntnis, dass wir uns hiermit aufrichtig bei allen echten Eseln auf der Erde für diese Verwechslung entschuldigen.
Erstveröffentlichung 1995
Obwohl sie mit LICHT-Geschwindigkeit flogen, wurde es nicht heller in ihren Köpfen.
Das Märchen vom Träumen
Annasibyll nahm die Antitraumpille nicht! Es war verrückt und unerhört, oder genauer: ungehörig.
Hansana wusste es von Sonja-Lu, Sonja-Lu hatte es von Zelia, Zelia war mit Annasibyll, wenn nicht befreundet, so doch näher bekannt.
Nun ja, Annasibyll hatte schon immer ihre Eigenheiten gehabt. Ein Mädchen, das stets alles besser wissen wollte, eine junge Frau, der die Männer durchweg zu trocken erschienen und die deshalb allein blieb – aber nun das?
Jeder im Land Praktika wusste doch, was Träume waren: ein schädlicher, böser Firlefanz, der von der Arbeit abhielt und die Sitten verdarb. Er störte den Schlaf und lenkte das Denken in eine falsche Richtung, er verwandelte die Realität in ein unübersichtliches Durcheinander.
„Sie wird schon sehen, was sie davon hat“, sagte Hansana, „in den Büchern steht, dass man vom Träumen hässlich wird. Man kriegt die Krätze davon oder verliert die Haare. Es stellt sich nur nicht gleich heraus.“
„Mein Bruder hat mir erzählt, dass Träume geistig verwirren“, äußerte sich Sonja-lu,
„Mein Mann kennt einen, der die Pille vergaß und solche Nervenschmerzen bekam, dass er noch heute mit den Gelenken zittert, wenn er daran zurückdenkt.“
„Wie furchtbar“, seufzte Zelia, „da werden schon die Babys an die Antipille gewöhnt, im Kindergarten und in der Schule malt man die Gefahren des Träumens aufs schrecklichste aus, und dennoch gibt es solche Fälle. Und ausgerechnet Annasibyll.“
„Ich kann nur hoffen, dass sie sich bald besinnt.“
„Es ist einfach nicht zu glauben“, sagte Hansana. „Als wenn sie noch im zwanzigsten Jahrhundert lebte. Aber ich weiß schon, woran es liegt. Sie hat keinen Mann, keine Kinder, keine Pflichten. Sie ist nicht wie wir.“
„Leider gibt es das“, murmelte Sonja-Lu.
„Träumt sie denn nun?”, fragte Hansana mit betont gleichgültiger Stimme.
„Wie sie behauptet, ja”, erwiderte Zelia.
„Und was träumt sie?“, wollte Sonja-Lu, dem Schein nach uninteressiert, wissen.
„Das hat sie mir nicht gesagt“, antwortete Zelia.
„Nicht“, sagten Hansana und Sonja-Lu gleichzeitig, und Hansana fügte hinzu: „Ist ja auch egal. Es wird sowieso unsinniges Zeug sein.“
Aber dann sickerte doch einiges von den Träumen bis zu den drei Freundinnen durch. Annasibyll schien kein Geheimnis daraus machen zu wollen. Ob sie nicht merkte, wie albern ihre Geschichten waren?
Und dafür setzte sie nun alles aufs Spiel.
„Sie behauptet, sie habe von einem Schiff geträumt“, berichtete Zelia. „Von Wasser und einem Schiff. Die Sonne habe geschienen, und überhaupt sei herrliches Wetter gewesen.“
„Wenn ich Schiffe sehen will, brauche ich nur zum Hafen zu gehen“, erwiderte Hansana geringschätzig. „Wasser gibt’s da auch genug.“
Sonja-Lu zuckte die Achseln. „Was heißt Sonnenschein und herrliches Wetter. Mal gibt’s solche, mal solche Tage. Dazu braucht man keinen Traum.“
„Und was war das für ein Schiff?“, fragte Hansana. „Hatte es Maschinen geladen oder Lebensmittel? Blaue Venusrüben vielleicht? Die habe ich eine Ewigkeit nicht mehr zu kaufen gekriegt.“
„Nichts von alledem. Das ist ja das Eigenartige. Annasibyll meint …“
„Eins von den Superfahrgastschiffen wird sie in ihrem Traum gesehen haben“, unterbrach sie Sonja-Lu. „Die sind jetzt der letzte Schrei. Haben ein gewaltiges Fassungsvermögen.“
„Nein“, sagte Zelia, „nicht so etwas Bekanntes. In alten Büchern hab ich nachgeblättert, um dieses sonderbare Wort zu finden. Sie hat von einem Segelschiff geträumt.“
„Ein Segelschiff? Was soll das sein?“
„So ein Kahn ohne Atomantrieb. An Masten sind Stoffsegel aufgespannt, in die der Wind bläst. Annasibyll erzählte, dass dieses Schiff sanft übers Wasser glitt. Sie war ganz allein auf dem Kahn und nur im Badeanzug.“
„Allein und im Badeanzug“, murmelte Hansana, „so ein Unsinn. Zu welchem Zweck, frag ich dich. Man fährt auf Schiffen, um zu einem bestimmten Ort zu gelangen. Zusammen mit vielen Leuten. Um etwas zu befördern oder jemanden zu besuchen. Das weiß in Praktika jedes Kind.“
„Sie behauptet, dass sie einfach so dahinfuhr und dass es angenehm war, ihr sei leicht und wohlig gewesen. Das mache eben der Traum, erklärt sie.“
„Was der Traum wirklich macht, wird sie merken, wenn’s zu spät ist“, sagte Sonja-Lu.
„Dann hat sie auch noch vom Fliegen geträumt“, berichtete Zelia weiter. „Sie sei bis hoch in die Wolken gestiegen. Es sei wunderbar gewesen.“
„Sie soll nicht so übertreiben“, erwiderte Hansana. „Hoch in die Wolken steigt mein Mann immer, wenn er in die Hauptstadt reist. Mit der Schnellen Rakete, was ist schon dabei. Ich hab’s vor kurzem selbst erlebt, man setzt sich in einen Sessel und starrt die Lehne des Vordermanns an. Hoch geht’s und runter in zehn Minuten. Manchen wird beim Start oder bei der Landung übel. Da ist nichts Wunderbares.“
„Sie behauptet aber, dass sie ohne die Schnelle Rakete fliegt. Einfach mit ausgebreiteten Armen. Manchmal müsse sie mit den Beinen strampeln, um nicht abzusinken. Der Wind sei um sie, die Wolken und die Sonne. Es sei sehr schön.“
„Mit den Beinen strampeln – wie albern“, bemerkte Sonja-Lu. „Was soll daran schön sein. Mein Mann würde mir was flüstern, wenn ich mit den Beinen strampelnd in der Luft herumfuhrwerkte.“
„Sie erzählt, dass sie auf ihren Flügen manchmal einen Mann träfe“, berichtete Zelia. „Er schwebe durch die Luft oder sei einfach da. Er sei jung, groß und stets lustig.“
„Ein Mann – da sieht man, worauf die Sache hinaus will“, sagte Hansana. „Die üblichen Geschichten von Frauen, denen keiner gut genug ist und die vorgeben, sie kämen allein zurecht. Träume, dass ich nicht lache. Zum Glück haben wir das nicht nötig.“
„Jung soll er sein – wie jung denn?“, fragte Sonja-Lu. „Immerhin ist sie wie wir Mitte Dreißig. Mein Mann ist fünfundvierzig, wie sich’s gehört. Ernst und arbeitsam. Der schwebt nicht in der Luft.“
„Soll ich nun weitererzählen oder nicht?“, fragte Zelia.
„Ich kann mir schon denken, was da noch kommt.“
„Ich auch, ich weiß Bescheid.“
„Dann kann ich’s ja lassen.“
„Dir scheinen diese … diese Träume direkt Spaß zu machen“, sagte Hansana vorwurfsvoll.
Zelia schwieg beleidigt, und erst als Sonja-Lu sie aufforderte: „Nun red schon weiter, war nicht so gemeint“, entschloss sie sich.
„Der Mann in Annasibylls Traum ist angeblich sehr stark. Sie behauptet, er trüge sie manchmal auf den Händen.“
„Wozu das?“, fragte Hansana erstaunt. „Ist sie krank in ihren Träumen? Kann er seine Kraft nicht für wesentlichere Dinge aufsparen?“
„Sie meint, es sei sehr angenehm, sich an ihn zu schmiegen, sich umarmen zu lassen. Sie laufen auch zusammen über die Wolken und spielen Fangen.“
„Kindereien.“
„Der Mann in Annasibylls Traum kommt mitunter auch auf ihr Segelschiff“, fuhr Zelia fort. „Dann trägt er nur eine Badehose, und manchmal …“
„Manchmal?“, fragte Sonja-Lu in leicht drohendem Ton.
„Manchmal – behauptet sie – sei er … also na ja … sogar ganz nackt.“
„Da haben wir’s“, sagte Hansana befriedigt, „genau, was zu erwarten war.“
„Ein junger Mann, lustig und nackt“, ergänzte Sonja-Lu voller Abscheu, „das ist die Höhe.“
Zelia schwieg eingeschüchtert, aber sie hatte so was wie Sehnsucht im Blick.
Das Land Praktika war, wie schon der Name sagt, durch und durch praktisch eingerichtet. Die Straßen waren alle glatt und gerade, die Wohnungen boten genauso viel Raum, wie die Bewohner brauchten, es gab das zu kaufen, was benötigt wurde. Nicht mehr, nicht weniger, wozu auch? Die Beförderungsmittel waren schnell und funktionierten ohne Pannen; Regen, Sonne, Wind, Schnee gab es in den richtigen Proportionen. Das große Gesetz, nach dem sich alles bewegte, hieß: zweckmäßig. Der Mann bekam eine Frau, wenn es zweckmäßig war, dass Kinder gezeugt wurden, die Frau einen Mann aus demselben Grund. Klar, dass im Land Praktika kein Platz für Fantasterei blieb. Die Maler gestalteten die Landschaft in großer Genauigkeit nach, die Schriftsteller schrieben nur Reportagen. Übrigens war das Fotoplastieren die am höchsten geschätzte Kunst. Die Technik war dagegen allgemein geachtet und sehr weit entwickelt. Alles, was zähl- oder berechenbar war, wurde nachdrücklich gefördert. Unter diesen Bedingungen kann es nicht verwundern, dass den Träumen schon vor langer Zeit der Prozess gemacht worden war. Verurteilt, verbannt und geächtet. Ein Überbleibsel der Vergangenheit, ein überflüssiges Relikt. Die Menschen brauchten sie nicht, man lebte ohne sie ruhiger. Ein gesetzliches Verbot war übrigens nicht nötig, die von alters her überlieferten Warnungen reichten aus. Natürlich kam es einmal vor, dass einer die Antipille vergaß. Aber da sich alle gegenseitig daran erinnerten, passierte das nur selten. Beim ersten Anzeichen eines Traumes wurden die Sünder ohnehin von Furcht und Reue gepackt. Nein, es bestand keine Gefahr, dass die Menschen von den bewährten Prinzipien abwichen. Doch nun, mit einem Mal, diese Annasibyll.
Annasibyll erzählte immer neue Einzelheiten über ihre Segelschifffahrten, ihre Flugerlebnisse und den starken, lustigen, nackten Mann. Hansana und Sonja-Lu verstopften sich die Ohren vor ihren Geschichten, doch Zelia kam mehr und mehr durcheinander. Gewiss, sie hatte zwei noch kleine Kinder, um die sie sich kümmern musste, gewiss, sie hatte einen Mann, mit dem sie abends vor dem Plastiktelevisor saß, aber was sie von Annasibyll hörte, war doch sehr aufregend. Was fühlte man, wenn man mit einem lustigen Mann durch die Lüfte schwebte, wenn man sich von ihm streicheln ließ und mit ihm auf den weichen Wolken lag, nicht unbedingt zum Zwecke des Kinderzeugens. Zelias Mann war alt, klein und glatzköpfig, gern hätte sie auch mal einen mit vollem schwarzem Haar kennengelernt. Einen, der zärtlich war, wie sich Annasibyll ausdrückte. Zelia konnte sich nichts Genaues darunter vorstellen.
Eines Tages, als Zelia mit der Familie beim Abendbrot saß, ließ sie ihre Antitraumpille statt ins eigene Mineralteeglas in das ihres Mannes fallen. Auf einen festen, traumlosen Schlaf, mein prosaischer Lebensgefährte. Doppelt hält besser!
Der Mann merkte nichts – am nächsten Tag fiel allgemein positiv sein besonderer Ernst, seine große Nüchternheit auf. Was dagegen Zelia anging, so schlief sie in dieser Nacht sehr unruhig. Als der Morgen kam, wachte sie schweißgebadet auf, hatte aber nichts geträumt. Sie war ein wenig enttäuscht. Dennoch wiederholte sie abends die Handlung vom Vortag.
In der zweiten Nacht wälzte sich Zelia erneut im Bett hin und her, gleichzeitig aber begann sich ihr Schlaf mit sonderbaren Schemen zu füllen. Das waren weder Segelschiffe noch Wolken, es waren Wesen mit unförmigen Köpfen, die an ihr herumzerrten. Sie hatten die Gesichter ihrer früheren Schullehrer und redeten ununterbrochen auf sie ein. Zelia konnte nur nicht verstehen, was sie sagten. Später stand die junge Frau dann auf einem leeren Schulhof, und die Gestalten bewarfen sie mit Steinen. Doch es waren keine Steine, sondern mächtige runde Pillen. Antitraumpillen. Zelia bekam einen Schreck und erwachte.
An diesem Tag fiel die Ernsthaftigkeit ihres Mannes noch positiver auf – sie selbst jedoch fühlte sich sehr elend. Trotzdem verzichtete sie erneut auf die Pille. Sie nahm sich fest vor, von einem jungen, nackten Mann zu träumen. Und tatsächlich, sie hatte Erfolg. Großen Erfolg – gleich zwei nackte Männer begegneten ihr. Wenn auch nicht auf einem Segelschiff und nicht in den Wolken, so doch im leeren Hof ihrer Schule.
Na immerhin! Zelia ging auf die Männer zu, um sie zu begrüßen und sich streicheln zu lassen. Da jedoch waren es plötzlich gar keine Männer mehr. Es waren alte, ausgetrocknete Frauen, zottlig und müde, und als Zelia genau hinsah, hatten sie große Ähnlichkeit mit ihren Freundinnen Hansana und Sonja-Lu.
An diesem dritten Tag fühlte sich Zelia im Gegensatz zu ihrem glatzköpfigen Mann noch verwirrter als an den vorherigen, und sobald sie eine Minute frei hatte, lief sie zu Annasibyll. Aber Annasibyll war nicht zu Hause, Zelia traf lediglich ihre Mutter an.
„Annasibyll ist weggefahren, und sie wird wohl auch nicht so schnell zurückkommen. Da tauchte plötzlich ein junger, schwarzhaariger Mann bei uns auf, der von einem fernen Land erzählte, wo es noch Segelschiffe geben soll. Segelschiffe, Sie wissen, das sind solche Kähne ohne Atomantrieb …“
„Ich weiß, ich weiß … hat sie denn keine Nachricht für ihre Freunde hinterlassen … für mich?“
„Leider nicht. Sie war ja so aufgeregt. Kaum, dass sie mir auf Wiedersehen sagte.“
Zelia verabschiedete sich von der Mutter und verließ das Haus. Sie war verwirrt und ein bisschen unglücklich. Sie wusste nicht, ob sie Annasibyll bedauern oder beneiden sollte.
Vor der Tür traf sie zu ihrer Überraschung Hansana und Sonja-Lu, die leicht betroffene Gesichter machten.
„Was sucht ihr denn hier, wolltet ihr etwa zu Annasibyll?“
„Zu Annasibyll, nein … Wir … wirklich, wir kommen rein zufällig hier vorbei.“
„Schwindelt nicht, ihr wollt zu ihr. Ihr habt die Antitraumpille nicht genommen, und nun …“
„Wo denkst du hin“, protestierte Sonja-Lu, „das stimmt nicht, du hast ganz falsche Vorstellungen.“
„Was erlaubst du dir“, trumpfte Hansana auf, „wir und die Pille nicht nehmen.“
„Was habt ihr Schlimmes geträumt?”, verlangte Zelia mit fester Stimme, sie kannte sich selbst nicht wieder. „Na los, rückt schon heraus mit der Sprache.“
Die beiden sahen sich verblüfft und unsicher an. „Ich immer nur das eine“, gestand Sonja-Lu kleinlaut, „dass ich nämlich von einem Superfahrgastschiff ins eiskalte Wasser stürzte. Es war schrecklich.“
„Ich habe gar nichts geträumt“, sagte Hansana, die sich gefangen hatte, von oben herab.
„Obwohl du die Antitraumpille weggelassen hast.“
„Nun ja … Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Aber ich hab ja gleich gesagt, dass es Kindereien sind.“
„Wie lange lasst ihr die Pille schon weg?“
„Fünf Tage“, gab Sonja-Lu widerwillig zu.
„Acht Tage“, sagte Hansana, „ich wollte mit diesem Unsinn ein für allemal aufräumen.“
„Bei Annasibyll kommen wir zu spät, sie ist mit dem schwarzhaarigen jungen Mann auf und davon. In ein Land, wo es noch Segelschiffe geben soll“, sagte Zelia, und Bedauern klang aus ihrer Stimme.
Die beiden Freundinnen schürzten verächtlich die Lippen. Sie sahen nun ausgedörrt und müde aus, ganz wie in Zelias Traum.
„Ich wusste gleich, dass es auf eine bloße Kinderei hinausläuft“, murrte Hansana. „Dass deine Annasibyll nicht ernstzunehmen ist.“
„Die Alten haben schon recht, wenn sie uns vor solcher Fantasterei warnen“, ergänzte Sonja-Lu. „Nackte Männer, die in der Luft herumstrampeln, dass ich nicht lache!”
Erstveröffentlichung 1980
Robotern kann man die Arbeit, aber nicht die Liebe schmackhaft machen.
Flusspferde eingetroffen
Bella-X 3 sah fasziniert auf die Anzeige im Schaufenster der Zoohandlung. „Flusspferde eingetroffen!“ stand da in leuchtender Phosphorschrift. Das war eine echte, sehr angenehme Überraschung. Gerade gestern, kurz vor dem Rückflug aus der Hauptstadt, hatte sie wie nebenbei gehört, dass Flusspferde der letzte Schrei waren. Wer etwas auf sich hielt, versuchte eins für sein Grundstück zu ergattern. Ihre Freundin Carry-Gama war ganz traurig gewesen, dass sie noch keins hatte. „Es ist schwer ranzukommen“, hatte sie gesagt, „wenn du wüsstest, wie selten die Tiere sind.“
Bella-X 3 betrat aufgeregt den Superladen, der vom Lärm trillernder Vögel und kreischender Affen erfüllt war. Sie hatte keine genaue Vorstellung vom Aussehen eines Flusspferdes, erinnerte sich aber an ein Tierkarussell ihrer Kindheit, mit dem sie ein paar Mal gefahren war. Deshalb dachte sie an eine Art Pony mit Schwimmhäuten an den Hufen oder mit Rückenflosse. Ja, wenn es um das neueste Modell des Königsflyers gegangen wäre oder um den Springwagen Typ Magnifique. Die waren in jeder Wochenzeitschrift fotoplastiert und in allen Einzelheiten beschrieben. Aber Flusspferde? Bella-X 3 konnte sich nicht erinnern, jemals eins abgebildet oder gar in natura gesehen zu haben. Im Tierpark der Hauptstadt, dem einzigen, den es im Land gab, sollte man ein oder zwei Exemplare besichtigen können. Vielleicht hätte sie die Gelegenheit wahrgenommen, hätte sie nicht nach Hause zurück gemusst.
In dem weiträumigen Laden herrschte ein bläuliches Halbdunkel, doch die junge Frau wusste sofort, wohin sie sich zu wenden hatte. Hinten rechts stand eine Schlange, und dort wurde ihr auch in der gleichen leuchtend grünen Schrift wie im Fenster bedeutet: „Flusspferde hier!“ Zu sehen war keins der seltenen Tiere, das verwunderte aber auch niemanden. In diesem Vorraum war nur der Automat aufgestellt, der das Geld entgegennahm und den entsprechenden Bon aushändigte. Die Tiere befanden sich in der hinteren Halle, wo man sie auch besichtigen konnte.
Aber wer nahm sich dafür schon die Zeit. Es kam darauf an, sich sofort in die Schlange einzureihen, um nicht vielleicht in letzter Minute leer auszugehen. Wenn es sich um so etwas Kostbares drehte! Die anderen kauften ja gleichfalls unbesehen.
Bella-X 3 stellte sich also an und kramte in ihrer Handtasche nach den großen Scheinen. Eine solche Erwerbung würde nicht ganz billig sein. Etwas verlegen fragte sie einen untersetzten, vierschrötigen Kerl vor ihr, ob er etwas über den Preis wüsste. „Drei Rote“, erwiderte der Mann unfreundlich, „da steht’s doch groß und breit, können Sie nicht lesen?“
Drei Rote, tatsächlich, an einer Tafel über ihr blinkte alle paar Sekunden der Preis auf. Bellas Enthusiasmus bekam einen starken Dämpfer. Mit vier Gelben hatte sie gerechnet, höchstens mit fünf. Drei Rote dagegen – dafür konnte man einen halben Flyer kaufen. Das lag, bei Licht besehen, über ihren finanziellen Möglichkeiten. So viel Geld trug sie natürlich auch nicht bei sich, sie musste es vom Konto abbuchen lassen. Eduard-Orion würde rot und blass werden, wenn er das hörte. Aber sollte sie deswegen diese einmalige Gelegenheit auslassen? Er würde sich schon wieder abregen. Irgendwie waren sie immer zusammengekommen.
Der Automat erledigte seine Arbeit zuverlässig und schnell. Bella-X 3 bewegte sich in der Schlange, die keineswegs kürzer wurde, zügig voran. Aber kurz vor dem Ziel war erst einmal Schluss. „Die kommen mit der Auslieferung nicht nach“, sagte eine dralle Frau hinter ihr. Es war immer dasselbe bei solchen Einkäufen.
Zwei Männer in der Schlange unterhielten sich, Bella spitzte die Ohren. Sie hätte gern Genaueres über die Tiere erfahren, scheute sich aber, durch Fragen ihre Unwissenheit einzugestehen. Dabei war es eigentlich keine Schande: Woher sollte man in dieser Welt aus Plast und Beton solche Kenntnisse haben. Wenn sie wenigstens einen Blick in die hintere Halle hätte werfen können. Vielleicht hätte sie jetzt Zeit dazu gehabt, aber konnte man denn wissen, ob der Automat nicht doch im nächsten Augenblick weiterarbeitete? Dann war ihr Platz vergeben, und sie hätte sich wieder hinten anstellen müssen. Wer aber konnte sagen, wie weit der Vorrat reichte. Da verließ sie sich lieber auf Carry-Gama. Wenn die so von diesen Flusspferden geschwärmt hatte, ging die Sache schon in Ordnung.
Etwas Exaktes konnte Bella-X 3 nicht erlauschen, sie erfuhr nur, dass die Tiere am liebsten Schlingpflanzen fraßen und – wie der eine Mann meinte – sehr gutmütig waren. Na also, dachte sie, Ponys mit einer Neigung zum Wasser. Da muss Eduard Orion eben ab und zu zum See rüber, einen Packen Schilf holen. Hat er eine neue Freizeitbeschäftigung. Sonntags können wir das Tierchen ja auch mal an den Fluss führen. Als wir noch unseren Spitz hatten, waren wir sowieso öfter am Fluss als jetzt. Hat uns eigentlich ganz gut getan.
Gerade als Bella-X 3 ihren Scheck einwerfen wollte, erhaschte sie noch einen Satz über Eisen- oder besser Elektrobarrieren, die man brauche, um das Flusspferd ungefährdet in Schach zu halten. Sie stutzte, erschrak sogar etwas, kam aber nicht mehr zum Überlegen. „Möchten Sie zurücktreten?“, fragte mit knarrender Stimme der Automat.
„Nein, nein, ich bin sehr interessiert“, stotterte Bella. Sie warf ihren Scheck in den dafür bestimmten Kasten. Das Signal, das die Richtigkeit des Papiers bestätigte, kam eine Sekunde später. Nun waren die Würfel gefallen, es gab kein Zurück mehr.
Von leisen Zweifeln geplagt, nichtsdestoweniger aber mit einem Gefühl stolzer Genugtuung betrat Bella-X 3 die hintere Halle. Eine Menge Schaulustiger drängte sich an der Auslieferung, so dass ihr die Sicht verdeckt war. Erst als sie ihren Bon schwenkte, machten ihr die Leute widerwillig Platz. Ein Verkäufer in grauer Berufskleidung, mit Goldlitzen auf den Ärmeln, winkte sie nach hinten. „Kommen Sie, noch haben Sie die Wahl“, sagte er fröhlich.
Die Flusspferde standen in großen, kahlen Boxen bis über den Bauch im Wasser und glotzten unbeteiligt vor sich hin. Sie waren so mächtig und massig, dass Bella-X 3 zunächst an eine Verwechslung glaubte. Pferde hatte sie zur Genüge in alten Büchern gesehen – diese gewaltigen plumpen Tiere konnten nicht von der gleichen Rasse sein. Als sie dann begriff – begreifen musste –, was sie gekauft hatte (für einen so unmäßigen Preis), blieb ihr fast das Herz stehen. Sie musste sich abwenden und zwei ihrer Coeur-fit-Tabletten schlucken. Worauf, heiliger Kosmos, hatte sie sich da eingelassen. Was sollte sie mit einem solchen Vieh anstellen?
Der Verkäufer, geschäftig und vom Wert seiner Ware überzeugt, merkte nichts von ihren Nöten. „Na“, sagte er, „sind das nicht ein paar prächtige Exemplare. Zum Beispiel die junge Dame hier“ – er wies auf einen der nackthäutigen Kolosse, der gähnend das breite Maul aufriss –, „sie hat einen Appetit wie zehn Ochsen. Sie wird Ihren See wunderbar von allem Geschling und Geranke frei halten.“
„Wir haben keinen See“, flüsterte Bella-X 3.
„Oder der Herr mit dem – verzeihen Sie – Supergesäß. Beachten Sie, wie wuchtig seine Bewegungen sind. Wie stark seine Eckzähne. Keine Ihrer Freundinnen dürfte einen so schönen Bullen aufzuweisen haben.“
„Besitzen Sie keine kleineren Exemplare?“
„Kleinere?“, fragte der Mann indigniert. „Da bekommen wir zum ersten Mal seit Jahren für den Allgemeinbedarf direkt aus Afrika richtige ausgewachsene Flusspferde, und Ihnen sind sie zu groß. Man kann den Leuten eben nichts recht machen. Kaufen Sie sich doch ein Meerschweinchen, wenn Sie ein kleineres Tier haben wollen.“
Bella-X 3 schwieg eingeschüchtert. Als ihr aber der Herr mit dem Supergesäß in wahrscheinlich durchaus friedlicher Absicht den Kopf zuwandte und die herrlich riesigen Elfenbeineckzähne zeigte, nahm sie all ihren Mut zusammen. „Ich möchte den Kauf rückgängig machen“, sagte sie.
Der Verkäufer maß sie eisig von Kopf bis Fuß. „Ganz unmöglich, das geht nicht.“
„Aber ich … es handelt sich um einen Irrtum. Ich habe keine Verwendung dafür.“
„Das hätten Sie sich schon eher überlegen müssen, liebe Frau. Schließlich handelt sich’s nicht um eine Zahnbürste.“
„Na, wie ist’s, geht’s hier endlich weiter“, drängte in diesem Augenblick ein junger Mann, der seiner Uniform nach zum Wartungspersonal der unterirdischen Wasserreservoirs gehörte, „ich hab’ nicht so lange Zeit, muss wieder an die Arbeit.“
„Da beschweren Sie sich bitte bei dieser Dame“, sagte der Verkäufer steif, „manche Leute wissen einfach nicht, was sie wollen.“
„Ich … ich hab’ nicht gedacht, dass diese Flusspferde so groß sind“, flüsterte Bella-X 3.
„Nehmen Sie doch das kleine da drüben“, empfahl der junge Mann und wies auf eine Eckbox. „Es passt genau zu Ihrem Typ.“ Er lachte unverschämt.
Tatsächlich schien das Tier in der Ecke etwas weniger massig. Während die anderen Flusspferde durchweg vier bis fünf Meter maßen, mochte es nicht mehr als drei fünfzig lang sein.
„Wenn Sie es unbedingt wieder los sein wollen, brauchen Sie nur eine Anzeige in der Abendzeitung aufzugeben“, sagte der Verkäufer etwas freundlicher. „Es ist ja ein Modeartikel. Interessenten finden sich genug.“
Bella-X 3 gab sich geschlagen. „Und wie kriege ich das Tier auf mein Grundstück?“
„Fürs Abholen ist der Kunde selbst zuständig“, sagte der Verkäufer. „Sie wissen doch, Personalmangel.“ Und er fügte humorvoll hinzu: „Immerhin ist es ja keine siebenteilige Anbauwand, die Sie zu Hause selbst zusammenbauen müssten.“
Der Transport des Flusspferdes auf ihr kleines Grundstück kostete Bella-X 3 weitere zwei Gelbe, aber sie konnte von Glück reden, dass sie überhaupt einen LKSW, einen Luftkissenspezialwagen, dafür bekam, die Nachfrage war in diesen Tagen ungeheuer. Wenigstens bedeutete ihr das der Vermietungsautomat am Videofon.
Mit der Anlieferung des Tieres ergaben sich dann sofort neue Probleme. Nicht, dass Dickbein, wie es von dem zunächst entsetzten, später resignierenden Eduard-Orion getauft wurde, aggressiv gewesen wäre – es schickte sich durchaus in sein Los, schien sogar froh, der tristen Box in der Zoohandlung entronnen zu sein. Aber Bella-X 3 war doch gezwungen, seinen Eigenheiten Rechnung zu tragen. So musste zum Beispiel der Swimmingpool erweitert und eine Elektrobarriere errichtet werden, die das Tier an Ausflügen in die Nachbargärten hinderte. Schon am zweiten Tag seiner Anwesenheit war nämlich ein unangenehmer Zwischenfall eingetreten, als Biggi-F, der Nachbarsjunge, das Flusspferd mit gespaltenen Laserstrahlen beschoss. Nach einer Zeit geduldigen Kopfschüttelns war Dickbein urplötzlich aus dem Wasser gerast und hatte in blinder Wut den Elastikzaun, die Beleuchtungsanlage des Nachbarn, seine erst kürzlich aus Betonsilber errichtete Veranda niedergerissen. Biggi-F hatte sich vor dem heranstürmenden Tier gerade noch durch einen Sprung in den Dungkompressor retten können, der glücklicherweise nicht in Betrieb war. Lediglich die Tatsache, dass besagtes Betonsilber (ein Mangelartikel) vom Nachbarn illegal beschafft worden war, hatte Bella-X 3 vor einem Prozess bewahrt.
All die uneingeplanten Kosten zehrten das ohnehin reduzierte Konto der X-Orions mit bestürzender Schnelligkeit auf. Allein das Futter, das einmal in der Woche durch einen Flyer des Großhandels herangeschafft werden musste, verschlang soviel wie der normale Haushalt der Familie. Dass Dickbein eine echte Sensation für Verwandte und Bekannte, ja sogar für die gesamte nähere Umgebung darstellte, war dabei nur ein schwacher Trost. Gewiss, es schmeichelte Bellas Stolz, wenn Enrico Plü beeindruckt sein Kunstbärtchen zwirbelte und vor den versammelten Freundinnen vom Club Future ausrief: „Du bist doch die Größte!“ oder wenn ihr durch die Tätowiererin im Schönheitssalon „Blau auf Weiß“ zugetragen wurde, die Schwestern Elektron, die immer im Mittelpunkt stehen wollten, seien ganz krank vor Neid. Aber die Arbeit mit dem Flusspferd, die Geldsorgen blieben ihr trotz allem. Der Swimmingpool war blockiert, der Rasen davor nicht passierbar, wenn Dickbein seinen Kot, wie bei Flusspferden üblich, im Kreis verteilt hatte. An Wochenendruhe war auf dem Grundstück erst recht nicht mehr zu denken. Dafür sorgten schon die Pilgerzüge von Neugierigen, die sich ständig am Zaun vorbeibewegten. Von Sonnenaufgang bis in die späte Nacht hinein ging das. Wenn sich die Leute wenigstens mit Anschauen begnügt hätten. Aber nein, da flogen Lebensmittelreste aller Art in den Garten, doch auch andere Gegenstände und sogar Steine. Um Dickbeins Fresslust zu testen, es anzustacheln, wenn es einmal nicht gewillt war, sein Konterfei zu zeigen. Der Zaun wurde beschädigt, die Nachbarn beschwerten sich über den Lärm und reichten Klage ein. Die X-Orions hatten stundenlang mit Reparaturen zu tun, mussten alle paar Tage eine Ladung Müll zum Schuttplatz fahren. Vitaminpastetuben, große Eislimonadenbeutel, Kunststoffmelonen, Zuckerersatzstäbe. Schließlich waren sie sogar gezwungen, einen Stachelbetonzaun zu errichten. Erst danach wurde es auf dem Grundstück etwas ruhiger.
Natürlich hatte Bella, dem Rat des Verkäufers aus der Zoohandlung folgend, Dickbein wieder abstoßen wollen. Sie hatte eine fett gedruckte Anzeige in der Abendzeitung aufgegeben, doch ohne jeden Erfolg. Das war auch nicht erstaunlich, nahmen doch die Verkaufsangebote von Flusspferden in der Presse urplötzlich lange Spalten ein. „Vielen Leuten ist es wie Ihnen ergangen“, sagte mit belustigtem Lächeln das Roboterfräulein in der Anzeigenannahme, „sie haben die Viecher erstanden, ohne zu wissen, was sie taten. Versuchen Sie’s doch mal im Tierpark oder beim Säuberungsdienst der Talsperren. Da müssen Sie freilich stark im Preis heruntergehen.“
Aber auch dort kam Bella zu spät. Selbst geschenkt nahmen die erwähnten Institutionen keine Flusspferde mehr an. Wenigstens für die nächsten zwei Jahre nicht. Erst mussten die Investitionen genehmigt sein, die für die Versorgung und den Schutz der Tiere notwendig waren. Die junge Frau wollte einen Rat von Carry-Gama einholen, Dickbein, wenn irgend möglich, an sie abtreten, doch die Freundin befand sich auf einer Studienreise in der Antarktis. Der Himmel mochte wissen, wer ihr die Genehmigung hierzu verschafft hatte. Auf jeden Fall war sie für die folgenden Monate außer Reichweite.
Da half alles nichts, die Sache musste durchgestanden werden. Um das Futter bezahlen zu können, nahm Eduard-Orion einen Kredit bei der Naturschutzbank auf. Außerdem vermieteten sie ihre Wohnung an einen auf Stadttrubel bedachten Mars-Eremiten. Sowohl Bella als auch ihr Mann machten Überstunden. Für ihn als Dispatcher von Gebäudereinigungsautomaten war das nicht ganz so anstrengend wie für sie, die nach sieben Stunden intensiver visueller Konzentration ohnehin ziemlich durchdrehte. Sie arbeitete nämlich in einer Textilschweißanstalt und hatte die Lichtbündel zu beobachten, mit denen farbige Muster in Exportteppiche gebrannt wurden. Wenn Bella-X 3 nun nach neun oder zehn Stunden dieser Tätigkeit in die Aluzementhütte zurückkehrte, die jetzt ihr Zuhause war, hatte sie keinen Blick mehr für den eigentlich recht freundlichen Dickhäuter. Höchstens, dass sie manchmal nach kargem Abendbrot durch ein jähes Schnauben auf ihn aufmerksam gemacht wurde, das aus dem Dunkel des Wasserbassins zu ihr herüberdrang.
So vergingen zwei Jahre, und eines Tages geschah, was die X-Orions nach den Strapazen der Vergangenheit nur als einen großen Glücksfall ansehen konnten. Die Frist jenes Kredits war abgelaufen, den die Naturschutzbank gewährt hatte, und da es den Ehepartnern unmöglich war, die Summe nebst Zinsen aufzubringen, wurde ihr Besitz gepfändet. Genauer gesagt, das Flusspferd, einziger noch vorhandener Wertgegenstand (immerhin hatte es zwei herrliche Elfenbeineckzähne), wurde beschlagnahmt. Mit einer Träne im Auge, aber Freude im Herzen sah Bella seinem Abtransport zu. Dickbein gähnte zum Abschied melancholisch, ehe es in den Luftkissenspezialwagen stieg. Man würde es in einer Talsperre im Süden unterbringen, die Gelder für die hierzu notwendigen Investitionen waren inzwischen genehmigt worden.
Am nächsten Tag kehrten Bella und Eduard in ihre Wohnung zurück. In Anbetracht der bevorstehenden Pfändung hatten sie dem Mars-Eremiten gekündigt und eine Woche unbezahlten Urlaub genommen. Sie wollten nur eins tun: sich erholen. Schlafen, essen, vorm Panotelevisor sitzen. Gerade hatten sie eine Werbeschau für das neuste Modell des Königsflyers angestellt, knabberten jeder an einer Synthetikdelihasenkeule, als der Gästeanzeiger zu summen begann.
Bella erhob sich äußerst unwillig und ging zur Tür. Draußen stand, in eine Art Plastschutz gehüllt und mit einer Aluzell-Kiste unterm Arm, ihre Freundin Carry-Gama.
„Carry, du“, rief Bella mehr erstaunt als erfreut, „seit zwei Jahren hab’ ich nichts mehr von dir gehört. Erst hieß es, du seist in der Antarktis, dann sagte man mir, du hieltest dich in Südamerika auf. Nie hast du uns eine Zeile geschrieben. Wo kommst du auf einmal her?“
„Ach“, sagte Carry, von deren Kleid ein dumpfer, undefinierbarer Geruch ausging, „wenn ich dir erzählen sollte, wo ich überall war und was mir alles zugestoßen ist, ich müsste eine Woche reden. Du hast ja keine Ahnung von der Welt! Aber lass mich erst mal ‘rein, und wundere dich bitte nicht über meinen Aufzug. Ich habe dir nämlich etwas mitgebracht. Eigenhändig in Peru erstanden und bei uns, wenn überhaupt, nur für sechs Rote zu bekommen. Du wirst staunen. Man muss zwar etwas vorsichtig mit ihm umgehen, aber für euer Grundstück ist es genau das Richtige. Schau mich nicht so entsetzt an, Eduard-Orion, es ist keine Giftschlange. Etwas viel Sympathischeres, etwas, das euch lästige Besucher vom Hals hält. Ein kleines, bescheidenes Wesen, nicht größer als eine Katze, mit einem herrlichen Fell und einem wunderbar puschligen Schwanz. Hier, ich überreich es euch. Ihr sollt auch was von der Welt haben. Es ist der letzte Schrei in der Hauptstadt. Ein Skunk, wenn ihr wisst, was das ist, oder prosaischer und allgemeinverständlicher ausgedrückt: ein Stinktier.
Erstveröffentlichung 1980
Du wirst mir noch über den Kopf wachsen, sagte die NI (natürliche Intelligenz) zur KI – da war es schon geschehen.
Immer zu Diensten!
Till Markhausen 1055 Berlin Schönhauser Allee 200
An die Automatenvermittlung 108 Berlin Zentralpark 13-16
Berlin, den 8.5.2011
Sehr geehrte Herren!
Mit meinem Schreiben beziehe ich mich auf Ihre Rechnung vom 7. Mai, die mich sehr verwundert hat. Hier liegt offenbar ein Missverständnis vor – gestatten Sie, dass ich die Dinge kurz richtigstelle. Sie verlangen, dass ich 68,23 Mark für eine Leistung bezahle, die ich einerseits nicht angefordert, andererseits im Grunde selbst erbracht habe.
Aber lassen wir die Tatsachen sprechen. Vor drei Wochen, am Freitag, dem 16.4., hatte ich in Ihrem Kundendienst eine Fensterputzmaschine bestellt. Sie wurde mir für Mittwoch, den 28.4., 9 Uhr morgens, zugesichert. Am angegebenen Tag – ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass schönes, fürs Scheibensäubern günstiges Wetter war – wartete ich zunächst vergebens. Gegen 11.30 Uhr klingelte es dann an der Tür, und zu meiner Freude stand ein Automat draußen. Ich ließ ihn ein, da ich annahm, es sei der gewünschte Glasreiniger. Er hatte aber nur ein Damespiel mit und setzte sich sofort an den Tisch. Da ich merkte, dass es sich um eine Verwechslung handelte, versuchte ich ihm den Irrtum klarzumachen. Ich sagte, ich hätte keinen Unterhaltungsautomaten bestellt, sondern einen Fensterputzer, und er solle wieder gehen.
Doch dazu ließ er sich nicht bewegen. Nun weiß ich zwar, dass Roboter ihrem Programm folgen müssen, im Allgemeinen beugen sie sich aber, wenn der Kunde inzwischen seinen Willen geändert hat. Dieser, mit der Bezeichnung D 874, wollte dagegen nicht einmal einsehen, dass ich ihn nicht angefordert hatte. Ich konnte ihn nicht loswerden, und da ich noch immer auf den Reinigungshelfer hoffte, tat ich ihm schließlich den Gefallen. Ja, ich gebe es zu, ich spielte mit ihm Dame, doch müsste eigentlich ich dafür bezahlt werden. Zumal dieser D 874 eigenartige Manieren hatte. Er lachte hämisch, wenn ich einen Fehler beging, und bezeichnete mich mehrmals als Anfänger. Einmal, als ich versehentlich einen Stein hinunterwarf, den ich nicht gleich wiederfinden konnte, riss er einen schwarzen Knopf von meiner überm Stuhl hängenden Jacke und fügte den in die Partie ein. Mein Protest half nichts. Nach fünf Stunden erst gelang es mir, die Maschine abzuschieben – der Fensterputzer war nicht aufgetaucht.
Ich habe Ihnen wegen dieser sonderbaren Vorgänge am 30.4. einen Brief geschrieben, auf den ich bisher keine Antwort erhielt. Stattdessen diese Rechnung. Wäre ich nicht ein Mensch, der über Humor verfügt, würde ich eine Entschädigung verlangen.
Ich hoffe, dass die Angelegenheit damit bereinigt ist, wenn meine Fenster vorläufig auch noch vor sich hin schmutzen.
Hochachtungsvoll!
Till Markhausen
Automatenvermittlung 108 Berlin Zentralpark 13-16
An Herrn Till Markhausen 1055 Berlin Schönhauser Allee 200
Berlin, den 20.5.2011
Sehr geehrter Herr Markhausen!