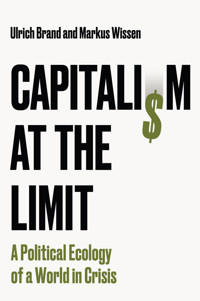Ulrich Brand, Markus Wissen
ImperialeLebensweise
Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Laura Kohlrausch, oekom verlagKorrektorat: Maike SpechtUmschlaggestaltung: Andrew Corbett DesignSatz: Ines Swoboda, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-86581-154-0
Inhalt
Danksagung
Kapitel 1 An den Grenzen einer Lebensweise
Kapitel 2 Multiple Krise und sozial-ökologische Transformation
Kapitel 3 Der Begriff der imperialen Lebensweise
Kapitel 4 Die historische Entstehung der imperialen Lebensweise
Kapitel 5 Die globale Verallgemeinerung und Vertiefung der imperialen Lebensweise
Kapitel 6 Imperiale Automobilität
Kapitel 7 Falsche Alternativen. Von der grünen Ökonomie zum grünen Kapitalismus?
Kapitel 8 Konturen einer solidarischen Lebensweise
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Über die Autoren
Für Bettina, Wiebke und Simon
Danksagung
Das Schreiben des vorliegenden Buches war nicht nur für uns als Autoren eine äußerst bereichernde Erfahrung intensiver und freundschaftlicher wissenschaftlicher Kooperation. Es wurde auch getragen von einer Woge kritischen Wohlwollens seitens vieler FreundInnen und KollegInnen, denen wir dafür an dieser Stelle herzlich danken möchten.
Ein wesentlicher Meilenstein bei der Entstehung des Buches war ein Workshop im August 2016 in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Mario Candeias, Stefanie Graefe, Friederike Habermann, Uwe Hoering, Boris Kanzleiter, Bettina Köhler, Tom Kopp, Steffen Kühne, Miriam Lang, Christoph Podstawa, Sabine Pongratz, Katharina Pühl, Daniela Setton, Silke van Dyk und Christa Wichterich haben in einer mehrstündigen intensiven Diskussion die Entwürfe zweier zentraler Kapitel solidarisch gegen den Strich gebürstet und uns ebenso viel Kritik wie Ermutigung zukommen lassen. Der Workshop war für uns die Initialzündung zum Endspurt der Manuskripterstellung.
In den letzten Jahren bekamen wir bei Vorträgen und in Lehrveranstaltungen immer wieder kritische Rückfragen und wichtige Anregungen, die zur Verfestigung unserer Gedanken beitrugen – und natürlich auch Zweifel säten, weil uns deutlich wurde, was wir in diesem Buch alles nicht berücksichtigen können. Ein interessantes, in jüngerer Zeit entstandenes Forum ist die I.L.A.-Werkstatt. In ihr beschäftigt sich eine Gruppe von WissenschaftlerInnen und politisch Aktiven mit »imperialen Produktions- und Lebensweisen« und »Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert«. Wir hatten erfreulicherweise die Gelegenheit, einige unserer Überlegungen dort zur Diskussion zu stellen.
Wichtige und außerordentlich anregende Kommentare zu einzelnen Teilen des Manuskripts haben wir von Gundula Ludwig, Tobias Boos, Alina Brad, Lutz Brangsch, Michael Brie, Ariane Brenssell, Kristina Dietz, Franziskus Forster, Daniel Fuchs, Franziska Kusche, Miriam Lang, Hanna Lichtenberger, Kathrin Niedermoser, Melanie Pichler, Etienne Schneider, Isabella Radhuber, Anke Schaffartzik und Stefan Schmalz erhalten.
Ulrich Brand dankt zudem dem Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam (IASS) – und dort insbesondere Mark Lawrence, Sebastian Helgenberger und Falk Schmidt – dafür, dass er im Sommersemester 2016 im Rahmen eines Gastaufenthaltes unter anderem an diesem Buch arbeiten konnte. In einem Kolloquium am IASS wurden einige Überlegungen dieses Buches präsentiert und von den Teilnehmenden, insbesondere den KommentatorInnen Boris Gotchev, Sebastian Helgenberger, Kristin Nicolaus und Falk Schmidt, mit wichtigen Hinweisen versehen. Markus Wissen dankt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) für die Gewährung eines Forschungssemesters, das ihm die Arbeit an diesem Buch zeitlich ermöglicht hat.
Louis Asamoah, Samuel Decker, Franziska Kusche und Carla Noever haben uns bei der technischen Manuskripterstellung wertvolle Hilfe geleistet, Samuel Decker hatte zudem die Idee zum Untertitel des Buches. Nicht zuletzt danken wir Christoph Hirsch für die wohlwollende Begleitung des Projekts vonseiten des oekom Verlags und Laura Kohlrausch für ihr ausgezeichnetes Lektorat.
Ulrich Brand und Markus Wissen
Wien und Berlin im Dezember 2016
Kapitel 1An den Grenzen einer Lebensweise
Kein Gemeinsames ist möglich, sofern wir uns nicht weigern, unser Leben und unsere Reproduktion auf dem Leid anderer zu gründen und uns als von ihnen getrennt wahrzunehmen.
Silvia Federici1
Zum Anlass des Buches
Im Februar 1994 erschien in der Zeitschrift The Atlantic Monthly ein Beitrag des US-amerikanischen Journalisten Robert D. Kaplan mit dem Titel »Die kommende Anarchie«.2 Am Beispiel von Westafrika widmet sich der Autor darin der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der sogenannten unterentwickelten Welt und zeichnet ein äußerst düsteres Bild derselben. Dessen Wirkung wird durch die drastisch-suggestiven Fotos von verstopften Straßen in südlichen Megacitys, von Slums, Kindersoldaten, verschmutzten Flüssen und Bürgerkriegsszenen, mit denen der Beitrag unterlegt ist, noch gesteigert. Die Botschaft ist klar: Nachdem der globale Norden mit dem Ende des Kalten Krieges das Interesse am globalen Süden verloren hat, droht dieser im Chaos zu versinken. Er wird zum Hort von Gewalt, Staatszerfall, Epidemien, »Überbevölkerung« und ökologischer Zerstörung.
Die Intention des damaligen Beitrags war es nicht, auf das Leid von Menschen hinzuweisen oder den Zusammenhängen zwischen dem Reichtum im Norden und den Konflikten im Süden nachzuspüren. Es geht Kaplan vielmehr darum, eine Weltordnung zu skizzieren, in der die übersichtliche Konkurrenz zwischen Nationalstaaten durch eine anarchische Vielzahl von »kulturell« und religiös motivierten Konflikten abgelöst wird. Zudem will er vor der Bedrohung der nationalstaatlichen Ordnung auch des globalen Nordens warnen, die aus einer Ausbreitung der Anarchie des Südens sowie aus den Spannungen resultiert, die in den kulturell heterogenen Gesellschaften des Nordens selbst angelegt sind.
Der ökologischen Problemdimension in Gestalt von zunehmender Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung misst Kaplan dabei eine besondere Bedeutung bei: »Es ist an der Zeit, ›die Umwelt‹ als das zu begreifen, was sie ist: die nationale Sicherheitsfrage des frühen 21. Jahrhunderts. Die politischen und strategischen Auswirkungen von wachsenden Bevölkerungszahlen, sich ausbreitender Krankheit, Entwaldung, Bodenerosion, Erschöpfung von Wasserressourcen, Luftverschmutzung und, möglicherweise, steigenden Meeresspiegeln in kritischen überbevölkerten Regionen wie dem Nil-Delta und Bangladesch – Entwicklungen, die zu massenhafter Migration führen und, umgekehrt, Gruppenkonflikte anheizen werden – stellen die zentrale außenpolitische Herausforderung dar, aus der alle anderen Herausforderungen letztlich hervorgehen werden.«3
Gut 20 Jahre nach Erscheinen des Artikels von Kaplan überbieten sich europäische PolitikerInnen mit Vorschlägen und konkreten Maßnahmen der Abschreckung und Abschottung gegenüber Menschen, die, getrieben von existenzieller Not beziehungsweise dem Wunsch nach einem besseren Leben, die EU zu erreichen versuchen. Die Zurückweisung einer im internationalen Vergleich überschaubaren Zahl von Geflüchteten4 wird zu einer Frage der nationalen Sicherheit stilisiert, Zäune werden gebaut, »Schicksalsgemeinschaften« beschworen und »Obergrenzen« eingefordert. Es scheint, als würde sich die von tiefen Interessengegensätzen entzweite politische Elite Europas in dem Bestreben annähern, an den Geflüchteten ein Exempel zu statuieren, um der von Kaplan imaginierten Bedrohung nationalstaatlicher – und in diesem Fall auch supranationaler – Ordnung geschlossen und mit aller Macht entgegenzutreten.
Daneben zeigt sich in der Situation des Jahres 2016 noch eine zweite Reminiszenz an Kaplans Diagnose von 1994: Viele der Menschen, die abgewiesen oder abzuweisen versucht werden, scheinen auch aus ökologischen Gründen zu fliehen: weil steigende Temperaturen oder Konflikte um knapper werdende Ressourcen in Landwirtschaft und Bergbau sie der Möglichkeit berauben, ein von Not und Gewalt freies Leben zu führen. Auch der Syrienkrieg reiht sich in diese Erzählung ein, und zwar insofern, als ihm eine lange Dürre vorausging, die das gesellschaftliche Konfliktpotenzial vergrößerte.5
Kaplans Katastrophenszenario scheint sich also im Jahr 2016 zu bestätigen. Und nicht nur das: Es liefert der europäischen Abschottungspolitik gleich die Rechtfertigungsgründe. Wenn »die Umwelt« zur Frage nationaler Sicherheit wird und wenn es nun mal der globale Süden ist, dem »die Umwelt« besonders übel mitspielt, wenn dieser Süden zudem in einem solchen Chaos versinkt, dass jede Perspektive politischer Stabilität und ökonomischer Entwicklung unter nationalstaatlichen Vorzeichen undenkbar wird, dann muss sich der globale Norden scheinbar auf die Verteidigung seiner zivilisatorischen Errungenschaften konzentrieren. Und sich zu ebendiesem höheren Zweck die Menschen aus dem globalen Süden vom Leib halten.
Das Problem ist nur, dass sowohl die Diagnose von Kaplan als auch die heutige Flüchtlingspolitik ihre Legimitation beziehungsweise Plausibilität gerade daraus beziehen, dass sie sich über die beiden entscheidenden Zusammenhänge ausschweigen. Erstens: Menschen werden nicht einfach durch die »Knappheit« natürlicher Ressourcen und »den Klimawandel« in die Flucht getrieben. Stattdessen sind es ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse – wie der ungleiche Zugang zu Land, Wasser und Produktionsmitteln –, die Ressourcen knapp und den Klimawandel für viele zu einer existenziellen Bedrohung machen. Zweitens: Diese Verhältnisse lassen sich nur begreifen, wenn man sich von den unmittelbaren Eindrücken löst und den Blick über den Tellerrand der betroffenen Regionen hinaus auf den globalen Kontext richtet. Erst dann nämlich werden ökologische Krisen und gewaltsam ausgetragene Konflikte in ihrer ganzen Komplexität verständlich.
Hinter den Konflikten sogenannter verfeindeter »Ethnien« im Kongo etwa wird der Bedarf des globalen Nordens an Coltanerzen sichtbar, die für die Herstellung von Mobiltelefonen oder Laptops gebraucht werden. Wasserkonflikte – in vielen Teilen der Welt scheinbar die zwangsläufige Folge einer im Zuge des Klimawandels zunehmenden Trockenheit – werden als Resultat der Zerstörung kleinbäuerlicher Produktionsweisen verstehbar, wie sie von agrar-industriellen Unternehmen des globalen Nordens im Einklang mit den Interessen lokaler und nationaler Eliten des globalen Südens betrieben wird. Und als eine Ursache der – mangels anerkannter Fluchtgründe oft als »illegal« gebrandmarkten – Migration afrikanischer Kleinbauern nach Europa gerät die EU-Agrar- und Außenhandelspolitik in den Blick, die mit dem Export hoch subventionierter Agrarprodukte nach Afrika dortige Märkte und Einkommensmöglichkeiten zerstört.6
Aus dieser Perspektive verliert die Analyse Kaplans genauso den Anschein der Plausibilität wie die Politik der EU den der Legitimität. Die EU-Politik wird als Versuch begreifbar, einen Wohlstand, der auch auf Kosten anderer entsteht, gegen die Teilhabeansprüche ebendieser anderen zu verteidigen. Sie ist insofern die logische Konsequenz einer Lebensweise, die darauf beruht, sich weltweit Natur und Arbeitskraft zunutze zu machen und die dabei anfallenden sozialen und ökologischen Kosten zu externalisieren: in Gestalt von CO2, das bei der Herstellung der Konsumgüter für den globalen Norden emittiert und von den Ökosystemen der Südhalbkugel absorbiert wird (beziehungsweise sich in der Atmosphäre konzentriert); in Gestalt von metallischen Rohstoffen aus dem globalen Süden, die die unabdingbare Voraussetzung von Digitalisierung und »Industrie 4.0« im globalen Norden darstellen; oder in Gestalt der Arbeitskräfte im globalen Süden, die bei der Extraktion von Mineralien und Metallen, bei der Wiederverwertung unseres Elektroschrotts oder beim Schuften auf pestizidverseuchten Plantagen, die die im globalen Norden verzehrten »Südfrüchte« hervorbringen, ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren.
Zur Intention des Buches
Wir bezeichnen die Lebensweise, die auf derartigen Voraussetzungen beruht und immer auch die Produktionsweise mit einschließt, als imperial. Damit wollen wir erstens das sichtbar machen, was den Alltag – das Produzieren und Konsumieren – der Menschen im globalen Norden sowie einer größer werdenden Zahl von Menschen im globalen Süden ermöglicht, meist ohne die Schwelle der bewussten Wahrnehmung oder gar der kritischen Reflexion zu überschreiten. Es geht uns darum, wie sich Normalität gerade über das Ausblenden der ihr zugrunde liegenden Zerstörung herstellt. Mit anderen Worten: Thema des Buches sind die Alltagspraxen sowie die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen und internationalen Kräfteverhältnisse, die Herrschaft über Mensch und Natur erzeugen und verstetigen.
Zweitens möchten wir erklären, wie und warum sich in einer Zeit, in der sich Probleme und Krisen in den unterschiedlichsten Bereichen (soziale Reproduktion, Ökologie, Wirtschaft, Finanzen, Geopolitik, europäische Integration, Demokratie etc.) häufen, zuspitzen und überlagern, so etwas wie Normalität herstellt. Die imperiale Lebensweise erscheint uns in diesem Zusammenhang zentral. Bei ihr handelt es sich um ein Paradoxon, das im Epizentrum verschiedenster Krisenphänomene angesiedelt ist: Sie wirkt – siehe oben – in vielen Teilen der Welt verschärfend auf Krisenphänomene wie den Klimawandel, die Vernichtung von Ökosystemen, die soziale Polarisierung, die Verarmung vieler Menschen, die Zerstörung lokaler Ökonomien oder die geopolitischen Spannungen, von denen man noch bis vor wenigen Jahren ausging, sie seien mit dem Ende des Kalten Krieges überwunden worden. Mehr noch: Sie bringt diese Krisenphänomene wesentlich mit hervor. Gleichzeitig trägt sie aber dort, wo sich ihr Nutzen konzentriert, zur Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse bei. So wäre es ohne die auf Kosten von Mensch und Natur andernorts hergestellten und ebendeshalb billigen Lebensmittel womöglich weitaus schwieriger gewesen, die Reproduktion der unteren Gesellschaftsschichten des globalen Nordens auch angesichts der tiefen Wirtschaftskrise seit 2007 zu gewährleisten. Damit soll die soziale Spaltung, wie sie im globalen Norden durch diese Krise noch einmal beschleunigt wurde, keineswegs verharmlost werden.
Drittens wollen wir die gegenwärtigen Krisen und Konflikte als Manifestation der Widersprüchlichkeit der imperialen Lebensweise begreifbar machen. Dass sich viele Probleme heute derart krisenhaft zuspitzen, ist auch darauf zurückzuführen, dass die imperiale Lebensweise derzeit im Begriff ist, sich zu Tode zu siegen. Ihrem Wesen nach beinhaltet sie die Möglichkeit eines überproportionalen Zugriffs auf Natur und Arbeitskraft – mit anderen Worten: auf ein »Außen« – im globalen Maßstab. Sie setzt also voraus, dass andere auf ihren proportionalen Anteil verzichten. Je weniger diese anderen dazu aber bereit sind beziehungsweise je mehr sie selbst darauf angewiesen sind, auf ein Außen zuzugreifen und ihre Kosten auf dieses zu verlagern, desto eher geht der imperialen Lebensweise die Geschäftsgrundlage verloren.
Und genau das ist derzeit der Fall. Im selben Maße, wie sich Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien kapitalistisch entwickeln und die dortigen Mittel- und Oberklassen sich »nördliche« Vorstellungen und Praxen des guten Lebens zu eigen machen, wachsen ihr Ressourcenbedarf und ihr Bedarf, Kosten etwa in Gestalt von CO2 zu externalisieren. Sie steigen dadurch nicht nur in ökonomischer, sondern auch in ökologischer Hinsicht zu Konkurrenten des globalen Nordens auf. Das Resultat sind ökoimperiale Spannungen, wie sie sich etwa in der globalen Klima- und Energiepolitik zeigen. Dazu kommt, dass immer weniger Menschen im globalen Süden bereit sind, sich ihr eigenes Leben von der imperialen Lebensweise des globalen Nordens kaputt machen zu lassen. Die aktuellen Flucht- und Migrationsbewegungen sind auch vor diesem Hintergrund zu sehen. In ihnen zeigt sich zudem die ungebrochene Attraktivität, die die imperiale Lebensweise auf diejenigen ausübt, die bislang nicht an ihr teilhaben konnten: Die Geflüchteten suchen Sicherheit und ein besseres Leben, das unter Bedingungen der imperialen Lebensweise in den kapitalistischen Zentren eher zu realisieren ist als anderswo.
Dies erklärt auch, warum sich die repressive und gewaltförmige Seite der imperialen Lebensweise – in Gestalt von Rohstoffkonflikten oder der Abschottung gegen Geflüchtete – gerade heute so deutlich offenbart. Die imperiale Lebensweise beruht auf Exklusivität, sie kann sich nur so lange erhalten, wie sie über ein Außen verfügt, auf das sie ihre Kosten verlagern kann. Dieses Außen schwindet jedoch, denn immer mehr Ökonomien greifen darauf zu, und immer weniger Menschen sind bereit oder in der Lage, die Kosten von Externalisierungsprozessen zu tragen. Die imperiale Lebensweise wird dadurch zum Opfer ihrer eigenen Attraktivität und Verallgemeinerung.
Den kapitalistischen Zentren bleibt dann nur noch der Versuch, ihre Lebensweise durch Abschottung und Ausgrenzung exklusiv zu stabilisieren. Damit bringen die diese Politik exekutierenden Kräfte, die sich in der Regel selbst als »bürgerliche Mitte« etikettieren, genau das hervor, was sie als ihren Widerpart begreifen: autoritäre, rassistische und nationalistische Bestrebungen. Dass diese derzeit überall erstarken, liegt auch daran, dass sie sich in der Krise als die eigentlichen, weil konsequenteren Garanten jener Exklusivität inszenieren können, die im Normalbetrieb der imperialen Lebensweise immer schon angelegt ist. Und im Unterschied zu ihren »bürgerlichen« Konkurrenten sind sie in der Lage, ihrer Wählerschaft ein Angebot zu machen, das diese auf eine subalterne Position festlegt und sie gleichzeitig aus ihrer postdemokratischen Passivierung befreit. Nora Räthzel hat diesen Mechanismus im Hinblick auf den Rassismus, wie er sich im Deutschland der frühen 1990er-Jahre artikulierte, treffend als »rebellierende Selbstunterwerfung« bezeichnet. Den Akteuren wird es dabei ermöglicht, »sich als Handelnde in Verhältnissen zu konstituieren, denen sie ausgeliefert sind«.7
Wenn diese Diagnose zutrifft, dann wären – viertens – die Anforderungen an eine Alternative radikaler zu formulieren, als dies im Mainstream der Ökologiedebatte geschieht. Es reicht dann nicht mehr, eine »grüne Revolution«8 oder einen neuen »Gesellschaftsvertrag«9 einzufordern und der starken Rhetorik zum Trotz die politische Ökonomie der Probleme sowie die imperiale Lebensweise unangetastet zu lassen. Auch greift es zu kurz, implizit oder explizit darauf zu setzen, dass »die Politik« aus der unabweisbaren, da wissenschaftlich immer genauer belegten Tatsache der ökologischen Krise endlich die richtigen Konsequenzen zieht – wird damit doch übersehen, dass das so adressierte vermeintliche Steuerungssubjekt »Staat« kein möglicher Gegenpol, sondern ein wesentliches Moment in der institutionellen Absicherung der imperialen Lebensweise ist.
Stattdessen kommt es zunächst darauf an, die ökologische Krise als das anzuerkennen, was sie ist: ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Produktions- und Konsumnormen des globalen Nordens, wie sie sich mit dem Kapitalismus herausgebildet und schließlich verallgemeinert haben, auch in ihrer ökologisch modernisierten Variante nur auf Kosten von immer mehr Gewalt, ökologischer Zerstörung und menschlichem Leid aufrechterhalten lassen, und auch dies nur in einem kleinen Teil der Welt. Aufgrund der autoritären, weiter auf Inwertsetzung der Natur und gesellschaftliche Spaltung setzenden Politik erleben wir derzeit eine beispiellose Akkumulation der Widersprüche. Die Reproduktion der Gesellschaft und ihrer biophysikalischen Grundlagen kann über den kapitalistischen Wachstumsimperativ immer weniger gesichert werden. Wir erleben eine Krise des Krisenmanagements, eine Hegemonie- und Staatskrise.
Ausgehend von dieser Einsicht, geht es sodann darum, die vielfältigen Alternativen, wie sie derzeit gegen die dominanten Entwicklungen praktiziert werden, auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit und auf ihre verbindenden, die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit steigernden Elemente zu befragen: Inwieweit zeichnen sich in den Bewegungen für Energiedemokratie, Ernährungssouveränität oder solidarische Ökonomie, um nur einige zu nennen, die Umrisse einer Vergesellschaftung ab, die in einem starken Sinne demokratisch ist, die also in dem Prinzip gründet, dass alle, die von den Folgen einer Entscheidung betroffen sind, gleichberechtigt an deren Zustandekommen mitwirken? Dies ist aus unserer Sicht eine der zentralen Fragen, denn sie verweist auf ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip, das dem der imperialen Lebensweise diametral entgegengesetzt ist.
Zum Aufbau des Buches
Damit sind die zentralen Themen umrissen, die in diesem Buch behandelt werden sollen.10 Wir beginnen damit, dass im zweitenKapitel die Probleme analysiert werden, die sich in jüngerer Zeit zu einer »multiplen Krise« verdichtet haben und zunehmend autoritär bearbeitet werden. Auffällig ist dabei, dass die Krisenbearbeitung nicht nur autoritär, sondern auch umkämpft ist. Innerhalb der Nationalstaaten, auf der Ebene der Europäischen Union, im Verhältnis zwischen dieser und den USA oder in den Institutionen der globalen Umweltpolitik gibt es gegensätzliche Auffassungen darüber, wie mit den wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Erschütterungen der vergangenen Jahre umgegangen werden soll. Selbst der zunehmende Autoritarismus, der durch den Wahlsieg von Donald Trump einen neuen Höhe- beziehungsweise Tiefpunkt erreicht hat, ließe sich noch als Ausdruck einer Verunsicherung deuten, die sich unter den politischen Eliten ausgebreitet hat.11 Die Fähigkeit zur Formulierung hegemonialer Projekte und politischer Führung ist der »bürgerlichen Mitte« allem Anschein nach abhandengekommen. Derweil bildet sich im linksliberalen politischen und wissenschaftlichen Spektrum ein Konsens heraus, demzufolge die vielfältigen Krisenphänomene mit einer ökologischen Modernisierung der Volkswirtschaften gemeinsam bearbeitet werden können. Allerdings sind die einschlägigen Ansätze nicht nur viel zu zögerlich, sondern lassen auch den Problemkern der multiplen Krise, den wir in der imperialen Lebensweise sehen, unangetastet.
Im dritten Kapitel geht es um eine genauere begriffliche Bestimmung dieses Problemkerns. Wir führen die »imperiale Lebensweise« als Kategorie ein, die zwischen dem Alltagshandeln der Menschen und den diesem zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen vermittelt. Damit wollen wir die Mechanismen freilegen, über die die in den Strukturen angelegten Herrschaftsverhältnisse normalisiert werden. Zentral ist die Unterscheidung verschiedener Begriffsdimensionen, die wir – gestützt auf verschiedene Traditionen kritischen Denkens, vor allem Marx, Gramsci, feministische Theorie, Bourdieu und Foucault – im Folgenden vornehmen. Dabei soll nicht nur die in dieser Einleitung bereits skizzierte Externalisierung, sondern auch die soziale Hierarchisierung im globalen Norden als zentrale Dimension der imperialen Lebensweise deutlich werden. Wir wollen zeigen, dass die Verantwortung für sozial-ökologisch destruktive Produktions- und Konsumnormen und der Nutzen, der aus ihnen gezogen werden kann, über Klassen-, Geschlechter- und rassisierte Verhältnisse vermittelt ist. Zudem soll der Doppelcharakter der imperialen Lebensweise als struktureller Zwang und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten deutlich werden.
Kapitel 4 und 5 zeichnen in einer groben Skizze die Geschichte der imperialen Lebensweise von ihren Anfängen im Kolonialismus bis zu ihrer heutigen Verallgemeinerung nach. Die in Kapitel 4 im Mittelpunkt stehende Epoche ist der Fordismus. Sie prägte die kapitalistischen Zentren von den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre und bescherte den Menschen einen in seiner Breitenwirkung bis dahin ungekannten Zuwachs an materiellem Wohlstand, der gleichwohl auf sozialer Ungleichheit basierte und diese reproduzierte. Uns interessiert am Fordismus vor allem, wie die ressourcen- und emissionsintensiven Konsumnormen, die bis dahin den oberen Klassen vorbehalten waren, in die Mittel- und Unterklassen des globalen Nordens diffundierten und damit der Boden für die heutige sozial-ökologische Krise bereitet wurde.
Kapitel 5 setzt mit einem politischen »Gelegenheitsfenster« ein: der Krise des Fordismus in den 1970er-Jahren. Bei dieser handelte es sich nicht nur um eine Erschöpfung der ökonomischen Potenziale eines bestimmten Akkumulationsmodells, sondern um eine umfassende gesellschaftliche Krise, in der die vorherrschenden Formen des Arbeitens, des Zusammenlebens und der Nutzung von Natur von alten und neuen sozialen Bewegungen politisiert wurden. Dieses Fenster schloss sich jedoch schon bald. Was folgte, waren eine Vertiefung der imperialen Lebensweise in den Zentren und ihre Ausbreitung auf immer mehr Länder an der kapitalistischen Peripherie. Die in jüngerer Zeit zu beobachtenden geopolitischen und -ökonomischen Spannungen und Verschiebungen sind, so unsere These, auch vor dem Hintergrund dieser Verallgemeinerung des Nichtverallgemeinerbaren zu begreifen.
Das sechste Kapitel betrachtet die Geschichte und aktuelle Ausprägung der imperialen Lebensweise in Bezug auf einen gesellschaftlichen Bereich, in dem sich viele ihrer Bestimmungen verdichten: die Automobilität. Wir beginnen mit der Beobachtung, dass ausgerechnet in einer Zeit des wachsenden Bewusstseins der ökologischen Krise die Nachfrage nach besonders ressourcen- und emissionsintensiven Autos wie den Sport Utility Vehicles (SUVs) zunimmt. Diese Paradoxie wird begreifbar, wenn man Automobilität im Kontext sich wandelnder Subjektivierungsformen sowie Klassen- und Geschlechterverhältnisse untersucht. Das SUV-Fahren erscheint dann als Ausdruck der automobilen Subjektivität des neoliberalen Kapitalismus, als exklusive, weil nicht verallgemeinerbare Form des Umgangs mit sozialen und ökologischen Bedrohungen und mit einer in alle Poren des gesellschaftlichen Lebens vordringenden Konkurrenz – eine Umgangsform, die gleichwohl jene Phänomene, auf die sie zu reagieren vorgibt, erst hervorbringt beziehungsweise verstärkt.
Eine ökologische Modernisierung der Automobilität sowie anderer gesellschaftlicher Bereiche, wie sie sich derzeit vielerorts andeutet, wird die Voraussetzungen und Folgen der imperialen Lebensweise letztlich nicht verändern. Es handelt sich um eine der falschen Alternativen, die wir im siebten Kapitel untersuchen. »Falsch« bedeutet allerdings nicht »unwirksam«. Im Gegenteil könnten sich die an vielen Orten der Welt beobachtbaren Ansätze einer green economy durchaus zu einem Projekt namens grüner Kapitalismus verdichten. Dieser wird – dafür könnten rechte, neoliberale, teilweise auch sozialdemokratische Regierungen weltweit sorgen – von starken fossilistischen Elementen durchsetzt sein. Zudem wird er an der grundlegenden Problematik der Produktion und Externalisierung sozial-ökologischer Kosten nichts ändern, denn dazu müsste nicht nur das »Wie«, sondern auch das »Was« des Produzierens und Konsumierens infrage gestellt werden.
Im achten Kapitel widmen wir uns den Akteuren, die genau dies tun, die sich also gerade nicht mit einer ökologischen Modernisierung der imperialen Lebensweise zufriedengeben, sondern nach deren Überwindung streben. Natürlich ist es nicht möglich, der Vielfalt der praktizierten und angedachten grundlegenden Alternativen auf wenigen Seiten gerecht zu werden. Deshalb geht es uns dabei auch nicht um eine erschöpfende, sondern um eine systematisierende Darstellung entlang aktueller Erfahrungen und der von uns wahrgenommenen strategischen Herausforderungen: das Zurückdrängen beziehungsweise den Widerstand gegen ein weiteres Vordringen der imperialen Lebensweise, wie sie etwa in den Kämpfen gegen das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen TTIP aufscheinen; das Schaffen und Absichern von Freiräumen, in denen sich Neues entwickeln kann, beispielsweise der Einsatz für Energiedemokratie und Ernährungssouveränität; und die Ausdehnung dieses Neuen auf solche gesellschaftlichen Bereiche, in denen es trotz eines allgegenwärtigen Unbehagens bislang kaum Fuß fassen konnte.
Kapitel 2Multiple Krise und sozial-ökologische Transformation
Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisieepoche vor allen anderen aus.
Karl Marx und Friedrich Engels1
Wir leben in einer paradoxen Situation. Auf der einen Seite gibt es breite gesellschaftspolitische Diskussionen über die ökologische Krise, insbesondere über den Klimawandel. Auch die Energiewende wurde in vielen Ländern zu einem wichtigen Thema. In den Medien ist Umweltpolitik präsent, vielfältige Forschungen finden dazu statt, eine nicht mehr überschaubare Anzahl von Fachtagungen behandeln spezifische Aspekte der ökologischen Krise und ihrer Bearbeitung. Staatliche Politik und Verwaltung befassten sich seit Jahren intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen, und auch in vielen Unternehmen und ihren Verbänden und bei einer zunehmenden Zahl von Beschäftigten und ihren Gewerkschaften scheint das Thema »angekommen« zu sein. Im Schulunterricht sind Umwelt und Nachhaltigkeit inzwischen fester Bestandteil der Lehrpläne, an den Hochschulen gibt es ein breites Angebot von einschlägigen Studiengängen sowie von Lehrmodulen in den herkömmlichen Fächern.
Es tut sich etwas – und die vielfältigen Debatten und Aktivitäten haben eine lange Vorgeschichte. Die Energiewende etwa wäre kaum vorstellbar ohne die Umweltbewegung in (West-)Deutschland seit den 1980er-Jahren, ohne die harten Auseinandersetzungen um den Stellenwert der Atomenergie; ohne die zivilgesellschaftlichen und lokalpolitischen Vorreiter, die bereits mit der Energiewende begannen, als es den Begriff noch gar nicht gab. In Österreich waren die Volksabstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf im Jahr 1978 und die Auseinandersetzungen um das Wasserkraftwerk in der Hainburger Au zu Beginn der 1980er-Jahre Meilensteine der umweltpolitischen Sensibilisierung.
Umso paradoxer ist die Tatsache, dass die Umweltzerstörung weiter und immer schneller voranschreitet, wie weiterhin alarmierende Studien und Berichte zeigen: Der globale Ressourcenverbrauch hat sich nach einer rasanten Beschleunigung um die Jahrhundertwende seit 1970 verdreifacht.2 Der notwendige sozial-ökologische Umbau der Gesellschaften gelingt nur in wenigen Bereichen und ist bei Weitem nicht ausreichend.3 Mehr noch, er wird durch höchst dynamische nichtnachhaltige Entwicklungen konterkariert: Die Autos werden im Durchschnitt größer und mit stärkeren Motoren ausgestattet, der Flugverkehr nimmt weiter zu, der Fleischkonsum bleibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf hohem Niveau, und die ökologisch wenig nachhaltig produzierten Smartphones wurden in den letzten Jahren fest im Alltag der Menschen verankert. Vergegenwärtigen wir uns vor diesem Hintergrund einige jüngere Entwicklungen.
Von der Doppelkrise zur multiplen Krise
Die Ausrufung des Zeitalters »nachhaltiger Entwicklung« vor 25 Jahren in Rio de Janeiro war ein Meilenstein. Auf der Weltkonferenz zu Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im Juni 1992 wollte die sogenannte Weltgemeinschaft einen Startschuss dazu abgeben, die »Doppelkrise« von Umwelt und Entwicklung anzugehen.4 Nach dem Ende der Blockkonfrontation, angesichts eines steigenden Umweltbewusstseins in vielen Ländern und des offensichtlichen Scheiterns klassischer Entwicklungsstrategien, die ökologische Fragen weitgehend ausblendeten, wurde eine Umorientierung angestrebt. Die beiden »Rio-Konventionen« zu Klima und biologischer Vielfalt sowie die Agenda 21 sollten einen globalen Rahmen für lokale, nationale und regionale Politiken schaffen. Auf der internationalen Ebene entwickelte sich die Vorstellung eines »globalen Umweltmanagements«5: Wenn nur die richtigen politischen Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, so die Annahme, dann lassen sich die Probleme lösen und ein sozial-ökologischer Umbau vorantreiben. Das Leitbild der »nachhaltigen Entwicklung« schillerte.
Kritische Stimmen – etwa im Umfeld der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) – merkten bereits damals an, dass trotz der ehrgeizigen Ziele vieles nicht angesprochen wurde. Dazu gehörte etwa die kapitalistische Globalisierung: Sie war kein Thema, obwohl seit Mitte der 1980er-Jahre über eine Welthandelsorganisation verhandelt wurde, die dann 1995 tatsächlich zustande kam. Der Geist, aus dem sie geschaffen wurde, durchdrang auch die internationale Umweltpolitik: Sowohl die Klimarahmen- als auch die Biodiversitätskonvention setzten bei der Bekämpfung der ökologischen Krise wesentlich auf Marktmechanismen. Ebenso kein Thema waren die imperialen Nord-Süd-Verhältnisse, obwohl der zweite Golfkrieg eineinhalb Jahre vor der Rio-Konferenz begann und der damalige US-Präsident Bush betonte, der US-amerikanische Lebensstil sei nicht verhandelbar. Und schließlich hinterfragte nach Rio kaum jemand, ob denn die bestehenden politischen Institutionen – sei es auf lokaler und nationalstaatlicher, sei es auf internationaler Ebene – die Probleme überhaupt angehen könnten. Die Debatte über Globalisierung und über die Schwächung oder Veränderung des Staates fand kaum in den Diskussionen um nachhaltige Entwicklung statt – dort dominierte ein starkes Vertrauen in Staat und Regierungen.
2007/08 wurde die Diskussion um Nachhaltigkeit durch die Wirtschafts- und Finanzkrise modifiziert. Umweltpolitische Anliegen gerieten unter Druck, weil es nun ums (vermeintliche) »Kerngeschäft« ging, nämlich die Sicherung von kapitalistischem Wachstum, Produktion und Arbeitsplätzen. Die Abwrackprämie in Deutschland und die Schrottprämie in Österreich stehen als Beispiel dafür, wie in der Krise Unternehmen, Gewerkschaften und Politik einen Schlüsselsektor der deutschen und österreichischen Industrie – in Kombination mit Kurzarbeit – stabilisierten. Als Teil des zweiten Konjunkturpaketes im Jahr 2009 förderte die deutsche Bundesregierung mit der »Umweltprämie« den Kauf eines neuen Autos mit 2.500 Euro (insgesamt handelte es sich um 5 Milliarden Euro). Von Januar bis September 2009 wurden mit der Prämie 1,75 Millionen Neuwagen angeschafft. In Österreich wurde die Anschaffung von 30.000 Neuwagen mit jeweils 1.500 Euro bezuschusst, um die Automobilzulieferer zu unterstützen. Aus kurzfristiger ökonomischer Sicht war das durchaus sinnvoll, um nicht Menschen entlassen zu müssen und um wichtige Produktionskapazitäten zu erhalten, die ggf. verloren gegangen wären. Aus sozialer Sicht hatten Abwrack- und Schrottprämie eine gewisse Schlagseite, weil dadurch gerade die mächtigen Industrien mit ihren gewerkschaftlich organisierten, gut bezahlten und weitgehend männlichen Arbeitsplätzen gestützt wurden. In anderen wirtschaftlich ebenso relevanten Branchen wie der Pflege gab es weit weniger politische Unterstützung für die Beschäftigten. Und aus ökologischer und auch aus langfristiger ökonomischer Perspektive ist die Stabilisierung einer Branche, die ohnehin tiefgreifend umgebaut werden muss, durchaus problematisch. Ein Neuwagen emittiert in der Regel zwar weniger Schadstoffe als ein älteres Modell. Da der »ökologische Rucksack« eines Autos – also der gesamte Material- und Energieaufwand, der für seine Herstellung, Nutzung und Entsorgung erforderlich ist – aber über dessen gesamte Lebensdauer abgeschrieben wird, verbleibt eine nicht abgeschriebene »Restschuld«, wenn ein Fahrzeug früher als nötig verschrottet wird. Und genau dafür wurden mit der Abwrack- und Schrottprämie Anreize geschaffen.6
Solchen ökologisch wenig sensiblen Krisenpolitiken zum Trotz wurde zur selben Zeit – und dann insbesondere seit dem Scheitern der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen und der Entstehung einer globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit – die ökologische Krise repolitisiert. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011, die in einigen Ländern zu einer stärkeren Förderung erneuerbarer Energien führte (oder aufgrund derer diese Förderung zumindest zum politisch deklarierten Ziel wurde), sowie die Dramatik im Vorfeld und auf der Pariser Klimakonferenz Ende 2015, auf der es um ein Folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll von 1997 ging, sind vielen noch gut in Erinnerung.
Im Vergleich zu den umweltpolitischen Debatten der 1990er-Jahre hat sich der Kontext jedoch in zweierlei Hinsicht deutlich verschoben. Erstens gingen der spektakuläre wirtschaftliche Aufstieg einiger vormaliger Entwicklungsländer und die damit einhergehenden Wohlstandsgewinne für Teile der Bevölkerung mit einer enormen Zunahme der Förderung und Nutzung natürlicher Ressourcen sowie mit steil ansteigenden Treibhausgasemissionen einher. Schon heute etwa weisen einige Schwellenländer in absoluten Zahlen – also nicht pro Kopf – größere CO2-Emissionen auf als viele OECD-Länder, Tendenz steigend: China emittierte im Jahr 2014 etwa 9,7 Milliarden Tonnen CO2 und damit pro Kopf etwa sieben Tonnen, die USA im Vergleich 5,6 Milliarden Tonnen (allerdings pro Kopf 17 Tonnen).7 Um diese Mengen einzuordnen: Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen geht davon aus, dass jeder Mensch im Zeitraum von 2010 bis 2050 über ein jährliches »Budget« von 2,7 Tonnen CO2 verfügt.8 Das heißt, er oder sie darf im Durchschnitt pro Jahr nicht mehr emittieren als diese Menge, damit das 2-Grad-Ziel in der Klimapolitik9 mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent erreicht werden kann. In dieser Rechnung ist das Wachstum der Weltbevölkerung noch nicht berücksichtigt.
Zweitens wird seit Beginn der Krise 2007/08 zunehmend anerkannt, dass es sich bei der derzeitigen Krise um eine multiple oder Vielfachkrise handelt:10 Neben der Finanz- und Wirtschaftskrise werden auch ökologische Dimensionen berücksichtigt. Ein linksliberaler Londoner Thinktank, die New Economics Foundation, spricht vom triple crunch, also einer Dreifachkrise: der Finanzmärkte, des Klimawandels und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen.11 Doch der Begriff der multiplen Krise nimmt weitere Aspekte in den Blick: Die Krise politischer Repräsentation und der etablierten Parteien beispielsweise hängt damit zusammen, dass Letzteren immer weniger die Bearbeitung der drängenden Probleme zugetraut wird. Gerade die Krise seit 2007/08 zeigte, dass konservative, liberale und sozialdemokratische Parteien zuvorderst die Interessen der Eliten vertreten. Das führt in vielen Ländern zur Bildung neuer Parteien oder zur Stärkung von solchen, die bislang wenig Bedeutung hatten. In den meisten Ländern Europas handelt es sich dabei um rechte und rechtsextreme Parteien, aber in Griechenland, Portugal, Slowenien oder Spanien kam es auch zur Stärkung linker Parteien.12 Seit Sommer 2015 verschärfte sich die Repression seitens der mitunter schon lange währenden autoritären beziehungsweise gewalttätigen Regime wie des türkischen gegenüber oppositionellen Gruppen, Bürgerkriege wie jener in Syrien nehmen an Brutalität zu, und die negativen Effekte der kapitalistischen Globalisierung in anderen Ländern zeigen sich immer deutlicher. Die unter dem Druck der Weltmarktkonkurrenz ohnehin prekären Lebensverhältnisse werden untragbar. Die Flüchtlingsbewegung (»Flüchtlingskrise«) ist eine Reaktion darauf. Viele Menschen im globalen Norden zeigen sich solidarisch mit den Flüchtlingen – andere begegnen ihnen jedoch offen rassistisch. Wir erleben zudem eine Krise der sozialen Reproduktion, die durch Verarmung, gesellschaftliche Spaltung und Einschnitte in soziale Netze verursacht ist. Damit kommt es auch zu einer Krise der etablierten Geschlechterverhältnisse, weil insbesondere Frauen mit Zusatzarbeiten belastet werden.13
Die multiple Krise manifestiert sich für Länder, Bevölkerungsgruppen und Individuen höchst unterschiedlich, gleichwohl kann von einer weitweiten Krise gesprochen werden. Vor 25 Jahren wurde noch angenommen, dass die »Doppelkrise« von Umwelt und Entwicklung zuvorderst die Menschen in den Ländern des globalen Südens treffen würde. Die multiple Krise heute ist eine des globalen Entwicklungsmodells.
Die siebzehn konkreten und operationalisierten »Ziele nachhaltiger Entwicklung« (Sustainable Development Goals, SDGs) sind prominenter Ausdruck davon. Sie wurden in der UNO-Generalversammlung im September 2015 nach einem dreijährigen Prozess als Entwicklungsagenda 2030 verabschiedet. Inwiefern es nun zu weitreichenden Veränderungen kommt oder ob die Anstrengungen im Modus einer ökologischen Modernisierung verbleiben, muss die Zukunft zeigen (vgl. Kapitel 7). Für unseren Zusammenhang ist jedoch wichtig: Waren die 2001 verabschiedeten Entwicklungsziele zur Jahrtausendwende (Millennium Development Goals, MDGs) noch stark auf die Länder des globalen Südens hin und an klassischen Entwicklungsthemen ausgerichtet, so gelten die SDGs für alle Länder und geben sozial-ökologischen Fragen einen hohen Stellenwert.
In der Präambel wird ein hoher Anspruch formuliert: »Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine Transformation der Welt zum Besseren stattfinden.«14 Einige wichtige Ziele lauten beispielsweise, dass Subventionen für fossile Energien oder für Agrarexporte auslaufen sollen (Ziele 12.c und 2.b). In einem solchen Dokument, das von 193 Regierungen verabschiedet wird, gibt es jedoch auch viele Kompromisse. Unternehmen etwa sollen, so die recht weiche Formulierung, »dazu angehalten« werden, nachhaltige Verfahren und Nachhaltigkeitsberichterstattung einzuführen (Ziel 12.6.). Ziel 8 ist ein »dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum«.
Die SDGs könnten als Ahnung der globalen politischen Eliten interpretiert werden, dass erstens die klassischen Entwicklungsstrategien des kapitalistischen Weltmarktes nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ökologischen und multiplen Krise immer weniger funktionieren, dass zweitens die imperiale Politik der Kontrolle großer Weltregionen nicht mehr gelingt und dass drittens ein Mechanismus wahrscheinlich der Vergangenheit angehört: Krisen in ihren negativsten Auswirkungen tendenziell in andere Regionen, nämlich jene des globalen Südens, und, wie besonders am Beispiel des Klimawandels oder des Atommülls sichtbar, in die Zukunft zu externalisieren. Eine Kontinuität zu früheren Dokumenten liegt jedoch im ungebrochenen politischen Steuerungsoptimismus.
Große Transformation?
Der inzwischen sehr verzweigte Diskurs über nachhaltige Entwicklung und seine Spezifizierung in Form der SDGs und anderer Strategien wie jener einer Grünen Ökonomie (vgl. Kapitel 7) ist weiterhin hochgradig relevant. Und eine übergreifende Klammer scheint es auch zu geben. Verfolgt man die wissenschaftlichen Diskussionen der letzten fünf Jahre, scheinen wir in ein Zeitalter der Transformation einzutreten: einer Großen oder sozial-ökologischen Transformation, einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit.15 Auch die Vereinbarung zu den SDGs ist überschrieben mit »Transforming Our World – the 2030 Agenda for Sustainable Development«. Wie vor über zwei Jahrzehnten beim Begriff der nachhaltigen Entwicklung handelt es sich bei jenem der Transformation um ein ambitioniertes Konzept, das einen politisch-strategischen Raum öffnen soll, um die gewaltigen Probleme unserer Zeit anzugehen.
Für die deutschsprachige Diskussion ist das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) von 2011 bis heute ein wichtiger Referenzpunkt. Im Zentrum steht das Argument, dass die Gesellschaften ihre energetische Grundlage auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Die Schlagworte lauten »Dekarbonisierung« und Überwindung einer »fossilnuklearen« Wirtschaftsweise, was durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Verringerung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Energieeffizienz erreicht werden soll. Eine solche Transformation soll zuvorderst und dringend in den frühindustrialisierten Ländern, mittelfristig jedoch weltweit stattfinden. Das WBGU-Gutachten wie auch die meisten anderen Beiträge zur Transformation untersuchen Veränderungsprozesse hin zu Nachhaltigkeit, wollen diese vorantreiben sowie weitere anstoßen.
Der Begriff der Transformation ist zwar längst nicht so prominent wie jener der »nachhaltigen Entwicklung«. Dennoch erfüllt er in den aktuellen Fachdiskussionen eine ähnliche Funktion: Die ökologische Krise wird in einen breiteren Kontext gestellt.
Ähnlich wie der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist jedoch auch jener der Transformation wenig konkret. Transformation wird – so eine repräsentative Definition – verstanden als »fundamentale Veränderung (shift), die Werte und Routineverhalten hinterfragt und herausfordert sowie vormalige Perspektiven verändert, um Entscheidungen und Entwicklungspfade rationaler zu machen«.16 Sie bezieht sich »auf Veränderungen der systemischen Eigenschaften von Gesellschaften und umfasst soziale, kulturelle, technologische, politische, wirtschaftliche und rechtliche Veränderungen«.17
Auch wenn der Transformationsbegriff noch wenig gesellschaftspolitische Relevanz hat, so ist er in Fachkreisen durchaus wichtig. Das deutet auf Elitendissense darüber hin, wie die multiple Krise im Rahmen der bestehenden kapitalistischen Formation zu bearbeiten wäre – zunehmend wird anerkannt, dass neoliberale Orientierungen in die Irre führen. »Transformation« geht deutlich über die bislang dominanten umweltpolitischen und Nachhaltigkeitsperspektiven hinaus, die davon ausgehen, dass mit Technologien und Investitionen – und den entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten und politischen Rahmenbedingungen – ein Übergang in eine kohlenstoffarme Gesellschaft erreicht werden kann. Stattdessen werden grundlegendere Veränderungen für nötig gehalten, die von »Pionieren des Wandels« wie ökologisch orientierten Unternehmen, BürgerInneninitiativen oder WissenschaftlerInnen vorangetrieben werden sollen.18 Ergänzt wird das durch Hoffnungen auf einen gesellschaftlichen Wertewandel hin zur Nachhaltigkeit.
Dabei werden Hindernisse wie Pfadabhängigkeiten, die mächtigen Interessen der Energie- und Automobilindustrie, aber auch das dominante Wissenschaftssystem durchaus benannt. »Die am schwierigsten zu induzierenden Veränderungen der Großen Transformation sind jenseits der Technologien angesiedelt – etwa die Veränderung von Lebensstilen, eine globale Kooperationsrevolution, die Überwindung von Politikblockaden sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit generationenübergreifenden Langfristveränderungen«.