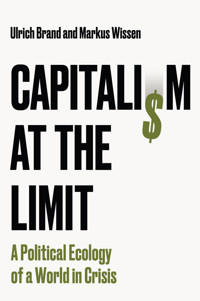Ulrich Brand, Markus Wissen
Kapitalismus am Limit
Öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektivent
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHGoethestraße 28, 80336 München
Umschlaggestaltung: Laura DenkeLektorat: Laura KohlrauschKorrektorat: Petra KienleTypografie & Satz: Ines Swoboda
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-98726-304-0
https://doi.org/10.14512/9783987262951
Wir danken der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Förderung
»Kapitalismus am Limit von Ulrich Brand und Markus Wissen ist ein brillant geschriebenes, von großem empirischen und konzeptuellen Wissen genährtes Zeitdokument. Der Kapitalismus wird in naher Zeit enden. Hoffentlich, bevor er den Planeten und die menschliche Gesellschaft zerstört hat. Wie eine postkapitalistische Produktionsweise beschaffen sein wird, hängt weitgehend von der solidarischen Überwindung der imperialen Lebensweise ab. Die Kämpfe, die uns dazu bevorstehen, analysiert dieses höchst eindrückliche Buch.«
Jean Ziegler
»Ich habe mich auf der Stelle festgelesen. Wer sich fragt, wie wir noch Bewegung in die spät-kapitalistische Todesstarre kriegen, findet hier systematische Antworten und einen Wegweiser in die solidarische SelbstbegrenzungEin unverzichtbares Buch!«
Eva von Redecker
»Corona-Pandemie, Inflation, Klimakrise – der Kapitalismus hat keine Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Vielmehr noch: Die Krise ist Normalzustand. Dieses Buch ist nicht nur eine Erklärung, sondern auch Anleitung für ein anderes Morgen.«
Carla Reemtsma
»Der Systemsturz des Kapitalismus findet nicht automatisch und egalitär statt. Das bedeutsame Buch von Ulrich Brand und Markus Wissen beleuchtet die Bedingungen für die solidarische Überwindung der imperialen Lebensweise im globalen Norden und für den Kampf gegen Krieg und Faschismus. Es ist ein Muss für alle, die an einer emanzipatorischen Zukunft mitarbeiten wollen.«
Kohei Saito
»Die imperiale Lebensweise ist schon ins progressive Wörterbuch eingegangen. Es steht schwer zu befürchten, dass die Argumente und Formulierungen im neuen Buch von Brand und Wissen unseren Diskurs – geradezu sprichwörtlich – bereichern werden.«
Ilija Trojanow
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitalismus und Klimakrise
Kapitel 2
Monströse Normalität
Kapitel 3
Chronologien einer Krise
Kapitel 4
Grüner Kapitalismus
Kapitel 5
Öko-imperiale Spannungen
Kapitel 6
Autoritäre Politiken
Kapitel 7
Solidarische Perspektiven
Anmerkungen
Literatur
Über die Autoren
Abkürzungsverzeichnis
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BRI
Belt and Road Initiative
BRICS
Forum der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (erweitert Mitte 2023)
BUND
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
CBD
Convention on Biological Diversity (Übereinkommen über die biologische Vielfalt)
COP
Conference of the Parties (Vertragsstaatenkonferenz)
EGD
European Green Deal
EU
Europäische Union
FFF
Fridays for Future
IEA
International Energy Agency (Internationale Energieagentur)
IGBCE
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat)
IPCEI
Important Project of Common European Interest (Wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse)
IRA
Inflation Reduction Act (Gesetz zur Reduzierung der Inflation – Investitionsprogramm der Biden-Administration von 2022)
IWF
Internationaler Währungsfonds
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OPEC
Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organisation erdölexportierender Länder)
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr
ÖVP
Österreichische Volkspartei
SIPRI
Stockholm International Peace Research Institute
SUV
Sport Utility Vehicle
UNEP
United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
UNO
United Nations Organization (Organisation der Vereinten Nationen)
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen)
WTO
World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
Vorwort
Dieses Buch ist das Produkt einer langjährigen freundschaftlichen wissenschaftlichen und politischen Kooperation der beiden Autoren. Nach anfänglichen Zweifeln und Suchprozessen, ob wir es uns in dieser sich rasch verändernden und unübersichtlichen Welt zutrauen können, das große Ganze zu denken, haben wir es aus unserer Sicht zu einem guten Ende gebracht. Doch es wäre in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen ohne die vielen Diskussionen, Anregungen und Rückmeldungen zu Kapitelentwürfen und einzelnen Argumentationsgängen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Beteiligten. Wir schätzen uns sehr glücklich, in inhaltlich derart inspirierende und solidarische Kontexte eingebunden zu sein.
Zuvorderst ist der Rosa-Luxemburg-Stiftung – und allen voran Mario Candeias und Barbara Fried, damalige Direktor*innen des Instituts für Gesellschaftsanalyse (IfG) – für die Gewährung von Forschungsstipendien zu danken, mit denen wir zwischen 2021 und 2023 die Grundlage zu diesem Buch legen konnten. Ein wichtiger Diskussionszusammenhang während dieser Zeit war neben dem monatlichen IfG-Kolloquium der Jour fixe »Ökosozialistische Strategien«. In diesem Rahmen haben wir uns zehnmal getroffen, um begrifflich, konzeptionell und ausgehend von konkreten Erfahrungen in Bereichen wie Energie, soziale Infrastrukturen, Landwirtschaft oder Mobilität die Eckpunkte eines emanzipatorischen sozial-ökologischen Projekts zu diskutieren. Wir danken allen Teilnehmer*innen und Vortragenden für die vielfältigen Anregungen. Besonders bedanken wir uns bei Nina Treu, die den Jour fixe koordiniert hat.
Bei einem eintägigen Workshop in der Stiftung im Dezember 2022 haben wir erste Überlegungen zu einzelnen Buchkapiteln vorgestellt und aufgrund der instruktiven Rückmeldungen das Konzept noch einmal überarbeitet. Das Graduiertenkolleg »Krise und sozial-ökologische Transformation«, das das Studienwerk der Stiftung gemeinsam mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin initiiert hat, war und ist für uns ein wichtiger und äußerst anregender Kontext. Ein großes Dankeschön dafür geht an die Stipendiat*innen, die Assoziierten, die Steuerungsgruppe sowie an Marcus Hawel und Jane Angerjärv, ohne die es das Kolleg nicht gäbe. Bei zwei Dissertant*innen-Seminaren von Kristina Dietz und Ulrich Brand im Mai und im Dezember 2023 gab es hilfreiche Rückmeldungen zu spezifischen Ideen.
Für wichtige Rückmeldungen danken wir: Frank Adler, Axel Anlauf, Lia Becker, Alexander Behr, Tobias Boos, Alina Brad, Michael Brie, Achim Brunnengräber, David Caicedo Sarralde, Kristina Dietz, Ines Dombrowsky, Simon Dreier, Wiebke Dreier, Dennis Eversberg, Gabriel Eyselein, Daniel Fuchs, Karin Gabbert, Christoph Görg, Tobias Haas, Christine Höbermann, Uwe Hoering, Sagal Hussein, Thomas Jahn, Tim Köhler, Mathias Krams, Stephan Krull, Steffen Kühne, Andreas Lob-Hüdepohl, Danyal Maneka, Julian Niederhauser, Anna Niesing, Carla Noever Castelos, Benjamin Oprakto, Lia Polotzek, Oliver Prausmüller, Johannes Rendl, Wolfram Schaffar, Jakob Scherer, Nina Schlosser, Stefan Schmalz, Matthias Schmelzer, Etienne Schneider, Dieter Segert, Stefan Schoppengerd, Florian Steig, Anne Tittor, Johannes Waldmüller, Christa Wichterich, Gerrit von Yorck und Florian Zschoche. Pia Kauer und Patrick Makal danken wir für ihre engagierte Recherche und Zuarbeit, Christian Prinz für seine versierte technische Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts. Und wir danken unseren Familien für die Toleranz in intensiven Arbeitsphasen.
Die Zusammenarbeit mit dem oekom-Verlag ist eine Freude. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter*innen für die professionelle Kooperation bei der Bucherstellung und für die Vorbereitung der vielen Tätigkeiten, die auf die Veröffentlichung des Buches folgen. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Laura Kohlrausch, die uns im letzten Jahr intensiv begleitete und viele gute Ratschläge gab. Sie hat das Manuskript mit ihrer inhaltlichen Neugierde am Thema sowie mit Vorschlägen, den Text an wichtigen Stellen lesbarer und verständlicher zu machen, wesentlich verbessert.
Uns alle verbindet das gemeinsame Interesse am Verstehen der Dynamiken und Ursachen, welche die Lebensverhältnisse von immer mehr Menschen sowie die biophysischen Grundlagen des Zusammenlebens zunehmend verschlechtern. Und uns eint die Überzeugung, dass über engagiertes und strategisch umsichtiges Handeln doch eine bessere Zukunft und die Bedingungen für ein gutes Leben für Alle entstehen können. Wenn das Buch auch bei den Leser*innen Denkprozesse auslöst, Zusammenhänge erkennen und aktuelle Entwicklungstendenzen besser einordnen lässt, wenn es zum Handeln und Weitermachen ermutigt, dann hat es seinen Sinn erfüllt.
Berlin / Wien, im Januar 2024
Kapitel 1
Kapitalismus und Klimakrise
Die sozial-ökologische Krise ist so schwerwiegend, dass wir uns der Realität des Kollapses nicht entziehen können: Er findet statt und wir müssen jetzt Entscheidungen treffen.
Maristella Svampa1
Im Jahr 2022 sorgte eine Gruppe prominenter Klimaforscher*innen für Aufsehen. Das internationale Team warnte vor der Gefahr eines möglichen climate endgame.2 Die Klimakrise, so das Argument, könnte sich zu einer globalen Katastrophe entwickeln, die nicht nur den Kollaps von Gesellschaften, sondern die komplette Auslöschung der Menschheit zur Folge haben würde. Die gängigen Klimaszenarien unterschätzten diese Möglichkeit. Sie konzentrierten sich zu sehr darauf, die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs um 1,5 oder 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter abzubilden. Gegenwärtig steuere die Welt aber auf einen Anstieg von 2,1 bis 3,9 Grad bis zum Jahr 2100 zu. Die damit verbundenen Risiken, vor allem jene, die aus der wechselseitigen Verstärkung unterschiedlicher Krisen resultieren – Klimakrise, Biodiversitätsverlust oder Pandemien –, seien noch zu unbekannt, um das Schlimmste auszuschließen. Wir sollten daher ernsthaft auch mögliche worst-case-Szenarien analysieren. Zu diesem Zweck schlagen die Klimawissenschaftler*innen Untersuchungen vor, die neben der Modellierung von Risiko-Kaskaden und extremen Temperaturanstiegen auch die Erforschung von früheren gesellschaftlichen Zusammenbrüchen beinhalten.
Bemerkenswert an dem climate-endgame-Text ist zweierlei: Zum einen werfen die Autor*innen äußerst dringende und relevante Fragen auf. Ihre Annahme, dass alles noch schlimmer kommen könnte als in den bisher entwickelten Szenarien vorhergesagt, klingt durchaus plausibel: So zeigt der Copernicus Climate Change Service in einer Studie, dass das Jahr zwischen November 2022 und Oktober 2023 wahrscheinlich das wärmste seit 125.000 Jahren war.3 Dazu kommen die jüngsten politischen Entwicklungen wie Kriege, umweltpolitisches Versagen und der Aufstieg einer autoritären Rechten.
Umso auffälliger ist es zum anderen, dass sich die vorgeschlagene Forschungsagenda nahezu gänzlich über die gesellschaftlichen Ursachen der Klimakrise ausschweigt: über die ihr zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse und die Akteure,4 die eine Katastrophe vielleicht noch verhindern könnten. Um was genau wird beim climate endgame gespielt? Wer sind die Spielerinnen und Spieler? Spielen sie alle mit denselben Voraussetzungen oder starten einige mit einem riesigen Sack voller Macht und Geld, während die anderen eher schlechte Karten haben? Wer bestimmt die Spielregeln? Und arbeiten in diesem makabren Spiel wirklich alle darauf hin, den worst case möglichst zu verhindern? Solche Fragen sucht man in dem Text vergeblich. Wenn es ums Ganze der Menschheit geht, so ließe sich die implizite Prämisse etwas überspitzt charakterisieren, dann zählen primär die harten naturwissenschaftlichen Fakten. Mit sozialwissenschaftlichen Differenzierungen kann man sich nicht länger aufhalten. Schließlich sitzen alle im selben Boot. Und das droht akut zu sinken.
Die Autor*innen des endgame-Textes lassen sich den Erdsystemwissenschaften zurechnen. Diese befassen sich mit den ganz großen Fragen: den »planetaren Grenzen« oder dem Übergang der Menschheit in ein neues Erdzeitalter namens »Anthropozän«. Zunehmend werfen sie auch einen Seitenblick auf die sozialen Dimensionen der ökologischen Krise: Sie nehmen zur Kenntnis, dass soziale Ungleichheit ein Krisentreiber ist, und merken kritisch an, dass diejenigen, die am wenigsten Verantwortung für die Krise tragen, am stärksten von ihr betroffen sind. Nach den gesellschaftlichen Verhältnissen, die diese Ungleichheiten hervorbringen, fragen sie jedoch nur selten.5 Eher scheint die Überzeugung vorzuherrschen, dass die dramatischen Befunde irgendwann schon aufrütteln würden, dass »die Macht« in Form von staatlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsträger*innen letztlich nicht mehr umhinkönne, »der Wahrheit«, also der Wissenschaft, Gehör zu schenken und deren Erkenntnisse in eine wirksame Krisenpolitik zu übersetzen. »Die effektive Kommunikation der Forschungsergebnisse wird entscheidend sein«, schreiben die endgame-Autor*innen hoffnungsvoll.6
Nicht zuletzt die Erfahrungen mit der deutschen Ampel, die 2021 als »Fortschrittskoalition« gestartet war und die soziale Marktwirtschaft als sozial-ökologische Marktwirtschaft neu begründen wollte, zeigen, dass es sich bei dieser Hoffnung um einen Trugschluss handelt.7 Das liegt nur zum Teil daran, dass in der Ampel mit der FDP eine reformresistente Klientelpartei über ein enormes Erpressungspotenzial verfügt und nicht zögert, dieses bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu aktivieren. Das Problem hat vielmehr tiefere Ursachen: Die Apparate des kapitalistischen Staates verfügen über eine enorme Kapazität, noch das größte Problem kleinzuarbeiten oder gar zu ignorieren. Wird dann doch einmal ein ambitionierterer politischer Entwurf gewagt, so gerät dieser schnell in die Mühlen einer durch die Boulevardpresse verstärkten konservativ-populistischen Meinungsmache. Ganz ähnlich kann man das in Österreich beobachten, wo die konservativ-grüne Regierungskoalition Anfang 2020 mit dem Motto »Das Klima und die Grenzen schützen« antrat. Die ÖVP, große Teile der staatlichen Apparate, in denen es bis heute kaum ökologische Orientierungen gibt, sowie konservative Medien und der Boulevard erschweren eine weitreichende sozial-ökologische Politik.
Das ist kein Zufall und auch nicht nur eine Frage der Parteienkoalition, die im jeweiligen Parlament gerade über eine Mehrheit verfügt. Vielmehr handelt es sich, so eine bereits 50 Jahre alte, aber immer noch treffende Formulierung von Claus Offe, um »die nicht-zufällige (d. h. systematische) Restriktion eines Möglichkeitsraumes«8: Staatliche Politik im Kapitalismus ist strukturell begrenzt durch gesellschaftliche Orientierungen und tief verankerte Herrschaftsverhältnisse, die sich in die staatlichen Apparate (Ministerien, Parlamente oder Notenbanken) einschreiben, vom staatlichen Personal verinnerlicht werden und den Horizont dessen abstecken, was politisch als möglich gilt.
So müssen Umweltpolitiker*innen, die für den Übergang zur Elektro-Automobilität kämpfen, zwar mit dem Widerstand der Verfechter fossiler Freiheiten rechnen. Aber ihr Anliegen ist dennoch anschlussfähig an die grundlegenden Logiken, die in Gesellschaft und Staatsapparaten walten: die Logik der Innovation, der Stärkung einer Kernindustrie des deutschen beziehungsweise österreichischen Exportmodells, des Erhalts von Arbeitsplätzen für eine mehrheitlich männliche Industriearbeiterschaft, des Ausbaus automobiler Infrastrukturen, der automobilen Lebensweise. Wer sich dagegen für eine – aus klimapolitischen Gründen dringend gebotene – Überwindung des autozentrierten Verkehrssystems und der automobilen Lebensweise einsetzt, gerät mit genau diesen Logiken in Konflikt. Solch ein Anliegen befindet sich jenseits des Horizonts dessen, was als sag- oder machbar gilt, es hat den viel beschworenen »Boden der Realität« verlassen – einer sehr spezifischen Realität freilich, die sich systematisch gegen eine problemadäquate Wahrnehmung und Behandlung der sehr realen Klimakrise sperrt. Hier auf die aufrüttelnde Wirkung wissenschaftlicher Befunde und eine effektive Kommunikation derselben zu vertrauen, ist ein unzureichendes und mitunter durchaus frustrierendes Unterfangen.
Das gilt noch stärker im Hinblick auf internationale Organisationen, in die sich die Kräfteungleichgewichte einer fossil getriebenen Weltwirtschaft noch viel unvermittelter einschreiben können als in die zumindest teilweise noch liberaldemokratisch ausbalancierten nationalen Arenen. Dies zeigte etwa die Weltklimakonferenz 2023 in Dubai. Sie wurde vom Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Sultan Ahmed al Dschabir, geleitet, der gleichzeitig dem staatlichen Ölkonzern vorsteht. Die vermeintliche Kraft des besseren, weil durch wissenschaftliche Einsichten gestützten Arguments kollidierte hier besonders augenfällig mit den Interessen einer fossilistischen Politik und Ökonomie, die versuchen, auch die umweltpolitischen Arenen zu übernehmen.9
Kapitalismus am Limit
Damit wollen wir nicht sagen, dass man sich gar nicht erst auf (internationale) staatliche Politik und bürgerliche Öffentlichkeit einlassen und versuchen sollte, den Horizont des hier Sag- und Machbaren zu erweitern. Es ist aber wichtig, sich der systemischen Grenzen eines solchen Unterfangens ebenso bewusst zu sein wie der Tatsache, dass dieses nur dann erfolgreich sein kann, wenn es vom Rückenwind progressiver gesellschaftlicher Kräfte angetrieben wird. Letztlich kommt es darauf an, die politischen Handlungsmöglichkeiten dadurch zu erweitern, dass die sie einschränkenden gesellschaftlichen Verhältnisse überwunden werden: Verhältnisse, die nicht nur die Natur und nicht-menschliche Lebewesen im großen Stil zerstören, sondern in denen auch der Mensch – als Teil der Natur – »ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.10
Dazu bedarf es eines klaren Blicks auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die oft als selbstverständlich oder natürlich hingenommenen Logiken, die unserer Lebensweise zugrunde liegen – und die nicht selbstverständlich oder alternativlos sind. Wir brauchen ein Verständnis des Kapitalismus und dessen vielfältiger Verbindungen mit patriarchalen, rassifizierten und kolonialen Herrschaftsverhältnissen. Und vor allem brauchen wir angesichts der tiefen Krise, in der wir uns befinden, eine Vorstellung von den Grenzen des Kapitalismus, genauer gesprochen von den vielfältigen Grenzen, an die kapitalistische Gesellschaften aufgrund der ihnen innewohnenden Funktionslogiken heute stoßen und die sie mit katastrophalen Folgen zu überschreiten drohen. Um die Zeitdiagnose eines Kapitalismus am Limit geht es in diesem Buch.
Unsere These ist, dass die kapitalistische Produktionsweise und die mit ihr verbundene imperiale Lebensweise die entscheidende Ursache dafür sind, dass die Menschheit die planetaren Grenzen überschreitet und sich in einen potenziell katastrophischen Bereich manövriert. Dies führt zu vielfältigen Konflikten, die die Krise potenziell noch verschärfen, in denen aber auch solidarische Alternativen aufscheinen. Zu deren Stärkung beizutragen, ist unser zentrales Anliegen.
Der Kapitalismus ist aufgrund der ihm innewohnenden Konkurrenz-, Wachstums- und Profitlogik strukturell blind gegenüber seinen eigenen sozialen und ökologischen Voraussetzungen. Der Zwang, wachsen und in einem Konkurrenzumfeld profitabel sein zu müssen, führt kapitalistische Unternehmen auf Kollisionskurs mit den reproduktiven Notwendigkeiten der menschlichen und nicht-menschlichen Natur. Für unzählige Menschen und nicht-menschliche Lebewesen bedeutete dies auch in der Vergangenheit schon enormes Leid oder gar Tod. Soziale und ökologische Standards im Sinne von Grenzziehungen mussten und müssen der Kapitalseite und dem Staat in harten Kämpfen immer wieder abgetrotzt werden.
In den geographischen Räumen und den sozialen Klassen hingegen, in denen sich die kapitalistischen Reichtümer konzentrieren, wird die sozial-ökologische Destruktivität der Produktion und des Warenkonsums kaum als solche empfunden, sondern in der Öffentlichkeit sowie in den Alltagspraktiken und -wahrnehmungen zum Verschwinden gebracht. Es wird verdrängt, dass wir die Erde und unsere Mitmenschen zerstören.
Lange Zeit ließen sich die Krisen verbergen: indem das Kapital sozial-ökologische Kosten in den globalen Süden, auf Arbeiter*innen, auf unbezahlte Reproduktionsarbeit oder auf künftige Generationen verlagerte; indem es immer neue Sphären der Rohstoff-Extraktion erschloss (wie aktuell den expandierenden Tiefseebergbau); oder indem es sogar noch im Umweltschutz ein Geschäftsfeld entdeckte. Meist bereitete dabei die gewählte Form der ökologischen Problembearbeitung die nächste, noch tiefere Krise schon vor, die Problembearbeitung war also eher eine Problemverlagerung. Die energetische Nutzung von Kohle etwa wirkte zu Beginn der Industrialisierung einem anderen ökologischen Problem entgegen, nämlich der Holzkrise. Auf lange Sicht ebnete sie jedoch den Weg in ein viel größeres Problem: die Klimakrise.
Das Neue an der gegenwärtigen Situation ist, dass sich die systemimmanenten Möglichkeiten, sozial-ökologische Krisen durch räumliche und zeitliche Verlagerungen zu bearbeiten, der Erschöpfung nähern. Anders gesagt: Die dem Kapitalismus innewohnende Tendenz der Grenzverschiebung gerät selbst an ihre Grenzen.11 Die Indizien dafür häufen sich. Und sie bemächtigen sich zunehmend des Alltags auch der Menschen im globalen Norden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die sich zuspitzenden Katastrophen durch einen konsequenten Klimaschutz und durch wirksame Politiken der Klimaanpassung in ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur zumindest zu begrenzen. Deutschland etwa wird voraussichtlich bereits Mitte des Jahrhunderts »mindestens zwei Grad wärmer sein als zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Sommertage mit mehr als 30 Grad werden dann völlig normal sein, die Spitzentemperaturen 40 Grad überschreiten, die Zahl der tropischen Nächte (in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt) wird sich verdoppeln.«12
Dabei ist die Klimakrise nur eines der Phänomene, die als Resultat ökologischer Grenzüberschreitungen krisenhaft in den Alltag hineinwirken. Eine weitere, für viele traumatische und in ihren Auswirkungen höchst ungleiche Krise war die Coronapandemie. Sie lässt sich nicht losgelöst von der Expansion einer kapitalistisch-industriellen Landwirtschaft begreifen. Denn in dem Maße, wie die Massentierhaltung zunimmt und Lebensräume für Tiere durch Abholzung und Monokulturen zerstört werden, wächst die Gefahr von Zoonosen: Menschen geraten mit Wildtieren in Kontakt, Mikroorganismen werden auf menschliche Körper übertragen, wo sie gefährliche Krankheiten auslösen können. SARS-CoV-2 ist das Resultat einer Strategie grenzenloser Expansion, die plötzlich an Grenzen gerät.13
Die Krise ist somit nicht länger lokal begrenzt, sondern global. Sie ist auch nicht länger ein zukünftiges Phänomen, das für Teile der Menschheit, vor allem die Wohlhabenden im globalen Norden, primär über wissenschaftliche Beschreibungen zugänglich wäre. Vielmehr bricht die sozial-ökologische Krise auf vielfache Weise auch in den Alltag derer ein, die bislang – auf sehr unterschiedliche Weise – von der kapitalistischen Naturzerstörung in Form der imperialen Lebensweise profitierten. Trotzdem bleibt diese inklusive des Versuchs, ihre negativen Folgen zu verlagern, weiterhin attraktiv und interessierte politische und ökonomische Kräfte tun viel dafür, sie dauerhaft zu erhalten.
Die Krise wird dadurch verschärft, dass der Bedarf an Rohstoffen und Energie für die globale kapitalistische Produktions- und Wachstumsmaschinerie immer noch zunimmt, nicht zuletzt durch die Digitalisierung und partielle Dekarbonisierung, die sogenannte twin transition. Die Folgen dieser Entwicklung sind immens: Die »billige Natur«14 in Form von Rohstoffen, Energie oder CO2-Senken, auf die der Kapitalismus angewiesen ist, wird teurer und ist zunehmend umkämpft. Zudem lassen sich die Kosten der bereits entstandenen und künftig zu erwartenden Schäden aus Katastrophenereignissen wie der Überflutung im Ahrtal oder den Waldbränden in Griechenland kaum quantifizieren. Im selben Maße, wie der Kapitalismus die Menschheit in das ungewisse Terrain jenseits der planetaren Grenzen befördert, sieht er sich also mit immer höheren selbst verursachten Kosten konfrontiert und untergräbt seine eigenen Existenzbedingungen.
Öko-imperiale Spannungen
Die staatliche Politik wird dieser Entwicklung in keiner Weise gerecht. Sie befindet sich selbst in einer tiefen Krise. Statt zur Einhegung trägt sie zur weiteren Entgrenzung des Kapitalismus und zur Eskalation des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur bei. Das ist selbst dort der Fall, wo aktuell Strategien für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft verfolgt werden. Im internationalen Maßstab werden die Versuche, die sozial-ökologische Krise zumindest teilweise abzufedern, von rasant zunehmenden geopolitischen und geoökonomischen Rivalitäten überformt. Diese entzünden sich nicht zuletzt am Zugang zu den Rohstoffen und Infrastrukturen, die für eine ökologische Modernisierung erforderlich sind, etwa Metallen oder den Kapazitäten für die Produktion grünen Wasserstoffs. Insofern handelt es sich um »öko-imperiale Spannungen«. Sie entstehen im Verhältnis der kapitalistischen Zentren untereinander sowie zwischen diesen und aufstrebenden Ländern wie China und Indien. Öko-imperiale Spannungen werden zu einem Strukturmoment der internationalen Politik und manifestieren sich immer wieder in offenen politischen Konflikten bis hin zu Kriegen.
Auch der Aufstieg rechter Kräfte in vielen Teilen der Welt ist ein politischer Ausdruck vielfältiger Krisenerscheinungen. Wir verstehen ihn als Indikator dafür, dass die Fähigkeit kapitalistischer Gesellschaften, die eigenen Widersprüche im Rahmen liberaldemokratischer Verfahren zu bearbeiten, erodiert: Die Grenzen der liberalen Demokratie als eine dem Kapitalismus im globalen Norden lange Zeit adäquate politische Form zeichnen sich ab.
Umkämpfte Krisenpolitik
All dies bedeutet nicht, dass das Ende von Kapitalismus und liberaler Demokratie unmittelbar bevorstünde. Vielmehr befinden wir uns in einer Phase des Übergangs, deren Verlauf und Dauer ebenso ungewiss sind wie das, was nach ihr kommt.
Es ist eine Phase der Suchprozesse und Kämpfe, die durchaus auch kurzzeitige, sehr selektive Stabilisierungen in Gestalt eines autoritären und/oder ökologisch modernisierten Kapitalismus beinhalten kann. So werden aktuell weltweit die Produktionsanlagen und Infrastrukturen für erneuerbare Energien stark ausgebaut, insbesondere im Strombereich.15 Viele Staaten haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Ökonomien zu dekarbonisieren und klimaneutral zu werden. Insofern leben wir auch und gerade wegen der Krisen in einer Zeit der dynamischen Restrukturierung des Kapitalismus, die in vielerlei Hinsicht nicht nur von den wirtschaftlichen und politischen Eliten, sondern auch von breiten Teilen der Bevölkerung willkommen geheißen oder zumindest als alternativlos angesehen wird. Die Ökologisierung des Kapitalismus mit dem Fokus auf seiner Dekarbonisierung hat in den letzten Jahren also deutlich an Konturen gewonnen.
Gleichzeitig steigen der Verbrauch fossiler Energieträger und entsprechend deren Förderung weltweit weiter an – buchstäblich befeuert durch einen wachsenden Energiebedarf der Weltwirtschaft etwa im Zuge der Digitalisierung, aber auch durch hohe Energiepreise, die die Investitionen in die Förderung und Verbrennung fossiler Energieträger attraktiv machen.16 Im Jahr 2022 wurden 80 Prozent der globalen Energie mit Erdöl, Kohle/Torf und Erdgas erzeugt, elf Prozent mit Biokraftstoffen – die nicht per se ökologisch und sozial nachhaltig sind – und nur jeweils ein Prozent mit Windenergie und Photovoltaik.17 Christian Zeller zufolge investiert das fossile Kapital »nach einigen Jahren zurückhaltender Investitionstätigkeit wieder verstärkt in die Erneuerung und Erweiterung der fossilen Infrastruktur«.18
Die ökologische Modernisierung des Kapitalismus – das deutet sich in diesen Entwicklungen an – birgt durchaus ökonomische und ökologische Potenziale. Aber sie konkurriert oder koexistiert mit fossilen Strategien und den konservativen sowie rechts-autoritären Kräften, die diese verfolgen. Die Kehrseite eines Grünen Kapitalismus, eines autoritär-fossilen Entwicklungsmodells oder einer denkbaren Kombination zwischen autoritär-fossilen und grünen Elementen in den Zentren sind weiter zunehmende Katastrophen: sowohl an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems als auch im Verhältnis zwischen Zentren und Peripherien und im Verhältnis der Zentren untereinander. Keineswegs ausgeschlossen ist auch ein »Kollaps« in dem Sinne, dass Infrastrukturen wegbrechen, die für die Versorgung mit basalen Gütern und Dienstleistungen – Lebensmitteln, Kleidung, Energie oder Wohnraum – essenziell sind.19 Politik reduziert sich in diesem Szenario auf ein reaktives Krisenmanagement, das wesentlich über Appelle an die individuelle Anpassungsfähigkeit und Resilienzsteigerung funktioniert. Die Funktionalitäts- als auch die Legitimationsreserven von grünen und autoritären Kapitalismusmodellen – das heißt ihr hegemoniales Potenzial, worauf wir noch eingehen werden – dürften folglich äußerst begrenzt und schnell aufgebraucht sein.20
Die sich zuspitzende sozial-ökologische Krise und die damit einhergehenden Verunsicherungen resultieren in Transformationskonflikten. Diese entstehen dort, wo die vielfältigen ökologischen Krisenerscheinungen auf gesellschaftliche Widersprüche treffen und sich in soziale Auseinandersetzungen übersetzen. Gekämpft wird um die künftigen Formen des Produzierens und Konsumierens, um die Tiefe und Reichweite der nötigen Veränderungen, um die Verteilung von deren Kosten. Es geht also um das Was und Wie der Transformation.21 Der Frankfurter Soziologe Dennis Eversberg spricht gar von einem Transformationskonflikt im Singular, denn die sozial-ökologische Krise sei »die grundlegende Matrix […], auf die fast jeder Konflikt in irgendeiner Weise zumindest partiell bezogen sein wird«.22 Das werden wir im Verlauf des Buches an verschiedenen Stellen zeigen.
Genau aus diesem Grund müssen auch die kritischen Sozialwissenschaften – im Verbund mit emanzipatorischen gesellschaftlichen und politischen Kräften und bezogen auf deren Kämpfe – die großen Fragen stellen. Das sind weniger Fragen nach den planetaren Grenzen – diesen widmen sich die Erdsystemwissenschaften. Im kritischen Dialog mit Letzteren wäre vielmehr die Frage nach den Funktionsmechanismen und Grenzen eines sozialen Systems mit seinen immer zerstörerischen kapitalistischen Naturverhältnissen aufzuwerfen, das die Menschheit mit fatalen und höchst ungleich verteilten Folgen über die planetaren Grenzen hinaus zu katapultieren droht.23
Solidarische Perspektiven
Sicherlich wäre es ein mühsames Unterfangen, dieser Frage nachzugehen, ohne dass die Kritik des Bestehenden die Chance hätte, zur praktischen Kritik im Handgemenge zu werden. Aber diese Chance besteht. Denn trotz der und gegen die dystopisch anmutenden Entwicklungen gibt es relevante gesellschaftliche Kräfte, die eine grundlegende sozial-ökologische Transformation vorantreiben. Die Bewegung für Klimagerechtigkeit und ihre jüngsten und dynamischsten Teile, Fridays for Future (FFF), Ende Gelände und Letzte Generation, tun dies vor allem im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den Generationen: Die ökologischen Hinterlassenschaften der heute Lebenden, so das Argument, schränken die Möglichkeiten künftiger Generationen zu einem selbstbestimmten Leben drastisch ein. Die linke Strömung von FFF hat diese Sichtweise um eine Analyse der sozialen Verhältnisse innerhalb der Generationen erweitert. Demnach gibt es heute wie in der Zukunft Gewinner*innen und Verlierer*innen der ökologischen Krise. Damit rücken etwa Klassenfragen ins Zentrum, der Protest verschiebt sich von Appellen an »die Politik«, den Interessen künftiger Generationen Rechnung zu tragen, zur konkreten Intervention beispielsweise in betriebliche und tarifpolitische Auseinandersetzungen.24
Der in der Arbeiter*innenbewegung und von Seiten der Gewerkschaften erhobenen Forderung nach einer just transition, einem gerechten Strukturwandel, wohnt die Verbindung von ökologischer und Klassenfrage schon terminologisch inne. Allerdings wird sie in sehr unterschiedlicher Radikalität thematisiert: einerseits in eher dialogorientierten Ansätzen, die das Problem vorrangig in den Beschäftigungswirkungen des Übergangs sehen – also im drohenden oder bereits stattfindenden Abbau von Arbeitsplätzen im Bergbau, in der Autoindustrie oder anderen Problembranchen; andererseits in radikalen Positionen, die aus einer internationalistischen Perspektive die Ungerechtigkeit des Status quo beim Namen nennen und sich für einen grundlegenden Strukturwandel und für eine gebrauchswertorientierte Reorganisation der Ökonomie einsetzen.25
Das ist auch die Stoßrichtung von dekolonialen und (öko-)feministischen Bewegungen, die die Klimakrise als Teil neokolonialer Nord-Süd-Beziehungen und einer umfassenden Krise der sozialen Reproduktion begreifen. Neben dem Kampf gegen patriarchale Gewalt sowie für eine Aufwertung von Sorgearbeit und sozialen Infrastrukturen geht es dabei zunehmend auch um die Frage, wer für die Kosten der Klimafolgenanpassung aufzukommen hat, wie diese so gestaltet werden kann, dass soziale und globale Ungleichheiten abgebaut werden, und welche Reparationen von Seiten des globalen Nordens als Ausgleich für die Schäden zu zahlen sind, die die Klimakrise im globalen Süden bereits verursacht hat.26
Viele dieser Ansätze konvergieren in der Degrowth- und Postwachstumsdebatte, die sich in jüngerer Zeit sehr dynamisch entwickelt hat.27 In ihr gehen kapitalismuskritische, dekoloniale und feministische Ansätze, kritische Sozialwissenschaft und emanzipatorischer Aktivismus eine sehr lebendige und fruchtbare Verbindung ein. Ausgehend von einer Vielzahl von Kämpfen um eine sozial-ökologische Alternative zum Bestehenden wird die reale Utopie einer Welt entwickelt und in Ansätzen praktiziert, die die absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung mit einem Zuwachs an Gleichheit und Demokratie verknüpft. Der japanische Philosoph Kohei Saito hat jüngst das ökologische Denken des (späten) Marx für die Postwachstumsdebatte fruchtbar gemacht und deren Zielhorizont auf den Begriff des »Degrowth-Kommunismus« gebracht.28
Zum Anliegen und Aufbau des Buches
Die tiefe Krise, in der wir uns befinden, hat viel dystopisches Potenzial. Oft scheint es so, als gehe es nur noch um eine »Überlebenswirtschaft« (Ulrike Herrmann).29 Die Widersprüche des Kapitalismus werden aber auch auf eine emanzipatorische Weise politisiert. Wir befinden uns mithin in einem Kairos-Moment: einer keineswegs völlig offenen, aber gestaltbaren Situation, in der soziale Kämpfe geführt werden, die über die Zukunft der Menschheit mitentscheiden. Mit diesem Buch möchten wir ein Deutungsangebot machen, das die Krise und die Widersprüche besser zu verstehen hilft. Und wir wollen zum Handeln ermutigen sowie Debatten voranbringen, in denen nach emanzipatorischen Alternativen gesucht wird. Diese werden ebenso reformorientiert wie radikal sein müssen. Ihr emanzipatorischer Gebrauchswert wird sich daran bemessen, inwieweit sie das ganz Andere und Neue in konkreten Veränderungen sichtbar werden lassen und mit diesen vorbereiten. Damit stellen wir uns in eine Denktradition, in der die notwendigen Spannungen zwischen konkreten Schritten und weitreichenden strukturellen Veränderungen strategisch produktiv gemacht werden – man denke etwa an »revolutionäre Realpolitik« (Rosa Luxemburg), »nicht-reformistische Reformen« (André Gorz), »radikalen Reformismus« (Joachim Hirsch) oder »doppelte Transformation« (Dieter Klein).
Im folgenden zweiten Kapitel schlagen wir eine Brücke zu unserem Buch Imperiale Lebensweise. Ausgehend vom Diskurs über die »Zeitenwende«, dessen Vorstellungen von gesellschaftlicher Normalität wir kritisieren, rekapitulieren wir das Grundanliegen des Konzepts der imperialen Lebensweise und erweitern dieses vor allem um klassentheoretische sowie die globalen und die Geschlechterverhältnisse betreffenden Aspekte. Das zweite Kapitel steckt damit den begrifflichen Rahmen für die Zeitdiagnose ab, die wir in den folgenden Kapiteln vornehmen.
Im dritten Kapitel setzen wir uns zunächst mit dem Konzept der planetaren Grenzen, dem Anthropozän-Narrativ, der ökologischen Ungleichheits- und der soziologischen Nachhaltigkeitsforschung auseinander. Sodann entwickeln wir unseren eigenen Begriff von der sozial-ökologischen Krise. Dabei beziehen wir uns auf einschlägige öko-marxistische, gramscianische, feministische und dekoloniale Arbeiten. Das qualitativ Neue an der heutigen Situation besteht für uns darin, dass ökologische Krisenphänomene disruptiv in die Menschheitsgeschichte einbrechen und soziale Krisen verstärken.
Im vierten bis sechsten Kapitel betrachten wir die Entwicklungen, die aus dieser Situation resultieren.30 Das vierte Kapitel widmet sich am Beispiel des European Green Deal den Tendenzen in Richtung eines Grünen Kapitalismus. Unsere These ist, dass dieser zwar wirkungsmächtig ist, aber nur über sehr begrenzte Potenziale der Krisenbearbeitung verfügt. Das liegt an den sozial-ökologischen Kosten, die er selbst produziert und auf andere in Raum und Zeit verlagert, an geopolitischen und geoökonomischen Konkurrenzen, die auch wegen der ökologischen Krise zunehmen, sowie an den sich häufenden disruptiven Krisenereignissen, die sich kaum mehr umfassend bearbeiten lassen.
Die unübersichtliche und sich rasch wandelnde internationale Lage ist Gegenstand des fünften Kapitels. Wir entwickeln den bereits erwähnten Begriff der »öko-imperialen Spannungen« vor dem Hintergrund der sich verschärfenden ökologischen Krise und von drei weiteren globalen Entwicklungen: der Krise der neoliberalen Globalisierung, wie sie sich unter anderem in einer partiellen »De-Globalisierung« zeigt, des Aufstieg Chinas zu einem Herausforderer der etablierten imperialen Zentren USA und EU sowie einer intensiveren Ausbeutung von Rohstoffen in Ländern des globalen Südens – Rohstoffen, die teilweise für eine Dekarbonisierung der kapitalistischen Zentrumsökonomien benötigt werden. Bei allen weltpolitischen und -wirtschaftlichen Veränderungen scheint ein Konsens darüber bestehen zu bleiben, die imperiale Lebensweise auszuweiten und zu vertiefen.
Im sechsten Kapitel untersuchen wir das Erstarken einer autoritären Rechten in der Krise der imperialen Lebensweise. Die Rechte versucht, dem Überschreiten und Durchlässig-Werden verschiedenster Grenzen durch neu-alte Grenzziehungen (gegen Migrant*innen und Geflüchtete) und Identitäten (Stärkung einer in die Krise geratenen Männlichkeit) zu begegnen. Damit treibt sie die bürgerlichen Parteien so vor sich her, dass diese sich selbst autoritäre Positionen zu eigen machen und z. B. in eine tödliche Asylpolitik übersetzen. Unsere Kritik richtet sich auch gegen links-autoritäre, sich selbst als »links-konservativ« bezeichnende Strömungen, die in jüngster Zeit in Deutschland eine zunehmende Rolle spielen. Bei allen Unterschieden verstehen wir die autoritären Tendenzen als ein Symptom für die Grenze, an die die liberale Demokratie geraten ist. In deren Rahmen lassen sich die vielfältigen Krisenphänomene nicht mehr bearbeiten. Die Alternative besteht darin, hinter die liberale Demokratie zurückzufallen oder aber im Sinne einer »Demokratisierung der Demokratie« über sie hinauszugehen.
Im abschließenden siebten Kapitel skizzieren wir die Horizonte einer solidarischen Krisenpolitik. Unser Ausgangspunkt ist der Konflikt um das Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier, der zu Beginn des Jahres 2023 für Aufsehen sorgte. Wir fragen, was sich aus den Erfolgen und dem Scheitern der Klimabewegung in Lützerath lernen lässt, und beschreiben die Elemente einer emanzipatorischen Alternative, wie wir sie in zahlreichen Kämpfen zu erkennen glauben: solidarische Begrenzungen, Vergesellschaftung als Basis für eine sozial-ökologische Wirtschaft, solidarische Resilienz, Reparatur sowie ein anderes Verständnis und eine andere Praxis von Freiheit. Am Ende stellen wir Überlegungen im Hinblick auf »transformative Zellen« an.
Unser Buch versteht sich als Analyse und Kritik im Handgemenge. Wir untersuchen die Grenzen von Kapitalismus und liberaler Demokratie, sind uns dabei aber der notwendigen Grenzen unserer eigenen Überlegungen bewusst. Diese liegen vor allem in der Dynamik der aktuellen Krisensituation und der Unvorhersehbarkeit der konkreten Entwicklungen begründet. Wir wollen die Möglichkeiten identifizieren, die sich im Guten wie im Schlechten angesichts des Manifest-Werdens zahlreicher Widersprüche andeuten – im Wissen um die Vorläufigkeit unserer Überlegungen und im Bestreben, zur Orientierung emanzipatorischer Praxis beizutragen, als deren Teil wir uns selbst begreifen.
Kapitel 2
Monströse Normalität
Wann immer wir uns auf Konsum- oder Produktionsmuster einlassen, die mehr verbrauchen, als wir brauchen, üben wir Gewalt aus.
Vandana Shiva1
Es wird ungemütlich auf der Erde – inzwischen nicht nur im globalen Süden, in dem ökologische Katastrophen fast schon zur Tagesordnung gehören, sondern auch im globalen Norden. Überflutungen, Trockenheit, Waldbrände oder Stürme sind Unterbrechungen, die Normalitäten erschüttern, für selbstverständlich gehaltene, weil weitgehend im Unsichtbaren funktionierende Infrastrukturen außer Betrieb setzen und unendliches Leid hervorrufen. Die Klimakrise, die für viele Menschen im globalen Norden bisher vor allem in wissenschaftlichen Modellen und Medienberichten existierte, wird zunehmend zur Alltagserfahrung.2
Dazu kommen die Nachwirkungen der Coronapandemie, die ihrerseits eng mit der ökologischen Krise zusammenhängt und deswegen nicht die letzte ihrer Art bleiben wird. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat sein Übriges getan, um Selbstverständlichkeiten zu entsorgen, in diesem Fall: dass eine Versorgung mit preiswerter Energie jederzeit gesichert ist und dass konventionelle Kriege der Vergangenheit angehören – eine eurozentrische Selbstverständlichkeit freilich, die über die Alltäglichkeit von Energiearmut und kriegerischer Gewalt in vielen Teilen der Welt hinwegsieht. Der Krieg im Nahen Osten ist ein weiterer, in seinen Konsequenzen kaum absehbarer weltpolitischer Einschnitt.
Zeitenwende – welche Zeitenwende?
Dass es sich hierbei nicht um temporäre Phänomene handelt, deutet sich in der »Zeitenwende« an, die seit der einschlägigen Rede des deutschen Bundeskanzlers unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs beschworen wird.
Zwar ließe sich diese Rhetorik leicht und ideologiekritisch als Rechtfertigung eines beispiellosen Aufrüstungsprogramms enttarnen: In einem Land mit dem siebtgrößten Rüstungsetat weltweit wird ein 100 Milliarden Euro starkes Sonderprogramm aufgelegt, nicht etwa um der existentiellen ökologischen Bedrohung zu begegnen, sondern um die Armee schlagkräftiger zu machen. Künftig sollen zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgegeben werden. Aber zum einen sind Ideologien nicht einfach nur Schleier, die sich über die Wirklichkeit legen und von ihr getrennt existieren. Vielmehr sind sie Wahrnehmungsformen der Wirklichkeit, die das Handeln von Akteuren anleiten und insofern selbst Wirklichkeit schaffen. Zum anderen ist die Rede von der Zeitenwende ein Symptom der tiefen Verunsicherung (nicht nur) der politischen Eliten angesichts eines epochalen Umbruchs, der nicht erst mit dem russischen Angriffskrieg begann und dessen konkreter Verlauf und Ausgang im Ungewissen liegen. Als solches reiht sie sich ein in andere diskursive und politisch-strategische Verschiebungen, die sich etwa im European Green Deal oder dem europäischen Streben nach »strategischer Autonomie« gegenüber den USA, vor allem aber gegenüber China, manifestieren.3
Mit Stephan Lessenich ließen sich solche Verschiebungen im gesellschaftlichen Diskurs als Spuren einer Krise von lange Zeit vorherrschenden Normalitäten begreifen:4 Das auf fossilen Energieträgern beruhende Energieregime und die von ihm geprägten gesellschaftlichen Mentalitäten stoßen angesichts der Klimakrise unweigerlich an ihre Grenzen; Finanzkrisen werden zu Alltagsphänomenen; das lange Zeit für selbstverständlich gehaltene Wirtschaftswachstum und der damit einhergehende »Fortschritt« werden brüchig.5 Flucht- und Migrationsbewegungen stellen das europäische Grenzregime in Frage, mit diesem geraten die dominanten Vorstellungen von »Ordnung«, »Sicherheit« und »Stabilität« ins Wanken, und das unermessliche Leid der Geflüchteten an den Außengrenzen der EU lässt sich kaum mehr verdrängen. Dazu kommt das Aufbegehren feministischer, queerer und antirassistischer Bewegungen, das sowohl die von einer weißen, heterosexuellen Männlichkeit geprägte soziale Positionsordnung als auch die alltäglichen Praktiken der rassifizierenden Zuschreibungen gegenüber »anderen« erschüttert.6
Der globale Norden befindet sich also in einer epochalen und irreversiblen »Denormalisierung«,7 die mit der großen Wirtschaftskrise Ende der Nuller-Jahre einsetzte und in der sich die bis dahin meist latenten und im Sinne der Herrschenden einigermaßen bearbeitbaren Widersprüche sichtbar in den Alltagsverhältnissen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen manifestieren.
Mit den vielfältigen und sich häufenden Krisen verschwinden die Normalitätsvorstellungen gleichwohl nicht. Im Gegenteil: Je mehr das, was lange Zeit als normal galt, in Frage gestellt wird, desto stärker scheint der Wunsch zu sein, es zu verteidigen und zur Normalität zurückzukehren – etwa in Form von wirtschaftlichem Wachstum um (fast) jeden Preis. Bestenfalls ist dabei von Anpassung und Resilienz die Rede: Es gelte, jene flexible Widerstandsfähigkeit zu stärken, die es Individuen, Gesellschaften oder Ökosystemen erlaube, Störungen zu absorbieren, ohne dabei aus dem Takt zu geraten und in einen gänzlich anderen Zustand überzugehen. Resilienz, so heißt es kritisch-pointiert bei Stefanie Graefe, »stimmt uns nicht nur auf eine in multipler Weise ungewisse, undurchschaubare und deshalb eben prinzipiell auch bedrohliche Gegenwart ein, sondern gibt uns zugleich ein Mittel an die Hand, mit dieser Situation fertigzuwerden.«8
So verstanden sollen die Maßnahmen, wie sie in jüngerer Zeit vom Staat im Rahmen der Zeitenwende ergriffen werden, die Resilienz und Anpassungsfähigkeit steigern. Bei aller Betonung grundlegender Veränderungen beanspruchen sie, die für eine Verteidigung des Bestehenden nötigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ressourcen zu mobilisieren: Mit höheren Rüstungsausgaben wird auf militärische Bedrohungen reagiert; im Rekordtempo geschaffene Flüssiggasterminals sollen als infra-strukturelle Schnittstellen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die fossilen Energieträger aus den USA, Afrika und anderen Teilen der Welt auch in die deutschen Netze eingespeist werden können. Resilienz in diesem Sinne verhält sich affirmativ zum Bestehenden. Sie wird zur Anforderung, der die Gesellschaft und die Individuen angesichts des Unvermeidlichen gehorchen müssen. Das Unvermeidliche selbst gilt als äußere Bedrohung einer verteidigungswerten Normalität.
Aus einer kritischen, transformativen Perspektive, wie wir sie einnehmen, kommt es dagegen darauf an, das scheinbar Unvermeidliche in seinen gesellschaftlichen Ursachen zu begreifen und damit in seiner untrennbaren Verbindung mit der Normalität, die mit den affirmativen Politiken verteidigt werden soll: Die Krisen und Bedrohungen sind keine äußeren Phänomene. Vielmehr hat die lange Zeit für selbstverständlich gehaltene imperiale Lebensweise die Gefährdungen, mit denen sie sich heute konfrontiert sieht und vor denen sie geschützt werden soll, selbst hervorgebracht. Das Problem liegt also in eben jener Normalität, die mit der Zeitenwende verteidigt werden soll.
Offensichtliche Beispiele dafür sind die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl sowie die jahrzehntelange Weigerung, einen Pfad der konsequenten Dekarbonisierung einzuschlagen. Sie haben ein autoritäres Regime gestärkt, das sich nun nach innen immer repressiver und nach außen kriegerisch gebärdet. Wladimir Putin, so der britische Historiker und Energieforscher Simon Pirani,9 war seit seinem Amtsantritt der »Gendarm des Kapitals«, der mit einem zentralisierten Staatsapparat nach den krisenhaften 1990er-Jahren die oligarchisierte Gesellschaft stabilisierte und dafür Anerkennung im Westen erhielt – etwa durch die Mitgliedschaft in der Gruppe der führenden Industrieländer (G8) bis zur Annexion der Krim 2014. Grundlage seiner Macht waren und sind die hohen Einnahmen aus den Exporten fossiler Energieträger, insbesondere in den Westen. Spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine ist der Gendarm außer Kontrolle geraten.
Auch der Klimawandel ist eine direkte Folge unserer Normalität: Er resultiert aus dem Wachstumszwang eines Wirtschaftssystems, das nur auf Basis von Konkurrenz und fossilen Energien aufrechterhalten werden kann. Der Klimawandel ist die Kehrseite der gesellschaftlichen Normalisierung und globalen Ausbreitung emissionsintensiver Produktions- und Konsummuster; nicht zu-letzt ist er der Tatsache geschuldet, dass die soziale Ungleichheit und die zerstörerischen Aktivitäten der Superreichen – in Deutschland emittiert diese Gruppe, die 0,001 Prozent der Bevölkerung ausmacht, mit 11.700 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr das Tausendfache des Bundesdurchschnitts10 – zumindest toleriert werden.
Pandemien wie Covid-19 häufen sich nicht durch unglückliche Zufälle, sondern hängen mit der globalisierten industriellen Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung zusammen. Denn das Landwirtschafts- und Ernährungssystem ist entlang der gesamten Produktkette »um Praktiken herum organisiert, die die Entstehung und anschließende Übertragung von Krankheitserregern beschleunigen«.11 Die Krankheiten, die es hervorbringt, bilden folglich die Kehrseite von normalisierten Annehmlichkeiten wie der ständigen Verfügbarkeit vieler Lebensmittel, die der Agrarsoziologe Philip McMichael als »food from nowhere« bezeichnet hat.12 Bewusster Konsum allein, so wichtig er ist, kann daran nichts ändern. Er reicht nicht an die systemischen Ursachen des Problems heran: Der Anbau, die Transportwege und die Distribution von Lebensmitteln über Supermärkte stellen eine notwendige Infrastruktur kapitalistischer Gesellschaften dar, die auch dann, wenn ihre Widersprüche nicht in Form von Pandemien manifest werden, für die Natur und viele Menschen zerstörerisch ist.13
Die Liste der monströsen Kehrseite unserer Normalität ließe sich fast beliebig erweitern. Sie zeigt, dass die Normalität das Problem ist und dass jeder Versuch, sie zu schützen oder wiederherzustellen, auf Dauer nur tiefer in die Krise hineinführt.
Begreift man die als Zeitenwende titulierte Häufung von Krisen auf diese Weise, dann liegt eine wichtige Herausforderung darin, einen klaren und kritischen Blick auf unseren Normalzustand zu werfen und die krisenerzeugenden Mechanismen darin zu verstehen: die vorherrschenden Produktions- und Konsummuster, wie sie in den gesellschaftlichen Kräfte- und Machtverhältnissen, den politischen und wirtschaftlichen Institutionen und den Infrastruktursystemen der Ernährung, der Energieversorgung oder der Mobilität verankert sind, sich im Alltag reproduzieren und durch eine ungleiche internationale Ordnung abgesichert werden.
Interessant und politisch dringend geboten ist es vor allem, zu begreifen, wie Produktions- und Konsummuster, die weltweit derart viel Leid und Zerstörung verursachen, überhaupt als normal gelten können und warum eine Sicherung dieser monströsen Normalität – nichts anderes verbirgt sich hinter der Politik der Zeitenwende – ernsthaft als erfolgreiche Resilienz- und Anpassungsstrategie erscheinen kann.
Imperiale Lebensweise
Wir möchten mit dem Konzept der imperialen Lebensweise einen Beitrag zum Verständnis der geschilderten Paradoxie leisten: Warum halten wir so sehr an der monströsen Normalität fest? Warum verteidigen wir sie und versuchen sogar, sie mit viel Aufwand wiederherzustellen, obwohl ihre Destruktivität kaum mehr geleugnet werden kann? Vor allem wollen wir die Dynamiken verstehen, die aus diesem Widerspruch entstehen: die widerstreitenden Kräfte und Bewegungen für eine autoritäre Stabilisierung, eine ökologische Modernisierung und eine solidarische Überwindung der imperialen Lebensweise.
Unser Erkenntnisinteresse ist ein praktisches: Indem wir die sozial-ökologischen Widersprüche, ihre Zuspitzung und ihre zunehmend konflikthafte Manifestation analysieren, wollen wir zu einer Reflexion und Stärkung solcher Praxen beitragen, die die Grenzen des Kapitalismus in einem emanzipatorischen Sinn zu überschreiten versuchen. Es sollen also Optionen und Wege aufgezeigt werden, wie sich eine weitere Verschärfung der vielfältigen Krisen vermeiden lässt, wie die Anpassung an das nicht mehr Vermeidbare solidarisch gestaltet und wie das Zer- und Gestörte so weit wie möglich repariert beziehungsweise regeneriert werden kann.
Als imperiale Lebensweise haben wir in unserem gleichnamigen Buch14 Produktions- und Konsummuster bezeichnet, die den tendenziell unbegrenzten Zugriff auf Natur und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab voraussetzen. Die Organisation von Produktion und Konsum in Teilen der Welt (globaler Norden) beziehungsweise durch dominante gesellschaftliche Gruppen, so unsere Annahme, beeinträchtigt die Naturverhältnisse anderer Gruppen und anderer Teile der Welt oder zerstört gar deren Lebensgrundlagen.
Ein Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die in sozial-ökologischer Hinsicht paradoxe Konstellation der 2010er-Jahre: Einerseits wurde die ökologische Krise damals stark politisiert, und im Pariser Klimaabkommen von 2015 sowie in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, die im selben Jahr verabschiedet wurden, fand diese Politisierung einen prominenten Ausdruck. Andererseits wurden wesentliche Maßnahmen gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008 im Sinne eines bestenfalls leicht modifizierten »Weiter so« formuliert, das den Interessen der dominanten gesellschaftlichen Kräfte folgte. Ikonische Beispiele waren die »Abwrackprämie« in Deutschland und die »Schrottprämie« in Österreich: staatliche Zuschüsse in Höhe von 2.000 beziehungsweise 2.500 Euro für die Verschrottung eines noch intakten Autos und die Anschaffung eines Neuwagens. Die Umweltzerstörung schritt in den 2010er-Jahren trotz aller Politisierung weiter voran, indem sich jene Produktions- und Konsummuster vertieften und verallgemeinerten, die den Problemkern der ökologischen Krise bildeten: Die Autos wurden größer, schwerer und mehr, der Flugverkehr intensivierte sich und der Verzehr von Fleisch und anderen Lebensmitteln, die unter einem hohen Ressourceneinsatz und oft miserablen Arbeitsbedingungen sowie unter Inkaufnahme von großem Tierleid hergestellt wurden, nahm zu. Das galt im lokalen ebenso wie im globalen Maßstab, wobei die dynamische wirtschaftliche Entwicklung von Ländern wie China und Indien eine zentrale Rolle spielte.
Mit dem Konzept der imperialen Lebensweise wollen wir ein Angebot machen, die widersprüchliche Gleichzeitigkeit einer Infragestellung der krisengenerierenden Prozesse und ihrer Verstetigung, Ausbreitung oder gar Intensivierung hegemonietheoretisch zu begreifen. Dabei spielt der Begriff des »Alltagsverstands« von Antonio Gramsci eine zentrale Rolle. Gramsci zufolge nehmen die Menschen die Welt und die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie leben, nicht auf eine kohärente und reflektierte Art und Weise wahr. Es sind vielmehr nicht weiter hinterfragte, durchaus widersprüchliche Traditionsbestände, die ihren Blick auf die Welt und die Gesellschaft prägen und den Alltagsverstand konstituieren. Der Alltagsverstand ist also ein Deutungsrahmen, den Menschen benötigen, um sich in den Verhältnissen zu orientieren und zu bewegen. Er ist
»keine einheitliche, in Raum und Zeit identische Auffassung: er ist die ›Folklore‹ der Philosophie, und wie die Folklore bietet er sich in unzähligen Formen dar: sein grundlegender Charakter ist es, eine auseinanderfallende, inkohärente, inkonsequente Weltauffassung zu sein, der Beschaffenheit der Volksmengen entsprechend, deren Philosophie er ist. […] Die Hauptelemente des Alltagsverstands werden von den Religionen geliefert, und zwar nicht nur von der aktuell herrschenden Religion, sondern auch von den vorangegangenen Religionen, ketzerischen Volksbewegungen, von früheren wissenschaftlichen Auffassungen usw.«15
Der Alltagsverstand ist widersprüchlich, weil die Welt widersprüchlich ist. Menschen leben unbewusst oder auch absichtlich ignorant die imperiale Lebensweise, sie arbeiten und konsumieren in ihr. Oft wissen sie um die Ausbeutung anderer Menschen in Textilfabriken, um die Zerstörung von Regenwäldern für die industrielle Landwirtschaft oder um die Klimakrise. Diese Widersprüchlichkeit des Alltagsverstands, die Ahnung und Erfahrung, dass nicht alles in Ordnung ist, stellt zugleich ein politisches Terrain von Auseinandersetzungen dar. Dabei kann auch ein kritisches Denken und Handeln bei einzelnen, wie auch in kollektiver Form, entstehen. In diesem Fall wird Hegemonie, die Zustimmung zu den bestehenden Verhältnissen, angegriffen (zum Hegemoniebegriff ausführlich in Kapitel 4). Dazu bedarf es neben oft wenig sichtbaren gesellschaftlichen Verschiebungen auch krisenhafter Momente und bewussten Handelns.
Warum ist diese widersprüchliche Lebensweise aber »imperial«, ist der Imperialismus nicht längst Geschichte? Denker*innen wie David Harvey argumentieren, dass der Imperialismus nicht nur eine historische Phase des Kapitalismus ist, deren Spannungen sich im Ersten Weltkrieg entluden.16 Vielmehr handelt es sich um einen Reproduktionsmodus kapitalistischer Gesellschaften und somit um ein Strukturmerkmal derselben: Der Kapitalismus ist immer räumlich expansiv und damit imperialistisch. Allerdings lässt er sich als solcher mit den klassischen und neueren Imperialismustheorien allein nicht begreifen. In diesen wird der Imperialismus vor allem als Gewalt- und geopolitisches Konkurrenzverhältnis betrachtet.17 Das ist zweifellos zutreffend. Um jedoch zu verstehen, wie dieses Verhältnis sich nicht nur wegen, sondern auch trotz der ihm innewohnenden physischen und strukturellen Gewalt reproduziert, müssen wir seine hegemoniale Verankerung in den Alltagspraxen und -wahrnehmungen vor allem im globalen Norden, aber auch in den Mittel- und Oberklassen der Gesellschaften des globalen Südens untersuchen.
Das ist das Anliegen, das wir mit dem Konzept der imperialen Lebensweise verfolgen. Dieses verbindet Alltagsverhältnisse mit übergreifenden kapitalistischen gesellschaftlichen und internationalen Strukturen und Imperativen wie der Kapitalakkumulation und des Wirtschaftswachstums. Es verdeutlicht, dass der Imperialismus auch deshalb funktioniert, weil die ihm innewohnende Gewalt in unzähligen Akten des Produzierens und Konsumierens zum Verschwinden gebracht und gleichsam normalisiert wird: Man sieht den Autos nicht an, unter welchen Bedingungen die Ressourcen extrahiert wurden, aus denen sie hergestellt worden sind. Ebenso wenig lässt das Fleisch im Supermarkt das Leid der Tiere, die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion oder die Treibhausgasemissionen der industriellen Landwirtschaft erkennen, ohne die es sich niemals in derart großen Mengen zum sprichwörtlich kleinen Preis verkaufen ließe. In den Supermärkten und Autohäusern sowie in der Werbung werden ganz andere Assoziationen hervorgerufen. Es geht beim Auto um Kraft, Schnelligkeit, Männlichkeit und Freiheit beziehungsweise um Sicherheit und Schutz vor Bedrohungen, beim Fleischkonsum um normalisierte oder statusorientierte Ernährung, das heißt um Versprechen und positiv konnotierte Eigenschaften von Produkten, deren sozial-ökologisch destruktive Voraussetzungen systematisch verdunkelt werden.
Die imperiale Lebensweise ist ebenso ein Ermöglichungs- wie ein Zwangsverhältnis, in das Menschen qua ihrer Zugehörigkeit zu einer kapitalistischen Gesellschaft hineinsozialisiert werden. Sie ist für viele attraktiv und erstrebenswert. Gleichzeitig kann man sich ihr aber auch nicht einfach entziehen. Der Begriff der imperialen Lebensweise ist eine gesellschaftliche Strukturkategorie. Er soll die existenziellen und gegenseitigen Abhängigkeiten verdeutlichen, die tief in den ökonomischen, politischen und kulturellen Verhältnissen verankert sind und zu sehr ungleichen Lebenschancen führen: Die Notwendigkeit, die eigene Arbeitskraft gegen Lohn verkaufen und sich dabei oft in der Produktion sozial-ökologisch problematischer Waren verdingen zu müssen, oder die Infrastrukturen einer autozentrierten Mobilität und eines agrarindustriellen Ernährungssystems lassen vielen kaum eine andere Wahl als die Partizipation an der imperialen Lebensweise.
Deren Kern besteht deshalb nicht aus individuellen Konsumentscheidungen, die prinzipiell auch anders getroffen werden könnten, wenn die Konsument*innen nur ausreichend über die sozial-ökologischen Folgen aufgeklärt würden. Vielmehr sind Konsumentscheidungen in den meisten Fällen »notwendige Praktiken der sozialen Reproduktion, mit denen sich erst der Lebensunterhalt in einer kapitalistischen Wirtschaft bestreiten lässt (wohnt man auf dem Land, muss man zum Beispiel Benzin verbrauchen, um zur Arbeit zum kommen)«.18