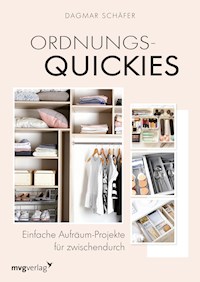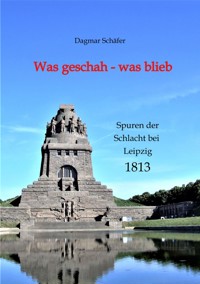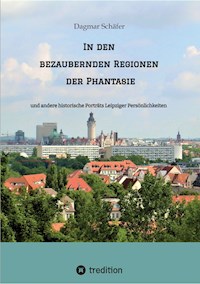
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leipzig ist besonders. Kaum eine zweite Stadt in Deutschland hat im Verlauf der Jahrhunderte so viele außerordentliche Persönlichkeiten hervorgebracht oder angezogen. Einige der klugen Köpfe haben sich einen Namen gemacht, andere hingegen sind mehr oder weniger vergessen. Und so finden sich im Buch bekannte Namen neben weniger bekannten - Christian Fürchtegott Gellert und Adam Friedrich Oeser, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller, Benedikte Naubert und Carl Gustav Carus, Eduard Friedrich Poeppig und Theodor Fontane, Ethel Smyth und Gerda Taro ... Sechzehn historische Porträts als kleine Auswahl, die andeutet, wie viele Leipziger Lichtgestalten noch zu entdecken sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dagmar Schäfer
In den bezaubernden Regionender Phantasie
und andere historische PorträtsLeipziger Persönlichkeiten
Dagmar Schäfer
In den bezaubernden Regionender Phantasie
und andere historische PorträtsLeipziger Persönlichkeiten
© 2022 Dagmar Schäfer Covergrafik von Dagmar Schäfer
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
ISBN Softcover: 978-3-347-53447-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-53448-3
ISBN E-Book: 978-3-347-53449-0
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Vorwort
Pfiffiger Fabulist und weltkluger Klein-Pariser
Das Herz gegen den Reiz fühlbar gemacht
Begegnung mit dem „Evangelium des Schönen“
In den bezaubernden Regionen der Phantasie
Es „schillert“ in Leipzig-Gohlis
Bildchronist der Völkerschlacht
Der universelle Carus
Domizil für Victoria amazonica
Ein Lied geht um die Welt
Geistiger Goldschatz
Schöpfer der „Gartenlaube“
Lieblingsort Leipzig
67000 Bücher auf einen Streich
„My darling Mother …“
Kasperle geht noch immer auf Reisen
„Sie hatten das gleiche Lachen, sie lachten zur gleichen Zeit“
Literaturverzeichnis (Auswahl)
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Leipzig ist besonders. Kaum eine zweite Stadt in Deutschland hat im Verlauf der Jahrhunderte so viele außerordentliche Persönlichkeiten hervorgebracht oder angezogen – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler, Ärztinnen und Ärzte, Redakteurinnen und Redakteine … Einige der klugen Köpfe haben sich einen Namen gemacht, sind im Bewusstsein nicht nur der Leipziger verankert, andere hingegen sind mehr oder weniger vergessen, obwohl sie Beachtung verdient hätten. Und so finden sich in diesem Buch bekannte Namen neben weniger bekannten – eine kleine Auswahl, die andeutet, wie viele bemerkenswerte Leipziger Persönlichkeiten noch zu entdecken sind.
Lichtgestalten sind sie alle. Ihre Leistungen machen sie einzigartig und erinnerungswürdig, auch wenn hier und da ein Schatten das Licht trübt. Auch Lichtgestalten irren zuweilen, machen Fehler, geraten ins Abseits. Sie müssen meist mühsam um Anerkennung ringen, gewinnen Freunde und Unterstützer, werden aber auch bekämpft, belogen und hintergangen.
Die Leipziger Persönlichkeiten, die in diesem Buch porträtiert werden, sind deshalb so ganz von dieser Welt – klug, engagiert und keineswegs ohne Fehl und Tadel. Aber das macht wohl jede von ihnen gerade erst liebenswert. Man darf sich getrost auf Augenhöhe mit ihnen einlassen.
Pfiffiger Fabulist und weltkluger Klein-Pariser
Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)
Christian Fürchtegott Gellert hatte die Nachtmütze noch auf dem Kopf und war auch im Übrigen, was seine äußere Erscheinung anbetraf, an diesem 11. Dezember 1760 keineswegs auf Besucher eingestellt, als es nachmittags halb drei Uhr heftig an seine Tür klopfte. Kurz darauf betrat ein Major Quintus den Raum: Der preußische König Friedrich II. bitte den Dichter um 3 Uhr zum Besuch. Gellert erbleichte, musste sich vor Schreck niedersetzen. Der Preußenkönig hatte im besetzten Leipzig Winterquartier bezogen, es war Krieg, jener, den man später den Siebenjährigen nennen wird. Der Dichter-Professor schützte Krankheit vor, doch der Major blieb unbeeindruckt: Drei Viertelstunden gab er dem angeblich Kranken zum Ankleiden, dann aber wolle ihn der König sehen. Gellert war in großer Aufregung – kein Barbier zur Stelle, keine Perücke zur Hand. Dennoch kam er rechtzeitig in seine Kleider und um vier Uhr zum König.
Nach zwei Stunden Gespräch mit Friedrich wurde Gellert belobigt entlassen. Gefasst und beherzt war er dem König entgegengetreten. Auf die Frage, ob er mit seinen Fabeln nur den französischen Dichter La Fontaine nachahme, antwortete Gellert recht keck: „Nein, Sire, ich bin ein Original; das kann ich ohne Eitelkeit sagen; aber darum sage ich noch nicht, daß ich ein gutes Original bin.“ Auf den Krieg angesprochen, wagte Gellert sogar die Forderung: „Geben Sie uns nur Frieden, Sire!“ Und fügte noch hinzu: „Wenn ich König wäre, so hätten die Deutschen bald Frieden.“ Der Dichter hasste den Krieg, verabscheute Gewalt jeder Art. Er lehnte übrigens auch Friedrichs Versuche ab, ihn zu kurieren. Friedrich: „Erstlich muß Er alle Tage eine Stunde reiten und zwar traben.“ Gellert: „Wenn das Pferd gesund ist, so kann ich nicht fort; und wenn es krank ist wie ich, so kommen wir alle beide nicht fort.“ Wieder zu Hause, schrieb Gellert erleichtert nieder: „Gott sei Dank, daß ich’s überstanden habe!“
Die Einladung Friedrichs, der deutsche Dichtung eigentlich ablehnte, kam nicht von ungefähr. Gellert war bereits zu Lebzeiten eine Legende, als Volksdichter und Sprachlehrer der Deutschen genoss er außergewöhnliche Popularität. An diesem Phänomen kam auch der Preußenkönig nicht so einfach vorbei. Gellerts Vorlesungen an der Leipziger Universität waren überlaufen, seine Wohnung im Hof des Großen Fürstenkollegs stets belagert. Alle Welt wollte den Dichter-Professor persönlich sehen oder wenigstens mit ihm korrespondieren oder ihm ein Geschenk machen. Von Fürsten bekam Gellert gutwillige Pferde geschenkt, mit denen der ewig Kränkelnde Spazierritte ins Rosental unternahm, von einfachen Leuten, die seine Fabeln liebten, ein paar Fässer Bier oder ein Fuder Holz, damit es der Dichter schön warm habe in seiner Wohnung. Das Geschenkangebot eines Husarenleutnants – Pistole, Gewehr – schlug Gellert allerdings aus. Er brauche keine Waffen, erklärte er, seine Waffen stünden im Bücherschrank.
„Ein kluges Frauenzimmer gilt mir mehr als eine gelehrte Zeitung“
Christian Fürchtegott Gellert kam am 4. Juli 1715 als neuntes von dreizehn Kindern in einer Pfarrerfamilie im sächsischen Hainichen zur Welt. Mit dreizehn Jahren bezog er die Fürstenschule St. Afra in Meißen, schloss dort mit seinen späteren literarischen Kollegen Gottlieb Wilhelm Rabener und Carl Christian Gärtner Freundschaft. 1734 begann er in Leipzig Theologie zu studieren, aber die schönen Wissenschaften behagten ihm mehr. Wegen Geldmangel musste Gellert seine Studien unterbrechen und als Hauslehrer tätig werden. Erst 1741 kehrte er an die Universität Leipzig zurück, um Literatur und Philosophie zu studieren. Er promovierte, wurde als Dozent tätig, hielt Vorlesungen über Poesie, Rhetorik, Moral und Pädagogik, ab 1751 als außerordentlicher Professor.
Worin liegt das Geheimnis seiner großen Beliebtheit bei den Studierenden, bei den einfachen Leuten, bei den Bürgern, ja selbst beim Adel? Gellert, der Aufklärer, sprach sie alle an, erreichte sie alle, wurde ihr Lehrer – mit einfacher, für alle verständlicher Sprache und Poesie. „Mein größter Ehrgeiz besteht darin“, schrieb er über sein Wirken, „daß ich den Vernünftigen dienen und gefallen will und nicht dem Gelehrten im engeren Verstande. Ein kluges Frauenzimmer gilt mir mehr als eine gelehrte Zeitung, und der niedrigste Mann von gesundem Verstande ist mir würdig genug, seine Aufmerksamkeit zu suchen, sein Vergnügen zu befördern und ihm in einem leicht zu behaltenden Ausdrucke gute Wahrheiten zu sagen und edle Empfindungen in seiner Seele rege zu machen.“ So weitgefächert Gellerts Publikum als Universitätsgelehrter und Dichter war, so facettenreich und schwer fassbar erscheint seine eigene Persönlichkeit. Als kränklich, mild und gefällig wird er beschrieben, aber auch als gewandter Weltmann mit geschliffenen Umgangsformen, der den Adel zu gewinnen wusste. Anton Graff und Adam Friedrich Oeser haben Gellert porträtiert: einen Mann mit feinge- schnittenem Gesicht, markanter Nase und klarem Blick.
Einige der Studenten, die Gellerts Vorlesungen besuchten, machten später selbst als Dichter von sich reden und sind von ihrem Professor zumindest beeinflusst worden: Lessing, Klopstock, Goethe. Letzterer erinnerte sich: „Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden … Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligtum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ist …“ Auch die äußere Erscheinung Gellerts hat Goethe beschrieben: „Nicht groß von Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanfte, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts.“
„Denn stammtest du aus ihren Hütten: So hättest du auch ihre Sitten“
Gellerts „Fabeln und Erzählungen“, die 1746 und 1748 in zwei Teilen erschienen, wurden ein gewaltiger Erfolg, man kann sie das erfolgreichste deutsche Buch des 18. Jahrhunderts nennen. Es folgten unzählige Auflagen und Nachdrucke; sie wurden im gesamten deutschen Sprachgebiet verbreitet und auch in nahezu alle europäischen Sprachen übersetzt. Gellert wurde mit den Fabeln berühmt, sein Leipziger Verleger Johann Wendler wurde reich. Zum Dank ließ Wendler seinem für ihn so einträglichen Autor nach dessen Tod ein Denkmal im eigenen Garten setzen. Der Leipziger Verleger Bernhard Christoph Breitkopf, dem Gellert sein Manuskript zuerst anbot, hatte es als uninteressant und nicht verkäuflich abgelehnt – eine der großen Fehlentscheidungen in der Geschichte des Buchhandels.
Die Fabeln wurden in allen Bevölkerungsschichten gelesen. Mit den menschlichen Akteuren, die Gellert in seinen Fabeln auftreten lässt, konnte ein sächsischer Bauer ebenso etwas anfangen wie ein preußischer König. Der Dichter hatte die Welt aufmerksam beobachtet, ehe er pfiffig und weltklug über sie fabulierte. Und alle bekamen sie ihren Teil ab: die Philosophen, die Dichter, die Adligen, die Frauen, die Ehemänner, die Eingebildeten, die Heuchler, die Prahler, die Habgierigen … Ganz Aufklärer ist Gellert, wenn er in der Fabel „Das Kutschpferd“ die hohen Herren zurechtweist, weil sie die Bauern verachten, obwohl sie von ihnen leben:
„Denn stammtest du aus ihren Hütten:
So hättest du auch ihre Sitten
Und was du bist, und mehr, das würden sie auch sein,
Wenn sie wie du erzogen wären.
Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren.“
Aber Gellert schlägt auch andere Töne an. In der Fabel „Der junge Drescher“ rät er davon ab, nach Höherem zu streben:
„O lernt, ihr unzufriednen Kleinen,
Daß ihr die Ruh nicht durch den Stand gewinnt.“
Zum amüsanten Plauderer wird Gellert, wenn er sich dem Ehestand widmet. In der Fabel „Die glückliche Ehe“ beschreibt er das einzige Ehepaar, das bis in den Tod glücklich war – es starb schon in den Flitterwochen. Jedem, der glücklich leben möchte, rät er in der Fabel „Der gute Rat“, gar nicht erst zu heiraten. Er selbst hat sich daran gehalten; Gellert blieb zeitlebens unverheiratet.
Grotesk wird es in der Fabel „Der Selbstmord“: Gellert erzählt die Geschichte eines unglücklich liebenden Jünglings, der sich zum Freitod entschließt – um sich beim Anblick seines Degens anders zu besinnen:
„Er reißt den Degen aus der Scheide,
Und – -o was kann verwegner sein!
Kurz, er besieht sich die Spitz und Schneide,
Und steckt ihn langsam wieder ein.“
So berühmt Gellert auch mit seinen Fabeln wurde, blieb sein literarisches Werk insgesamt doch eher schmal. Er schuf noch den Brief- Roman „Das Leben der schwedischen Gräfin von G…“ und einige Lustspiele. Mit Gellert ging zugleich Leipzigs Zeit als Hauptstadt der deutschen Literatur ihrem Ende entgegen.
Bach-Gellert-Gruft wiederentdeckt
Gellert starb 1769 und wurde unter großer Anteilnahme der Leipziger Bevölkerung auf dem Alten Johannisfriedhof beigesetzt. Auch danach noch besuchten Verehrerinnen und Verehrer das Grab Gellerts; mitunter war der Besucherandrang so groß, dass die Friedhofstore geschlossen werden mussten. Doch schon bald setzte das Vergessen ein – und die Kritik. Die Volkstümlichkeit Gellertscher Dichtung wurde nun immer mehr als Beschränktheit ausgelegt.
Auch im Tod kam Gellert lange Zeit nicht zur Ruhe. 1900 wurden seine Gebeine in die Gruft unter dem Altarraum der Leipziger Johanniskirche überführt. Als die Kirche im Zweiten Weltkrieg ausgebombt und 1949 endgültig abgetragen wurde, erhielt Gellert in der Paulinerkirche eine neue Ruhestätte – bis diese Kirche 1968 gesprengt wurde. Seitdem befindet sich Gellerts Grabstätte auf dem Leipziger Südfriedhof.
Im Dezember 2014 gelang es dem Leipziger Freundeskreis Gellert, die Ruhestätte unter der ehemaligen Johanniskirche, wo die Särge von Bach und Gellert gestanden hatten, freizulegen. Zwar musste die Gruft, die einst ein Anziehungspunkt für die Besucher Leipzigs war, vorerst wieder mit Erde bedeckt werden, aber vielleicht kann man sie in naher Zukunft wieder besichtigen – Gellert-Freunde würde es freuen.
Das Herz gegen den Reiz fühlbar gemacht
Adam Friedrich Oeser (1717-1799)
Als am 10. September 1756 die Truppen Friedrich II. Dresden besetzten und der sächsische Kurfürst Friedrich August II., zugleich König von Polen, mit seinem Premierminister Graf Brühl nach Warschau ging, wirkte sich dies fatal auf das Kulturleben der Residenzstadt aus. Zu den zahlreichen Künstlern, die Dresden verließen, gehörte auch der Maler Adam Friedrich Oeser. Am 17. Februar 1717 in Preßburg geboren und von Lehrern der Wiener Akademie unterrichtet, war er vor allem vom Bildhauer Georg Raphael Donner geprägt worden. Dieser hatte ihm vermittelt, das Ideal der Kunst sei Einfachheit, Natürlichkeit und Ruhe; die Antike stehe höher als die Kunst nach ihr. 1739 kam Oeser in die sächsische Residenz, um hier als Künstler zu wirken. Er schloss sich Louis de Silvestre an, einem der wesentlichen Vertreter der Malerei in Dresden, und erfuhr einige Förderung. An freie Kunstentfaltung war zunächst dennoch nicht zu denken, Oeser konnte nicht wählerisch sein und hatte die Wünsche seiner Auftraggeber zu erfüllen.
Der junge Künstler betätigte sich als Miniaturmaler, war 1749 an der malerischen Ausschmückung beim Umbau des Schlosses Hubertusburg beteiligt. Auch begann er, als Illustrator zu arbeiten – ein Betätigungsfeld, das ihn lebenslang begleiten sollte. Dresden brachte Oeser zudem die Begegnung mit dem Archäologen Johann Joachim Winckelmann, den er im November 1754 in seine Wohnung aufnahm. Beide vereinte in der Hauptstadt der Barockkultur eine gemeinsame Grundstimmung: der Wille zu Schlichtheit, zur Einfachheit des klassischen Altertums.
Zeichenakademie als erstes Friedensgeschenk