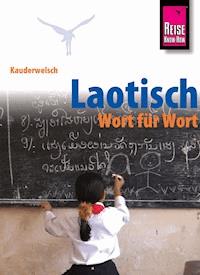Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Kunstvermittlung in der Schule stellt für Einsteigerinnen und Einsteiger eine besondere Herausforderung dar, denn sie sollen nun die Rolle der aktiv Unterrichtenden einnehmen. Aber was genau unterscheidet den Kunstunterricht von anderen Fächern? Wie ist eine gute kunstpädagogische Aufgabe strukturiert? Und welche Aufgabentypen gibt es? Um den Kunstunterricht erfolgreich zu gestalten, bietet das Buch konkrete Wege für die Unterrichtsplanung und -durchführung. Damit eignet es sich besonders für den Einstieg in die Lehrpraxis, ob aus dem Schulpraktikum im Studium, dem Referendariat oder aus Weiterbildungen heraus. Es versammelt nach einer Einführung zahlreiche interaktive Übungen, die eine schrittweise Annäherung an den komplexen Bereich "Kunst unterrichten" erlauben. Die Lehr-Lern-Einheiten werden durch Schaubilder unterstützt. Die Materialien eignen sich für Lehrangebote verschiedenster Art, vom Universitätsseminar bis zur kollegialen Fortbildung für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
I Kunst und ihre Vermittlung – Grundlagen
1 Was brauchen Anfänger*innen?
1.1 Der Didaktische Kreis – ein einfaches Planungs- und Reflexionsmodell
1.2 Das Bewusstsein für die eigene Ausgangsposition des Nachdenkens
1.3 Ermutigung, aktiv die Rolle des bzw. der Lehrer*in einzunehmen
1.4 Freiräume des Ausprobierens
2 Der Didaktische Kreis – zur Einführung
3 Kunst und Klientel – die Schüler*innen und die Kunst
4 Zum künstlerischen Prozess: Subjekt und erweitertes Subjekt
4.1 Ein Beispiel: Eleanor Rigby
4.2 Eine Beobachtung aus der Schule
5 Zu den subjektiven und allgemeinen Anteilen im Künstlerischen
5.1 Kunst und Kunstdidaktik: Ist Kunst lehrbar?
5.2 Kunst und Bildung im Generationswechsel – Enkulturation als Neukonstruktion
5.3 Pädagogische Konsequenz: Induktion statt Deduktion
5.4 Warum das alles?
6 Elemente des Didaktischen Kreises für Einsteiger*innen
6.1 Die Schüler*innen
6.2 Die Kunst
6.3 Didaktik
6.4 Methodik – Projekt im Praktikum?
6.5 Einleitung des Übungsteils – ein Blick auf das Ganze
II Kunstpädagogik zwischen Lenkung und Offenheit – Übungsteil
7 Didaktik – im Spannungsfeld von Schüler*innen und Kunst
7.1 Der künstlerische Prozess und die Pädagogik
7.2 Der Didaktische Kreis
7.2.1 Erste Planungsschritte mit dem Didaktischen Kreis
7.2.2 Die Persönlichkeit der Lehrenden
7.2.3 Der Didaktische Kreis und ICH
7.2.4 Auf der Suche nach Unterrichtsideen – 1. Zufallstechniken
7.2.5 Auf der Suche nach Unterrichtsideen – 2. Künstlerischer Spaziergang
7.3 Unterrichtsideen sortieren, verschriftlichen, prüfen
7.3.1 Zufallsverfahren oder künstlerischer Spaziergang – am Ende steht eine Idee für eine Unterrichtsreihe
7.3.2 Vorbereitung einer Unterrichtsstunde – Vertiefung – hier zum Thema Licht und Schatten
7.3.3 Unterrichtsreihe schriftlich skizzieren
7.3.4 Einzelstunde tabellarisch darstellen
7.3.5 Unterrichtsentwürfe kritisch befragen
7.4 Die Schüler*innen und ihre Entwicklung
7.5 Ziele in der Kunstpädagogik
7.5.1 Zur Einführung
7.5.2 Die Zieldiskussion zwischen den Stühlen
7.5.3 Über Ziele im Kunstunterricht grundsätzlich nachdenken
7.5.4 Ziele und Aufgaben: Induktives oder deduktives Denken
7.5.5 Ziele verschriftlichen
7.5.6 Zielperspektiven diskutieren und Alternativen suchen
7.5.7 Ziele und Lernergebnisse – zur Diskussion
7.5.8 Ziele zu veröffentlichten Unterrichtsvorschlägen formulieren
7.5.9 Ziele formulieren – andere Bildsorten – Beispiel Zeitschriften
8 Methodik
8.1 Der größere Rahmen
8.2 Aufgaben in der Kunstpädagogik
8.2.1 Eine kunstpädagogische Aufgabe stellen – Schnittstelle aller Überlegungen
8.2.2 Mündlich Aufgaben stellen – zwei Beispiele
8.2.3 Checkliste – Gute kunstpädagogische Aufgaben stellen
8.3 Methodische Entscheidungen – Unterrichtsphasen abwechslungsreich gestalten
9 Kunstbereiche und ihre Bildungspotenziale – didaktisch-methodische Felder der Kunstpädagogik
9.1 Kunst als Inhalt-Form-Verschränkung
9.2 Inhalt und Thema als Sinnstiftung für das künstlerische Denken
9.3 Formales-sprachfernes Denken im Zentrum des künstlerischen Prozesses
9.3.1 Kontrollierte Beherrschung und Planung der Form durch die Anwendung einer künstlerischen Technik
9.3.2 Intuitive Materialorientierung – wachsen und wuchern lassen
9.4 Gegenständliche (Mimesis) versus ungegenständliche Kunst (Konstruktion) als pädagogisches Problem
9.5 Kunstrezeption
9.6 Aneignen, interpretieren, transformieren – Kunstrezeption gestaltungspraktisch und bildkompetent
9.7 Kreativitätsförderung als übergreifendes Prinzip
9.8 Performative Methoden – Körperlichkeit und Bewegung als Sinnstiftung
9.9 Räume gestalten – Rauminstallation
9.10 Konzeptkunst
9.11 Der Fördergedanke in der Kunstpädagogik – die personale Entwicklung im Fokus
9.11.1 Kunstpädagogik und Fördergedanke praktisch
9.11.2 Selbsterfahrung
9.12 Werken
9.13 Keine Kunstpädagogik
10 Interaktive Übungen mit der Gruppe
10.1 Übung 34 – Unterrichtssimulation (ca. 120 Min.)
10.2 Übung 35 – Klassengespräch anhand einer Bildbetrachtung
11 Reflektieren, bewerten und benoten
12 Unterrichtsbesuch
13 Nachbereitungsseminar – kompakt an 2 Tagen
13.1 Tag 1
13.1.1 Einstiegsübung mit Kunst-Kalenderblättern (ca. 45 Min.)
13.1.2 Frage-Antworten nach Impulskarten (ca. 90 – 100 Min.)
13.1.3 Gesprächsthema: Meine Lehrer*innenrolle finden (ca. 45 – 60 Min.)
13.1.4 Kunstunterricht reflektieren (ca. 2x 60 Min. mit einer Pause)
13.2 Nachbereitung – Tag 2: Kooperative Beratung (KB)
13.2.1 Grundlagen der kooperativen Beratung (KB)
13.2.2 Darstellung der Übungen
13.2.3 Demogespräch, Darstellung der Schritte
14 Einen Praktikumsbericht verfassen
Anhang
Zusatzmaterial zum Download
Literatur
Der Autor
Klaus Werner studierte in Köln Kunstpädagogik, Kunsttherapie und Gehörlosenpädagogik und absolvierte das Referendariat in Bielefeld. Ab 1994 war er Förderschullehrer in Bad Camberg, Hessen, Schwerpunkt Hören und Kommunikation. Seit 2006 lehrt er am Institut für Kunstpädagogik, JLU-Gießen. Dort betreut er Schulpraktika, kunstpraktische Seminare in Zeichnen, Druckgrafik und Malerei sowie kunstdidaktische Seminare, u. a. mit den Schwerpunkten Improvisation/performative Methoden und künstlerisches Arbeiten, sowie Kunstpädagogik der Grundschule, Förderschule, Sek. I und Sek. II. Er ist selbst im Bereich Malerei künstlerisch tätig.
Klaus Werner
In den Kunstunterricht einsteigen
Grundlagen und Übungen für Universität, Referendariat und Weiterbildung
Verlag W. Kohlhammer
Für Tine, Romy und Tilda
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043618-3
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043619-0epub: ISBN 978-3-17-043620-6
Einleitung
Die Kunst und damit auch die Kunstpädagogik stehen in einem widersprüchlichen und auf weiten Strecken auch verunsichernden Spannungsfeld. »Diese Spannungen sind in der Existenz des Menschen begründet – in seiner Lust am Schöpferischen einerseits, in seiner Liebe zur Ordnung und Vernunft andererseits; wesensmäßig sucht er das Unabsehbare wie das Übersehbare« (Schmoll, gen. Eisenwerth, 1961, S. 634). Die Suche nach Regeln in der Kunst und gleichzeitig nach künstlerischen Freiheiten und das Bestreben, die gefundene Regeln zu durchbrechen und zu erweitern, führen zu einer janusköpfigen Ausgangslage für den Kunstunterricht: Wann gewähre ich als Pädagog*in Freiheiten oder erwarte sogar einen freien Umgang mit einer Aufgabenstellung von den Schüler*innen? Wann überfordern diese Freiheiten die Schüler*innen womöglich und wann ist daher die Vermittlung von Regelwissen angezeigt?
Dieses Buch wendet sich an Erwachsenenbildner*innen sowie Lernende in erster und zweiter Phase der Lehrer*innenausbildung sowie im Fortbildungszusammenhang gleichermaßen. Studierende der Kunstpädagogik, Referendar*innen oder Kunstpädagog*innen in außerschulischen Arbeitsbereichen finden in den Texten und Übungen konkrete Handreichungen, um eigene Unterrichtsvorhaben im Selbststudium zu planen und zu reflektieren. Lehrende, sei es an der Universität, im Referendariat oder in Fort- und Weiterbildung, finden Möglichkeiten, ihre Seminargestaltung auszudifferenzieren. Die Materialien eignen sich für Lehrangebote verschiedenster Art, vom Universitätsseminar bis zu kollegialen Fortbildungen etwa für fachfremd unterrichtende Kolleg*innen, ob als Workshop an einem Tag oder am Wochenende oder als vielwöchiges Angebot, das 30 – 40 Stunden und mehr umfasst. Auch Kunstpädagog*innen, die in außerschulischen Einrichtungen in öffentlicher oder freier Trägerschaft arbeiten, können sich mit den Angeboten gegenseitig fortbilden oder Anregungen für die eigene Arbeit finden. Es ist dann jeweils zu entscheiden, welche Lektionen ausgewählt werden und ob ein Unterrichtsbesuch oder ein Praktikumsbericht für das Fortbildungskonzept relevant ist.
Die Übungen sind über 15 Jahre im Zusammenhang mit den Universitätsseminaren zum Schulpraktikum Kunst gewachsen: Vorbereitungsseminar, Durchführung mit Unterrichtsbesuch und Nachbereitungsseminar als Kompaktveranstaltung am Wochenende. Insofern kann ich wirklich von Lernen durch Lehren sprechen, denn durch die Fragen und Diskussionen mit den Studierenden, die in den Veranstaltungen auftauchten, hatte ich immer wieder neu Anlass, Lehrinhalte zu überdenken und geeignete Übungen weiterzuentwickeln. Dieser Prozess ist mit diesem Buch nicht abgeschlossen, es handelt sich also gewissermaßen um einen Zwischenbericht.
Die Tatsache, dass in einer konkreten Lehrsituation, ob in der Schule oder außerschulisch, die Grundproblematiken eines Inhalts besonders deutlich werden, ist auch der Grund, weshalb das Schulpraktikum Kunst eine so wesentliche Schnittstelle im Studium darstellt. Es verbindet die bis dahin erarbeitete didaktische Theorie und den künstlerischen Entwicklungsstand der Seminarteilnehmer*innen mit der aktiven und konkreten Unterrichtspraxis in der Schule. Nach der Praktikumserfahrung können die angehenden Kunstlehrer*innen andere Fragen an das Studium oder die Ausbildung stellten, denn ihre Problemsensitivität ist nun erheblich geschärft. Die Teilnehmer*innen verlassen die Beobachterrolle der Hospitant*innen und betreten die Bühne der aktiv Unterrichtenden, was qualitativ etwas ganz Anderes ist. Vielleicht konnten sie sich schon in einem anderen Praktikum erproben und dabei erste Erfahrungen sammeln, doch nun kommt der Anspruch hinzu, vorausschauender und komplexer als bisher den Kunstunterricht zu planen. Dabei ahmen einige ansatzweise den Kunstunterricht nach, den sie selbst erlebt haben, weil er für die eigene Schüler*innenbiografie so prägend war (vgl. Wahl, 2006, S. 13). Das kommt sogar dann vor, wenn sie diesen bei näherer Betrachtung selbst durchaus kritisch beurteilen würden. Den anderen fällt es schwer, überhaupt als Unterrichtende zu handeln, weil sie ausgesprochen selbstkritisch sind und jeden Schritt, jede Entscheidung zunächst durchdenken möchten. Das schränkt ihre Handlungsfähigkeit stark ein. Sie sind sich ihrer Wirkungsmächtigkeit bewusst, überschätzen diese möglicherweise sogar, sind ausgesprochen vorsichtig und möchten die Schüler*innen nicht einschränken. Beide Gruppen müssen sich behutsam in Richtung des anderen Pols bewegen: Die erste Gruppe wird im Seminar dazu angehalten, das zu problematisieren und zu reflektieren, was sie für »normal« oder selbstverständlich halten. Die anderen werden ermutigt, bewusst Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu stellen und im Unterricht die Aktivitäten der Schüler*innen zu lenken – selbstverständlich immer didaktisch-methodisch reflektiert.
In der Seminararbeit ist es wesentlich, die Übungen mit der Fachtheorie zu verknüpfen, damit Theorie und Praxis nicht parallel nebeneinander existieren, ohne miteinander zu kommunizieren. Noch immer bringt das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis bei Studierenden zwei Haltungen hervor: 1) An der Universität wird (zu) viel Theorie erörtert, die man nicht anwenden kann, jetzt kommt die Praxis und die funktioniert nach eigenen Gesetzen. Endlich Praxis, endlich keine Theorie mehr (vgl. dazu Wahl, 2006, S. 12) oder: 2) Die Theorie hat Spaß gemacht, war interessant und positiv herausfordernd, die Praxis aber ist zu banal und kann meinen Idealen nicht entsprechen, ich entferne mich von ihr. Beide Positionen bleiben unbefriedigend, weil sie die Herausforderung nicht annehmen, Theorie und Praxis zu verschränken. Wenn ich die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit richtig einschätze, findet eine Bewegung aufeinander zu statt: Die Universitäten bemühen sich um eine verstärkte Theorie-Praxis-Verschränkung schon in der ersten Phase der Lehrer*innenausbildung und die Ausbilder*innen im Referendariat sind bestrebt, die Theorie differenzierter einzubinden, und wenden sich gegen das »Rezepthandeln« (vgl. Schoppe, 2019, S. 27 f.). Diethelm Wahl konstatiert dennoch, dass es die erworbenen Wissensbestände aus der ersten und zweiten Ausbildungsphase kaum »vermögen, das Planungshandeln von Lehrerinnen und Lehrern nachhaltig zu beeinflussen« (2006, S 12). »Lernziele werden nicht reflektiert. Methodische Aspekte bis hin zu Differenzierung oder Individualisierung treten in den Hintergrund« (Haas, zitiert nach Wahl, ebd.). Diese Tatsache hat viele Ursachen. Eine könnte sein, dass an Universitäten zu wenig konkret geübt wird. In der zweiten Ausbildungsphase ist dann der Notendruck schon so stark, dass Experimentierfelder kaum noch Platz haben. Dieses Buch bietet Übungen an, die konkret in Unterrichtsplanungen und Erprobungen hineinführen. In den Lektionen sollen freie und gerne auch kontroverse Diskussionen unter Anbindung an die fachdidaktische Theorie angeregt werden. Das Buch soll den Einsteiger*innen helfen, sich in theoriegeleiteten Übungen mit Feedback zu erproben, ohne immer direkt benotet zu werden. Hierzu sind Übungen beschrieben, die auch die persönliche Verbindung zur Berufswahl, den aktuellen Standpunkt beleuchten und das vertiefte Nachdenken über die eigene Lehrer*innenrolle fördern können. Dieses Kompendium möchte einen Beitrag dazu leisten, mit Lernenden, die das Unterrichten beginnen, die ersten Schritte des Durchdenkens und Erprobens gemeinsam zu gehen.
Die Praktikumserfahrung hat noch eine andere wichtige Funktion, die mitunter schmerzhaft ist: Es geht für die Teilnehmer*innen darum herauszufinden, ob der Lehrer*innenberuf die richtige Entscheidung für das eigene Leben ist. Die Seminarleiter*innen müssen diese Frage spätestens in der Nachbereitung offen ansprechen. Dies löst mitunter Ängste und Widerstände aus, daher sollte das Angebot von Einzelgesprächen hinzukommen. Lehrer*in sein heißt, Freude am Wechsel der Blickrichtung zwischen Schüler*innen und Unterrichtsinhalten zu haben. Es bedeutet, sich in die Ebene, auf der sich die Schüler*innen bewegen, ohne »Wenn und Aber« einzudenken und einzufühlen, um dann wieder gedanklich zum Unterrichtinhalt zu wechseln und diesen mit den Schüler*innen zu verbinden. Wenn dieses »Pendeln« als sehr anstrengend erlebt wird oder gar nicht stattfindet, sollte der Berufswunsch überdacht werden, denn es macht den Kern einer erfolgreichen Lehrtätigkeit aus. Die Erkenntnis, besser auszusteigen, ist ein wichtiger persönlicher Schritt, der aber meistens als persönliches Versagen erlebt wird. Diesen Prozess konstruktiv zu begleiten und zu unterstützen, ist eine wichtige Aufgabe der Seminarleitung.Das Buch gliedert sich in zwei Teile.
I Kunst und ihre Vermittlung – Grundlagen
Grundhaltungen zum Kunstverständnis und zur Unterrichtsstruktur wirken sich konkret auf den täglichen Unterricht aus und müssen thematisiert werden, bevor man in eine Unterrichtsplanung einsteigt. Daher ist es notwendig, einige theoretische Überlegungen den Übungen in Teil II voranzustellen.
Zu Beginn wird ein einfaches Modell zur Planung von Kunstunterricht vorgestellt, in dem wesentliche Aspekte einer Unterrichtsplanung in ihren Interdependenzen zusammengedacht werden: Die Schüler*innen, die Kunst, die Didaktik und Methodik. Ich nenne es den Didaktischen Kreis. Weiter wird der Frage nachgegangen, was einen künstlerischen Prozess auszeichnet, welche Strukturelemente er aufweist und welche Konsequenzen dies für die Kunstpädagogik hat. In dem Zusammenhang wird gefragt, ob Kunst überhaupt lehrbar ist und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um künstlerische Prozesse in einen Unterrichtszusammenhang zu bringen. Dabei geht es um die allgemeinen und subjektiven Anteile der Kunst, um ihre Regeln und deren Durchbrechung im Generationswechsel. Der künstlerische Prozess der Schüler*innen ist von Subjektivität geprägt, obwohl er ebenfalls Allgemeines und Überindividuelles aufnimmt und verarbeitet. Dieser Spannungsbogen muss sich in seiner Widersprüchlichkeit auch auf das Verständnis des Kunstunterrichts auswirken, das heißt, im Kunstunterricht braucht es Spielräume für subjektives Handeln jenseits der Beliebigkeit.
Absichten und Ziele: Unterrichten heißt immer Ziele verfolgen, aber das Verhältnis der Kunstpädagogik zu ihren Zielen ist von besonderer Art. Die Unterrichtsziele im Kunstunterricht dienen dazu, die Schüler*innen in das künstlerische Denken und Handeln hineinzuführen, sie in einen Such- und Gestaltungsprozess zu schicken, aber nicht, um alles vorzugeben, schon gar nicht die Ergebnisformen eines entstehenden Produkts, im Gegenteil: Sie wollen die eigenen Wege der jeweiligen Klientel sinnvoll und vertiefend unterstützen. Im Kunstunterricht geht es nicht in erster Linie um das unkritische Nachvollziehen und »Lernen« von Kunst, sondern um das Einüben eigener Wege unter Einbezug der Kunstgeschichte und ggf. Kunstwissenschaft sowie der aktuellen Kunstlandschaft. Um dies leisten zu können, müssen Kunstpädagog*innen über ausreichend Erfahrung mit eigenen künstlerischen Prozessen verfügen; fehlt diese, sind die Pädagog*innen durch die Versuche und Experimente der Schüler*innen verunsichert und stehen ihnen ratlos gegenüber. Im Theorieteil werden die Unterschiede eines deduktiven und induktiven kunstdidaktischen Denkens erläutert, im Übungsteil werden dazu Übungen angeboten. Kunst ist im eigentlichen Sinne nicht lehrbar, aber wir müssen alles tun, um das künstlerische Denken und Handeln zu vermitteln – wie ist mit diesem Dilemma umzugehen?
II Kunstpädagogik zwischen Lenkung und Offenheit – Übungsteil
Leitziel der Kunstpädagogik ist es, die Heranwachsenden zu selbständigem Denken und Handeln im Künstlerischen zu befähigen und letztlich auch frei mit dem Vorhandenen kenntnisreich umzugehen. Wenn kenntnisreiche Freiheit im Künstlerischen das Ziel ist, muss sie auch im didaktisch-methodischen Vorgehen eine Rolle spielen. Weil Schüler*innen aber keine Künstler*innen sind, die ihren Prozess schon vollständig autonom bestimmen und lenken, müssen im Kunstunterricht in der Regel über die Aufgabenstellungen Wege eröffnet, Prozesse angestoßen und auch gelenkt werden. Die Methodik bewegt sich zwischen Lenkung und Offenheit, immer mit dem Ziel, die Selbständigkeit zu erweitern.
Auch das kunstpädagogische Handeln muss erlernt werden. Auch hier ist das Ziel, die zukünftigen Lehrer*innen zu einem selbständigen kunstpädagogischen Denken und Handeln zu befähigen und nicht nur Vorgaben zu befolgen. Im Übungsteil werden nun zu den verschiedenen Aspekten der Unterrichtsplanung und -reflexion Seminarübungen angeboten. In einem Seminarzusammenhang können wahrscheinlich nicht alle Übungen umgesetzt werden, vielmehr handelt es sich um einen Pool von Übungen, die ausgewählt und miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Übungen stehen daher zwar in einem sinnvollen Aufbau, können aber selbstverständlich je nach Bedarf aus diesem herausgelöst und in einer anderen Abfolge eingesetzt werden. Die Übungen und Theoriegesichtspunkte verstehen sich als Anstoß des Nachdenkens, nicht als Rezepte für einen guten Kunstunterricht. Um Verbindungen und Interdependenzen anzuzeigen, sind Querverweise zu anderen Kapiteln eingefügt. Das Schema des Didaktischen Kreises wird zur Planung von Unterricht und zur Reflexion nach einer Unterrichtshospitation oder im Nachbereitungsseminar genutzt. Immer geht es darum zu verstehen, welches Element gerade reflektiert wird (Klientel, Kunst, Didaktik/Absichten, Methodik), wie die Bausteine der Planung zusammenhängen und sich bedingen. Die Übungen werden durch Impulstexte, Infoboxen, Schaubilder und einführende Texte ergänzt und unterstützt, um einen Einstieg in das Denken und Handeln zu erleichtern. In der Regel schließen sich noch Kommentare an, um transparent zu machen, welche Absichten mit den Übungen verfolgt werden.
Aufbau der Übungen: Der Übungsteil beginnt mit
•
einem Blick auf das Ganze. Gegenwärtige und historische Konzeptionen von Kunstunterricht werden auf verschiedene Gesichtspunkte befragt: das Menschenbild/Schülerbild, das Kunstverständnis, die Vermittlungsabsichten/Ziele und die Methodik einer Zeit oder eines kunstpädagogischen Konzepts.
•
Es schließen sich Übungen zu den Grundaspekten einer Unterrichtsplanung an, wie sie im Didaktischen Kreis dargestellt sind. Hier wird von den persönlichen Beziehungen ausgegangen, die die Teilnehmer*innen bereits mit diesen verbinden, als auch nach Perspektiven der Erweiterung und Fortentwicklung gefragt.
•
Weitere Übungen thematisieren die Suche nach eigenen Unterrichtsideen, deren Verschriftlichung und kritische Befragung.
•
Mehrere Übungen sind den Zielen und Aufgabenstellungen im Kunstunterricht gewidmet.
•
Grundsätzlich fließen in einer kunstpädagogischen Aufgabenstellung alle bisherigen Überlegungen zusammen und konkretisieren sich dort. Bereits an der Struktur einer gestellten Aufgabe können schlüssige oder sich widersprechende Vorannahmen aufgezeigt werden. Im Hintergrund stehende Überlegungen zur Didaktik oder Methodik werden hier deutlich, aber auch logische Brüche, Befürchtungen oder Unsicherheiten. Eine gut gestellte Aufgabe ermöglicht Fortschritte, ohne alles vorzuschreiben. Eine schlecht gestellte Aufgabe lässt die Schüler*innen, ob über- oder unterfordert, auf ihr Handlungsspektrum zurückfallen, auf dem sie sich schon vorher bewegt haben, es kommt aber nichts hinzu. In diesem Zusammenhang tauchen wieder die Begrifflichkeiten des deduktiven und induktiven kunstpädagogischen Denkens auf und es werden grundsätzliche Überlegungen zur Struktur von Unterrichtszielen in der Kunstpädagogik bearbeitet.
•
In einem weiteren Kapitel werden wesentliche methodisch-didaktische Felder von Kunstunterricht dargestellt und in ihrer Struktur beschrieben. Durch Übungen werden diese näher untersucht und ihre Bedeutung für den Unterricht befragt. Die Teilnehmer*innen sollen auf diese Weise ihr eigenes Spektrum an künstlerischen Verfahren und Zugängen erweitern.
•
Die Übungen zur Bildbetrachtung und Unterrichtssimulation bieten Möglichkeiten, konkrete Unterrichtssituationen in der Gruppe zu erleben, auszuwerten und zu reflektieren.
•
Ein weiteres Thema ist das Reflektieren und Bewerten im Kunstunterricht. Dies wird in den Seminaren häufig von den Teilnehmer*innen nachgefragt, weil sie die besondere Brisanz der Problematik erkennen und dazu arbeiten möchten.
•
Eine wichtige Erfahrung ist der Unterrichtsbesuch als Zusammenführung von Planung, Durchführung und Reflexion von Unterrichtsversuchen. In der konkreten Erfahrung samt anschließendem, strukturiertem Beratungsgespräch liegen wesentliche Chancen von Erkenntniszuwachs.
•
In der Nachbereitung des Praktikums werden erstens die kunstpädagogische Arbeit (Unterrichtsversuche) im engeren Sinne beleuchtet und zweitens die weiteren Eindrücke aus der Schulwirklichkeit, die im Praktikum in ihrer Vielfalt und Komplexität auf die Studierenden eingewirkt haben. Dies geschieht u. a. mit Übungen zur kooperativen Beratung nach Wolfgang Mutzeck.
•
Am Ende steht ein Vorschlag für die Struktur eines Praktikumsberichts mit einem ausführlich formulierten Unterrichtsentwurf. Beides dient der vertiefenden, schriftlichen Reflexion der Unterrichtsversuche und der gesamten Praktikumserfahrung.
Zur Orientierung im Buch
Erläuterung
Übung
\Infobox
I Kunst und ihre Vermittlung – Grundlagen
1 Was brauchen Anfänger*innen?
1.1 Der Didaktische Kreis – ein einfaches Planungs- und Reflexionsmodell
Als Planungs- und Reflexionsmodell bringe ich den Didaktischen Kreis (DK) ein (bei Übung 7, ▸ Abb. 6, siehe Download). Das Modell fiel mir während eines Unterrichtsbesuchs ein, zu dem ich eine differenzierte Rückmeldung geben wollte. Die Arbeit mit dem DK soll immer wieder die Interdependenzen der Elemente einer Unterrichtsvorbereitung im Fach Kunst verdeutlichen. Der DK hat seine Rolle in der U-Planung, aber auch bei der Reflexion von U-Versuchen. Beim Einstieg in das kunstpädagogische Denken ist das Modell hilfreich, um die relevanten Aspekte einer Unterrichtsplanung zusammenführen, Einseitigkeiten zu durchschauen und zu überwinden. Es ist noch so übersichtlich, dass die Neueinsteiger*innen nicht von der Komplexität erdrückt werden, die das Gefüge »Unterricht« durchaus ausmacht. Es handelt sich dabei also zunächst um ein recht einfaches Konstrukt, das nicht den Anspruch hat, Details einer Unterrichtsplanung und -wirklichkeit zu erfassen, sondern nur die unverzichtbaren Eckpunkte einer Planung zu markieren. Von hier aus sollen sich weitere Diskussionen und Differenzierungen entwickeln.
Als Anker des Denkens stehen die Kategorien Schüler*innen, die Kunst, Absichten/Ziele und Methodik zur Verfügung. Die Absichten/Ziele werden nochmals in Fachziele und Förderziele unterteilt, weil das Fach einen Leistungsgedanken und einen Fördergedanken beinhaltet. Als Grundlage für einen gelingenden Kunstunterricht wird zuallererst eine solide Verbindung von Schüler*innen und der Kunst gefordert. Diese herzustellen, erscheint die erste Bedingung, die erfüllt sein muss, um Kinder und Jugendliche die Kunst zugänglich zu machen. Daran knüpfen sich die Gedanken zur Zielperspektive und schließlich zur Methodik. Alles fließt in der Gestaltung der Aufgabenstellung zusammen, der immer wieder eine gesteigerte Aufmerksamkeit zukommt: In der Aufgabenstellung münden verdichtend alle relevanten Überlegungen und bestimmen wesentlich den Unterricht.
1.2 Das Bewusstsein für die eigene Ausgangsposition des Nachdenkens
Wenn junge Erwachsene sich für die Kunstpädagogik entscheiden, ob innerschulisch oder außerschulisch, ist ihre Motivation und ihr persönliches Interesse in der Regel zunächst bei der Kunst angesiedelt oder im Hinblick auf eine Klientel, mit der sie Erfahrungen gemacht haben. Meistens sind diese beiden Seiten des Interesses nicht gleich groß. Entweder sind die Studierenden 1) schon in die eigene künstlerische Arbeit oder auch in die kunstgeschichtliche Auseinandersetzung tiefer eingetaucht oder 2) sie haben vermehrt Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Einrichtungen gesammelt und verbringen dort gerne Zeit. Es ist dann die Entwicklungsaufgabe im Studium, einerseits die ursprüngliche Neigung auszubauen, die oft die persönliche Stärke ausmacht, und andererseits auch die Seite zu entwickeln, die zunächst nicht im Vordergrund steht.
Auch bei den ersten Gedanken einer Unterrichtsvorbereitung gehen die beiden Denkrichtungen von den verschiedenen Positionen aus: Die einen denken zuerst an Kunst, die sie fasziniert, die sie vielleicht selbst ausüben und die sie vermitteln möchten. Die anderen denken an Heranwachsende, Kinder und Jugendliche, die sie zu neuen Erfahrungen anregen wollen, ohne zu wissen, wie das methodisch gehen könnte. Auch die Zielperspektive erscheint bei beiden Gruppen noch sehr unklar. So kann man durchaus von der Einseitigkeit des gedanklichen Einstiegs bei den Studierenden sprechen, was ganz normal ist. Ausgehend von dem Bewusstsein, von woher die einzelnen in das Planen einsteigen, können sie nun die fehlenden Aspekte ergänzen.
1.3 Ermutigung, aktiv die Rolle des bzw. der Lehrer*in einzunehmen
Wir sind alle geprägt von den Erfahrungen unserer eigenen Schulzeit, von den positiven wie den negativen. Wir haben unausgesprochen Lehrer*innen-Vorbilder und auch Negativ-Bilder in uns abgelegt: Das war ein toller Lehrer, eine tolle Lehrerin, oder: so will ich auf keinen Fall werden. Die Lehrer*innenrolle zu entwickeln, ist eine Aufgabe, die nur über die Zeit und mit wachsender Erfahrung gelingen kann. Im Studium ist es aber bereits wichtig, Elemente der Rollenfindung anzubahnen, jedoch unter erschwerten Bedingungen: Im Studium wird von den Studierenden die Rolle des/der Lehrer*in kaum abverlangt, es werden vielmehr zunächst Theorien und Konzepte vermittelt, die mitunter recht weit von der selbst erlebten Schulwirklichkeit entfernt sind. Um die Praxis stärker in das Studium hineinzuholen, werden seit einigen Jahren an den Universitäten Erfahrungen mit dem sogenannten Praxissemester gesammelt, in dem das Praktikum auf Woche 8 – 10 Wochen ausgedehnt wird, das Problem ist also seit langem bekannt. Wenn die Studierenden in die Lehrer*innenrolle kommen, sind viele durch die Fülle an Informationen und Ansprüchen, die sie mittlerweile in sich aufgenommen haben, stark verunsichert. Sie habe das Gefühl, auf keinen Fall diesen hohen Ansprüchen (»was ist guter Kunstunterricht?«) gerecht werden zu können. Das Ergebnis ist Ratlosigkeit, die sich regelrecht zu einer Lähmung der Eigenaktivitäten auswachsen kann. Geradezu symbolisch für diese Unsicherheit ist für mich geworden, dass die Studierenden, wenn es als Übung um einen motivierenden Unterrichtseinstieg ging, sehr gerne den Stillen Impuls wählten, also das Zeigen eines Bildes oder Objekts ohne Sprache. Ich habe mich gefragt, wieso der Stille Impuls so beliebt ist. Möglicherweise, weil er den Unterricht eröffnet, ohne dass die Studierenden das Wort ergreifen müssen, was eine viel aktivere Handlung darstellt. Denn die Verunsicherung der Studierenden, was denn eigentlich ihre Aufgabe als Kunstpädagog*in sein soll, ist groß. Es geht im Kunstunterricht nicht nur darum, die Schüler*innen bei ihren Prozessen vorsichtig und zurückhaltend zu begleiten und dabei keinesfalls zu sehr zu beeinflussen und zu lenken. Unterrichten heißt auch, etwas Neues vor Augen zu führen, etwas hervorzuheben, zu verdeutlichen, zu unterscheiden, Richtungen aufzuzeigen, Wege zu unterstützen und andere Wege mit den Schüler*innen gemeinsam möglicherweise als Sackgassen zu erkennen. Kunstpädagog*innen sind kompetente Türöffner, die den Schüler*innen eigene kreative Wege ermöglichen. Einsteiger*innen brauchen Ermutigung auf diesem Weg, didaktisch-methodische Entscheidungen zu treffen, diese zu begründen und zu erproben, und freilich auch die Bereitschaft, kritisch darüber zu sprechen.
1.4 Freiräume des Ausprobierens
Wenn wir Neues lernen, ist es wichtig, sich zu erproben, erste Erfahrungen zu machen und dabei jemanden an der Seite zu haben, der bzw. die korrigiert und berät, aber noch nicht benotet. Manchmal ist es sogar wichtig, ganz allein mit einer Situation zu sein, weil schon das Beobachten durch eine andere Person als hemmend erlebt wird. Leider gibt es diese Freiräume in der Lehrer*innenausbildung kaum – im Fortbildungszusammenhang mag es anders aussehen. Sehr schnell entsteht im Ausbildungsrahmen, sei es im Studium, sei es im Referendariat, der Druck der Notengebung, der das gesamte Setting verändert, weil das Element der Existenzsicherung prägend wird. Die Angst, Fehler zu machen, führt vielfach zu einer Unterrichtskonzeption, die auf »Sicherheit« ausgerichtet ist und die deshalb stark auf Vorhandenes zurückgreift. Phasen des Experimentierens und Erprobens, der Suche nach künstlerischen Wegen mit den Schüler*innen, werden vermieden, weil sie unwägbar und zu riskant erscheinen. Dies widerspricht jedoch den Grundintentionen des Faches, das kreative Spiel- und Bewegungsräume eröffnen möchte, Risiko eingeschlossen.
Ich erinnere mich an einen Unterrichtsbesuch an einem Gymnasium, bei dem die Nachbesprechung auf mich gleich sehr merkwürdig wirkte: Die Studentin begann sofort, sich für alles, was in ihren Augen »nicht so gut gelaufen war«, zu rechtfertigen (schwierige Klasse, problematische Themen im Alltag der Klassengemeinschaft, verhaltensauffällige Schüler*innen, ungeeignete Räume, zu wenig Zeit). Dabei unterstützte sie offensiv die Mentorin. Zudem zitierte die Studentin Auszüge aus den Lehrplänen, Kompetenzstandards und Rahmenrichtlinien, die sie berücksichtigt habe und brachte Fachtermini an, wo es nur ging. Ich unterbrach sie und betonte noch einmal, dass dieser Unterrichtsversuch nicht benotet würde, sondern nur die Reflexion, die sie dann später schriftlich abzugeben hätte. Daraufhin sahen sich Mentorin und Praktikantin an und die Mentorin sagte: OK, dann können wir ja offen reden. In der Folge entspannte sich die Gesprächsatmosphäre deutlich und es begann ein klares Beratungsgespräch ohne Missverständnisse über Stärken und Schwächen der Planung und Umsetzung des Unterrichts. Die Studentin erlebte es als positiv, dass ihr viel konzentrierte Aufmerksamkeit zuteilwurde, und bedankte sich anschließend dafür. Planungsschwächen konnten ohne Angst vor negativen Konsequenzen besprochen werden.
Weil die Unterrichtsbesuche eben nicht benotet werden, empfinden die Studierenden sie als bereichernde Beratung und fordern sie ein. Wir befinden uns bei ersten Unterrichtsversuchen in einer Phase des Lernens, die durch Reflexion und Beratung begleitet wird, und noch nicht in einer Prüfungsphase. Auf Bewertung und Benotung wird jedoch nicht verzichtet: Benotet wird ein Praktikumsbericht, in dem die Versuche reflektiert werden. Misslungene Unterrichtsversuche können so in der Reflexion und Suche nach Alternativen noch Basis von Erkenntnis werden.
Erfreulicherweise sind auf dem Gebiet der Unterrichtsbesuche und Nachbesprechungen in den letzten Jahren vielversprechende theoriegeleitete Modelle publiziert worden (z. B. Mutzeck, 2008b, S. 151, Köhler, 2015), die das beratende Auswerten der Unterrichtsversuche jenseits einer Benotung thematisieren. Die Benotung erzeugt gerade am Anfang einer Lehrer*innenausbildung einen destruktiven Druck und ist an dieser Stelle durchaus schädlich zu nennen. Der Weg des Lernens ist das Üben, Ermutigen, Kritik Anhören, Wiederholen, auf Details Achten und gezielter Üben, sich selbst und andere Beobachten, Fehler Verbessern und nicht Aufgeben. Meines Erachtens braucht es in den Ausbildungsphasen vermehrt Inseln des Erprobens unter Begleitung (Coaching) und Reflexion ohne Benotung.
2 Der Didaktische Kreis – zur Einführung
Das Modell des Didaktischen Kreises (▸ Abb. 6 Didaktischer Kreis und Download) ist zwar ein recht einfacher gedanklicher Einstieg in die Planung von Kunstunterricht, dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Unterrichtsgeschehen ein ausgesprochen komplexes Gefüge aus sich beeinflussenden Bedingungen ist.
Herleitung des Modells
Paul Heimann und seine Mitarbeiter legten Anfang der 1960er Jahre ein Modell für das Planen von Unterricht vor, das unter dem Namen »Berliner Modell« große Bekanntheit erfuhr und ebenso große Kritik auf sich zog. Wie immer man dazu stehen mag, das Berliner Modell brachte wesentliche Elemente einer Unterrichtsplanung zusammen, die ansonsten in der didaktischen Theorie zu wenig miteinander verknüpft werden, so auch in der Kunstpädagogik: die anthropogenen Voraussetzungen, soziokulturellen Voraussetzungen, Absichten und Ziele, Inhalt und Gegenstände, Methoden und Medien (Heimann, Otto, Schulz, 1965). Das Berliner Modell war dann der Ausgangspunkt für vielfältige didaktische Entwicklungen in seiner Nachfolge. Eine gute Übersicht hierüber bietet der kleine Reader »Didaktische Theorien« (1979/2006), in dem fünf relevante Didaktiker vorgestellt werden (Klafki, Schulz, von Kube, Möller, Winkel), die ihre Überlegungen parallel zur Berliner Didaktik entwickelt oder modifiziert haben. Ausgesprochen interessant ist das dokumentierte Gespräch am Ende des Buches, in dem die Autoren miteinander ins echte Gespräch kommen. Außerdem sitzen drei Lehrer*innen am Tisch, die das Problem der Unterrichtsplanung und der Didaktik-Theorie aus Sicht der täglichen Schulpraxis befragen. In diesem Gespräch wird die Brisanz der Theorie-Praxis-Verschränkung exemplarisch sehr deutlich, welche auch das Thema des Schulpraktikums sein muss: das Engagement der Beteiligten, das Bemühen, sich zu verstehen und Brücken zu schlagen, aber auch die Grenzen der Kommunikation und vor allem die Schwierigkeit, die notwendige tiefergehende Theorie und die Alltagspraxis in einen fruchtbaren Austausch zu bringen.
Der Didaktische Kreis, wie er hier vorgestellt wird, bezieht sich auf Paul Heimanns grundlegende Überlegungen zur Planung und Realisierung von Unterricht (siehe auch: Heimann, 1962a, S. 142 ff.). Allerdings ist das Modell an die besonderen Bedingungen des Kunstunterrichts angepasst und verändert worden. Nach Hans-Günther Richter bleibt es Heimanns Verdienst, die Grundbausteine von »Entscheidungsfeldern und Bedingungsfeldern mit ihren Untereinheiten in einen Strukturzusammenhang gebracht, das heißt ihre rationalen Beziehungen bestimmt zu haben« (Richter, 1981, S. 15). So lassen sich die wesentlichen und hilfreichen Bausteine des Berliner Modells auch für den Kunstunterricht heute nutzen, ohne damit automatisch die Kunstdidaktik G. Ottos zu übernehmen. Otto war Mitarbeiter von Heimann und wendete das lernzielorientierte Berliner Modell auf die Kunstdidaktik an, was dann zu einer problematischen Prägung und Einseitigkeit (Richter, 1976, S. 53) des Fachs führte. Ottos »Generalthema« (ebd.) war die »Intellektualisierung« als Gesamtaufgabe der Schule, das Vermitteln des überindividuellen, rationalen Strukturverstehens in der Kunst, wie er sie verstand (Buschkühle, 2017, S. 78 ff.) und damit die Überwindung des Subjektiven im Unterricht. Diese Auffassung darf heute als überwunden gelten, muss jedoch weiter unten dennoch thematisiert werden, weil sie nach wie vor ausgesprochen wirksam ist (▸ Kap. 5.3, ▸ Kap. 5.4 und ▸ Kap. 7.5).
Es darf hier also nicht der Eindruck entstehen, dass durch die Bezugnahme zum Berliner Modell nach Heimann, Otto, Schulz eine lernzielorientierte Auffassung des Kunstunterrichts erneuert werden soll, wie sie Gunter Otto versucht hat (z. B. Otto, 1969). Interessanterweise kommt Richter zu dem Ergebnis, dass Heimanns theoretische Grundlegung, die übrigens zur Analyse von Hospitationen im Rahmen der Lehrer*innenausbildung entwickelt wurde (Richter, 1981, S. 128), mehr Möglichkeiten bietet, als sie später von Otto unter Bezugnahme auf das Modell für den Kunstunterricht herausgearbeitet wurden. Nach Richter lässt Heimanns Modell durchaus »einen situationsgerechten, schülerzentrierten (...) Kunstunterricht« (ebd., S. 128) und »ausdruckshaft individuelle Gestaltungsvorgänge der Schülerinnen und Schüler zu, wie auch eine (wirklich) ›produktive‹ künstlerische Praxis« (ebd.).
3 Kunst und Klientel – die Schüler*innen und die Kunst
Im Zentrum dieses Kompendiums soll das produktive Subjekt stehen, also die Schüler*innen, die im Kunstunterricht die Möglichkeit erhalten, visuelle Kulturen kennenzulernen und eigene künstlerische Wege zu gehen, sich neben der Sprache, die in der Schule dominant ist, auch im symbolischen Denken und Handeln zu üben. Es ist eine Errungenschaft, dass das Fach Kunst den produktiven Anteil des Fachs seit Beginn der Reformpädagogik etablieren, ausbauen und erhalten konnte. »Auch in diesem Symbolsystem kann, wie im Sprachunterricht, gelernt werden, (um) die Vielfalt, Differenziertheit und Ausdrucksqualität der eigenen Artikulationsmöglichkeiten zu erweitern, d. h. ›bildsprachliche‹ Kompetenzen zu entwickeln.« (Legler, 2011, S. 344) Wobei es fraglich ist, ob man von ›bildsprachlich‹ reden sollte, wo es doch darum geht, die besondere Struktur der Bildenden Kunst hervorzuheben und von der Sprache abzugrenzen.
Ein wesentlicher Unterschied zur Sprache liegt darin, dass sich das Kind sein Symbolsystem selbst erarbeitet: »Gegenüber der Sprache als »ererbter« (de Saussure) Ausdrucksform gilt das kindliche Zeichnen als Beispiel einer ›selbsterarbeiteten Symbolik‹ (Meili-Dworetzki 1975, S. 131); d. h. während das Kind in ein vorgegebenes Sprachsystem hineinwächst, entwickelt es eine zeichnerische (oder allgemein: bildnerische) Ausdrucksweise in einer aktiven Auseinandersetzung mit den Personen seines sozialen Umfeldes und den Gegenständen seiner empirischen Welt als Darstellung dieser Gegebenheiten. (...) Diese analoge Beziehung zu den Gegenständen der empirischen Welt verschafft der symbolischen Mitteilung ihre Spielräume (Mehrdeutigkeit, individuelle Äußerungsformen u. ä.), (...) »(Richter, 1984, S. 45).
Diese bewusste Schwerpunktsetzung für das eigene künstlerische Denken und Handeln der Schüler*innen bedeutet aber nicht, die Vermittlung von kunsthistorischem Wissen und den kritischen Umgang damit gering zu schätzen. »Das Unterrichtsfach erfüllt die Bildungsansprüche, die sich aus der Kunstgeschichte und aus dem künstlerischen Arbeiten ergeben: von der Sicherung des kulturellen Erbes bis zur Fähigkeit, eine künstlerische Haltung gegenüber der Welt zu entwickeln« (Busse, 2015, S. 44). Das künstlerische Denken und die Kunstproduktion kommen ohne das Nachdenken über Kunst, also die Kunstrezeption und Reflexion, nicht aus. Busse fordert mit Recht eine Überprüfung der Beziehung von Kunstdidaktik und Kunstgeschichte ein (ebd., S. 68). Die achtbändige Reihe »Kunst, Geschichte, Unterricht« (Kirschenmann/Schulz, 2021) kommt in diesem Zusammenhang zur rechten Zeit, leistet in dieser Denkrichtung Grundlegendes und bietet einen Überblick über aktuelle und schon bekannte Konzeptionen, insbesondere im Zusammendenken von Rezeption und Produktion. Das Üben eines kenntnisreichen und distanzierten Nachdenkens über historische, gegenwärtige Kunst und visuelle Kultur ist ein unverzichtbares Instrument, damit Enkulturation gelingen und Bildkompetenz aufgebaut werden kann. Vielleicht liegt es an der Schnelligkeit, mit der Bilder und visuelle Kunst im Gegensatz zum geschriebenen Wort rezipiert (angeschaut, aufgenommen) werden können, weshalb es nur wenig Problembewusstsein für dessen Traditionen, Strukturen und Wirkungen gibt. Bilder sind ›irgendwie einfach da‹, was gibt es da viel zu reden? Es ist schwer zu verstehen, weshalb Schüler*innen mit einem mittleren oder höheren Abschluss kaum Kenntnisse der Kunstgeschichte haben, wo doch die Möglichkeiten der viel geforderten Anschauung im Unterricht nirgendwo interessanter sein dürften als im Kunstunterricht. Kunstbetrachtung kann Schüler*innen doch in Staunen versetzen! Auch die immer wieder zu vernehmende Empfehlung, sich angesichts der flüchtigen Bilderflut im Internet und anderswo vermehrt von den Bildern ab- und dem Lesen zuzuwenden, löst das Problem nicht. Wir sollten uns in der Schule den Bildern auch lesend und schreibend zuwenden, sie tiefgehend betrachten, durchdenken und diskutieren. Bild und Wort lassen sich nicht gegeneinander ausspielen, künstlerische Praxis und Kunstgeschichte im Fach auch nicht.
Zurück zu der Beziehung der Kunst und der Schüler*innen: Die beiden zentralen Pole bilden im Modell (▸ Abb. 6) die Schüler*innen und die Kunst, die wegen ihrer fundamentalen Stellung und Zusammengehörigkeit durch einen Pfeil verbunden sind. Damit soll die wesentliche Forderung erhoben werden, dass diese beiden Pole im pädagogischen Geschehen immer einen Bezug aufweisen müssen. Dieser Forderung erscheint zunächst banal, ist in der Praxis aber schon nicht selbstverständlich. Auch in der fachdidaktischen Literatur begegnen uns nicht wenige Vorschläge und Konzepte, die nicht in erster Linie die Schüler*innen und die Kunst zusammen denken, sondern in nur einem der beiden Bereiche beheimatet sind und nur an einem Bereich echtes Interesse zeigen. Wo diese Pole aber nicht zusammengebracht werden, muss Kunstpädagogik scheitern: entweder a) indem sie die Schüler*innen nicht erreicht, weil nicht ausreichend nach den Anschlussstellen zwischen der Kunst und den Heranwachsenden gesucht wird (Interessen, Lebensweltbezug, kognitive Entwicklungsebene), wie zwei Züge, die aneinander vorbei rasen: Da war etwas, aber es ging zu schnell, es war zu flüchtig und es gab keinen echten Kontakt, daher hat es für mich keinerlei Bedeutung. Ein Kunstunterricht ohne Anschluss an die Lernbasis der Schüler*innen mündet in letzter Konsequent in einem Verlust des Respekts der Schüler*innen vor dem Fach. Oder b) im anderen Fall, wenn die Kunst im Unterrichtszusammenhang bedenkenlos »kleindidaktisiert« wird, also zugunsten einer eindimensionalen und scheinbar schülerorientierten Vereinfachung der Vermittlungsabsicht ihre Vielschichtigkeit verliert.
»Der Heranwachsende muss autobiografische Inhalte, Inhalte seines Lebensgeschehens, seiner Auseinandersetzung mit der Umgebung in die Produktion einbringen können« (Richter, 1984, S. 37).