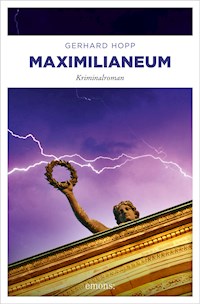Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach dramatischer Flucht aus Ostpreußen im Januar 1945 und fast zweijähriger Gefangenschaft in einem dänischen Flüchtlingslager gelangte der nun fünfzehnjährige Junge mit seiner Mutter nach Schleswig-Holstein, wo sein Vater auf einem Gut Arbeit gefunden hatte. Sein Bericht zeigt die Schwierigkeiten auf, die ein Neubeginn und der tägliche Kampf um die Existenz in einer fremden Umgebung mit sich brachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach dramatischer Flucht aus Ostpreußen im Januar 1945 und fast zweijähriger Gefangenschaft in einem dänischen Flüchtlingslager gelangte der nun fünfzehnjährige Junge mit seiner Mutter nach Schleswig-Holstein, wo sein Vater auf einem Gut Arbeit gefunden hatte. Sein Bericht zeigt die Schwierigkeiten auf, die ein Neubeginn und der tägliche Kampf um die Existenz in einer fremden Umgebung mit sich brachten.
Der Autor wurde 1931 in Schönau, Kreis Preußisch Holland / Ostpreußen geboren und besuchte dort zuletzt die Oberschule in der Kreisstadt. Der Einmarsch der Roten Armee im Januar 1945 beendete die Schullaufbahn des Dreizehnjährigen, der grauenvolle Gewalttaten der Russen miterleben musste. Die Rettung erfolgte durch die deutsche Wehrmacht, die auch die Flucht ermöglichte. Nach der Entlassung aus dem dänischen Internierungslager konnte er den Schulbesuch fortsetzen und studieren. Er wurde Lehrer an einem Gymnasium und unterrichtete Deutsch, Französisch und Philosophie.
Inhaltsverzeichnis
Rückblick
In der neuen Heimat
Das Gymnasium
Anders als die Anderen
Vorlieben und Schwächen
Kasper kommt
Ein Schülerstreich
Drill macht still
Was manchmal doch gelingt
Sportfest der Jungmannschule
Die Bretter, die die Welt bedeuten
Himmel und Erde müssen vergehen
Was macht die Kunst?
Ein König ohne Königreich
Wir nannten sie Mami
Endspurt
Die andere Wirklichkeit
Ein Häuschen im Grünen
Wir brauchen Licht
Jagdgelüste
Gartenbau
Haustiere
Seeblick
Schwimmtraining
Der Hamsterer
Aquis submersa
Dorfjugend
Nachbarschaft
Nützliche Anschaffung
Landarbeit
Überfall
Schwere Schicksale
Wiedersehensfreude
Krankheit
Kultur auf dem Dorfe
Wieder im Flüchtlingslager
Das Lager Louisenberg
Die Flüchtlinge aus der Sicht der Einheimischen
Vom Regen in die Traufe
Zum Leben zu wenig
Als Werkstudent im Einsatz
Schatzgräber im Trümmerfeld
Wohnverhältnisse
Hygiene
Schwein muss man haben
Keine Kohle – kein Feuer
Tröstliche Momente
Ferienarbeit als Krankenpfleger
Wem Gott will rechte Gunst
Abschied und Heimkehr
Wieder in der Heimat
Geschäfte und eine Fabrik
Unsere Seelenlage
Hilfe von außen und innen
Rückblick
Bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr durfte ich eine friedliche und wohlbehütete Kindheit verleben. Meine fürsorglichen Eltern behandelten mich liebevoll und versuchten trotz der ärmlichen Verhältnisse, die auf dem Lande herrschten, meine Wünsche zu erfüllen. Diese waren recht bescheiden, so wie der Lebensstil der Landarbeiterfamilie, die schwer arbeiten musste, um das tägliche Leben zu bestreiten. Ich meinerseits konnte meinen Eltern damit Freude bereiten, dass ich in der Schule gute Leistungen erbrachte. Als sie merkten, dass ich musikalisch war, kauften sie mir eine Ziehharmonika, auf der ich schnell zu spielen lernte, ohne Noten natürlich, nach Gehör. Die Fingersätze brachte ich mir selber bei. Oft saß ich unter dem Jasminbusch in unserem Garten und habe Volkslieder gespielt. Am Feierabend hörten meine Eltern gerne zu, und mein Vater, Kriegsveteran des Ersten Weltkrieges, wünschte sich meistens „Ich hatt’ einen Kameraden“ oder „Argonnerwald um Mitternacht“. Als der Sohn einer befreundeten Familie im Russlandkrieg gefallen war, schenkte mir seine Mutter sogar seine Geige. Leider konnte ich damals keinen Unterricht bekommen, so dass meine Versuche, auf ihr zu spielen, kümmerlich blieben. Als der Grundschullehrer empfahl, mich auf die Oberschule zu schicken, sagten meine Eltern sofort zu, denn sie wollten nicht, dass ich wie sie als Scharwerker bei schlechter Bezahlung auf dem gräflichen Gut schuften sollte. Da ich, abgesehen von einigen Kinderkrankheiten, unbeschwert leben konnte, liebte ich mein Dorf mit seinen Teichen, Wiesen und schönen Ahorn- und Lindenbäumen, die besonders zur Blütezeit honigsüß dufteten. Und wenn ich heute an den Blüten eines Jasminbusches schnuppere, steigen die wunderbaren Erinnerungen an meine Kindheit hoch. Auch hatte ich gute Freunde und Spielkameraden. Nicht zu vergessen unsere Haustiere: Eine Kuh, ein Schaf sowie Federvieh durften sich meine Eltern halten. Ich bekam, weil meine Eltern beide arbeiten mussten und ich oft allein zu Hause war, einen kleinen Hund als Gesellschafter. Alles in allem lebte ich in einer heilen Welt.
Als der Zweite Weltkrieg begann, änderte sich für mich zunächst einmal nichts, dennoch war eine Veränderung spürbar. 1939 bekamen wir Einquartierung von Wehrmachtssoldaten; mein Vater wurde eingezogen und musste am Polenfeldzug teilnehmen, den er zum Glück heil überstand. Die ersten Todesnachrichten brachten manchen Familien Trauer und Verzweiflung. Bedrohlich wurde die Lage, als die Rote Armee im Herbst 1944 in Ostpreußen einfiel und die grenznahen Bewohner Mord und Vergewaltigung erleiden mussten, denn Gauleiter Erich Koch hatte verboten zu fliehen oder die Flucht vorzubereiten. Schreckliche Nachrichten erreichten uns, dass die Russen grauenvolle Massaker unter der Zivilbevölkerung angerichtet hätten. Nemmersdorf war einer der Orte, wo die Eroberer bestialisch gewütet hatten. Dennoch konnte sich niemand vorstellen, dass auch uns dieses Los treffen könnte. Marion Gräfin Dönhoff, unsere Gutsherrin, hatte heimlich Wagen für die Flucht präparieren lassen, wurde aber verraten. Ein Vertreter der Parteileitung in Preußisch Holland übermittelte ihr einen schweren Verweis der Gauleitung in Königsberg, in dem ihr harte Maßnahmen angedroht wurden, wenn sie weiter Vorbereitungen zur Flucht träfe. Im Spätherbst wurde mein Vater zum Volkssturm einberufen, er war nun neunundvierzig Jahre alt und musste zum dritten Mal in seinem Leben in den Krieg ziehen. Nun sahen auch wir mit Bangen in die Zukunft. Uns blieb nicht verborgen, dass die Front immer näherkam. Schließlich gab es den Befehl zum Packen. Mehrere Leiterwagen wurden mit der nötigsten Habe und Lebensmitteln beladen, bis die Seitenbretter ächzten. Dann kam der Abschied. Die Tiere, die uns lieb geworden waren, mussten wir zurücklassen. In der Hektik des Aufbruchs ging der Schmerz darüber unter. Ein Gespann mit vier Pferden zog jeweils einen der zehn Wagen, auf denen die Bewohner Schönaus saßen. Es herrschte eisige Kälte, um minus 20°. Die Pferde hatten Mühe, die überladenen Fuhrwerke zu ziehen; Schnee und Glätte erschwerten das Vorwärtskommen. Nach vielen Stunden erreichten wir die Kreisstadt Preußisch Holland, die nur acht Kilometer entfernt war. Dort waren die Straßen verstopft, so dass wir stundenlang auf der Stelle standen. Am Nachmittag entschlossen sich die Gespannführer, zu unserem Dorf zurückzufahren, damit wir nicht auf den Wagen übernachten müssten. Als wir zu Hause angekommen waren, fanden wir unsere Wohnung von Flüchtlingen besetzt! Wir kamen uns im eigenen Heim wie Fremde vor. Nun waren wir etwa zehn Personen in unserer kleinen Wohnstube.
Es war der 23. Januar 1945, der Tag, an dem meine Welt unterging.
Um Mitternacht hörten wir Schüsse, nicht laut, denn unsere Doppelfenster isolierten gut. Alle lauschten, plötzlich hartes Pochen an der Tür. Kommandostimme in einer unverständlichen Sprache. Alles blieb wie gebannt still und bewegungslos. Da fasste sich ein Mann, ein Weißrusse, der als Flüchtling schon länger im Dorf lebte, ein Herz und ging zur Tür, öffnete und trat hinaus. Banges Warten, Ungewissheit, Angst. Nach einigen Minuten, die uns wie eine Ewigkeit erschienen, drängte eine Gruppe von Sowjetsoldaten in die Wohnstube, Maschinenpistolen im Anschlag. Ich stand in vorderster Reihe, den Russen genau gegenüber, sah in ihre finsteren Gesichter. Einer trat vor, fuchtelte drohend mit seiner Maschinenpistole umher, was wie eine Mähbewegung mit der Sense aussah. Dabei redete er heftig und schnell auf uns ein. Eingeschüchtert und jeden Augenblick die Salve erwartend, standen wir regungslos mit erhobenen Händen vor ihm. Würde er schießen? Er schoss nicht. Die Gruppe Soldaten verließ nach einiger Zeit, die mir sehr lang erschien, den Raum. Die Anwesenden blieben wie versteinert stehen. Nur allmählich löste sich die Starre, als meine Mutter beruhigend auf mich einredete, ganz leise natürlich. Ein russischer Offizier blieb über Nacht in unserer Stube und legte sich zu einer Frau ins Bett... Ihm verdanken wir wahrscheinlich, dass in dieser Nacht nicht Schlimmeres geschah.
Am nächsten Tag bereits erfuhren wir von Erschießungen und Vergewaltigungen im Dorf. Dann wurden wir mit anderen Bewohnern in einer anderen kleinen Wohnung eingesperrt, wo es zu schrecklichen Szenen kam, wenn Frauen gewaltsam hinausgezerrt und im angrenzenden Schuppen vergewaltigt wurden. Niemand durfte das Haus verlassen; wir lebten von den wenigen Vorräten, die in der Wohnung waren. Auch die Notdurft mussten alle, Kinder und Frauen, ob jung oder alt, auf einem Eimer verrichten. Nach etwa einer Woche eroberten deutsche Soldaten das Dorf zurück und befreiten uns. Als sie ihre Stellung nicht mehr halten konnten und weiterziehen mussten, gingen wir mit. Ein langer Fußmarsch, manchmal unter Fliegerbeschuss, führte uns bei Schnee und Frost zum Frischen Haff, dann über das Eis auf die Frische Nehrung zu dem kleinen Ort Kahlberg, wo uns ein Schiff aufnahm und nach Danzig brachte. Nach fünf Wochen in Sicherheit rückte die Front so nah, dass wir unsere Flucht wieder unter Lebensgefahr fortsetzen mussten. Zum Glück gelangten wir auf ein Schiff, das auf der Reede der Halbinsel Hela lag, die „Potsdam“, die Flüchtlinge über die Ostsee nach Westen brachte. Anfang April 1945 kamen wir in Kopenhagen an, von wo aus wir an einen anderen Ort transportiert wurden. Nach der Kapitulation wurden wir als Kriegsgefangene in ein Lager gesperrt und fast zwei Jahre bei dürftiger Verpflegung hinter Stacheldraht interniert. Als meine Mutter und ich entlassen und nach Deutschland geschickt wurden, waren wir glücklich. Doch all diese Erlebnisse haben Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken.1
1Ausführlicher Bericht in: Gerhard Hopp, Mit dreizehn auf der Flucht, Books on Demand, Norderstedt 2016
In der neuen Heimat
Vater war nach seiner Rettung aus dem Heiligenbeiler Kessel in Ostpreußen über Flensburg auf dem Gut Karlsminde untergekommen, wo er in einem wohnzimmergroßen Barackenraum mit fünf anderen Kameraden untergebracht war. Dort mussten auch wir übernachten. Dazu wurden zwei Feldbetten in die Ecke links neben die Tür gestellt. Zum Schlafen zogen wir uns kaum aus. Waschen erfolgte in einer kleinen Schüssel, und die Toilette befand sich im Schuppen gegenüber, natürlich war es ein „Trockenklo“, immerhin verriegelbar und nicht unter freiem Himmel wie im ersten Lager in Dänemark. Die Körperpflege war zwangsläufig auf ein kaum beschreibbares Minimum reduziert, ebenso wie die Intimsphäre, die eigentlich nur während der wenigen Minuten gewährleistet war, während derer man seine Notdurft im Schutze des Schuppens verrichtete. Nach unseren Lagererfahrungen schreckte uns jedoch nichts mehr ab, also auch nicht dieser Umstand, mit mehreren Männern – vor allem nachts, denn tagsüber waren sie zur Arbeit – einen Raum zu teilen. Meiner Mutter muss es besonders unangenehm gewesen sein, aber sie beklagte sich nicht. Ein paar Tage mussten wir hier ausharren. Ich war auch tagsüber immer sehr müde und schlief viel. Wie benommen erlebte ich die ersten Tage in der neuen Heimat. Die Lebensumstände waren primitiv, denn es gab kein fließendes Wasser. Es musste von einem etwa 50 Meter entfernten Brunnen geholt werden.
Nach etwa einer Woche war eine baufällige Kate so weit in Stand gesetzt, dass wir einziehen konnten. Die erste Nacht dort war eisig; draußen herrschten etwa fünf Grad Frost, innen nicht viel weniger. Der scharfe Ostwind blies durch Tür- und Fensterritzen und wirbelte zeitweise eine zarte Pulverschneefahne in den Raum. Es gab keinen Ofen. Wir lagen unter einer Pferdedecke auf Stroh und hatten den großen Raum durch eine Zeltplane abgeteilt. Immerhin besser als die Nacht auf dem Eis des Frischen Haffes! Ja, es war trotzdem eine der schönsten Nächte seit langem: Endlich als Familie vereint, in einer Art Zuhause; endlich wieder in Deutschland!
Unsere erste feste Behausung nach der Flucht
Endlich als Familie vereint? Nein, nicht ganz. Meine Schwester Hilde fehlte; von ihr wussten wir nichts. Später erfuhren wir, dass auch sie die Flucht überstanden hatte, allerdings mit der bitteren Erfahrung, ihren anderthalbjährigen Sohn Peter an einer Lungenentzündung sterben sehen zu müssen.
Vater 1946, vom Krieg gezeichnet
Weihnachten 1946? Keine Erinnerung daran. Wir hatten damit zu tun, uns eine Schlafstätte im anderen Teil der Kate einzurichten, weil der größere Raum für eine zweite Familie vorgesehen war. Es handelte sich für uns um eine Art Wohnschlafzimmer, vielleicht 12 Quadratmeter groß. Davor befand sich ein Raum mit Zementboden, in dem der Herd stand. Die Tür führte unmittelbar nach draußen. Diese Räume, die wir jetzt bewohnen sollten, waren ehemals ein Schweinestall gewesen, wie uns Dorfbewohner sagten: Die Wände waren feucht und schwammig, die Dielen angefault. Elektrisches Licht gab es nicht. Wir behalfen uns mit einem Hindenburglicht. Als das verbraucht war, nahmen wir Stiefelfett und hängten einen Wollfaden als Docht hinein. Es räucherte zwar fürchterlich, aber es war besser, als im Dunkeln zu sitzen.
Vom Gutshof bekamen wir Kartoffeln, meistens gefrorene, und täglich einen Liter Milch. Vater hatte bis jetzt im Keller des Herrenhauses mit anderen Arbeitern gegessen, in der Regel Suppe und Bratkartoffeln. Alle Arbeiter ohne Familie wurden so verpflegt. Jetzt aßen wir gemeinsam „zu Hause“. Wruken (Steckrüben) waren bald keine Abwechslung mehr.
Vater mit „seinem“ Gespann 1949
Vater ging täglich seiner Arbeit auf dem Hof und dem Felde nach. Wie zu Hause in Schönau hatte er auch hier ein Gespann zur Verfügung, das er natürlich betreuen musste. Sein Leben war in dieser Hinsicht geregelt. Mutter hatte nun wieder eine Familie zu versorgen und war mit Putzen, Kochen und Wäschewaschen beschäftigt. Bald kam Arbeit auf dem Gut hinzu. Dazu waren notwendige Behördengänge zu erledigen, um unseren Aufenthalt in Deutschland zu legitimieren. Zuständig war das Amt Klein Waabs, wo Mutter uns anmelden musste, ein Fußmarsch von einigen Kilometern, der mehrere Stunden in Anspruch nahm.
Mutter 1956
Was sollte nun mit mir geschehen? Inzwischen war ich fünfzehn Jahre geworden und nicht mehr schulpflichtig. Naheliegend wäre gewesen, auf dem Gut eine Beschäftigung als Landarbeiter anzunehmen und zur Ernährung der Familie mit beizutragen, wie es Willi, der Nachbarsjunge, tat.
Arbeitskräfte wurden immer benötigt, und sicher hatte der Gutsherr sich schon Hoffnungen gemacht. Denn wenn er schon Flüchtlinge aufnahm, musste sich die Sache rentieren. Mutter allerdings hatte andere Pläne. Für sie und meinen Vater stand von vornherein fest, dass ich weiter zur Schule gehen müsste. Noch vor den Weihnachtsferien 1946/47 sollte ich an der Oberschule in Eckernförde angemeldet werden. Mutter bestand darauf, dass Vater uns in die Stadt fuhr und mit in die Schule kam, wovon er nicht gerade begeistert war. Wir mussten im Flur Platz nehmen und warten, und da meinem Vater die Zeit lang wurde, stopfte er sich seine Pfeife mit dem damals üblichen „Siedlerstolz“, Tabak, den er selbst anbaute, und begann genüsslich zu rauchen. Mutter fand das unpassend und rügte sein Verhalten. Tatsächlich drückte er die noch kleine Glut aus. Dann kam ein großer, älterer Herr mit Goldrandbrille und fragte freundlich, was wir möchten. Mutter erklärte unser Anliegen, und die Anmeldung erfolgte. Der ältere Herr mit der Bassstimme und dem etwas linkischen Gang war der kommissarische Schulleiter und später mein Mathematiklehrer, ein Mann mit Humor und sehr individueller pädagogischer Auffassung, aber durchaus sympathisch.
Das Gymnasium
Der Unterricht sollte in der zweiten Januarwoche 1947 beginnen. Also machte ich mich am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien auf den Weg zur Bushaltestelle Gast, die etwa zwei Kilometer von unserer Behausung am Strand entfernt war. Mit Müh’ und Not konnte ich mich in den übervollen Bus hineinzwängen. Der kleine, bucklige Schaffner herrschte die vor dem Einstieg stehenden Schüler an, zusammenzurücken. „Brumm aff!“, war sein Standardkommando. Zunächst musste ich den vollen Fahrpreis bezahlen, weil ich nicht gleich eine Monatskarte bekam, denn die Kapazität des Busses reichte nicht für die vielen Fahrschüler aus, die von Kappeln, Vogelsang-Grünholz und Waabs nach Ekkernförde zur Jungmannschule strömten. Den hartnäckigen Bemühungen meiner Mutter habe ich es zu verdanken, dass ich schließlich eine Monatskarte bekam.