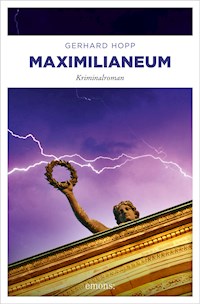Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Erinnerungen an seine Kindheit, die der Autor in dem kleinen ostpreußischen Dorf Schönau und in der Kreisstadt Preußisch Holland bis zur Flucht 1945 verlebt hat, sind bis ins hohe Alter wach geblieben. Die genauen und eindrucksvollen Schilderungen seiner Erlebnisse auf dem Dönhoffschen Gut sind beispielhaft für das Leben der Bewohner auf dem Lande in der damaligen Zeit. Das besondere Anliegen des Autors ist es, dass seine Heimat nicht in Vergessenheit gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen lieben Eltern in dankbarer Erinnerung gewidmet
Die Erinnerungen an seine Kindheit haben den Autor nicht losgelassen. Deshalb hat er sich entschlossen, sie trotz seines fortgeschrittenen Alters zu Papier zu bringen. Sie sind beispielhaft für die Bewohner des kleinen ostpreußischen Dorfes und deren Leben auf dem Dönhoffschen Gut. So entstand ein genauer, eindrücklicher Erlebnisbericht über die Kindheit eines Jungen im damals noch friedlichen Ostpreußen, bis im Januar 1945 durch den Einmarsch der Sowjetarmee seine idyllische Welt brutal zerstört wurde.
Der Autor ist Jahrgang 1931, wurde in Schönau, Kreis Preußisch Holland geboren, besuchte zunächst die Dorfschulen in Schönau, Rogehnen und Quittainen und wurde dann auf Veranlassung seines Lehrers zur Sankt Georgenschule, Gymnasium für Jungen und Mädchen, in Preußisch Holland geschickt. Mit dem Einmarsch der Sowjetarmee endete die Schulzeit des Dreizehnjährigen in Ostpreußen. Nach dramatischer Flucht und längerer Gefangenschaft in Dänemark gelangte er nach Schleswig-Holstein und konnte trotz widriger Umstände den Schulbesuch fortsetzen. Danach studierte er und wurde Lehrer an einem Gymnasium, wo er Deutsch, Französisch und Philosophie unterrichtete.
Der Autor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Familie
Erster Weltkrieg
Zweiter Weltkrieg
Frühe Kindheit
Hildes Lehrjahre
Haus und Garten
Hofarbeit
Eigene Ernte
Die Teiche
Herbstzeit
Jagdabenteuer
Dorfklatsch
Jugendstreiche
Weihnachten
Die Zwölften
Silvester
Ostern
Saure Wochen
Erntefest
Kriegerfest
Sonntagsvergnügen
Meine Schulzeit
Im Erholungsheim
Im Krankenhaus
Gabe und Last der Frau Link
Zwischenfall bei der Trauerfeier
Schulzeit in Rogehnen
Schulzeit in Quittainen
Kriegsdienst an der Heimatfront
Beim „Jungvolk“
Oberschule in Preußisch Holland
Die kleine Hochzeitsgesellschaft
Die bescheidene Festtafel
Meine Lehrerinnen und Lehrer
Leben in Preußisch Holland
Güteradressbuch
Skizze von Schönau
Liste der Familien
Einwohnerliste von Schönau
Anhang
Anmerkungen zur Sankt Georgenschule
So sprachen wir in Schönau
Schönau – Ein Nachruf
Nachwort
Vorwort
Obwohl nun schon so viele Jahre nach der Flucht vergangen sind, war die Zeit in der ostpreußischen Heimat so prägend, dass die Erinnerung daran immer wach geblieben ist. Menschen, Begebenheiten und Orte, die für die Kindheit von Bedeutung waren, drängten sich mit zunehmendem Alter immer stärker ins Bewusstsein, wollten Wortgestalt annehmen und festgehalten werden. Wer einmal einen großen Verlust erlitten hat, das gilt für die Heimat wohl in besonderem Maße, wird verstehen, warum ein Vergessen unmöglich ist. Das Ergebnis ist dieser Bericht, soweit die Wahrnehmung und das Gedächtnis eines Dreizehnjährigen in der Lage waren, Gesehenes, Gehörtes und selbst Erlebtes zu bewahren und nun als Greis wiederzugeben. Dankbar bin ich allen, die damals zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen haben, vor allem meinen Eltern, Verwandten, Nachbarn, Freunden und Lehrern und auch denen, die mir Anregungen durch Erzählungen und Bildmaterial gegeben haben, welche in diesen Bericht eingeflossen sind. Die Fortsetzung meines Lebensweges, die mit der Flucht beginnt, ist Thema eines weiteren Bändchens.
Die Familie
Zweiter Weihnachtstag 1931, abends zehn Uhr. Doktor Gerhard Uhse hat den Weg von Quittainen nach Schönau bei eisiger Kälte nicht umsonst gemacht. Er holt einen Winzling an das Licht der Welt, genauer gesagt, an das Licht einer trüben Petroleumfunzel, stellt fest, dass er schon bläulich angelaufen ist, und verhilft ihm mit dem üblichen Klaps − wahrscheinlich waren mehrere nötig − zum ersten Schrei. Die Zyanose signalisiert: Das war knapp. Immerhin war ich fast vier Wochen überfällig.
Was ließ mich so lange in der mütterlichen Geborgenheit verharren? Und warum bemühte sich niemand früher um mich? Wenigstens auf diese Frage gibt es eine plausible Antwort: Auf dem Lande wartete man eben, bis sich die Natur selber half. Als sie nun doch nicht half, musste Dr. Uhse nachhelfen, und er tat es mit Erfolg.
„Herr Doktor, wie kann ich Ihnen danken?“, soll meine Mutter erschöpft und glücklich gefragt haben. „Nennen Sie den Jungen doch nach mir, wenn Sie sich noch nicht auf einen Namen festgelegt haben; das würde mich freuen“, soll der Doktor geantwortet haben. So geschah es dann auch. Es war eine schwere Geburt gewesen. Mutter und Kind hatten in Lebensgefahr geschwebt: ein Omen für das spätere Leben?
Wir waren nun zu viert: meine Eltern, meine Schwester Hilde und ich. Meine Schwester hatte zum Zeitpunkt meiner Geburt vor etwa drei Wochen gerade ihren zehnten Geburtstag gehabt, und zwar am 1. Dezember. Wie mir später erzählt wurde, war sie gar nicht davon begeistert gewesen, einen kleinen Bruder zu bekommen. Sie fürchtete, auf mich aufpassen zu müssen, weil meine Mutter, wie es auf dem Land damals üblich war, als Scharwerkerin mitarbeiten musste. Dem Gutsherrn dagegen war jeder Nachwuchs willkommen, der später eine billige Arbeitskraft sein würde.
Hier stehe ich in unserem Garten. Herbst 1936 (5 Jahre)
Meine Mutter Anna, geborene Eichler, war einunddreißig Jahre alt, als sie mich gebar. Sie wurde am 13. Mai 1900 in Einhöfen, Kreis Preußisch Holland geboren und war eins von dreizehn (!) Kindern. Davon starben einige noch im frühen Kindesalter; ihre Brüder Adolf und Hermann Eichler sind im Ersten Weltkrieg in den Karpaten gefallen. Gustav wohnte mit seiner Familie in Schönau, Fritz war in Elbing ansässig und auf der Schichau-Werft beschäftigt. Paul lebte in seiner Nähe und starb recht früh an Tuberkulose. Schwester Berta hatte den Bergbauangestellten Karl Lunkwitz in Bochum geheiratet und Martha, die jüngste Schwester (1907 ‒ 1990), war die Frau von dem Landwirt August Knoblauch geworden. Bis zur Flucht 1945 bewirtschafteten sie ihren Bauernhof in Conradswalde / Westpreußen und wohnten später in Westfalen, wo sie sich eine Hühnerfarm aufbauten.
Als Mutter etwa vierzehn Jahre alt war, zog die Familie Eichler nach Schönau. Dort fand ihr Vater August eine Arbeit als Stellmacher. Er zimmerte Bretter- und Leiterwagen, Bracken (Deichselquerhölzer), Harken, Forken-, Schaufel- und Axtstiele. Um sich ein Zubrot zu verdienen, schnitzte er Holzschuhe, für den Winter als Kurzstiefel, für den Sommer als Holzpantoffeln, die wir „Schlorren“ nannten. Für mich hatte er einmal einen kleinen Bollerwagen gebaut. Seine Frau, also Mutters Mutter, starb an Krebs, als sie etwa Mitte vierzig war. Die Stiefmutter war nicht gut zu den fremden Kindern, und meine Mutter muss sehr unter ihr gelitten haben. Deswegen hatten wir keinen Kontakt zu Eichlers.
Mein Opa August (1861 – 1942) war nicht groß und hatte eine sehr gerade Haltung beim Gehen; karsch nannten wir so eine Haltung. Und weil dabei die Brust hervortrat, sagte Mutter, wenn sie ihn sah: „Do geht dä Brostebrecher.“ Meine Mutter und ich sind erst in die Wohnung meiner Großeltern gegangen, als Opa gestorben war. Er war in der kleinen, niedrigen, etwas dunklen Stube aufgebahrt bahrt. Einundachtzig Jahre alt war er geworden. Ich war damals elf Jahre alt. Über dem linken Auge hatte ich eine Geschwulst, einen so genannten Grützbeutel. Meine Mutter hatte gehört, dass diese Missbildung verschwinden würde, wenn sie vom Finger eines Toten berührt würde. Da sie manchmal etwas abergläubisch war, sah sie nun eine Gelegenheit gekommen, mich von diesem unschönen Gebilde zu befreien. Wie aber sollte das gehen? Der Tote lag mit gefalteten Händen im offenen Sarg; die Finger konnte man nicht auseinanderbiegen. Also redete Mutter mir zu, mich so über seine Hände zu beugen, dass ich sie mit dem Grützbeutel berührte. Nach langem Zögern neigte ich meinen Kopf den Händen entgegen, aber im letzten Augenblick zog ich ihn doch zurück.
Meine Mutter Anna Hopp (13.5.1900 ‒ 23.8.1968), hier etwa 20 Jahre alt
Von da an sträubte ich mich gegen einen erneuten Versuch. Da half kein Zureden mehr. So gingen wir nach einer kurzen Gedenkzeit unverrichteter Dinge nach Hause. Später wurde die Geschwulst im Kreiskrankenhaus in Preußisch Holland von Chefarzt Dr. Mertens operativ entfernt.
Mutter war eine resolute Frau, die − zumindest nach außen hin − den Ton angab. Sie war redegewandt, offen, kämpferisch bis draufgängerisch, mit stark ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn. Sie war mutig und sagte dem Kämmerer Hermann Bauch die Meinung, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte oder jemand bei der Einschätzung der Arbeitsleistung begünstigt wurde. Sie mischte sich gern ein und ergriff Partei für die Schwächeren, wobei sie durchaus schon einmal ihre kräftige Statur zur Geltung brachte. Sie war furchtlos und von sich überzeugt und deshalb nicht bei allen beliebt. Wen sie mochte, dem gab sie das Letzte, war hilfsbereit und gütig zu ihm. Sie war außerordentlich fleißig und hatte Freude an der harten Landarbeit. Beim Kornbinden die Erste zu sein, war ihr ehrgeiziges Ziel. Nach der Feldarbeit rackerte sie sich zu Hause weiter ab. Da mussten die Schweine gefüttert, Hühner und Gänse versorgt und die Kuh gemolken werden. Hausarbeit und Essenmachen gehörten natürlich auch noch zu ihren Pflichten. Brot buk (eine damals noch übliche Wortform) sie einmal in der Woche selbst, ein herrliches, knusperiges Brot, fast so lang wie der Tisch. Aber bis es auf den Tisch kam, mussten Mehl, Milch, Wasser, Salz im großen, hölzernen Brottrog gemischt, geknetet und mit Sauerteig angesetzt werden. Der Trog wurde mit einem Laken zugedeckt, damit der Teig „gehen“ konnte. Nach einer bestimmten Zeit wurde der Laib geformt und in den gemauerten Backofen in der Mitte des Dorfes gebracht, wo inzwischen die Holzkohle glühte und die nötige Hitze abgab. War das Brot fertig, wurde es mit einer langstieligen, flachen Holzschaufel aus dem Ofen herausgezogen. Vor dem Anschneiden machte Mutter auf der Unterseite des Brotes mit der Messerspitze ein Kreuz als Zeichen des Segens und des Dankes. Der Aufstrich war Butter, „gute“ Butter, selbst gemacht aus der Milch der eigenen Kuh. Das Buttern war eine Sache für sich. Lottchen, unsere kleine schwarzbunte Kuh, gab reichlich Milch von bester Qualität. Davon wurde ein Teil an die Molkerei Sebelin in Rogehnen geliefert, der Rest diente zum Trinken und Kochen. War die Butter alle, wurde Milch mit Hilfe einer Zentrifuge (Schleuder aus glänzendem Chrom, eine Kostbarkeit im Haushalt) entrahmt. Die Sahne kam in das hölzerne Butterfass und wurde möglichst schnell wiederholt durch ein mit Löchern versehenes rundes Brett gepresst, das an einem Stiel befestigt war und wie ein Kolben in einer Maschine auf und ab bewegt wurde. Das zylindrische Butterfass war oben geschlossen, damit die Sahne und später die Buttermilch nicht herausspritzten. Nach geraumer Zeit bildeten sich Fettklümpchen und schließlich größere Butterklumpen, die aus dem Fass herausgenommen und zu einem Quader gepresst wurden. Was wir selber nicht verbrauchten, verkaufte Mutter auf dem Wochenmarkt in Preußisch Holland, auch Fleisch, wenn ein Schwein geschlachtet worden war, sowie Eier und Geflügel.
Nicht zu vergessen die Wäsche. Sie wurde in einem großen, verzinkten Kessel auf dem Kohleherd ausgekocht. Nach dem Spülen und Wringen hängte Mutter sie auf eine Leine oder legte sie im Sommer bei gutem Wetter auf die Bleiche, ein Rasenstück, auf dem besonders die weißen Leinenlaken und Damastbezüge ausgebreitet wurden, damit die Sonne sie bleichen konnte.
Wenn die Ernte eingebracht war, musste Mutter für den Winter vorsorgen. Das hieß Schafwolle spinnen und stricken: Strümpfe und Handschuhe vor allem. Gemüse und Früchte waren schon eingemacht und die Kartoffeln eingekellert oder in der Miete, einer mit Stroh und Erde überdeckten Grube, vergraben. Und schließlich musste Mutter auch für uns Kinder da sein und Erziehungsarbeit leisten. Bei all der Arbeit gab es für sie nur ein Erziehungsprinzip: Gehorsam aufs Wort.
Mein Vater Karl wurde am 26. November 1895 in Schönau, Kreis Preußisch Holland geboren, stammte also aus einer alteingesessenen Landarbeiterfamilie. Einige Monate vor seiner Geburt starb sein Vater an den Folgen eines Unfalles. Ein Pferd hatte ausgeschlagen und ihn schwer getroffen. Wahrscheinlich wurde die Milz beschädigt, so dass er innerlich verblutete. Wie es auf dem Lande damals üblich war, hatte der Schwerverletzte ohne ärztliche Hilfe auf Besserung gehofft, bis der Tod eintrat.
Vaters Schwester
Vater war das jüngste von fünf Kindern; seine Geschwister hießen August, Henriette, genannt Jette, Wilhelmine, genannt Minna, und Friedrich. Onkel August fand in Königsberg eine Anstellung bei der Post, die ihm sein Schwager Wilhelm Schmidt verschafft hatte. Dieser war mit Vaters Schwester Jette verheiratet, die durch einen Bombenangriff auf Kö-Henriette nigsberg 1944 ums Leben kam.
Er war Kranführer im Königsberger Hafen.
Vaters Schwester Wilhelmine Schindowski
Familie Schindowski; von links: Edith; Tante Minna; Onkel Hermann; Hildegard mit Sohn Hansi; ihr Mann Josef; Ruth
Tante Minna hatte den Postboten Hermann Schindowski geheiratet und lebte zuletzt in Preußisch Holland in einem schönen Siedlungshäuschen in der Marienfelder Straße.
Mein Vater Karl Hopp (26.11.1895 – 6.8.1981), hier 18 Jahre alt
Links Vaters Mutter Marie Hopp geb. Eichler mit Freundin Frau Broszinski 1915
Nachdem Vater am 17. September 1921 geheiratet und mit meiner Mutter einen Hausstand gegründet hatte, nahm er seine Mutter Marie (16.8.1854 ‒ 15.3.1928) bei sich auf. Aus diesem Grunde blieb er in Schönau Landarbeiter, obwohl er Gelegenheit gehabt hätte, in Preußisch Holland oder Königsberg eine andere Arbeit zu finden. Es ist verständlich, dass er seine alte Mutter nicht verlassen wollte, da er doch nur sie gehabt und sie ihn bis zu seiner Heirat versorgt hatte. Denn seinen Vater Karl (1854 ‒ 1895) hatte er ja nie kennen gelernt. Und seine Mutter wollte unbedingt in Schönau bleiben. Mein Vater war ein frommer Mann, der mich schon als kleinen Jungen das Beten lehrte. Abends setzte er sich auf die Kante meines Bettes und sprach mir das Nachtgebet vor, das ich dann mit ihm wiederholte. Die von ihm gelernten Gebete haben mir oft geholfen.