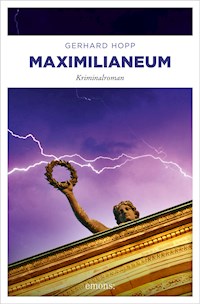Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ostpreußen im Januar 1945. Die Kriegswalze überrollt das idyllische Land und einen großen Teil der Bevölkerung, für die es kein Entkommen gibt, darunter der Dreizehnjährige und seine Mutter. Denn Flucht ist von höchster politischer Stelle verboten worden. So fallen viele Menschen auf grausame Weise der sowjetischen Invasion zum Opfer. Hier der erschütternde Bericht über diese Ereignisse, wie der Autor sie als Kind erlebt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Leserin schrieb an den Autor:
„Ihr Buch habe ich mit großem Interesse, voller Staunen über die Genauigkeit Ihres Wissens und mit innerer Anteilnahme gelesen, natürlich als Ostpreußin und auch als Flüchtling, wobei meine Flucht mit meiner Mutter aus Neuenburg/Westpreußen eine reine Ferienreise war. [...] Ihre Flucht mit Ihrer Mutter mitten ins Inferno des Krieges hinein, die Haßtimmung der siegenden Russen mit den grausamsten Taten ihrer Rache ertragen zu haben, das habe ich noch nie so ausführlich gelesen. Dieser Abschnitt Ihres Buches enthält trotz der Sachlichkeit, mit der Sie (erlebt als Kind) Ihre Eindrücke beschreiben, eine große Spannung. [...]“
Ingrid Sch., Glücksburg/Ostsee
Der Autor ist Jahrgang 1931, geboren in Schönau / Ostpreußen. Er studierte Germanistik, Romanistik, Religion, Philosophie und Pädagogik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und unterrichtete bis zu seiner Pensionierung 1994 Deutsch, Französisch und Philosophie an einem Gymnasium.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Die Heimat
Erster Fluchtversuch
Rüchkehr nach Schönau
Die Russen sind da
Die Retter kommen
Unter Beschuss
Erneuter Aufbruch zur Flucht
Fliegerangriff
Unverhofftes Wiedersehen
Trennung
Eisige Übernachtung
Auf der Frischen Nehrung
Schiff in Sicht
Wieder an Land
Urlaubsgefühle
Gefahr aus der Luft
Die Flucht geht weiter
Bombennacht in der Kasematte
Auf der Reede von Hela
Rettung über See
Ankunft in Dänemark
Endlich am Ziel
Gefangen und interniert in Slagelse
Im Gefangenenlager Grove/Karup
Krankheit
Ausflug
Freizeitbeschäftigungen
Konfirmation im Flüchtlingslager
Freunde und Verwandte
Beziehungsprobleme
Handwerkliches ...
... und Künstlerisches
Ende der Gefangenschaft
Eckernförde – fast am Ziel
Anhang
Das Schicksal der in der Heimat Zurückgebliebenen
Verschleppung meiner Cousinen Hildegard und Ruth Sch. nach Sibirien
Nachwort zum Fluchtbericht
Meinungen
In der neuen Heimat
Das Gymnasium
Anders als die anderen
Vorlieben und Schwächen
Kasper kommt
Hinter dem Gitter – ein Schülerstreich
Drill macht still
Was manchmal doch gelingt
Die Bretter, die die Welt bedeuten
Himmel und Erde müssen vergehen
Klassenfahrt
Was macht die Kunst?
Ein König ohne Königreich
Wir nannten sie Mami
Endspurt
Die andere Wirklichkeit
Ein Häuschen im Grünen
Wir brauchen mehr Licht
Jagdgelüste
Gartenbau
Haustiere
Seeblick
Schwimmtraining
Aquis submersa
Dorfjugend
Nützliche Anschaffung
Landarbeit
Überfall
Schwere Schicksale
Wiedersehensfreude
Lebensgefahr
Kultur auf dem Dorfe
Umzug in ein Flüchtlingslager
Vom Regen in die Traufe
Zum Leben zu wenig
Als Werkstudent im Einsatz
Schatzgräber im Trümmerfeld
Wohnverhältnisse
Hygiene
Schwein muss man haben
Keine Kohle – kein Feuer
Geschäfte und eine Fabrik
Die Seelenlage von Lagerbewohnern
Hilfe von außen und innen
Vorwort
Die Anregung, meine Erinnerungen an Kindheit und Jugend aufzuschreiben, erhielt ich von dem Flensburger Historiker Professor Dr. Wolfgang Stribrny, da es kaum Darstellungen des damaligen Geschehens aus der Sicht eines Kindes – ich war damals dreizehn Jahre alt – gab. So entstand zunächst der Bericht über die Flucht und die Gefangenschaft in Dänemark.
Damit konnte ich mich jedoch nicht zufrieden geben, denn der Verlust der Heimat drängte mich dazu, möglichst viel von dem festzuhalten, was mir von der Kindheit in Ostpreußen in Erinnerung geblieben war, und Unwiederbringliches zumindest so weit zu dokumentieren, wie es mein Gedächtnis nach so langer Zeit zuließ. Am Anfang dieses Berichtes wird Heimatliches nur kurz gestreift, weil der Fluchtbericht im Mittelpunkt dieser Darstellung steht.
Nach Krieg und Gefangenschaft ging das Leben in ungewöhnlichen Bahnen weiter. Also war es folgerichtig, auch diese schwere Zeit des Neuanfangs in meine Erinnerungen einzubeziehen. Eine Rückkehr in die alte Heimat wäre das eigentliche Ende der Flucht gewesen. Aber diese Hoffnung wurde bald zunichte gemacht.
Die Heimat
Als ich dreizehn war, ging meine Welt unter.
Meine Welt, das war ein kleines Dorf in Ostpreußen, das Vorwerk eines gräflichen Gutes. Es war ein schönes Dorf, weshalb man ihm wohl den Namen Schönau gegeben hatte. Auch eine Au gab es, einen Bach mit klarem Wasser, das aus einer Quelle im Quittainer Wald heranfloss und drei Teiche füllte. Mein Dorf war umgeben von saftigen Wiesen und fruchtbaren Feldern. Nicht weit davon stand ein prächtiger Mischwald, zu dem Vater mit mir an manchen Sonntagen bei gutem Wetter radelte, um Brennnesseln für unser Schwein zu holen.
Ansichtskarte von Schönau mit Kirche, Forsthaus, Schule und Dorfteich
Dabei erklärte er mir Baumarten und Wildpflanzen. Auf den Wiesen weideten wohlgenährte Milchkühe; eine davon war unser Lottchen, eine kleine schwarzbunte Kuh, die auf Anruf brav zum Melken an den Weidenzaun kam und reichlich gute Milch gab. Ich schmiegte mich gern an ihr warmes Fell, kraulte sie zwischen den kurzen Hörnern und ließ meine Hand über ihren sanften Hals gleiten. Milch, die wir nicht verbrauchten, wurde an die Molkerei in Rogehnen geliefert, um zum Deputat ein wenig Geld zu erhalten; demselben Zweck diente die Butter, die Mutter selbst herstellte und auf dem Markt der Kreisstadt Preußisch Holland verkaufte. Nur dadurch waren notwendige Anschaffungen möglich wie Geschirr, Kleidung oder ein Fahrrad. Die kleine Hühnerschar, die in einem Verschlag im Schweinestall untergebracht war, versorgte uns mit Eiern, und das grunzende Schwein musste leider eines Tages um die Weihnachtszeit sein Leben lassen, um uns mit seinem Fleisch zu ernähren. Speckseiten wurden in den Kamin gehängt und langsam geräuchert, damit sie sich über längere Zeit hielten. Ein paar Gänse gehörten auch zum Geflügelbestand, und sogar ein Schaf durften die Scharwerker im Gutsstall unterstellen. Es lieferte Wolle für Strümpfe und Handschuhe, denn die Winter waren streng in Ostpreußen. An den langen Winterabenden spannen und strickten die Frauen diese wunderbare Bekleidung.
Mein bester Freund war Nelly, eine falbfarbene Mischlingshündin, etwas verspielt und sehr lieb. Sie begleitete mich, wenn ich durch das Dorf streifte, an meinem Lieblingsplatz, einem massigen Ahornstumpf am Rande eines dickichtartigen Gebüsches, inne hielt und den Enten und Gänsen zusah, die auf dem Dorfteich hin und her schwammen und nach Nahrung tauchten. Eine Idylle, die ich wie selbstverständlich genoss.
1938 mit sechs Jahren vor der Schönauer Schule
Gerne setzte ich mich an milden Sommerabenden in unserem Obstgarten unter den Jasminbusch, dessen Blüten berauschend dufteten, und spielte Volkslieder auf meiner einreihigen Ziehharmonika. Das waren besonders schöne Augenblicke.
Trotz aller Ärmlichkeit, die bei uns wie in jeder Landarbeiterfamilie herrschte, empfand ich keine Not, sondern Zufriedenheit und oft auch Glücksgefühle.
Eine meist sorglose Kindheit – ernste Erkrankungen früherer Jahre waren vergessen – hatte ich meinen fleißigen und fürsorglichen Eltern zu verdanken, die von früh bis spät schwere Landarbeit zu verrichten hatten. Ihnen verdankte ich auch die Chance, das Gymnasium zu besuchen, statt nach meinem vierzehnten Lebensjahr als Scharwerker ihr Schicksal zu teilen. Meine Welt war eine verhältnismäßig heile Welt, bis sich bedrohliche Ereignisse ankündigten. Sie sollten der Anfang von ihrem Ende sein.
Während der zweiten Hälfte des Jahres 1944 gab es hin und wieder Luftalarm, was den Schulbetrieb empfindlich störte. Schließlich musste das Schulgebäude geräumt werden, um die vielen verwundeten Frontsoldaten unterzubringen. Der stark reduzierte Unterricht fand nun in anderen Räumen statt, unter anderem in der Sankt Bartholomäus-Kirche von Preußisch Holland. In den Weihnachtsferien kehrte ich in mein Elternhaus nach Schönau zurück. So konnte ich meinen dreizehnten Geburtstag zu Hause verleben. Wie meistens bekam ich auch an diesen Weihnachten – mein Geburtstag fiel auf den zweiten Feiertag – ein kleines Geschenk, keinen Luxus, sondern etwas Praktisches. Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk bildeten meistens eine Einheit. Diesmal waren es Handschuhe, von Mutter selbst gestrickt.
Vater 1938
Diese Weihnachten verliefen anders als sonst: Es gab für die Dorfgemeinschaft keine Feier mehr, die bisher immer in der großen Wohnstube des Kämmerers stattgefunden hatte. Unsicherheit und Ungewissheit lagen in der Luft.
Mein Vater war mit neunundvierzig Jahren im Herbst zum Volkssturm eingezogen worden und sollte die Heimat gegen die anstürmenden Sowjetarmeen verteidigen. Nun hatte er ein paar Tage Urlaub bekommen. Das Fest verlebten wir in einer sehr bedrückenden Atmosphäre, denn die Zukunft war ungewiss. Von Flucht wurde gesprochen, aber niemand vermochte sich vorzustellen, wie sie vonstatten gehen sollte. Niemand wollte glauben, dass wir unmittelbar bedroht waren.
Vater während der Ausbildung 1939
in Riesenburg/Westpreußen
Wir wussten in unserer dörflichen Idylle noch nichts von der erfolgten Invasion der Roten Armee in Ostpreußen und den Gräueltaten von Nemmersdorf; vielleicht wusste mein Vater mehr, aber er hielt sich an das Schweigegebot über die militärische Lage. Wir wussten auch nicht, dass bereits Flüchtlingsströme aus dem östlichen und nördlichen Teil Ostpreußens in panischer Angst unterwegs waren, um sich dem Zugriff der Roten Armee zu entziehen.
2. von rechts: Vater als Unteroffizier im Polenfeldzug 1939
Nach den Feiertagen musste mein Vater wie auch andere ältere Männer zu seiner Volkssturmeinheit zurückkehren. Der Abschied war schwer für uns alle, auch wenn sich meine Eltern nichts anmerken ließen. Ich selbst war damals noch nicht in der Lage abzuschätzen, was dieser Abschied bedeuten konnte. Ich dachte nicht daran, dass ich meinen Vater nicht wiedersehen könnte, obwohl schon eine Reihe anderer Dorfbewohner im Krieg gefallen war.
Für meinen Vater war es die dritte Einberufung in seinem Leben:
1916 Teilnahme am Ersten Weltkrieg bis 1918 in der französischen Champagne, mit Verschüttung und gefährlicher Verwundung im Gesicht; ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. 1939 in den Polenfeldzug gezogen als Unteroffizier und Kompanieführer, einigermaßen gesund zurückgekommen. Schließlich wurde er 1944 zum Volkssturm einberufen, um die Heimat gegen die anrückende Rote Armee zu verteidigen. Dreimal im Leben in den Krieg ziehen – wie muss ihm da zumute gewesen sein!
Vater 1915 im Ersten Weltkrieg (20 Jahre alt)
Anfang Januar 1945 fingen die alten, wehruntauglichen Männer an, Kisten zu zimmern, die mit den nötigsten Habseligkeiten – oder was der Einzelne dafür hielt – voll gepackt und zugenagelt wurden. Schwere Leiterwagen wurden hergerichtet, um das Hab und Gut, das jeder retten wollte, aufzunehmen. Die seitlichen Leitern wurden durch Bretter geschlossen und durch Bohlen verstärkt, damit die Ladung nicht durchfallen konnte. Dennoch bogen sich die Holme unter der übermäßig drückenden Last. Jede Familie versuchte alles unterzubringen, was sie besaß. Das war zwar nicht viel, aber in diesem Falle zu viel. Unser Gepäck bestand aus einer großen Holzkiste mit Geschirr und Kleidern, zuoberst eine Reichsflagge, die uns mein Schwager überlassen hatte. Er hatte sie als Erinnerung an die Kriegstrauung mit meiner Schwester 1943 von seinem Kommandeur Oberleutnant Rehbein verehrt bekommen; wir ahnten nicht, dass dieses Tuch uns fast zum Verhängnis geworden wäre. Ein Waschkessel mit Speckseiten, schön geräuchert und einige Wochen als Proviant ausreichend, sowie Würste, Butter und Brot kamen dazu, alles aus der Deputanten- und Selbstversorgerspeisekammer. Weniger Wichtiges stopften wir in Säcke. Die vier Familien unseres Insthauses hatten einen Leiterwagen zur Verfügung, und da der Platz begrenzt war, gab es beim Aufladen schon einmal Meinungsverschiedenheiten. Der Wagen war überladen und ächzte; die Seitenbretter bogen sich.
Erster Fluchtversuch
Am Dienstag, dem 23. Januar 1945, setzte sich der Treck nach dem Hellwerden in Bewegung, die Gespanne wurden von Männern gelenkt, die nicht eingezogen worden waren. Die Mitfahrenden waren überwiegend Frauen und Kinder. Außer meiner Mutter und mir saßen auf unserem Wagen Marie Freitag mit Kurt und Marie Hinz mit Ruth. Paul Hinz war in Russland gefallen. Wegen der Kälte kauerten wir eingemummt auf dem hochbeladenen Wagen und mussten uns durchschütteln lassen. Nach den anstrengenden Vorbereitungen für die Flucht war die Fahrt erholsam wie eine Spazierfahrt. Leider war es keine, sondern ein erzwungener Aufbruch in eine ungewisse Zukunft.
Es war früher Vormittag. Der Himmel war bedeckt, es herrschte klirrende Kälte, um minus 20 Grad C. Der festgefahrene Schnee knirschte unter den Eisenreifen der Wagenräder. Das war also der Abschied von meiner Welt. In diesen Augenblicken, als die Pferde anzogen, beherrschten mich andere Gefühle als ein sentimentaler Abschiedsschmerz: Unruhe, Angst, ob wir der Gefahr entfliehen könnten. Wer hätte geahnt, einmal Hals über Kopf seine Heimat verlassen zu müssen? Alle Parolen, die uns Sicherheit vorgaukelten, waren über Nacht als Lüge entlarvt worden. Kein fremder Soldat würde deutsches Reichsgebiet betreten? Endsieg? Die Wirklichkeit sah anders aus.
Nur schrittweise kamen wir voran. Ich blickte zurück auf mein schönes Dorf, das in winterlichem Schmuck friedlich in der weißen Landschaft lag. Zurück blieben die Früchte schwerer, teils jahrelanger Arbeit: Hausrat, Möbel, Fahrräder; die wertvolle Zentrifuge; meine wenigen, aber für mich äußerst kostbaren Bücher; meine erste Ziehharmonika; meine Geige, ein Geschenk von Frau Peiler. Das Instrument hatte ihrem Sohn Gustav gehört, der in Russland gefallen war, ebenso wie ihr Sohn Fritz. Das besonders Schmerzliche: Haustiere und Vieh konnten nicht mitgenommen werden. Wie grausam war es, sie im Stich zu lassen, ohne sie füttern und tränken zu können; die Hühner, die uns mit Eiern versorgten; unser Schaf, von dessen Wolle meine Mutter „Handschkes“ und Strümpfe strickte; Lottchen, unsere kleine schwarz-bunte Kuh, die immer reichlich gute Milch gab, so viel, dass wir sogar welche an die Käserei in Rogehnen liefern konnten. Und schließlich mein Hund Nelly, der liebe, treue Mischling. Auch er musste zurückbleiben. Der Anfang einer nicht zu heilenden Entwurzelung.
Die vier Pferde vor unserem Wagen hatten Mühe, das Fuhrwerk zu bewegen. Manchmal rutschte ein Pferd aus, wenn es auf eine vereiste Stelle trat und die Stollen des Hufeisens nicht fassten. Der Treck, etwa sechs Wagen, fuhr nach Preußisch Holland, in die Kreisstadt, um dann über Elbing weiter nach Westen zu gelangen. So war es jedenfalls geplant. Gegen Mittag kamen wir in der Stadt an. Dort wimmelte es von Pferdewagen, so dass kein Durchkommen war. Wir standen mit dem Fuhrwerk in einer Nebenstraße wie festgenagelt. Ratlosigkeit machte sich breit; wir schwankten zwischen Hoffen und Bangen. Unruhe und Ungeduld wuchsen. Jeder wusste, wir würden wohl vor dem Dunkelwerden nicht weiterkommen, wenn überhaupt. Da sah ich ein Auto an uns vorbeifahren, einen kleinen DKW, in dem ich einen Lehrer von der St. Georgenschule erkannte, Studienrat N. Wenn meine Cousine Edith von ihm sprach, nannte sie ihn mit seinem Spitznamen Papchen, so wie seine Frau ihn ansprach. Als ich in die Sexta kam, war meine Cousine schon in der Oberstufe und Abiturientin. Frau N., eine etwas korpulente Dame mittleren Alters, meine Zeichenlehrerin, war nicht mit im Wagen. Ich war erstaunt über das plötzliche Auftauchen dieses Lehrers und die Möglichkeit, mit dem Auto besser davonzukommen als wir. Außerdem wundere ich mich noch heute darüber, dass er nicht früher geflohen war, denn er war sicher besser über die Lage informiert als wir Landbewohner und hätte vielleicht Möglichkeiten gehabt, das Fluchtverbot zu umgehen. Was wohl aus meinen anderen Lehrern geworden sein mochte?
Die St. Georgenschule in Preußisch Holland, Meinhardstraße 3: mein Gymnasium seit Ostern 1943
Direktor Kurt Kotelmann damals etwa 57 Jahre alt, der mir sehr gewogen war; das wohlwollende Fräulein B., die Biologie unterrichtete; die hübsche und flotte Deutschlehrerin Liselotte M., nebenbei BDM- Führerin, um die dreißig; die alte, würdige Edith G., die den Spitznamen „Gurk“ erhalten hatte, mit etwa 62 Jahren schon recht betagt; die liebenswürdige Sekretärin Paula Jordan.
In Preußisch Holland wohnte meine Schwester Hilde, die 1943 ihren Verlobten Paul Salowski geheiratet hatte. Paul hatte für diesen Zweck Fronturlaub bekommen, von den Soldaten auch als „Zeugungsurlaub“ bezeichnet. Seine Truppe lag in Russland. Die Hochzeitsfeier fand bei uns in Schönau statt. Ich war damals elfeinhalb und durfte mit ein paar Liedern auf meiner Handharmonika zur Unterhaltung der Hochzeitsgesellschaft beitragen. Als ich das Gymnasium in der Stadt besuchte, fand ich einige Zeit bei Hilde eine Bleibe. Sie wohnte in der Straße der SA 17. Früher hatte diese Straße Langgasse geheißen, weil sie sich durch den ganzen Altstadtkern hinzog.
Hildes Hochzeit am 10. Juli 1943 in Schönau
Von links: Mutter, leider verdeckt; Vater; Hilde als Braut; Paul als Bräutigam; Pauls Mutter Anna S.; Tante Wilhelmine Sch., Vaters Schwester; Onkel Hermann Sch.; dahinter v. /.: Meine Cousine Hildegard Sch.; mein Cousin Gerhard Sch.; meine Cousine Edith Sch.; Gertrud S., Pauls Schwester; meine Cousine Ruth Sch.; ich rechts oben, fast völlig verdeckt.
Obwohl wir nun nicht weit von ihrer Wohnung entfernt waren, konnten wir nicht hingehen, um zu sehen, ob sie noch dort war oder die Stadt mit ihrem anderthalbjährigen Sohn bereits verlassen hatte. Wir konnten keine Verbindung zu ihr aufnehmen, denn weder wir noch sie hatten ein Telefon. Zwar hatten wir gehört, dass die Angehörigen der NSKK-Truppe im Ernstfall evakuiert werden sollten, wussten aber nichts Genaues. Tante und Onkel Schindowski besaßen in der Marienfelder Straße 11 ein Siedlungshäuschen, das sie mit ihren Kindern bewohnten. Die Söhne Erwin und Gerhard waren beim Militär. Was aus der Familie nun geworden war, wussten wir nicht. Hatten sie sich früher in Sicherheit bringen können? In unserer jetzigen Situation des sinnlosen Ausharrens in der Kälte drehten sich unsere Gedanken nur um eine Frage: Wann geht es endlich weiter?
In einem der Häuser links fand ich bei Hilde für einige Wochen Unterkunft.
Schwester Hilde 1940
Die Jugendherberge von Preußisch Holland In dieser Jugendherberge bekam ich als Sextaner durch Fürsprache von Oberstudiendirektor Kotelmann ein eigenes Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt.
Rückkehr nach Schönau
Wie ich viel später erfuhr, hatte der Befehl des Gauleiters von Ostpreußen Erich Koch eine rechtzeitige Evakuierung der Zivilbevölkerung bis zuletzt unter Androhung der Todesstrafe verhindert. Selbst Marion Gräfin Dönhoff, der auch das Vorwerk Schönau gehörte, konnte sich erst in letzter Minute zu Pferde vor den Russen retten. Dazu hatten ihr die Quittainer Instleute geraten, wie sie in einem Fernsehinterview betonte. Sie wollte damit dem Vorwurf entgehen, ihre Leute in dieser schwierigen Lage im Stich gelassen zu haben. Die Chance, uns selbstständig in Sicherheit zu bringen, hatten wir leider nicht. Da die Gespannführer keine Möglichkeit sahen weiterzukommen, beschlossen sie, nach Schönau zurückzufahren, damit wir über Nacht wenigstens ein Dach über dem Kopf hatten.
Während die Habseligkeiten zum Teil wieder abgeladen wurden, richteten wir uns aufs Zuhausebleiben ein. Inzwischen kamen Flüchtlinge aus östlicheren Teilen Ostpreußens ins Dorf und suchten Quartier. Meine Mutter nahm bereitwillig auf, was in unsere bescheidene Wohnung passte, die aus einem Wohnschlafzimmer, einer kleinen Kammer und einem zur Küche umgebauten Flur bestand. Bald fühlten sich die Gäste so heimisch, dass sie nicht nur von den Räumlichkeiten Besitz ergriffen, sondern auch von Dingen, die sich in der Tischschublade befanden, wie z.B. Zigaretten. Ungeniert bediente sich eine junge Frau, ohne zu fragen. Ein seltsames Gefühl war es, in der eigenen Wohnung nicht mehr bestimmen zu können; die Fremden waren weit in der Überzahl, so dass ein Protest sinnlos gewesen wäre. Insgesamt befanden sich etwa zwölf Personen in dem kleinen Raum. Die Petroleumfunzel verbreitete trübes Licht. Spannung lag in der Luft; irgendetwas musste bald geschehen. Hin und wieder gedämpfte Gespräche, dann wieder betretenes, ängstliches Schweigen, so verlief der Abend. Das Dröhnen von schweren Fahrzeugen kam näher.
Das Dorf Schönau liegt an der Hauptverkehrsstraße, die von Mohrungen über Quittainen, Rogehnen und Preußisch Holland nach Elbing führt und in diesen Kriegstagen auch, Rollbahn“ genannt wurde. Was das hieß, wurde mir klar, als ich am späten Nachmittag des 23. Januar 1945 kurz vor Dunkelheit an die Kreuzung ging, um zu sehen, was sich dort tat. Was ich sah, machte mich stutzig: Aus Richtung Quittainen kommend, zogen Kolonnen von Militärlastwagen vorbei. Auf den Kotflügeln der Fahrzeuge saß je ein Soldat, den Karabiner umgehängt, einen Arm über die Motorhaube gelegt. Ich hatte das Gefühl, von mitleidvollen Blicken angesehen zu werden, die etwas mitteilen wollten, es jedoch nicht konnten. Oder zeigten sie nur Müdigkeit und Abgestumpftheit? Die zurückweichenden Truppen wussten, was uns bevorstand, während wir ahnungslos und ohnmächtig unserem Schicksal ausgeliefert waren. Die Fahrzeugschlange sah unheimlich, fast gespenstisch aus, ein grauschwarzer Bandwurm, der sich mit dumpfem Gebrumm durch eine Schneewüste fraß. Als die Dunkelheit hereinbrach, ging ich nach Hause zurück. Dort unterhielten sich die Flüchtlinge zeitweise munter, dann aber wieder verhalten. Ich fühlte mich gar nicht wohl in der Enge und mit den fremden Leuten. Meine Mutter nahm die Lage hin und war ebenfalls zurückhaltender als sonst.
Die Russen sind da
Dann, gegen Mitternacht, hörten wir Schüsse, nicht laut, denn unsere Doppelfenster isolierten gut. Alle lauschten, plötzlich hartes Pochen an der Tür. Kommandostimme in einer unverständlichen Sprache. Alles blieb wie gebannt still und bewegungslos. Dann fasste sich ein Mann, ein Weißrusse, wie meine Mutter wusste, ein Herz und ging zur Tür, öffnete und trat hinaus. Banges Warten, Ungewissheit, Angst. Nach einigen Minuten, die uns wie eine Ewigkeit erschienen, drängte eine Gruppe von Sowjetsoldaten in die Wohnstube, Maschinenpistolen im Anschlag. Ich stand in vorderster Reihe, den Russen genau gegenüber, sah in ihre finsteren Gesichter. Einer trat vor, fuchtelte drohend mit seiner Maschinenpistole umher, was wie eine Mähbewegung mit der Sense aussah. Dabei redete er heftig und schnell auf uns ein. Eingeschüchtert und jeden Augenblick die Salve erwartend, standen wir regungslos mit erhobenen Händen vor ihm. Würde er schießen? Er schoss nicht.
Die Gruppe Soldaten verließ nach einiger Zeit, die mir sehr lang erschien, den Raum. Die Anwesenden blieben wie versteinert stehen. Nur allmählich löste sich die Starre, als meine Mutter beruhigend auf mich einsprach, leise natürlich. Wir warteten und lauschten. Was würde geschehen? War das alles gewesen?
Dann waren Schüsse zu hören, ganz in der Nähe, wahrscheinlich auf der anderen Seite des Hauses bei Hinz und Ernst Hopp. Niemand traute sich hinaus, um nachzusehen. Kurz danach kam ein russischer Soldat in unsere Wohnung. Er sprach uns ruhig, fast freundlich an – auf Deutsch, fließend, mit einem weichen, etwas singenden Akzent, wie es sich manchmal bei deutsch sprechenden Franzosen anhört. Er beruhigte uns; wenn wir die Wohnung nicht verließen, würde uns nichts geschehen. Wir atmeten auf.
Seinem Verhalten und seiner Erscheinung nach schien er Offizier zu sein, der offenbar auf Grund seiner Befehlsgewalt die Soldaten von uns fernhalten konnte. Die Zeiger unseres schönen Regulators hatten inzwischen Mitternacht weit überschritten.
Die Anwesenden setzten sich auf die Ofenbank, die Stühle und auf den Fußboden. In unseren beiden nebeneinander stehenden Betten lagen meine Mutter, eine junge Frau und ich. Der Offizier legte sich zu meiner Mutter...
Ich hatte Angst um meine Mutter und fragte flüsternd die junge Frau neben mir, was nun geschehe. Sie beschwichtigte mich, und ich blieb ruhig. Wahrscheinlich waren alle anderen Frauen froh, dass sie unbehelligt blieben.
Am nächsten Vormittag wagte ich mich nach draußen, schlich an der Hauswand entlang und schaute vorsichtig um die Ecke. Da lagen einige Gestalten vor dem Haus, aufgereiht, mit den Gesichtern im Schnee. Deshalb konnte ich keinen erkennen. Ich blickte auch nicht lange hin, wandte mich vor Schreck ab und lief zurück in unsere Wohnung. Es konnten nur die Männer sein, die sich hierher geflüchtet hatten, die weder für den Volkssturm noch für das Militär tauglich waren, also alte, wehrlose Männer.