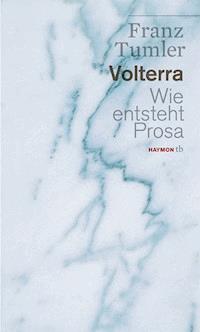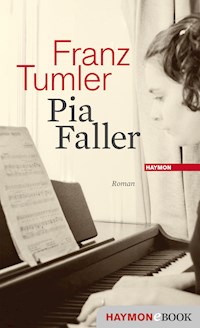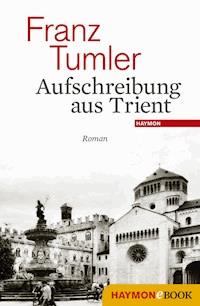Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
LITERARISCHE ANNÄHERUNGEN AN DIE ALTE HEIMAT SÜDTIROL Franz Tumler, in den 1960er Jahren in einem Atemzug mit Günter Grass oder Uwe Johnson genannt, gilt bis heute als einer der wichtigsten Autoren der literarischen Moderne. In Bozen geboren, wuchs Tumler in Oberösterreich auf und lebte ab den 1950ern bis zu seinem Tod in Berlin. Doch in seinem Schreiben hat er sich seiner ursprünglichen Heimat Südtirol beharrlich genähert, in Romanen ebenso wie in Erzählungen, Essays, Reportagen, Gedichten und Tagebuchaufzeichnungen. SÜDTIROL IN ALLEN FACETTEN DURCH DIE AUGEN FRANZ TUMLERS Dieser Band versammelt erstmals Franz Tumlers eindrücklichste Betrachtungen zu Südtirol über fünf Jahrzehnte hinweg: von Auszügen aus seiner monumentalen literarischen Landvermessung "Das Land Südtirol" bis hin zu bislang kaum beachteten und unveröffentlichten Texten aus seinem Nachlass. In drei große Themenbereiche gegliedert, verteilen sich die Texte auf die Felder Autobiographie, Ortsbestimmung sowie Sprache und Leben. Dieser Band ist der sechste in der laufenden Werkausgabe der wichtigsten Werke Franz Tumlers im Haymon Verlag. ********************************************************* Bisher erschienen in der laufenden Werkausgabe in Einzelbänden von Franz Tumler: Volterra. Wie entsteht Prosa Nachprüfung eines Abschieds Aufschreibung aus Trient Der Schritt hinüber Hier in Berlin, wo ich wohne ***************************************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Tumler
In einer alten Sehnsucht
Ein Südtirol-Lesebuch
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ferruccio Delle Cave
Jahrgang 1912
Autobiographie
autobiographische Prosa, Niederschrift vermutlich 1945
I. Buch: Kindheit (Linz)
Meine erste Erinnerung ist, daß ein fremder Mensch, ein Soldat, der einen Vollbart trug und eine Pfeife rauchte, in unserer Wohnung in Linz auf der Fensterbank saß. Später erfuhr ich, daß dies mein Onkel Johann Muther aus Laas in Südtirol war, daß er von der Front aus Galizien auf Urlaub gekommen war, ehe er heimfuhr nach Südtirol. Damals wußte ich es noch nicht, aber jetzt ist es mir bedeutend, daß dieser erste Mensch, von dem ich ein Gedächtnis habe, ein Verwandter aus der Heimat meines Vaters war, die ich mit Kinderaugen nicht gesehen habe.
Ich bin am 16. Jänner 1912 in Gries bei Bozen geboren. Mein Vater war der K. u. K. Professor Dr. Franz Tumler aus Schlanders im Vintschgau. Er starb am 17. November 1913 an einer Blinddarmentzündung. Ich war noch nicht zwei Jahre, meine Schwester war drei Monate alt. Meine Mutter war dreiundzwanzig Jahre alt, sie ging mit uns zurück in ihr Elternhaus nach Linz. Dort wuchs ich auf.
Die Menschen, die da waren, waren mein Großvater, meine Großmutter und meine Mutter. Mein Großvater Josef Fridrich war 1856 in Mödling bei Wien geboren. Er hatte Buchdruckerei gelernt und war nach einer kurzen Dienstzeit im Deutschmeisterregiment in das Militärgeographische Institut nach Wien gekommen, dort hatte er die damals neue österreichische Generalstabskarte gedruckt. Die Arbeit hatte dem Gesellen Ansehen verschafft. Als angehender Meister trat er in die Buchdruckerei Haas in Steyr ein. Von dort ging er nach Ried im Innkreis und gründete mit einigen Konzipisten die P. R. [Preßvereinsdruckerei?] und übernahm die Leitung der Preßvereinsdruckerei. Er hat in seiner Druckerei Ansichtskarten und kleine Reisebeschreibungen für eine Zeitung verfaßt. Im Jahre 1913 nahm er seinen Abschied als Geschäftsleiter und kam nach Linz als Korrektor in die Preßvereinsdruckerei. Die Vorfahren unseres Großvaters stammten aus Wien, seine Mutter hieß Rosina Knab und war die Tochter eines evangelischen Tuchmachers aus Bielitz in den Karpathen.
Meine Großmutter Ernestine Schiffermaier war die Tochter eines Försters aus Waizenkirchen in Oberösterreich. Dieser Förster war Wachtmeister gewesen. Er stammte aus Hollabrunn in Niederösterreich. Meine Großmutter war in Ossiach in Kärnten geboren, als ihr Vater dort bei dem Militär Gestüt gewesen war.
Kindheit in Ungarn
Ihre Mutter dagegen kam aus der Gegend von Waizenkirchen.
Meine Mutter Ernestine war in Ried im Innkreis zur Schule gegangen, in Salzburg hatte sie im Ursulinenstift die Lehrerbildungsanstalt besucht. Mein Vater war in Ried Lehrer am Gymnasium gewesen, unter seinen Schülern war auch Richard Billinger gewesen und andere Leute, die später wieder meine Lehrer gewesen sind. 1910 hat meine Mutter geheiratet und war nach Bozen, wohin mein Vater an das Gymnasium gekommen war, in die Villa Fortuna gezogen.
Die zweite Erinnerung, die ich habe, ist die an den Tod des Kaisers Franz Joseph. Mein Onkel Josef Fridrich kam zu uns und erzählte, er habe seinem Sohne, meinem Vetter also, der seine Suppe nie essen wollte, vorgehalten, der Kaiser sei deswegen gestorben, weil er seine Suppe nicht mehr habe essen wollen. Diese Bemerkung machte mir tiefsten Eindruck, ich behielt die Erinnerung.
Ein anderes Ereignis knüpfte sich mir an das erste. Kaum war der alte Kaiser gestorben, war auch der junge Kaiser in seinem Leben gefährdet. In den Zeitungen stand: auf einer Frontreise in Italien sei er auf einem vom Hochwasser unterwanderten Weg abgestürzt und habe sich nur an den Zweigen eines Weidenbaumes im Wasser festhalten können. Die Zeitungen verfehlten nicht, das Ereignis auszumalen und die glückliche Errettung des Kaisers zu preisen, zu Hause wurde alles lebhaft besprochen, und ich glaube, daß ich, davon eingenommen, zum ersten Mal bewußt ein Dankgebet sprach, wohl auch dazu angehalten wurde.
Ich entsinne mich deutlich der Tatsache, daß die Brüder meiner Mutter, die im Felde standen bis auf den einen erwähnten ältesten Onkel Josef, der ein Eisenbahninspektor in Salzburg war, ab und zu auf Urlaub heimkamen. Das ging so vonstatten, daß sie zuallererst auf den Balkon geführt wurden, dort ihre Kleider ablegten und sich, der Läuse wegen, gründlich wuschen. Dann erst durfte ich mich ihnen nähern.
Die Brüder meiner Mutter waren von dem ältesten Onkel Josef angefangen: Leopold Fridrich, er war vor dem Krieg Bankbeamter gewesen, war ins Ausland gegangen, hatte in Portugal auf der Seite der Royalisten mit gekämpft, war in die Verbannung nach Brasilien gegangen und von dort nach England. Im Jahr 1914 kam er zurück. Im Felde diente er, bis er eine Gasvergiftung erlitt, nach dem Krieg ging er nach Steyr und schlug sich auf die Seite der Sozialdemokraten, er war auf der Gemeinde dort Beamter.
Mein Onkel Wilhelm Fridrich wollte Geistlicher werden, er faßte den Entschluß, in den Jesuitenorden einzutreten. Dies entzweite ihn mit meinem Vater, der, obwohl streng katholisch, doch die Jesuiten nicht liebte. Der Orden aber wies ihn wegen abweichlicher Gesundheit zurück u. Onkel Wilhelm mußte in seinem Studium aussetzen. Er wirkte in Kalksburg als Erzieher der Erzherzöge … von Habsburg-Lothringen; er empfing die niederen Weihen. Er meldete sich als Freiwilliger im Feld, und das Gedicht, das er damals schrieb, wurde in einer Zeitung gedruckt, mein Großvater hatte es bis zuletzt in seinem Zimmer unter Glas und Rahmen hängen. Im Jahr 1916 fiel mein Onkel Wilhelm bei Sagan in Galizien, angeblich von der Hand tschechischer Überläufer. Seine Briefe zeigen dichterisches Gemüt und Kraft; er ist am meisten meiner Mutter ähnlich, und ich bins, was die Ähnlichkeit von meiner Mutter Seite her angeht, am meisten ihm.
Mein Onkel Alois Fridrich lernte das Gewerbe des Großvaters, die Buchdruckerei, er war lang im Feld, wurde verwundet und ergriff dann den alten Beruf. Er kam nach Innsbruck und stieg dort zum Verlagsleiter in der Wagnerschen Universitätsdruckerei auf. Auch er hat sich um das Poetische bemüht, ebenso wie meine Mutter übrigens, und gelegentliche kleine Schilderungen und Erzählungen von ihm sind in Zeitungen gedruckt worden. Das einzige selbständige Büchlein hat doch mein Vater Franz Tumler hinterlassen, es ist eine wissenschaftliche Schrift über den Weinbau der alten Römer in Südtirol, erschienen in einer Schriftenreihe des „Schlern“ in Innsbruck.
[…]
Meine Reise nach Südtirol
Meine Reise nach Südtirol begann ich in Attnang, … dort stieg ich abends in den Zug, der die Nacht durch bis Innsbruck fuhr. Ich saß mit einem Mädchen im Abteil, das von Ebensee herkam; sie hatte blonde Haare, helle blaue Augen und eine weiße Haut. Ich fuhr die Nacht mit ihr zusammen und war verwundert und glücklich, daß sie sich meiner Nähe ergab, wir erwiesen uns Zärtlichkeiten und Liebkosungen und saßen stumm, als in Innsbruck der Tag aufdrang.
Ich ging zu Tante Moidl in die Seilergasse, ging ein wenig in der Stadt herum, auf den Rennweg, in die Hofkirche. Mittag fuhr ich weiter mit einem Zug, der voller deutscher Reisender war. Ich muß damals eine merkwürdige Anziehungskraft ausgeübt haben; in meinem Abteil saß ein reisendes Liebespaar aus Böhmen. Ich sprach ein wenig mit dem Mann und mit der Frau, dann trat ich auf den Gang, da kam mir die Frau nach und schob mir verstohlen einen Zettel in die Tasche, auf dem sie mir ihre Neigung erklärt hatte und mich um ein Stelldichein in Bozen am Bahnhof bat. Dieser Zettel, dazu das Erinnern an die Nacht zuvor setzten mich in Verwirrung, aber ich schrieb diesen Berührungen eine Bedeutung zu, als ob heimliche Kräfte meine Reise zum Guten führen wollten.
In Bozen angekommen, schaute ich mich zuerst um ein Quartier um; ich fand es in einem billigen Gasthaus in der Museumsstraße. Auf dem Bahnhof traf ich die Frau, aber plötzlich war sie ängstlich, der Mann könne ihr nachspionieren, ich war froh, als ich mich entfernen konnte. Ich ging durch die Stadt. Den ersten Weg, den ich machte: zu unserem Haus, der Villa Fortuna. Ich ging die Talferpromenade hinauf, droben über die Brücke und am Mauracherhof, bei dem wir die Milch geholt hatten (das wußte ich alles von den Erzählungen meiner Mutter), zurück. Ich traf an der Villa Fortuna die alte Traubenverkäuferin Flora und ihren Mann Beppo; als ich ihr meinen Namen sagte, flossen ihr die Tränen herunter. In dem Haus, in dem wir gewohnt hatten, wohnten Italiener. Ich betrat es nicht. Ich ging weiter zu dem Hause, in dem die Professor Webers wohnten; ich traf den Mann, der ein Freund meines Vaters gewesen war: einen undurchsichtigen Menschen, Familienforscher, von Provinz ganz durchstockt. Lebendiger war mir seine Frau, eine Wienerin, die sich aber dem Lande völlig angepaßt hatte und die nun scharf gegen jedes Rauchen und Trinken war, das sie auch mir gleich [ausstellte?]. Die Weberischen hatten drei Söhne, der mittlere war mit mir gleich, der ältere Wido wollte Musiker werden; der jüngere Teja ging noch zur Schule. Ich schloß mich der Frau an und machte mit ihr einen Spaziergang auf die Oswaldpromenade. Sie war gesprächig und politisch interessiert, ich mußte sie von diesen Gegenständen immer wieder ablenken, ich wollte von meinem Vater hören.
Ich blieb drei Tage in Bozen und ging überall hin: auf den Guntschna, den Kalvarienberg, nach Runkelstein. Alles, was ich sah, verklärte sich mir zu einem poetischen Bilde: in Runkelstein sah ich Landstreicher im Gras sitzen, vom Kalvarienberg schaute ich durch das ausgeglühte Gestein nach Süden, wo in der Bucht vor der Flanke des Berges das italienische Militärlager war; ich ging auch nach Sigmundskron den Weg durch die Etschau, saß lange am Ufer des grauen Flusses und stieg dann erst zu der Ruine hinauf. Ich besuchte die Kirchen, in Gries sprach ich beim Pfarrer vor und sah meine Taufmatrikel nach; auf dem Friedhof suchte ich den Platz, wo das Grab meines Vaters gewesen war. Ich ging auch in der Stadt herum und setzte mich in das deutsche Café und in die Conditorei Hofer, dort blätterte ich in den Heften des „Schlern“, einer Zeitschrift, die sich mit der Geschichte des Landes beschäftigte und die sehr gut war.
Dann zogs mich aber weiter, daß ich in das Land eindrang, und ich ging geradewegs auf den Teil zu, der mich am meisten mit seinen Geheimnissen bewegte: in die ladinischen Täler. Ich ging durch das Eggental bis zum Karerpaß, dort zweigte ich ab zur Ostertaghütte, auf ihr übernachtete ich. Am anderen Tag ging ich zur Grasleitenhütte und von dort weiter über den Antermoja durch ein Tal, das sehr seltsam aussah: es senkte sich nach Süden, umschloß einsame grüne Almwiesen, auf denen die verschlossenen Hütten dicht beieinander standen, nach diesem stillen Grunde erst stürzte der Bach steil in die Tiefe. Es war das Val Udaj, und der Eindruck, den es mir machte, blieb in mir; ich war sehr glücklich, als sei ich von aller Welt an diesen Ort wie in eine Heimat gekommen. In Pezzo übernachtete ich, den nächsten Tag ging ich über das Sellajoch auf dem Weg durchs Durontal und über die Rodella nach Plan de Gralba, dort übernachtete ich wieder, am vierten Tag fuhr ich durchs Grödnertal nach Klausen und nach Bozen zurück. Das Gebiet, das ich berührt hatte, ist mir später viel genauer noch bekannt geworden; von damals her bliebs wie eine Ahnung in mir stehen.
Von Bozen fuhr ich nach Trient, sah die Stadt, fuhr weiter nach Rovereto, von dort bis Torbole. Ich blieb etliche Tage in Torbole und schrieb ein kleines Stück, betitelt „Landschaft des Südens“, das ich dann in Bozen an die Zeitung gab für Geld. Mit den Deutschen in der Pension machte ich Ausflüge: nach Malcesine, nach Riva, in den botanischen Garten von Riva, wir kletterten auch ein Stück am Monte Baldo in die Höhe und sahen die Weltkriegsstellungen. Von Torbole fuhr ich mit dem Schiff bis Gardone. Ich sah den Ort, ging zu der Villa, dem steinernen Schiff d’Annunzios, in die Höhe und wanderte zu Fuß nach Salò, das mich mehr ansprach als die anderen Orte. Von Salò fuhr ich mit dem Schiff weiter bis Desenzano, von dort mit dem Zug bis Verona. In Verona blieb ich in einem Hotel auf der Piazza d’Erbe; drei Tage sah ich die Stadt: das Theater, den Giardino Giusti, alle Kirchen, insbesondere die gegossenen Türen von San Zeno; ich wagte mich auch aufs Land, und ich wurde mit der Stadt so vertraut, wie ichs etwa mit Salzburg war.
Von Verona fuhr ich zurück nach Bozen. Nun erst besuchte ich meine Verwandten. Ich fuhr nach Laas. Kehrte bei den Mutherischen ein. Ich fand den alten Muther und die Tante Maria, die Lena – die beiden Schwestern meines Vaters. Ich sah das Haus, auf dem ein neues Stockwerk aufgebaut war. Mein Vetter Ernst war auf der Gemeinde angestellt; Friedrich arbeitete sich ein als Nachfolger am Hof; die drei Cousinen waren noch zu Hause. Ich hatte von dem ersten Dasein als Kind alles noch ein wenig im Gedächtnis. Nun führte mich Ernst weiter herum, und ich sahs mit anderen bewußten Augen. Wir gingen in den Marmorbruch, der erweitert worden war, fuhren mit der Seilbahn hinauf und krochen in die Höhlen. Auf dem Nörderberger Weg kehrten wir zurück. Wir gingen auf die Laaser Alpe, übernachteten bei den Hirten und versuchten den Übergang ins Suldner Tal. Aber es lag noch zuviel Schnee, die Lawinen sperrten uns den Weg, wir verirrten uns und kamen über die Tschengelser Alp wieder zurück. Wir fuhren nach Spondinig und Mals und gingen auf die hohen Höfe am Sonnenberg. Von dort oben her, vom Zerminiger, waren die Tumler ins Tal nach Schlanders gekommen; auf den Zerminiger waren sie vom Schnalstal her gekommen. Mich wehte alle Ahnenherkunft geheimnisvoll an. Wir besuchten den Bruder meines Vaters in Schlanders, dort sah ich mein eigentliches Vaterhaus im grünen an dem sonnigen Hang; ein uralter Weinstock blühte davor am Tor. Ich sah noch meine blonden und helläugigen Schlanderser Vettern und die Base Hilda, die Ähnlichkeit mit mir hatte und neben der ich verhaltenen scheuen Gefühls voll saß. In Laas ging ich den Weg noch einmal nach Allitz, wo das Wasser gefaßt und geleitet wird in den uralten Leitungen.
Ich fuhr mit Ernst nach Meran, wir besuchten die Burg Tirol, ich fuhr nach Bozen, nahm von den Weberschen Abschied und fuhr über Innsbruck nach Hause.
Zum ersten Mal war ich mit bewußtem Auge in meiner Heimat gewesen. Es war mir, als hätte ich mir einen tiefen und wahren Hintergrund des Lebens hereingeholt. Ich war einmal zwanzig Jahre alt geworden und hatte ihn nicht gehabt; oft hatte ich Sehnsucht empfunden nach ihm, das Bild des Vaters war mir dann aufgestiegen. Nun lebte das alles weiter mit mir: mein Vater, die Herkunft aus dem alten Land und alten Volk, die Gegend gerade um Laas und im Vintschgau war mir erschienen, als ob sie auch in Griechenland sein könnte, und Ähnlichkeit hatte sie gewiß: das breite Tal, der sonnendurchglühte nördliche Hang, der breite Schuttkegel des Gadriàbaches davor. Dieser Gadrià-Kegel war mir ein besonders geheimnisvoller Bezirk, die alten Wasserleitungen waren in ihm gegraben, an seinem Rand stand die Kirche St. Sisinius aus dem Jahre 900. Aber neben dem Alten war mir das Neue aufgedrungen: ich hatte die Unterdrückung der Deutschen durch die Italiener gesehen, meine politische Leidenschaft wendete sich mit Macht dieser Tatsache zu. […]
Meine Fahrt nach Südtirol
Im September rüstete ich mich zu meiner Fahrt nach Südtirol. Ich hatte mir vorgenommen, mich mit den ladinischen Tälern insbesondere zu beschäftigen und den Volkssagen dieser Täler nachzugehen, mir, wenn möglich, Bücher darüber zu schaffen. Von einem Bekannten meines verstorbenen Vaters in Innsbruck bekam ich die Adresse des Professors Archangelo Lardschneider, eines Mannes ladinischer Herkunft, der in Innsbruck lebte; ich ging zu ihm und lieh mir einige Bücher aus. Aus diesen konnte ich Anhalte gewinnen über die Orte, denen bestimmte Volkssagen zugeschrieben wurden. Ich machte mir Aufzeichnungen, derart, daß ich mir danach die Orte, die ich aufsuchen wollte, auszog und auf solche Weise einen ersten Plan zu meinen Wanderungen in Südtirol mir festlegte. Diese Auszüge machte ich an den hellen Nachmittagen in dem Hofgartencafé in Innsbruck; die Tische dort waren leer, nur ein paar Leute des italienischen Konsulats, Offiziere und Sekretäre, die sich dort zum Tee regelmäßig trafen, erinnerten mich daran, daß meine Heimat von Italien okkupiert war. Nach drei Tagen war ich mit dieser Arbeit fertig und fuhr nach Bozen. Mein erster Gang war nun, Mechow zu suchen. Er hatte mir die Adresse einer geistlichen, von Schwestern geleiteten Pension gegeben, als ich hinkam, erfuhr ich, daß er nach Jenesien gezogen sei, wo die Schwestern ein ähnliches Heim auf dem Berg besaßen. Ich ging in der Sommerhitze am Vormittag die dreieinhalb Stunden bei Jenesien hinauf; aber da war Mechow eben ins Tal gegangen; also kehrte auch ich, ohne daß ich etwas aß, gleich wieder um, lief wieder nach Bozen hinunter und traf ihn dort auch nach dem Mittagessen, als er eben wieder sich rüstete, nach Jenesien aufzusteigen. In seiner Gesellschaft war eine Frau, die mir fremd vorkam, ich glaubte zuerst, sie sei eine Italienerin, weil sie auch einen fremd klingenden Namen hatte, sie hieß Alice Beate V…, und wollte in der Stadt noch bleiben und erst, wenn ein Maultier beschafft war, Mechow nachfolgen nach Jenesien.
Auch ich blieb in Bozen und suchte am anderen Tag gleich zwei Leute auf, die mir bei der Arbeit, die ich vorhatte, helfen konnten. Der eine war der Direktor des Bozner Museums, auch ein Freund meines Vaters, das verschaffte mir den Zutritt zu ihm, und ich bekam von ihm ein Buch geliehen, eine um 1860 von dem Professor Alton herausgegebene Sammlung ladinischer Sagen, zweispaltig gedruckt mit ladinischem und italienischem Text. Ich machte mich während der Zeit, die ich in Südtirol war und in Bozen weilte, an eine eifrige Übersetzungsarbeit, indem ich mit Hilfe der italienischen die ladinischen Wörter identifizierte und mir eine Art deutsch-ladinisches Wörterbuch anlegte, die verschiedenen Dialekte unterschied, die sämtlich mit dem Provencalischen mehr Ähnlichkeit hatten als mit dem Italienischen, und in einem [Merkblatt?] auch festlegte, was mir von der Grammatik deutlich wurde. War ich in den Tälern, so ließ ich mir von den einfachen Leuten in den Wirtshäusern aus dem Buche vorlesen. Die waren sehr erstaunt, denn sie hatten, weil es außer diesem Buch, das aber nur in den Museen lag, keine ladinischen Veröffentlichungen gab, noch niemals etwas in ihrer Sprache gedruckt gesehen, ja sie benutzten sie nicht einmal zum Schreiben; ihre Schrift-Sprache war vor 1918 Deutsch gewesen, nun war sie Italienisch. Ich aber gewann aus diesem Vorlesen den getreuen Klang der Sprache, und zudem konnte ich von den Leuten neue Erzählungen erfahren, die nicht in dem Buche Altons verzeichnet waren.
Ein anderer Mann, den ich aufsuchte, war der Schriftsteller Karl Felix Wolff. Lardschneider hatte ihn mir angeschwärzt als Aufschneider, der sich seine Sagen, die er in etlichen kleinen Büchern veröffentlicht hatte, nur erdichtet habe, niemals seien sie in der Volksüberlieferung wirklich gewesen. Trotzdem wollte ich auch Wolffs Rat hören. Ich ließ mich bei ihm, der in einem alten Bozner Bürgerhaus lebte, dessen Treppe sich um einen Lichthof wand, anmelden und wurde mißtrauisch empfangen von einem Stubenmenschen, der sich, was ich bald einsah, auf den verschiedensten Gebieten: der Geologie, der Reisebeschreibung, der Namensforschung, dilettierend betätigt hatte und dessen Meinungen von den zünftigen Gelehrten, die freilich auch kleinen Formats waren, heftig bekämpft oder hohnlächelnd abgetan wurden. Ich bekam einen kleinen Einblick in das enge und streitsüchtige Leben der Intelligenz in einer kleinen Provinz, auch mein Professor Weber spielte da eine Rolle, und mich gelüstete es nicht sehr nach näherer Bekanntschaft mit diesem Kerl. Als ich im Gespräch Rudolf Pannwitzens „Ladinersage“ erwähnte, beklagte sich Wolff, daß Pannwitz ihm die Motive zu der Sage abgeluchst und gestohlen hätte, ähnlich schien er mit jedem Menschen vergrämt.
Weil auch der Museumsdirektor mich mit der muffigen Art der gelehrten Provinzleute empfangen hatte, die in Bozen nicht besser zu sein schienen als in Linz, hätte ich den Mut für meine Sache verloren, wenn ich mich nicht auf mich selber gestellt hätte, wenn die Bücher mir nicht Auskunft gegeben hätten und das Land schon mich angezogen hätte. Ich hatte, weil Mechow in dem Hospiz der geistlichen Schwestern gewohnt hatte, für die zwei Tage auch dort Wohnung genommen; dabei war ich bei Tisch der Frau wieder begegnet, die noch immer auf das Maultier wartete, das sie auf den Berg bringen sollte. Als ich mich am dritten Tag fertig machte zu meinem ersten Gang ins Gebirge, als ich mir nach den Landkarten und Büchern die Orte festgelegt hatte, die ich berühren wollte, war mir bange, wie vor einem größern Abschied, und ich lud die Frau ein, mit mir im Café Kusseth noch eine Schale Kaffee zu trinken; und da erfuhr ich zum ersten Mal ihre seltsame Gabe, von den Gedanken der anderen mitzuwissen; sie sprach mir Mut zu, obwohl ich Mutlosigkeit zwar fühlte, aber nicht zu erkennen gegeben hatte. Ich nahm Abschied, packte meinen Rucksack und fuhr mit dem Zug nach Süden.
Die Wanderungen, die ich jetzt beschreiben werde, sind mir in vielem Einzelnen genau im Gedächtnis geblieben wie nichts von einer Zeit sonst: Bilder, Stimmen, Empfindung, Einsamkeit – das waren die Elemente, denen ich mich aussetzte.
Ich fuhr bis Neumarkt, ein Pater wies mir die gewundene Straße ins Gebirge. Ich hatte auf der Karte einen Feldsteig ausgemacht, auf dem kam ich zu zwei Bauernhöfen, dann durch ein Tal zu einer Säge und von dort gegen Abend in das Dorf Truden. Ich übernachtete und hatte hier, wo nur Deutsche wohnten, aber die erste Gelegenheit, meine Sagenaufzeichnungen bestätigt zu finden von der Wirtin und von einem Schmiede, zu dem mich die Wirtin am anderen Morgen führte, ehe ich weiterging. – Diesen zweiten Tag regnete es, in einer nebligen Luft, durch die mir nur das Geläute der Herden herdrang, ging ich über ein Hochmoos bei Altrej, dem letzten deutschen Dorf. Am Nachmittag eilte ich den steilen Sturz ins Fleimstal hinunter und war nun in der plötzlich veränderten, hier nur noch von Italienern bewohnten Gegend, ich stieg dieses Tal aufwärts, bis ich spät abends in Cavalese eintraf und dort in einem italienischen Wirtshaus übernachtete. Andern Früh sah ich die alte Thingstätte an der Kirche des vor Zeiten nicht italienischen Ortes, dann ging ich weiter talauf und bog auf die linke Seite zu den Trümmern eines alten sagenumwobenen Gehöftes Talamon, ich sah die Steine, über die das Gras wuchs. An der Stelle bog ich in das Lagorajtal ein, das auch eine alte Sagenstätte bezeichnet; dieses Seitental geht in die südliche Gebirgskette hinein, und an einem Ende liegt ein kleiner Bergsee, der Lagoraj-See. Ich ging vier Stunden in dem Tal, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen, und als am Talschluß der Baumwuchs aufhörte und der See zwischen kahlen Halden und Wiesen blau lag, war ich in der vollkommensten Einsamkeit. Nur ein verirrter Ziegenbock, der von der Abfahrt der Almtiere noch zurückgeblieben war, meckerte hinter Felstrümmern hervor. Ich trat in die Schafhütte und rastete dort, dann stieg ich auf die Kette, wechselte von ihr hinüber in das nächste Tal, das bei Zaj wieder in das Haupttal hinaus führte. Diese Gebirge sind wenig begangen, die spärlichen Steige sind kaum mit Marken versehen, ich mußte mich allein auf die Karte verlassen. Ein Gefühl unbeschreiblicher Öde nahm mich gefangen auf diesen hohen Wegen, nichts von Menschen und menschlicher Bildung war weit in dem Umkreis. Nach drei Stunden kam ich zu dem ersten Haus, einer Badstube, denn dort im Zajtal fließt eine mineralhaltige Quelle zu Tage. Ich ging noch weiter bis Zaj, dort blieb ich über Nacht. Am andern Tag ging ich das Fleimstal aufwärts ins Fassatal, dort bog ich ab zu der Bergkirche Santa Juliana, die mir auch einen Sagenort bezeichnete. Ich verlief mich dort und verlor Zeit, darum kam ich zu spät zu meinem eigentlichen Aufstieg in die Dolomiten, bei Dunkelheit erst erreichte ich die Grasleitenhütte, wo mir der Wirt eine Sage von goldenen Lämmern erzählte und ein reichsdeutscher Sommergast dieses Sagenforschen verargte, weil ich es, wie er sagte, nicht in Deutschland betrieb, wo es noch etwas zu forschen gebe. Am andern Tag ging ich den Gebirgssteig über Laurins Rosengarten zur Kölner Hütte, von dort lief ich abwärts nach Thiers. Ich übernachtete an dem Ort, nun hatte ich nicht mehr Lust zu laufen, sondern wartete auf das Auto, das abends nach Bozen gehen sollte. Die Zwischenzeit nutzte ich, mit einer deutschen Sommergastin aus Düsseldorf einen Ausflug auf die Alm zu machen, und ich muß gestehen, ich nutzte die Ferienlust der Fremden aus, sie in die Arme zu nehmen und ihr einen Kuß aufzudrücken.
In Bozen übernachtete ich im Hospiz und erfuhr, daß Mechow und Frau … in Jenesien seien; ich brachte den anderen Vormittag noch in der Stadt hin, am Nachmittag ging ich hinauf.
Ich war oben und traf die beiden, als sie von einem Spaziergange zurückkehrten, da konnte ich ihnen an dem Fernblick der Dolomiten gleich zeigen, wo ich aus dem Berg heruntergekommen war, und als mich Frau … fragte, ob ich dort Gutes also gefunden habe, antwortete ich: Ja, Feen sind mir untergekommen, und sie sagen einem etwas, aber man darf es nicht weitererzählen. Wir versammelten uns abends nach dem Essen, und zu meinem Erstaunen fand ich Mechow nicht aufgelegt zu einem Gespräch, wie ichs etwa mit Würtz geführt hätte unter anderen Umständen; er zog ein Würfelspiel vor. Die Gesellschaft solcher Art Leute mußte ich erst gewöhnen, sie ließ mich unbefriedigt, unter manchen Gedanken schlief ich ein. Mechow hatte über Schlaflosigkeit und Nervosität geklagt, ein solcher Zustand hatte für mich bis jetzt nur als Einbildung existiert, aber wie ich immer sehr empfindlich war für die Art eines Menschen, geschahs mir auch hier: sogleich schlief ich auch schlecht.
Am andern Morgen begleitete ich Mechow auf einem Spaziergang über die Lärchenwiesen oberhalb Jenesien, er erzählte mir, er habe mit Frau … gesprochen und müsse mir etwas sagen. Dies verhielt sich so: ich hatte in einer ungewissen Empfindung ihn in Bozen gefragt, ob die Frau eine Deutsche sei, er hatte ausweichend geantwortet, ihr aber meine Frage berichtet. Nun hatte sie ihm aufgetragen, mir zu sagen, daß sie Jüdin sei; damit ich danach meinen Umgang mit ihr einrichten könne.
Ich hatte nun seit den Zeiten, da ich mit Hella Frank in die Schule gegangen war und seit ich Dr. Erbachs Familie kennengelernt hatte, mit Juden nichts zu tun gehabt; es war mir die Begegnung darum befremdend, aber ich war frei genug, zu sagen, daß mir eine anständige Gesellschaft ohne Vorurteil anständig sei. Ich nahm mich zusammen vor der Frau, ihr jede Höflichkeit zu erweisen, zudem schien mir dieses intellektuell-literarische Verhältnis zwischen ihr und Mechow, das von seiner edlen Art ebenso Zeugnis gab wie von seiner geistigen Krankheit und von ihrer Hingabefähigkeit der Seele ebenso wie von der Durchgebildetheit ihres Geistes, nicht recht verträglich zu sein, ich befand mich in der Rolle des Ausgleichenden zwischen Spannungen, trotzdem nahm eine sonderbare Gereiztheit bei Mechow zu. Er hatte im Frühling in Bonn und in Mainau am Bodensee eine größere Arbeit über Italien begonnen, damals eben war Frau … mit ihm gewesen. Nun, da er die Arbeit weiterführen wollte, meldete sich eine neue Periode der Depression bei ihm an. Nach etlichen Spaziergängen und abendlichen Spielen brach Mechow seinen Aufenthalt in Jenesien ab und ging mit mir nach Bozen. Er wollte nach Venedig fahren, von dort erhoffte er sich ungeduldig neuen Antrieb zur Arbeit. Ich aber bereitete mich auf meinen zweiten Gang ins Gebirge vor.
Ich fuhr an einem Regenabend mit dem Auto nach dem Karerpaß. Dort im Hotel war nur mehr, wo die Gäste längst abgezogen waren, die Herberge für die landläufigen Reisenden offen, ich kam an und sah sie: es waren, wo eben die Zeit des Dienstbotenwechsels war, Knechte und Mägde, die von einem Tal ins andere zu ihrem neuen Posten wanderten, auf dem sie einstehen sollten. Ihre Bagage und Holzkoffer hatten sie in der großen Hotelküche abgestellt, darin aß man auch; es gab für alle das gleiche Gericht: Knödel in der Suppe; bald suchte ich meine Kammer auf, war nichtsdestoweniger zufrieden, mit dem täglichen Leben des Volks diesen Umgang gefunden zu haben. Am andern Tag wanderte ich auf Abkürzungssteigen ins Fassatal und kam bis Campitell. Ich ging am Abend ein Stück ins Durontal hinauf und setzte mich auf einen Stein und dachte daran, wie mir der Name bedeutend geworden war. Andern Morgen brach ich in aller Früh auf. Dabei wurde ich Zeuge eines seltsamen Vorganges. Schon in der Dunkelheit hatte ich Lärmen von Karren und Pferden gehört, die Dorfleute waren ins Durontal aufgebrochen, um von den Bergwiesen dort das Heu herunter zu holen. Sie hatten Stall-Lampen mitgehabt und sie beim Hellwerden hier und dort an einer der zahlreichen Weg-Kapellen abgestellt, um sie am Nachmittag auf dem Rückweg wieder zu holen. Die nun, die am spätesten gefahren waren, hatten ihre Lampen kurz nach dem Dorf abstellen können; je früher einer gefahren war, umso weiter droben im Tal stand seine Lampe. Ich ging hinauf und kam mittags in das Haus auf der Seiseralpe, das mir in seiner Touristengeschäftigkeit in wenig guter Erinnerung ist. Von der Wirtschaft wanderte ich weiter über die Hochfläche der Seiser Alp bis zu dem Absturz von St. Ulrich in Gröden, und von dort ging ich im Grödnertal hinaus nach Klausen. Ich versäumte nicht, auf das Kloster Säben zu steigen; mit dem Abendzug fuhr ich nach Bozen.
Dort war Mechow indessen von Venedig unbefriedigt zurückgekommen; und auch Frau V… war von Jenesien ins Tal gekehrt. Ich sah die beiden, und es ergab sich wieder, daß ich in ihrem Hospiz Quartier nahm; so wohnte ich denn zum andern Male wie schon so oft in einem geistlichen Haus. Mechow und Frau … gingen jeden Tag in der Kapelle des Hospizes zur Messe, und auch der Hintergrund ihrer Freundschaft wurde mir damals offenbar: es war die leidenschaftliche Ausübung der Katholischen Religion bei ihr wie bei ihm; ich achtete diese Neigung, aber ich konnte sie nicht teilen. Ich hielt mich auch tags meist allein; die Ausbeute meiner Wanderungen, das Ordnen und Übersetzen der Sagen, das Vergleichen der Literatur, beschäftigte mich für die bestimmten Stunden. Nur die Tischzeiten vereinigten mich mit Mechow, und allgemach erst, als er bestimmte Ausflüge vorschlug, gingen wir auch über Längen zusammen.
So fuhren wie an einem Nachmittag auf den Ritten, auf dem ich neun Jahre zuvor mit meinen Eltern zu Fuß gegangen war; an einem anderen Tag gingen wir nach Sigmundskron, an einem anderen fuhren wir auf den Mendelpaß. Wir gingen über die Oswaldpromenade zum Peter Ploner und auf den Guntschna; wir gingen hinter Runkelstein ein Stück ins Sarntal. Wir machten einen Tageweg ins Überetsch an die Montiggler Seen, und zuweilen saßen wir abends in einem Gasthof oder Weinhaus. An einem solchen Abend sah ich im Gasthof zur Post als Kellnerin das Mädchen wieder, mit dem ich mich vor zwei Wochen am Antermojasee mit Schneebällen beworfen hatte. Mechow aber wurde immer unzufriedener mit seinem Hiersein. Er hatte mit Beate … in Mainau so gelebt: daß er in der Früh gearbeitet hatte, sie ihm dann das Gearbeitete auf der Maschine reingeschrieben hatte, während er spazierenging, am Nachmittag waren sie dann zusammen spazierengegangen und hatten sich wieder getrennt. Der Frau war das genug gewesen: einem großen Geist in Hinwendung den Dienst zu tun. Mechow, als er sah, daß er diese Einteilung nicht wiederholen könne, rüstete sich zur Abreise. Wir gingen nochmals zusammen nach St. Magdalena, von dem Ausflug kam ich mit einer Grippe zurück. Ich lag zu Bett, als Mechow fuhr; weil er Angst hatte, seine Kinder in Braunenburg anzustecken, verabschiedete er sich an der Tür.
Vielleicht war es das nervöse Leben Mechows, das mich in seiner Art krank gemacht hatte, kaum war er fort, gesundete ich wieder. Und sogleich richtete ich mich auf einen neuen Weg ins Gebirge. Es war das dritte, es sollte der längste werden; ich wollte, wo ich das Grödnertal und das Fassatal kennengelernt hatte, in das dritte ladinische Tal in Buchenstein, auf italienisch Livinallongo, auf ladinisch Fodom, vorstoßen.