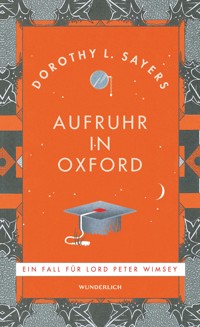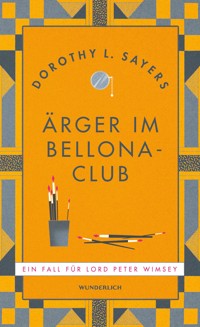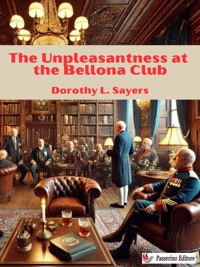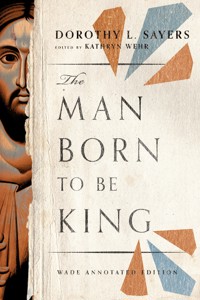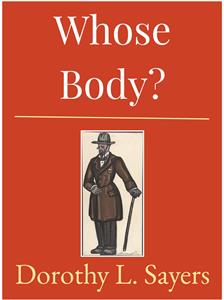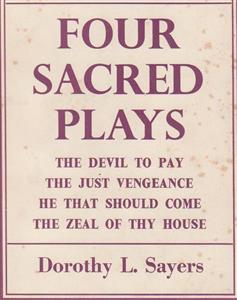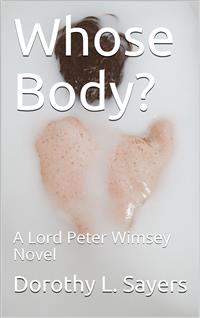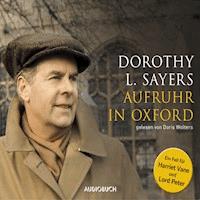4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lord Peter Wimsey
- Sprache: Deutsch
Laurence und Rosamund Harwell gelten in ihren Kreisen als Paradebeispiel einer amour fou. Während Laurence als Theaterproduzent seinen Geschäften nachgeht, bändelt die kapriziöse Rosamund mit einem jungen Dramatiker an. Als sie kurze Zeit später ermordet aufgefunden wird, soll sich Lord Peter ein wenig in der feinen Gesellschaft umhören ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dorothy L. Sayers • Jill Paton Walsh
In feiner Gesellschaft
Über dieses Buch
Laurence und Rosamund Harwell gelten in ihren Kreisen als Paradebeispiel einer amour fou. Während Laurence als Theaterproduzent seinen Geschäften nachgeht, bändelt die kapriziöse Rosamund mit einem jungen Dramatiker an. Als sie kurze Zeit später ermordet aufgefunden wird, soll sich Lord Peter ein wenig in der feinen Gesellschaft umhören …
Vita
Dorothy L. Sayers, Jahrgang 1893, legte als eine der ersten Frauen an der Universität ihres Geburtsortes Oxford ihr Examen ab. Mit ihren mehr als zwanzig Detektivromanen schrieb sie Literaturgeschichte, und sie gehört neben Agatha Christie und P. D. James zur Trias der großen englischen «Ladies of Crime». Schon in ihrem 1923 erschienenen Erstling «Ein Toter zu wenig» führte sie die Figur des eleganten, finanziell unabhängigen Lord Peter Wimsey ein, der aus moralischen Motiven Verbrechen aufklärt.
Jill Paton Walsh, 1937 geboren, hat viele Kinderbücher und Romane veröffentlicht, von denen «The Knowledge of Angels» für den Booker Prize nominiert wurde. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen und verfasste neben ihren anderen Werken auch zwei höchst erfolgreiche Kriminalromane, «The Wyndham Case» und «A Piece of Justice».
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel «Thrones, Dominations» bei Hodder and Stoughton, a division of Hodder Headline PLC, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024
Copyright © 2000 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Thrones, Dominations» Copyright © 1998 by the Trustees of Anthony Fleming (deceased) and Jill Paton Walsh
Redaktion Anne Tente
Cover-Konzept anyway, Hamburg, Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung George Marks/iStock
ISBN 978-3-644-53211-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ich war begeistert und fühlte mich zutiefst geehrt, als die Partner von Lord Peter Wimsey mich baten, einen Fall aufzuzeichnen, der ihn kurz nach seiner Heirat beschäftigte. Dies war sowohl eine Periode der Neuorientierung in seinem und dem Leben seiner Frau als auch eine Zeit der Umbrüche im öffentlichen Leben des Landes. Seit meiner ersten Begegnung mit ihm in meiner Schulzeit habe ich Lord Peter verehrt und bewundert. Wie bei einem Menschen, der 1890 geboren wurde, nicht anders zu erwarten, ist sein Verhalten geprägt von zahlreichen altmodischen Manierismen. Sein unsterblicher Charme jedoch beruht auf einem Charakterzug, den er mit Ralph Touchett (in Bildnis einer Dame), mit Benedikt (in Viel Lärmen um nichts) und sogar in gewisser Weise mit Mr. Rochester in Jane Eyre gemein hat, aber mit kaum jemandem sonst in der Literatur oder im wirklichen Leben. Er bedarf nämlich einer ihm intellektuell gleichrangigen Frau als Gefährtin.
Eine so ungewöhnliche Verbindung wie die Lord Peters mit Harriet Vane mußte natürlich weithin Neugier auslösen. Ich habe mich bemüht, diese Neugier zu befriedigen: in den Grenzen, die mir sowohl die literarische Form der Kriminalgeschichte als auch der Respekt vor Lord Peters früherer Chronistin gesetzt haben.
Jill Paton Walsh
Ich möchte Mr. Bruce Hunter und den Treuhändern Anthony Flemings dafür danken, daß sie mich mit der Vollendung von In feiner Gesellschaft betraut haben.
Mein Dank gilt der unschätzbaren Hilfe von Dr. Barbara Reynolds; der freundlichen Unterstützungdurch den Vorsitzenden der Dorothy L. Sayers Society, Christopher Dean, sowie Bunty Parkinson vom dortigen Archiv; der Hilfe durch Marjorie Lampe Meade und die Mitarbeiter des Marion E. Wade Center am Wheaton College, Illinois; der Bibliothek der Universität Cambridge; Richard Walduck dafür, daß er mir The Lost Rivers of London geliehen hat; Carolyn Caughey und Hope Dellon für ihre kompetente herausgeberische Beratung; sowie der Hilfe, die mir wie stets und in allem durch John Rowe Townsend zuteil wurde.
Ihr Throne, kaiserliche Mächte, Jugend
Des Himmels, ihr, des Äthers Tugenden!
Es wären diese Ehrentitel denn
Zu ändern nun, und unser neuer Rang
Fürsten der Hölle?
Throne, Gewalten, Mächte, Fürstentümer …
JOHN MILTON
1
In Frankreich, sagt’ ich, verstehn sie das Ding besser.
LAURENCE STERNE
«Nein», sagte Monsieur Théophile Daumier, «ich kann diese Engländer einfach nicht verstehen.»
«Niemand versteht sie», antwortete Mr. Paul Delagardie, «sie sich selbst am wenigsten.»
«Ich sehe, wie sie hin- und hereilen, ich beobachte sie, ich spreche mit ihnen – denn meines Erachtens ist es übrigens unwahr, daß sie einsilbig und unfreundlich sind – aber ihr Innenleben bleibt mir verschlossen. Sie sind unaufhörlich beschäftigt, aber ich kenne die Beweggründe für ihr unermüdliches Tun nicht. Es ist gar nicht ihre Reserviertheit, die mich kapitulieren läßt, denn oftmals sind sie überraschend redselig – das Problem ist, daß ich nicht weiß, wo ihre Redseligkeit aufhört und ihre Zurückhaltung anfängt. Man sagt, daß sie sich strikt an die Konventionen halten würden, und doch können sie eine Nonchalance unter Beweis stellen, die ihresgleichen sucht. Und wenn man sie darauf anspricht, scheinen sie keinerlei Theorie über das Leben zu haben, die man definieren könnte.»
«Sie haben völlig recht», sagte Mr. Delagardie. «Die Engländer haben eine Abneigung gegen Theorien. Aber es ist, eben darum, recht leicht, mit uns auszukommen. Unsere Konventionen sind rein äußerlich, man kann sie sich schnell zu eigen machen. Aber unsere Lebensphilosophie ist jeweils eine individuelle, und wir halten uns nicht für berufen, in die der anderen hineinzureden. Deshalb ist es bei uns auch erlaubt, in einem öffentlichen Park jegliche aufrührerische Meinung offen zu äußern – mit der einzigen Auflage, daß sich keiner so weit vergessen darf, die Zäune herauszureißen oder auf die Blumen zu treten.»
«Ich bitte um Verzeihung, ich hatte einen Moment lang vergessen, daß Sie selbst Engländer sind. Vom Äußeren her und auch von Ihrem Akzent gehen Sie ohne weiteres als Franzose durch.»
«Danke sehr», antwortete Mr. Delagardie. «Ich bin tatsächlich nur zu einem Achtel französischer Abstammung. Die anderen sieben Achtel sind englisch, und der Beweis dafür ist, daß ich Ihre Worte als Kompliment auffasse. Im Gegensatz zu Juden, Iren und Deutschen mögen es die Engländer, wenn man ihre Herkunft für noch gemischter und exotischer hält, als sie es in Wirklichkeit ist. Dadurch wird die romantische Saite im englischen Temperament zum Klingen gebracht. Sagen Sie einem Engländer, er sei reinrassig angelsächsisch und ohne jeglichen semitischen Einschlag, und er wird Sie auslachen; sagen Sie ihm, daß seine Ahnenreihe vor langer Zeit auch einmal französische, russische, chinesische oder sogar arabische oder Hindu-Anteile aufzuweisen hatte; dann wird er Ihnen höflich und mit Genugtuung zuhören. Je entfernter die Verwandtschaft, desto besser, versteht sich; das ist zum einen pittoresker und verschafft Ihnen zum anderen einen weniger zweifelhaften Ruf in der Gesellschaft.»
«Einen zweifelhaften Ruf? Aha! Sie geben also zu, daß Engländer alle Völker außer dem eigenen verachten?»
«Nur solange er noch nicht dazu gekommen ist, sie zu assimilieren. Was er verachtet, sind nicht so sehr andere Völker als vielmehr andere Kulturen. Er läßt sich nur ungern als dahergelaufenen Südländer bezeichnen; sollte er aber mit Glutaugen und dunklerem Teint ausgestattet sein, dann führt er diese Charakteristika mit Freuden auf einen Hidalgo zurück, den es in einem Wrack der spanischen Armada an die englische Küste verschlagen hat. Bei uns kommt alles aufs Gefühl und die Assoziationen an, die geweckt werden.»
«Ein merkwürdiges Volk!» fand Monsieur Daumier. «Und trotzdem ist der Nationaltypus unverkennbar. Man sieht jemanden und erkennt sofort, daß er Engländer ist – aber das ist auch schon alles, was man je über ihn erfahren wird. Nehmen Sie zum Beispiel das Paar am Tisch gegenüber. Er ist unzweifelhaft ein Engländer, einer aus der Schicht der wohlhabenden Müßiggänger. Er hat ein leicht militärisches Auftreten und ist sehr braun gebrannt – aber das liegt vielleicht nur an seiner Vorliebe für le sport. Wenn man ihn so anschaut, möchte man meinen, daß ihn außer der Fuchsjagd nichts im Leben interessiert – wenn man davon absieht, daß er in der Tat offensichtlich sehr angetan von seiner außerordentlich schönen Begleiterin ist. Aber wenn Sie mich fragen, er könnte Abgeordneter sein, Finanzier oder genausogut Bestsellerautor. Von seinem Gesicht läßt sich zumindest nichts ablesen.»
Mr. Delagardie warf einen Blick auf die in Rede stehenden Gäste.
«Ach, ja!» sagte er. «Erzählen Sie mir, was Sie mit ihm und der Frau an seiner Seite anfangen können. Sie haben recht: Sie ist ein hinreißendes Geschöpf. Ich hatte immer schon ein Faible für echte Rotblonde. Sie können oft sehr leidenschaftlich sein.»
«Leidenschaft, so glaube ich, steht da drüben im Moment auch zur Debatte», antwortete Monsieur Daumier. «So, wie ich das sehe, ist sie eine Geliebte und keine Ehefrau – oder, besser gesagt, denn sie ist ja offensichtlich verheiratet, zumindest nicht seine Frau. Wenn überhaupt eine Verallgemeinerung über die Engländer zulässig ist, dann die, daß sie ihre Ehefrauen als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Engländer verzichten darauf, die Blume der Leidenschaft mit ihrer Gartenschere zu pflegen. Sie lassen die Blume einfach wild wuchern, bis von ihr eines Tages nur noch gemäßigte Zuneigung übrig ist, die wohl ihre Früchte trägt und ein Produkt der Natur ist, aber ganz gewiß keine Zierde. Sie müssen sie nur einmal beobachten, wenn sie miteinander sprechen. Entweder sie hören ihren Ehefrauen überhaupt nicht zu, oder sie sind allenfalls mit einer intelligenten Höflichkeit bei der Sache, die man einer geschwätzigen Zufallsbekanntschaft zuteil werden läßt. Ce monsieur là-bas ist auch unaufmerksam, aber aus einem anderen Grund: Er ist von den persönlichen Reizen der Dame gefangen, und seine Gedanken sind auf künftige Freuden gerichtet. Er ist, wie man bei Ihnen sagt, über beide Ohren verliebt – und soweit ich das bisher beobachtet habe, kann ein Engländer diesen Zustand einfach nicht verbergen. Anders als wir Franzosen läßt er nicht jeder Frau schon aufgrund ihres Geschlechts gewissenhafte Aufmerksamkeit zukommen. Wenn er sich dazu hinreißen lassen sollte, so etwas wie Hingabe an den Tag zu legen, dann hat er immer besondere Gründe dafür. Ich wage die Hypothese, daß wir es hier mit zweien zu tun haben, die durchgebrannt sind, auf jeden Fall handelt es sich um ein Abenteuer; eine Affaire vielleicht, die er in London verheimlichen müßte. Hier, in unserem verruchten Paris, kann er sich ohne Scham gehen lassen.»
«Ich stimme Ihnen soweit zu», meinte Mr. Delagardie, «daß es sich hierbei wirklich nicht um das typische englische Ehepaar handelt. Und es stimmt auch, daß der Engländer, einmal auf dem Kontinent, die Konvention der englischen Reserviertheit fahrenläßt – Tatsache ist, daß das sogar ein Bestandteil ebendieser Konvention ist. Aber Sie sagen gar nichts über die Dame.»
«Sie ist auch verliebt, aber gleichzeitig ist sie sich des Opfers bewußt, daß sie gebracht hat. Sie macht ihm kein geringeres Angebot als ihre Kapitulation, und trotzdem versteht sie es, sich den Hof machen zu lassen. Denn schließlich wird derjenige, der am meisten aufs Spiel setzt, ihr Ja erringen. Wenn sie sich aber einmal hingibt, dann rückhaltlos. Der braungebrannte Gentleman ist wirklich zu beneiden.»
«Ihre Beobachtungen sind überaus interessant», erwiderte Mr. Delagardie. «Dies um so mehr, als sie weitgehend nicht zutreffen, wie ich zufälligerweise weiß. Aber wie Sie ganz richtig sagen, die Engländer können einen erstaunen. Was halten Sie denn zum Beispiel von dem so ganz anderen Paar in der Ecke gegenüber?»
«Der blonde Diplomat mit dem Monokel und die resolute Brünette im orangen Taft?»
«Genaugenommen ist er kein Diplomat, aber das ist der Mann, den ich meine.»
«Bitte», sagte Monsieur Daumier mit mehr Überzeugung in der Stimme, «da haben Sie das englische Ehepaar par excellence. Sie sind aus sehr gutem Stall, der Mann besonders, und sie geben dem ganzen Saal eine Lektion in Tischmanieren. Beim Bestellen zieht er sie zu Rate, gibt acht, daß sie auch bekommt, was sie wünscht, und bestellt sein eigenes Essen nach seinem Gusto. Wenn sie ihre Serviette fallen läßt, hebt er sie für sie auf. Wenn sie spricht, hört er zu und antwortet angemessen, doch immer mit einem unerschütterlichen Phlegma und fast ohne sie dabei anzusehen. Er ist der vollkommene Kavalier, und es ist ihm alles vollkommen gleichgültig, und dieser herzerweichenden Selbstbeherrschtheit setzt sie eine Kälte entgegen, die der seinen in nichts nachsteht. Sie kommen zweifellos gut miteinander aus, und schon aus Gewohnheit herrscht zwangsläufig sogar ein gewisses Einvernehmen, denn ihr Gespräch plätschert ohne große Pausen ruhig dahin. Denn wenn die Engländer jemanden nicht mögen, fangen sie selten an zu schreien: Sie verfallen in Schweigen. Diese beiden hier streiten sich weder in der Öffentlichkeit noch hinter verschlossenen Türen, da bin ich sicher. Sie sind schon so lange miteinander verheiratet, daß jedes leidenschaftliche Gefühl, das sie einmal füreinander empfunden haben mögen, längst abgestorben ist. Vielleicht war da aber auch nie allzu viel, denn schließlich sieht sie nicht gerade besonders gut aus, und er macht den Eindruck eines Mannes, der einen gewissen Wert auf Schönheit legt. Möglicherweise ist sie reich gewesen, und er hat sie wegen ihres Geldes geheiratet. Und mit einiger Sicherheit gönnt er sich seine Eskapaden, wie es ihm beliebt, und um der Kinder willen schickt sie sich in die Situation, solange seine Untreue nicht zum Stadtgespräch wird.»
Mr. Delagardie goß noch ein wenig Burgunder in beide Gläser, bevor er antwortete.
«Sie haben den Mann einen Diplomaten genannt», sagte er schließlich. «Und Sie haben den überzeugenden Beweis erbracht, daß er zumindest nicht seine ganze Lebensgeschichte offen auf seinem Gesicht herumträgt. Zufälligerweise kenne ich beide Paare einigermaßen gut und bin in der Lage, Sie in dem zu korrigieren, was die bloßen Tatsachen angeht.
Also, zum ersten Paar: Der Mann ist Laurence Harwell, der Sohn eines sehr vornehmen und reichen Anwalts der Krone, der vor ein paar Jahren starb und seinem Sohn ein sehr stattliches Vermögen hinterlassen hat. Obwohl er in der üblichen Landhaus- und Privatschulumgebung aufgewachsen ist, ist er kein übermäßig großer Anhänger des Sports im englischen Sinne. Den Großteil seiner Zeit verbringt er in London und versucht sich ein wenig in der Finanzierung von Theaterprojekten. Daß er etwas Farbe hat, kommt daher, daß er gerade aus Chamonix kommt, aber ich glaube, er wollte damit eher der Dame als sich selbst einen Gefallen tun. Diese, weit davon entfernt, seine Geliebte zu sein, ist wirklich und wahrhaftig seine Ehefrau, und sie hatten kürzlich ihren zweiten Hochzeitstag. Sie gehen recht in Ihrer Annahme, daß die beiden ganz außerordentlich verliebt ineinander sind, denn diese Heirat war eine extrem romantische Angelegenheit. Die Opfer, gleichwohl, hatte er zu bringen und nicht sie – will sagen, sofern man überhaupt von einem Opfer sprechen kann, wenn ein Mann eine ausgesuchte Schönheit als Ehefrau für sich gewinnt. Ihr Vater war in gewisse betrügerische Transaktionen verwickelt, die ihn von einem beträchtlichen Wohlstand in die Armut stürzten und einen kurzen Aufenthalt im Gefängnis zur Folge hatten. Rosamund, seine Tochter, war gezwungen, eine Stellung als Mannequin in einem vielbesuchten Modesalon anzunehmen, bis Harwell auf der Bildfläche erschien, um sie zu retten. Sie werden oft das romantischste – manche gehen so weit zu sagen, das einzige – verheiratete Liebespaar in London genannt. Sie haben freilich noch keine Kinder, daher rührt vielleicht der Umstand, daß die Blume der Leidenschaft noch nicht verwelkt ist. Wenn sie nicht zusammen sind, dann sind sie auch nicht glücklich – und das mag auch gut sein, da beide, wie ich glaube, einen Hang zur Eifersucht haben. Es versteht sich von selbst, daß sie zahlreiche Verehrer hat. Die kommen allerdings nicht recht zum Zuge, denn mit Ausnahme des einen lassen alle ihr amouröses Temperament kalt.»
«Ich muß mich wiederholen», sagte Monsieur Daumier, «Mr. Harwell ist zu beneiden. Die Geschichte ist in der Tat romantisch, aber anders, als ich angenommen hatte.»
«Und doch, im wesentlichen», fuhr Mr. Delagardie fort, «hatten Sie nicht völlig unrecht. Die Beziehung zwischen den beiden ist im Grunde die von Liebhaber und Geliebter und nicht die zwischen Ehemann und Ehefrau. Das andere Paar ist wohl geheimnisvoller und vielleicht sogar romantischer.
Der Mann ist gewiß von guter Herkunft, er ist der zweite Sohn des dahingeschiedenen Herzogs von Denver und, wie das Leben so spielt, mein Neffe. Er hat sich unter anderem auch in der Diplomatie versucht, aber das ist nicht sein Beruf. Wenn er denn überhaupt einen Beruf hat, so ist es die Kriminologie. Schönheit bedeutet ihm etwas bei altem Wein und alten Büchern, und zeitweise hat er sich als beachtlicher Connaisseur auf dem Gebiet der holden Weiblichkeit hervorgetan. Seine Frau, die da drüben mit ihm am Tisch sitzt, ist eine Schriftstellerin, die bislang für ihren Lebensunterhalt selbst aufkam. Vor ungefähr sechs Jahren wurde sie, zu einem gut Teil durch sein Eingreifen, vom Vorwurf freigesprochen, ihren Liebhaber ermordet zu haben. Bei meinem Neffen war es Liebe auf den ersten Blick: Seine Werbung um sie hat er geduldig, aber zielgerichtet gute fünf Jahre durchgehalten. Im letzten Oktober haben sie geheiratet und sind soeben erst aus den verlängerten Flitterwochen zurückgekehrt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Stand ihrer Beziehung momentan ist, da ich schon einige Wochen nichts mehr von ihnen gehört habe, und die Flitterwochen wurden durch einige unglückliche Vorkommnisse verkompliziert. Es hat einen Mord in ihrem Haus gegeben, und soweit ich weiß, hat der emotionale Aufruhr im Bemühen, den Täter der Justiz zuzuführen, eine erhebliche Störung verursacht. Mein Neffe hat es mit den Nerven und ist ein verklemmter Pedant, während meine Nichte, wie ich sie nach dieser Heirat nennen darf, ein Dickkopf voller Energie und Freiheitsdrang ist. Beide werden sie von einem wahrhaft diabolischen Stolz geritten. In Mayfair lauert man schon auf das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Versuchsanordnung einer ehelichen Verbindung.«
«Nähern sich denn alle Engländer», forschte Monsieur Daumier, «ihrer Auserwählten als Perseusgestalt?»
«Das würden sie wohl alle gern – aber glücklicherweise haben nicht alle die Gelegenheit dazu. Es ist eine Rolle, die man nur schwer ohne eine gehörige Portion Selbstverliebtheit durchhalten kann.»
In diesem Moment erhob sich der Mann mit dem Monokel auf eine Mitteilung des Kellners hin und kam den langgezogenen Speisesaal des Hotels herunter, anscheinend auf dem Weg zum Telefon. Er nickte Mr. Delagardie zur Begrüßung zu, ging aber weiter, sich sehr gerade haltend und mit dem flinken, leichtfüßigen Schritt eines guten Tänzers. Währenddessen ruhten die dunklen und zugegebenermaßen hübschen Augen seiner Frau mit einem eigenartig konzentrierten Ausdruck auf ihm – nicht unbedingt verwirrt oder ängstlich oder besorgt, auch wenn Monsieur Daumier alle drei Adjektive durch den Kopf gingen, um sofort wieder fallengelassen zu werden.
Er sagte: «Was die Gemahlin Ihres Neffen angeht, so habe ich mich getäuscht. Er ist ihr nicht gleichgültig. Aber mir scheint, sie ist sich seiner nicht ganz sicher.»
«Das», antwortete Mr. Delagardie, «mag wohl sein. Kein Mensch kann sich meines Neffen Peter je sicher sein. Aber ich denke, sie ist ihm auch nicht ganz gleichgültig. Wenn er mit ihr spricht, ohne sie dabei anzusehen, dann wahrscheinlich, weil er etwas zu verbergen hat – entweder Liebe oder Haß; ich habe schon das eine wie das andere beobachten können, wenn die Flitterwochen erst einmal vorüber waren.»
«Évidemment», mußte Monsieur Daumier zugeben. «Nach dem, was Sie erzählen, muß die Beziehung zwischen diesen zweien von höchst delikater Natur sein. Dies um so mehr, als beide nicht mehr ganz jung an Jahren sind.»
«Mein Neffe wird bald sechsundvierzig, und seine Frau ist Anfang Dreißig. Oh! Die Harwells haben uns bemerkt, ich glaube, sie kommen zu uns herüber. Ich kenne sie nicht allzu gut. Der alte Harwell war mit Sir Impey Biggs befreundet, der bei den Wimseys ein und aus geht, so daß ich den Sohn und seine Frau gelegentlich bei gesellschaftlichen Anlässen getroffen habe.»
Monsieur Théophile Daumier war hoch erfreut über die Gelegenheit, Rosamund Harwell aus der Nähe betrachten zu können. Sie war der Typ, den er ausgesprochen schätzte. Es war nicht nur das weich fließende Rotgold der Haare oder das flüssige Bernstein ihrer Augen, die leicht schräg unter die geschwungenen, fein gezeichneten Brauen gesetzt waren; auch war es nicht allein der volle rote Schwung der Lippen oder die Blässe der Haut, obwohl all das, für sich genommen, dazu beitrug. Das Gesicht war herzförmig, und der Körper, den man unter dem enganliegenden Kleid mehr als nur erahnen konnte, ließ ihn an die unverhüllten Reize einer Botticelli-Venus denken. Solche Eigenschaften würdigte Monsieur Daumier lediglich mit dem kalten Blick eines Kenners. Nein, es war ihre überwältigende Weiblichkeit, die sein Blut in Wallung brachte und ihm zu Kopf stieg wie das Bouquet eines edlen Weins. Er war sehr empfänglich für eine Ausstrahlung dieser Art und verblüfft, sie bei einer Engländerin vorzufinden, denn er hatte sich damit abgefunden, von den Engländerinnen entweder mit einer aggressiven Ungeschlechtlichkeit oder aber einer erstickenden mütterlichen Liebenswürdigkeit konfrontiert zu werden: das eine wie das andere bar jeder Anziehungskraft. Und auch die Stimme, mit der Mrs. Harwell den Gemeinplatz äußerte: «Sehr erfreut» – sie war warm, volltönend, melodisch, wie goldenes Glockengeläut, eine Stimme voller Verheißung.
Mr. Delagardie erkundigte sich, ob die Harwells einen längeren Aufenthalt in Paris planten.
«Wir bleiben vierzehn Tage», sagte Rosamund Harwell, «wir wollen ein bißchen einkaufen. Und uns amüsieren, natürlich.»
«War der Schnee gut in Chamonix?»
«Ja, der schon, aber so ein schreckliches Getümmel im ganzen Ort!»
Der Blick, mit dem sie ihren Mann bedachte, konnte ihn wohl aus jedem Getümmel herauslösen und mit ihr allein auf eine Insel der Verzückung tragen. Monsieur Daumier hatte den Eindruck, daß selbst dieser unspektakuläre Wortwechsel mit zwei Gentlemen fortgeschrittenen Alters in einem Speisesaal die Geduld von Laurence Harwell auf eine harte Probe stellte. Er schätzte den Gatten auf etwa dreißig und seine Frau mindestens fünf Jahre jünger. Mr. Delagardie zog die Unterhaltung durch ein paar weitere unwichtige Erkundigungen in die Länge – womöglich absichtsvoll, um seinem Freund die Möglichkeit zu geben, die romantischen Engländer aus der Nähe begutachten zu können. Sie wurden abgelenkt, als der Neffe von Mr. Delagardie, inzwischen vom Telefonieren zurückgekehrt, mit seiner Frau an ihren Tisch trat.
«Vous voilà, mes enfants», begrüßte Mr. Delagardie nachsichtig die beiden. «Ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Peter, ich glaube doch, du kennst Mrs. und Mr. Harwell?»
«Nur dem Namen nach.»
«Dann darf ich euch bekanntmachen. Mein Neffe, Lord Peter Wimsey, und meine Nichte Harriet. Und das ist mein Freund, Monsieur Daumier. Was für ein Zufall, daß wir alle im selben Hotel wohnen, ohne uns abgesprochen zu haben, wie Figuren aus einer Gesellschaftskomödie!»
«So ein großer Zufall nun auch wieder nicht», meinte Wimsey, «wenn du in Betracht ziehst, daß die Küche hier momentan die beste in Paris ist. Was die Komödie angeht, so fürchte ich, sie wird den dritten Akt nicht erreichen: Wir fahren morgen wieder nach London. Wir waren nur ein, zwei Tage auf einer Stippvisite hier – kleiner Tapetenwechsel, du verstehst.»
«Ja», sagte sein Onkel. «Ich habe in der Zeitung gelesen, daß die Hinrichtung jetzt stattgefunden hat. Die ganze Sache muß sehr aufreibend für euch beide gewesen sein.» Seine schlauen alten Augen wechselten schnell vom einen Gesicht zum anderen.
Wimsey antwortete in neutralem Ton: «Ja, sehr unerfreulich.»
Der ganze Mann war eigentlich neutral und farblos, dachte Monsieur Daumier: Haare, Teint und die flache, ausdruckslose Stimme mit der abgehackten Sprechweise des Privatschulabsolventen.
Wimsey wandte sich an Mrs. Harwell und sagte höflich: «Ohne Zweifel werden wir das Vergnügen haben, Sie bald in London wiederzusehen.»
«Ich hoffe es», erwiderte Mrs. Harwell.
Mr. Delagardie drehte sich zu seiner Nichte: «Also seid ihr am Audley Square anzutreffen, wenn ich zurückkomme, nehme ich an?»
Monsieur Daumier war ein wenig neugierig auf ihre Antwort. Im Lichte ihrer Vergangenheit mußte man das Gesicht dieser Frau doch interessant nennen: dunkel, resolut, zu entschieden für seinen Geschmack, was Gesichtszüge und Ausdruck anging, intelligent, mit einer Andeutung von Eigensinn um den Mund und die starken geraden Augenbrauen herum. Sie hatte etwas abseits gestanden, still und, wie er mit Anerkennung bemerkte, ohne albernes Getue. Er wartete begierig darauf, sie sprechen zu hören, obwohl er sonst die schrillen Kadenzen der gebildeten Engländerinnen nicht goutierte.
Als die Stimme dann erklang, war er überrascht, sie war dunkel und voll, mit einem Timbre, das Rosamund Harwells goldene Glöckchen wie eine Spieluhr klingen ließ.
«Ja, wir können uns jetzt hoffentlich in Ruhe einrichten. Ich habe das Haus noch gar nicht richtig gesehen, seit es fertig ist. Die Herzogin hat sich ganz reizend darum gekümmert. Es wird uns eine Freude sein, dir alles zu zeigen.»
«Meine Mutter war ganz in ihrem Element», erzählte Wimsey. «Eine Generation später geboren, wäre sie mit Sicherheit eine professionelle Innenarchitektin geworden und hätte als berufstätige Frau auf eigenen Füßen gestanden. Was in der Folge wiederum vermutlich die Existenz meiner eigenen Person verhindert hätte. Solche Zufälligkeiten in der Chronologie der Ereignisse halten die angeborene Eitelkeit ganz schön in Schach.»
«Wir sind auch ganz begeistert», sagte Mrs. Harwell. «Wir haben gerade eine neue Wohnung in Hyde House bezogen. Wenn wir wieder in London sind, geben wir gleich eine Party, nicht wahr, Darling?»
Ihr Lächeln umhüllte ihren Ehemann, um dann mit charmanter Freundlichkeit an Mr. Delagardie weitergegeben zu werden, der prompt erwiderte: «Ich darf das doch hoffentlich als Einladung verstehen? Hyde House? Ist das nicht der große neue Block in Park Lane? Ich habe gehört, die Ausstattung dort ist das reinste Wunder an Komfort.»
«Es ist absolut traumhaft», bestätigte Mrs. Harwell. «Wir sind hingerissen. Geräumige Zimmer, und stellen Sie sich vor, wir brauchen keine Küche – wir können im Restaurant im ersten Stock essen, oder wir lassen uns das Essen hochschicken. Nie wieder Ärger mit dem Personal, denn der ganze Service ist inklusive. Die Heizung ist elektrisch. Es ist wie im Hotel, nur daß wir unsere eigenen Möbel haben. Wir haben sehr viel aus Chrom und Glas und wunderschöne moderne Vorhänge, von Ben Nicholson, und ein paar Susie Cooper-Vasen. Die Hausverwaltung füllt sogar unseren Barschrank auf – nicht daß der sehr groß wäre, aber es ist ein ganz entzückendes Stück, Nußbaum, mit eingebautem Radioapparat und einem kleinen Bücherregal an der Seite.»
Monsieur Daumier sah Wimsey zum ersten Mal seiner Frau einen Blick zuwerfen. Wie sich herausstellte, waren seine Augen, wenn er sie einmal ganz aufmachte, von einem klaren Grau. Obwohl sich kein einziger Muskel im Gesicht Seiner Lordschaft bewegte, war sich der Beobachter eines stillen amüsierten Einverständnisses zwischen den beiden bewußt.
«Und bei allen Wunderwerken der Technik, die ihm zur Verfügung stehen könnten», kommentierte Mr. Delagardie, «läßt mein von allen guten Geistern verlassener Neffe sein unglückliches Weib in einem vorsintflutlichen und, wie ich stark annehme, von Ratten heimgesuchten georgianischen Herrenhaus wohnen, ganze fünf Stockwerke hoch, das noch nicht einmal einen Aufzug hat. Alles die reine Selbstsucht und eine schwere Herausforderung für Leute, die langsam auf die mittleren Jahre zugehen. Meine liebe Harriet, wenn du nicht eine Menge Alpinisten zu deinen Bekannten zählst, wird euch wohl außer extrem jungen und energiegeladenen Leuten überhaupt niemand besuchen.»
«Dann wirst du sicher der häufigste Gast in unserem Hause sein, Onkel Paul.»
«Ich danke dir, meine Liebe, doch meine Jugend, ach! zeigt sich wohl nur im Herzen.»
Laurence Harwell, dessen Ungeduld sichtlich zugenommen hatte, meldete sich nun auch zu Wort: «Darling, wenn wir uns jetzt nicht verabschieden, kommen wir noch zu spät.»
«Ja, natürlich. Es tut mir wirklich leid. Wir wollen uns das neue Stück im Grand Guignol ansehen. Ein haarsträubender Einakter über eine Frau, die ihren Geliebten umbringt.»
Monsieur Daumier hielt diese Ankündigung für unpassend.
Wimsey erwiderte unbeeindruckt: «Wir dagegen wollen unseren Verstand in der Comédie üben.»
«Und wir», sagte Mr. Delagardie und erhob sich von seinem Platz, «wir werden unsere Lebensgeister in den Folies-Bergère wecken. Du meinst sicher, in meinem Alter müßte ich es besser wissen.»
«Im Gegenteil, Onkel Pandarus, du weißt schon viel zuviel.»
Die Harwells belegten das erste Taxi, das in Reichweite kam, und fuhren in Richtung Boulevard de Clichy davon. Als die anderen vier noch einige Minuten auf der Eingangstreppe des Hotels warteten, hörte Monsieur Daumier, wie Lady Peter zu ihrem Gatten bemerkte: «Ich habe noch nie jemanden mit so viel Liebreiz wie Mrs. Harwell getroffen, glaube ich.»
Worauf er wissend erwiderte: «Nein? Ich schon. Aber höchstens zweimal.»
Eine Antwort, wie Monsieur Daumier fand, die zu allerlei Mutmaßungen Anlaß geben sollte.
«Natürlich», sagte Peter mit einem Anflug von Gereiztheit, «müssen wir Onkel Pandarus über den Weg laufen.»
«Ich mag ihn», meinte Harriet.
«Ich auch – aber nicht, wenn ich mir vorkomme wie die Larve einer Köcherfliege, die aus ihrem Gehäuse gezerrt wird. Er hat Augen wie Nadeln, das ganze Abendessen über habe ich gemerkt, wie sie uns durchbohrt haben.»
«Tief können sie bei dir nicht gekommen sein, du warst der formvollendete Granitblock.»
«Das glaube ich gerne. Aber weswegen sollt’ ein Mann mit warmem Blut erstarr’n unter dem Blick der Großahns zu Alabaster, nur weil der Onkel seine Nase überall hineinstecken muß? Aber egal. Mit dir kann ich frei atmen und die Überreste meines Verstands darauf verwenden, mein Gehäuse wiederherzustellen.»
«Nein, Peter.»
«Nein? Harriet, du hast keine Ahnung, wie nackt sich so ein armer Wurm ohne Hülse fühlt … Worüber lachst du?»
«Ich muß an ein eigenartiges Kirchenlied denken, in dem es heißt: ‹Ein schwacher Wurm, von Angst erfüllt, an deine Brust ich flieh.›»
«Nicht zu fassen. Aber komm, gib mir deine Hand. Schlangen am Busen nähren ist töricht, Würmer dagegen göttlich … Später dann, Aphrodite – merde! Ich vergesse immer wieder, daß ich ein verheirateter Mann bin und du meine Ehefrau, die ich ins Theater führe. Also schön, meine Liebe, und was hältst du von Paris?»
«Notre-Dame ist prachtvoll, und die Geschäfte sind teuer und sehr edel, aber die Taxis fahren viel zu schnell.»
«Ich bin geneigt, dir hierin zuzustimmen», sagte Seine Lordschaft, als der Wagen unerwartet rasch vor den Türen der Comédie Française hielt.
«Hat es dir gefallen, Darling?»
«Ich fand es wunderbar. Und du?»
«Ich weiß nicht», sagte Harwell unbehaglich. «Ganz schön gewalttätig, findest du nicht? Es ist natürlich der Schockeffekt, auf den das Ganze hin angelegt ist, aber es sollte schließlich Grenzen geben. Diese Würgeszene …»
«Schrecklich aufregend, nicht wahr?»
«Ja, wie sie einen fesseln können, das wissen sie genau. Aber trotzdem finde ich diese Form der Spannung irgendwie grausam.» Seine Gedanken waren einen Moment lang bei dem Londoner Intendanten, der auf seine Unterstützung hoffte, sofern sich ein passendes Stück finden ließ. «Für das West End müßte man es wohl ein wenig überarbeiten. Es ist intelligent und unterhaltsam, aber es ist wirklich grausam.»
«Leidenschaft ist nun einmal grausam, Laurence.»
«Bei Gott, mir muß das keiner sagen.»
Sie bewegte sich leicht im Halbdunkel, und der Duft von zerdrückten Blüten stieg ihm in die Nase. Als sie ihm den Kopf zuwandte, dessen Silhouette sich gegen die vorbeifliegenden Lichter des Boulevards abzeichnete, als sie sich mit ihrem Körperan den seinen preßte, da wurde ihm klar, daß das gottverdammte Theaterstück ihm aus irgendeinem Grund die Trumpfkarte zugespielt hatte. Das war es, was einen verrückt machte, was einen in diesen Rausch versetzte, was sich einem immer wieder entzog: Man konnte nie wissen, woran es lag. «Rosamund! Was hast du gesagt, Darling?»
«Ich habe gefragt, ob sie es nicht auch wert ist.»
«Wert ist … ?»
Mr. Paul Delagardie deponierte vorsichtig sein Gebiß in einem Glas mit Desinfektionslösung und summte eine kleine Melodie vor sich hin. Also wirklich, es gab keinerlei Anlaß für so eine Äußerung wie die von Maudricourt – er hatte den alten Narren im Foyer getroffen –, daß die Beine auch nicht mehr das seien, was sie früher einmal waren. Beine – und Brüste, wo wir schon dabei sind – hatten sich im Gegenteil seit seiner Jugendzeit sehr zum Vorteil verändert; zumindest war jetzt wesentlich mehr davon zu sehen. Maudricourt wurde langsam senil; die natürliche Folge, wenn man in seinen Sechzigern häuslich wurde und die Frauen aufgab. So etwas mußte ja zwangsläufig zu Drüsenatrophie und Arterienverkalkung führen. Mr. Delagardie zog den Gürtel seines Morgenrocks fester und faßte den Entschluß, auf jeden Fall morgen bei Joséphine vorbeizuschauen. Sie war ein braves Mädchen und, so glaubte er, hatte ihn tatsächlich gern.
Er zog die Vorhänge zurück und blickte nach hinten hinaus in den Garten dieses großartigen Hotels. In vielen Fenstern brannte noch Licht, bei anderen war es bereits gelöscht. Während er hinsah, verschwand sogar noch eins, dann zwei und drei dieser leuchtenden Rechtecke in der Dunkelheit, wenn die Gäste, abrupt in Diskretion gehüllt, ihren Kissen zustrebten, um Trost zu suchen und gegebenenfalls auch zu finden. Oben am Januarhimmel flammten kalte Feuer, die keiner löschen würde. Mr. Delagar die fühlte sich so jung und beschwingt, daß er die Balkontür öffnete und sich hinauswagte, um einen besseren Blick auf Kassiopeias Stuhl zu haben, mit dem er eine sentimentale Erinnerung der angenehmen Sorte verband. Hieß sie Phyllis, oder war es Suzanne gewesen? Beim Namen war er sich nicht sicher, doch an das Ereignis erinnerte er sich nur zu gut. Und das Sternbild hatte mit den Jahren keineswegs etwas von seinem Glanz eingebüßt, ebensowenig wie die vom alten Maudricourt verleumdeten Beine.
Von einem der dunklen Fenster über Eck wehte das leise Lachen einer Frau herüber. Es plätscherte sanft die Tonleiter hinunter und endete in einem schnellen, erwartungsvollen Seufzer. Als Gentleman trat Mr. Delagardie eilig vom Balkon und schloß die Tür. Außerdem wollte er auch gar nicht mehr hören.
Es war schon einige Zeit her, daß sie so in seinen Armen gelacht hatten. Phyllis, Suzanne: was mochte aus ihnen geworden sein? Joséphine, soviel stand fest, war ein braves Mädchen, sie wußte, was sich gehörte, und war ihm ergeben. Aber ein scharfes rheumatisches Reißen in den Gelenken erinnerte ihn daran, wie unklug es für ältere Herren war, draußen auf dem Balkon zu stehen und den Winterhimmel zu bewundern. Glücklicherweise war sein ausgezeichneter Diener immer sehr gewissenhaft, was die Wärmflasche anging.
Auszug aus dem Tagebuch von Honoria Lucasta, Herzoginwitwe von Denver:
6. Januar
War noch mal rasch am Audley Square, um nachzusehen, ob im Haushalt alles seinen Gang geht, solange Peter und Harriet in Paris sind. Die Ärmsten hatten kaum Zeit, es sich selbst anzusehen, obwohl mir Harriet sehr lieb gedankt hat und meinte, es gefalle ihr. Hat dann auch noch gesagt: «Alles sehr ungewohnt für mich», was vermutlich stimmt. Habe offensichtlich wenig Vorstellung davon, wie eine Arzttochter sich einrichtet oder diese Künstlertypen, in deren Kreisen sie verkehrt hat. Blödsinnigerweise in diese Richtung laut gedacht, als Helen mich abgeholt hat, um im Kino den neuen Film mit Greta Garbo zu sehen. Helen hat gesagt, sie würde meinen, «verwahrlost» sei das richtige Wort, aber das ist ihr üblicher Unsinn. Greta Garbo ist eine junge Frau mit Klasse, und Harriet kann alles so verändern, wie sie es haben will, wenn sie erst mal drin wohnt. Habe versprochen, am Freitag die Delagardie-Vettern für eine Woche in Dorset zu besuchen, und verpasse deswegen die Dinnerparty bei Helen, wo Harriet ihren ersten Auftritt in London hat. Hoffe, sie kommt ohne meine Schützenhilfe aus – also, Harriet natürlich. Helen braucht weiß Gott nicht noch fremde Reserven zu mobilisieren, eher schon das Gegenteil davon. Demobilisierung? Immobilisation? Muß unbedingt an meinem Wortschatz arbeiten.
2
Eigenartig, wie ein gutes Essen bei festlicher Bewirtung alle wieder versöhnt.
SAMUEL PEPYS
Don’t you know
I promised, if you’d watch a dinner out, We’d see truth dawn together?
ROBERT BROWNING
Helen, Herzogin von Denver, war eine in der Ausübung ihrer gesellschaftlichen Pflichten sehr gewissenhafte Frau. Wie wenig sie auch ihren Schwager und seine Braut schätzen mochte, es war ihre Pflicht, ihnen zu Ehren so rasch wie möglich nach den Flitterwochen ein Dinner zu veranstalten.Dies hatte sich als keineswegs einfache Aufgabe erwiesen. Die Wimseys hatten sich (was für sie nur typisch war) in eine vulgäre Morduntersuchung hineinziehen lassen, und das gleich am Tag nach ihrer übereilten, heimlichen und insgesamt völlig verdrehten Hochzeit. Danach waren sie auf den Kontinent gefahren. Statt nach London zurückzukehren, hatten sie sich auf dem Land verkrochen und waren nur einmal aus der Versenkung aufgetaucht, um vor Gericht gegen den Mörder auszusagen. Danach dann hatten sie es vorgezogen, zu bleiben, wo sie waren, bis die Hinrichtung vorbei war, und in dieser Zeit hatte Peter dem Vernehmen nach unter Depressionen gelitten. Das war sein Lieblingstrick, wenn ein «Fall» abgeschlossen war. Warum sich jemand das Los eines gewöhnlichen Verbrechers so nahegehen lassen sollte, war der Herzogin unbegreiflich. Wenn man fürs Henken nichts übrig hatte, sollte man sich nicht in die Arbeit der Polizei einmischen. Die ganze Angelegenheit war nichts weiter als ein Akt des Exhibitionismus, dem man mit der gebührenden gesunden Strenge begegnen sollte. Die Herzogin machte sich über das Hinrichtungsdatum kundig, ließ für den Freitag der darauffolgenden Woche Einladungen ergehen und schrieb an Lady Peter Wimsey einen Brief, in dem das Wesentliche nur zwischen den formell gehaltenen Zeilen zu lesen war: «Nichtbefolgen auf eigene Gefahr».
Diese Unnachgiebigkeit hatte sich ausgezahlt. Die Einladung war angenommen worden. Welche Mittel Harriet Wimsey eingesetzt hatte, um ihren Gatten zu überzeugen, wußte die Herzogin nicht; sie legte auch keinen Wert darauf, es zu erfahren. Sie bemerkte dem Herzog gegenüber lediglich: «Ich wußte, das würde bei ihr ziehen. Diese Frau wird sich die erste Möglichkeit zur Aufwertung ihrer Reputation doch nicht entgehen lassen! Wenn jemand nach oben will, dann die.»
Der Herzog grummelte nur. Er hatte seinen Bruder gern und war durchaus bereit, auch seine Schwägerin zu mögen, wenn man es ihm nur erlaubte. Seiner Meinung nach war bei beiden eine kleine Schraube locker; aber da es den Anschein machte, daß der eine mit den Macken der anderen ganz gut zurechtkam – warum nicht? In den letzten zwanzig Jahren hatte er die Hoffnung allmählich aufgegeben, daß Peter je heiraten würde, und ihn nun in ein geregeltes Leben eintreten zu sehen, erfüllte ihn mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Schließlich mußte er sich offen eingestehen, daß sein einziger Sohn, der zu halsbrecherischen Autofahrten neigte, der gesetzliche Erbe war, und wenn der ausfiel, stand nur noch Peters hypothetische Linie zwischen dem Titel und einem verkalkten Vetter dritten Grades, der an der Riviera lebte. Denn es gab nur eine Leidenschaft, die die harmlose und eher dumpfe Existenz des Herzogs dauerhaft beherrschte: den Familienbesitz beisammenzuhalten, allen ungeheuerlichen Zumutungen wie Grundstückssteuer, Erbschaftssteuer und dem Steuerzuschlag zum Trotz. Er war sich bitter der Tatsache bewußt, daß sein eigener Sohn diese Leidenschaft nicht teilte. Wenn er an seinem Schreibtisch saß und mit den Büchern und Berichten seines Verwalters kämpfte, wurde er manchmal von entsetzlichen Zukunftsvisionen heimgesucht: er selbst tot, der Fideikommiß gebrochen, das Gut zerstückelt, das Herrenhaus an einen Filmmagnaten verkauft. Wenn man Saint-George nur begreiflich machen könnte – man mußte es ihm irgendwie begreiflich machen … Und darauf folgte stets derselbe Gedanke, beunruhigend und sonderbar illoyal: Peter ist ein schräger Vogel, aber ihm könnte ich eher vertrauen. Diesen Gedanken verscheuchte er dann immer mit einem Grummeln und fing an, einen aufgebrachten Brief an seinen Sohn in Oxford zu schreiben, in dem er sich über die Schulden beklagte, die dieser machte, den Umgang, den er pflegte, und die Seltenheit seiner Besuche auf dem Familiensitz.
So traf nun also die Herzogin Vorbereitungen für eine Dinnerparty in Carlton House Terrace, und der Herzog schrieb an Lord Saint-George, der bei Freunden in Shropshire weilte, daß er den Anstand zeigen müsse, seinen Onkel und seine Tante zu empfangen, wenn sie von ihrer Reise zurückkehrten, und daß es keinen Zweck habe, den Trimesterbeginn als Ausrede für sein Fernbleiben vorzuschieben. Er könne sehr gut am nächsten Morgen nach Oxford zurückfahren.
«Bist du bereit, dich der Familie zu stellen?» fragte Lord Peter Wimsey seine Frau. Mit der goldumrandeten Einladung in der Hand sah er sie über die lange Frühstückstafel hinweg an.
«Ich bin zu allem bereit», sagte Harriet munter. «Außerdem muß es ja irgendwann passieren, oder?»
«Es spricht einiges dafür, daß wir das hinter uns bringen», gab Seine Lordschaft zu bedenken, «solange wir noch nebeneinander sitzen können.»
«Ich dachte, Eheleute werden grundsätzlich auseinander gesetzt», sagte Harriet.
«Nein, die ersten sechs Monate nach der Hochzeit dürfen wir noch zusammensitzen.»
«Dürfen wir auch unter dem Tisch Händchen halten?»
«Das wohl eher nicht», antwortete Peter. «Es sei denn, das Schiff geht gerade unter. Aber wir dürfen uns beim Menü insgesamt einen Gang lang miteinander unterhalten.»
«Legt das Protokoll auch fest, bei welchem Gang?» fragte Harriet.
«Nicht daß ich wüßte. Nimmst du mich als Hors d’œuvre, als Suppe, Fischgang, Hauptgericht, Pastete, Käse oder Dessert?»
«Als wohlverdientes Dessert, Mylord», sagte Harriet würdevoll.
Wenn die Gäste der Herzogin samt und sonders entweder ganz oben auf der Skala des gesellschaftlichen Status standen oder ausgesprochen en vogue waren oder sogar beides zusammen, so kann dieser Umstand nicht auf die Absicht der Gastgeberin zurückgeführt werden, die Braut zu kompromittieren. Eine solche hochkarätige Versammlung war sie Peters gesellschaftlicher Position schuldig. Die Herzogin hoffte aufrichtig, daß sich «diese Frau» gut aufführen würde. Es war eine höchst unpassende Verbindung, aber man mußte eben gute Miene zum bösen Spiel machen. Und wenn sich aufgrund der geplanten Tischordnung ein oder zwei Gäste in trostloser Nachbarschaft plaziert sehen würden, so ließ sich daran nichts ändern. Die Rangordnung mußte beachtet werden, die Brautleute hatten ihre vorgeschriebenen Plätze, und die übrigen Eheleute waren getrennt zu setzen. Man konnte nun einmal nicht alles haben im Leben, und damit hatten sich die Leute abzufinden. Dennoch machte der Herzog ein säuerliches Gesicht.
«Hättest du nicht jemand Lebhafteren als ausgerechnet den alten Croppingford gegenüber von Harriet hinsetzen können? Der kann doch über nichts anderes reden als Pferde und die Jagd. Gib ihr doch den jungen Drummond-Taber, der kann über Bücher und solches Zeug schwafeln und mir zur Not aus der Klemme helfen.»
«Kommt nicht in Frage», gab die Herzogin zurück. «Es ist Harriets Abend, und Croppingford muß bei ihr sitzen. Charlie Grummidge geht nicht, der muß mich zu Tisch führen.»
«Jerry neben Marjorie Grummidge? Der wird bestimmt frech werden.»
«Als Sohn des Hauses wird Jerry sich wohl einmal höflich gegenüber den Freunden seiner Mutter zeigen können.»
«Hm», machte der Herzog, der die Marquise von Grummidge aufs herzlichste verabscheute, was ebenso warm erwidert wurde.
«Auf der anderen Seite sitzt Mrs. Drummond-Taber neben Jerry, und die ist sehr attraktiv und charmant.»
«Sie ist eine alte Langweilerin.»
«Er kann genug für sie beide reden. Und zu Peter habe ich Belinda Croppingford gesetzt. Sie ist recht lebhaft.»
«Er haßt Frauen mit grünen Fingernägeln», wandte der Herzog ein. Die zweite Heirat des Earl von Croppingford hatte Freunde und Familie in Aufruhr versetzt. Aber er war ein Vetter der Herzogin mütterlicherseits, und getreu ihren Prinzipien ließ sie nichts auf ihn kommen.
«Sie ist die bestaussehende Frau in London. Zumindest früher wußte Peter gutes Aussehen zu schätzen.»
Dem Herzog schoß der Gedanke durch den Kopf, hier sei eine Verschwörung im Gange, Peter spüren zu lassen, was er verpaßt hatte. Aber er sagte nur milde: «War es wirklich nötig, Amaranth Sylvester-Quicke einzuladen? Sie ist Peter gegenüber ein bißchen sehr deutlich geworden auf der Jagd vor zwei Jahren.»
«Aber in keiner Weise!» entgegnete die Herzogin scharf und fügte dann etwas widersprüchlich hinzu: «Das ist schon lange her. Ich muß ehrlich sagen, ich finde es schade, daß er nicht so gescheit war, sie zu heiraten, wenn er schon unbedingt jemanden heiraten mußte. Das wäre erheblich passender gewesen. Aber zu behaupten, sie sei ihm gegenüber ein bißchen sehr deutlich geworden, das ist absurd. Außerdem ist sie die Nichte von Lady Stoate, und sie wohnt bei ihr. Wir können schlecht Lady Stoate einladen und sie nicht. Und Lady Stoate muß kommen, damit sie diesen Chapparelle mitbringen kann.»
«Was der hier soll, verstehe ich überhaupt nicht, wenn du schon davon anfängst. Der ist doch Maler oder irgend so etwas, ja? Was hat der auf einer Familienfeier zu suchen?»
«Ich begreife dich wirklich nicht», sagte die Herzogin. «Erst beklagst du dich, daß wir mit niemandem aufwarten können, der Harriet mit Büchern und Kunst und all solchen Dingen die Bälle zuspielt, und dann hast du etwas gegen Gaston Chapparelle. Ich für meinen Teil lege auf diese Art von Leuten überhaupt keinen Wert, wie du weißt, aber im Moment lassen sich einfach alle von ihm malen, und es heißt, seine Bilder werden im Kurs steigen.»
«Ach, jetzt verstehe ich», sagte der Herzog. Offenbar hatte die Herzogin vor, sich den richtigen Künstler für ein paar Ergänzungen zur hauseigenen Portraitgalerie zu sichern. Saint-George war jetzt an der Reihe, natürlich, und im nächsten Jahr vermutlich ihre Tochter Winifred. Die Herzogin hatte definitiv keinen Geschmack, aber einen hervorragenden Geschäftssinn. Frühzeitig kaufen, das war ihre Devise, bevor die Preise hochgingen – und für eine Einladung zum Dinner und die Förderung der Künste konnte man ja wohl mit einem angemessenen Rabatt rechnen.
«Er führt Mrs. Drummond-Taber zu Tisch», fuhr die Herzogin fort. «Falls er irgend etwas Absonderliches sagt, ist sie die letzte, die das stört. Zweifelsohne hat Henry als Verleger sie mit diesem eigenartigen Künstlervolk vertraut gemacht. Und Belinda Croppingford wird es womöglich noch gefallen. Er hat also rechts und links eine attraktive Frau neben sich sitzen und gegenüber dazu noch Amaranth Sylvester-Quicke. Ich sehe wirklich nicht, was daran falsch sein soll.»
Dem Herzog wurde klar, daß seine Gattin mit dieser «Plazierung» einiger Portraits um ihn herum bereits Schritte unternommen hatte, den Künstler auf seine Willfährigkeit festzunageln. Er fand sich damit ab, wie gewöhnlich. Und Lord Saint-George, der – wenn er es wirklich darauf anlegte – seine Mutter zu so gut wie allem herumkriegen konnte, sah sich unversehens in einer Position, aus der heraus es nichts zu diskutieren gab. Am Morgen vor der Dinnerparty kam seinem Vater nämlich etwas zu Gehör, das einen so langen, lauten und wütenden Krach verursachte, daß er selbst für die Annalen der Wimseys eine denkwürdige Begebenheit darstellte.
«Wie ich deinem Onkel heute ins Gesicht sehen soll, weiß ich nicht», keuchte der Herzog wütend. «Jeder halbe Penny wird zurückbezahlt und von deinem Unterhaltsgeld abgezogen. Und wehe, ich höre je wieder solche Geschichten …»
Und so kam es, daß der Herzog, als der junge Mann seinem Widerwillen Ausdruck verlieh, der Tischherr von Lady Grummidge zu sein, sich mit der geräuschvollen Plötzlichkeit eines krachenden Donners auf die Seite seiner Gattin schlug und wetterte: «Du tust, was man dir sagt!», womit er die Angelegenheit ein für allemal entschied.
«Ich hoffe bloß», murmelte die Herzogin, «Peter kommt nicht zu spät. Das sähe ihm ähnlich.»
Sie wußte genau, daß ihm das ganz und gar nicht ähnlich sähe: Er war sowohl vom Naturell her wie aus Höflichkeit ein pünktlicher Mensch. Freilich sah es ihm ähnlich, als letzter einzutreffen und so den Zeitpunkt seines Auftritts auf den dramatisch wirkungsvollsten Moment festzusetzen. Die anderen Gäste hatten ihm in die Hände gearbeitet, indem sie selbst ein außerordentlich pünktliches Erscheinen an den Tag gelegt hatten, als ob sie einmütig beschlossen hätten, kein Quentchen von der gesellschaftlichen Sensation zu versäumen, die sich hier angekündigt hatte. Die Wimseys waren erst am Nachmittag zuvor aus Paris zurückgekehrt, bisher hatte sie noch niemand zu Gesicht bekommen. Der Skandal um den Gerichtsprozeß hatte die Neugier angefacht und auch die Verkaufszahlen der jungvermählten Schriftstellerin in die Höhe getrieben, so daß der berüchtigte Name Harriet Vane, auf grelle grün-orangefarbene Buchumschläge gedruckt, die Augen ihrer Schwiegerverwandtschaft an jedem Bücherstand und jeder Buchauslage beleidigte. Diesen Umstand schien der Ehrenwerte Henry Drummond-Taber als einen Anlaß zur Gratulation anzusehen. Er war Teilhaber im Verlag Bonne and Newte geworden, obwohl er Sohn eines Earls und von unangreifbarer gesellschaftlicher Reputation war. Die Herzogin, die plötzlich ein wirtschaftliches Interesse unter seinem angenehmen Plauderton witterte, fragte sich, ob es nicht womöglich ein Fehler gewesen war, ihn nach Carlton House Terrace einzuladen. Es war eine Sache, ausländische Künstler, die in Mode waren, zu protegieren; eine ganz andere, den Verkauf von Kriminalromanen zu fördern.
Mit einem huldvollen Lächeln sagte sie: «Als verheiratete Frau wird Harriet die Schreiberei natürlich gar nicht mehr nötig haben. Und ihre Zeit wird ja ohnehin sehr in Anspruch genommen sein.»
Mr. Drummond-Taber seufzte. «Unsere Schriftstellerinnen sollten eine Strafklausel in ihren Verträgen haben, die sie vom Heiraten abhält», war sein ehrlicher Kommentar. «Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben.»
In der Zwischenzeit hatte die verwitwete Lady Stoate, die wie eine verblaßte Fotografie von Queen Victoria aussah und eine der neugierigsten und aufdringlichsten alten Frauen in London war, Gaston Chapparelle bei der wenig begeisterten Lady Grummidge abgeladen und bombardierte nun ihren Gastgeber mit allerlei höchst überflüssigen Fragen über «den Mord». Der Herzog stritt beharrlich jede Kenntnis von Interna ab und behielt mit einem unguten Gefühl seinen Sohn im Auge, der seine Pflichten den Respektspersonen und den älteren Gästen gegenüber vernachlässigte und sich an Amaranth Sylvester-Quicke gehängt hatte. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, sparte er in dieser Unterhaltung weder an Gemeinheiten noch an Taktlosigkeiten. Lord Grummidge und Lord Croppingford hatten sich zusammengefunden, um die Probleme der Kanalisation auf Landgütern zu diskutieren.
Lady Grummidge befreite sich aus den Fängen von Gaston Chapparelle, warf im Vorübergehen einen abschätzigen Blick auf das giftgrüne Kleid von Lady Croppingford und wandte sich lautstark an die Herzogin: «Es tut mir leid, meine liebe Helen, ich habe mich nicht so farbenprächtig zu diesem feierlichen Anlaß herausgeputzt, aber Feststimmung scheint mir angesichts der erschütternden Neuigkeiten aus Sandringham auch kaum angemessen zu sein.»
In diesem Moment meldete der Lakai: «Lord und Lady Peter Wimsey». So wurde das Paar, zwei Schiffen eines Flottenverbands gleich, vom Stapel gelassen und machte sich auf die nicht enden wollende Reise den langgezogenen Salon hinauf, während es vom Hafen her – dem Kamin – dem ständigen Beschuß streng forschender Blicke ausgesetzt war.
Gaston Chapparelle, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdiente, in anderer Leute Gesichter zu lesen, und darüber hinaus durch den Klatsch von Lady Stoate gut gerüstet war, warf nur einen Blick auf das Schauspiel und dachte: «Oh, oh! Man trotzt der Obrigkeit, ganz klar. Erstaunlich. Das wird Madame la Duchesse gar nicht schmecken. Das Kleid ganz exquisit, vollendeter Geschmack, drei unvergleichliche Rubine. Wie soll man sie beschreiben? Ist sie hübsch? Keine Spur, aber mein Gott! Was für eine Erscheinung! Welche Charakterstärke! Sie wird ihre Sache schon gut machen. Aber der Schlüssel zu ihrem Geheimnis ist der Mann. Il est formidable, mon Dieu, der weiße Minnefalke …»
Und als man sich reihum begrüßte, fügte er bei sich hinzu: «Na, das wird ein Riesenspaß.»
Der Herzog begegnete der neuen Lady Peter Wimsey mit einiger Besorgnis. Natürlich hatten sie sich schon vorher getroffen, in der Verlobungszeit, aber immer war jemand anderes dabei gewesen – seine Frau, Peter, die Herzoginwitwe von Denver –, und die waren für ihn stets in die Bresche gesprungen, was die Konversation anging. Die nächsten fünf Minuten oder mehr war er jedoch auf sich allein gestellt und mußte zusehen, wie er mit ihr zu Rande kam. Es war ihm überaus bewußt, daß schriftstellernde Oxford-Absolventinnen so gar nicht sein Metier waren. Er wagte vorsichtig einen Anfang: «Na, alles in Ordnung bei euch?»
«Alles bestens, ich danke dir. Es war wunderschön in Paris. Und das Haus ist einfach perfekt. Oh, und jetzt habe ich ja auch deine Gobelins an Ort und Stelle hängen sehen, und ich muß mich noch einmal richtig bei dir bedanken. Sie passen ganz großartig dort hin, und sie sind wirklich wunderschön.»
«Freut mich, wenn sie euch gefallen», sagte der Herzog. Er konnte sich nicht im mindesten darauf besinnen, wie die Gobelins aussahen, obwohl er noch eine schemenhafte Erinnerung hatte, daß seine tatendurstige Mutter sie als passendes und wertvolles Hochzeitsgeschenk mit interessantem Familienbezug ausgewählt hatte. Da gab es etwas, von dem er meinte, es ansprechen zu müssen, obwohl er nicht recht wußte, wie.
«War sicher nicht so einfach, die letzte Zeit, mit dem Mord und so. Unschöne Sache.»
«Ja, es war wirklich ein unerfreuliches Erlebnis. Aber es ließ sich eben nicht verhindern. Wir müssen versuchen, darüber hinwegzukommen.»
«Ganz recht», sagte der Herzog. Er ließ unbehaglich seinen Blick über die versammelte Gesellschaft schweifen und fügte, ohne darüber nachzudenken, hinzu: «Sie werden keine Ruhe geben und dumme Fragen stellen. Alles Klatschbasen. Gar nicht drauf achten.» Seine Schwägerin warf ihm ein dankbares Lächeln zu. Mit gedämpfter Stimme fragte er: «Wie wird Peter damit fertig?»
«Es war eine schlimme Zeit für ihn, aber ich glaube, jetzt ist er über den Berg.»
«Gut. Kümmert er sich ordentlich um dich?»
«Perfekt.»
Das klang einigermaßen beruhigend. Der Herzog besah sich seine Schwägerin etwas aufmerksamer. Ihm dämmerte, daß das, was da neben ihm saß – Grips hin, Grips her –, sich in Form und Erscheinung nicht wesentlich von anderen Frauen unterschied. Er sagte aufrichtig: «Das freut mich. Freut mich sehr.»
Harriet bemerkte die aufrichtige Sorge, die ihm ins Gesicht geschrieben war. «Es wird alles gut, Gerald. Ganz bestimmt.»
Der Herzog war überrascht, und es fiel ihm keine andere Antwort ein als: «Sehr schön.» Ihm schien, sie stünden nun auf recht vertrautem Fuß. Er ließ sich ganz in dieses Gefühl fallen und preschte ohne Rücksicht auf Verluste vor: «Ich habe immer gesagt, sie sollen Peter in Ruhe lassen. Der Junge ist alt genug, zu wissen, was er will.»
Nachdem er damit die Familie dem Feind auf Gedeih und Verderb ausgeliefert hatte, war es ihm auf einmal peinlich, und er verstummte schlagartig.
«Danke dir. Ich werde zusehen, daß er es auch bekommt.»
Die Meldung, es sei angerichtet, bewahrte ihn vor weiteren Entblößungen und ließ ihn statt dessen bei Tisch in die Fänge der erwartungsvollen Lady Grummidge geraten.
Was für ein Unsinn, dachte die Herzogin, die mit einem halben Ohr Grummidges Ausführungen über sanitäre Anlagen würdigte, was für ein Unsinn, anzunehmen, daß Peter Lady Croppingford nicht ausstehen konnte, er war schließlich damit beschäftigt, sie zu kleinen Lachkaskaden hinzureißen – gewiß eine Leistung, da man sich noch im Suppenstadium der Veranstaltung befand. Tatsächlich aber führte Lady Croppingford einen Sturmangriff gegen ihren Nachbarn, wobei sie sich dessen wunde Punkte gnadenlos zunutze machte, und er wich ihren Hieben aus, so gut es ging, indem er den Kasper für sie spielte – daß er in Wirklichkeit Qualen litt, war lediglich an seinem ausdruckslosen Gesicht und der Tatsache abzulesen, daß er beim Sprechen die Endungen leicht verschliff. Saint-George hörte mit aufsässigem Gesicht Lady Grummidge zu, vermutlich tadelte sie ihn dafür, daß er seine Ferien in Shropshire verbracht hatte. Auf der anderen Seite des Tisches unterhielten sich paarweise Lord Croppingford mit Lady Stoate und Henry Drummond-Taber mit Amaranth Sylvester-Quicke, ohne daß es Probleme gab. Nur die schöne Mrs. Drummond-Taber saß still im Abseits: Gaston Chapparelle, der seine Suppe mit unnötiger Hast heruntergestürzt hatte, machte keinen Versuch, sie in ein Gespräch zu ziehen, sondern fixierte mit entrückter Miene Harriet. Von einem Franzosen sollte man bessere Manieren erwarten können, auch wenn es sich um einen Künstler handelte. Harriet mußte man jedoch zugestehen, daß sie nichts tat, um diese Aufmerksamkeit zu erregen – sie redete ruhig mit ihrem Schwager, und ihr austernfarbenes Satinkleid war, obwohl augenscheinlich sündhaft teuer, von züchtigem Schnitt. Glücklicherweise merkte Mrs. Drummond-Taber offenbar gar nicht, daß sie vernachlässigt wurde. Jemand hatte einmal zu ihr gesagt, daß sie eine außerordentliche Ruhe und Gelassenheit zu ihren Stärken zählen dürfe, und seither neigte sie ein wenig dazu, diese Disposition bewußt zur Schau zu tragen.
Nichtsdestotrotz hielt es die Herzogin für ihre Pflicht, Miss Sylvester-Quicke mit Lord Grummidge ins Gespräch zu bringen, und wollte soeben Peters Aufmerksamkeit von Lady Croppingford abziehen, als sie in einem plötzlichen Moment der Ruhe am Tisch hörte, wie Harriet, an Drummond-Taber gewandt, vergnügt verkündete: «Sie nennen mich am besten weiter einfach Miss Vane, das wird weit weniger Verwirrung stiften.»
Erst der Ausdruck auf Lady Grummidges Gesicht machte Harriet klar, welchen Schock sie da (ganz unbedacht) der Gesellschaft versetzt hatte.
Der Herzog reagierte mit ungewohnter Schnelligkeit: «Ich nehme an, das ist so üblich, was? Habe mir nie Gedanken über diese Dinge gemacht.»
«Nun ja», antwortete der Verleger, «manche Autorinnen wollen es so, und andere wollen es anders. Und sie machen ein ganz schönes Gewese darum. Für uns ist es natürlich immer das einfachste, den Namen zu benutzen, der auch auf dem Umschlag steht.»
«Und den zu ändern ist in diesem Fall wohl unmöglich, nehme ich an», bemerkte Lady Grummidge.
«Ausgeschlossen», erwiderte Harriet, «die Leser würden da nie eine Verbindung herstellen.»
«Werden denn normalerweise vorher die Ehemänner zu Rate gezogen?» wollte Lady Grummidge wissen.
«Ich kann nicht für alle Ehemänner dieser Welt sprechen», sagte Peter. «Mich hat man zu Rate gezogen, und ohne auch nur einen Moment zu zögern, gab ich mein D’accord.»
«Ihr was?» fragte Lady Stoate.
«Mein D’accord», wiederholte Peter. «Weil man sich so der Illusion hingeben kann, nicht nur eine Angetraute, sondern auch noch eine Geliebte zu haben, was doch wohl höchst erfreulich ist.»
«Du bist albern, Peter», sagte die Herzogin mit eisiger Stimme.
«Nun», meinte Lady Grummidge, «jedenfalls sind wir schon alle sehr gespannt auf Ihr nächstes Buch. Aber womöglich, meine Liebe, kommen Sie zu demselben Schluß wie einige von uns hier, daß nämlich ein Ehemann und eine Familie schon Arbeit genug sind, um den Tag mehr als auszufüllen.»
«Arbeit?» Unvermutet und mit unerwarteter Stoßrichtung, wie es manchmal seine Art war, brachte sich der Herzog ins Gespräch ein. «Meine liebe Marjorie, was weißt du schon von Arbeit? Du müßtest mal ein paar von meinen Pächterfrauen sehen. Ziehen sechs Kinder groß, mit der ganzen Kocherei und Wäsche, und schuften dabei noch auf dem Feld. Manche bringen ganz gutes Geld nach Hause. Ich würde verflixt gern wissen, wie sie das hinkriegen.»
Zweifelsohne war es ihm gelungen, das Thema der Tischgesellschaft zu wechseln, aber nachdem er nun einmal Lady Grummidge mit ungewöhnlichem Nachdruck über den Mund gefahren war, beeilte er sich, das mit einem ausgedehnten Austausch von Gesellschaftsklatsch wiedergutzumachen.
Dies lieferte Harriet dem Wohl und Wehe von Lord Croppingford aus, und der Herzog fragte sich, wie die beiden wohl miteinander zurechtkämen. Was um alles in der Welt sollte Croppingford mit einer Frau anfangen, die nicht wußte, wo bei einem Pferd vorne und wo hinten war? Als der Herzog hörte, wie die laute Stimme munter einen Schwatz über das Wetter begann, um direkt bei der Jagdsaison zu landen, fühlte er sich von einem unerklärlichen Impuls gepackt, zur Rettung herbeizueilen.
Lady Grummidge tadelte ihn: «Gerald, du bist wohl nicht recht bei der Sache …»
«Nie im Leben auf einem Pferd gesessen?» ließ sich Croppingford vernehmen, zutiefst schockiert, aber bemüht, dies nicht zu zeigen.
«Nur einmal auf einem Esel in Margate, da war ich sechs. Aber reiten wollte ich schon immer lernen.»
«Gut, gut», sagte Croppingford. «Sie müssen einfach mal mit raus.»
«Gern … Aber was meinen Sie: Ist dreiunddreißig nicht zu alt, um reiten zu lernen, ohne daß man sich dabei zum Gespött der Leute macht? Ganz ehrlich? Ich möchte mir nicht vorkommen wie dieses Puppengesicht im Punch, das immer irgendwem im Weg steht und dafür ausgeschimpft wird.»
«Na, na, Sie doch nicht», erwiderte Lord Croppingford, der sich langsam für das Thema zu erwärmen begann. «Schauen Sie einmal, ich an Ihrer Stelle würde folgendermaßen vorgehen …»
«Und im Herbst», wollte Miss Sylvester-Quicke wissen, «erwarten Sie da, den neuen Harriet Vane im Programm zuhaben?»
«Hoffnung ist des Menschen Brot», antwortete Drummond-Taber. «Aber aktive Schritte in diese Richtung zu unternehmen wäre unethisch, wie die Amerikaner sagen.» Man mußte bei diesem Fräulein auf der Hut sein, so dachte er, sie stand im Ruf, die Klatschspalten der Sonntagszeitungen zu beliefern.
«Kann sie denn schreiben? Wahrscheinlich schon. Schreiben können sie ja, diese Intellektuellen. Peter sieht richtig mitgenommen aus, finden Sie nicht? Flitterwochen und ein Mord, beides gleichzeitig war wohl ein bißchen viel für ihn.»
Henry Drummond-Taber merkte vorsichtig an, daß ein Mord im wirklichen Leben bestimmt seine anstrengenden Seiten hätte.
«Ihr jedenfalls scheint es nicht sehr viel ausgemacht zu haben. Na ja, für sie ist es ja auch nichts Besonderes. Also, ich meine, sie wird solche Dinge wohl einfach als gute Publicity ansehen. Wie auch immer – ist es nicht erfrischend, einmal zwei so nüchtern-distanzierte Jungvermählte zu erleben? Nicht wie sonst dieses Gehabe, von wegen ‹Ihre Blicke suchten sich über den Tisch hinweg›, das für alle anderen doch immer so peinlich ist. Die Harwells zum Beispiel benehmen sich immer noch so – wirklich unanständig, nach zwei Jahren! Sie kommen ja wohl nächste Woche nach London zurück. Ich habe gehört, sie läßt sich von Chapparelle malen, ist das wahr?»
Der Verleger gab zu, es so gehört zu haben.
«Ich halte ihn ja für einen überaus beunruhigenden Menschen. Kennen Sie diese entsetzlich desavouierenden Portraits von Lady Camshaft und Mrs. Hartley-Skeffington? Die beiden selbst erkennen natürlich gar nicht, was allen anderen ins Auge sticht. Es ist wirklich zum Schießen. Aber es ist der letzte Schrei, sich von Chapparelle sein Innerstes nach außen kehren zu lassen. Eine Art exhibitionistische Ersatzhandlung, nehme ich an.»
«Tatsächlich?»
«Jetzt sehen Sie ganz geschockt aus. Sagen Sie mir bloß nicht, er hat versprochen, auch Ihre Frau zu malen! Aber auch wenn – ich bin sicher, die Psyche Ihrer Frau ist robust genug, sich dem auszusetzen, ohne Schaden zu nehmen. Mit einem Gesicht wie dem ihren glaube ich kaum, daß man ihr irgendwelche Komplexe oder Neurosen oder so etwas anhängen kann. Ganz die Venus von Milo!»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: