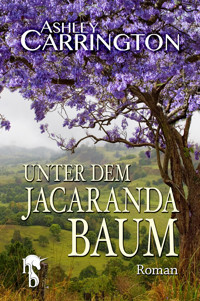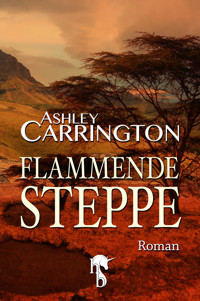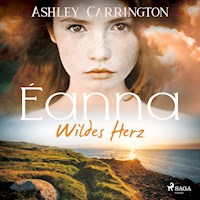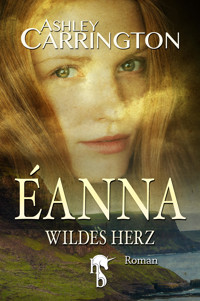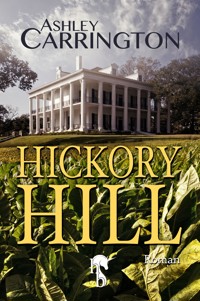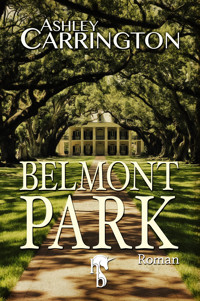6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Roman voll dunkler Familiengeheimnisse, Schuld und Hass, aber auch voll Hoffnung und der Kraft der wahren Liebe: Selbst als erfolgreiche Schriftstellerin bleibt Emily Forester der Heimat ihrer Kindheit, der Prince Edward Island im St.-Lorenz-Strom, treu. Hier bekommt sie als Zehnjährige ein Tagebuch geschenkt, mit dem sie ihre Begeisterung fürs Schreiben entdeckt, aber hier lernt sie auch die Schattenseiten des Lebens kennen: das komplizierte Verhältnis zu ihrer unglücklichen Schwester und das ernüchternde Ende ihrer ersten großen Liebe. Gefangen in einer leidenschaftslosen Ehe mit einem Geistlichen schreibt Emily fernab des Stroms ihren ersten Roman, doch der sittenstrenge Reverend verbrennt das Manuskript. Als Emily bei einem Besuch auf der Insel nach zehn Jahren ihre Jugendliebe wieder trifft, droht ihr Leben aus den Fugen zu geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ashley Carrington
Insel im blauen Strom
Roman
Meiner Frau Helga in Liebe und Dankbarkeit
»Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe – das einzig Bleibende, der einzige Sinn.«Die Brücke von San Luis ReyThornton Wilder
Prolog
Prince Edward Island 1969
»Ist Ihnen nicht gut, Missis Forester?«
Emily Forester schreckte aus ihren beklemmenden Gedanken auf und schaute die Stewardess verständnislos an. Die junge Frau, die im Mittelgang der halbleeren Propellermaschine auf der Höhe ihres Sitzes stehen geblieben war, beugte sich mit besorgter Miene zu ihr herab.
»Wieso fragen Sie?«
»Sie weinen, Ma’am.« Die Stewardess warf kurz einen Blick auf den Brief in Emily Foresters Hand. Es war, als wollte sie auf diese stumme, diskrete Weise fragen, ob der Brief vielleicht die Ursache ihres Kummers sei. Er trug deutliche Brandspuren an den Rändern. Offensichtlich hatte man ihn im letzten Moment davor bewahrt, lichterloh in Flammen aufzugehen und vom Feuer verzehrt zu werden.
Emily wischte sich mit einer raschen Handbewegung die Tränen von den Wangen, ließ den Brief in ihren Schoß sinken und lächelte verlegen. »Ach, der Brief! … Er … er hat mich an einige romantische Erlebnisse in meiner Jugend erinnert«, sagte sie leichthin zu der jungen, attraktiven Frau, die vom Alter her durchaus ihre Tochter hätte sein können. »Und derlei Sentimentalitäten bringen mich immer schnell zum Weinen. Denken Sie sich nichts dabei.« Sie bemühte sich weiterhin zu lächeln, doch es kostete sie große Anstrengung.
Der Stewardess, noch voller Enthusiasmus für ihren Beruf und aufrichtig um das Wohl ihrer Passagiere besorgt, war die Erleichterung deutlich anzusehen. »Dann ist es ja gut, Missis Forester. Darf ich Ihnen noch einen Martini bringen, bevor wir die Bordbar schließen? Wir landen in einer Viertelstunde.«
Nur mühsam widerstand Emily der Versuchung, sich noch einen zweiten Drink zu gönnen. »Nein, danke. Einer ist so früh am Nachmittag mehr als genug.« Dabei hatte sie das Gefühl, eigentlich alle Drinks auf Erden nötig zu haben. Ihre Vernunft sagte ihr jedoch, dass nichts sie vor dem schützen konnte, was nun auf Prince Edward Island vor ihr lag. Alkohol schon gar nicht. Im Gegenteil: Sie würde all ihre Kraft und Klarheit brauchen, um mit der erschütternden Wahrheit ins Reine zu kommen und vor den Dämonen der Vergangenheit nicht in die Knie zu gehen. Und um den Mut zu finden, Byron einen Besuch abzustatten.
Die Stewardess machte im ersten Moment ein enttäuschtes Gesicht, weil sie nichts weiter für ihren liebsten Passagier tun konnte, lächelte jedoch sofort wieder. »Dies ist meine erste Flugwoche, und Sie an Bord zu haben, ist für mich … ich meine natürlich für uns alle von der Quebec Air eine ganz besondere Ehre!« Sie errötete wie ein junges Mädchen unter dem Blick ihres ersten Schwarms. »Ich liebe Ihre Bücher. Sie … sie sind einfach wunderbar. Besonders wenn man auch von der Insel kommt. Ich bin an der Golfküste, in North Rustico, aufgewachsen.«
»Danke«, sagte Emily freundlich und rechnete insgeheim damit, dass die Stewardess sie im nächsten Augenblick um ein Autogramm bitten würde.
Die junge Frau war jedoch entweder zu gut ausgebildet oder zu schüchtern. Sie nickte ihr nur mit einem strahlenden Lächeln zu und ging weiter.
Emily unterdrückte einen schweren Seufzer, als sie wieder mit ihren Gedanken alleine war. Ganz langsam faltete sie den angekohlten Brief zusammen. Wie oft hatte sie ihn in den letzten Tagen schon zur Hand genommen und gelesen! Immer und immer wieder. Geradezu zwanghaft, wie eine Drogensüchtige, die sich wegen ihrer Haltlosigkeit selbst hasst, aber dennoch nicht von ihrem zerstörerischen Gift loskommt.
Mittlerweile kannte sie die Zeilen fast auswendig. Dennoch griff sie immer wieder zu diesen angesengten Seiten – in der trügerischen Hoffnung, bei der erneuten Lektüre vielleicht einen Hinweis zu finden, den sie bislang übersehen hatte und der die erschütternde, schreckliche Wahrheit ein wenig erträglicher machte. Doch einen derartigen gnädigen Hinweis gab es nicht, und so befiel sie jedes Mal aufs Neue das entsetzliche Gefühl, von einem überwältigenden Gewicht der Schuld und Ohnmacht schier erdrückt zu werden und keine Luft mehr zu bekommen.
»Warum nur, Leonora?«, murmelte sie und wurde von einer Woge brennenden Zorns und Aufbegehrens erfasst. »Warum hast du das getan? Und warum hast du mich von dir gestoßen und kein Vertrauen gehabt? Und warum habt ihr so lange geschwiegen? All die Jahre!«
Weil wir alle Gefangene unserer eigenen Schuld sind, beantwortete sich Emily die Frage mit einem Anflug von Bitterkeit selbst. Niemand entkommt seiner Vergangenheit. Die Vergangenheit prägt einen für immer – und dem Teufel begegnet man auf halbem Weg zu Gott. Wie recht Andrew damit doch hatte! Der Mensch ist nun mal das, was er liebt und tut, nicht, was er denkt und sagt. Und der gefährlichste Feind des Glaubens und der Liebe ist der Zweifel: die bohrende Frage, ob nicht alles nur Betrug und Selbsttäuschung ist. O ja, an Betrug und Selbsttäuschung hatte es in ihrem Leben keinen Mangel gegeben. So viel Schmerz und so viele Irrungen! Und wofür? Um jetzt voller Scham und Schuld erfahren zu müssen, dass nichts so gewesen ist, wie es einst den Anschein gehabt hatte? Dass sich hinter der Maske der Unschuld eine abscheuliche Fratze verbarg?
Warum habt ihr mir das angetan?
Die Propellermaschine der Quebec Air zog eine sanfte Linkskurve und verlor spürbar an Höhe. Emily hob unwillkürlich den Kopf und blickte aus dem Fenster. Ihr Gesicht hellte sich auf. Eine Weile vergaß sie, was sie bedrückte, denn unter ihr rissen die Wolken auf und gaben den Blick auf Prince Edward Island frei: ein gut zweihundertzwanzig Kilometer langer, sichelförmig geschwungener Streifen fruchtbaren Landes, der an der schmalsten Stelle bei Summerside, am Isthmus zwischen der Malpeque Bay im Norden und der Bedeque Bay im Süden, kaum sechs Kilometer aufwies und der sich an der breitesten Stelle auf vierundsechzig Kilometer ausdehnte, womit er in etwa die Größe der Karibikinseln Trinidad oder Tobago erreichte.
Aus der Luft sah Prince Edward Island mit seinem dichten Flickenteppich aus Wäldern, Wiesen und Weiden beinahe wie ein riesiger grüner Schmetterling mit bunten Farbtupfern aus. Besonders die knallgelben Flecken der Rapsfelder stachen ins Auge. Die Strände und Dünen entlang der Küste leuchteten dagegen im milden Licht der Frühlingssonne in einem warmen, sandgoldenen Ton. Wie feine Adern durchzogen die geteerten Straßen sowie die vielen schmalen Feld- und Waldwege mit der typisch lehmroten Erde der Insel den grüngefleckten Leib des Schmetterlings. Und er trieb, gleichsam ermattet und an den Flügeln zerzaust von seinem langen Flug durch stürmisches Wetter, auf den klaren, eisigen Fluten des Sankt-Lorenz-Stromes dahin, der sich hier im Nordosten von Kanada zwischen Akadien und Neufundland zu einem mächtigen Golf öffnet, bevor er sich in den unermesslichen Fluten des Nordatlantiks verliert.
Emilys Augen füllten sich mit Tränen, als ihr plötzlich mit überwältigender Klarheit bewusst wurde, was ihr diese Insel bedeutete, die sie vor mehr als drei Jahrzehnten noch am Tag ihrer Hochzeit verlassen hatte. Das dort unten war das Fleckchen Erde, wo Herz und Seele tiefere Wurzeln geschlagen hatten, als sie sich je hätte träumen lassen, wo sie größtes Glück, aber auch schmerzhafteste Verletzungen erfahren hatte. Ein Ort abgründigster Geheimnisse, die – wie ein verseuchter Brunnen, aus dem alle ahnungslos trinken – das Leben so vieler vergiftet und noch mehr Hoffnungen zerstört hatten.
Und doch fühlte sie sich nur hier wahrhaft zu Hause. Selbst wenn sie mittlerweile doppelt so viele Jahre in Lac-Saint-Germain und in Quebec wie auf der Insel verbracht hatte: Prince Edward Island und insbesondere die Gegend von Summerside und Charlottetown trugen das unverbrüchliche Siegel der Heimat und würden es immer tragen.
Ja, es war ihre Insel. Ihre Insel im blauen Strom, zu der sie nun endlich zurückkehrte – zutiefst verstört, beschämt und bedrängt von quälenden Schuldgefühlen und Ängsten, aber auch mit dem unbändigen Mut der Verzweiflung an der Hoffnung festhaltend, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren war. Nicht verloren sein durfte! Sie mochte Angst vor der Dunkelheit des Abgrunds haben, der sich vor ihr aufgetan hatte. Und dennoch hielt sie in solch dunklen Stunden an der Hoffnung fest, die Andrew einst mit den Worten in ihr gesät hatte: »Die Nacht ist bei aller Dunkelheit doch auch voller Sterne.«
Wann hat das alles bloß begonnen, fragte sich Emily, als die Propellermaschine ihren Landeanflug auf den Flughafen von Charlottetown, der Hauptstadt der Insel, begann. Wann nur war das einst für ewig unverbrüchlich gehaltene Band der schwesterlichen Verbundenheit zerrissen? Wann waren das Vertrauen und die Nähe ihrer großen Schwester Leonora geschwunden, die sie als kleines Mädchen so bedingungslos geliebt und angehimmelt hatte?
Emily brauchte nicht lange zu überlegen. Noch bevor die Maschine auf der Rollbahn des Wald-und-Wiesen-Flugplatzes aufsetzte, wusste sie die Antwort auf ihre Frage. Es hatte damit begonnen, dass sie im Winter 1926 im Alter von zehn Jahren an Scharlach erkrankte und mehrere Wochen lang von ihrer zwei Jahre älteren Schwester getrennt worden war, um diese nicht anzustecken. Danach begann sich die tiefe Kluft, die zu einem schrecklichen Abgrund werden sollte, zwischen ihnen zu öffnen. Und wenn auch das Verhängnis in Wirklichkeit schon viel früher seinen Anfang genommen hatte, so zeigte es in den letzten Wochen des bedrückend langen Winters von 1926 doch zum ersten Mal unverhohlen seine hässliche Fratze.
Ja, meine Krankheit machte den Ausbruch einer ganz anderen Krankheit erst möglich, dachte Emily und schauderte, als die Erinnerung sie wie ein Sog ergriff und mehr als vierzig Jahre zurück in ihre Vergangenheit zog …
Teil 1
Prince Edward Island 1926–1935
1
Erst zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit traf Doktor Norman Thornton mit seinem Pferdeschlitten bei den Foresters ein. Schnee bedeckte sein Cape aus grober schwarzer Wolle und fand sich, mit einigen kleinen Eisklumpen, auch in seinem dichten, zotteligen Vollbart, der die Farbe von Eisenspänen hatte.
»Dem Himmel sei Dank, dass Sie endlich da sind, Doktor!«, rief Agnes Forester ihm zu, kaum dass er die Zügel festgebunden hatte und vom Sitz gestiegen war. »Unsere kleine Emily glüht schon seit Stunden vor Fieber!« Der Vorwurf in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
Doktor Thornton zog seine abgewetzte Ledertasche unter einer alten Pferdedecke hervor. »Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Missis Forester. Oder hätte ich Heather Wilkins vielleicht verbluten und ihr Kind mit der Nabelschnur um den Hals ersticken lassen sollen?«, antwortete er auf seine direkte, bärbeißige Art.
»Sie wissen schon, wie ich es gemeint habe«, sagte Agnes Forester verlegen und schloss hinter ihm die Tür.
»Halt den Doktor nicht mit unnötigem Geschwätz auf, Agnes!«, wies Frederick Forester seine Frau ungehalten zurecht. Und an seine älteste Tochter Leonora gewandt, die stumm und mit blassem Gesicht in der Tür zur Küche stand, sagte er mit bedeutend sanfterer Stimme: »Wenn deine Mutter schon jegliche Höflichkeit vergisst, so nimm wenigstens du dem Doktor das nasse Cape ab und bring ihm eine Tasse Tee!«
»Ja, Dad!«, erwiderte Leonora eilfertig und nahm den schweren Umhang entgegen.
»Der Tee kann bis nachher warten!« Doktor Thornton stiefelte die Treppe ins erste Obergeschoss hinauf, ging den kleinen, dunklen Flur hinunter, vorbei an den Zimmern der Eheleute, und stand einen Augenblick später an Emilys Bett. An der gegenüberliegenden Wand der kleinen Kammer, nur durch eine alte Wäschekommode mit vier Schubfächern getrennt, befand sich das Bett ihrer älteren Schwester Leonora.
Mit rotfleckigem, schweißglänzendem Gesicht und fiebrigen Augen blickte das zehnjährige Mädchen zu Doktor Thornton auf, der zunächst den Docht der Petroleumlampe auf der Kommode höherschraubte, um mehr Licht zu haben, und sich dann über sie beugte. »Hast du starke Halsschmerzen, mein Kind?«, fragte er.
Emily nickte.
Doktor Thornton befühlte ihre Stirn, entblößte kurz ihre Brust, um dort den Ausschlag zu begutachten, und forderte sie dann auf, den Mund zu öffnen und die Zunge herauszustrecken. »Natürlich, Himbeerzunge! Das Kind hat eindeutig Scharlach«, verkündete er mit ernster Miene. »Das Mädchen muss sofort isoliert werden. Die Krankheit ist höchst ansteckend und kann einen bösen Verlauf nehmen.«
»Wir könnten die Dachkammer für sie herrichten«, schlug Frederick Forester vor und rieb sich über den Ellbogen seines halbsteifen linken Armes, den er nur noch arg eingeschränkt gebrauchen konnte. Seit ihm im Ersten Weltkrieg auf einem französischen Schlachtfeld ein Granatsplitter diese schwere Verletzung zugefügt hatte, plagten ihn bei starker Kälte Schmerzen.
»Da ist es viel zu eisig!«, widersprach seine Frau.
»Ach was, eisig ist es zur Zeit in jedem Zimmer außer in der Küche und im Laden! Hier ist es auch nicht anders«, entgegnete Frederick barsch. »Sie liegt ja im Bett und bekommt aufgeheizte Ziegelsteine unter die Decke geschoben. Da hat sie es warm. Und da sie eh vor Fieber glüht, ist die Dachkammer so gut wie jedes andere Zimmer auch!«
Doktor Thornton enthielt sich jeglichen Kommentars. Die Insulaner pflegten ihren ganz besonderen Stolz. Kein Außenstehender wagte es, einem Mann in seine häuslichen Angelegenheiten auch nur im Ansatz hineinzureden. Selbst für ihn als Arzt galten ganz enge Grenzen, was er sagen und vorschlagen durfte. Und diese Ratschläge mussten in viele vorsichtige Formulierungen wie »möglicherweise«, »wer weiß, ob nicht vielleicht« oder »könnte eventuell mal gelegentlich eine Überlegung wert sein« verpackt werden, um auch ja jeglichen Eindruck von Besserwisserei zu vermeiden. Zudem musste er Frederick Forester recht geben: In allen oberen Räumen herrschte bittere Kälte. Aber das war im Winter der Normalzustand. Nicht nur bei den Foresters, sondern in so gut wie allen Häusern auf Prince Edward Island. Sogar in seinem eigenen Heim fand er an manchem Morgen den Wasserkessel festgefroren auf der Herdplatte vor, wenn er die Nacht zuvor vergessen hatte, noch gut Holz nachzulegen – was viele Inselbewohner für eine Verschwendung von kostbarem Brennholz hielten.
Damit war die Angelegenheit entschieden. Agnes wickelte ihre kranke Tochter in warme Decken und wiegte sie in ihren Armen wie ein Baby, bis Frederick das Eisengestell von Emilys Bett auseinandergeschraubt, oben in der Dachkammer wieder zusammengebaut und auch die mit Stroh gefüllte Matratze die steile Treppe hinaufgeschafft hatte.
Bevor ihre Mutter mit ihr in der Dachkammer verschwand, erhaschte Emily noch einen kurzen Blick auf das angsterfüllte Gesicht ihrer Schwester, die am Fuß der Stiege stand und eine Hand erhoben hatte, als wollte sie ihr zum Abschied zuwinken. Sie sagte auch noch etwas, denn Emily sah, wie Leonora die Lippen bewegte. Doch nicht ein Wort drang durch das wilde Pochen und Rauschen, das ihre Ohren erfüllte. »Muss ich jetzt sterben, Mom?«, flüsterte Emily, und jedes Wort ließ die Schmerzen in ihrem Hals jäh aufflammen. »Komme ich jetzt vor Gottes Strafgericht?«
»Was redest du denn für ein dummes Zeug!«, schalt ihre Mutter sie liebevoll. »Natürlich wirst du nicht sterben. Du bist zäh und wirst das im Handumdrehen hinter dich bringen. Und habe ich dir nicht schon mal gesagt, dass du dir diese … harschen Buß-und Fegefeuerpredigten von Reverend Sedgewick nicht so zu Herzen nehmen sollst? Du hast nichts auf dich geladen, wofür du gestraft werden müsstest. Und überhaupt ist Gott kein unbarmherziger Richter.«
Emily sah ihre Mutter mit erleichterter Verwunderung an und ignorierte ihre starken Halsschmerzen. Es geschah selten, dass ihre Mutter so wie jetzt aus sich herausging und dermaßen offen zu ihr sprach. »Dann … dann stimmt das also alles gar nicht, was Reverend Sedgewick über Gott predigt?«
Agnes Forester zögerte kurz. »So kann man das auch nicht sagen. Reverend Sedgewick ist gewiss ein ehrenwerter und gottesfürchtiger Mann, mein Kind. Aber es gibt nun mal Menschen, die reden immer nur von der Finsternis und vergessen darüber ganz, dass im Leben alles zwei Seiten hat – und diese andere Seite ist der lichte Tag mit dem Sonnenschein. Und Gott ist zuallererst das Licht und die barmherzige Liebe, mein Kind, nicht das Dunkel und das Strafgericht.«
Emily dachte kurz darüber nach. »Dann ist Mister Sedgewick also ein Prediger der Finsternis?«
Agnes Forester seufzte und vermied eine direkte Antwort. »Es ist traurig, dass manche Menschen sich beharrlich in die Dunkelheit verkriechen, anstatt ins warme Sonnenlicht zu treten. Leider zählt Mister Sedgewick zu ihnen.«
»Muss er einem dann nicht leidtun?«, krächzte Emily.
Ihre Mutter stutzte über die Frage und nickte dann mit einem feinen Lächeln. »Ja, das muss er wohl. Aber das bleibt besser unter uns, versprichst du mir das?«
Emily nickte ernst und kreuzte dann Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand zum Schwur. Mit ihrer Mutter ein solch gewichtiges Geheimnis zu teilen, war etwas Wunderbares und Aufregendes und gab ihr das Gefühl, schon fast erwachsen zu sein. Sie hatte noch nie mit ihrer Mutter ein Geheimnis geteilt, und Leonora bestimmt auch nicht.
»Ich bin gleich wieder bei dir und mache dir einen Wadenwickel«, versprach Agnes Forester und erhob sich vom Bett. Als sie die Stiege hinunterkam, drang von unten vor der Tür zur Küche die Stimme ihres Mannes zu ihr. »Was ist es denn geworden, der Zuwachs bei den Wilkins, Doc?«
»Wieder ein Junge, Frederick. Prächtiges Kerlchen. Fast neun Pfund schwer und kräftig wie ein kleiner Ochs!«
Agnes Forester hörte ihren Mann kurz und freudlos auflachen. »Der dritte Sohn, den Heather zur Welt gebracht hat. Ja, diese Frau weiß eben, worin ihre Aufgabe besteht und was sie ihrem Mann schuldig ist!«
Agnes wankte wie unter einem unverhofften Schlag ins Gesicht. Ihre Hand umklammerte das Treppengeländer, während sie sich so heftig auf die Lippen biss, dass ihr die Tränen kamen.
Doktor Thornton räusperte sich und sagte verlegen: »Nun ja, die Launen der Natur …« Er brach ab. »Ah, da ist ja der versprochene Becher Tee. Ich danke dir, Leonora.«
Die Männer gingen in die warme Küche.
Agnes Forester verharrte noch eine ganze Weile im dunklen, kalten Flur. Sie weinte bittere Tränen, weil sie in so vielen Dingen versagt und schwere Schuld auf sich geladen hatte. Besonders als Ehefrau, die ihrem Mann nur zwei Mädchen geschenkt und bei fünf schweren Fehlgeburten drei Söhne verloren hatte. Alles andere hätte Frederick ihr verzeihen können, nicht aber, dass sie ihm keinen Stammhalter geboren hatte. Dafür gab es keine Entschuldigung. Nicht nur in seinen Augen. Das war eine Schande und Schuld, die sie bis zu ihrem Tode quälen würde. Und als ob das noch nicht genug der Seelenpein wäre, gab es in ihrem Leben noch andere schwerwiegende Sünden. Manchmal glaubte sie, nicht mehr die Kraft und den Willen zum Weiterleben zu haben.
Aber allein dieser Gedanke war schon eine schreckliche Versündigung, der sie widerstehen musste. Und bisher hatte sie auch noch immer genug Kraft und Demut gefunden, um ihr Kreuz weiterhin klaglos zu tragen. Hatte sie ihr bitteres Los denn nicht auch mehr als verdient? Ja, wohl schon, daran gab es für sie nicht den geringsten Zweifel. Zu groß war die Schuld, die sie auf sich geladen hatte.
2
Das Fieber, das tagelang das Leben aus Emilys schmächtigem Körper zu brennen versuchte, bescherte ihr eine Vielzahl von Träumen – grässliche wie märchenhaft schöne. Oftmals verschwammen aber auch Wirklichkeit und Phantasie miteinander. Wann immer sie jedoch die Augen öffnete, sah sie ihre Mutter an ihrem Bett sitzen oder über sie gebeugt, wie sie ihr neue Wickel anlegte, ihr das Gesicht abwusch oder ihr heiße Fleischbrühe Löffel für Löffel einflößte.
Ihre Mutter begleitete sie häufig in jene Träume, die von beglückend märchenhafter Art waren. Einmal jedoch verwandelte sich die friedvolle Atmosphäre in einen hässlichen Alptraum, der von einem Ausbruch an Gewalt beherrscht wurde. Emily vergaß alle Träume, bis auf diesen einen, wenn sie von ihm auch nur eine vage Erinnerung bewahrte. Es blieben nur einige wenige Bilder in ihrem Gedächtnis haften: ihre Mutter, die eine wunderschöne Kette mit kleinen jadegrünen Perlen in der Hand hielt und einen wundersamen Zauberspruch sagte, ein Wirbel von tausend Schneeflocken, die seltsamerweise jedoch keine Kälte, sondern Wärme und Sonnenschein mit sich führten, und dann das Bild einer groben Faust aus blauem Eis, die ihre Mutter zum Schreien brachte. Die Kette riss, und plötzlich floss Blut aus dem Mund ihrer Mutter, und in diesem Blut schwammen die einzelnen Perlen.
Über drei Wochen, bis in die zweite Märzwoche hinein, blieb Emily in der Dachkammer isoliert. Als sie die ersten zehn kritischen Tage überstanden hatte und das Fieber zu sinken begann, fragte sie nach ihrer Schwester und ihrem Vater: »Warum kommen Leonora und Dad nie zu mir?«
»Weil Doktor Thornton jeglichen Besuch verboten hat. Du könntest sie ja noch immer anstecken«, antwortete ihre Mutter.
»Und du allein kannst dich nicht anstecken?«, wunderte sich Emily und wünschte, wenigstens Caroline, ihre beste Freundin, dürfte sie besuchen kommen. Aber wer sollte sie mit ihrem Rollstuhl bis unter das Dach tragen? Denn Caroline Clark war seit ihrer Kinderlähmung vor vier Jahren auf Rollstuhl und Krücken angewiesen.
Agnes lächelte sie zärtlich an. »Ich bin deine Mutter, Kind. Wer sollte dich denn sonst pflegen?«, antwortete sie und richtete die Genesungswünsche der Nachbarn und Freunde aus – sowie die der wenigen Kunden, die den Stoffladen von Frederick Forester am östlichen Ortsrand von Summerside überhaupt noch zu betreten wagten, solange seine jüngste Tochter bekanntlich mit einer ansteckenden, gefährlichen Krankheit daniederlag.
Doktor Thornton machte regelmäßig Krankenbesuche. »Weil er weiß, dass er von mir ordentlich und umgehend bezahlt wird«, erklärte Frederick nicht ohne Stolz. »Die meisten seiner Patienten lassen ihn endlos auf seiner Rechnung sitzen. Und bei so mancher Niederkunft vergelten sie ihm seine Dienste, indem sie das Neugeborene raffinierterweise auf seinen Namen taufen lassen. Denn das ist Lohn, nämlich Gotteslohn, genug, so ist es nun mal der Brauch. Deshalb findet man in Summerside und Umgebung ja auch überdurchschnittlich viele Kinder, die Norman und Norma heißen. Glaub mir, dass der Doc diese Unsitte unter seinen zahlungsscheuen Patienten mehr als alles andere verflucht.«
Als Emily sich wieder besser fühlte, aber von Doktor Thornton zur Sicherheit noch immer in Quarantäne gehalten wurde, verbrachte sie viele Stunden vor dem kleinen Giebelfenster. Eingewickelt in mehrere Decken, kauerte sie in einem alten Korbstuhl, hauchte gegen die mit Eisblumen bedeckte Scheibe, um mit ihrem warmen Atem ein Guckloch zu schaffen, und blickte hinaus in die verschneite Landschaft. Am unterschiedlichen Glockenklang der Schlitten versuchte sie zu erraten, wer da wohl gerade über die verschneiten Felder an ihrem Haus vorbeiglitt.
Ihr Blick reichte weit: Ober den Obsthain der Duncans, die Farm von Silas und Hazel Robinson und die dahinterliegenden Felder, die sich wellenförmig wie die erstarrten Wogen einer einst bewegten See kilometerweit nach Norden und Osten erstreckten und von den Spuren der Pferdeschlitten durchzogen waren. Denn das schlichte Haus der Foresters mit dem schmalen Anbau hinter dem Laden, über dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Forester’s Fine Fabrics hing, lag am äußersten nordöstlichen Ortsrand von Summerside.
Mit den feinen Stoffen war es jedoch nicht sehr weit her. Die wenigsten der knapp viertausend Einwohner der geschäftigen Hafenstadt begaben sich bis in die Russell Street, wo schon die ersten Farmen lagen, um bei Frederick Forester Stoffe einzukaufen, geschweige denn, um wirklich feines und teures Tuch zu erstehen. Dieses Geschäft machten zwei andere Kaufleute, die ihre eleganten und wohlsortierten Läden mit holzgetäfelten Verkaufsräumen und edlen Porzellanlampen über den goldbraunen Verkaufstischen im Herzen von Summerside hatten, nämlich unten im Süden, in der belebten Water Street am Hafen sowie an der Ecke Central und First Street. Wer bei Frederick Forester als Kunde in den Laden trat, gehörte zumeist zur Landbevölkerung und brauchte hauptsächlich derben Drillich für die Arbeit auf den Farmen, strapazierfähigen Kord, robuste Wolle für den Winter sowie einfaches Leinen und billigen Kaliko für die heißen Sommermonate – und ließ nicht selten bis zur nächsten Ernte oder zum nächsten Schlachttag anschreiben.
Emily verbrachte auch viel Zeit damit, von ihrem Bett aus auf die unzähligen Nägel zu schauen, mit denen die Dachschindeln befestigt waren. Gut daumenlang ragten sie aus den unverkleideten Sparren heraus, und an besonders kalten Morgen hing an jedem Ende ein kleiner weißer Eiszapfen. Dann stellte sie sich vor, sie befände sich in einem unterirdischen Eislabyrinth, das aus unzähligen solcher Eiszapfen bestand und aus dem sie nur dann wieder herausfand, wenn sie sich den Weg ganz genau merkte, den ihr Blick durch diesen Irrgarten aus Eis nahm. Aber sosehr sie sich auch bemühte, dieses Gedankenspiel möglichst lange hinzuziehen, es beanspruchte doch nur einen Bruchteil der schrecklich vielen Stunden, die sie vom Morgen bis zur nächsten Nacht allein in der Dachkammer verbrachte, isoliert von ihrer vertrauten Welt mit ihren vielfältigen Beschäftigungen, Ablenkungen, Pflichten und Begegnungen.
Allein die Besuche ihrer Mutter und die des Arztes unterbrachen Emilys Einsamkeit, die mit jedem Tag quälender wurde. Keiner von beiden blieb jedoch lange genug, um ihre Sehnsucht nach Gesellschaft auch nur annähernd zu stillen. Doktor Thornton hielt sich nie länger als ein, zwei Minuten an ihrem Krankenbett auf, und ihre Mutter bekam spätestens nach einer halben Stunde Gewissensbisse, weil sie so lange ihre häuslichen Pflichten vernachlässigte. »Sei vernünftig, Kind! Ich kann hier nicht stundenlang bei dir sitzen und dem lieben Herrgott die Zeit stehlen. Die Arbeit im Haus tut sich nun mal nicht von selbst!«, sagte sie mehr als einmal, wenn Emily bettelte, sie möge doch noch etwas bleiben. Sie machte ihr jedoch ein Geschenk, von dem sie hoffte, dass es ihrer Tochter helfen würde, die vielen einsamen Stunden besser zu ertragen.
Freudig erregt öffnete Emily das zerknitterte braune Packpapier. Ihr fielen zwei brandneue Bleistifte entgegen, und dann hielt sie ein Buch in der Hand, auf dessen Deckel ein Bild abgedruckt war, das zarte Rosenblätter auf einem Spitzentaschentuch zeigte. Als sie das Buch aufschlug, das gar keinen Titel trug, stellte sie fest, dass alle Seiten leer waren. »Was ist das, Mom?«, fragte sie verwundert.
»Ein Tagebuch oder Poesiealbum, ganz wie du willst, mein Kind«, erklärte ihre Mutter mit strahlender Miene. »Du kannst tausend Dinge, die dir in den Sinn kommen, in dieses Buch malen oder schreiben. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Später kannst du auch gepresste Blumen oder gar eine Locke deiner besten Freundin einkleben. Glaube mir, es ist etwas Wunderbares, so ein Tagebuch und Poesiealbum zu haben. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Als junges Mädchen habe ich einst auch solch ein Buch besessen, und es war mein kostbarster Schatz.«
Emily hatte Mühe, sich ihre Enttäuschung über ein derart unpraktisches Geschenk nicht anmerken lassen. Was sollte sie mit so einem Buch? Weder verstand sie sich aufs Zeichnen, noch hatte sie vor, niederzuschreiben, was ihr durch den Sinn ging. Wozu auch? Sie wusste doch auch so, was sie beschäftigte. Und dass ihre Mutter einst Zeit damit verbracht haben sollte, in solch einem Büchlein irgendetwas aufzuschreiben, erschien ihr äußerst unglaubwürdig. Mit ihrer Mutter verband sie nur Bilder einer stets beschäftigten, schwitzenden Frau, die beispielsweise in der dampfenden Waschküche über das Waschbrett gebeugt stand oder die jeden Abend in der Küche den Teig für das Brot des kommenden Tages knetete und dabei nie vergaß, aus dem Vaterunser die Zeile »Herr, gib uns unser tägliches Brot« zu zitieren, bevor sie das Blech mit dem Teiglaib in den Ofen schob. Das Bild ihrer Mutter jedoch, wie sie etwas ganz und gar Unnützes tat, nämlich etwas in ein Tagebuch zu kritzeln, erschien ihr geradezu lächerlich und überstieg ihre Vorstellungskraft bei Weitem. Aber auch wenn sie nichts Rechtes mit diesem Buch voll leerer Seiten anzufangen wusste, so blieb es doch ein Geschenk, und allein das war schon etwas Besonderes, gab es Geschenke doch sonst nur zu Weihnachten. Ihre Mutter hatte ihr eine Freude machen wollen, das rührte sie, wie unsinnig die Wahl des Geschenkes auch ausgefallen sein mochte. Zudem sah das Bild mit den Rosenblättern auf dem Vorderdeckel wirklich hübsch aus. Und warum sollte sie nicht auch etwas besitzen, wofür sie keine praktische Verwendung wusste?
Mit diesen Gedanken fiel es Emily nun nicht mehr ganz so schwer, ein überzeugendes Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, als sie sich artig für das wunderbare Poesiealbum bedankte.
»Du wirst sehen, es wird dir viel Freude bereiten!«, versicherte ihr die Mutter und hastete zurück zu ihrer Arbeit.
Wenn Caroline nicht gewesen wäre, hätte Emily die leeren Seiten des Poesiealbums vielleicht doch schon bald mit gelangweiltem Gekritzel verschmiert. Doch ihre Freundin bewahrte sie davor und machte ihr ahnungslos ein Geschenk, das Emily ihr ganzes Leben lang beglücken sollte.
Ob nun Fügung oder Zufall, auf jeden Fall brachte ihre Mutter ihr am nächsten Morgen ein schweres, in Leinen gewickeltes Paket ans Bett. »Das hat Mister Rhodes gerade im Laden für dich abgegeben«, teilte sie ihr mit, eine Spur von Stolz in der Stimme. »Ich soll dir die besten Grüße von Caroline bestellen, und er wünscht dir schnelle Genesung, natürlich auch im Namen seiner Herrschaft.«
Emilys Gesicht leuchtete auf. Sie fragte sich gespannt, mit was Caroline sie da wohl bedacht hatte.
Ihre Mutter bewegte jedoch etwas anderes. »Du wirst nicht glauben, wer zufällig im Laden stand. Edwina Cobbs! Natürlich hat sie sich nicht ein Wort entgehen lassen. In ein paar Stunden wird es die ganze Nachbarschaft wissen, dass der Commodore seinen Fahrer zu uns geschickt hat.« Sie lachte kurz auf. »Na, deinem Vater wäre es natürlich zehnmal lieber, wenn anstelle des Fahrers die Frau des Commodore mal unseren Laden betreten würde. Aber eine vornehme Dame wie sie lässt natürlich in Boston schneidern und würde sich nie im Leben ihre Stoffe in einem Geschäft wie dem unsrigen aussuchen.«
Das mit einer hübschen blauen Kordel verschnürte Leinenpaket enthielt drei in Leder gebundene Bücher und einen Briefbogen aus schwerem cremeweißen Büttenpapier, den Caroline wohl vom Sekretär ihrer Mutter stibitzt hatte, wie das Monogramm HC, das für Heather Clark stand, verriet. Caroline schrieb ihr mit schöner, rundschwingender Handschrift:
Liebe Emily,
ich bin keine große Briefeschreiberin, aber von wochenlangem Im-Bett-Liegen verstehe ich eine ganze Menge, wie Du weißt. Von Büchern, die mich oft vor dem Verzweifeln bewahrt haben und noch heute zu meinen treuesten Freunden zählen (natürlich erst lange nach Dir!), hast Du ja bisher nichts wissen wollen, Du Sturkopf. Aber vielleicht versuchst Du es jetzt doch einmal. Zeit hast Du ja genug. Du kannst beruhigt sein: Bücherlesen führt nicht bei jedem gleich zur Sucht so wie bei mir, und Du riskierst auch keine Blutarmut, wenn Du mal ein Buch zur Hand nimmst und ein paar Stunden darin liest. Ich habe drei von meinen Lieblingsbüchern für Dich ausgesucht. Wehe, sie gefallen Dir nicht! Lass auf alle Fälle den Kopf nicht hängen. Du bist bestimmt im Handumdrehen wieder auf den Beinen–das hoffe ich jedenfalls, denn langsam wird es mir langweilig, ja, sogar mit meinen vielen Büchern. Du fehlst mir. Der gute Stanley Rhodes ist nicht halb so gut im Rollstuhlschieben wie Du. Er weigert sich sogar standhaft, mit mir Rennen durch die Gänge zu fahren, und ich kann ihn auch nicht dazu bringen, mit mir von der verschneiten Terrasse aus Schneebälle auf die Krähen und auf die anderen Dienstboten zu werfen. Und das will mal ein gehorsamer Kabinensteward der Royal Canadian Navy gewesen sein! Ich glaube, der alte Knabe (Stanley ist gestern zweiunddreißig geworden! Ich wette, bald beginnt er, so grau zu werden wie mein Daddy!) ist es nur gewohnt, Befehle von meinem Vater entgegenzunehmen, dem er nach seinem Abschied so treu gefolgt ist. Du weißt, er nennt ihn auch heute noch zackig Commodore. Na ja, irgendwie tun das ja alle. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich Dir sonst noch schreiben soll. Sieh also gefälligst zu, dass Du wieder auf die Beine kommst. Und dann erzählst Du mir, wie Dir die Bücher gefallen haben. Ich erwarte Lobeshymnen, also übe schon mal!
Deine Freundin Caroline, die ganz ungeduldig Deiner Genesung harrt!
Von wegen keine große Briefeschreiberin! Das war mal wieder eine von Carolines typischen Untertreibungen, dachte Emily, voller Bewunderung für die elegante Handschrift und Ausdrucksweise ihrer Freundin. Sie hatte noch nie etwas so Wundervolles in ihrer Hand gehalten – die köstlich duftende Orange, die es in guten Jahren zu Weihnachten gab, vielleicht einmal ausgenommen.
Emily las den Brief mindestens ein Dutzend Mal, so sehr freute sie sich über die Zeilen ihrer Freundin, die trotz ihrer schrecklichen Krankheit eine ansteckende Lebensfreude besaß. Dann faltete sie ihn sorgfältig zusammen, um ihn in ihr Poesiealbum zu legen. Dieser Brief, der erste, den sie in ihrem Leben erhalten hatte, bedeutete eine große Kostbarkeit, die sie für immer bewahren wollte.
Bei den drei Büchern handelte es sich um die Romane Robinson Crusoe, Die Schatzinsel sowie die Märchensammlung Tausendundeine Nacht. Sie blätterte mäßig interessiert in ihnen herum, schaute sich die vereinzelten Stiche und Zeichnungen an und legte die Bücher schließlich zur Seite. Niemand in ihrer Familie las. Das einzige Buch in ihrem Haus war die Bibel. Aber die nahm auch nur ihre Mutter zur Hand.
Viele Stunden später jedoch, als sich der Nachmittag endlos lange hinzog und die Langeweile wieder einmal unerträglich wurde, griff sie aus schierer Verzweiflung, wie sie die Zeit bloß totschlagen sollte, dann doch zu einem der Bücher, die Caroline ihr geschickt hatte. Mit grimmiger Miene und felsenfest davon überzeugt, über die ersten zwei Seiten nicht hinauszukommen, schlug sie Die Schatzinsel auf und begann zu lesen.
Erst als ihre Mutter mit dem Abendessen kam, vermochte sie sich aus dem Bann zu lösen, der sie stundenlang alles andere hatte vergessen lassen. Hastig stopfte sie sich den Eintopf hinein. Sie konnte gar nicht schnell genug zu den Abenteuern des Schiffsjungen Jim Hawkins und des zwielichtigen Schiffskochs John Silver zurückkehren.
Emily verschlang die drei Bücher und begann sie sofort wieder von vorn zu lesen, derart fasziniert, ja berauscht war sie von diesem neuen phantastischen Universum zwischen zwei Buchdeckeln, das sich ihrem Geist auf einmal offenbarte. Ihr hatte sich die unendliche Welt der Literatur eröffnet, eine Welt, die sie von dem Tag an nie wieder verlassen und die sie stets zu den großen Wundern und Segnungen ihres Lebens zählen sollte.
3
Nach über drei Wochen Quarantäne in der Dachkammer sprach Doktor Thornton eines Abends endlich die erlösenden Worte: »Die Krankheit ist auskuriert. Nun ist nichts mehr zu befürchten. Die Isolation ist aufgehoben, Missis Forester.«
Emily sprang aus dem Bett und wäre dem bärbeißigen Landarzt vor Erleichterung beinahe um den Hals gefallen. Endlich konnte das Leben weitergehen! Sie rannte hinunter in die Küche. »Dad! Leonora! Ich bin gesund!«, rief sie außer sich vor Freude, dass sie diese Tortur endlich überstanden hatte.
»Gott sei Dank, mein Kind!«, antwortete ihr Vater und bedachte sie mit einem warmherzigen Lächeln. »Wir haben uns alle lang genug Sorgen um dich gemacht.«
Emily strahlte. Wie sehr sie doch ihren Vater und ihre Schwester, ja das ganze alltägliche Leben in diesen Wochen vermisst hatte. Es war wunderbar, wieder zurück zu sein. »Wirklich, Dad?«
Frederick ließ die Zeitung sinken, legte seinen gesunden Arm um Emilys Taille und zog sie auf seinen Schoß. »Und ob wir uns um dich gesorgt haben, nicht wahr, Leonora?«
Emilys Schwester, die gerade am Spülbecken stand und Kartoffeln geschält hatte, als Emily in die Küche gestürzt kam, wischte sich die nassen Hände an der Schürze ab. »Sicher haben wir das!«, bestätigte sie, machte dabei aber ein nicht gerade freundliches Gesicht. Ihre Miene war verschlossen, ja fast abweisend.
»Dünn bist du geworden, mein Kind«, stellte Frederick fest.
»Ach was, sie war immer so mager!«, meinte Leonora ungehalten. Dann sagte sie schroff zu Emily: »Nachdem du dich jetzt wochenlang da oben in deiner Kammer auf die faule Haut gelegt hast, wird es höchste Zeit, dass du wieder deinen Teil der Hausarbeit übernimmst! Du kannst gleich damit anfangen.«
Emily rutschte vom Schoß ihres Vaters und sah sie mit sprachloser Betroffenheit an. Ihre Schwester hatte zwar schon immer eine sehr bestimmende Art gehabt, aber dass Leonora sie nach diesen drei schweren Wochen, die hinter ihr lagen, so anfahren würde, damit hätte sie nicht gerechnet. Als ob sie sich die Krankheit selbst an den Hals gehext hätte, um sich vor ihren Pflichten zu drücken! Statt dass ihre Schwester sich freute, dass sie kuriert war, kam sie ihr mit unhaltbaren Vorwürfen!
Leonora machte eine ungeduldige Gebärde. »Also, komm schon und hilf mir bei den Kartoffeln!«
»Was redest du da? Ich habe mir das mit dem Scharlach doch nicht ausgesucht!«, protestierte Emily gegen diese ungerechte Unterstellung und verstand selbst nicht, warum sie sich dennoch schuldbewusst fühlte. Sie wandte sich an ihren Vater. »Kann ich nicht erst meine Sachen wieder ins Zimmer hinunterbringen, Dad? Und baust du mein Bett wieder in unserem Zimmer auf?«
Ihr Vater räusperte sich und faltete geräuschvoll die Zeitung zusammen. »Das wird nicht nötig sein, Kind«, antwortete er.
»Und warum nicht?«, fragte Emily verständnislos.
»Weil es kein gemeinsames Zimmer mehr gibt«, antwortete Leonora hinter ihr, und etwas wie Triumph tönte aus ihrer Stimme. »Das ist jetzt ganz allein mein Zimmer. Du wirst weiterhin in der Dachkammer schlafen.«
Emily glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen, und blickte verstört von ihrem Vater zu ihrer Schwester und zurück. »Das … das kann doch nicht sein!«
»Es ist wirklich besser so, Emily«, sagte Frederick und begann seine Pfeife zu stopfen. »Das Zimmer ist für euch beide allmählich wirklich zu klein. So hat jeder mehr Platz.«
Emily erblickte ihre Mutter in der Tür. »Mom, sag doch du etwas!«, flehte sie. »Ich will nicht in die Dachkammer. Warum kann ich plötzlich nicht mehr mit Leonora in einem Zimmer schlafen?«
Ihre Mutter wich ihrem Blick aus. »Es ist beschlossene Sache, Kind. So hat wirklich jeder mehr Platz. Und die Dachkammer kann man auch sehr hübsch herrichten, du wirst sehen«, versuchte sie ihre jüngste Tochter zu trösten.
»Aber ich brauche doch gar nicht mehr Platz!«, beteuerte Emily mit Tränen in den Augen.
»Vielleicht denkst du zur Abwechslung auch mal an mich!«, sagte Leonora bissig. »Ich habe nämlich genug davon, dieses kleine Zimmer mit dir zu teilen und mir dein ständiges Gebrabbel im Schlaf anzuhören. Mir reicht es, dass du jede Nacht …«
»Genug!«, donnerte ihr Vater und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es knallte. Alle zuckten zusammen. »Die Sache ist beschlossen, und damit hat es sich. Ich will nichts weiter hören – weder jetzt, noch später.«
Emily konnte nicht begreifen, wie Leonora ihr das antun konnte, auch wenn sie tatsächlich einen etwas unruhigen Schlaf hatte und bei jedem Unwetter zu ihrer Schwester ins Bett kroch. Sie hütete sich jedoch, in Gegenwart ihrer Eltern darüber auch nur noch ein einziges Wort fallen zu lassen. Ihr Vater war gewöhnlich ein recht umgänglicher Mann, doch wenn er erst einmal eine Sache für beschlossen erklärt hatte, dann war das wirklich das letzte Wort, so wie das Amen in der Kirche. Und dann tat man besser daran, sich nicht länger aufzulehnen oder seine Unzufriedenheit durch Maulen oder eine beleidigte Miene zur Schau zu stellen. Das konnte einem schmerzhaft zu stehen kommen.
Sie gab die Hoffnung jedoch nicht auf, Leonora doch noch umstimmen zu können. Immerhin waren sie doch Schwestern und gehörten demnach zusammen! Sie war sogar zu dem Versprechen bereit, tapfer zu sein und nicht mehr zu ihr ins Bett zu kommen, wenn es blitzte und donnerte. Und ihre nächste Weihnachtsorange, dieses wunderbarste aller Geschenke, dem alle schon monatelang entgegenfieberten, wollte sie ihr auch versprechen. Konnte es ein größeres Zeichen des Opfers und der Schwesterliebe geben? Nein, ganz unmöglich! Leonora würde überwältigt sein und bestimmt wieder ihr Zimmer mit ihr teilen wollen!
Ja, Emilys Zuversicht hätte nicht größer sein können – und umso tiefer traf sie dann die Zurückweisung ihrer Schwester.
»Was willst du? Scher dich aus meinem Zimmer!«, herrschte Leonora sie an, als Emily sich in dieser Nacht zu ihr schlich. »Und lass es dir ja nicht noch einmal einfallen, nachts durchs Haus zu geistern und mich so zu erschrecken!«
»Aber es ist doch auch für dich nicht schön, so allein im Zimmer zu sein!«, versuchte Emily sie zu überzeugen, und meinte, mit Engelszungen zu reden. »Wir können uns vor dem Einschlafen nichts mehr erzählen, so wie früher immer – und wenn ich von nun an da oben unter dem Dach schlafe und du hier, können wir doch auch morgens und abends nicht mehr miteinander unsere Gebete sprechen!« Alles unwiderlegbare Einwände, die nur einen einzigen Schluss zuließen, wie Emily fand.
Nicht jedoch ihre Schwester. »Was macht das schon für einen Unterschied? Dann betest du eben allein!«, erwiderte Leonora gereizt. »So, und jetzt troll dich. Ich bin müde. Und wenn du noch einmal nachts so durch das Haus schleichst und mich störst, rufe ich Dad – und dann setzt es Hiebe, kapiert?«
Emily fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen. »Wie … wie … kannst du nur so gemein sein?«, stammelte sie mit erstickter Stimme.
»Ich bin nicht gemein, Schwesterchen«, antwortete Leonora von oben herab. »Ich bin nur, ganz im Gegensatz zu dir, du Heulsuse, kein kleines Kind mehr. Aber davon verstehst du natürlich nichts. Und jetzt verzieh dich gefälligst, ehe ich es mir noch anders überlege und Dad schon jetzt rufe!«
Blind vor Tränen, schlich sich Emily zurück in ihre Dachkammer. Etwas, was sie für gottgegeben und auf ewig für unverbrüchlich gehalten hatte, das Band schwesterlicher Verbundenheit, hatte seinen ersten tiefen Riss bekommen.
4
Gewöhnlich sind einige warme Tage im April auf Prince Edward Island noch längst kein Grund, den Einzug des Frühlings zu feiern und die Schneekufen von den Pferdewagen zu montieren. So manch ein Schneesturm, begleitet von eisigen Nordostwinden, hat häufig noch in den letzten Apriltagen die Hoffnung auf ein frühes Weichen des Winters jäh zunichte gemacht.
Auch in diesem Jahr setzte der Frühling erst Anfang Mai ein. Im Nu verwandelten schmelzender Schnee und milder Regen Straßen und Wege in Schlammpfade. Wer von den Besitzern der fast dreitausend Automobile, die Mitte der zwanziger Jahre schon auf der Insel registriert waren, sein Gefährt nicht unbedingt brauchte, ließ es in dieser Zeit aufgeweichter Straßen besser ungenutzt stehen. Denn allzu häufig blieben Autos im tiefen Morast stecken, und ihre Fahrer wurden zum Gespött der Leute, wenn ein Pferdegespann geholt werden musste, um das Automobil aus dem Dreck zu ziehen.
Überall schmückte sich die Landschaft mit frischem Grün, das voller Ungeduld und mit unbändigem Lebensdrang der Sonne entgegenspross, durch Scholle und Rinde brach und sich von den schützenden Schichten unzähliger Knospenschalen befreite. Und am sonnigen Himmel tauchten die ersten Schwärme Zugvögel auf, die aus dem Süden zurückkehrten, um die Insel im blauen Sankt-Lorenz-Strom wieder zu bevölkern.
Niemand begrüßte den Frühling wohl mit mehr Dankbarkeit und Erleichterung als die Farmer. Der lange Winter hatte längst ihre Vorräte an Heu und Kraftfutter aufgezehrt, und in vielen Stallungen vermochte sich das abgemagerte Vieh kaum noch auf den Beinen zu halten. Jeder Farmer dankte dem Allmächtigen, wenn sein Vieh es im Frühling wieder hinaus aufs Gras schaffte. Es noch einmal »hinaus aufs Gras schaffen« war eine gebräuchliche Redewendung, die jedoch nicht nur die Farmer in Verbindung mit ihrem Vieh benutzten. Auch die Alten und Gebrechlichen führten diese Redensart im Mund, wenn sie in langen Wintermonaten ihrer Hoffnung – oder ihren Zweifeln – Ausdruck verliehen, ob sie es wohl noch einmal bis in den neuen Frühling, eben »auf das Gras schaffen« würden.
Auch Emily hatte das Ende des Winters kaum erwarten können. Ihre Freude, dass der Frühling sich endlich durchgesetzt hatte und die fruchtbare Insel nun in einen blühenden Garten verzauberte, wurde in diesem Jahr jedoch durch die wachsende Entfremdung von ihrer Schwester stark getrübt. Früher hatten sie gescherzt und in ihrem Übermut allerlei Unsinn angestellt, während sie ihre schweren Stiefel, die dicken schwarzen Wollstrümpfe und die lästigen, weil kneifenden Strumpfhalter zusammen mit Winterschal, Handschuhen und Wollmützen mit Ohrenklappen in die große Truhe geräumt hatten, um sie erst wieder sechs, sieben Monate später hervorzuholen, wenn die letzten Eisfischer drüben von Robinson’s Pond aufflogen und ihre lange Reise in den warmen Süden antraten. In diesem Jahr ordnete jedes der Mädchen seine Wintergarderobe erstmals allein, und es fielen auch keine Scherze.
Emily verstand nicht, dass Leonora immer weniger mit ihr zu tun haben wollte und sie mehr denn je barsch bevormundete, als wäre sie ein dummes kleines Baby. Ihre Schwester gab sich nicht mehr mit ihr ab, und auf dem Weg zur Schule schloss sie sich neuerdings der schon fast vierzehnjährigen Deborah Cobbs an, die genauso plump und schwatzsüchtig war wie ihre Mutter und die sie, Emily, auf den Tod nicht ausstehen konnte, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte.
In dieser Zeit wurde Emily zum ersten Mal in ihrem Leben schmerzhaft bewusst, dass sie keine Verwandten auf der Insel besaß, weder Großeltern noch Tanten und Onkel, und damit natürlich auch keine Cousinen und Vettern, mit denen sie hätte Freundschaft schließen können. Ihre Eltern waren erst kurz vor der Geburt ihrer Schwester nach Prince Edward Island gekommen. Und das Einzige, was sie über die Vergangenheit ihrer Eltern wusste, war, dass ihr Vater in Halifax auf Nova Scotia in einem Waisenhaus aufgewachsen war und dass über die Familie ihrer Mutter, mit der sich ihre Eltern offenbar überworfen hatten, niemals gesprochen werden durfte. Nicht einmal Leonora wagte es, dieses Thema anzuschneiden. Es war einfach tabu. Doch das brachte natürlich nicht die Frage nach dem Warum in ihr zum Schweigen, sondern verdrängte sie nur in tiefere Regionen ihrer Gedanken.
Emily litt sehr unter der harschen Ablehnung, die sie in den Monaten nach ihrer Genesung von ihrer Schwester erfuhr. Und mehr als einmal versuchte sie, der Ursache auf den Grund zu kommen und sich mit Leonora auszusprechen. »Sag mir doch, wenn ich dir etwas getan habe! Was immer es ist, ich habe es bestimmt nicht böse gemeint, und ich verspreche dir auch, dass ich es wiedergutmache! Sag mir nur, was ich dir getan habe!«, bat sie eindringlich.
»Gar nichts hast du getan, außer so nervig zu sein, wie du nun mal bist!«, antwortete Leonora unwirsch. »Und ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Warum liegst du mir dauernd mit diesem Gejammer in den Ohren, Emily? Ich habe einfach weder Lust noch Zeit, mit dir Kleinkinderspielchen zu spielen. Dafür bin ich zu erwachsen, begreif das endlich. Such dir Mädchen, die so alt sind wie du, und hör endlich auf, mir auf die Nerven zu gehen!«
Wenn es nur das gemeinsame Spielen, die gemeinsamen Gebete vor dem Aufstehen und Zubettgehen, das nächtliche Austauschen von geflüsterten Vertrautheiten im Bett vor dem Einschlafen und Ähnliches gewesen wäre, was Leonora nicht länger mit ihr teilen mochte, hätte Emily es ja vielleicht noch verstanden, wenn auch nicht weniger schmerzlich bedauert. Ihre Schwester war nun einmal über zwei Jahre älter als sie, und der Altersunterschied war wirklich gewaltig, wenn sie es recht überlegte.
Aber es waren nicht allein diese langjährigen Gewohnheiten geschwisterlicher Verbundenheit, mit denen Leonora brach. Ihre Schwester legte ein ganz neues Verhalten an den Tag, das in den folgenden Monaten zunehmend von Überheblichkeit und Herrschsucht bestimmt wurde. Nichts konnte sie ihr mehr recht machen. Und alles, was sie sagte, tat sie als kindisches Geplapper ab. Ja, Leonora behandelte sie zunehmend wie ein kleines Kind. Sogar wie sie ihre Zöpfe zu flechten hatte, wollte sie ihr vorschreiben. Und was am schlimmsten war: Leonora stellte sie vor ihrem Dad bloß, wann immer sich ihr dazu eine Gelegenheit bot.
Emily beklagte sich bitterlich bei ihrer Mutter. »Immer muss ich nach ihrer Pfeife tanzen! Und nie lässt sie ein gutes Haar an mir!«, beschwerte sie sich. Ihre Hoffnung, dass ihre Mutter dem gemeinen Benehmen ihrer Schwester endlich Einhalt gebieten würde, erfüllte sich jedoch nicht. Ja, ihre Mutter schien gar nichts tadelnswert daran zu finden.
»Leonora ist schon ein großes Mädchen und sieht daher viele Dinge anders als du. Sie meint es nur gut mit dir, auch wenn sie manchmal vielleicht etwas streng mit dir ist.«
»Streng? Sie ist gemein!«, rief Emily erregt.
»Das will ich von dir nicht noch einmal hören!«, wies ihre Mutter sie ärgerlich zurecht. »Leonora ist deine ältere Schwester, und du bist ihr Gehorsam schuldig, so wie es sich in einer guten Familie gehört!«
»Aber wenn sie mich doch immer …«, setzte Emily zu einem empörten Widerspruch an.
»Genug! Ich will nichts mehr von diesem dummen Gerede und Gezänk hören, Emily!«, schnitt ihre Mutter ihr streng das Wort ab und erhob die Hand zur Warnung, dass es jeden Moment eine Ohrfeige setzen könnte. »Du wirst tun, was Leonora dir sagt! Dafür sind ältere Schwestern da. Also rauft euch gefälligst zusammen! Ich dulde keinen Zank unter meinen Kindern – und schon gar kein Gepetze, haben wir uns verstanden, Emily Forester?«
Emily nickte stumm, mit hochrotem Gesicht und sich fest auf die Lippen beißend, um ja die Tränen des Zorns und der Enttäuschung zurückzuhalten.
»Wir alle müssen lernen, uns mit dem für uns vorbestimmten Platz zu begnügen und das Beste daraus zu machen«, fügte ihre Mutter noch hinzu. »Je früher du das kannst, desto besser wirst du im Leben zurechtkommen. Und nun geh!«
Emily würgte ihren Widerspruch hinunter. Sie musste sich geschlagen geben. Denn bei ihrem Vater versuchte sie erst gar nicht, sich über Leonora zu beschweren. Sie wagte es nicht. Mit diesen häuslichen Angelegenheiten belästigte man ihn besser nicht. Derlei Dinge zählten zu den »Frauensachen« und damit zu den Dingen geringer Bedeutung, die von der Mutter und Hausfrau zu regeln waren.
Außerdem wäre es auch vergebens gewesen, hatte Leonora ihren Vater doch um den Finger gewickelt. Er hatte sie eindeutig zu seinem Liebling erkoren, dem er alles durchgehen ließ. Während Emily bei der Arbeit im Haushalt eine lange Liste von Pflichten zu erfüllen hatte, durfte Leonora vorn im Laden dem Vater zur Hand gehen, wenn er Hilfe benötigte. Nur ihr erklärte er die besonderen Eigenschaften und die Handhabung der Stoffe. Und auch nur sie durfte ihm abends sein Glas Milch mit Honig bringen, das er stets vor dem Schlafengehen zu sich nahm.
Und natürlich verband die beiden die Liebe zum Schachspiel. Ihr Vater nannte es »das Spiel der Könige – und zugleich König aller Spiele«. Er hatte sogar in einer Ecke seines Geschäftes ein Schachbrett stehen, um sich neue Züge auszudenken oder berühmte Partien nachzuspielen, wenn es nichts zu tun gab. Leonora hatte sich schon mit zehn von seiner Begeisterung anstecken und sich bereitwillig unterweisen lassen. Und nun verbrachte sie regelmäßig Stunden mit ihrem Vater vor dem Schachbrett. Dagegen hatte sie, Emily, nie Gefallen an dem Spiel mit den schwarzen und weißen Figuren gefunden. Ihr fehlte nicht nur die Geduld, sich mehrere Züge im Voraus auszudenken und sich Strategien zurechtzulegen, sie vermochte auch nicht länger als eine halbe Stunde still vor dem Brett auszuharren. Ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, die mit ihrem Vater den halben Sonntag über eine Partie gebeugt verbringen konnte, ohne kribbelig zu werden und ins Freie stürmen zu wollen.
Aber auch wenn sie, Emily, Interesse am Schachspiel mit ihrem Vater gezeigt hätte, hätte es ihr nichts genutzt. Voller Eifersucht wachte Leonora nämlich darüber, dass sie ihr auch nicht eines der Privilegien, die sie für sich allein in Anspruch nahm, streitig machte. Der Vorfall bei der abendlichen Rasur ihres Vaters führte Emily dies zu Beginn des Sommers besonders deutlich vor Augen.
Ihr Vater, ein gut aussehender Mann von schlanker und hochgewachsener Gestalt, gab viel auf seine gepflegte äußere Erscheinung. Und da er unter besonders starkem Bartwuchs litt und sich mit Bart oder gar mit Bartstoppeln nicht leiden mochte, rasierte er sich zusätzlich zur Morgenrasur noch ein zweites Mal am frühen Abend. Irgendwann im März hatte er auf den Wunsch ihrer Schwester hin damit begonnen, ihr in der Küche beizubringen, wie man die Rasierseife im kleinen schwarzen Porzellantiegel mit der richtigen Menge Feuchtigkeit zum Schäumen brachte, den Schaum gleichmäßig auf der Haut auftrug und das Rasiermesser, nachdem die Klinge am Lederriemen die nötige Schärfe erhalten hatte, sachkundig über die Haut führte.
Die Prozedur des Rasierens hatte auf Emily von Kind an eine besondere Faszination ausgeübt. Sie wurde es nie müde, ihrem Vater dabei zuzusehen, wie das gefährlich scharfe Messer in seiner Hand eine tiefe Schneise nach der anderen durch den Schaum schnitt und dort glatte, herrlich aromatische Haut hinterließ, wo gerade noch dunkle Stoppeln gewuchert hatten. Und nun lehrte er Leonora diese atemberaubende Kunst, ein dermaßen gefährlich scharfes Messer mit sicherer Hand über seine Kehle zu führen! Eine Kunst, für die sie ihren Vater wie einen todesmutigen Helden bewundert hatte, solange sie denken konnte. Es erfüllte sie mit brennendem Neid und stiller Empörung, dass Leonora nun mit diesen fast geheiligten Gerätschaften umgehen durfte. Nichts erschien ihr ungerechter. Ihre Schwester kam ihr wie jene verbrecherische ägyptische Hohepriesterin vor, von der sie in einer der Märchen- und Sagensammlungen aus Carolines Bibliothek gelesen hatte und die sich in dieser Geschichte durch gemeine Intrigen ihr hohes Amt erschlichen hatte, um im Auftrag einer fremden Macht den gütigen Herrscher zu töten.
Eines frühen Abends, als Leonora draußen im Häuschen neben dem Hühnerstall auf dem Abort hockte und ihre Mutter auf der anderen Seite des Hinterhofs auf dem Platz vor dem Gemüsegarten einen Korb Wäsche auf die Leine hängte, saß Emily am großen Küchentisch und schälte Kartoffeln. Vor dem Fliegengitter surrten die Insekten, Hühner gackerten im Hof, einer der Hunde von den Robinsons bellte jenseits des Obsthains, und goldenes Sonnenlicht, in dem Staubflocken tanzten, flutete in die Küche. Die friedvolle Stimmung dieses wunderschönen Sommerabends zauberte ein verträumtes Lächeln auf ihr Gesicht, während sie ihrem Vater dabei zusah, wie er alles für seine abendliche Rasur vorbereitete. Der Klappspiegel stand vor ihm, und das geschärfte Messer lag bereit. Leise vor sich hin summend, brachte er die Rasierseife im Tiegel zum Schäumen.
Als er den Kopf hob, fing er Emilys Blick auf. Er zögerte kurz und blinzelte ihr dann verschwörerisch zu. »Na, möchtest du es auch mal versuchen?«, fragte er und hob den Rasierpinsel, der von einer kleinen Haube weißen Schaums gekrönt war. »Was meinst du, traust du es dir genauso zu wie deine große Schwester?«
Emilys Lächeln ging in ein Strahlen über, das nur die Kraft der Sonne zu übertreffen vermochte. »O ja, Dad!«, rief sie in überschwänglicher Freude, dass ihr Vater, den sie als das Maß aller Dinge anhimmelte, endlich auch sie ernst nahm und sie durch einen besonderen Beweis seiner väterlichen Zuneigung auszeichnete.
»Dann komm her!«
Sie ließ das Schälmesser in die Schüssel mit den Kartoffeln fallen, sprang vom Stuhl auf, wischte sich die Hände an der verschlissenen Schürze ab, die sie sich über ihr sommerliches Hängerkleid gebunden hatte, und stand im nächsten Moment an der Seite ihres Vaters.
Er schob seinen Stuhl ein wenig vom Tisch zurück, damit sie sich auf seinen Schoß setzen konnte, und drückte ihr den Pinsel mit dem Rasierschaum in die Hand. Emily schlug vor Aufregung und Freude das Herz im Hals. Auch ein juwelenbesetztes Zepter hätte sie in diesem Moment in keine größere Verzückung versetzen können.
»Ja, oben am linken Ohr anfangen und dann zügig in kleinen kreisenden Bewegungen um das Kinn herum und zum rechten Ohr hinauf«, hielt er sie an, während Emily ihm das Gesicht einseifte. »Warte, hier noch ein bisschen.«
»Oh, entschuldige, Dad!«
»Aber das ist doch nicht schlimm. Im Gegenteil, du machst das wirklich schon ganz gut«, lobte er sie.
»Wirklich, Dad?«
»Ja, du bist schon ein großes Mädchen.«
Emily strahlte ihn an. Sicher war sie noch nie in ihrem Leben glücklicher gewesen.
»So, und jetzt musst du den Pinsel wieder in den Tiegel …« Ihr Vater kam nicht weiter, denn in dem Augenblick kam Leonora in die Küche gestürmt. Mit verkniffenem Gesicht riss sie Emily den Rasierpinsel aus der Hand, knallte ihn auf den Tisch, packte sie grob am Oberarm und zerrte sie vom Schoß ihres Vaters.
»Aua, du tust mir weh!«, schrie Emily auf.
»Ja, hoffentlich!«, fauchte Leonora sie an. »Kaum dreht man dir den Rücken zu, da vergisst du auch schon deine Pflichten! Du taugst wirklich zu nichts, Emily!«
Verstört blickte Emily in das wutverzerrte Gesicht ihrer Schwester, die sie noch nie zuvor so außer sich gesehen hatte. Oder war das schon Hass, was in Leonoras Miene zum Ausdruck kam? »Aber … ich … ich habe doch alles gemacht. Die Kartoffeln sind geschält«, stammelte sie bestürzt und schaute Hilfe suchend zu ihrem Vater. »Dad, sag du ihr doch, dass du mich …«
Leonora ließ sie erst gar nicht ausreden. »Dad ist viel zu nachsichtig mit dir. Aber wenn du glaubst, du kannst ihm Honig um den Bart schmieren, dann hast du dich geirrt!«, geiferte sie. »Und wenn du mit den Kartoffeln fertig bist, dann kümmere dich gefälligst um die Hühner. Und sieh zu, dass du nicht wieder die Stalltür offenlässt!«
Emily rechnete fest damit, dass ihr Vater ihre Partei ergreifen und Leonora nun endlich einmal in ihre Schranken weisen würde. Ihre Erwartung wurde jedoch bitter enttäuscht, als er stattdessen bestürzend nachsichtig zu ihrer Schwester sagte: »Beruhige dich wieder und veranstalte nicht so einen Radau, Leonora. Und mach nicht so ein finsteres Gesicht. Damit kannst du ja sogar frische Molke in Sauerquark verwandeln!« Das klang so, als hätte er an ihrem Verhalten im Grunde genommen nichts auszusetzen. Und zu Emily gewandt fuhr er gleichmütig fort: »Tu, was sie sagt, und kümmere dich um die Hühner, Kind.«
Die Ungerechtigkeit schnürte Emily Herz und Kehle zu. Schnell lief sie aus der Küche. Sie wollte ihrer Schwester nicht den zusätzlichen Triumph gönnen, sie in Tränen ausbrechen zu sehen, um sie dann wieder einmal als Heulsuse verspotten zu können.
Leonora kam ihr wenige Augenblicke später nach, als ihre Mutter mit dem Wäschekorb ins Haus zurückkehrte, und verstellte ihr in der Ecke zwischen Abort und Hühnerstall den Weg. Von der Küche aus war dieser Winkel des Hinterhofes nicht einzusehen. »Tu das nie wieder, oder du wirst mich kennenlernen, wie du es dir nicht einmal in deinen schlimmsten Alpträumen vorstellen kannst!«, zischte Leonora. Sie unterstrich ihre Drohung, indem sie Emily gegen die Bretterwand des Abortes presste, sie am Kragen ihres Kleides packte und den Stoff in ihrer Faust einmal halb herumdrehte, so dass er Emilys Kehle zuzuschnüren drohte.
Emilys Augen weiteten sich vor Schreck. Sie bekam es regelrecht mit der Angst zu tun. »Lass mich los! … Ich weiß gar nicht, was du willst!«, stieß sie entsetzt hervor.
»Wenn einer Dad rasiert, dann bin ich das, hast du mich verstanden? Das habe ich mir verdient! Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, dass du versuchst, dich bei ihm einzuschmeicheln; dann schlage ich dich grün und blau!«, drohte Leonora ihr. »Und glaub bloß nicht, das ist nur Gerede! Ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, dass ich es tun werde!«
Emily starrte sie zitternd an. »Ich hasse dich! … Ich hasse dich!«, schrie sie und spuckte ihr ins Gesicht.
Leonora zuckte zusammen. Doch anstatt nun den letzten Rest Beherrschung zu verlieren und sie zu schlagen, wie Emily es erwartete, ließ ihre Schwester sie los und trat einen Schritt zurück. Sie wischte sich mit dem Handrücken den Speichel von der Wange und lächelte plötzlich. Doch es war kein freundliches Lächeln, mit dem sie Emily bedachte. »Hass du mich nur. Das ist ganz in Ordnung, solange du nur nicht vergisst, auf welchen Platz du gehörst – und was dir blüht, wenn du dich nicht daran hältst!« Dann wandte sich Leonora abrupt um und jagte die Hühner mit Fußtritten in den Stall.
In dieser Nacht begann Emily Tagebuch zu führen. Denn in ihr tobten entsetzliche Gedanken und Empfindungen, die sie nicht einmal ihrer Freundin Caroline anzuvertrauen wagte.
Sie setzte sich an das breite Fensterbrett des Giebelfensters, durch das helles Mondlicht fiel, griff zum Bleistift und schrieb, ohne lange zu überlegen, als ersten Satz in ihr Tagebuch: Ich hasse meine Schwester, und ich wünschte, Leonora wäre tot, tot, tot!
5
Die Drohung ihrer Schwester hatte Emily wirklich Angst gemacht; sie nahm diese Drohung ernst. Fortan achtete sie darauf, Leonora möglichst aus dem Weg zu gehen und ihr keinen Anlass zu bieten, wieder über sie herzufallen. Was blieb ihr auch anderes übrig? Leonora hatte den Vater auf ihrer Seite, und damit war jeder Gedanke an Auflehnung zwecklos. Denn auch wenn sie von ihrer Mutter Beistand bekommen hätte, hätte das wenig ausgerichtet. Vaters Wort war in ihrer wie in jeder anderen Familie, die sie kannte (die Clarks vielleicht einmal ausgenommen!), nun mal Gesetz. Daran vermochte auch die Mutter nur in den seltensten Fällen zu rütteln, sofern sie es denn überhaupt versuchte.
Außerdem konnte sich Emily nicht daran erinnern, dass ihre Mutter ihrem Vater jemals die Stirn geboten und nachdrücklich darauf bestanden hätte, dass er eine Entscheidung zurücknahm oder doch wenigstens in ihrem Sinne korrigierte. Ein solches Verhalten lag einfach nicht in ihrer zurückhaltend ruhigen, ja manchmal geradezu erschreckend wortlosen und schwermütigen Natur. Ihre Mutter war von robuster und kräftiger Statur, und ihr starker Körper vermochte unermüdlich und klaglos zu arbeiten. Aber diese Härte und Ausdauer hatte nur Geltung in Verbindung mit der täglichen Plackerei im Haus, im Gemüsegarten oder bei der Nachbarschaftshilfe auf den Äckern und Feldern der umliegenden Farmen. Im Verhältnis zum Vater ihrer Kinder kennzeichneten dagegen starke Selbstbeschränkung und Widerspruchslosigkeit ihr wahres Wesen. Ob es daran lag, dass sie keine Söhne, sondern »nur« zwei Mädchen zur Welt gebracht hatte?
Jedenfalls konnte sich Emily auf das seltsame Verhalten ihrer Mutter oft keinen vernünftigen Reim machen. Gelegentlich fiel ihr auf, dass ihre Mutter immer wieder dem Blick ihres Vaters auswich, und dann beschlich sie der verrückte Gedanke, dass ihre Mutter irgendetwas Sündhaftes getan haben könnte, von dem ihr Vater wusste. Dass sie deshalb unter Schuldgefühlen litt und sich nicht einmal bei Kleinigkeiten gegenüber ihrem Ehemann zu behaupten wagte. Ob das wohl auch der Grund war, warum ihre Mutter nie lachte oder sonstige Zeichen von Fröhlichkeit zeigte?