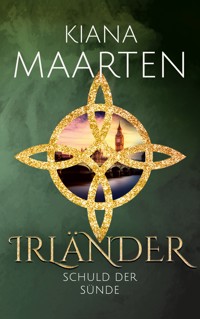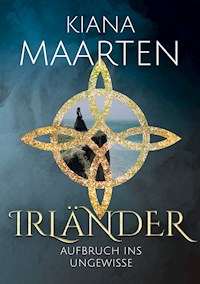
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Aufbruch ins Ungewisse", der erste Band von Kiana Maarten opulenter Irlandsaga, bietet alles, was man von einem Roman erwartet: Abenteuer, Romantik und Spannung. Eine im Umbruch gekommene Ära, in der eine leidenschaftliche Liebesgeschichte über Mary Anne und Jack, der stolze Ire, die Leser in ihren Bann zieht. Nach dem Tod ihrer Eltern und einer beschwerlichen Reise durch Amerika um 1880, gefolgt von einem langen Kampf der Gefühle zu Jack und den Einwohnern der Stadt, heiratet Mary Anne den stolzen Iren, um schließlich mit Jack in die Heimat ihrer Väter zu fliehen - nach Irland! Dort soll ihr eigentlicher Kampf erst beginnen. Eine Geschichte von Liebe, Abenteuer, Revolutionen und Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Historisch korrekt. Der Link zu dem Video der Irlandsaga von Kiana Maarten Band 3 "Schuld der Sünde" kann gerne kopiert werden. https://www.youtube.com/watch?v=NB-ioybsAiQ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
ERSTER TEIL
***
Abschied
BOSTON 1880
Ihr Herz schlug ihr so heftig gegen die Brust, als hätte sich seine Größe in den letzten Minuten verdoppelt. Ein fast schon lähmendes Gefühl, das Mary Anne bis in ihre Magengrube spürte. Umso weniger bedauerte sie, dass sie im Strudel der Ereignisse kaum etwas gefrühstückt hatte; eine gebutterte Scheibe Weißbrot, ein Schluck Tee, mehr war bei all den Sorgen und dem Kummer der vergangenen Tage nicht herunterzubekommen. Sie musste sich beherrschen, nicht aus dem Landauer zu springen und das noch frische Grab ihres Vaters freizuschaufeln, um sich zu vergewissern, dass er wirklich tot war. Auch wenn Mary Anne wusste, dass sie zu solch einem Kraftakt überhaupt nicht imstande gewesen wäre, so zart und elegant, wie sie in ihrer eingeschnürten Teile war. Der einzige Mensch, den sie je geliebt hatte, lag nun sechs Fuß unter der Erde, unter einem Berg von Blumen und Kränzen an einer repräsentativen Stelle des Friedhofs.
Vater hatte mich großgezogen, seit ich acht war, dachte sie, nein, meine Gouvernante hatte die Aufgabe übernommen; vorher hatte ich eine Mutter gehabt. Du musst Ruhe bewahren, ermahnte sie sich, während ihre Schläfen so wild pochten, dass sie kaum einen Gedanken fassen, geschweige denn ein Gespräch führen konnte. Sie erinnerte sich nur bruchstückhaft an die Rede des Pfarrers: dass ihr Vater ein geschätzter Bürger, Wohltäter und Geschäftsmann von Boston gewesen war. Sie beschwor vor ihrem inneren Auge sein Gesicht herauf, die großen Linien um seinen Mund und die Augen, die hohe Stirn und sein graues Haar, das besonders schön anzusehen war. Ihr junges Gesicht wirkte wie eine Maske, als sie ihre Augen wieder öffnete und auf den schwarz marmorierten Taft ihres Kleides starrte. Die Schneiderin hatte in der kurzen Zeit, die ihr zur Verfügung stand, gute Arbeit geleistet. Denn der Tod von Geoffrey South kam unerwartet und obwohl kein Fieber oder eine Seuche in der Stadt kursierte wie sonst zu dieser Jahreszeit. Dieses Jahr wurde Boston von Krankheiten verschont, die die Seemänner aus Übersee mitbrachten und die sich regelmäßig von den verdreckten Gassen des Armenviertels bis zur Stadtmitte ausbreiteten. Ihre Mutter starb vor drei Jahren an Tuberkulose, auch eine Krankheit, über die man so gut wie nichts wusste.
Sie musste bei diesem Gedanken aufgestöhnt haben, denn ihre Zofe hob den Blick und sah sie besorgt an.
»Es geht mir gleich wieder besser«, beruhigte Mary Anne sie. »Ich brauche nur einen Moment.«
Dann saß sie eine Weile still da, ganz ohne zu denken. Erst der anschwellende Lärm auf dem nahe gelegenen Kai riss sie aus ihrer Starre. Sie holte tief Luft und streckte zaghaft ihren Kopf aus dem Fenster, um den halbwegs kühlen Fahrtwind im Gesicht zu spüren. Die Sonne stand im Zenit und schien über die hohen Masten und Segel der Schiffe im Hafen. Es war ein warmer Tag. Selbst so nah am Wasser wehte zu dieser Tageszeit kein Lüftchen, und die Gerüche von heißem Teer und Fischabfall drangen bis ins Innere der Kutsche. Mary Anne stieß einen Strom, warmer feuchter Luft aus und zwang sich etwas zu entspannen. Doch der Tod ihres Vaters brach ihr schlicht das Herz. Der Patriarch war bei der wöchentlichen Begehung in seiner Spinnerei zusammengebrochen. Herzversagen lautete die Diagnose des Arztes, ein Mann, der selbst unter gesundheitlichen Einschränkungen litt, untersetzt, wassersüchtig, in wattiertem Gehrock und Lackstiefeln, die seine aufquellenden Beine zusammenhielten.
Wie wird es jetzt weitergehen? Mary Anne verspürte eine langsam anschwellende Panik. Großer Gott! Wen konnte sie jetzt noch fragen, wenn sie Hilfe brauchte?
Ihre ehemalige Gouvernante, bemerkte, dass sich ihre Züge veränderten, ihre Augen flammten kurz auf. »Sie sind nun ganz auf sich allein gestellt, ohne männliche Führung. Sie müssen stark sein und auf Gott vertrauen. Ihr Vater wusste, warum er ...« Die Zofe sank kurz in sich zusammen, bevor sie kämpferisch ihr Kinn hochzog. »Mich bei Ihnen behielt. Er war stets um Sie besorgt gewesen, ja das war er.«
Mary Anne sah sie unverwandt an. Eleonora Winters war, was Geoffrey South zu Lebzeiten als alte Jungfer bezeichnet hatte. Sie war Ende vierzig, nicht so alt und erhaben wie ihr Name, der zum ersten Mal im Jahre 1066 in Gloucestershire, England, erwähnte wurde und dessen Geschichte mit der »alten Welt« verbunden war wie auch die ihrer Familie. Die Angestellte war schlank und hatte blassblondes gekräuseltes Haar, ihre sehr lange, schlanke Nase ließ sie ein wenig linkisch aussehen, was sie aber nicht war. Miss Winters war warmherzig, gütig und für ihr Alter eher naiv.
Gedankenverloren blickte Mary Anne aus dem Fenster, zumindest dem wenigen, das sie selbst dafür halten konnte. Es waren noch nicht viele Menschen auf den Straßen. Erst nach dem Gottesdienst würde die feine Bostoner Gesellschaft auf der Main Street promenieren und den Kindern Eis oder Zuckerstangen kaufen, während die arme Bevölkerungsschicht am Sonntag für das Nötigste hart arbeiten musste. Sie spürte, dass es von nun an auch nicht mehr nur unbeschwerte Tage gab. Und obwohl sie nur wenig Zuversicht hatte, dass ihr Leben sich jemals wieder lebenswert anfüllen würde, mochte sie es nicht einfach wegwerfen. Ihre Befürchtung wurde zur Stimme ihres Vaters.
»Ich bin bei dir”, schien er zu flüstern. »Ich liebe dich. Verzeih mir, dass ich dich ins Unglück stürze.” Unglück! Was denn für ein Unglück? Plötzlich überkam Mary Anne eine dunkle Vorahnung.
»Ich werde das Personal verringern müssen, Papas Kammerdiener und Schreiber. Auch in der Küche brauchen wir nicht mehr als drei Paar Hände. Die Zeit der opulenten Dinners, bei denen mein Vater Funktionären, Bankiers und der Geschäftswelt von Boston das Geld aus den Tasch…« Sie hielt abrupt inne. Aber sie hatte bereits zu viel gesagt, Miss Winters sah betroffen auf ihre Hände.
Der Witwer war über all die Jahre in Boston ein angesehener Mann gewesen, doch als Geschäftsmann war er skrupellos. Mit Schuldnern ging er erbarmungslos um. Seine Arbeiter, meist Kinder und Frauen, mussten bis zu fünfzehn Stunden am Tag schuften. Mary Annes Vater konnte jedoch auch liebevoll und fürsorglich sein. In ihm hatten zwei Seelen gewohnt, die sich ständig bekämpften. In Mary Anne schlummerte auch etwas Hartes, sogar Wildes und Unzähmbares, so ungern sie sich das auch eingestand. Hinter ihrer rosigen Haut, den hellgrünen Augen und dem hellbraunen Haar verbarg sich ein heller Verstand, der genau wusste, dass Veränderungen in der Luft lagen.
Nach einer Weile hielt die Kutsche vor einem weißen Haus mit korinthischen Säulen. Die von Gaslampen gesäumte Straße war die erste Adresse in Boston. Elegante Häuser mit schwarzen Eisenzäunen prägten den Stadtteil. Mary Anne blieb noch einen Moment sitzen, um durchzuatmen. Die Luft war dünn und beinahe trocken. Sie verspürte kein großes Interesse, die Trauergäste zu empfangen, nur um sich ihr Mitleid anzuhören, bis sie zu gegebener Zeit das Dinner eröffnete. Die Angst, dem nicht gewachsen zu sein, war so stark, dass sie sich am liebsten in ihrem Zimmer eingeschlossen hätte. Aber als neue Herrin von South House kannte sie ihre Verpflichtungen und konnte sich daher keiner kindlichen Neigung hingeben.
Eleonora Winters bemerkte ihre Unsicherheit sowie die kleinen Schweißperlen auf ihrer hohen Stirn.
»Ich bin ja bei Ihnen, Miss. Sie werden Ihre Aufgabe mit Bravour erledigen, wie immer«, sagte die Zofe ermutigend. »Ich wünschte nur, ich könnte Ihnen das alles ersparen.«
»Es ist meine Pflicht«, entgegnete Mary Anne entschieden. »Schließlich bin ich die Tochter meines Vaters.«
Als sie später die kühle Halle betraten, waren die meisten Trauergäste bereits eingetroffen. Sie plauderten leise über ihre Gläser hinweg, die sie graziös in ihren behandschuhten Händen hielten. Sie hatten die neue Hausherrin noch nicht bemerkt, die einen beiläufigen Blick auf den Aubusson-Teppich warf, auf dem immer noch der Rotweinfleck zu sehen war. Die Szene, wie ihr Vater wenige Tage vor seinem Tod aufgebracht in der Halle gestanden und mit unterdrückter Wut mit einem ihr fremden Mann debattiert hatte, flimmerte wieder vor ihrem geistigen Auge. Der Fremde hatte einen großen, braunen Umschlag in seiner Hand gehalten und ihrem Vater gedroht. Mary Anne hatte den Erpresser deutlich sehen können, als sie hinter der Salontür hervorlugte, denn er stand neben einer geschliffenen Petroleumlampe, die ihr helles Licht auf ihn abstrahlte. Er hatte markante Züge und lange, dunkle, wuschelige Koteletten, die bis zum Kinn reichten. Sein hartes Gesicht passte so gar nicht zu seiner Fistelstimme, die in bedrohliches Flüstern übergegangen war, als er dem alten Herr eine Handbreit näher kam. Sie erschrak, als sie die Reaktion ihres Vaters sah, der wütend sein Rotweinglas zu Boden warf, das er die ganze Zeit über erregt in der Hand gehalten hatte, und den Umschlag an sich riss.
Als Geoffrey South später in den Salon zurückkam, erwähnte er den Zwischenfall mit keinem Ton. Und den Mut, ihren Vater zu fragen, hatte Mary Anne nicht aufgebracht.
Sie saß im Sessel und zwang sich, nicht so heftig zu atmen, weil sie aus Angst, entdeckt zu werden, in Windeseile zu ihrem Platz geeilt war.
Mary Anne sah die Trauergäste wie verschwommen vor sich stehen, fing sich aber gleich wieder. »Gehen wir zu den Gästen, Miss Winters«, sagte sie mit fester Stimme, obwohl sie bereits ahnte, dass sich über ihrem Kopf dunkle Wolken zusammenzogen.
***
Die ersten Gläubiger standen schon im Morgennebel vor der Tür. Der Notar teilte Mary Anne kühl und reserviert mit, dass das Testament ihres Vaters praktisch wertlos sei, da er hoch verschuldet gewesen war. Die harten Worte verursachten bei ihr eine Ohnmacht. Auch als sie später im Damenzimmer auf dem Sofa mit der Medaillon-Lehne lag, sah sie noch kleine schwarze Punkte vor ihren Augen. Tränen liefen ihr die Wangen hinunter, doch sie gab keinen Laut von sich. Als ahnte sie bereits, was für eine entbehrungsreiche Zeit auf sie zukommen würde, ließ sie das letzte Mal ihren Blick umherschweifen.
Die Sonne schien durch die Fenster, beleuchtete jedes Möbelstück, jede Schramme und die ein Dutzend Bilder, die an den hellgelben Wänden hingen und in wenigen Tagen unter den neugierigen Blicken ihrer Nachbarn zur Versteigerung abgeholt werden sollten. Nur die Kleider von Worth und ein paar Erinnerungsstücke aus ihrem bis dahin behüteten Leben, auf das sie bereits wie eine alte Frau zurückblickte, die mit Gott ihren Frieden geschlossen hatte, würden ihr noch bleiben. Vor ein paar Tagen hatte Mary Anne sich noch allein und verlassen gefühlt. Trotzdem hatte sie die Hoffnung, irgendwann ein glückliches Leben führen zu können. Als Ehefrau und Mutter und als Dame der Gesellschaft. Sie erkannte schmerzlich, dass sie nicht nur eine Waise, sondern auch mittellos war, ohne Vermögen und Stellung. Wenn kein Wunder geschähe, würde sie vermutlich bald unter einer Brücke schlafen, um dann an Kummer und Entkräftung zu sterben. Bei der bloßen Vorstellung dessen schrie sie kurz auf, sodass sie die näher kommenden Schritte nicht wahrnahm.
Die Zofe, die nur noch mit Mary Anne und einer Köchin im Hause lebte, betrachtete sie voller Sorge.
»Kleines«, sagte sie leise und strich ihr über die salzig-feuchte Wange. »Sie müssen eine Kleinigkeit zu sich nehmen.«
Doch Mary Anne schüttelte den Kopf. »Ich kriege keinen Bissen hinunter.«
Miss Winters’ Lippen öffneten sich zu einem Seufzer. »Sie sind eine gebildete junge Dame. Sie werden Ihren Verstand nutzen und aus der prekären Lage das Beste machen.«
»Was soll ich gegen dieses Unheil schon tun? Wenn Frauen aus meiner Schicht mittellos sind, haben sie nicht das Recht wie die Männer, ihre Lage mit Arbeit zu verbessern. Und es ist kein passender Heiratskandidat in Sicht. Wenn kein Wunder geschieht, werde ich als Bettlerin enden.«
Mary Anne war hübsch und gebildet, doch sie gehörte bislang zu jener Sorte junger Damen, die sich mehr für das Bemalen von Tassen interessierten, als dass sie sich mit den wichtigen Dingen des Lebens auseinandersetzten. In Mary Annes behüteter Welt gab es keine Armut, Hungersnöte oder Geldsorgen. Ihr Vater war stets darauf bedacht gewesen, ihr Leben so angenehm und sorglos wie nur möglich zu gestalten. Der Blick für die Realität, die körperliche und seelische Belastbarkeit, die sie für ihre neue Situation jetzt so dringend gebraucht hätte, fehlten ihr gänzlich, auch wenn Mary Anne sich in der Vergangenheit des Öfteren gefragt hatte, ob es für eine Frau nicht mehr gab als Sticken und Bogenschießen.
Die Angestellte begann leise zu schluchzen, das konnte sie fast auf Kommando. Sie schielte zu dem Sheraton-Sekretär, auf dem ein Umschlag lag, der nach ihrem Sinn für Ordnung dort nicht hingehörte.
»Was ist das für ein Brief?«
Mary Anne folgte ihrem Blick ratlos. »Ich weiß es nicht. Vater hatte ihn vor zwei Wochen bekommen, heute Morgen habe ich ihn zwischen den Büchern entdeckt. Ich hatte eigentlich vor, ihn zu lesen, um mich ein wenig abzulenken.«
Eleonora Winters ging zum Sekretär und kam mit dem Umschlag in ihrer Hand zurück. Sie blieb vor dem Sofa stehen und sah Mary Anne eindringlich an.
»Sie müssen ihn öffnen!«
»Er war für meinem Vater bestimmt, ich kann doch nicht …« Mary Anne erinnerte sich plötzlich an den Vorfall in der Halle, an den Unbekannten und den geheimnisvollen Umschlag. Sie sprang auf, riss der Angestellten das Kuvert aus den Händen und machte es auf. Eleonora Winters schnalzte missbilligend mit der Zunge, was Mary Anne mit hochgezogenem Kinn eindrucksvoll ignorierte.
Als sie die Papiere überflogen hatte, sah sie wieder auf, bleich und zitternd. Dann ließ sie sich auf das Sofa sinken. Miss Winters hatte noch immer den pikierten Gesichtsausdruck, als sie sich Mary Anne näherte.
»Noch eine schlechte Nachricht verkraftet mein Herz nicht!«, ermahnte sie Mary Anne in einem jammervollen Ton und setzte sich auf einen Sessel. Doch ihre Neugier siegte. »Ist es so schlimm, Miss?«
»Wie man es nimmt. Mein Vater hat anscheinend eine Schwester.«
»Ein Bastard!«, stieß die Angestellte unüberlegt aus. Als sie jedoch begriff, wie taktlos ihre Worte gewesen waren, senkte sie verlegen ihre kurzen Wimpern. Doch Mary Anne tadelte sie nicht, sondern griff nach ihrer Hand. »Meine Großeltern haben nie von ihr gesprochen. Es kann sich nur um ein uneheliches Kind handeln.«
Es musste ein Schock für meinen Vater gewesen sein, als er als strenggläubiger Mensch von der Untreue seines Vaters erfuhr, dachte Mary Anne, strich sich eine hellbraune Locke aus dem Auge und blickte aus dem Fenster. Sie versuchte, den Schauer zu unterdrücken, der sie überkam. Sie würde ihrer Angestellten nicht zeigen, dass sie unter dem Skandal in ihrer Familie litt, einem Skandal, der in den Augen der Menschen noch vernichtender war als ihre plötzliche Armut. Doch Eleonora Winters sah den sorgenvollen Ausdruck in Mary Annes Gesicht. Wenn eine junge Frau ihre gute Stellung in der Gesellschaft verloren hatte, gab es für sie immer noch die Möglichkeit, als Gouvernante zu arbeiten, doch mit einem Skandal im Gepäck blieben ihr sämtliche Türen verschlossen.
»Sehen Sie es einmal von der praktischen Seite. Ihre …« Miss Winters räusperte sich, denn sie beabsichtigte, etwas gegen ihre Überzeugung zu sagen. »Ihre Tante wird Ihnen helfen können. Sie ist bestimmt eine vornehme Lady. Wo soll die Dame leben? Hier in Boston?«
»In Bodie«, antwortete Mary Anne unbedarft. »Die Stadt liegt in Kalifornien.«
Miss Winters starrte sie mit aufkommender Panik an.
»Oje. Das ist kein Ort für eine Dame! Da können Sie auf keinen Fall hin! Dort leben nur Säufer und …« Sie stand aus dem Sessel auf, ging zu einem der beiden Fenster und öffnete es aufgebracht, die Luft war jedoch viel zu schwül, um eine Abkühlung auf ihre erhitzten Wangen zu bringen. »Und wenn ich Böden schrubbend das Geld verdienen muss, diese sündhafte und verruchte Stadt wird Ihnen erspart bleiben.«
Mary Anne griff perplex nach einer Majolika-Porzellanschale, in der getrocknete Pflaumen lagen, und steckte sich, ohne recht Appetit auf Früchte zu haben, eine in den Mund. So erregt hatte sie ihre Zofe noch nie erlebt. Die sonst so kontrollierte Person hatte bisher immer nur Gutes über ihre Mitmenschen geäußert. Mary Anne blickte über ihre Schulter nach hinten. Ihre Angestellte stand noch immer mit dem Rücken zu ihr am Fenster, und obwohl Mary Anne ihr Gesicht nicht sehen konnte, vermutete sie, dass es angespannt war. Sie hörte, wie Miss Winters schnaufend die Luft einsog.
»Was ist an Bodie so schlimm, dass es Sie so aufwühlt?« Ein Sonnenstrahl fiel durch die Gardine auf ihr makelloses Gesicht. »Wenn meine Tante dort lebt, kann die Stadt doch nicht so verrucht sein«, äußerte sie ihre Logik. »Ich finde, dass Sie etwas zu heftig reagieren.«
Mary Anne hatte eine Tante! Da sprach sie eine Sprache und schrieb sie sogar, und doch gab es ein Wort, das sie nie in den Mund genommen hatte, das ihr nicht einmal in den Sinn gekommen war. Erschreckend gleichgültig steckte sie sich noch eine getrocknete Pflaume in den Mund. Sie empfand bei dem Gedanken, eine Verwandte zu haben, nicht das Geringste.
Miss Winters’ Kopf fuhr herum, sie sah ihren Schützling an und blickte dann wieder aus dem Fenster. Zwei rote hektische Flecken erschienen auf ihrer Wange, und ihre Hand begann so heftig zu zittern, dass sie nach dem Vorhang griff, um es zu verbergen. Der angstvolle und gequälte Blick ihrer Angestellten erinnerte Mary Anne in aller Deutlichkeit daran, dass sie in einer Welt lebte, in der eine Frau keine Fragen stellte und in der man keine Wahl hatte, in der man keine Entscheidung treffen konnte. Aber Mary Anne sah sich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Sie musste ihrer Tante einen Brief schreiben, damit sie von ihrer Nichte in Boston erfuhr; und ganz tief in ihrem Innersten hoffte sie, dass Vaters geheimnisvolle Schwester sie nach Bodie einladen würde.
***
In den darauffolgenden Tagen herrschte ein gewaltiges Durcheinander; die beiden Angestellten, die Mary Anne noch geblieben waren, sortierten und verpackten, hasteten umher und trafen alle mögliche Vorbereitungen für die Auflösung des Haushalts. Das Silber und die wertvollsten Bilder waren bereits von einer Speditionsfirma abgeholt worden. Noch ein Dutzend Teppiche, Tischchen und Büsten standen in Kisten verpackt in den untersten Räumen und verbreiteten eine Atmosphäre, die allen aufs Gemüt schlug. War ein Raum einmal leer geräumt, betrat Mary Anne ihn nicht mehr. Sie war fest entschlossen, das Haus in seinem alten Glanz in Erinnerung zu behalten. Aber wenn Mary Anne die Haustür hinter sich gelassen hatte, holte sie die Realität ein. Wenn ihr zuweilen bekannte Gesichter auf der Straße entgegenkamen, wurde sie kaum noch eines Blickes gewürdigt. Die Damen tuschelten hinter vorgehaltener Hand und sahen ihr hinterher, als hätte sie in der Gegend nichts mehr verloren. Mary Anne schämte sich dann und machte gleich wieder kehrt, um sich für den Rest des Tages in ihr Zimmer zurückzuziehen. Schnell und herzlos verurteilte die feine Bostoner Gesellschaft ihren gesellschaftlichen Abstieg. Keiner ihrer einst so guten Nachbarn würde sie mehr zum Tee einladen, geschweige denn seinen Söhnen vorstellen. Ihre einstige Beliebtheit – dahin. Die einst gute Partie für ihre Erben war aus dem elitären Kreis ausgeschlossen worden. In ihrem Leben war Mary Anne alles immer zugeflogen; alles, was ihr Herz begehrte, hatte sie auch bekommen. Sie hatte sich niemals um etwas bemühen müssen. Alles wurde von ihrem Vater oder Miss Winters erledigt. Manchmal geschahen Dinge, ohne dass sie wusste, warum, und oft ohne dass sie überhaupt Kenntnis davon nahm. Deshalb dauerte es eine Weile, bis sie begriff, wie sie in ihrer jetzigen Situation handeln sollte. Und danach brauchte sie noch länger, um den Mut aufzubringen, endlich den Brief an ihre Tante zu schreiben.
Mary Anne saß vor dem Sekretär, obwohl sie noch mit sich haderte. Langsam richtete sich ihr Blick auf das leere Blatt Papier mit ihrem Monogramm. Dann begann sie zu schreiben, Zeile für Zeile. Zwei Seiten lang.
Das Kratzen des Federkiels auf dem Papier und Mary Annes äußerlicher Zustand ließen Miss Winters in ihrer Bewegung innehalten, als sie das Zimmer betrat.
Mary Anne saß nur mit einem Leibchen, knielangen Unterhosen und angeschnallter Turnüre vor einem Tischchen. Die Turnüre diente dazu, das Gesäß mit halb verstärktem Fischbein und Rosshaar aufzubauschen.
»Kommen Sie rein«, sagte Mary Anne, als sie die Tür aufgehen hörte. »Ich bin gleich so weit.«
Eleonora Winters presste ihre Lippen zusammen, bis sie so schmal wurden wie ein Knopfloch. Ihr Schützling hatte die Drohung, der Tante zu schreiben, tatsächlich wahr gemacht. Wahrscheinlich würde ihre »Kleine« sie noch bitten, den Brief persönlich zum Postamt zu bringen. Bei der Vorstellung begann die Angestellte, unruhig die Finger gegeneinanderzureiben, während sie zum geöffnetem Kleiderschrank ging.
»Es wird Zeit, sich anzukleiden. Es ist bereits acht Uhr. Der Hahn hat schon vor Stunden gekräht.« Miss Winters schob geräuschvoll ein paar Kleider beiseite. »Nur weil Sie nicht mehr solvent sind, müssen Sie nicht Ihre gute Erziehung vergessen.«
Es war das erste Mal, dass die Angestellte so unverblümt über die verzweifelte Lage ihres Schützlings sprach. Sie bedauerte sogleich ihren Fauxpas und räusperte sich verlegen.
Mary Anne legte ohne Eile die Feder beiseite, ohne auf den Kommentar ihrer Zofe zu reagieren. Dann faltete sie die Papierbögen zusammen und ließ sie auf der Schreibplatte liegen. Als sie schließlich aufstand und sich in der Erwartung, angekleidet zu werden, vor den länglichen Spiegel stellte, summte sie zuversichtlich.
Die Angestellte schüttelte den Kopf, als sie Mary Anne in ihrer Unterwäsche betrachtete.
»Um diese Uhrzeit noch so herumzulaufen. Wenn Ihr Vater noch leben würde, dann ...«
»Dann wäre er jetzt in seinem Büro in der Spinnerei und würde davon nichts mitbekommen«, unterbrach Mary Anne sie mit der Spur eines Lächelns um den Mund. »Kleiden Sie mich an!Oder soll ich so zum Hafen fahren?«
Miss Winters sah sie echauffiert an. »Ohne Begleitung fahren Sie nirgendwohin! Ich komme mit Ihnen. Schlimm genug, dass Sie kein Schwarz mehr tragen, jetzt wollen Sie auch noch alleine ins Hafenviertel. Das ist höchst unanständig.«
»Für meine Kreise bin ich schon jetzt nicht mehr gesellschaftsfähig«, beschwichtigte sie die Zofe. »Um an Geld zu kommen, muss ich ein paar Dinge veräußern. Wer sollte es denn sonst für mich tun? Ich habe kein Personal mehr.«
»Was wollen Sie denn nur am Hafen, Miss?«
Einen Moment wurde Mary Anne skeptisch beäugt. »Das werden Sie noch früh genug erfahren«, entgegnete sie und kniff sich in die Wangen, damit sie Farbe bekamen.
Was Miss Winters nicht ahnte war, dass Mary Anne beabsichtigte, sich über eine Schiffspassage nach New Orleans zu erkundigen, um von dort auf dem Landweg weiter nach Bodie zu reisen. Obwohl der Brief Boston noch nicht einmal verlassen hatte, schmiedete Mary Anne schon Zukunftspläne.
»Auch wenn Ihre Tante Sie aufnehmen wird, dauert es, bis Sie eine Antwort erhalten«, spekulierte Miss Winters und beobachtetet Mary Anne genau. »Es wäre besser, wenn Sie die Adresse meiner Schwester angeben. Sie werden, bis die Nachricht eintrifft, bei ihr wohnen müssen. Ich weiß nicht, wo Sie sonst hinkönnten.«
Mary Anne beobachtete sie durch den Spiegel. Miss Winters hatte den Satinunterrock sowie den Überrock aus dunkelblauer Lamé-Seide in ihren Händen und stülpte beides geschickt über ihren Kopf. Als alles richtig saß, türmten sich hinten Falten über Falten auf, während der Rock vorne flach war und von einem eingewirkten Silberfaden und einer Bordüre geschmückt wurde. Mary Anne spürte gleich, wie schmerzhaft eng ihr Kleid anlag, dabei war das plaudernde Herumstehen immer noch leichter als das Sitzen. Doch die Optik der Mode belohnte sie für die Unannehmlichkeiten.
»Es ist Ihnen doch recht, Miss?«,fragte sie in ihrer Arbeit vertieft. »Meine Schwester ist eine gute Person.«
Mary Anne nickte knapp und fingerte verlegen an ihrem Kragen. Während sie sich über Schiffspassagen und ihre Zukunft Gedanken gemacht hatte, hatte ihre Angestellte für das dringlichste Problem eine Lösung gefunden. Mary Anne biss sich auf die Lippen. Ihr Stolz rebellierte noch. Doch sie hätte Miss Winters auf das Schmerzlichste beleidigt und sie in einen Strudel voller Sorgen gerissen. Nein, Mary Anne würde ihr gut gemeintes Angebot zähneknirschend annehmen.
Als wenig später ihr Haar am Hinterkopf zu einem breiten Zopf hochgesteckt war, hielt Mary Anne es nach allem, was ihre Angestellte bereits für sie getan hatte und vermutlich noch tun würde, für nur konsequent, ihr die Umstände zu erklären, wie es zu dem Bankrott ihres Vaters überhaupt hatte kommen können.
»Wissen Sie noch, wie letztes Jahr im September die Bankfirma Jay Cook Company Bankrott machte, Miss Winters?«
Die Angestellte nickte irritiert. Die Frage kam völlig unerwartet.
»Es kam zu einer Wirtschaftskrise. Die New Yorker Börse wurde daraufhin für zehn Tage geschlossen. Mein Vater verlor an einem einzigen Tag sein gesamtes Vermögen. Ich habe das vergangene Woche von dem Notar erfahren.«
»Ja, ich erinnere mich.« Die Angestellte zog ihren Mund in Falten. »Hatte Ihr Vater nicht mehrere Konten? Ich meine, davon gehört zu haben.«
»Ja, unter meinem Namen, da konnte keiner von den Aasgeiern ran.«
»Miss South!« Die Zofe wich brüsk einen Schritt zurück. »Sie reden wie die Leute aus der Gosse.«
Mary Anne schwieg stirnrunzelnd und steckte sich selbstkritisch eine Hornspange am Hinterkopf fest. In den letzten Tagen war sie viel mit einfachen Menschen zusammen gewesen, um ihr restliches Hab und Gut zu verkaufen. Die einfachen Kaufleute waren direkt und teilweise plump in ihrer Aussprache, aber auch offenherzig und ehrlich. Charakterzüge, die ihren sehr ähnlich waren und in ihrer Klasse wie ein Virus bekämpft wurden. Miss Winters machte da keine Ausnahme. Sie teilte stets die Ansichten ihrer feinen Herrschaften. Die Angestellte machte einen Schritt nach vorne und zupfte an Mary Annes Rock den Volant und die Rüschen zurecht.
»Ich weiß nicht«, sagte Miss Winters, ohne den Kopf zu heben. »Der Goldrausch von ’52 in Montana hat den Leuten dort nur Hunger und Elend gebracht. Sie sollten nicht nach Bodie gehen.«
Mary Anne riss ihre Augen auf. Bodie war eine Goldgräberstadt! Sie musste die Geschwätzigkeit ihrer Zofe ausnutzen.
»Gibt es in Bodie immer noch Goldgräber?«
Eine weitere Falte saß schief, und Miss Winters zupfte sie zurecht. »Pah«, stieß sie verächtlich aus. »Das Goldland Kalifornien. Mein Bruder glaubte auch dort sein Glück zu finden.« Die Angestellte runzelte die Stirn und ging zum Tischchen, auf dem ein Nähkörbchen stand. Sie holte Nadel und Faden heraus. Als der Faden eingefädelt war, nähte sie auf den Knien eine lose Bordüre an dem Kleid an. »Die Stadt«, fuhr sie unbeirrt fort, »soll nach Waterman S. Bodey benannt sein. Es wurde viel darüber in der Zeitung geschrieben. Waterman war der Erste, der vor Ort ein Nugget zu Gesicht bekam. Die Stadt wird tatsächlich mit ›ie‹ geschrieben.« Sie schüttelte den Kopf. »Alles Analphabeten, Miss.«
»Wo lebt Ihr Bruder jetzt?« Mary Anne musste unbedingt erfahren, was aus dem Mann geworden war, der sein Glück einst in Bodie gesucht hatte. Ihre Angestellte biss nach vollendeter Arbeit den Faden durch und steckte die Nadel an ihrem Rock fest. »Er wurde erschossen, mitten auf der Straße, und das am helllichten Tag. Jetzt wissen Sie, warum Sie im Westen nichts zu suchen haben.« Ein kurzes betroffenes Schweigen erfüllte den Raum. Die Tischuhr tickte leise, und irgendwo im Haus schlug eine Tür zu.
»Oh Gott, diese Köchin!«, schimpfte Miss Winters und strich eine weitere Falte an ihrem Rock glatt.
»Ist er von einem Revolverhelden erschossen worden?«, fragte Mary Anne von dem Knall in der Halle und Miss Winters’ Kritik unbeeindruckt. »Scheinbar ist das Leben für Goldgräber dort gefährlich. Nun, ich bin eine Dame, mir kann nichts passieren.« Sie sah zu ihrer Angestellten hinunter, die ihren Blick prompt erwiderte.
»Dort leben Ganoven, Mörder und Taugenichtse. Ich habe Angst um den Staat. Die Goldgier der Menschen ist unersättlich. Eine anständige Frau hat dort nichts verloren, Miss South.«
»Meine Tante ist aber eine Lady! Auch in Bodie lässt es sich für unsereins gut leben. Es kann nicht so dramatisch sein, wie Sie es mir einreden wollen.« Mary Annes Stimme klang ungewöhnlich harsch. »Ich will nichts mehr davon hören!«
Miss Winters stand auf und baute sich vor ihr auf. »Sie haben manchmal sehr merkwürdige Anwandlungen. Es ist gut, dass Ihr Vater das nicht mehr miterleben muss. Sie fahren ohne Begleitung durch die Stadt, verkaufen wie eine Krämerin Ihr Hab und Gut und reden in solch einem Ton mit mir.« Sie wandte sich von Mary Anne ab und fing an zu weinen. »Nach all den Jahren ... Wie grausam Sie doch sein können«, schluchzte sie. »Wie können Sie nur glauben, dass ich ...«
Mary Anne blickte beschämt auf ihre Hände, bevor sie nach dem Unterarm ihrer Angestellten griff, der unkontrolliert zitterte.
»Ich weiß, dass ich zuweilen ungerecht sein kann.« Auch Mary Annes Körper reagierte jetzt, doch es war vor allem ihre Stimme, die sich schamhaft zitternd anhörte.
»Oh, liebes Kind.« Sie legte Mary Anne eine Hand auf die Wange. »Gehen Sie nicht fort, bleiben Sie bei mir. Sie könnten sich von dem Geld Ihres Vaters ein kleines Haus mieten. Ich könnte für Sie sorgen, so wie ich es immer getan habe.«
Mary Anne seufzte verneinend. »Die Summe ist im Verhältnis zu dem Vermögen, das mein Vater einst besaß, zwar noch recht hoch. Ich würde sie aber erst nach meiner Heirat als Mitgift erhalten. Aus der Not heraus einen Mann zu heiraten erachte ich als demütigend. Ich bin wohl oder übel auf mich gestellt.«
»Na ja«, stöhnte Miss Winters und versuchte, der Situation etwas Positives abzugewinnen. »Vielleicht ist Bodie nicht so unzivilisiert. Ihre Tante… es wird dort eine gute Gesellschaft geben, denken Sie nicht auch?« In ihren ängstlichen Augen flimmerte die Bitte, ihr auf jeden Fall recht zu geben.
»Selbstverständlich«, beteuerte Mary Anne zuversichtlich. »Wenn sie mich denn einlädt, wird es auch so sein.« Wenn sie mich denn einlädt, wiederholte Mary Anne stumm. Dieser Gedanke traf sie wie ein Hieb, sodass sie sich mit einer Hand am Tisch abstützen musste. Und wenn ihre Tante darauf keinen Wert legte? In ihrer aussichtslosen Situation wollte Mary Anne sich das erst gar nicht vorstellen.
***
Das Pferdegeschirr klirrte, als die offene Kutsche vor einem roten Backsteinhaus am Hafen zum Stehen kam. Die Mittagssonne schien zwischen den hohen Masten und Segeln der Schiffe hindurch, deren lange Schatten auf die Straße und die Gebäude fielen, die sich in dichter Reihe am Hafen entlangzogen, überwiegend Lagerhäuser und Spelunken. Aus manchen Kneipen erscholl Gelächter, in anderen lärmten und schrien Betrunkene.»Sehen Sie nur.« Miss Winters deutete auf eine Fregatte, die vor einem Klipper mit drei Masten lag. »Es ist die ›Constitution‹. Mein Vater war bei ihrem Stapellauf dabei, hier in Boston!«, erklärte sie Mary Anne stolz, während die beiden aus der Kutsche stiegen. »Da sah sie allerdings noch nicht so mitgenommen aus. Der Bürgerkrieg hat ihr nicht gutgetan.«
Mary Anne hörte ihr längst nicht mehr zu, sie war in ihren Gedanken bereits woanders. Sie raffte entschlossen ihren Rock mit beiden Händen und ging auf eine graublaue, verwitterte Holztür zu, die mit einem Türklopfer ausgestattet war, der im Laufe der Jahre durch die salzige Seeluft festgerostet war. Unterhalb einer neu angebrachten Türglocke stand auf einem Messingschild geschrieben: »Stewart Schifffahrt-Gesellschaft”.
Als im April 1861 mit den ersten Schüssen auf Fort Sumter in der Bucht von Charleston der Bürgerkrieg begann, war Mary Anne kaum sechs Jahre alt. Den Krieg hatte sie nicht mit dem Verstand eines Erwachsenen erlebt. Für sie lagen diese Jahre hinter einem Vorhang, der nur langsam von ihrem Vater gelüftet wurde. Wie ein entferntes Nebelhorn hörte sie, wie ihre Angestellte ununterbrochen redete. Miss Winters sprach die Belagerung von Charleston durch die Nordstaatler und die Befreiung der Sklaven an und betonte, wie froh sie wäre, das alles vorbei sei. Doch Mary Anne hatte kein offenes Ohr für ihre Zofe, ihre Gedanken drehten sich um die Schiffspassage nach New Orleans. Konnte sie sich die Reise überhaupt leisten? Und könnte sie ihre Truhen und Koffer mit an Bord nehmen? Würde ihre Tante im Notfall die hohen Kosten übernehmen? Und war sie nun eine Vollwaise oder, weil sie noch Verwandtschaft hatte, eine Halbwaise?
»Es ist offen«, stellte Miss Winter fest, als sie ihren Redeschwall beendet hatte, und drückte die Tür auf. Die Scharniere quietschten wie eine Katze, der auf den Schwanz getreten wurde. Mary Anne hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten.
»Jesus Christus! Wo sind wir nur gelandet?«, stöhnte die Angestellte und sah Mary Anne skeptisch an »Hier ist noch nicht einmal die kleinste Schraube in Ordnung. Was wird uns erst drinnen erwarten?«
Das fragte Mary Anne sich allerdings auch, als sie den halbdunklen Flur erblickte. Ihr Herz klopfte wild. Es war unmöglich, von der unerträglichen Spannung des Augenblicks nicht angesteckt zu werden. Im Haus war es ruhig, und so erschien ihr das Knarzen der abgetretenen Holzstufen übermäßig laut. Die aufkommende Vorsicht und Wachsamkeit ließen beide Frauen verstummen, bis Mary Anne an eine braun lackierte Tür klopfte und ohne zu zögern eintrat. Ihr schlug sogleich ein muffiger Geruch entgegen. Der kleine Raum schien schon seit Tagen nicht durchgelüftet worden zu sein.
An den vergilbten Wänden des Büros standen Regale, die mit Büchern vollgestopft waren. Zwei große Schränke waren mit Seekarten und Pappschachteln bis zum Bersten gefüllt. Und inmitten dieser Unordnung beugte sich ein kahlköpfiger Mann mit einem auffälligen Silberblick über einen Tisch, auf dem sich weitere Papiere stapelten. Der Sekretär hatte ein Doppelkinn und kaute geistesabwesend vor sich hin.
»Guten Tag, Sir. South. Mit wem habe ich die Ehre?«
Der kaum einen Meter sechzig große Angestellte erstarrte vor Ehrfurcht bei dem eleganten Anblick. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass Mary Annes Herz wie rasend gegen das Oberteil ihres dunkelblauen Seidenkleids pochte. Rein äußerlich ging nur Selbstbewusstsein von ihr aus. Vor stiller Bewunderung brachte der Sekretär immer noch kein Wort heraus, und so sagte Mary Anne ihm in aller Kürze, was zu sagen war, und ließ ihm dann einige Sekunden Zeit, sich wieder zu fangen.
Schließlich fragte sie: »Die Passage von Boston nach New Orleans ist hoffentlich nicht zu kostspielig?«
Der Sekretär fuhr sich nachdenklich übers Kinn, während Mary Anne ein parfümiertes Tüchlein aus ihrem Ärmel hervorzog und es sich unter die Nase hielt. Die verbrauchte Luft war kaum auszuhalten, und die Situation war für einen kurzen Moment erstarrt, bis der Mann ein paar Schritte nach vorne trat und einen abschätzenden Blick auf Miss Winters warf, die noch immer wie angewurzelt im Hintergrund stand, bevor er zufrieden nickte.
»Also schön«, sagte Mary Anne schließlich ungeduldig und blickte in das aufgedunsene, großporige Gesicht des Sekretärs. »Mit wem muss ich Weiteres besprechen?«
Der Sekretär hielt ihr seinen hochgerichteten Zeigefinger entgegen, der sie weiter zur Geduld ermahnen sollte, und verschwand ins Nebenzimmer, als plötzlich eine aufgebrachte Stimme aus dem halbdunklen Zimmer nebenan zu hören war.
»Was ... wer …? Dummkopf, herein mit ihr.«
Mary Annes über das Geschehen erstaunter Blick war auf Miss Winters gerichtet, als sie hörte, wie jemand eine Schublade aufzog und dann ein Streichholz anrieb. Ein schwacher Lichtschein fiel auf ihr Kleid.
»Madam.« Der Sekretär stand jetzt vor ihr, und sein Atem roch nach fettiger Wurst und Bier. »Mr. Whitfield erwartet Sie.”
Mary Anne nickte Miss Winters zu, um ihr zu signalisieren, dass es nicht lange dauern würde, und ging an dem ausgestreckten Arm des Sekretärs vorbei.
Die Wände des Raumes, der sich nicht wesentlich von dem Vorzimmer unterschied, waren mit Bildern zugehängt, auf denen ausschließlich Schiffe zu sehen waren. Auf einer Kommode brannten zwei Petroleumlampen, die kaum Licht spendeten, weil die Glaszylinder mit einer dicken Schicht Ruß überzogen waren. Wie kann ein Mensch nur in einem muffigen, halbdunklen Raum arbeiten?, fragte Mary Anne sich stirnrunzelnd und blickte auf die beiden Fenster, vor denen kaffeebraune Gardinen zugezogen waren. Ein demonstratives Räuspern erfüllte die düstere Atmosphäre, und noch bevor Mary Anne ausmachen konnte, aus welcher Ecke des Zimmers das Geräusch kam, trat ein unerwartet gut gekleideter Herr hinter einem langen Schreibtisch hervor. Der Mann hatte große Ähnlichkeit mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ulysses Simpson Grant. Er war Ende vierzig, hatte eine breite Stirn, kleine, braune Augen und einen schmalen Bart, wie er zurzeit à la mode war.
»Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Madam?« Er wies auf einen Stuhl mit Knopfpolsterung. Als Mary Anne darauf zuging, ließ er sie keinen Moment aus den berechnenden Augen.
»Miss«, korrigierte sie ihn bestimmt und setzte sich auf den Stuhl. Sie wusste, dass sie reifer wirkte, als sie tatsächlich war, und das ärgerte sie zuweilen. Und in einer von Männern dominierten Welt konnte eine Frau nur auf ihr gutes Aussehen vertrauen. Es war das erste Mal, dass Mary Anne sich um alles selbst kümmern musste. Und es war das erste Mal, dass sie ihren Charme dazu einsetzen musste. Sie hatte plötzlich einen so trockenen Mund, dass sie kaum sprechen konnte, und so betrachtete sie wahllos eines der Bilder an der Wand.
»Hübsches Schiff«, bemerkte sie nach einer Weile. »Gehören die alle Ihnen? Ich meine, der Company?«
»Ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt«, sagte der Mann unbeirrt. »Whitfield, Gnädigste.«
Mr. Whitfield ließ sich wieder in seinen Drehstuhl nieder und schaukelte langsam hin und her. »Aber nein«, antwortete er schließlich auf ihre Frage. »Das Bild war ein Geschenk.« Seine Stimme klang rau, und er hatte einen Akzent, der Mary Anne bekannt vorkam. »Das ist die ›Cutty Sark‹. Ein Teeklipper.
Sie wurde für John ›Jock‹ Willis gebaut. Ich habe für ihn in London gearbeitet. Ich bin Engländer, Miss.« Er strich stolz sein dunkelaschblondes Haar nach hinten.
Daher seine distanzierte Art, ging es Mary Anne durch den Kopf, und sie musterte ihn unauffällig, während sie an ihrem parfümierten Spitzentaschentuch schnupperte. Irgendetwas an ihm gefiel ihr nicht, aber auch der Mangel an Licht und frischer Luft trug zu ihrem Unwohlsein bei. Sie hustete demonstrativ.
»Soll ich etwas frische Luft hereinlassen?« Mr. Whitfield deutete auf eines der zugezogenen Fenster und ging darauf zu.
»Das wäre nett. Und seien Sie so gut und ziehen Sie die Vorhänge auf.«
Mr. Whitfield zögerte einen Moment, erfüllte Mary Anne aber schließlich den Wunsch. Als das eindringende Licht den Raum durchflutete, bekamen die Bilder und das Mobiliar plötzlich Farbe und Gestalt. Das Zimmer wirkte jetzt beinahe freundlich und gemütlich. Die leicht salzige Luft, die durch das hochgeschobene Fenster drang, half ihr zusätzlich, einen klaren Gedanken zu fassen. Mr. Whitfield setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Es schien Mary Anne, als hätte er die Vorhänge am liebsten zugelassen; in der Flut des Sonnenlichts fühlte er sich regelrecht entblößt.
»Nun, was kann ich für eine so bezaubernde Dame tun?«
Er bekam jedoch keine Antwort. Mary Anne starrte unentwegt auf das faustgroße Feuermal auf seiner rechten Wange. Als sie sich ihres unschicklichen Verhaltens bewusst wurde, steckte sie das Taschentuch in ihren Ärmel zurück und sah verlegen auf ein Tintenfässchen, das vor ihr auf dem Tisch stand. Um einen Anflug von Scham zu ignorieren, strich Mr. Whitfield sich grinsend mit der Fingerspitze über das Mal.
»Ich bin auf einen Kurpfuscher hereingefallen, Miss. Ich wollte es entfernen lassen, seitdem schmerzt es im grellen Licht«, erklärte er ruhig. »Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Er griff nach einem kleinen, elfenbeinernen Briefbeschwerer und drehte und wendete ihn in seinen Händen. Unverwandt blickte er auf die polierte Oberfläche, als hätte es ihn Stolz gekostet.
Mary Anne blinzelte noch verwirrt, als plötzlich sein Sekretär mit einem Zettel in der Hand neben dem Schreibtisch stand. Zu dem Wurstgeruch seines röchelnden Atems umgab ihn jetzt noch der warme, durchdringende Geruch von Tabak. Und noch bevor Mary Anne ihr Anliegen vorbringen konnte, hingen seine fettigen Lippen an Whitfields Ohr.
»Von der Börse, Sir. Mr. Barens sagt, es sei wichtig«, flüsterte er. »Sie bieten acht Dollar vierzig für Rinderhäute. Das höchste Gebot seit je, und die ›Pilgrim‹ wurde von unserem Reiter gesichtet. Sie ist zwölf Meilen vor Sine Point.«
»Was denn, die ›Pilgrim‹ schon hier?« Whitfield legte den Briefbeschwerer aus der Hand, nahm den Zettel an sich und sah seinen Sekretär triumphierend an. »Früher als in einer Stunde wird das Schiff den Hafen nicht erreichen. Sagen Sie Barens, dass ich ihn aufsuchen werde. Das Geschäft machen wir!« Er legte das Stück Papier auf die Tischplatte, die aus feinstem Mahagoni war. Mr. Whitfield blickte Mary Anne an, hielt einen Moment inne und dachte nach. Dann schüttelte er den Kopf. »Tja, äh, wo waren wir noch stehen geblieben?«
Mary Anne seufzte leidvoll. »Ich möchte in den nächsten Wochen nach New Orleans und von dort auf dem Landweg weiter nach Bodie reisen. Ich wollte mich über die Kosten informieren.«
Whitfields Kiefermuskeln spannten sich an, als sie ihm das Reiseziel nannte, er blieb jedoch weiterhin ruhig. »Nun ja, eine Erste-Klasse-Kabine hat ihren Preis, wie alles von hoher Qualität. Schrankkoffer und Hutschachtel sind selbstverständlich frei, Kisten und Mobiliar werden extra berechnet. Aber es wird besser sein, wenn ich das mit Ihrem Herrn Vater oder Ehegatten bespreche. Es ist doch recht ungewöhnlich, dass das zarte Geschlecht sich darüber den Kopf zerbrechen soll.«
»Sir!«, entgegnete Mary Anne ungewohnt resolut. »Ich bin weiß Gott in der Lage, mich selbst um alles zu kümmern.«
Whitfield sah sie abschätzig an, und als er ihre Entschlossenheit sah, lenkte er ein. »Wann soll die Reise losgehen, Miss?«
»Den genauen Termin kann ich Ihnen noch nicht sagen«, erwiderte Mary Anne und zwang sich weiter, nur in seine Augen zu blicken, in denen sie unverhohlene Zweifel an ihrer Reise sah. »Ich erwarte in den nächsten zwei bis drei Wochen eine Einladung aus Bodie. Aber ich werde nicht erster Klasse reisen. Es sind ja nur ein paar Tage, die ich auf See verbringen werde.« Sie versteckte ihre unruhigen Hände in den Falten ihres Kleides und wunderte sich nicht zum ersten Mal, wie ähnlich die Menschen reagierten, wenn sie von Bodie hörten.
»Ach, deswegen möchten Sie weniger komfortabel reisen?« Mr. Whitfields Gesichtsausdruck war jetzt bedenklich. »Wissen Sie überhaupt, was für ein Gesindel sich auf einem Schiff herumtreibt? Und damit meine ich nicht nur die Matrosen. Eine Lady sollte immer standesgemäß und unter ihresgleichen reisen, und wenn es nur für eine Stunde ist.«
Mary Anne musste jetzt ihren ganzen Stolz herunterschlucken, um Whitfield ihre Lage zu schildern.
»Sir, mein Vater war Geoffrey South. Er war in dieser Gegend nicht unbekannt. Und wenn er es nicht war, dann jetzt nach seinem Bankrott. Nur zwei Straßen von hier ist seine ...« Sie korrigierte sich. »War seine Spinnerei.« Sie hatte plötzlich das Gefühl, splitterfasernackt vor ihm zu sitzen, wie eines der Mädchen, die sich in der Kunstakademie für ein paar Cents für angehende Maler auszogen, um auf diese Weise ihre arme Familie zu unterstützen. Durch das halb geöffnete Fenster fielen Streifen von Sonnenlicht auf ihren Kopf, das Licht verlieh ihrem Haar die Farbe von aufgebrühtem Tee. Sie war von einer Aura schimmernder Staubkörnchen umgeben, und ihre Haut schimmerte wie Porzellan. Nichts an ihr sah arm oder gewöhnlich aus. Im Gegenteil, sie war schöner als jemals zuvor.
»Wer kannte Ihren Vater nicht.« Whitfield lächelte jovial. »Ich habe nicht nur einmal Schwierigkeiten mit ihm gehabt, seine englisch-irischen Wurzeln waren nicht zu leugnen. Wehe, seine Ladung kam nicht pünktlich ... Na ja, lassen wir das, wir Engländer lästern nicht gerne über unsere Nachbarn.« Er schnalzte mit der Zunge. »Er ist also tot, davon habe ich nichts gehört.« Er zog eine Braue hoch. »Gott, konnte der Kerl brüllen! Aber nichtsdestotrotz mochte ich ihn irgendwie. Es würde ihm nicht gefallen, was Sie zu tun gedenken, Miss.«
»Mr. Whitfield. Ich habe keine andere Wahl.« Mary Anne hielt sich die Hand auf den Mund und blickte aus einem der Fenster. Draußen auf der Straße fuhr ein Bierwagen vorbei. Die Holzfässer polterten laut auf der Ladefläche.
»Sie müssen nicht verlegen werden, Miss. Ehrlichkeit steht einer Dame hin und wieder gut zu Gesicht. Eine Frau aus Ihren Kreisen, die von heute auf morgen ohne einen Cent dasteht, ist oftmals zu mehr Mut bereit als sie selbst dachte.«
Er stand auf und ging zu einem Tischchen. Einen Moment lang stand er in einer dunklen Ecke. Ein leises Klirren von Kristallflaschen und eine Frage erfüllten den Raum. »Portwein?« Whitfield wandte sich Mary Anne zu. Sein aufgesetztes Oxford-Lächeln untermauerte seine These.
»Ich trinke nicht! Und schon gar nicht am Tage.« Mary Anne fuhr mit dem Kopf zurück und sah Mr. Whitfield empört an.
Sie war gerade im Begriff aufzustehen, als er mit zwei gefüllten Gläsern in den Händen vor ihrem Stuhl stand. »Zieren Sie sich nicht so. Sie werden alle Kraft und Mut brauchen!« Er drückte ihr das Likörglas in die Hand.»Ich bevorzuge Whiskey, zum Wohl.« Mit einem Schluck war sein Glas geleert.
Mary Anne hatte noch nie zuvor solch einen unverschämten Menschen kennengelernt. Sie stellte das Likörglas mit einem lauten Klicken auf den Schreibtisch.
»Wie ich schon sagte, ich trinke nicht!« Sie fuhr auf, legte sich eine gelöste Haarsträhne nach hinten und sagte, ohne über die Konsequenzen nachzudenken: »Reservieren Sie mir eine Erste-Klasse-Kabine für das erste Schiff, das in See sticht. Die Rechnung schicken Sie mir zu. Die Adresse müsste Ihnen bekannt sein. Guten Tag, Sir.« Sie musterte ihn noch kurz bevor sie auf die offen stehende Tür zuging.
»Die Passage ist nicht günstig, Miss South«, rief er ihr hinterher. »Wir sollten bei einem Dinner noch einmal darüber sprechen. Ich kann sehr großzügig zu einer Lady sein, die sich in einer Notlage befindet.«
Der Gedanke, noch Geld für die Reise auftreiben zu müssen, beunruhigte Mary Anne. Sie gestand sich ein, dass sie unüberlegt gehandelt hatte. Eleonora Winters spähte in das halbdunkle Zimmer. Ihr verwirrtes Gesicht hielt Mary Anne davon ab, sich umzudrehen und auf Mr. Whitfields frivoles Angebot entsprechend zu reagieren. Sie hörte ihn hinter ihrem Rücken angespannt atmen, während ein erwartungsvolles Schweigen von ihrer Angestellten ausging. Mary Anne ignorierte die jeweilige Erregung der beiden Personen, griff nach ihrem Rock und ging zur Tür hinaus. Mit hochgehobenen Röcken wirbelte sie auf die Straße. Ihre Zofe folgte ihr prustend und griff sachte nach ihrem Arm.
»Was ist denn passiert, Miss South?«
»Nichts!«
Eleonora Winters blieb beharrlich und ließ sich von Mary Annes Puppengesicht nicht täuschen. »Ich kenne Sie, seit Sie Nein sagen können, und das haben Sie weiß Gott oft genug gesagt. Also sagen Sie mir, ob er Ihnen gegenüber eine unschickliche Bemerkung gemacht hat. Und wehe, wenn … Ich verprügle den Kerl!« Sie fuchtelte drohend mit ihrem Schirm in der Luft herum.
»Nein, was denken Sie denn?«, beteuerte Mary Anne nicht gerade glaubwürdig. »Mr. Whitfield kommt aus England.« Damit schien aus ihrer Sicht alles gesagt zu sein.
»Und warum glaube ich Ihnen dann nicht?« Die Angestellte ließ den Sonnenschirm sinken. Ihr langes Gesicht mit der geraden Nase bebte vor Mary Annes Augen. Miss Winters war daran gewöhnt, dass Mary Anne sie um den kleinen Finger wickeln und sich mit ihren Launen bei ihr durchsetzen konnte. Doch ihre Lüge bestürzte und verletzte sie.
»Ich habe vorhin etwas sehr Dummes getan«, gestand Mary Anne nach kurzer Überlegung. »Wir müssen noch einiges veräußern, glaube ich.«
Eleonora Winters schüttelte energisch den Kopf. »Das Eigentum Ihres Vaters gehört jetzt der Bank of Boston.«
»Die Bank kann unmöglich wissen, was mein Vater besessen hat«, erwiderte Mary Anne harsch. »Auf dem Dachboden liegt bestimmt noch brauchbarer Plunder, den ich verkaufen kann. Ich habe keine andere Wahl.«
Ein beklommenes Schweigen erfüllte die Luft. Dann stieg Mary Anne in die Kutsche, und als sie vom Sitzplatz aus ihre Angestellte glühend vor Missbilligung auf dem Bürgersteig stehen sah, wechselte sie zu einer anderen Taktik.
»Ich besitze noch zwei goldene Taschenuhren meines Vaters, wenn Ihnen das lieber ist …«
Wie erwartet bäumte sich Miss Eleonora Winters auf. »Das kommt ja gar nicht infrage. Ihr Vater hätte das nie gebilligt. Dann kram ich lieber auf dem Dachboden herum.« Sie stieg erregt in den Einspänner, während Mary Anne triumphierend schmunzelte.
Erst als sie ein paar Minuten gefahren waren und ein seichter Wind die Kutsche mit dem feinen Sprühregen von einem Springbrunnen benebelte, hatte Miss Winters sich wieder beruhigt. Noch am selben Nachmittag wühlte und kramte Mary Anne mit ihrer Angestellten in Schrankkoffern, Holzkisten und alten Schränken herum, auch wenn diese anfänglich noch dagegen protestierte. Der Dachboden war ein langer, großer, hoher Raum. An den dunklen Holzbalken hingen Spinnweben und alte Lampen. Ein verlassenes Vogelnest klemmte zwischen zwei gekreuzten Balken. Das von Schmutz überzogene runde Fenster ließ kaum Tageslicht herein, was ihre Suche nach Gegenständen, die sie veräußern konnten, nicht leichter machte.
Nur eine kleine Öllaterne spendete ihnen Licht. Die Luft roch holzig, staubig und nach allem, was im Laufe der Jahre hier abgestellt und vergessen worden war.
Mary Anne öffnete gebannt eine Holzkiste. »Oh.« Sie wedelte mit der Hand den Staub aus ihrem Gesicht. »Ich denke, ich habe etwas Vielversprechendes gefunden.«
Ihre Angestellte kam hinter einer alten Schneiderpuppe hervor, auf der ein alter Herrenüberzieher hing. »Was ist es denn?«, fragte sie, während sie einen Stuhl aus dem Gerümpel zog und ihn säuberlich mit dem Tuch abstaubte.
»Ein Koffer mit Chemikalien.«
»Chemikalien, was denn für Chemikalien?« Miss Winters setzte sich schnaufend auf den Stuhl. »Wir müssen bereits seit Stunden hier oben sein. Meine armen Füße. Sie sollten sich auch eine Pause gönnen.«
Mary Anne nickte zwar, doch statt sich auszuruhen, kramte sie weiter in der Kiste. Miss Winters, die vor Erschöpfung kurz die Augen schloss, hörte, wie Mary Anne die Aufschrift einer weiteren Kisten ablas: »›Fotoapparat der Firma Brownell for Eastmann‹. Er gehörte meinem Vater.« Mary Anne glaubte, sich zu fühlen wie einst Hernando de Soto, als er 1541 den Mississippi entdeckt hatte.
»Hiervon hatte ich bis jetzt nur gehört«, stieß sie begeistert aus. »Dieses Ding ist ein Wunder der Technik, Miss Winters.«
Ihre Angestellte zuckte unbeeindruckt die Schultern. »Tja, vermutlich. Es ist bereits der zweite Apparat, den ich sehe. Der erste hieß Dag... Dog... Digar...« Miss Winters runzelte nachdenklich die Stirn. »Egal, ich erinnere mich an eine silberne Platte mit einem Bild Ihrer Eltern.«
»Daguerreotypie?«
Die Zofe nickte. »Man musste vor einem Kasten wie diesem dort sitzen, ganz still.« Sie deutete abwertend auf den Fotoapparat. »Dabei musste einem die Sonne auf das Gesicht scheinen. Ihr Vater hat gesagt, es sei eine französische Erfindung, obwohl in solchen Dingen ja sonst immer die Deutschen die Nase vorn haben«, erklärte sie spöttisch.
»Aber nach der Guillotine mussten die Franzosen ja etwas Humanes in die Welt aussenden.«
Mary Anne lächelte amüsiert. »Ja, Sie haben vermutlich recht.«
»Der Apparat ist nur einmal benutzt worden. Bei Ihrer Taufe, hinten im Garten. Bei der Aufnahme musste ein Pulver in einer Schüssel gezündet werden, statt wie sonst auf die Sonne zu warten. Ihr Vater meinte noch, es sei ein Fortschritt.« Die Angestellte wischte sich über die Stirn, was auf ihrem Ärmel einen breiten Schmutzstreifen hinterließ. Zum Glück hatten sich Mary Anne und Miss Winters auf ihre Aufgabe angemessen vorbereitet und trugen ältere Kleider.
»Ihre Mutter war an diesem Tag wunderschön, Miss.« Der Blick der Zofe fiel durch das Fenster in die Vergangenheit. »Gott sei Dank hat es nicht geregnet, sonst gäbe es heute von dem Ereignis kein Foto.«
Mary Anne ließ den Kopf sinken. Sie wusste gar nicht mehr, wie es war, eine Mutter zu haben. Seit ihrem achten Lebensjahr musste sie ohne deren Liebe und Fürsorge auskommen. Ihr Vater wurde für sie der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Vor lauter Liebe zu ihm hatte sie nicht gesehen, dass der Patriarch alles verachtete, was nicht seinem Weltbild entsprach. Die Missachtung seinen Arbeitern und zuweilen ihrem späteren Verehrer gegenüber gehörte ebenso dazu wie der lebenslange Hass auf seinen Vater. Doch seine guten Taten bestimmten Mary Annes Erinnerung an ihren Vater. Sie musste nur noch lernen, alleine in der Welt zurechtzukommen, ohne die Führung eines Mannes. Während das alles nur ganz langsam in ihr Bewusstsein rückte, hockte sie auf dem Dachboden und kramte in den Holzkisten und Körben herum in der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden, was hinter dem Rücken des Insolvenzverwalters aus dem Haus geschmuggelt werden konnte.
»Ich habe das silberne Teeservice meiner Mutter versteckt. Wir brauchen eine Kiste, bevor es entdeckt wird.« Der Angestellten blieb der Kummer in ihrer Stimme nicht verborgen. »Es muss noch heute zu Ihrer Schwester gebracht werden«, ordnete Mary Anne an und öffnete einen alten Korb. »Ich habe auch ihre Wertwolle Toilettengarnitur retten können.«
»Sie haben es nicht vergessen, Miss?«
»Ich werde sie nie vergessen.« Mary Anne drückte Miss Winters’ Hand. Sie umschloss ihre langen warmen Finger, und beide sagten keinen Ton mehr.
Mary Anne musste an die Abende denken, an denen sie mit ihren Eltern vor dem Kamin gesessen hatte. Ihr Vater las ihnen bei einer Zigarre und einem Glas Portwein aus einem Buch vor, während ihre Mutter ihr die langen teebraunen Haare bürstete. In Mary Annes Gedanken waren es die schönsten und lebendigsten Bilder, die sie von ihrer Kindheit hatte.
»Sie haben das Diebesgut also gut versteckt?«, fragte Miss Winters rappelte sich mühevoll auf. »Bei der Vorstellung kribbelt mein ganzer Körper. Jetzt sind wir gewöhnliche Diebe.« Die Zofe begann hinter vorgehaltener Hand hemmungslos zu kichern und vergaß für einen Augenblick die Trauer.
»Gott, sind wir schamlos.«
»Vermutlich sind wir das, ein wenig zumindest«, lächelte Mary Anne. »Kümmern Sie sich darum. Es muss alles verpackt werden. Der Fotoapparat muss natürlich auch mit.«
»Was wollen Sie denn mit dem Ding in Bodie anfangen?« Miss Winters’ Kichern verstummte, und sie blickte mit verständnisloser Miene auf die verstaubte Kiste. »Da gibt es nichts, was sich lohnen würde zu fotografieren.«
Mary Anne sah sie fragend an. »Waren Sie denn schon einmal da?«
»Natürlich nicht! Aber mein Bruder hat kein gutes Wort über die Stadt geschrieben.«
»Das ist aber nicht meine Meinung!«, erwiderte Mary Anne. »Was ihm nicht gefiel, kann mir umso mehr gefallen. Außerdem gehörte der Fotoapparat meinem Vater. Das Gerät kann mir vielleicht einmal sehr nützlich sein. Gottes Wege sind unergründlich.« Sie konnte nicht ahnen, wie recht sie damit haben sollte.
»Unergründlich«, wiederholte Eleonora Winters in einem hohen Ton. »Trotzdem halte ich das für keine gute Idee.« Sie kämpfte sich zwischen dem ganzen Plunder einen Weg zur Tür frei und verschwand hinter einem hohen Haufen Gerümpel. Wenig später hörte Mary Anne nur noch das leise Klicken ihrer Absätze auf den Holzstufen.
Es wurde augenblicklich still, und hätte draußen nicht eine Drossel gezwitschert, wäre es auch friedlich gewesen. Mary Anne schloss für einen Augenblick die Augen, um dem Gesang des Vogels zu lauschen, und sah in ihrem Geist ihren Vater. Aber es war nicht der Vater, wie sie ihn an jenem letzten Tag gesehen hatte, als er zu seiner Fabrik aufbrach, mit klaren Augen und entspanntem Gesicht. Es war vielmehr die Erinnerung an besagten Abend in der Halle, als er seinen Wutausbruch hatte. Sein ganzes Weltbild musste in diesem Augenblick zusammengebrochen sein, als er erfuhr, dass er eine Halbschwester hatte, eine wildfremde Frau, auf die Mary Anne ihre ganze Hoffnung projizierte.
***
Mary Anne saß in ihrer Unterwäsche auf einem gepolsterten Stuhl. Sie war erschöpft und wartete geduldig auf das ersehnte Bad. Die Köchin kam mit dem letzten Eimer heißen Wassers und schüttete es in die halb aufgefüllte Wanne, während Miss Winters mit einer Hand die Wassertemperatur überprüfte.
»Kommen Sie, Kleines, so müsste es gut sein.« Die Angestellte trocknete sich die Hand an ihrer weißen Schürze ab und schritt zur Tür. »Und baden Sie nicht zu lange, sonst wird Ihre Haut schrumpelig«, ermahnte sie ihren Schützling und verließ das Schlafzimmer. Als Mary Anne in der kupfernen Klauenfuß-Wanne saß, die vor dem brennenden Kamin stand, genoss sie das warme, nach Wandelröschen duftende Badewasser und ignorierte jegliche Warnung. Das Feuer knisterte beruhigend und verbreitete eine wohlige Wärme in dem Raum. Miss Winters hatte wie immer an alles gedacht. Mary Anne überkam ein Gefühl von Geborgenheit, als sie kinntief in dem Seifenschaum lag. Sie erinnerte sich an die eleganten Bälle, die in South House veranstaltet wurden, und an die Teerunden ihrer Mutter. Sie hatte all den Annehmlichkeiten ihres bisherigen Lebens, den vielen Glöckchen im Haus, die nur da waren, damit ein Butler oder ein Zimmermädchen herbeieilte, um ihre Wünsche zu erfüllen, nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ist meine Tante eine geachtete und vornehme Frau? Ist sie wohlhabend? Und wenn sie es nicht ist, kann ich dann ohne diese großen und kleinen »Annehmlichkeiten« leben, die für mich so selbstverständlich sind? Am anderen Ende der Stadt wohnten Menschen, die ohne all das auskommen mussten. Könnte ich das auch?, fragte sie sich, während sie sich das Gesicht wusch. Luxus war nichts Lebensnotwendiges, nichts, worauf Mary Anne nicht verzichten konnte. Trotzdem waren diese Annehmlichkeiten nach dem Tod ihres Vaters alles, was sie noch besaß. Es gehörte zur ihrer Welt, in der sie sich auskannte, in der sie zu Hause war. Ein anderes Leben kannte sie nicht. Irgendwann stand sie verschrumpelt vor einem Spiegel und betrachtete kritisch ihr Spiegelbild, um herauszufinden, was die Frau, die ihr in die Augen blickte, noch alles ertragen konnte. Zeit und Raum schienen sich immer mehr aufzulösen, als plötzlich die Tür aufging.
»Sie sind fertig. Das ist gut, Sie haben nämlich Besuch«, sagte Eleonora Winters, als sie das Zimmer betrat. Sie wickelte Mary Anne gleich in ein großes weiches Handtuch ein. »Der Herr wartet im Arbeitszimmer Ihres Vaters. Was für ein Glück, dass der Raum noch möbliert ist.«
Mary Anne brauchte noch eine Sekunde, um ihre Gedanken zu ordnen. Bis auf ihr Schlafzimmer standen sämtliche Räume im Haus leer oder waren mit Holzkisten, verschnürten Teppichen und Bildern vollgestellt. Mary Anne brauchte noch einen weiteren Moment. »Kenne ich den Gentleman?« Es war seit Langem wieder der erste Besuch.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Miss Winters. »Ich kenne den Herrn nicht. Er ist aber ordentlich gekleidet. Am besten gehen Sie gleich zu ihm, wer weiß, vielleicht bringt er gute Nachrichten«, spekulierte sie. »Weiß Gott könnten wir welche gebrauchen.« Miss Winters zündete zwei weitere Petroleumlampen mit grünen Glasschirmen an, sofort erstrahlte das Zimmer in einem warmen Smaragdton. Mary Anne sah flüchtig aus dem Fenster, es begann bereits zu dämmern.
»Ach, bevor ich es vergesse, Miss, ich habe alles aus dem Haus geschafft, das gesamte Diebesgut«, flüsterte die Angestellte verschmitzt, obwohl sich niemand außer ihnen im Zimmer befand. »Mein Schwager kommt heute Nacht. Er kümmert sich dann um alles Weitere.«
Das Petroleum verbreitete beim Anbrennen einen beißenden Geruch und erhellte den Raum. Die Angestellte ging unbeirrt zu einer Konsole und zündete eine weitere Lampe an. Mary Anne zog währenddessen ihr Unterkleid an. Sie fragte sich, wer sie um diese Uhrzeit noch sprechen wollte. Aufgrund ihrer Erfahrungen der letzten Tage war sie auf jede noch so schlechte Nachricht vorbereitet.
Als sie eine Viertelstunde später die Tür zum Arbeitszimmer aufstieß, wunderte sie sich über ihren Besuch. Die Linkrusta-Tapete mit ihrem William-Morris-Muster in Dunkelrot und stumpfem Gold schien den groß gewachsenen Herrn zu faszinieren. Er befühlte mit seiner Hand die Tapete, strich darüber und nickte wohlwollend. Mary Anne musterte ihn höchst erstaunt. Der Mann stand mit dem Rücken zu ihr und begutachtete noch das Bücherregal und den marmornen Kaminsims. Sie räusperte sich, um sich bemerkbar zu machen und ihrer eigenen aufkommenden Anspannung ein Ende zu setzen.
»Ah, Miss, guten Abend.« Als der Fremde sich umdrehte, bemerkte sie, die qualmende Zigarre in seiner Hand. »Wie ich sehe, haben Sie sich bedient.« Mary Anne forderte ihn mit einem kühlen Blick auf, die Asche seiner Zigarre in die Glasschale zu schnipsen, was er auch gleich tat. Dabei betrachtete sie ihn genau und erschrak.
»Gütiger Gott, Sie waren schon einmal hier, bei meinem Vater.« Mary Anne spürte deutlich, dass ihre Beine nachgaben, und als unter einem Bild einen Sessel erblickte, ging sie zwei Schritte darauf zu und ließ sich wie betäubt darin nieder.
»Es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe, Miss. Das lag nicht in meiner Absicht.«
Ihr Besucher schnippte zur Sicherheit noch einmal Asche in die Schale ab, bevor er zu ihr kam. »Ich habe von der Tragödie in der Zeitung gelesen. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, nur zu.«
»Niemand kann mir helfen«, antwortete Mary Anne ablehnend. »Ich werde Boston schon bald verlassen.«
Der Fremde zog kräftig an seiner Zigarre und erzeugte eine Rauchwolke, bevor er sie in seiner Hand weiterqualmen ließ. »Sie wollen also zu Ihrer Tante. Ihr Vater konnte also nicht verhindern, dass Sie von ihr erfuhren.«
Für den Bruchteil einer Sekunde war Mary Anne irritiert. »Das geht Sie überhaupt nichts an!« Ihr Ton war durch ihre aufkommende Unsicherheit bissig geworden. »Ich verbitte mir diese Vertrautheit!«
»Sie sind nur so feindselig zu mir, weil ich über den Seitensprung Ihres Großvaters Bescheid weiß. Die ach so gute Familie South ist anscheinend in einen kleinen Skandal verwickelt, nicht wahr?« Er ließ provokativ die Spitze seiner Zigarre hell aufglühen, während er Mary Anne weiterhin taxierte. Dann ließ er ein kleines Rauchwölkchen von seinen gespitzten Lippen aufsteigen. »Ich habe doch recht, oder etwa nicht?«
Das Gespräch nahm eine Wendung, die Mary Anne so wenig gefiel wie der üble Geruch des verbrannten Tabaks, der über ihrem Kopf schwebte. Sie hatte schon mehrmals versucht, über all die Dinge nachzudenken, die geschehen waren, seit ihr Vater tot war. Aber die Ereignisse überschlugen sich dermaßen, dass sie kaum einen Moment Ruhe fand, um nach Antworten zu suchen.