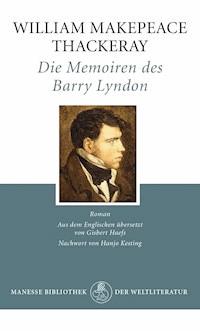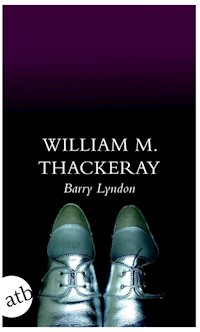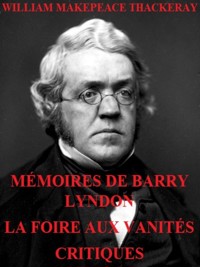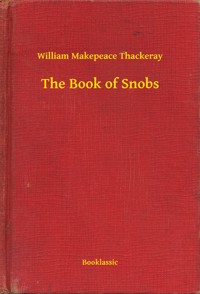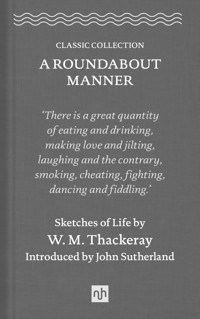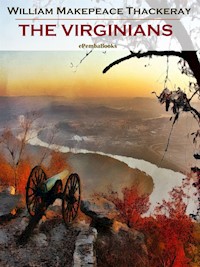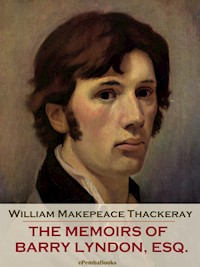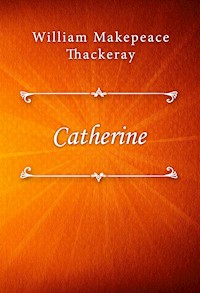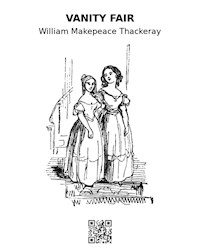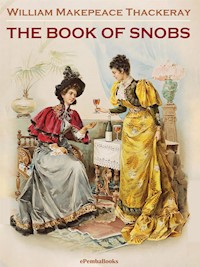3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT+KRITIK. Sie will sich damit nicht abfinden. Die Gouvernante Rebekka Sharp verlässt das Internat und strebt den Aufstieg in die höhere Gesellschaft an. Selbstsicher, intelligent, auch skrupellos bewegt sie sich, im Gegensatz zu ihrer naiven Freundin Amelia, auf Empfängen und Diners. Schmeicheleien und Intrigen, wirtschaftlicher Bankrott ebenso wie das historische Großereignis der Schlacht von Waterloo bestimmen das Leben der beiden Frauen, ihren Aufstieg und Fall in der englischen Gesellschaft. Gemeinsam mit den Romanen von Charles Dickens und den Brontë-Schwestern zählt Thackerays satirisches Gesellschaftspanorama heute zu den wichtigsten und vergnüglichsten Werken des Viktorianismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1494
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
William Makepeace Thackeray
Jahrmarkt der Eitelkeit
Ein Roman ohne Helden
Aus dem Englischen von Heinrich Conrad
Fischer e-books
Vor dem Vorhang
Wie der Marionettentheaterdirektor so vor dem Vorhange auf seiner Bühne sitzt und sich das Leben und Treiben des Marktes anschaut, da überfällt ihn tiefe Melancholie. Da wird viel gegessen, getrunken, geliebt, kokettiert, gelacht, geweint, geraucht, betrogen, geprügelt, getanzt und gegeigt, Prahlhänse schieben sich durchs Gedränge, Stutzer sehen nach hübschen Frauen, Diebe machen die Taschen leer, Polizeibeamte passen auf, Quacksalber (andere Quacksalber, denen ich die Pest wünsche!) schreien vor ihren Buden, Bauernjungen starren auf die flitterbehangenen Tänzer und die armen, alten, geschminkten Seilspringer, während schnellfingrige Burschen sich an ihren Rocktaschen zu schaffen machen. Ja, so sieht es auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit aus; es ist sicher kein moralischer, auch kein lustiger Ort, wenn auch Lärm genug gemacht wird. Seht euch die Gesichter der Schauspieler und Hanswürste an, wenn sie von ihrer Arbeit kommen! Der Lustigmacher wäscht sich die Schminke vom Gesicht ab, ehe er sich mit seiner Frau und den kleinen Hanswürsten hinter dem Vorhang zu Tische setzt. Der Vorhang wird gleich wieder in die Höhe gehen, und dann wird er von neuem Purzelbäume schlagen und rufen: »Hallo! Wie geht es Ihnen?«
Ein nachdenklicher Mensch, der durch eine solche Schaustellung wandert, wird er sich weder durch seine eigene noch durch anderer Leute Lustigkeit belästigt fühlen, meine ich. Ein humoristischer oder gemütvoller Zwischenfall vergnügt und rührt ihn hier und da: ein kleines Kind, das eine Pfefferkuchenbode mit den Augen verschlingt, ein hübsches Mädchen, das rot wird, wenn der Liebste mit ihr spricht und ihr etwas zum Geschenk aussucht, der arme Hausnarr hinter dem Wagen, der in Gesellschaft seiner ehrlichen Familie die Knochen abnagt, die er mit seinen Sprüngen erhält – aber der Gesamteindruck ist mehr melancholisch als heiter. Wenn ihr davon nach Hause kommt, so setzt ihr euch nüchtern, nachdenklich, mitleidig nieder und beschäftigt euch mit euern Büchern oder Geschäften.
Eine andere Moral habe ich an diese Geschichte vom Jahrmarkt der Eitelkeit nicht zu knüpfen. Manche Leute finden Jahrmärkte immer unmoralisch und gehen mit ihrer Familie und ihren Dienstboten nicht hin; vielleicht haben diese recht. Aber Leute, die anders denken, und träge oder wohlwollend oder sarkastisch gesonnen sind, mögen vielleicht eine halbe Stunde hingehen und sich die Sache ansehen. Da gibt es Szenen aller Art: schreckliche Kämpfe, große, halsbrecherische Wettrennen, Szenen aus der vornehmen Welt, manchmal auch aus der recht kleinen, für die Gefühlvollen Liebesgeschichten, für Andere Leichtes, Komisches – das Ganze mit entsprechender Szenerie und vom Verfasser mit seinen eigenen Lichtern glänzend beleuchtet.
Was soll der Puppenspieldirektor noch mehr sagen? – Er dankt noch für die Freundlichkeit, mit der er in all den bedeutendsten Städten Englands, durch die er mit seinem Theater zog, besonders von den geachteten Führern der öffentlichen Presse, dem Adel und der Bürgerschaft aufgenommen worden ist. Er ist stolz in dem Gedanken, daß seine Marionetten den Beifall der besten Gesellschaft dieses Reiches erlangt haben. Die berühmte kleine Becky ist als hervorragend gelenkig und munter auf dem Drahtseile anerkannt worden; aber auch die Puppe Amelia, die zwar einen kleineren Kreis von Bewunderern hat, ist vom Künstler mit der größten Sorgfalt geschnitzt und angezogen worden; die Marionette Dobbin ist nur dem Aussehen nach unbehilflich, sonst tanzt sie sehr lustig und natürlich. Manchem hat auch das Tanzen der kleinen Jungen gefallen. Ferner wird gebeten, die reichgekleidete Figur des schurkischen Edelmanns zu beachten, an der keine Kosten gespart worden sind, und die am Ende dieses merkwürdigen Stücks vom Teufel geholt werden wird.
Und hiermit und mit einem tiefen Bückling zieht sich der Direktor zurück und der Vorhang geht in die Höhe.
London, den 28. Juni 1848.
Erster Band
Erstes KapitelChiswick Mall
Unser Jahrhundert war eben in sein zweites Jahrzehnt getreten, da fuhr an einem sonnigen Junimorgen am großen Eisengitter von Fräulein Pinkertons Pensionat für junge Damen zu Chiswick Mall recht gemächlich eine große Familienkutsche vor, deren zwei recht wohlgenährte, glänzend angeschirrte Pferde von einem gleichfalls recht wohlgenährten Kutscher mit dreieckigem Hute und Perücke gelenkt wurden. Ein schwarzer Diener, der auf dem Bocke neben dem wohlgenährten Kutscher thronte, sprang, als das Fuhrwerk vor Fräulein Pinkertons blankem Messingschild anhielt, sofort auf seine krummen Beine und zog die Glocke, was wenigstens zwanzig junge Köpfe veranlaßte, aus den schmalen Fenstern des stattlichen aus Ziegelsteinen aufgeführten Gebäudes herauszugucken. Ein scharfer Beobachter hätte sogar die kleine rote Nase des gutmütigen Fräuleins Jemima Pinkerton selbst über ein paar Geranientöpfen ihres guten Stübchens erspähen können.
»Es ist Frau Sedleys Kutsche, Schwester,« sagte Fräulein Jemima; »Sambo, der schwarze Diener, hat eben geläutet, und der Kutscher hat eine neue rote Weste an.«
»Ist alles Nötige für Fräulein Sedleys Abreise vorbereitet, Jemima?« fragte das majestätische Fräulein Pinkerton, die Semiramis von Hammersmith, die Freundin Doktor Johnsons, die Korrespondentin der Frau Chapone.
»Die Mädchen sind heute morgen um vier Uhr aufgestanden, um ihre Koffer zu packen, Schwester,« antwortete Fräulein Jemima; »wir haben ihr einen Blumenstrauß gepflückt.«
»Sage doch lieber, ein Bouquet, Schwester Jemima, das hört sich feiner an.«
»Meinetwegen, also ein Bouquet, und zwar eins, das fast so groß ist wie ein Heuschober; ich habe auch zwei Flaschen Levkojenwasser für Frau Sedley hinzugepackt, und das Rezept davon in Amelias Koffer gelegt.«
»Ich kann mich doch darauf verlassen, Jemima, daß du eine Abschrift von Fräulein Sedleys Rechnung gemacht hast? Dies hier, ja? Gut, gut – dreiundneunzig Pfund vier Schillinge. Bitte adressiere sie an Herrn John Sedley, Wohlgeboren, und versiegle dieses Billett, das ich an seine Frau geschrieben habe.«
In Fräulein Jemimas Augen war ein eigenhändiger Brief ihrer Schwester, des Fräuleins Pinkerton, ein Gegenstand tiefster Verehrung, wie es etwa ein Handschreiben eines Herrschers gewesen wäre. Nur wenn ihre Schülerinnen die Anstalt verließen, oder wenn sie heirateten, und einmal auch, als das arme Fräulein Birch am Scharlachfieber starb, hatte Fräulein Pinkerton persönlich an die Eltern ihrer Zöglinge geschrieben, und Fräulein Jemima meinte: wenn überhaupt etwas Frau Birch über den Verlust ihrer Tochter hätte trösten können, so wäre es jener mitleidige und beredte Brief gewesen, mit dem Fräulein Pinkerton das Ereignis ankündigte.
Fräulein Pinkertons »Billett«, um das es sich in diesem Augenblick handelte, hatte folgenden Inhalt:
The Mall, Chiswick, 15. Juni 18–.
Gnädige Frau, – nach ihrem sechsjährigen Aufenthalt in der Mall, habe ich die Ehre und das Vergnügen, Fräulein Amelia Sedley ihren Eltern als eine junge Dame vorzustellen, die nicht unwert ist, eine geziemende Stellung in deren gebildetem und feinem Kreise einzunehmen. Die Tugenden, die für die junge englische Dame charakteristisch sind, die Kenntnisse, die ihrer Geburt und ihrem Stande geziemen, fehlen dem liebenswürdigen Fräulein Sedley nicht, deren Fleiß und Gehorsam sie ihren Lehrern lieb gemacht haben und deren entzückende Sanftmut ihre älteren und jüngeren Gefährtinnen bezaubert hat.
In der Musik, im Tanzen, in der Orthographie, in jeder Art des Stickens und Nähens hat sie die sehnlichsten Wünsche ihrer Freunde verwirklicht. In der Geographie bleibt noch manches zu wünschen übrig, und auch ein sorgfältiger und beständiger Gebrauch eines während der nächsten drei Jahre täglich vier Stunden zu tragenden Rückenstützbrettes wird zur Erlangung der für jede junge Modedame so nötigen würdevollen Haltung sehr zu empfehlen sein.
In den Grundsätzen der Religion und Moral wird man Fräulein Sedley ebenfalls einer Anstalt würdig finden, die durch die Anwesenheit des Großen Lexikographen und den wohlwollenden Schutz der bewunderungswürdigen Frau Chapone geehrt worden ist.
Beim Verlassen der Mall nimmt Fräulein Amelia nicht nur die Herzen ihrer Gefährtinnen mit sich, sondern auch die zärtliche Achtung ihrer Lehrerin, die die Ehre hat, gnädige Frau, sich selbst zu unterzeichnen als
Ihre ergebene gehorsamste Dienerin
Barbara Pinkerton.
P. S. – Fräulein Sharp begleitet Fräulein Sedley. Es ist durchaus notwendig, daß Fräulein Sharps Aufenthalt in Russell Square nicht zehn Tage übersteigt. Die vornehme Familie, bei der sie Stellung gefunden hat, wünscht, so schnell wie möglich selbst ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Als sie dies »Billett« beendet hatte, schrieb Fräulein Pinkerton ihren eigenen Namen und den Fräulein Sedleys auf das weiße Vorsatzblatt eines Johnsonschen Wörterbuches – dies interessante Werk überreichte sie nämlich ihren Schülerinnen stets beim Abgang aus der Mall. Die Innenseite des Einbandes trug eine Abschrift der »Zeilen an eine junge Dame beim Verlassen von Fräulein Pinkertons Schule in der Mall, vom seligen hochverehrten Doktor Samuel Johnson«. In der Tat schwebte der Name des Lexikographen stets auf den Lippen der majestätischen Dame, und ein Besuch, den er ihr einmal gemacht hatte, war auch wirklich die Ursache ihres Rufes und ihres Vermögens geworden.
Als ihr von ihrer älteren Schwester aufgetragen wurde, das »Wörterbuch« aus dem Schrank zu holen, hatte Fräulein Jemima zwei Exemplare des Buches aus dem erwähnten Verwahrungsorte genommen, und als Fräulein Pinkerton die Inschrift in das erste Wörterbuch gemacht hatte, händigte ihr Jemima mit etwas zweifelhafter und furchtsamer Miene das zweite ein.
»Für wen ist denn dies, Jemima?« fragte Fräulein Pinkerton mit schneidender Kälte.
»Für Becky Sharp,« antwortete Jemima, am ganzen Leibe zitternd und über ihr verblühtes Gesicht bis zu ihrem Hals hinunter errötend, obgleich sie ihrer Schwester den Rücken zugekehrt hatte, »für Becky Sharp; sie geht doch auch fort.«
»Jemima!« donnerte Fräulein Pinkerton, »bist du denn nicht bei Sinnen? Stelle das Wörterbuch sofort an seinen Ort, und wage es in Zukunft niemals mehr, dir eine solche Freiheit herauszunehmen.«
»Aber Schwester, es kostet ja nur zwei Schilling und neun Pence, und die arme Becky wird sich gekränkt fühlen, wenn sie keins bekommt.«
»Rufe Fräulein Sedley sofort zu mir,« befahl Fräulein Pinkerton; die arme Jemima wagte kein Wort mehr zu sagen und trottete ganz ängstlich und betrübt ab.
Fräulein Sedleys Papa war ein Londoner Kaufmann und ziemlich reich dazu, wogegen Fräulein Sharp eine Freischülerin war, für die Fräulein Pinkerton, wie sie meinte, auch ohne die hohe Ehre des Wörterbuches beim Abgang, schon gerade genug getan hatte.
Man kann zwar den Briefen von Schulvorstehern nicht mehr und nicht weniger trauen als Grabschriften; aber es kommt doch wohl manchmal vor, daß jemand stirbt, der wirklich all das Lob verdient, das der Steinmetz über seinen Gebeinen einhaut: der ein guter Christ, ein guter Vater, Kind, Weib oder Gatte war, dessen Verlust wirklich eine trostlose Familie nachweint. Ebenso geschieht es in Erziehungsanstalten des männlichen und weiblichen Geschlechts wohl dann und wann einmal, daß der Schüler das Lob, das ihm der uneigennützige Erzieher spendet, wohl verdient. Fräulein Amelia Sedley nun war eine junge Dame dieser besonderen Art, und sie verdiente nicht nur alles, was Fräulein Pinkerton zu ihrem Lobe sagte, sondern hatte noch viele andere reizende Eigenschaften, die diese pompöse alte Minerva nicht sehen konnte, da zwischen ihrer Schülerin und ihr selbst eine zu große Verschiedenheit an Rang und Alter bestand.
Denn sie konnte nicht nur singen wie eine Lerche, oder wie eine Billington, und tanzen wie Hillisberg oder Parisot, und prächtig sticken und so korrekt wie ein Wörterbuch schreiben, sondern sie hatte auch solch freundliches, heiteres, zärtliches, sanftes, edles Herz, daß jeder, der ihr nahe trat, sie lieben mußte, von Minerva selber bis herunter zum armen Aufwaschmädchen und zur Tochter der einäugigen Kuchenfrau, die einmal wöchentlich den jungen Damen in der Mall ihre Waren verkaufen durfte. Sie hatte zwölf intime Busenfreundinnen unter den vierundzwanzig jungen Damen. Sogar das neidische Fräulein Briggs sprach niemals schlecht von ihr, das hohe und mächtige Fräulein Saltire (Lord Dexters Enkelin) gab zu, daß ihre Gestalt fein sei, und Fräulein Swartz, eine reiche wollhaarige Mulattin von St. Christoph, bekam am Tage von Amelias Fortgang einen solchen Weinkrampf, daß man Dr. Floß rufen und sie mit Riechsalz halb betrunken machen mußte. Fräulein Pinkertons Zuneigung war, wie man sich denken kann, der hohen Stellung und den hervorragenden Tugenden dieser Dame entsprechend, eine ruhige und würdevolle; nur Fräulein Jemima hatte bei dem Gedanken an Amelias Abreise schon mehrere Male leise geschluchzt, und würde, wenn nicht die Furcht vor ihrer Schwester gewesen wäre, einen ebensolchen hysterischen Anfall wie die doppelt zahlende Erbin von St. Christoph bekommen haben. Aber solchen Luxus an Kummer können sich nur Salonpensionärinnen gestatten. Die ehrliche Jemima hatte an all die Rechnungen, das Waschen und Ausbessern, die Puddings, die Gerichte und Geschirre und an die Beaufsichtigung der Dienstboten zu denken. Aber warum überhaupt von ihr reden? Es ist leicht möglich, daß wir von diesem Augenblick an bis zum Ende nichts mehr von ihr hören, und daß, wenn sich einmal die großen Eisenpforten geschlossen haben, weder sie noch ihre ehrwürdige Schwester mehr in die kleine Welt unserer Geschichte hinaustreten.
Aber da wir viel von Amelia hören werden, so schadet es nichts, schon im Beginn unserer Bekanntschaft zu bemerken, daß sie ein liebes kleines Geschöpfchen war, und es ist, im Leben sowohl wie in Romanen, worin (besonders in Romanen) so viel Schurken der schlimmsten Art vorkommen, ein wahres Glück, eine so unschuldige und gutgeartete Person zur beständigen Gefährtin zu haben. Da sie keine Heldin war, so brauche ich auch ihre Persönlichkeit nicht zu beschreiben; ich habe auch wirklich fast Furcht zu sagen, daß ihre Nase eher kurz als majestätisch war, auch daß ihre Wangen viel zu rund und rot für eine Heldin aussahen. Aber ihr Gesicht blühte von rosiger Gesundheit, und ihre frischen Lippen lächelten, und sie hatte ein Paar Augen, die in hellster und ehrlichster Fröhlichkeit glänzten, ausgenommen natürlich, wenn sie mit Tränen gefüllt waren, was leider viel zu oft vorkam. Das törichte Ding konnte nämlich über einen toten Kanarienvogel schluchzen, oder über ein Mäuschen, das die Katze glücklich erwischt hatte, oder über das Ende eines Romans, wenn es auch noch so einfältig war. Und ihr ein unfreundliches Wort zu sagen – wenn wirklich jemand hartherzig genug war, das zu tun – nun, das war ganz zwecklos! Sogar Fräulein Pinkerton, diese erhabene und göttergleiche Dame, schalt sie nach dem ersten Male nie mehr aus; obgleich sie von Empfindlichkeit nicht mehr verstand als von Algebra, so gab sie allen Lehrern und Lehrerinnen besondere Anweisung, Fräulein Sedley äußerst sanft zu behandeln, da unsanfte Behandlung ihr schade.
Als der Tag der Abreise gekommen war, wußte Fräulein Sedley, die entweder immer lachte oder immer weinte, durchaus nicht, wie sie sich verhalten sollte. Sie freute sich auf Zuhaus, und doch tat es ihr auch bitterlich leid, die Schule zu verlassen. Schon seit drei Tagen folgte ihr die kleine Laura Martin, die Waise, überall hin, wie ein kleines Hündchen. Sie hatte wenigstens vierzehn Geschenke zu machen und zu bekommen, und vierzehn feierliche Versprechen zu geben, jede Woche zu schreiben. »Sende meine Briefe im Kuvert an meinen Großpapa, den Grafen von Dexter,« sagte Fräulein Saltire (die, nebenbei gesagt, etwas geizig war) – »Sieh nicht auf das Porto, sondern schreibe jeden Tag, süßes Herz,« sagte das stürmische, wollhaarige, aber großherzige und zärtliche Fräulein Swartz, und die kleine Waise Laura Martin (die eben erst die Buchstaben schreiben gelernt hatte) nahm ihrer Freundin Hand und sagte, ihr ernst ins Gesicht schauend: »Amelia, wenn ich dir schreibe, muß ich dich Mama nennen dürfen.« All dies wird Jones, der dies Buch in seinem Klub liest, natürlich äußerst närrisch, trivial, schwatzhaft und entsetzlich sentimental finden. Ich sehe schon in diesem Augenblick, wie Jones (von seinem Hammelbraten und seiner Flasche Wein etwas erhitzt) seinen Bleistift herauszieht und die Worte töricht, schwatzhaft usw. unterstreicht und ihnen die Bemerkung »sehr wahr« hinzufügt. Nun, er ist eben ein Genie und bewundert das Große und Heroische im Leben und in den Romanen, darum sollte er auf diese Warnung hören und sich anderswohin wenden.
Na, also. Die Blumen und die Geschenke und die Koffer und Hutschachteln des Fräuleins Sedley sind von Sambo auf das Fuhrwerk gepackt worden, dazu ein sehr kleiner und sehr abgenutzter alter Lederkoffer, der Fräulein Sharps Visitenkarte sauber aufgenagelt trägt und den Sambo grinsend hinaufreicht und der Kutscher mit ebensolchem Grinsen unterbringt – und nun geht’s ans Abschiednehmen. Der Kummer dieses Augenblicks wurde beträchtlich durch die bewunderungswürdige Rede gemindert, die Fräulein Pinkerton an ihre Schülerin hielt. Die Abschiedsrede regte Amelia nicht zum Philosophieren an oder machte sie nicht etwa ruhiger, indem sie darüber nachdachte, aber sie war über alle Maßen stumpfsinnig, pompös und langweilig, und da Fräulein Sedley ihre Lehrerin sehr fürchtete, so wagte sie in ihrer Gegenwart nicht, sich irgend einem Ausbruch ihres inneren Kummers zu überlassen. Ein Topfkuchen und eine Flasche Wein standen im Empfangszimmer, wie es bei feierlichen Elternbesuchen üblich war, und als Fräulein Sedley ihren Teil davon genossen hatte, konnte sie abfahren.
»Du wirst doch hineingehen und dich bei Fräulein Pinkerton verabschieden, Becky!« sagte Fräulein Jemima zu einer jungen Dame, die niemand beachtete, und die eben mit ihrer eigenen Hutschachtel die Treppe hinunterkam.
»Das muß ich wohl,« antwortete Fräulein Sharp ruhig und zur großen Verwunderung Fräulein Jemimas. Dann klopfte sie an die Tür, erhielt Erlaubnis zum Eintritt, ging ganz unbefangen hinein und sagte mit reinstem französischem Akzent: »Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux.«
Fräulein Pinkerton verstand kein Französisch, sie leitete nur die, welche es lehrten; daher biß sie die Lippen zusammen und warf ihren ehrwürdigen Kopf mit der römischen Nase (den ein großer, feierlicher Turban schmückte) zurück und sagte nur: »Fräulein Sharp, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen.« Und indem die Semiramis von Hammersmith so sprach, winkte sie mit der einen Hand, zum Zeichen des Lebewohls, aber zugleich auch um Fräulein Sharp Gelegenheit zu geben, den einen Finger, den sie zu diesem Zwecke vorstreckte, schütteln zu können.
Fräulein Sharp aber faltete ihre eigenen Hände mit einem sehr kalten Lächeln zusammen, knickste dazu, und lehnte auf diese Weise gänzlich ab, die angebotene Ehre anzunehmen, woraufhin Semiramis zorniger denn je ihren Turban zurückwarf. Es war wirklich ein kleines Gefecht zwischen der jungen Dame und der alten, und die alte hatte verloren. »Gott behüte dich, mein Kind,« sagte sie und umarmte Amelia, wobei sie über des Mädchens Schulter hinweg wütende Blicke nach Fräulein Sharp schleuderte. »Komm mit, Becky,« sagte Fräulein Jemima, das junge Mädchen ängstlich mit sich ziehend, und die Empfangszimmertür schloß sich für immer hinter ihnen.
Dann kam das Schluchzen und Abschiednehmen unten. Worte können es nicht beschreiben. Alle Dienstboten waren im Flur – alle lieben Freundinnen – alle jungen Damen – und auch der Tanzlehrer, der gerade eben angekommen war. Das war ein Drängen, Umarmen, Küssen und Weinen, und Fräulein Swartz, die Doppeltzahlende, hörte man aus ihrem Zimmer hysterisch »Jup« schreien – keine Feder kann all das schildern, und ein zärtliches Herz möchte gern davon schweigen. Das Umarmen war vorüber, sie nahmen Abschied. Das heißt: Fräulein Sedley schied von ihren Freundinnen; Fräulein Sharp war vor wenigen Minuten unbemerkt in den Wagen gestiegen, um sie weinte niemand. Der krummbeinige Sambo schlug die Kutschentür hinter seiner weinenden jungen Herrin zu und sprang hinten auf den Wagen.
»Halt!« rief da Fräulein Jemima und stürzte mit einem Paketchen auf die Tür zu.
»Es sind nur ein paar belegte Brötchen, liebes Kind,« sagte sie zu Amelia, »aber du könntest hungrig werden. Und für dich, Becky Sharp, habe ich hier ein Buch, das meine Schwester, das heißt ich – Johnsons Wörterbuch, du weißt schon, du darfst ohne das nicht fortgehen. Lebt wohl! Fahrt zu, Kutscher. Gott behüte euch!«
Und das gute Geschöpf lief, von Rührung überwältigt, in den Garten zurück.
Aber siehe da, gerade als die Kutsche abfuhr, steckte Fräulein Sharp ihren blassen Kopf aus dem Fenster und warf das Buch wahrhaftig in den Garten zurück!
Dies brachte Jemima vor Entsetzen fast einer Ohnmacht nahe. »Nein, so etwas habe ich doch noch nie,« – sagte sie – »so ein trotziges« – ihre Erregung ließ sie keinen Satz vollenden. Der Wagen rollte fort; die großen Tore schlossen sich; die Glocke läutete zur Tanzstunde. Die Welt liegt vor den beiden jungen Damen; und so: lebe wohl, Chiswick Mall!
Zweites KapitelFräulein Sharp und Fräulein Sedley schicken sich zur Eröffnung des Feldzuges an
Als Fräulein Sharp die im vorigen Kapitel erwähnte heroische Tat getan und das Wörterbuch über das Pflaster des kleinen Gartens hinweg vor des erstaunten Fräulein Jemimas Füße hatte fallen sehen, nahm das Gesicht der jungen Dame, das vor Haß fast totenbleich ausgesehen hatte, ein Lächeln an, das aber kaum angenehmer war, und sie sank erleichterten Gemüts auf ihren Sitz zurück, indem sie sagte: »Das Wörterbuch ist erledigt; Gott sei Dank, daß ich aus Chiswick heraus bin.«
Fräulein Sedley war über diese rebellische Handlung fast ebenso erschrocken, wie es Fräulein Jemima gewesen war; man bedenke, sie hatte eben in dieser Minute die Schule verlassen, und die Eindrücke von sechs Jahren verlieren sich doch nicht gleich. Nein, bei manchen Leuten dauern solche Ängste und Schrecken aus der Jugendzeit sogar für immer und ewig. Ich kenne zum Beispiel einen ältern Herrn von achtundsechzig Jahren, der eines Morgens beim Frühstück mit sehr erregtem Gesicht zu mir sagte: »Ich träumte heute Nacht, daß Dr. Raine mir die Rute gab.« Die Phantasie hatte ihn in jener Nacht fünfundfünfzig Jahre zurückgetragen. Dr. Raine und seine Rute schienen ihm mit achtundsechzig noch so schrecklich wie einst mit dreizehn. Wenn ihm der Doktor selbst leibhaftig im achtundsechzigsten Jahre mit einer großen Rute erschienen wäre und mit schrecklicher Stimme gerufen hätte: »Junge, zieh die Hosen runter!?« – Nun, wir wollen das nicht ausmalen – genug, Fräulein Sedley war über diese respektlose Tat furchtbar erschrocken.
»Wie konnten Sie das nur tun, Rebekka?« sagte sie endlich nach einer Pause.
»Wie, denken Sie denn etwa, daß Fräulein Pinkerton herauskommen und mich wieder in das schwarze Loch zurückholen wird?« sagte Rebekka lachend.
»Nein, aber –«
»Ich hasse das ganze Haus,« fuhr Fräulein Sharp wütend fort, »ich hoffe, es nie wieder vor Augen zu sehen. Ich wünschte, es läge auf dem Grund der Themse, wahrhaftig! Und wenn Fräulein Pinkerton darin wäre, so würde ich sie ganz gewiß nicht herausholen. Oh, wie gern sähe ich sie auf dem Wasser schwimmen, mitsamt ihrem Turban, ihrer langen Schleppe und ihrer Nase, die wie der Schnabel eines Kahns aussieht.«
»Scht!« machte Fräulein Sedley.
»Ach was – wird etwa der schwarze Diener klatschen?« sagte Rebekka lachend. »Er kann gern zurückgehen und Fräulein Pinkerton erzählen, daß ich sie von ganzer Seele hasse, und ich möchte sogar, daß er es täte, ja, ich wünschte, ich könnte es ihr auch beweisen. Zwei Jahre lang habe ich nur Beleidigungen und Beschimpfungen von ihr erduldet. Ich bin schlechter behandelt worden als die geringste Küchenmagd. Ich habe außer von Ihnen nie ein freundliches oder gütiges Wort bekommen. Ich mußte die kleinen Kinder in den untersten Klassen warten und mit den jungen Damen Französisch sprechen, bis mir meine eigne Muttersprache zum Ekel wurde. Aber daß ich zu Fräulein Pinkerton Französisch sprach, das war doch ein Hauptspaß, nicht wahr? Sie versteht kein Wort Französisch, war aber immer zu stolz, es einzugestehen. Ich glaube, deshalb schickte sie mich auch fort, und darum sei dem Himmel Dank für das Französische. Es lebe Frankreich! Es lebe der Kaiser! Es lebe Bonaparte!«
»O Rebekka, Rebekka, schämen Sie sich!« rief Fräulein Sedley; denn von allem, was Rebekka bis jetzt gesagt hatte, war dies die größte Blasphemie; in jenen Tagen bedeutete in England: »Lang lebe Bonaparte!« soviel wie: »Lang lebe Luzifer!« »Wie können Sie, wie wagen Sie es nur, solche gottlosen, rachevollen Gedanken zu haben?«
»Rache mag gottlos sein, sie ist aber natürlich,« entgegnete Rebekka. »Ich bin kein Engel.« Und, der Wahrheit die Ehre, das war sie auch wirklich nicht. Vielleicht hat der Leser bemerkt, daß Rebekka im Laufe dieser kleinen Unterhaltung (die stattfand, während der Wagen gemächlich am Flusse entlang rollte) zweimal Anlaß nahm, dem Himmel zu danken, das erste Mal für ihre Befreiung von einer Person, die sie haßte, und das zweite Mal, weil es ihr gelungen war, ihre Feinde in eine Art Verwirrung oder Ratlosigkeit zu bringen, und keines von diesen beiden Ereignissen ist ein sehr liebenswürdiger Anlaß zu religiöser Dankbarkeit, und freundliche, versöhnliche Menschen würden einen solchen gewiß nicht suchen. Rebekka Sharp war aber auch nicht im geringsten freundlich und versöhnlich. Alle behandelten sie schlecht, sagte die junge Menschenfeindin; nun, wir können mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß ein Mensch, den alle schlecht behandeln, die Behandlung, die ihm zuteil wird, auch vollkommen verdient. Die Welt ist ein Spiegel und gibt jedem das Abbild seines eignen Antlitzes zurück. Mach ihr ein böses Gesicht, so wird sie dich wieder finster ansehen, lache sie an und lache mit ihr, so ist sie dir ein freundlicher, gutmütiger Gefährte; darum mögen denn alle jungen Leute selber wählen. Soviel ist sicher: wenn die Welt Fräulein Sharp vernachlässigte, so hatte sie auch gewiß nie irgend jemandem etwas Gutes getan; auch kann nicht erwartet werden, daß vierundzwanzig junge Damen alle so liebenswürdig sein sollen wie die Heldin dieser Geschichte, Amelia Sedley (die wir, gerade weil sie am besten dazu paßte, dazu erwählt haben, sonst hätte uns ja nichts in der Welt hindern können, Fräulein Swartz oder Fräulein Crump oder Fräulein Hopkins an ihren Platz als Heldin zu stellen). Man konnte nicht erwarten, daß eine jede so bescheiden und sanft wie Fräulein Amelia Sedley war und jede Gelegenheit ergriff, um Rebekkas Hartherzigkeit und Übellaunigkeit zu besiegen, und durch tausend freundliche Worte und Handlungen einmal wenigstens ihre Feindseligkeit gegen ihre Mitmenschen zu bezwingen.
Fräulein Sharps Vater war Künstler gewesen und hatte in Fräulein Pinkertons Schule Zeichenunterricht gegeben. Er war ein geschickter Mann, ein angenehmer Gesellschafter, ein sorgloses Menschenkind, das gern Schulden machte und gern ins Wirtshaus ging. Wenn er betrunken war, pflegte er Frau und Tochter zu schlagen und am nächsten Morgen im Katzenjammer die Welt wegen der Vernachlässigung seines Genies zu schmähen und mit vielem Witz, ja manchmal sogar mit vollem Rechte, die Narren, seine Malerkollegen, zu verspotten. Da er sich nur mit äußerster Schwierigkeit selbst erhalten konnte, und eine Weile im Umkreise von Soho, wo er lebte, überall Geld schuldig war, so wollte er seine Verhältnisse aufbessern und heiratete eine junge Französin, eine Statistin bei der Oper. Der niedere Rang ihrer Mutter wurde von Fräulein Sharp nie erwähnt, sondern sie behauptete in der Folge stets, daß die Entrechats eine edle Gascogner Familie seien, und daß sie sehr stolz darauf sei, von ihnen abzustammen. Und merkwürdig: in eben dem Maße, wie Fräulein Sharp im Leben stieg, nahmen auch die Voreltern der jungen Dame an Rang und Glanz zu.
Rebekkas Mutter hatte irgendwie eine gewisse Erziehung genossen, und ihre Tochter sprach ein reines Französisch mit pariserischem Akzent. Das war zu jener Zeit eine Seltenheit, und diese Kenntnisse verschafften ihr die Anstellung bei dem sonst so strenggläubigen Fräulein Pinkerton. Als nämlich ihre Mutter gestorben war, schrieb ihr Vater, der nach dem dritten Anfall von Delirium tremens keine Hoffnung auf Genesung mehr hatte, einen mannhaften und pathetischen Brief an Fräulein Pinkerton, in dem er die Waise ihrem Schutze empfahl. Hierauf war er ins Grab gesunken, nachdem noch zwei Gerichtsvollzieher über seinem Leichnam gekämpft hatten. Rebekka war siebzehn Jahre alt, als sie nach Chiswick kam und als Freischülerin angenommen wurde. Ihre Aufgabe war, wie wir gesehen haben, Französisch zu sprechen; dafür erhielt sie Wohnung und Kost, jährlich ein paar Guineen und die Erlaubnis, von den Lehrern, die bei der Schule angestellt waren, so viele Kenntnisse einzuheimsen, wie sie konnte.
Sie war klein und schlank von Gestalt, blaß, mit sandgelbem Haar; die Augen hielt sie gewöhnlich niedergeschlagen, aber wenn sie aufsah, waren sie sehr groß und seltsam anziehend, so anziehend, daß der frisch von Oxford angekommene Herr Crisp, der Helfer des Vikars von Chiswick, des ehrwürdigen Herrn Flowerdew, sich in Fräulein Sharp verliebte, nachdem ein Blick ihrer Augen, der von dem Kirchenstuhl des Pinkertonschen Pensionats nach der Kanzel hinüberflog, ihn getroffen und tödlich verwundet hatte. Der unglückliche junge Mann, der bisweilen bei Fräulein Pinkerton, einer Bekannten seiner Mama, Tee trank, hatte tatsächlich in einem der einäugigen Apfelfrau zur Besorgung übergebenen Briefe Fräulein Sharp gewissermaßen die Ehe angetragen. Der Brief wurde abgefangen, Frau Crisp wurde von Burton herbeigerufen und brachte ihren geliebten Sohn eiligst fort; aber der bloße Gedanke, daß so ein Adler sich im Chiswickschen Taubenschlage befände, verursachte in Fräulein Pinkertons Busen solchen Aufruhr, daß sie Fräulein Sharp fortgeschickt hätte, wenn sie nicht durch einen Vertrag bei Strafe an sie gebunden gewesen wäre. Natürlich glaubte sie auch niemals den Beteuerungen der jungen Dame, daß sie nie auch nur ein einziges Wort mit Herrn Crisp gewechselt habe, als unter Fräulein Pinkertons eigenen Augen, bei der sie ihn zweimal am Teetisch getroffen hatte.
Neben vielen großen und vollkommen entwickelten jungen Damen, die der Anstalt angehörten, sah Rebekka Sharp wie ein Kind aus. Aber sie besaß die traurige Frühreife der Armut. Manchen Mahner hatte sie begütigt und von ihres Vaters Tür weggebracht, manchen Krämer in gute Laune geschwatzt und durch ihr Schmeicheln zu neuem Kredit beredet. Sie saß meist bei ihrem Vater, der auf ihren Witz sehr stolz war, und lauschte dem Geschwätz seiner wilden Genossen – das öfter für Mädchenohren sehr wenig geeignet war. Aber sie war auch nie ein Mädchen gewesen, wie sie selbst sagte; schon vom achten Jahre ab war sie ein Weib gewesen. O warum auch ließ Fräulein Pinkerton solchen gefährlichen Vogel in ihren Käfig ein?
Die alte Dame hatte eben Rebekka, wenn ihr Vater sie nach Chiswick brachte, für das sanfteste Geschöpf von der Welt gehalten, so bewunderungswürdig hatte sie damals immer ihre Rolle als kleine Einfalt gespielt, und noch ein Jahr vor der Abmachung, wodurch Rebekka in ihr Haus kam – es war gerade Rebekkas sechzehnter Geburtstag – hatte Fräulein Pinkerton majestätisch und mit einer kleinen Rede ihr eine Puppe geschenkt – die sie, beiläufig gesagt, dem Fräulein Swindle konfisziert hatte, die heimlich in den Schulstunden damit gespielt hatte und dabei ertappt worden war. Wie hatten Vater und Tochter gelacht, als sie nach der Abendgesellschaft (zu der alle Lehrer eingeladen waren) nach Hause gingen, und wie wütend würde Fräulein Pinkerton gewesen sein, wenn sie ihre eigne Karikatur gesehen hätte, die die kleine Schauspielerin Rebekka wirklich aus ihrer Puppe fertiggebracht hatte. Becky hielt zum Entzücken von Newman Street, Gerard Street und dem ganzen Künstlerviertel lange Gespräche mit ihr, und wenn die jungen Maler kamen, um bei ihrem trägen, liederlichen, genialen und jovialen Kollegen ihren Gin mit Wasser zu trinken, pflegten sie regelmäßig Rebekka zu fragen, ob Fräulein Pinkerton zu Hause sei. Sie war ihnen ebenso bekannt, die arme Seele, wie Herr Laurence oder Präsident West. Einmal hatte Rebekka die Ehre, ein paar Tage in Chiswick bleiben zu dürfen; Jemima brachte sie nach Hause zurück, worauf sie sofort eine andere Puppe Fräulein Jemmy taufte; denn, obgleich ihr das gutherzige Geschöpf Fruchtsäfte und Kuchen, die für drei Kinder gereicht hätten, gegeben und dazu beim Abschied noch ein Siebenschillingstück geschenkt hatte, war des Mädchens Sinn für das Lächerliche doch weit stärker als ihre Dankbarkeit, und sie opferte Fräulein Jemmy genau so mitleidslos wie ihre Schwester.
Dann kam die Katastrophe, und sie wurde nach der Mall als ihrer neuen Heimat gebracht. Die strengen Regeln der Anstalt erstickten sie fast, die Gebete und Mahlzeiten, die Lektionen und Spaziergänge, die mit klösterlicher Regelmäßigkeit angeordnet waren, bedrückten sie und gingen fast über ihre Kräfte. Sie blickte auf die Freiheit und Armut des alten Heims in Soho mit so großem Bedauern zurück, daß jeder, auch sie selbst glaubte, sie verginge vor Kummer um ihren Vater. Sie hatte ein kleines Giebelstübchen, worin die Dienstboten sie nachts umherwandern und schluchzen hörten, aber sie weinte vor Wut, nicht vor Gram. Sie hatte sich bisher nicht viel verstellt, aber ihre Einsamkeit machte sie jetzt gelehrig. Sie hatte nie mit Frauen verkehrt; ihr Vater war trotz seiner Liederlichkeit doch talentiert, und sein Geplauder war ihr tausendmal angenehmer als das Geschwätz der Geschlechtsgenossinnen, mit denen sie jetzt zusammenlebte. Die pompöse Eitelkeit der alten Schulvorsteherin, die alberne Gutmütigkeit ihrer Schwester, das törichte Geschwätz und die Klatschereien der älteren Mädchen und die kalte Korrektheit der Lehrerinnen stießen sie in gleichem Maße ab. Sie hatte kein warmes, mütterlich fühlendes Herz, dies unglückliche Mädchen, sonst hätte das Geplauder und Erzählen der jüngeren Kinder, die hauptsächlich ihrer Obhut anvertraut waren, sie sanfter gestimmt und angezogen. Sie hatte nun doch schon zwei Jahre unter ihnen gelebt, und keinem einzigen tat es leid, daß sie fortging. Die sanfte, weichherzige Amelia Sedley war die einzige, an die sie sich wenigstens etwas näher anschloß; aber wer hätte sich nicht Amelia angeschlossen?
Das Glück – die bessere Stellung der jungen Damen um sie herum, verursachte Rebekka unsägliche Qualen des Neides. »Was sich das Mädchen da einbildet, weil sie die Enkelin eines Earls ist,« sagte sie von der einen. »Wie sie vor der Kreolin scharwenzeln und sich ducken wegen ihrer hunderttausend Pfund! Ich bin tausendmal gescheiter und anziehender als die mit all ihrem Reichtum. Ich bin ebenso wohlerzogen wie die Grafenenkelin mit ihrem feinen Stammbaum, und doch sieht jeder hier über mich hinweg. Aber gaben nicht, als ich noch bei meinem Vater war, manche Leute die lustigsten Bälle und Gesellschaften auf, um einen Abend mit mir zusammen zu sein?« Sie beschloß, auf jeden Fall aus ihrem Gefängnis loszukommen, und fing jetzt an, auf eigene Faust zu handeln und zum ersten Mal feste Zukunftspläne zu fassen.
Sie erwarb sich alles Wissen, das sie an diesem Ort erlangen konnte; sie beherrschte schon Musik und Sprachen und erlangte darum schnell das wenige ihr noch fehlende Wissen, das für Damen in jenen Tagen nötig war. Sie übte unaufhörlich auf dem Klavier, und als eines Tages die Mädchen alle fort waren und sie allein zu Hause geblieben war, spielte sie ein Stück so gut, daß die lauschende Minerva weise dachte, sie könnte sich die Ausgabe eines Musiklehrers für die Jüngeren ersparen, und dem Fräulein Sharp ihren Willen kundgab, in Zukunft sollte sie diese unterrichten.
Das Mädchen schlug es aus, zum allerersten Male und zum Erstaunen der majestätischen Schullehrerin. »Ich bin hier, um die Kinder Französisch zu lehren,« sagte Rebekka schroff, »nicht aber, um Musik zu lehren und Ihnen Geld zu ersparen. Bezahlen Sie es mir, dann werde ich es tun.«
Minerva mußte nachgeben und konnte sie natürlich von diesem Tage an nicht mehr leiden. »Seit fünfunddreißig Jahren,« sagte sie sehr richtig, »habe ich keine Person gesehen, die es in meinem eigenen Hause gewagt hätte, meiner Autorität zu trotzen. Ich habe eine Schlange an meinem Busen genährt.«
»Eine Schlange – Unsinn,« entgegnete Fräulein Sharp der alten Dame, die vor Erstaunen fast in Ohnmacht fiel, »Sie nahmen mich, weil ich Ihnen nützte. Zwischen uns kommt Dankbarkeit nicht in Betracht. Ich hasse diesen Ort und möchte fort. Ich tue hier nichts, als wozu ich verpflichtet bin.«
Es war nutzlos, daß die alte Dame sie fragte, ob sie sich denn auch bewußt sei, daß sie zu Fräulein Pinkerton spräche? Rebekka lachte ihr ins Gesicht, ein schreckliches, spöttisches, teuflisches Gelächter, darob die Schulvorsteherin fast in Krämpfe verfiel. »Geben Sie mir Geld,« sagte das Mädchen, »dann werden Sie mich los – oder, wenn Ihnen das besser paßt, so suchen Sie mir eine gute Stellung als Erzieherin bei einer adligen Familie – das können Sie leicht, wenn Sie nur wollen.« Und bei jedem neuen Streit kam sie immer wieder darauf zurück: »Suchen Sie mir eine Stellung – wir hassen einander ja – und ich gehe dann sofort.«
Obgleich nun das würdige Fräulein Pinkerton eine römische Nase und einen Turban hatte, so groß wie ein Grenadier, und bis hierher eine unüberwindliche Prinzessin gewesen war, besaß sie doch weder den Willen noch die Charakterstärke ihrer kleinen Schülerin. Daher kämpfte sie vergeblich gegen sie, und konnte sie auch nicht einschüchtern. Als sie einmal versuchte, sie öffentlich auszuschelten, verfiel Rebekka auf den vorhin erwähnten Plan, ihr auf Französisch zu antworten, wodurch die alte Jungfrau vollständig geschlagen wurde. Um ihre Autorität in der Schule aufrechtzuerhalten, mußte sie diese Rebellin, dies Ungeheuer, diese Schlange, diesen Feuerbrand, daraus entfernen; und da sie zu dieser Zeit gerade davon hörte, daß Sir Pitt Crawleys Familie einer Erzieherin bedurfte, so empfahl sie wirklich Fräulein Sharp für diese Stellung, obgleich sie doch Feuerbrand und Schlange war. »Ich kann,« sagte sie, »Fräulein Sharps Benehmen – außer gegen mich – nicht tadeln und muß ihre bedeutenden Talente und Kenntnisse anerkennen. Soweit wenigstens ihre intellektuellen Leistungen in Frage kommen, macht sie dem Erziehungssystem meiner Anstalt alle Ehre.«
Auf diese Weise brachte die Schuldirektorin ihre Empfehlung mit ihrem Gewissen in Einklang, der Vertrag wurde aufgehoben und die Schülerin war frei. Die hier in wenigen Zeilen beschriebene Schlacht dauerte in Wirklichkeit natürlich einige Monate. Da nun Fräulein Sedley in ihrem siebzehnten Jahre stand, die Schule verlassen wollte und sich zu Fräulein Sharp hingezogen fühlte (»der einzige Punkt in Amelias Betragen, der ihrer Lehrerin nicht gefiel,« sagte Minerva), so war Fräulein Sharp von ihr eingeladen worden, eine Woche in ihrem Hause zu verleben, ehe sie ihre Stellung als Erzieherin in einem Privathause anträte.
So lag also die Welt vor diesen beiden jungen Damen: für Amelia eine ganz neue, frische, glänzende Welt im Blütenschmuck; für Rebekka war sie nicht mehr so ganz neu. (Wenn wir denn schon einmal die Wahrheit über die Crisp-Angelegenheit sagen wollen, so deutete die einäugige Kuchenfrau jemandem an, der gegen jemand anders die Sache als verbürgt hinstellte: daß bedeutend mehr zwischen Herrn Crisp und Fräulein Sharp vorgegangen sei, als bekannt geworden sei, und daß sein Brief die Antwort auf einen andern gewesen sei!). Aber wer weiß denn die Wahrheit? Jedenfalls fing Rebekka, falls sie sie wirklich schon kannte, die Welt wieder von vorne an.
Bis die jungen Damen das Chausseehaus von Kensington erreichten, hatte Amelia ihre Gefährtinnen zwar nicht vergessen, aber doch wenigstens ihre Tränen getrocknet und war tief errötet und entzückt gewesen, als ein junger Gardeoffizier, der beim Vorbeireiten nach ihr blickte, sagte: »Auf Taille, ein verdammt hübsches Mädchen.« Ehe noch der Wagen in Russell Square ankam, hatte man viel von Empfängen bei Hofe gesprochen, und ob junge Damen bei der Vorstellung Puder und Reifröcke trügen oder nicht, und ob sie wohl diese Ehre haben würde, daß sie den Ball des Lord-Mayors mitmachen würde, wußte sie, und als man endlich das Haus erreichte, hüpfte Fräulein Amelia Sedley an Sambos Arm so glücklich und hübsch heraus, wie nur irgend ein Mädchen in der ganzen großen Stadt London. Darin stimmten er und der Kutscher überein, und ebenso ihr Vater und ihre Mutter, desgleichen alle Dienstboten des Hauses, die knicksend und Bücklinge machend und lächelnd im Flur standen, um ihre junge Herrin zu begrüßen.
Natürlich zeigte sie Rebekka jedes Zimmer im Hause und jeden Gegenstand in ihren Schubladen, all ihre Bücher, ihr Piano, ihre Kleider, ihre Halsbänder, Broschen, Spitzen und allerlei Tand. Sie bestand darauf, daß Rebekka den Schmuck mit den weißen Karneolen und den Ring mit den Türkisen annehme, desgleichen ein reizendes geblümtes Musselinkleid, das ihr jetzt zu klein war, ihrer Freundin aber genau passen würde, und sie wollte auch ihre Mutter fragen, ob sie ihr nicht auch den weißen Kaschmirschal schenken dürfe. Konnte sie ihn nicht entbehren? Hatte nicht Bruder Joseph ihr gerade eben zwei aus Indien mitgebracht?
Als Rebekka die beiden prächtigen Kaschmirschals sah, die Joseph Sedley seiner Schwester mitgebracht hatte, sagte sie vollkommen richtig: »Es muß reizend sein, einen Bruder zu haben,« und gewann sich so, als alleinstehende Waise ohne Freunde oder Verwandte, leicht das Mitleid der weichherzigen Amelia.
»Sie stehen nicht allein,« sagte Amelia, »denn Sie wissen, liebe Rebekka, daß ich stets Ihre Freundin sein werde, die sie wie eine Schwester liebt; ja wahrhaftig, das will ich.«
»Ach, Eltern haben, wie Sie sie haben, gütige, reiche, zärtliche Eltern, die Ihnen alles gewähren, was Sie möchten, und deren Liebe noch kostbarer ist, als das alles! Mein armer Papa konnte mir nichts geben, und ich besaß immer nur zwei Kleider! Und einen Bruder zu besitzen, einen lieben Bruder! Oh, wie lieb müssen Sie ihn haben!«
Amelia lachte.
»Wie? Lieben Sie ihn etwa nicht? Sie, die Sie doch jeden Menschen lieben, wie Sie sagen.«
»Ja, natürlich tue ich das – nur –«
»Nur was?«
»Nur scheint sich Joseph wenig daraus zu machen, ob ich ihn liebe oder nicht. Er reichte mir zwei Finger zum Gruß, als er nach zehnjähriger Abwesenheit wiederkam! Er ist sehr freundlich und gut, aber er spricht kaum je mit mir; ich glaube, er liebt seine Pfeife viel mehr als seine …« Hier hielt Amelia inne, denn warum sollte sie eigentlich Böses von ihrem Bruder reden? »Als ich noch ein Kind war, war er sehr gut zu mir,« fügte sie hinzu, »ich war erst fünf Jahre alt, als er fortging.«
»Er ist gewiß sehr reich?« sagte Rebekka. »Alle indischen Nabobs sind doch ungeheuer reich.«
»Ich glaube, er hat ein sehr großes Einkommen.«
»Und ist Ihre Schwägerin eine angenehme, hübsche Frau?«
»Ach, Joseph ist ja gar nicht verheiratet,« sagte Amelia, und dann lachte sie wieder.
Vielleicht hatte sie dies schon zu Rebekka erwähnt, aber die junge Dame schien sich dessen nicht zu erinnern, und beteuerte wirklich, erwartet zu haben, daß sie eine Menge Neffen und Nichten von Amelia sehen würde. Sie war ganz enttäuscht, daß Herr Sedley nicht verheiratet war; sie sei überzeugt, daß Amelia gesagt habe, er sei verheiratet, und sie liebe doch kleine Kinder so sehr!
»Ich glaubte, Sie hätten in Chiswick genug davon gehabt,« sagte Amelia. Sie wunderte sich etwas, wie zärtlich ihre Freundin plötzlich geworden war, und wirklich würde in späterer Zeit Fräulein Sharp sich nie mehr so weit vergessen haben, Ansichten auszusprechen, deren Unwahrheit so leicht entdeckt werden konnte. Aber wir müssen erwähnen, daß sie jetzt erst neunzehn Jahre alt ist und noch nicht gelernt hat, sich zu verstellen, das arme, unschuldige Geschöpf, und daß sie erst ihre eigenen Erfahrungen machen muß. Die vorher erwähnte Reihe von Fragen bedeutete in den Gedanken dieses klugen jungen Weibes nichts weiter als dies: »Wenn Herr Sedley reich und unverheiratet ist, warum sollte ich ihn dann nicht heiraten können? Ich habe zwar nur vierzehn Tage Zeit dafür übrig, aber ein Versuch schadet ja nichts.« Und sie beschloß bei sich selbst, diesen lobenswerten Versuch zu machen. Sie verdoppelte ihre Zärtlichkeiten gegen Amelia, sie küßte das weiße Karneolhalsband, als sie es umband, und sie schwor, daß sie sich nie, nie davon trennen würde. Als die Glocke zum Essen läutete, ging sie, ihre Freundin umschlungen haltend, wie es junge Damen zu tun pflegen, mit ihr die Treppe hinab. Sie war vor der Tür des Speisezimmers so aufgeregt, daß sie kaum den Mut zum Eintreten fand. »Fühlen Sie nur, Liebling, wie mir das Herz klopft!« sagte sie zu ihrer Freundin.
»Nein, das fühle ich nicht,« sagte Amelia; »kommen Sie nur hinein und seien Sie nicht ängstlich. Papa tut Ihnen nichts.«
Drittes KapitelRebekka vor dem Feinde
Ein sehr starker, wohlgenährter Herr in Lederhosen und Suworoffstiefeln, mit mehreren ungeheuren Halstüchern, die ihm fast bis zur Nase heraufreichten, mit rotgestreifter Weste und apfelgrünem Rock mit fast talergroßen Stahlknöpfen (so war das Morgenkostüm eines Stutzers der damaligen Zeit) las am Feuer die Zeitung, als die beiden Mädchen hereintraten, schnellte aber sogleich aus seinem Lehnstuhle empor, wurde sehr rot, und verbarg beim Anblick der beiden fast sein ganzes Gesicht in seinem Halstuche.
»Nur deine Schwester, Joseph,« sagte Amelia lachend und schüttelte die beiden Finger, die er ihr entgegenstreckte. »Ich bleibe, wie du wissen wirst, jetzt ganz zu Hause, und dies ist Fräulein Sharp, meine Freundin, von der ich dir schon erzählt habe.«
»Nein, niemals, auf mein Wort,« sagte er, den Kopf energisch hinter dem Halstuch schüttelnd. »Das heißt, ja – wie kalt ist es doch, mein Fräulein,« – worauf er nach Leibeskräften im Feuer herumschürte, obgleich man mitten im Juni war.
»Er ist sehr hübsch,« flüsterte Rebekka ziemlich laut Amelia zu.
»Meinen Sie?« sagte diese, »das werde ich ihm sagen.«
»Um Himmelswillen nicht, Liebling!« sagte Fräulein Sharp, und schreckte dabei schüchtern wie ein Reh zurück. Sie hatte vorher dem Herrn einen achtungsvollen jungfräulichen Knicks gemacht, und ihre sittsamen Augen schauten so beharrlich auf den Teppich, daß es ein Wunder war, wie sie überhaupt Gelegenheit gefunden hatte, ihn zu sehen.
»Ich danke dir für die schönen Schals, Bruder,« sagte Amelia zu dem Feuerschürer. »Nicht wahr, sie sind schön, Rebekka?«
»Ach, himmlisch!« sagte Fräulein Sharp, und ihre Augen wanderten vom Teppich geradenwegs zum Kronleuchter.
Joseph vollführte noch weiter ein lautes Geklapper mit Schüreisen und Feuerzange, keuchte und pustete dabei, und sein gelbes Gesicht wurde so rot, wie es nur werden konnte.
»Ich kann dir keine so schönen Geschenke machen, Joseph,« fuhr seine Schwester fort, »aber während ich in der Pension war, stickte ich dir ein sehr hübsches Paar Hosenträger.«
»Guter Gott, Amelia!« schrie der Bruder, ernstlich aufgeregt, »was meinst du denn eigentlich?« Dann riß er aus Leibeskräften am Klingelzug, sodaß er in seiner Hand blieb, was des ehrlichen Burschen Aufregung noch vermehrte. »Um Himmelswillen sieh nach, ob mein Buggy vor der Tür ist, ich kann nicht mehr warten. Ich muß fort. Der verd – Reitknecht! Ich muß fort.«
In diesem Augenblick trat das Oberhaupt der Familie herein, mit seinen Petschaften klimpernd wie ein echter britischer Kaufmann. »Was gibt’s, Amy?« fragte er.
»Joseph will, ich soll nachsehen, ob sein – sein Buggy vor der Tür ist. Was ist denn ein Buggy, Papa?«
»Ein einspänniger Palankin,« sagte der alte Herr, der in seiner Art ein Witzbold war.
Joseph brach daraufhin in ein wildes Gelächter aus, hielt aber plötzlich, wie von einem Schuß getroffen, inne, weil sein Auge sich mit Fräulein Sharps Auge begegnete.
»Diese junge Dame ist also deine Freundin? Fräulein Sharp, es freut mich sehr, Sie zu sehen. Haben Sie und Amy schon Joseph gescholten, daß er fortgehen will?«
»Ich habe Bonamy versprochen, mit ihm zu essen.«
»O pfui, sagtest du nicht deiner Mutter, du wolltest hier essen?«
»Aber in diesem Anzug ist es unmöglich.«
»Sehen Sie ihn nur an, Fräulein Sharp, ist er nicht hübsch genug, um überall zu Tische zu gehen?«
Hierauf blickte natürlich Fräulein Sharp ihre Freundin an, und sie brachen beide in ein Gelächter aus, das den alten Herrn sehr belustigte.
»Sahen Sie je ein solches Paar Lederhosen bei Fräulein Pinkerton?« fuhr er fort, seinen Vorteil wahrnehmend.
»Um Himmelswillen, Vater,« schrie Joseph.
»Da haben wir’s, ich habe seine Gefühle verletzt. Liebe Frau, ich habe deines Sohnes Gefühle verletzt. Ich habe auf seine Lederhosen angespielt. Frage Fräulein Sharp, ob es wahr ist. Komm Joseph, schließe Freundschaft mit Fräulein Sharp und laß uns alle zum Essen gehen.«
»Wir haben ein Pilaw, wie du es liebst, Joseph, und Papa hat den besten Steinbutt vom Billingsgater Markt mitgebracht.«
»Komm, komm, nimm Fräulein Sharps Arm, und ich gehe mit diesen beiden jungen Damen hinterher,« sagte der Vater, bot Frau und Tochter den Arm und ging lustig ab.
Wenn Fräulein Rebekka Sharp in ihrem Herzen beschlossen hatte, die Eroberung dieses dicken Dandys zu machen, so meine ich nicht, meine Damen, daß wir sie deshalb tadeln können; denn obgleich der Männerfang im allgemeinen von den jungen Mädchen mit der geziemenden Schamhaftigkeit ihren Müttern anvertraut wird, so müssen wir doch bedenken, daß Fräulein Sharp keine liebenden Verwandten hatte, die diese delikate Sache für sie erledigen konnten. Falls sie sich nicht selbst einen Mann verschaffte, gab es niemand sonst in der ganzen weiten Welt, der ihr diese Last abgenommen hätte. Warum gehen junge Mädchen in Gesellschaft? Tun sie es nicht um des edlen Ehrgeizes willen, sich einen Mann zu suchen? Warum gehen sie in Scharen in die Bäder? Weshalb tanzen sie jede Nacht bis fünf Uhr morgens eine ganze tödlich lange Saison hindurch? Warum spielen sie auf dem Pianoforte Sonaten und lernen zu einer Guinee die Stunde von einem Modelehrer vier Lieder, warum spielen sie die Harfe, wenn sie schöne Arme und hübsche Ellbogen haben, warum tragen sie Lincoln-Green-Jägerhüte und -Federn? Doch nur, um irgendeinen »wünschenswerten« jungen Mann mit ihren todbringenden Bögen und Pfeilen zu erlegen. Was veranlaßt achtbare Eltern, ihre Teppiche aufzunehmen, ihr ganzes Haus auf den Kopf zu stellen, und ein Fünftel ihres Jahreseinkommens für Ballsoupers und eisgekühlten Champagner auszugeben? Ist es nur bloße Nächstenliebe und der reine Wunsch, junge Leute glücklich und tanzen zu sehen? Ah bah, ihre Töchter wollen sie verheiraten, und wie die ehrliche Frau Sedley in den Tiefen ihres gütigen Herzens schon zwanzig kleine Plänchen für das Unterbringen ihrer Amelia ausgesonnen hat, so hat auch unsere vielgeliebte, aber unbeschirmte Rebekka schon beschlossen, ihr Möglichstes zu tun, um sich einen Mann zu verschaffen, den sie noch nötiger braucht als ihre Freundin. Sie besaß eine lebhafte Phantasie und hatte außerdem ›Tausendundeine Nacht‹ und Guthries Geographie gelesen, und tatsächlich hatte sie sich während des Ankleidens zum Essen und nachdem sie von Amelia erfahren hatte, daß deren Bruder sehr reich sei, schon ein blendendes Luftschloß gebaut, dessen Herrin sie war, mit irgendeinem Gatten im Hintergrunde (sie hatte ihn bis dahin noch nicht gesehen, daher konnte seine Gestalt auch nicht sehr deutlich sein); sie hatte sich mit einer Unzahl Schals, Turbane und Diamanthalsbänder geschmückt und war beim Klange des Blaubartmarsches auf einen Elefanten gestiegen, um dem Großmogul einen friedlichen Besuch abzustatten. Reizende Luftschlösser! Der Jugend glückliches Vorrecht ist es, euch zu bauen, und wie manch phantasievolles junges Geschöpf außer Rebekka Sharp hat schon in solchen entzückenden wachen Träumen geschwelgt!
Joseph Sedley war zwölf Jahre älter als seine Schwester Amelia. Er stand in den Zivildiensten der Ostindischen Kompagnie, und wurde zu der Zeit, in der wir uns befinden, im ›Ostindischen Register‹, Abteilung Bengalen, als Einnehmer von Boggley Wollah geführt, was eine ehrenvolle und einträgliche Stellung ist, wie jedermann weiß. Wer etwa wissen möchte, zu welch höheren Stellen Joseph im Dienste noch aufstieg, muß sich an das erwähnte Register halten.
Boggley Wollah liegt in schöner, einsamer, marschiger, buschreicher Gegend, und ist durch seine Schnepfenjagd berühmt, auch stößt man dort nicht selten auf einen Tiger. Ramgunge, wo sich eine Magistratsperson befindet, liegt nur vierzig Meilen entfernt, und etwa dreißig Meilen weiter steht ein Kavallerieposten; so schrieb Joseph seinen Eltern, als er den Einnehmerposten bekam. Er hatte etwa acht Jahre seines Lebens ganz allein an diesem entzückenden Orte gelebt, an dem er kaum eine Christenseele sah, als zweimal im Jahr das Detachement, das die von ihm einkassierten Einnahmen nach Kalkutta zu bringen hatte.
Glücklicherweise wurde er um diese Zeit leberkrank und mußte zu seiner Heilung nach Europa zurückkehren, was für ihn eine Quelle großen Wohllebens und Vergnügens in seinem Vaterlande wurde. Solange er in London war, lebte er nicht in seiner Eltern Hause, sondern hatte eine eigene Wohnung genommen, als ein munterer Junggeselle, der er war. Ehe er nach Indien ging, war er zu jung gewesen, um an den köstlichen Vergnügen eines jungen Mannes von gutem Ton teilnehmen zu können, aber bei seiner Rückkehr stürzte er sich mit desto größerem Eifer in dieselben. Er fuhr mit seinen Pferden in den Park, speiste in den modischsten Gasthäusern (denn der Orientalische Klub war damals noch nicht erfunden), ging häufig ins Theater, wie es damals Mode war, oder erschien in der Oper in engen Kniehosen und mit aufgeschlagenem Hute.
Als er nach Indien zurückkehrte und auch nachher noch, pflegte er vom Glücke dieser Zeit seines Lebens mit großer Begeisterung zu sprechen und zu verstehen zu geben, daß er und Brummel die Tonangeber gewesen seien. Aber in Wirklichkeit war er hier ebenso einsam wie in seinem Dickicht in Boggley Wollah. Er kannte kaum einen einzigen Menschen in London, und wenn sein Doktor und seine Quecksilberpillen und sein Leberleiden nicht gewesen wären, so hätte er vor Langeweile sterben müssen. Er war träge, mäklig, und dazu ein Bonvivant. Die Erscheinung einer Dame erschreckte ihn über alle Maßen, daher kam es auch, daß er nur selten im elterlichen Kreise am Russell Square weilte, wo es so lustig zuging und die Scherze seines gutmütigen, alten Vaters seine Eigenliebe verletzten. Seine Leibesfülle verursachte Joseph viel angstvolle Bestürzung und Besorgnis, und dann und wann machte er eine verzweifelte Anstrengung, um sein überflüssiges Fett loszuwerden, aber seine Trägheit und Feinschmeckerei ließ schnell alle Änderungsversuche in den Hintergrund treten, und er aß lustig wieder dreimal am Tage. Er war niemals gut angezogen, aber er gab sich die erdenklichste Mühe, seine dicke Gestalt zu schmücken und brachte täglich viele Stunden damit zu. Sein Kammerdiener wurde nur von seinen abgelegten Kleidern reich, sein Toilettentisch war mit Pomaden und Essenzen besetzt wie der einer alternden Schönheit. Er hatte, um eine schlanke Taille zu bekommen, alle damals erfundenen Gurte, Mieder und Taillengürtel versucht. Wie die meisten fetten Menschen ließ er sich seine Kleider zu eng machen, bevorzugte zu leuchtende Farben und einen zu jugendlichen Schnitt. Wenn er nachmittags endlich angezogen war, so fuhr er ganz allein im Park herum, dann kam er zum Umkleiden zurück und ging ganz allein ins Piazza-Kaffeehaus speisen. Er war eitel wie ein Mädchen und vielleicht gerade deshalb so ausnehmend schüchtern. Wenn Fräulein Rebekka bei ihrem ersten Eintritt ins Leben diesen Mann besiegt, so ist sie eine außergewöhnlich kluge junge Person!
Ihr erster Zug war außerordentlich geschickt. Als sie Sedley einen sehr schönen Mann nannte, wußte sie, daß Amelia es ihrer Mutter wiedersagen würde, die es dann wahrscheinlich Joseph wiedersagen, auf jeden Fall aber sich über das ihrem Sohn gespendete Lob freuen würde. So sind doch einmal alle Mütter. Hätte man Sycorax gesagt, daß ihr Sohn Caliban so schön wie Apoll sei, so würde sie sich, obgleich sie eine Hexe war, darüber gefreut haben.
Vielleicht wollte Joseph Sedley auch das Kompliment überhören – denn Rebekka sprach laut genug – und er hatte es doch gehört und, da er sich in seinem Innern wirklich für einen sehr schönen Mann hielt, so durchzitterte dies Lob jede Fiber seines dicken Körpers und verursachte ihm einen wonnigen Kitzel. Dann kam jedoch ein Rückschlag. »Macht sich das Mädchen auch nicht über mich lustig?« dachte er, und rannte gradewegs nach dem Klingelzug, um wegzulaufen, wie wir gesehen haben, wovon ihn aber seines Vaters Späße und seiner Mutter Bitten abbrachten. Er führte die junge Dame in zweifelhafter und erregter Gemütsstimmung zum Essen hinunter. »Hält sie mich wirklich für schön?« dachte er, »oder spottet sie über mich?« Wir haben von Joseph Sedley gesagt, daß er so eitel war wie ein Mädchen. Der Himmel schütze uns, daß die Mädchen den Spieß nicht umdrehen und von einer ihres eignen Geschlechts sagen: »Sie ist so eitel wie ein Mann«, worin sie auch vollkommen recht hätten. Die bärtigen Geschöpfe sind ganz genauso eitel, ebenso mäklig am Anzug, ebenso stolz auf ihr Äußeres, sind sich ebenso ihrer Anziehungskraft bewußt wie jede Kokette der Welt.
Sie gingen alle zusammen hinab, Joseph puterrot, Rebekka sehr schamhaft, mit niedergeschlagenen grünen Augen. Sie war in Weiß gekleidet, mit nackten schneeweißen Schultern – das Bild der Jugend, der unbeschützten Unschuld und der demütigen jungfräulichen Bescheidenheit. »Ich muß sehr still und zugleich sehr wißbegierig in bezug auf Indien sein,« dachte Rebekka.
Wie wir vorhin hörten, hatte Frau Sedley ein schönes Curry, wie er es liebte, für ihren Sohn bereiten lassen, und im Laufe des Mahles wurde davon auch Rebekka angeboten. »Was ist das?« meinte sie mit einem fragenden Blicke auf Joseph.
»Famos,« sagte der mit vollem Munde und von der wonnigen Arbeit des Schluckens stark gerötetem Gesicht. »Mutter, das ist so gut wie meine eigenen Currys in Indien.«
»Ach, wenn es etwas Indisches ist, muß ich auch davon versuchen,« sagte Fräulein Rebekka; »was von daher kommt, muß alles gut sein.«
»Gib doch Fräulein Sharp etwas Curry, meine Liebe,« sagte Herr Sedley lachend.
Rebekka hatte nie zuvor das Gericht gekostet.
»Finden Sie’s ebenso gut wie all das andere, was aus Indien kommt?« fragte Herr Sedley.
»Ach, vortrefflich!« sagte Rebekka, obgleich der Cayennepfeffer sie in die Zunge biß.
»Versuchen Sie ein Chili damit, Fräulein Sharp,« sagte Joseph wirklich interessiert.
»Ein Chili,« hauchte Rebekka nur noch, »ach ja!« Sie dachte nämlich, daß ein Chili etwas Kühlendes wäre, wie der Name zu verheißen schien, und wurde damit bedient. »Wie frisch und grün sie aussehen,« sagte sie und steckte eine Schote in den Mund. Die war aber noch brennender als Curry, und nun hielt sie es auch nicht mehr aus. Sie legte die Gabel hin und rief: »Wasser, um Himmelswillen, Wasser!«
Herr Sedley brach in ein wildes Gelächter aus (er liebte derbe Späße, wie alle Börsenleute) und sagte: »Das sind echte Inder, darauf können Sie sich verlassen – Sambo, gib Fräulein Sharp Wasser.«
Das Gelächter seines Vaters steckte Joseph an, denn er fand den Spaß vortrefflich. Die Damen lächelten nur ein wenig. Sie meinten, die arme Rebekka müsse zuviel leiden. Die hätte allerdings gewünscht, daß der alte Sedley erstickt wäre, aber sie schluckte ihren Ärger so schnell hinunter wie vorher das scheußliche Curry, und sobald sie wieder sprechen konnte, sagte sie mit komischer, gutgelaunter Miene:
»Ich hätte an den Pfeffer denken sollen, den die Prinzessin von Persien in ›Tausendundeiner Nacht‹ in die Sahnetorte tut. Tun Sie in Indien auch Cayennepfeffer in Ihre Sahnetorte?«
Der alte Sedley fing an zu lachen und meinte, Rebekka sei ein gutmütiges Mädchen. Joseph sagte nur: »Sahnetorte, Fräulein? Unsere Sahne in Bengalen ist sehr schlecht. Wir brauchen meist Ziegenmilch, und, weiß Gott, die ziehe ich jetzt der andern vor.«
»Sie werden von nun an nicht mehr alles Indische lieben, Fräulein Sharp,« sagte der alte Herr; und als die Damen sich nach dem Essen zurückgezogen hatten, sagte der schlaue, alte Bursche zu seinem Sohn: »Paß auf, Joe, das Mädchen hat’s auf dich abgesehen.«
»Puh! Unsinn!« sagte Joe, hochgeschmeichelt. »Dabei fällt mir ein, da war ein Mädchen in Dumdum, die Tochter Cutlers von der Artillerie, die nachher Lance, den Regimentsarzt, heiratete – die lief mir im Jahre 1804 wie toll nach, übrigens auch dem Mulligatawney, von dem ich dir vor dem Essen erzählte – ein verteufelt guter Junge übrigens, dieser Mulligatawney, er ist jetzt Richter in Budgebudge und wird sicherlich in fünf Jahren Mitglied des Rates sein. Na, also die Artillerie gab einen Ball und Quintin vom 14. königlichen Regiment sagte zu mir: ›Sedley, ich wette dreizehn gegen zehn, daß Sophie Cutler entweder Sie oder Mulligatawney einfängt, ehe noch die Regenzeit eintritt‹. Topp, sagte ich, und wahrhaftig – der Rotwein ist sehr gut, ist er von Adamson oder Carbonell?«
Ein leichtes Schnarchen war die einzige Antwort; der ehrliche Börsenmann war eingeschlafen, und so ging das Ende von Josephs Geschichte für heute verloren. In Männerkreisen war er jedoch immer sehr mitteilsam, und so hat er diese köstliche Geschichte viele Dutzend Male seinem Apotheker Dr. Gollop erzählt, wenn dieser kam, um sich nach der Leber und der Wirkung der Quecksilberpillen zu erkundigen.
Da Joseph Sedley leidend war, so begnügte er sich mit einer einzigen Flasche Rotwein, außer dem Madeira, den er bei Tisch getrunken hatte, aß ein paar Teller Erdbeeren mit Sahne und vierundzwanzig kleine Butterzwiebäcke, die zufällig auf einem Teller in der Nähe lagen, und dachte sicherlich (wir Romanschreiber besitzen das Vorrecht der Allwissenheit) sehr viel an das Mädchen oben. »Ein hübsches, lustiges, gutlauniges junges Geschöpf,« dachte er bei sich. »Wie sie mich ansah, als ich ihr beim Essen das Taschentuch aufhob! Sie verlor es zweimal. Wer singt wohl da oben? Ob ich mal hinaufgehe und nachsehe?«
Aber seine Schüchternheit siegte. Sein Vater schlief, sein Hut hing im Flur, ganz nahe in Southampton Row war ein Droschkenstand. »Ich will doch gehen und die ›Vierzig Räuber‹ und Fräulein Decamp tanzen sehen,« sagte er, schlich sich sacht auf den Fußspitzen hinaus und verschwand, ohne seinen würdigen Erzeuger zu wecken.
»Da geht Joseph,« sagte Amelia, die an dem offenen Fenster stand, während Rebekka am Piano sang.
»Fräulein Sharp hat ihn verscheucht,« sagte Frau Sedley. »Warum ist der arme Joe aber auch so schüchtern?«
Viertes KapitelDie grünseidne Börse
Der Schreck des armen Joe dauerte zwei oder drei Tage; während dieser Zeit kam er nicht nach Hause, Fräulein Rebekka aber erwähnte auch nicht ein einziges Mal seinen Namen. Sie war gegen Frau Sedley ganz respektvolle Dankbarkeit; von den Bazars war sie über die Maßen entzückt, und im Theater, wohin die gute Dame sie mitnahm, von Bewunderung hingerissen. Als eines Tages Amelia Kopfschmerzen hatte und nicht zu einer Vergnügungsgesellschaft gehen konnte, zu der die beiden jungen Mädchen eingeladen waren, konnte nichts ihre Freundin bewegen, ohne sie zu gehen. »Wie! Sie, die Sie der armen Waise zum ersten Male in ihrem Leben Glück und Liebe erzeigt haben, sollte ich verlassen? Nie!« und die grünen Augen sahen mit Tränen zum Himmel auf, und Frau Sedley mußte sich gestehen, daß ihrer Tochter Freundin ein bezaubernd gutes Herz besäße.
Über Herrn Sedleys Späße lachte Rebekka mit einer Herzlichkeit und Ausdauer, die dem gutmütigen alten Herrn sehr gefielen und ihm wohltaten. Aber nicht nur bei den Familienoberhäuptern allein fand Fräulein Sharp Gnade. Sie wußte auch Frau Blenkinsop, die Haushälterin, für sich zu gewinnen, indem sie das tiefste Interesse für das Himbeermus an den Tag legte, dessen Bereitung gerade in deren Zimmer vor sich ging, sie bestand darauf, Sambo »Herr« und »Herr Sambo«, zum großen Entzücken des Schwarzen, anzureden, sie entschuldigte sich bei dem Kammermädchen, wenn sie ihr klingelte, wegen der Mühe, die sie ihr machte, so süß und bescheiden, daß die Dienerstube fast ebenso bezaubert von ihr war, wie die Herrschaften.
Eines Tages, als Rebekka einige Zeichnungen ansah, die Amelia aus der Schule nach Hause geschickt hatte, stieß sie plötzlich auf eine, über die sie in einen Strom von Tränen ausbrach, sodaß sie das Zimmer verlassen mußte. Es war an dem Tage, als Joe Sedley zum zweiten Male auftauchte.
Amelia stürzte ihrer Freundin nach, um die Ursache dieses Gefühlsausbruches zu erfahren, und das gutmütige Mädchen kam allein und selbst sehr bewegt zurück.