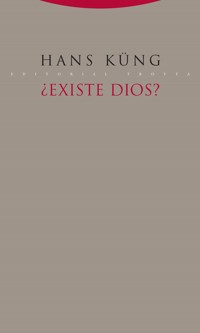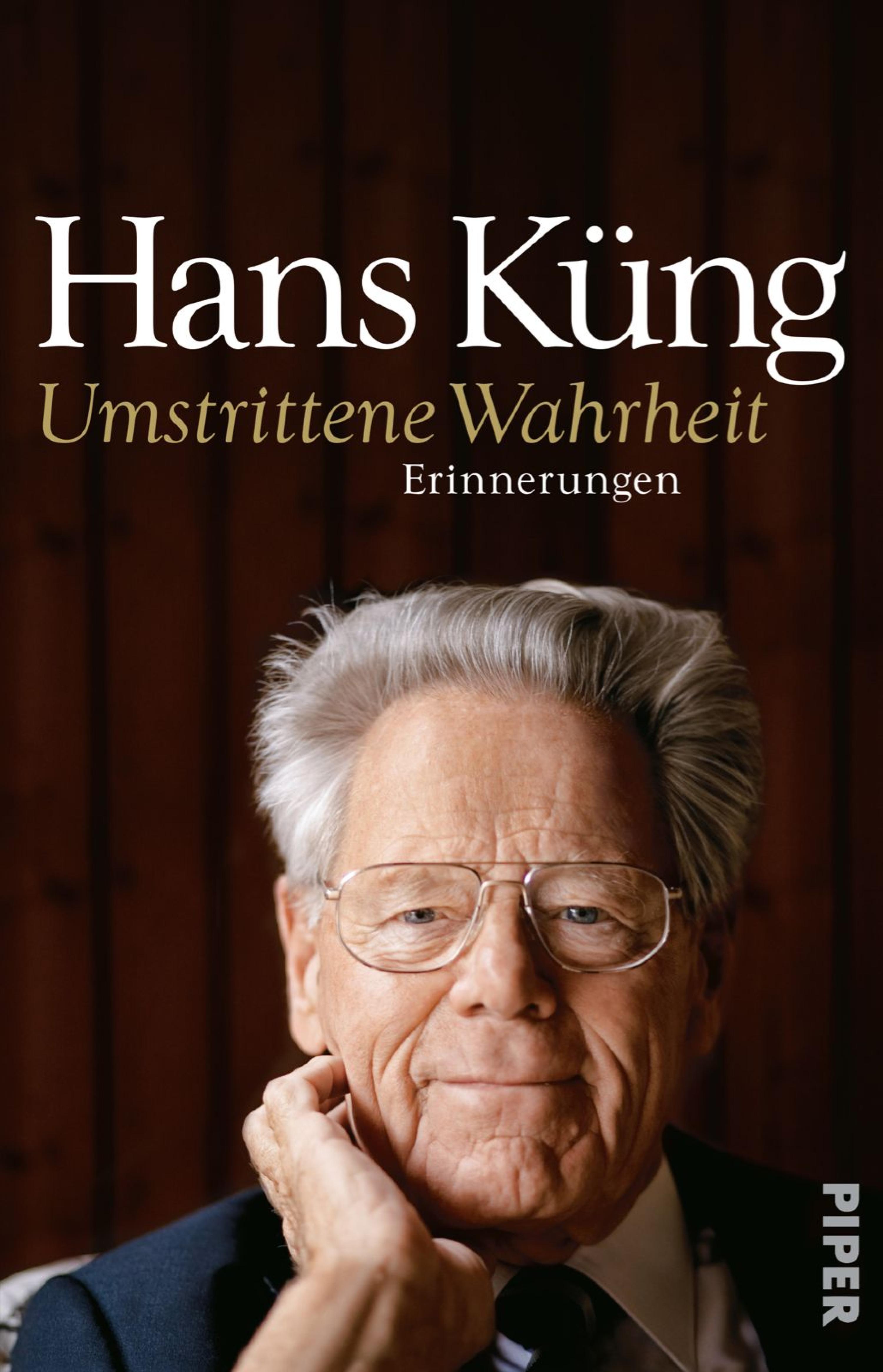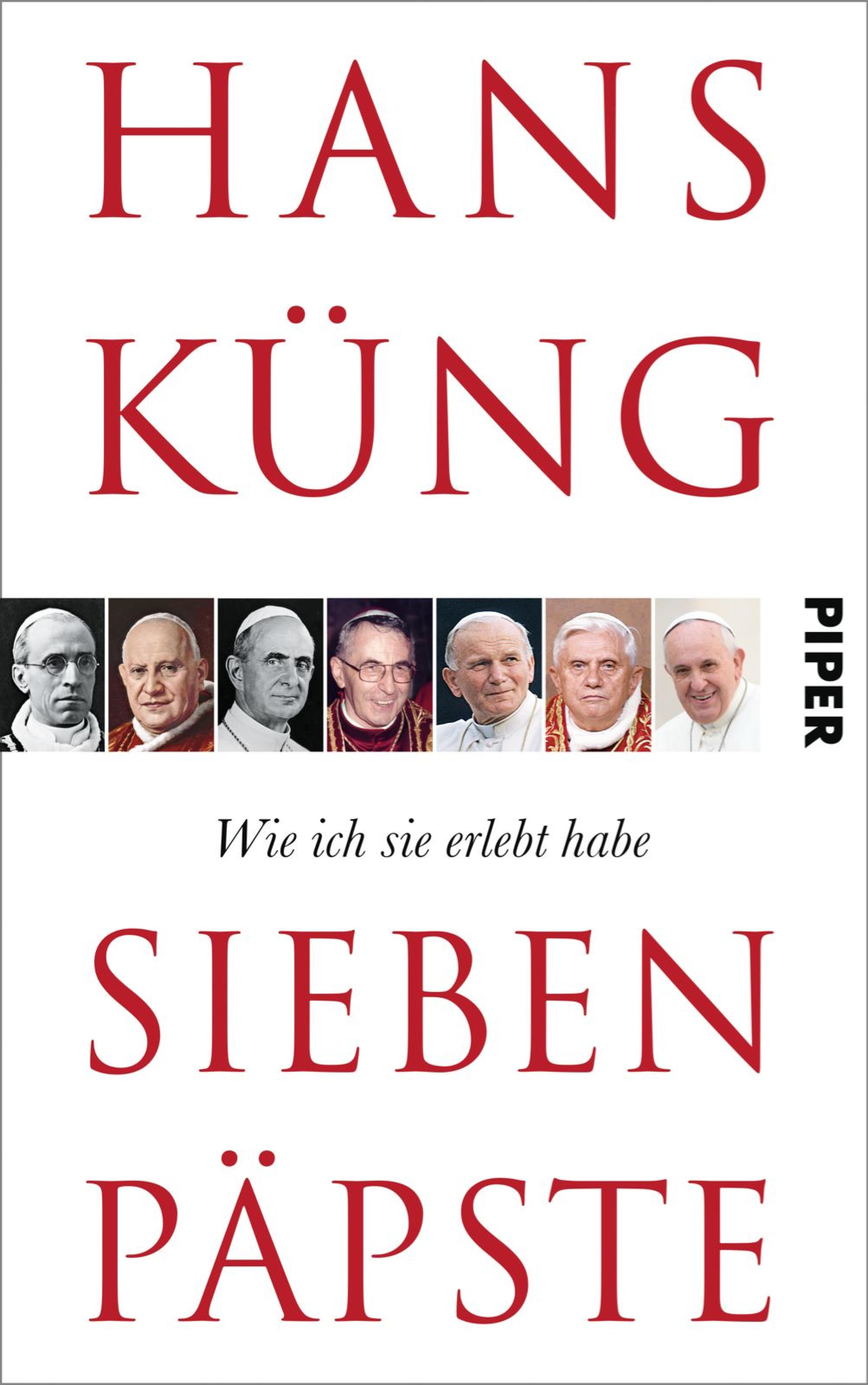11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Schon seit gemeinsamen Tübinger Tagen stehen sich die Jesus-Bilder von Joseph Ratzinger und Hans Küng diametral gegenüber. Hier der verkirchlichte, dogmatisierte Christus Ratzingers, dort der lebendige Jesus aus historischer Perspektive. Hans Küng hat die zentralen Texte zu Jesus von Nazareth aus seinem Buch »Christ sein« gelöst und neu gefasst: für einen befreiten Zugang, gegen alle Enge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Dieses Buch enthält die überarbeiteten Kapitel B I,1; II,1-2; C I-V,2; D II,1-2; III,2 des Buches »Christ sein« (1974).
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95603-1
© Piper Verlag GmbH München, 2012 Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Wie ich mich Jesus annäherte
Wer war jene einzigartige Gestalt, die dem Christentum den Namen gab? Wie ungezählte andere Katholiken vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65) bin ich aufgewachsen mit dem traditionellen Christusbild des Glaubensbekenntnisses, der hellenistischen Konzilien und byzantinischen Mosaiken: Jesus Christus als thronender »Gottessohn«, ein menschenfreundlicher »Heiland« und früher für die Jugend der »Christkönig«.
Im Katechismusunterricht lernten wir dogmatische Formeln, ohne sie zu verstehen: Jesus Christus sei die »zweite Person der Dreifaltigkeit«, »eine göttliche Person in zwei Naturen«, einer menschlichen und einer göttlichen. Über eine solche »Christologie von oben«, sozusagen vom Himmel hoch, hörte ich dann in Rom eine ganzsemestrige Vorlesung, mitsamt den Häresien, gegen welche Konzilien und Kaiser vorgegangen waren, und dazu die oft wenig überzeugenden Antworten auf die schon damals angemeldeten Schwierigkeiten. Zwar bestand ich all die nicht ganz einfachen lateinischen Examina problemlos – aber meine Spiritualität? Die blieb eher unbefriedigt. Lange Zeit interessierte mich am meisten die geistreiche paulinische Theologie, die Evangelien kamen mir dagegen zu vertraut und eher langweilig vor.
Richtig interessant wurde für mich die Christusfigur erst, als ich sie nach meinen sieben römischen Jahren aufgrund der modernen Bibelwissenschaft »von unten«, sozusagen aus der Perspektive seiner ersten Jünger kennenlernen durfte: als reale Gestalt der Geschichte. Das gründliche Studium der katholischen wie evangelischen exegetischen Literatur im Zusammenhang meiner Vorlesungen, Seminare und Publikationen war angetrieben durch meine ungeheure Wissbegierde nach diesem »unbekannten« irdischen Jesus.
Denn das Wesen des Christentums ist nun einmal nichts abstrakt Dogmatisches, ist keine allgemeine Lehre, sondern ist seit eh und je eine lebendige geschichtliche Gestalt: Jesus von Nazaret. Jahre hindurch habe ich mir so das einzigartige Profil des Nazareners aufgrund der überreichen biblischen Forschung der letzten zweihundert Jahre erarbeitet, habe alles in leidenschaftlicher Anteilnahme durchdacht, präzise begründet und systematisch dargeboten. Ja, ich habe sogar über das ganze Markus-Evangelium vom ersten bis zum letzten Vers gepredigt, und anschließend auch über die Bergpredigt.
Seit meinem Buch »Christ sein« weiß ich, wovon ich rede, wenn ich ganz elementar sage: Das christliche Lebensmodell ist schlicht dieserJesus von Nazaret als der Messias, Christós, der Gesalbte und Gesandte Gottes. Jesus Christus ist das Fundament echter christlicher Spiritualität. Ein herausforderndes Lebensmodell für unsere Beziehung zum Mitmenschen wie auch zu Gott selbst, das für Millionen Menschen in aller Welt Orientierung und Maßstab wurde.
Wer also ist ein Christ? Nicht derjenige, der nur »Herr, Herr« sagt und einem »Fundamentalismus« huldigt – sei dieser biblizistisch-protestantischer, autoritär-römisch-katholischer oder traditionalistisch-östlich-orthodoxer Prägung. Christ ist vielmehr, wer auf seinem ganz persönlichen Lebensweg (und jeder Mensch hat einen eigenen) sich bemüht, sich an diesem Jesus Christus praktisch zu orientieren. Mehr ist nicht verlangt.
Mein eigenes und so manches andere Leben mit seinen Höhen und Tiefen, und auch meine Kirchenloyalität und Kirchenkritik kann man nur von daher verstehen. Gerade meine Kirchenkritik kommt wie die so vieler Christen aus dem Leiden an der Diskrepanz zwischen dem, was dieser geschichtliche Jesus war, verkündete, lebte, erkämpfte, erlitt, und dem, was heute die institutionelle Kirche mit ihrer Hierarchie repräsentiert. Diese Diskrepanz ist oft unerträglich groß geworden. Jesus bei einem triumphalen Pontifikalamt im Petersdom? Oder im Gebet mit dem amerikanischen Kriegspräsidenten und Benedikt XVI. im Weißen Haus? Oder bei einer aufwendigen Staatsreise des »Stellvertreters« mit im Papamobil? Nicht auszudenken! Frei nach Dostojewskis Großinquisitor würde man ihn wohl überall fragen: »Warum kommst du uns zu stören?«
Am allerdringendsten und befreiendsten für unsere christliche Spiritualität ist es folglich, uns für unser Christsein theologisch wie praktisch nicht so sehr an traditionellen dogmatischen Formulierungen und kirchlichen Reglementierungen zu orientieren, die vielen Menschen abstrakt und existentiell belanglos erscheinen, sondern wieder mehr an der Person Jesu selber, wie sie uns aus den biblischen Zeugnissen entgegentritt.
Das 1974 veröffentlichte Buch »Christ sein« blieb für mich die Grundlage für die Exploration großer Arbeitsfelder, in die ich mich in den letzten vier Jahrzehnten mit aller theologischen Leidenschaft vorgearbeitet habe. Dass dieses umfangreiche Buch bis heute immer neue Auflagen erlebte und in 15 Sprachen übersetzt wurde, bedeutet eine überwältigende Bestätigung dieser Sicht von Christus und Christsein. Nach all dem Segeln in weite theologische Horizonte verspüre ich jetzt gegen Ende meiner theologischen Tätigkeit das Bedürfnis und die Freude, zum Zentrum meiner Theologie zurückzukehren, wo mein Herz schlägt, und es noch einmal ganz deutlich herauszuarbeiten. Ich halte mich bei diesem Jesus-Buch zumeist an die betreffenden Abschnitte meines Buches »Christ sein« (besonders im Teil C) und mache sie leichter lesbar durch zahlreiche Zwischentitel. Doch lasse ich alle nicht notwendigen exegetischen und theologischen Erklärungen ebenso weg wie alle Anmerkungen und Literaturangaben. Wer also die genauen Bibelstellen nachschlagen möchte, wird in den fast zweihundert Fußnoten der betreffenden Abschnitte in »Christ sein« die genauen Angaben finden. So ist ein konzentriertes Buch entstanden, ohne alle theologischen Spekulationen und Erbaulichkeiten.
Man wird mein Jesus-Buch mit den beiden Jesus-Büchern Joseph Ratzingers/Papst Benedikts XVI. vergleichen. In der Tat haben wir beide als Tübinger Dogmatik-Professoren in den 1960er-Jahren unser Jesus-Bild geformt. Und selbstverständlich will ich keinen unversöhnlichen Gegensatz zwischen unseren Jesus-Bildern konstruieren. Aber man sollte wissen: Schon in seiner Tübinger »Einführung ins Christentum« bot mein Kollege Ratzinger von der modernen Jesus-Forschung eine polemische Karikatur, während ich die Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Exegese entschieden aufnahm und so mein Buch »Christ sein« systematisch streng auf dem kritisch eruierten Befund des Neuen Testaments aufbaute. Er hat bei allem Lippenbekenntnis zur historisch-kritischen Methode deren für die Dogmatik unbequeme Ergebnisse ignoriert und mit Zitaten der Kirchenväter und aus der Liturgie geistreich überspielt. Sein Jesus-Bild »von oben« hat er entscheidend vom Dogma der hellenistischen Konzilien des 4./5. Jahrhunderts und von der Theologie Augustins und Bonaventuras inspirieren lassen. Er interpretiert – nicht ohne Zirkelschlüsse – die synoptischen Evangelien vom Johannes-Evangelium her und dieses wiederum vom Konzil von Nikaia (325) aus, das ich meinerseits am Neuen Testament messe. So präsentiert er durchgehend ein stark vergöttlichtes Jesusbild, während ich den geschichtlichen Jesus und seinen dramatischen Grundkonflikt mit der religiösen Hierarchie und der pharisäischen Frömmigkeit herausarbeite – mit allen Konsequenzen.
Für die Kritik an Ratzingers Positionen, von ihm als Papst ausdrücklich gewünscht, verweise ich auf die beiden reichhaltigen von Hermann Häring herausgegebenen Bände »›Jesus von Nazareth‹ in der wissenschaftlichen Diskussion« (Berlin 2008) und »Der Jesus des Papstes. Passion, Tod und Auferstehung im Disput« (Berlin 2011). Meinerseits kann ich auf große Ergänzungen der Ausführungen in »Christ sein« verzichten. Selbstverständlich hat sich die exegetische Forschung in Detailfragen weiterentwickelt. So weise ich jetzt auf die inzwischen sehr unterschiedlichen Einschätzungen von Qumran hin und präzisiere weitere Punkte. Aber kompetente Exegeten haben mir bestätigt, dass sich in den Grundfragen wenig geändert hat und meine systematisch-theologischen Folgerungen aktuell geblieben sind. Fazit: Wer im Neuen Testament den dogmatisierten Christus sucht, lese Ratzinger, wer den Jesus der Geschichte und der urchristlichen Verkündigung, lese Küng. Dieser Jesus ist es, der Menschen damals wie heute betroffen macht, zur Stellungnahme herausfordert und nicht einfach distanziert zur Kenntnis genommen werden kann.
Und so kann dieses mit nüchterner Leidenschaft geschriebene Buch zur spirituellen Vertiefung anleiten. Aus meinem Buch »Christ sein« könne man hundert Predigten machen, schrieb damals ein Pfarrer. Vielleicht, aber mein Buch selber predigt nicht, sondern zeichnet mit weiten Querbezügen jene Gestalt, deren Botschaft, Verhalten und Geschick eine christliche Spiritualität ermöglicht: ein wahres Menschsein und Christsein. Freilich habe ich dieses Buch nicht geschrieben, weil ich mich selber für einen guten Christen, sondern weil ich Christsein in der Nachfolge Jesu Christi für eine besonders gute Sache halte.
Leser dieses Buches aber, die eine Erklärung des traditionellen Glaubensbekenntnisses suchen, finden sie, an der biblischen Botschaft orientiert, in meinem Buch »Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt«. Wer sich für die Entwicklung der Christologie »von oben« und Fragen der Präexistenz und Erlösungslehre interessiert, kann sie in meinem Band »Das Christentum. Wesen und Geschichte« nachlesen.
Dass für Juden die Tora und für Muslime der Koran »der Weg, die Wahrheit und das Leben« ist, respektiere und verstehe ich, aber für mich als Christen ist es dieser Jesus Christus. Mein ökumenisches Interesse in diesem Buch hier war und ist es, auch für den interreligiösen Dialog das allen Christen Gemeinsame, Jesus als den Christus selber, herauszuarbeiten. Von dieser solide begründeten christlichen Basis aus, die mir als Christ geistige Identität vermittelt, konnte und kann ich es wagen, mich in die geistigen Abenteuer des Dialogs auch mit Juden und Muslimen, mit Gläubigen und Nichtgläubigen zu stürzen. Die Basisformel, mit der dieses Buch endet, hat mich durch all die Jahrzehnte begleitet und drückt auch heute und hoffentlich bis zu meinem Ende in aller Kürze mein ganz persönliches »Credo« aus:
In der Nachfolge Jesu Christi
kann der Mensch in der Welt von heute
wahrhaft menschlich leben, handeln, leiden und sterben:
in Glück und Unglück, Leben und Tod gehalten von Gott
und hilfreich den Menschen.
Tübingen, im Januar 2012
Hans Küng
I. Das Besondere des Christentums
1. Was ist christlich?
»Christlich«: weniger ein Schlagwort heute als ein Schlafwort. Christlich ist so vieles, zu vieles: Kirchen, Schulen, politische Parteien, kulturelle Vereine, und natürlich Europa, der Westen, das Mittelalter, ganz zu schweigen vom »allerchristlichsten König« – ein Titel von Rom verliehen, wo man im Übrigen andere Attribute vorzieht (»römisch«, »katholisch«, »römisch-katholisch«, »kirchlich«, »heilig«), um sie ohne alle Umstände mit »christlich« schlicht gleichzusetzen. Wie jede Inflation führt auch die Begriffsinflation des Christlichen zur Abwertung.
Gefährliche Erinnerung
Ob man sich überhaupt noch erinnert, dass das nach der Apostelgeschichte in Antiochien aufgekommene Wort, als es zuerst in welthistorischem Zusammenhang gebraucht wurde, eher ein Schimpfname als ein Ehrenname war?
Damals, als um 112 der römische Gouverneur in der kleinasiatischen Provinz Bithynien, Gajus Plinius II., bei Kaiser Trajan anfragt wegen der vieler Verbrechen angeklagten »Christen«, die nach seiner Nachprüfung zwar dem Kaiser den Kult verweigerten, aber sonst anscheinend nur »Christus als einem Gott« Hymnen sangen (= Glaubensbekenntnisse vortrugen?) und sich auf gewisse Gebote (nicht stehlen, rauben, ehebrechen, betrügen) verpflichteten.
Damals, als ein wenig später ein Freund des Plinius, Cornelius Tacitus, an einer Geschichte des kaiserlichen Rom arbeitend, verhältnismäßig genau vom großen Brand Roms 64 berichtet, den man allgemein Kaiser Nero selber zugeschrieben habe, der aber seinerseits die Schuld auf die »Chrestianer« abgeschoben habe: »Chrestianer« hergeleitet von einem unter Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichteten »Christus«, nach dessen Tod dieser »verderbliche Aberglaube« wie schließlich alles Schändliche und Gemeine seinen Weg nach Rom gefunden und nach dem Brand sogar eine große Menge Gläubiger gewonnen habe.
Damals, als wenig später und viel weniger genau der Kaiser-Biograph Sueton davon berichtet, dass Kaiser Claudius die Juden, die auf Veranlassung des »Christus« beständig Unruhen erregten, aus Rom ausgewiesen habe.
Damals, als – frühestes jüdisches Zeugnis schon um 90 – ebenfalls in Rom der jüdische Geschichtsschreiber dieser Zeit, Flavius Josephus, mit offensichtlicher Reserve die 62 erfolgte Steinigung des Jakobus, des »Bruders Jesu, des sogenannten Christus« erwähnt.
So weit die frühesten heidnischen und jüdischen Zeugnisse: Es wäre schon viel erreicht, wenn man sich auch heute erinnern würde, dass Christentum offensichtlich nicht irgendeine Weltanschauung oder irgendwelche ewigen Ideen meint, sondern irgendetwas mit einem Christus zu tun hat. Aber Erinnerungen können peinlich sein. Das erfuhr schon manche Partei, die ihr Parteiprogramm revidieren wollte. Ja, Erinnerungen können sogar gefährlich sein: Christentum – Aktivierung einer »gefährlichen und befreienden Erinnerung« (J. B. Metz). Das war doch ursprünglich mit der Lesung der neutestamentlichen Schriften, das war mit der Feier des Gedächtnismahles, mit dem Leben in der christlichen Nachfolge, mit dem ganzen vielfältigen Einsatz der Kirche in der Welt gemeint. Erinnerung an was? Von dieser offensichtlich beunruhigenden Erinnerung zeugen schon die eben vernommenen ersten heidnischen und jüdischen Nachrichten bezüglich des Christentums, Zeugnisse aus der Zeit der spätesten neutestamentlichen Schriften. Von diesen die Welt verändernden Erinnerungen berichten vor allem die christlichen Zeugnisse selbst. Erinnerung an was? Diese grundlegende Frage stellt sich für uns heute vom Neuen Testament wie überhaupt von der christlichen Geschichte her.
Erstens: Man betont oft und zu Recht die Verschiedenartigkeit, Zufälligkeit, teilweise auch die Widersprüchlichkeit der in der Sammlung des Neuen Testaments enthaltenen Schriften: Ausführliche systematische Lehrschreiben, aber auch wenig geplante Antwortschreiben auf Fragen der Adressaten. Ein Gelegenheitsbrieflein, kaum zwei Seiten lang, an den Herrn eines entlaufenen Sklaven und die eher langatmige Beschreibung der Taten der ersten Generation und ihrer Hauptfigur. Evangelien, die vor allem von Vergangenem berichten, und prophetische Sendschreiben, die der Zukunft gelten. Die einen im Stil gewandt, die anderen eher ungepflegt; die einen nach Sprache und Gedankenwelt von Juden stammend, die anderen von Hellenisten; die einen sehr früh, die anderen beinahe 100 Jahre später geschrieben …!
Die Frage ist wahrhaftig nicht unberechtigt: Was eigentlich hält die so verschiedenen 27 »Bücher« des Neuen Testaments zusammen? Die Antwort? Sie ist nach den Zeugnissen selbst erstaunlich einfach: Es ist die Erinnerung an einen Jesus, der im neutestamentlichen Griechisch »Christos« (hebräisch »maschiah«, aramäisch »meschiha«: Messias = Gesalbter) genannt wird.
Zweitens: Man betont ebenso oft und zu Recht die Risse und Sprünge, die Kontraste und Widersprüchlichkeiten in der Tradition und überhaupt der Geschichte der Christenheit: Jahrhunderte der kleinen Gemeinschaft und Jahrhunderte der Großorganisation, Jahrhunderte der Minorität und solche der Majorität; die Verfolgten werden die Herrschenden und wiederum nicht selten auch die Verfolgenden. Jahrhunderte der Untergrundkirche abgelöst durch die der Staatskirche, Jahrhunderte der neronianischen Märtyrer und Jahrhunderte der konstantinischen Hofbischöfe. Zeitalter der Mönche und Gelehrten und – oft ineinander verschlungen – solche der Kirchenpolitiker; Jahrhunderte der konvertierenden Barbaren im Aufgang Europas und Jahrhunderte des von christlichen Kaisern und Päpsten neu begründeten und auch wieder ruinierten Imperium Romanum; Jahrhunderte der Papstsynoden und Jahrhunderte der auf die Päpste zielenden Reformkonzilien. Das Goldene Zeitalter christlicher Humanisten wie säkularisierter Renaissancemenschen und die kirchliche Revolution der Reformatoren; Jahrhunderte der katholischen oder protestantischen Orthodoxie und Jahrhunderte der evangelischen Erweckung. Zeiten der Anpassung und Zeiten des Widerstandes, saecula obscura und das Siècle des Lumières, Jahrhunderte der Innovation und Jahrhunderte der Restauration, solche der Verzweiflung und solche der Hoffnung …!
Die Frage wiederum erstaunt nicht: Was eigentlich hält die so wunderlich kontrastierenden 20 Jahrhunderte christlicher Geschichte und Tradition zusammen? Und wiederum gibt es auch hier keine andere Antwort: Es ist die Erinnerung an einen Jesus, der auch durch die Jahrhunderte »Christus«, Gottes letzter und entscheidender Gesandter genannt wird.
Die Begriffe beim Wort nehmen
Die Umrisse werden später zu füllen sein. Aber in einer Zeit auch theologischer Vermischung und Vernebelung der Begriffe ist eine klare Sprache notwendig. Der Theologe leistet weder Christen noch Nichtchristen einen Dienst, wenn er die Dinge nicht beim Namen nennt, wenn er die Begriffe nicht beim Wort nimmt.
Christentum ist heute konfrontiert mit den Weltreligionen, die ebenfalls Wahrheit offenbaren, Wege zum Heil sind, »legitime« Religionen darstellen, ja, die auch von der Entfremdung, Versklavung und Unerlöstheit der Menschen wie von der Nähe, der Gnade, dem Erbarmen der Gottheit wissen können. Die Frage drängte sich auf: Wenn dem allem so ist, was ist dann noch das Besondere des Christentums?
Die noch umrisshafte, aber doch genau treffende Antwort muss lauten: Nach dem Zeugnis des Anfangs und dem der gesamten Tradition, nach dem Zeugnis der Christen und der Nichtchristen ist das Besondere des Christentums – und wie wenig banal und tautologisch diese Antwort ist, wird sich zeigen – dieser Jesus selbst, der in alter Sprache auch heute noch Christus genannt wird! Oder stimmt es vielleicht nicht: Keine der großen oder kleinen Religionen, sosehr sie ihn unter Umständen auch in einem Tempel oder ihrem heiligen Buch mitverehren mögen, würde ihn als letztlich entscheidend, als ausschlaggebend, als maßgebend für des Menschen Beziehungen zu Gott, zum Mitmenschen, zur Gesellschaft ansehen. Das Besondere, das Ureigenste des Christentums ist es, diesen Jesus als letztlich entscheidend, ausschlaggebend, maßgebend zu betrachten für den Menschen in diesen seinen verschiedenen Dimensionen. Und gerade dies war mit dem Titel »Christus« von Anfang an gemeint. Nicht umsonst ist schon damals dieser Titel mit dem Namen »Jesus« gleichsam zu einem Eigennamen zusammengewachsen.
Christentum ist heute zugleich konfrontiert mit den nachchristlichen Humanismen evolutiver oder revolutionärer Art, die ebenfalls für alles Wahre, Gute und Schöne sind, die alle menschlichen Werte und mit der Freiheit und Gleichheit auch die Brüderlichkeit hochhalten und die sich oft effektiver für die Entwicklung des ganzen Menschen und aller Menschen einsetzen. Andererseits wollen auch die christlichen Kirchen und Theologien wieder in neuer Weise menschlich und mitmenschlich sein: modern, aktuell, aufgeklärt, emanzipatorisch, dialogisch, pluralistisch, solidarisch, mündig, weltlich, säkular, kurz: human. Die Frage war unausweichlich: Wenn dem allem so ist, oder zumindest so sein sollte, was ist dann noch das Besondere des Christentums?
Die wiederum nur umrisshafte, aber doch schon völlig präzise Antwort muss auch hier lauten: Nach dem Zeugnis des Anfangs und der gesamten Tradition ist das Besondere wieder dieser Jesus selbst, der immer wieder neu als Christus erkannt und anerkannt wird. Man mache auch hier die Gegenprobe: Keiner der evolutionären oder revolutionären Humanismen, sosehr sie ihn unter Umständen als Menschen respektieren und gar propagieren, würde ihn als letztlich entscheidend, ausschlaggebend, maßgebend für den Menschen in allen seinen Dimensionen ansehen. Das Besondere, das Ureigenste des Christentums ist es, diesen Jesus als letztlich entscheidend, ausschlaggebend, maßgebend für des Menschen Beziehungen zu Gott, zum Mitmenschen, zur Gesellschaft zu betrachten: in abgekürzter biblischer Formel als »Jesus Christus«.
Aus beiden Perspektiven ergibt sich: Will das Christentum für die Menschen in den Weltreligionen, will es für die modernen Humanisten relevant sein, neu relevant werden, dann jedenfalls nicht einfach dadurch, dass es nachspricht, was die anderen vorsprechen, nachmacht, was die anderen vormachen. Solches Papageien-Christentum wird für die Religionen und die Humanismen nicht relevant. So wird es irrelevant, überflüssig. Aktualisierung, Modernisierung, Solidarisierung allein tut es nicht. Die Christen, die christlichen Kirchen müssen wissen, was sie wollen, was sie selber sich und den anderen zu sagen haben. Sie müssen bei aller unbeschränkten Offenheit für die Anderen ihr Eigenes zur Sprache, zur Geltung, zur Auswirkung bringen. Also: Das Christentum kann letztlich nur dadurch relevant sein und werden, dass es, wie immer in Theorie und Praxis, die Erinnerung an Jesus als den letztlich Maßgebenden aktiviert: an Jesus den Christus und nicht nur einen der »maßgebenden Menschen«.
Vorläufig sei wiederum ganz umrisshaft angedeutet, dass allein von diesem Christus her die dringenden rundum gefragten Fragen der Christen und Nichtchristen nach der Unterscheidung des Christlichen beantwortbar erscheinen. Als Test einige Beispiele.
Das erste: Ist eine in tiefem Gottesglauben vollzogene Mahlfeier von Christen und Moslems in Kabul, bei der Gebete aus christlicher und aus Sufi-Tradition gebraucht werden, eine christliche Eucharistiefeier? Antwort: Eine solche Mahlfeier kann ein sehr echter, ja sehr lobenswerter Gottesdienst sein. Eine christliche Eucharistiefeier jedoch wäre sie nur dann, wenn in ihr spezifisch dieses Jesus Christus gedacht würde (memoria Domini).
Das zweite: Ist ein in Benares am Ganges in letzter Hingabe vollzogenes gottgläubiges Tauchbad eines Hindu gleichzusetzen mit der christlichen Taufe? Antwort: Ein solches Tauchbad ist ein religiös gewiss sehr bedeutsamer und heilsamer Reinigungsritus. Zur christlichen Taufe jedoch würde es erst dann, wenn es auf den Namen Jesus Christus hin geschähe.
Das dritte: Ist ein Muslim in Beirut, der alles im Koran von Jesus Gesagte – und das ist vieles – hochhält, bereits ein Christ? Antwort: Er ist ein guter Muslim, solange für ihn der Koran verbindlich bleibt, und er mag auf seine Weise sein Heil finden. Christ aber wird er erst dann, wenn nicht mehr Mohammed der Prophet und Jesus sein Vorläufer ist, sondern dieser Jesus Christus für ihn maßgebend wird.
Das vierte: Ist das Eintreten für humanitäre Ideale, Menschenrechte und Demokratie in Chicago, Rio, Auckland oder Madrid christliche Verkündigung? Antwort: Dies ist ein für den einzelnen Christen und die christlichen Kirchen dringend gebotenes soziales Engagement. Zur christlichen Verkündigung jedoch wird es nur dann, wenn in der heutigen Gesellschaft praktisch und konkret das von diesem Jesus Christus her zu Sagende zur Geltung gebracht wird.
Unter Voraussetzung der in den vorausgehenden Abschnitten bereits erfolgten Klärung und der in den weiteren Teilen zu erfolgenden Konkretisierung können und müssen zur Vermeidung von Konfusion und unnötigen Missverständnissen ohne alle Diskriminierung folgende nüchternen Markierungen – überzeugt, aber nicht überzogen – gewagt werden:
– Christlich ist nicht alles, was wahr, gut, schön und menschlich ist. Wer könnte es leugnen: Wahrheit, Gutheit, Schönheit und Menschlichkeit gibt es auch außerhalb des Christentums. Christlich darf jedoch alles genannt werden, was in Theorie und Praxis einen ausdrücklichen positiven Bezug zu Jesus Christus hat.
– Christ ist nicht jeder Mensch echter Überzeugung, ehrlichen Glaubens und guten Willens. Niemand kann es übersehen: Echte Überzeugung, ehrlichen Glauben und guten Willen gibt es auch außerhalb des Christentums. Christ dürfen jedoch alle die genannt werden, für deren Leben und Sterben Jesus Christus letztlich ausschlaggebend ist.
– Christliche Kirche ist nicht jede Meditations- oder Aktionsgruppe, nicht jede Gemeinschaft engagierter Menschen, die sich zu ihrem Heil um ein anständiges Leben bemühen. Man hätte es nie bestreiten dürfen: Engagement, Aktion, Meditation, anständiges Leben und Heil kann es auch in anderen Gruppen außerhalb der Kirche geben. Christliche Kirche darf aber jede größere oder kleinere Gemeinde von Menschen genannt werden, für die Jesus Christus letztlich entscheidend ist.
– Christentum ist nicht überall dort, wo man Unmenschlichkeit bekämpft und Humanität verwirklicht. Es ist einfach wahr: Unmenschlichkeit bekämpft man und Humanität verwirklicht man auch außerhalb des Christentums – unter Juden, Moslems, Hindus und Buddhisten, unter nachchristlichen Humanisten und ausgesprochenen Atheisten. Christentum ist jedoch nur dort, wo die Erinnerung an Jesus Christus in Theorie und Praxis aktiviert wird.
Nun, dies alles sind zunächst Formeln der Unterscheidung. Aber diese Lehrformeln sind keine Leerformeln. Warum?
Sie beziehen sich auf eine sehr konkrete Person.
Sie haben den christlichen Beginn und die große christliche Tradition hinter sich.
Sie bieten zugleich eine klare Orientierung für Gegenwart und Zukunft. Sie helfen also den Christen und können doch auch die Zustimmung der Nichtchristen finden, deren Überzeugung auf diese Weise respektiert, deren Werte ausdrücklich affirmiert werden, ohne dass sie auf dogmatischem Schleichweg für Christentum und Kirche vereinnahmt werden.
Gerade dadurch, dass die Begriffe für das Christliche nicht verwässert oder beliebig gedehnt, sondern präzise gefasst werden, gerade dadurch, dass die Begriffe beim Wort genommen werden, ist beides möglich: Offenheit für alles Nichtchristliche zu wahren und zugleich alle unchristliche Konfusion zu vermeiden. Insofern sind diese Unterscheidungsformeln, so umrisshaft sie vorläufig erscheinen müssen, von großer Wichtigkeit. In aller Vorläufigkeit dienen sie der Unterscheidung des Christlichen!
Gegen alle oft gutgemeinte Zerdehnung, Vermengung, Verdrehung und Verwechslung des Christlichen sind die Dinge ehrlich beim Namen zu nennen: Das Christentum der Christen soll christlich bleiben! Es bleibt jedoch christlich nur dann, wenn es ausdrücklich an den einen Christus gebunden bleibt, der nicht irgendein Prinzip oder eine Intentionalität oder ein evolutiver Zielpunkt ist, sondern eine – wie noch sehr genau zu sehen sein wird – ganz bestimmte, unverwechselbare und unauswechselbare Person mit einem ganz bestimmten Namen! Das Christentum lässt sich schon von seinem Namen her nicht in ein namenloses, eben anonymes Christentum einebnen oder »aufheben«. Anonymes Christentum ist für den, der bei beiden Worten etwas denkt, eine contradictio in adiecto: ein hölzernes Eisen. Gutes Menschtum ist eine honorige Sache, auch ohne kirchliche Segnung und theologische Genehmigung. Christentum jedoch besagt Bekenntnis zu diesem einen Namen. Und auch christliche Theologen dürften sich die Frage nicht schenken: Was, wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem Namen?
2. Der geschichtliche Christus
Es ist allen Nachdenkens wert, woher es kommen mag: Offensichtlich ist nach dem Sturz so vieler Götter in unserem Jahrhundert dieser an seinen Gegnern Gescheiterte und von seinen Bekennern durch die Zeiten immer wieder Verratene noch immer für Ungezählte die bewegendste Figur der langen Menschheitsgeschichte: ungewöhnlich und unbegreiflich in vielfacher Hinsicht. Er ist Hoffnung für Revolutionäre und Evolutionäre, fasziniert Intellektuelle und Antiintellektuelle. Er fordert die Tüchtigen und die Untüchtigen. Theologen, aber auch Atheisten ist er ständig neuer Anstoß zum Denken. Den Kirchen Anlass zur ständigen kritischen Selbstbefragung, ob sie sein Grabmal oder seine lebendigen Zeugen sind, und zugleich ökumenisch über alle Kirchen hinausstrahlend bis ins Judentum und in die anderen Religionen hinein. Gandhi: »Ich sage den Hindus, dass ihr Leben unvollkommen sein wird, wenn sie nicht auch ehrfürchtig die Lehre Jesu studieren.«
Umso drängender wird jetzt die Wahrheitsfrage: Welcher Christus ist der wahre Christus? Auch die einfache Antwort »Sei freundlich, Jesus liebt dich« tut es nicht. Jedenfalls nicht auf die Dauer. Das kann leicht unkritischer Fundamentalismus oder Pietismus im Hippie-Gewand sein. Und wo man auf Gefühle baut, kann der Name beliebig gewechselt werden: statt Che Guevara im Jesus-Look jetzt Jesus im Guevara-Look, und wieder umgekehrt. Gestellt zwischen den Jesus des Dogmatismus und den Jesus des Pietismus, gestellt zwischen den Jesus des Protestes, der Aktion, der Revolution und den Jesus der Gefühle, der Sensitivität, der Phantasie, wird die Wahrheitsfrage so zu präzisieren sein: Der Christus der Träume oder der Christus der Wirklichkeit? Der erträumte oder der wirkliche Christus?
Kein Mythos
Was kann verhindern, dass man einem nur erträumten, einem von uns dogmatisch oder pietistisch, revolutionär oder schwärmerisch manipulierten und inszenierten Christus folgt? Jede Manipulation, Ideologisierung, ja Mythisierung Christi hat ihre Grenze an der Geschichte! Der Christus des Christentums ist – dies kann nicht genügend gegen allen alten oder neuen Synkretismus betont werden – nicht einfach eine zeitlose Idee, ein ewig gültiges Prinzip, ein tiefsinniger Mythos. Über eine Christusfigur im Götterhimmel eines Hindutempels können sich nur naive Christen freuen. Der gnädigen Aufnahme ihres Christus in ein Pantheon haben schon die frühen Christen mit allen Kräften widerstanden und oft genug mit ihrem Leben dafür bezahlt. Eher ließen sie sich Atheisten schimpfen. Der Christus der Christen ist vielmehr eine ganz konkrete, menschliche, geschichtliche Person: der Christus der Christen ist niemand anders als Jesus von Nazaret. Und insofern gründet Christentum wesentlich in Geschichte, ist christlicher Glaube wesentlich geschichtlicher Glaube. Man vergleiche die synoptischen Evangelien mit der weitestverbreiteten hinduistischen Dichtung Ramayana (großartig vor dem nächtlichen Tempel von Prambanan/Java und auf ungezählten Tempelfresken zur Darstellung gebracht), die in vierundzwanzigtausend Sanskritstrophen beschreibt, wie der hochgesinnte Prinz Rama (der inkarnierte Vishnu), dem seine Gattin Sita vom Riesenkönig Ravana nach Ceylon entführt wurde, mit Hilfe eines Heeres von Affen, die eine Brücke über den Ozean bauten, seine ihm treu gebliebene Gemahlin befreit und schließlich doch verstoßen hat: und man erkennt den ganzen Unterschied. Nur als geschichtlicher Glaube hat sich das Christentum schon am Anfang gegen alle die Mythologien, Philosophien, Mysterienkulte durchsetzen können.
Wenn auch ungezählte Menschen in Jesus übermenschliche, göttliche Wirklichkeit erfahren haben und wenn auch schon von Anfang an hohe Titel von ihm gebraucht wurden, so ist doch kein Zweifel, dass Jesus für seine Zeitgenossen wie auch für die spätere Kirche immer als ein wirklicher Mensch galt. Nach allen neutestamentlichen Schriften – und sie sind abgesehen von den genannten wenigen und unergiebigen heidnischen und jüdischen Zeugnissen unsere einzigen verlässlichen Quellen, auch Talmud und Midrasch fallen dafür aus – ist Jesus ein wirklicher Mensch, der zu einer ganz bestimmten Zeit und in einer ganz bestimmten Umgebung gelebt hat. Aber hat er wirklich gelebt?
Die historische Existenz Jesu von Nazaret wurde ähnlich wie die Buddhas und andere scheinbar unbestreitbare Tatsachen auch schon einmal bestritten. Die Aufregung war groß, wenn auch unnötig, als im 19. Jahrhundert Bruno Bauer das Christentum als eine Erfindung des Urevangelisten und Jesus als eine »Idee« verstand. Und noch einmal, als Arthur Drews, 1909, Jesus als reine »Christusmythe« interpretierte (ähnlich auch der Engländer J. M. Robertson und der amerikanische Mathematiker W. B. Smith). Aber extreme Positionen haben ihr Gutes. Sie klären die Situation und heben sich meist selber auf: die geschichtliche Existenz Jesu wird seither von keinem ernsthaften Forscher bestritten. Was selbstverständlich unernsthafte Schreiber nicht gehindert hat, über Jesus weiterhin Unernsthaftes zu schreiben (Jesus als Psychopath, als Astralmythos, als Sohn des Herodes, als im Geheimen verheiratet und Ähnliches mehr). Ein wenig betrüblich ist nur, wenn ein Philologe seinen Ruf damit ruiniert, dass er Jesus als Geheimbezeichnung für einen halluzinogenen Fliegenpilz (Amanita muscana) deutet, der angeblich in den Riten der ersten Christen verwendet wurde. Ob man etwas noch Originelleres finden wird?
Wir wissen von Jesus von Nazaret unvergleichlich mehr historisch Gesichertes als von den großen asiatischen Religionsstiftern:
mehr als von Buddha (gest. um 480 v. Chr.), dessen Bild in den Lehrtexten (Sutras) auffällig stereotyp bleibt und dessen stark systematisierte Legende weniger einen historischen als einen idealtypischen Lebensablauf wiedergibt;
mehr erst recht als von Buddhas chinesischem Zeitgenossen Kung-futse (Meister Kung, gest. vermutlich 479 v. Chr.), dessen zweifellos reale Persönlichkeit trotz aller Bemühungen wegen der Unzuverlässigkeit der Quellen nicht exakt zu erfassen ist und die erst nachträglich mit der chinesischen Staatsideologie des »Konfuzianismus« (einem im Chinesischen unbekannten Wort; sachgemäßer: »Lehre oder Schule der Gelehrten«) verknüpft wurde;
mehr schließlich als von Lao-tse, dessen Gestalt, von der chinesischen Überlieferung als real angenommen, wegen der unzuverlässigen Quellen biographisch überhaupt nicht fassbar ist und dessen Lebensdaten je nach Quellen ganz verschieden im 14., 13., 8., 7. oder 6. Jahrhundert v. Chr. angesetzt werden.
Der kritische Vergleich ergibt in der Tat erstaunliche Unterschiede: Die Lehren Buddhas sind durch Quellen überliefert, die wenigstens ein halbes Jahrtausend nach dessen Tod niedergeschrieben wurden, als die ursprüngliche Religion bereits eine weitgehende Entwicklung erfahren hatte.
Erst seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. wird Lao-tse als Autor des Tao-te-king bezeichnet, jenes klassischen Buches von »Weg« und »Tugend«, welches faktisch eine Kompilation aus mehreren Jahrhunderten ist, dann aber für die Formulierung der taoistischen Lehre entscheidend wurde.
Die wichtigsten Überlieferungstexte von Kung-futse – die »Biographie« von Szu-ma Chien und die »Gespräche« (Lun-yü: eine den Schülern zugeschriebene Sammlung von Aussprüchen Kungs, eingebettet in Situationsberichte) – sind 400 Jahre, das zweite gegen 700 Jahre von der Lebzeit des Meisters entfernt und kaum zuverlässig; authentisch gesicherte Schriften oder eine authentische Biographie Kung-futses gibt es nicht (auch die Chronik des Staates Lu stammt kaum von ihm).
Aber auch wenn man nach Europa blickt: Die älteste uns erhaltene Handschrift der Homerischen Epen stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der Text der Sophokleischen Tragödien beruht auf einer einzigen Handschrift des 8. oder 9. Jahrhunderts. Für das Neue Testament aber ist der Abstand von der Urschrift um vieles kürzer, sind die erhaltenen Handschriften zahlreicher, ist ihre Übereinstimmung größer als bei irgendeinem anderen Buch der Antike: Sorgfältige Handschriften der Evangelien gibt es bereits aus dem 3. und 4. Jahrhundert. In jüngster Zeit aber hat man vor allem in der ägyptischen Wüste noch sehr viel ältere Papyri entdeckt: das älteste Fragment des Johannes-Evangeliums – des letzten der vier Evangelien – liegt heute im Original in der John-Rylands-Bibliothek in Manchester, stammt aus dem Beginn des 2. Jahrhunderts und weicht mit keinem Wort von unserem gedruckten griechischen Text ab. Die vier Evangelien haben somit bereits um das Jahr 100 existiert; mythische Erweiterungen und Umdeutungen (in den apokryphen Evangelien usw.) finden sich vom 2. Jahrhundert an. Der Weg führte offensichtlich von der Geschichte zum Mythos und nicht vom Mythos zur Geschichte!
In Ort und Zeit
Jesus von Nazaret ist kein Mythos: seine Geschichte lässt sich lozieren. Sie ist keine Wanderlegende wie – betrüblich genug für manchen treuen Eidgenossen – der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell. Sie spielte gewiss in einem politisch unbedeutenden Land, in einer Randprovinz des römischen Reiches. Aber immerhin stellte dieses Land Palästina ältestes Kulturreich im Kern des »fruchtbaren Halbmondes« dar: Bevor sich das politisch-kulturelle Gewicht auf die beiden Spitzen des Halbmondes – Ägypten und Mesopotamien – verlagerte, vollzog sich dort etwa im siebten vorchristlichen Jahrtausend die große jungeiszeitliche Revolution, in der die Jäger und Sammler sich als Ackerbauern und Viehzüchter niederließen, sich damit zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte von der Natur unabhängig machten und sie selbständig produktiv zu beherrschen begannen, bevor es dann beinahe vier Jahrtausende später auf den beiden Spitzen des Halbmondes – Ägypten und Mesopotamien – zum nächsten revolutionären Schritt kam, nämlich der Schaffung der ersten Hochkulturen und der Erfindung der Schrift, und weitere fünf Jahrtausende später zum vorläufig letzten großen revolutionären Schritt, dem Griff nach den Sternen. Das in der Parabel vom barmherzigen Samariter genannte und in neuerer Zeit wieder ausgegrabene Jericho kann man die älteste stadtartige Siedlung der Welt (zwischen 7000 und 5000 v. Chr.) nennen. Als schmale Landbrücke zwischen den Reichen am Nil und an Euphrat und Tigris schon immer leicht Kampffeld der Großmächte, stand Palästina zur Zeit Jesu unter der Herrschaft der von den Juden gehassten römischen Militärmacht und den von ihr ernannten halbjüdischen Vasallen-Herrschern. Jesus, den manche in der nationalsozialistischen Zeit gerne zum Arier gemacht hätten, stammte zweifellos aus Palästina: genauer aus der nördlich gelegenen Landschaft Galiläa mit einer rassisch freilich nicht rein jüdischen, sondern stark gemischten Bevölkerung, die aber, anders als das zwischen Judäa und Galiläa liegende Samarien, Jerusalem und seinen Tempel als zentrales Kultzentrum anerkannte. Ein kleiner Wirkungsbereich in jedem Fall: zwischen Kafarnaum am lieblichen See Genesaret im Norden und der Hauptstadt Jerusalem im gebirgigen Süden nur 130 km Luftdistanz, von einer Karawane in einer Woche zu durchqueren.
Jesus von Nazaret ist kein Mythos: seine Geschichte lässt sich datieren. Sie ist kein überzeitlicher Mythos von der Art, wie sie die ersten Hochkulturen der Menschheit geprägt haben: Kein Mythos des ewigen Lebens wie in Ägypten. Kein Mythos der kosmischen Ordnung wie in Mesopotamien. Kein Mythos der Welt als Wandlung wie in Indien. Kein Mythos des vollendeten Menschen wie in Griechenland. Es geht um die Geschichte dieses einen Menschen, der in Palästina zu Beginn unserer Zeitrechnung unter dem römischen Kaiser Augustus geboren und unter dessen Nachfolger Tiberius öffentlich aufgetreten ist und schließlich durch dessen Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet wurde.
Unsicheres
Anderes bezüglich der genauen Lozierung und Datierung bleibt fraglich, ist aber sachlich von geringerer Bedeutung.
a. Welcher Herkunft? Der Geburtsort Jesu – von den Evangelisten Markus und Johannes nicht angegeben, nach den in den näheren Angaben voneinander abweichenden Mattäus und Lukas vielleicht aus theologischen Gründen (davidische Abstammung und Prophezeiung des Propheten Micha) Betlehem, nach der Vermutung mancher Forscher Nazaret – kann nicht eindeutig bestimmt werden. Jedenfalls ist, wie im ganzen Neuen Testament belegt, die eigentliche Heimat des »Nazareners« oder »Nazoräers« das unbedeutende Nazaret in Galiläa. Die Stammbäume Jesu bei Mattäus und Lukas treffen sich zwar bei David, gehen aber sonst so weit auseinander, dass sie nicht zu harmonisieren sind. Nach heute wohl allgemeiner Auffassung der Exegeten haben die in manchem legendär ausgeschmückten Kindheitsgeschichten ebenso wie die nur bei Lukas überlieferte erbauliche Geschichte vom Zwölfjährigen im Tempel einen besonderen literarischen Charakter und stehen im Dienst der theologischen Interpretation der Evangelisten. In den Evangelien wird zum Teil ganz unbefangen von Jesu Mutter Maria, seinem Vater Josef wie auch seinen Brüdern und Schwestern gesprochen. Seine Familie ebenso wie seine Heimatstadt haben sich gegenüber seiner öffentlichen Tätigkeit nach den Quellen distanziert verhalten.
b. Welches Geburtsjahr? Wenn Jesus unter Kaiser Augustus (27 v. Chr. bis 14 n. Chr.) und König Herodes (27–4 v. Chr.) geboren wurde, dann war sein Geburtsjahr nicht nach 4 v. Chr. Aus dem Wunderstern, der nicht mit einer bestimmten Gestirnkonstellation gleichzusetzen ist, lässt sich ebensowenig etwas ableiten wie aus der Schätzung des Quirinius (6 oder 7 n. Chr.), die für Lukas ein Hinweis auf die weltumspannende Bedeutung des Geburtsgeschehens Jesu war.
c. Welches Todesjahr? Wenn Jesus nach Lukas im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, also 27/28 (oder 28/29 n. Chr.) von Johannes dem Täufer getauft wurde, was allgemein als historische Tatsache angenommen wird, wenn er bei diesem ersten öffentlichen Auftreten nach Lukas ungefähr dreißig Jahre alt war und nach der gesamten Überlieferung (auch Tacitus) unter Pontius Pilatus (26–36) verurteilt worden war, dann muss er rund um das Jahr 30 den Tod erlitten haben. Für den genauen Todestag, der von den drei ersten Evangelisten und von Johannes verschieden überliefert wird (15. oder 14. Nisan), lässt sich auch im Rückgriff auf den aufgefundenen Festkalender der Qumrangemeinde am Toten Meer keine eindeutige Gewissheit erlangen.
Wenn sich somit die Daten des Lebens Jesu wie viele Zeitpunkte der alten Geschichte nicht mit letzter Genauigkeit errechnen lassen, so ist es geradezu denkwürdig, dass in jenem genügend bestimmten Zeitraum ein Mensch, von dem es keine »offiziellen« Dokumente, keine Inschriften, Chroniken, Prozessakten gibt, der bestenfalls drei Jahre (nach den bei Johannes berichteten drei Passafesten), aber vielleicht auch nur ein einziges Jahr (bei den Synoptikern ist nur von einem Passafest die Rede) oder gar nur wenige dramatische Monate, zumeist in Galiläa und dann in Jerusalem, öffentlich gewirkt hat, dass also dieser eine Mensch den Lauf der Welt in einer Weise verändert hat, dass man nicht ohne Grund die Weltjahre nach ihm zu datieren begonnen hat – den Herrschenden der Französischen Revolution ebenso wie denen der Oktoberrevolution und der Hitlerzeit nachträglich ein Ärgernis. Keiner der großen Religionsstifter hat in einem so engen Bereich gewirkt. Keiner hat so ungeheuer kurze Zeit gelebt. Keiner ist so jung gestorben. Und doch welche Wirkung: Jeder dritte Mensch, rund zwei Milliarden Menschen werden Christen genannt. Das Christentum steht – zahlenmäßig – mit Abstand an der Spitze aller Weltreligionen.
Mehr als eine Biographie
Eine Einsicht hat sich – trotz zahlloser romanhafter Jesus-Bücher – durchgesetzt: So leicht sich Jesu Geschichte lozieren und datieren lässt – eine Biographie Jesu von Nazaret lässt sich nicht schreiben! Warum? Es fehlen dafür einfach die Voraussetzungen.
Da sind die frühen römischen und jüdischen Quellen, die aber, wie wir sahen, über die Tatsache der historischen Existenz hinaus von Jesus kaum etwas Brauchbares berichten. Und da sind neben den in der Kirche von alters her offiziell akzeptierten Evangelien noch die erheblich später, mit allerlei seltsamen Legenden und fragwürdigen Nachbildungen von Jesus-Worten ausgeschmückten, öffentlich nicht benützten, »apokryphen« (= verborgenen) Evangelien, die abgesehen von ganz wenigen Jesus-Worten ebenfalls nichts historisch Gesichertes über Jesus beibringen.
So bleiben denn jene vier Evangelien, die nach dem »Kanon« (= Richtschnur, Maßstab, Liste) der alten Kirche als ursprüngliches Zeugnis des christlichen Glaubens für den öffentlichen Gebrauch in die Schriftensammlung des »Neuen Testaments« (analog zu den Schriften des »Alten Testaments«) aufgenommen wurden: eine Auswahl, die sich – wie der neutestamentliche Kanon überhaupt – in einer Geschichte von 2000 Jahren aufs Ganze gesehen durchaus bewährt hat. Doch diese vier »kanonischen« Evangelien liefern nicht den Ablauf des Lebens Jesu in seinen verschiedenen Stadien und Ereignissen. Über die Kindheit wissen wir wenig Gesichertes, über die Zeit dann bis zum dreißigsten Lebensjahr gar nichts. Und das Wichtigste: In den vielleicht nur wenigen Monaten oder bestenfalls drei Jahren der öffentlichen Tätigkeit lässt sich gerade das nicht feststellen, was Voraussetzung für jede Biographie wäre: eine Entwicklung.
Zwar wissen wir im Allgemeinen, dass der Weg Jesu von seiner galiläischen Heimat in die judäische Hauptstadt Jerusalem, von seiner Taufe durch Johannes und der Verkündigung der Nähe Gottes zur Auseinandersetzung mit dem offiziellen Judentum und zu seiner Hinrichtung durch die Römer führte. Aber an einer Chronologie und Topologie dieses Weges waren die ersten Zeugen offensichtlich nicht interessiert. Und ebensowenig an einer inneren Entwicklung: an der Genese seines religiösen, insbesondere seines messianischen Bewusstseins und seinen Motiven, oder gar an Jesu »Charakterbild«, »Persönlichkeit« und »innerem Leben«. Insofern (und nur insofern) scheiterte die liberale Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts mit ihrem Versuch einer Periodisierung und Motivierung des Lebens Jesu, wie dies Albert Schweitzer in seiner klassischen Geschichte der Leben-Jesu-Forschung feststellt: Eine äußere und insbesondere eine innere, psychologische Entwicklung Jesu lässt sich aus den Evangelien nicht heraus-, sondern bestenfalls hineinlesen. Woher kommt das?
Auch für Nichttheologen ist wichtig und nicht uninteressant zu wissen, wie die Evangelien in einem Prozess von ungefähr 50 bis 60 Jahren entstanden sind. Lukas berichtet in den ersten Sätzen seines Evangeliums davon. Erstaunlich genug: Jesus selber hatte ja kein einziges schriftliches Wort hinterlassen und hatte auch nichts für die treue Weitergabe seiner Worte getan. Die Jünger gaben seine Worte und Taten zunächst mündlich weiter. Wobei sie selber, wie jeder Erzähler, je nach Charakter und Zuhörerkreis verschiedene Akzente setzten, auswählten, interpretierten, verdeutlichten, erweiterten. Von Anfang an dürfte es ein schlichtes Erzählen vom Wirken, Lehren und Schicksal Jesu gegeben haben. Die Evangelisten – wohl alles nicht direkte Jünger Jesu, aber Zeugen der ursprünglichen apostolischen Überlieferung – sammelten alles sehr viel später: die mündlich überlieferten und nun zum Teil bereits schriftlich fixierten Jesus-Geschichten und Jesus-Worte, wie sie nicht etwa in Gemeindearchiven Jerusalems oder Galiläas aufbewahrt worden sind, sondern wie sie im gläubigen Leben der Gemeinden, in Predigt, Katechese, Gottesdienst verwendet wurden. Alle diese Texte hatten einen bestimmten »Sitz im Leben«, hatten bereits eine Geschichte hinter sich, die sie mitgeformt hatte, wurden bereits als Botschaft Jesu weitergegeben. Die Evangelisten – zweifellos nicht nur Sammler und Tradenten, wie man eine Zeitlang meinte, sondern durchaus originelle Theologen mit eigener Konzeption – ordneten die Jesus-Erzählungen und Jesus-Worte nach eigenem Plan und Gutdünken: Sie stellten einen bestimmten Rahmen her, so dass sich eine fortlaufende Erzählung ergab. Die Passionsgeschichte, auffällig übereinstimmend von allen vier Evangelisten überliefert, scheint schon verhältnismäßig früh eine Erzählungseinheit gebildet zu haben. Zugleich richteten die Evangelisten, wohl auch selber in der missionarischen und katechetischen Praxis stehend, die überlieferten Texte auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinden aus: Sie deuteten sie von Ostern her, erweiterten und passten sie an, wo es ihnen notwendig erschien. So erhielten die verschiedenen Evangelien von dem einen Jesus bei aller Gemeinsamkeit ein sehr verschiedenes theologisches Profil.
Markus, mitten im Umbruch zwischen der ersten und der zweiten Christengeneration, war es gewesen, der kurz vor der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach heute verbreitetster Ansicht das erste Evangelium schrieb (Markus-Priorität gegenüber der traditionellen Auffassung von Mattäus als dem ältesten Evangelium). Es stellt eine höchst originelle Leistung dar: dieses »Evangelium« bildet trotz der wenig literarischen Sprache eine völlig neue literarische Gattung, eine Literaturform, wie es sie bisher in der Geschichte nicht gegeben hatte.
Ende der Leseprobe