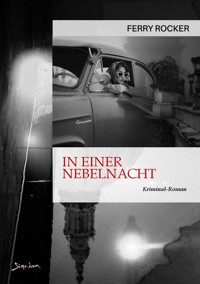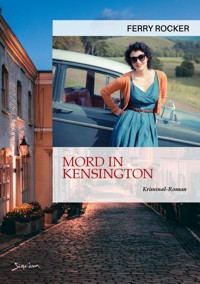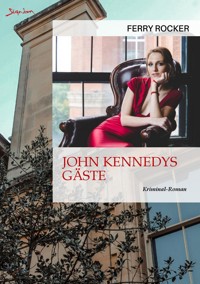
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein bekannter Schriftsteller hat seine Londoner Freunde eingeladen, das Wochenende bei ihm auf dem Lande zu verbringen. Und sie kommen gern, denn bei John Kennedy trifft man immer interessante Menschen. Aber diesmal nimmt das sonst so frohe Zusammensein ein ungutes Ende: Der Hausherr wird ermordet aufgefunden, alle Anwesenden geraten mehr oder minder in Verdacht, und die Polizei verhängt strengsten Hausarrest. Ein Gewirr von Möglichkeiten tut sich auf. Wer errät die wahren Zusammenhänge? Selbst Inspektor Bennett tappt völlig im Dunklen, obwohl er alle Spuren zu sichern vermochte... Wer dieses packende Buch liest, wird unwiderstehlich in eines jener tragischen Rätselspiele verwickelt, die den Ausgangspunkt für die besten Kriminalromane bilden. JOHN KENNEDYS GÄSTE von Ferry Rocker (eigtl. Eberhard Friedrich Worm - * 8. Februar 1896 in Berlin/† 29. August 1973 ebenda) erschien erstmals im Jahre 1953; der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
FERRY ROCKER
JOHN KENNEDYS GÄSTE
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
JOHN KENNEDYS GÄSTE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Impressum
Copyright © by Eberhard Friedrich Worm/Signum-Verlag.
Published by arrangement with the Estate of Eberhard Friedrich Worm.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Cover: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
Ein bekannter Schriftsteller hat seine Londoner Freunde eingeladen, das Wochenende bei ihm auf dem Lande zu verbringen. Und sie kommen gern, denn bei John Kennedy trifft man immer interessante Menschen.
Aber diesmal nimmt das sonst so frohe Zusammensein ein ungutes Ende: Der Hausherr wird ermordet aufgefunden, alle Anwesenden geraten mehr oder minder in Verdacht, und die Polizei verhängt strengsten Hausarrest.
Ein Gewirr von Möglichkeiten tut sich auf. Wer errät die wahren Zusammenhänge? Selbst Inspektor Bennett tappt völlig im Dunklen, obwohl er alle Spuren zu sichern vermochte...
Wer dieses packende Buch liest, wird unwiderstehlich in eines jener tragischen Rätselspiele verwickelt, die den Ausgangspunkt für die besten Kriminalromane bilden.
John Kennedys Gäste von Ferry Rocker (eigtl. Eberhard Friedrich Worm - * 8. Februar 1896 in Berlin/† 29. August 1973 ebenda) erschien erstmals im Jahre 1953; der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
JOHN KENNEDYS GÄSTE
Erstes Kapitel
»Sagen Sie mal, Manners, haben Sie nicht auch die Beobachtung gemacht, dass mit Kennedy etwas nicht in Ordnung zu sein scheint?«
Gregory Manners wandte leicht den kurzgeschorenen, eckigen Kopf. Ein Funke von Interesse glomm in seinen harten, grauen Augen auf.
»Mit John? Ja... hm... er ist nicht so wie sonst. Er scheint mir etwas melancholisch zu sein.«
William Braddoc, der begierig auf die schmalen Lippen Gregory Manners’ geschaut hatte, konnte eine Gebärde der Enttäuschung nicht unterdrücken.
»Melancholisch... Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Anwandlungen von Melancholie hatte er früher auch, wie fast jeder Mensch. Nein... na, da Sie es nicht bemerkt haben, werde ich wohl das Opfer einer Täuschung geworden sein.«
Gregory Manners war ein großer, breitschultriger Mann Mitte der Fünfzig. Etwas Strenges, Soldatisches ging von ihm aus, während William Braddoc so gar nicht diesem Typ ähnelte. Er war mittelgroß, schlank, sein Gesicht war sehr weich, mit fein gerundeten Zügen. Obgleich er die Fünfzig erst vor kurzem überschritten hatte, war sein Haar bereits schneeweiß. Da er sich des reizvollen Kontrastes, den das leicht gewellte weiße Haar und das tief gebräunte, fast noch jugendlich anmutende Gesicht boten, bewusst war, ging er meist ohne Hut und nahm die bewundernden Blicke der Umwelt als ihm gebührenden Tribut entgegen. Er war etwas eitel, aber keineswegs dumm. Leute, die ihn gut kannten, schätzten seine überragende Intelligenz und sein tiefes Wissen.
Braddoc war leicht verstimmt, dass er Manners gegenüber auf die Veränderung, die seiner Beobachtung nach mit John Kennedy vorgegangen war, hingewiesen hatte. Lächerlich, Manners hatte doch kein Auge für Feinheiten des Gefühlslebens! Das war doch ein Mann, der alles sehr unkompliziert sah, ein ehemaliger Militär, für den die ganze Welt aus einem Kasernenhof bestand. Aber die Äußerung, die Manners jetzt tat, bewies, dass er doch nicht der Schwachkopf war, für den ihn Braddoc in diesem Augenblick gehalten hatte.
»Sie meinen wahrscheinlich, Kennedy habe Angst?«
Braddoc, der sich resigniert in den Liegestuhl hatte sinken lassen, riss seinen Oberkörper wieder hoch.
»Ja«, sagte er eindringlich. »Also haben Sie es auch bemerkt? Es war ja auch zu auffällig. Gestern Abend, als wir bei Tisch saßen...«
»Und der Butler ihm mitteilte, dass er am Telefon verlangt werde. Er wurde leichenblass und sah aus wie ein Deserteur, den man an die Wand stellt.«
Natürlich, einen andern Vergleich konnte ein Oberst außer Dienst nicht finden.
»Ja, und heute läuft er herum, als erwarte er jede Sekunde eine unangenehme Nachricht. Vor zwei Stunden hat er sich auf sein Zimmer zurückgezogen, angeblich um zu arbeiten. John ist völlig verändert.«
Oberst Manners blickte dem kerzengerade in die heiße Sommerluft emporsteigenden Rauch seiner Zigarre nach.
»Vielleicht hat er Geld verloren. In diesen Zeiten...«
»Das halte ich für ausgeschlossen. John ist als Geschäftsmann sehr vorsichtig. Er hat, wie er mir sagte, erstklassige Papiere und verdient außerdem mit seinen Büchern eine Menge Geld. Nein, sein verändertes Benehmen muss eine andere Ursache haben.«
Nun richtete sich auch Oberst Manners auf. Er drückte seinen Zigarrenrest mit der Schuhspitze in den Erdboden. Dann rückte er seinen Liegestuhl tiefer in den Schatten der Bäume und flüsterte, nachdem er einen Blick über die Sträucher geworfen hatte: »Burke kommt. Ich glaube, wir tun gut daran, uns schlafend zu stellen. Der Mann fällt mir auf die Nerven, obgleich ich ja im allgemeinen eine gehörige Dosis Dummheit vertrage.«
William Braddoc seufzte schmerzlich auf, legte sich ebenfalls wieder bequem in seinen Liegestuhl zurück und schloss die Augen.
Jim Burke, der wie ein herrenloser junger Hund den Weg heruntergewackelt kam, hätte die beiden Männer, die durch die hohen Sträucher seinem Blick entzogen waren, sicherlich nicht entdeckt, wenn der Oberst nicht tiefe, rasselnde Schnarchtöne von sich gegeben hätte. Burke, ein Mann mittleren Alters mit einem Schafsgesicht und abstehenden Ohren, blieb stehen, schob mit der Hand einige Sträucher zur Seite und rief: »Hallo!« Sein Annäherungsversuch wurde von Manners mit noch tieferen Schnarchtönen beantwortet. Ein Sägewerk hätte nicht mehr Lärm machen können.
»Hallo, verdammt heiß heute!«
Als diese den Tatsachen entsprechende Äußerung von keinem der beiden Männer gebührend gewürdigt wurde, zuckte Burke missmutig die Achseln und trollte sich.
Jim Burke war allen Gästen Kennedys als der Mann bekannt, der einmal in jungen Jahren bei einem Wettspiel der englischen Nationalmannschaft als Ersatzmann einsprang und dem es im Laufe des Spiels gelang, ein Tor zu schießen, so dass England mit einem 1:0-Sieg aus dem Kampf hervorging. Dieses Ereignis war das große Erlebnis seines Lebens, und obgleich er seit vielen Jahren infolge einer schweren Verletzung, die er bei einem Straßenunfall erlitten hatte, nicht mehr spielte, wurde er nicht müde, jedem Menschen, den er kennenlernte, von seinem entscheidenden Anteil an einem Fußball-Länderspiel zu unterrichten. Er klagte in herzzerreißenden Tönen über den Niedergang des englischen Fußballspiels, und wer ihn dabei betrachtete, musste zu der Überzeugung kommen, dass der Kriegsminister nicht bekümmerter und verzweifelter über die ungenügende Bewaffnung der britischen Armee hätte klagen können.
»Ist er fort?«, raunte der Oberst.
»Ja, wir haben Glück gehabt. Bei dieser Hitze eine Unterhaltung über die Technik des Fußballspiels zu führen wäre wohl das Schlimmste, was einem passieren könnte.«
»Ja, diese Hitze«, grunzte der Oberst. »Völlig ungewöhnlich, jetzt, Ende Mai.« Plötzlich drang der tiefe Ton eines Boschhorns durch den Park, und Manners richtete sich in seinem Liegestuhl hoch. »Nanu, müsste mich doch sehr täuschen, wenn das nicht Andersons Wagen ist. Aber seit wann besucht Anderson Kennedys Herrengesellschaften?«
Braddoc verschränkte die Hände hinter seinem Kopf.
»Allerdings merkwürdig. Aber vielleicht hat der Rechtsanwalt etwas Geschäftliches mit John zu besprechen...«
»Heute, Samstagnachmittag? Das muss aber etwas Dringendes sein«, brummte Gregory Manners. »Solange ich Anderson kenne, fährt er jeden Samstagmittag Punkt zwölf Uhr auf sein Landgut bei Cheltenham.«
»Hallo, sind Sie endlich munter?«
Jim Burke hatte sich wie ein Indianer herangeschlichen und stand jetzt grinsend vor den beiden Männern, die ihn missmutig anstarrten, als wäre er eine tote Ratte.
Der Oberst räusperte sich bedächtig.
»Hören Sie mal zu, Burke: Soeben war Mr. Fryatt hier. Er hat mit Mr. Swayne um eine Flasche Whisky gewettet und sucht Sie jetzt, weil Sie als Schiedsrichter fungieren sollen. Ich glaube, es handelt sich um ein bestimmtes Fußballspiel.«
»Sehr schön!«, strahlte Burke. »Glaube sicher, dass Fryatt verlieren wird; er weiß ja noch nicht mal, was ein Eckball ist. Wo ist er denn?«
»Er ist den zur kleinen Seitenpforte führenden Weg hinuntergegangen. Wenn Sie sich beeilen, werden Sie ihn sicherlich noch einholen.«
Jim Burke ergriff einen kleinen Stein, beförderte ihn mit der Fußspitze in die Luft und verschwand trällernd.
»Das war nicht recht von Ihnen, diesen Trottel auf Fryatt zu hetzen«, sagte Braddoc lächelnd.
Der Oberst aber empfand keine Gewissensbisse.
»Ich habe ihn auf Fryatt gehetzt, weil dieser die Gabe besitzt, einem zuzuhören, ohne etwas zu hören. Ich mag Fryatt sehr gern. Er ist nicht so aufgeblasen wie die andern Schriftsteller, und wenn er das nötige Quantum intus hat, ist er der prächtigste Kamerad, den man sich vorstellen kann. Er hat übrigens während des Krieges das Viktoria-Kreuz bekommen.«
»So, ich kenne ihn nicht näher, finde aber seine Magazin-Geschichten sehr amüsant. Ich glaube, er könnte ungeheuer viel Geld verdienen, wenn er etwas fleißiger wäre.«
»Ja, aber er will gar nicht viel Geld verdienen. Er schreibt jede Woche eine Humoreske, und davon lebt er.«
»Wahrscheinlich sind deshalb seine Arbeiten so gut.« Braddoc hob seine Hand und warf einen Blick auf die Armbanduhr. »Was halten Sie davon, ins Haus zu gehen und etwas Trinkbares zu suchen?«
»Bin dabei!« Der Oberst zog sein Jackett über, klappte den Liegestuhl zusammen und stellte ihn gegen einen Baum. Er wollte Braddoc, der die Sträucher zur Seite gebogen hatte, gerade folgen, als dieser stehenblieb und ihm ein Zeichen machte, sich ruhig zu verhalten.
Sollte dieser unmögliche Burke zurückkommen, um sich über den Lausbubenstreich des Obersten zu beschweren? Aber die Person, die jetzt schnellen und harten Schrittes den Weg heraufkam, war nicht der Fußballsachverständige des britischen Weltreichs, sondern eine große, starkknochige Frau, Miss Marjorie Banks, die Stenotypistin und Haushälterin John Kennedys. Obgleich von Natur nicht reizlos, bot sie jetzt einen wenig erfreulichen Anblick. Ihr Gesicht war aschgrau, ihre Lippen waren böse aufeinandergepresst, und ihre Augen funkelten vor Erregung. Sie hatte beide Hände geballt, und es sah aus, als wenn sie bereit wäre, über den ersten besten, der sich ihr in diesem Augenblick in den Weg stellte, mit den Fäusten herzufallen.
Trapp, trapp, trapp... der Boden knirschte unter ihren Tritten... jetzt war sie verschwunden.
Die beiden Männer blickten einander stumm an. Dann zuckte Braddoc die Achseln und ging mit Manners auf das Haus zu.
Zweites Kapitel
John Kennedys Haus lag in der Nähe von Stoke Poges. Es war ein großes Haus inmitten eines völlig wilden Parkes, deutlicher ausgedrückt: der vorige Besitzer hatte es mitten in ein ihm gehörendes Stück Wald bauen und von einer hohen Mauer umgeben lassen. In unmittelbarer Nähe des Hauses waren dann Bäume gefällt und eine große Rasenfläche angelegt worden. Ein breiter, von Bäumen eingefasster Weg führte von der Freitreppe des Hauses zu einer großen eisernen Pforte in der Mauer.
Nachdem John Kennedy dieses große zweistöckige Haus zusammen mit einer riesigen Summe Geldes geerbt hatte, ließ er verschiedene Räume des Gebäudes renovieren und eine unterirdische Garage anlegen. An der Umgebung des Hauses änderte er aber nicht das Geringste. John Kennedy liebte keine wohlgepflegten Gärten; die Blüten eines wilden Holunderbusches oder des Weißdorns bereiteten ihm mehr Freude als die Produkte raffinierter Blumenzucht.
Als John Kennedy die Nachricht erhielt, dass ihn sein Onkel, der sich Zeit seines Lebens nicht um ihn gekümmert, zum Universalerben eingesetzt hatte - vor ungefähr fünf Jahren war das -, wurde er weder größenwahnsinnig noch geizig. Er gab seine Stellung als zweitklassiger Reporter auf und engagierte Miss Marjorie Banks, eine nicht mehr junge, aber sehr intelligente Stenotypistin des Verlages, als Sekretärin. Im Laufe der Zeit bewies Miss Marjorie Banks, dass sie nicht nur eine vorzügliche Stenotypistin, sondern auch eine tüchtige Haushälterin war, die es verstand, reibungslos mit dem Personal zusammenzuarbeiten, das Kennedy auf Wunsch seines verstorbenen Onkels hatte übernehmen müssen.
Vor fünf Jahren war Kennedy einer jener zahllosen Reporter, deren Namen sich der Leser nie merkt und die ständig davor zittern müssen, eines Tages wegen ihres vorgeschrittenen Alters auf die Straße geworfen zu werden. Jetzt war Kennedy ein bekannter und vielgelesener Autor von Gesellschaftsromanen, über deren Wert die Meinungen auseinandergingen. Kennedy selbst hielt sich nicht für ein Genie; niemand wusste, wie schmerzlich ihn die Erkenntnis getroffen hatte, dass er niemals über das Mindestmaß hinausragen würde. Mit der Zeit aber hatte er sich mit seinem Los abgefunden.
Er hatte während seiner fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit als Journalist so viele Menschen kennengelernt, dass er es sich, nachdem er wirtschaftlich unabhängig geworden war, wohl leisten konnte, sie zu meiden. Er lebte völlig zurückgezogen, schrieb seine Bücher, und wenn er das dringende Bedürfnis empfand, andere Gesichter um sich zu sehen - und das kam ungefähr alle acht Wochen vor -, griff er zum Telefonhörer und lud eine Menge Menschen zu sich ein. Dass er mit diesen Einladungen nicht nur den Zweck verfolgte, sich zu zerstreuen, sondern auch den, Studienobjekte für seine Romane zu haben, wusste eigentlich nur William Braddoc, den eine langjährige und sehr tiefe Freundschaft mit ihm verband.
An den Tagen, da Kennedys Haus Gäste beherbergte, glich es einem großen Hotel. Jeder der Eingeladenen konnte tun und lassen, was ihm beliebte. Wer spazieren gehen wollte, ging spazieren, wer in einem Liegestuhl dösen wollte, döste, wer in Kennedys reichhaltiger Bibliothek schmökern wollte, schmökerte - auf keinen der Gäste wurde ein anderer Zwang ausgeübt als der, sich pünktlich zu den Mahlzeiten einzufinden. Und diesem Zwang unterwarfen sich Kennedys Gäste gern, weil ihnen vorzüglich zubereitete Speisen und gute Weine vorgesetzt wurden.
Unter zwölf Menschen, die zusammenkommen, befinden sich immer neun, die Freude am Klatsch haben. Und selbstverständlich wurde auch über den Gastgeber und Miss Marjorie Banks gesprochen. Die meisten waren sich darüber einig, dass eines Tages John Kennedy, der vor kurzem fünfzig Jahre alt geworden war, seine Stenotypistin heiraten werde. Einige der Gäste aber vertraten den Standpunkt, dass man eine gute Stenotypistin nicht heiraten dürfe, wenn man sie als tüchtige Arbeitskraft behalten wolle.
John Kennedy reichte Cocktails herum. »Hallo, kommen Sie her, William«, rief er Braddoc zu, der geduldig den Darlegungen des jungen Philip Spencer lauschte, der mit der Arroganz der Jugend einige politische Probleme löste, indem er die Ideen alter, längst überwundener Staatsformen für unerhört neu hielt.
Kennedy war ein mittelgroßer Mann von schmächtiger Gestalt. Sein Gesicht zeigte die frischen Farben, die von einem Landaufenthalt zeugen, seine Augen verrieten Sinn für Humor. Da er eine Glatze hatte, wirkte seine Stirn unnatürlich hoch.
»Bitte, William«, er reichte seinem Freunde ein Cocktailglas. »Ich hoffe, Sie haben sich am Nachmittag nicht zu sehr gelangweilt.«
»Ich hörte, dass Sie zu arbeiten hatten.«
Ein Ausdruck von Verlegenheit huschte über das Gesicht Kennedys.
»Ja, ein neues Magazin verlangte dringend einen Beitrag von mir. Ich konnte nicht gut ablehnen, weil ich den Herausgeber kenne. Na, und so kam es denn, dass ich mich wenig um meine Gäste kümmern konnte. - Ich weiß noch nicht einmal, wer alles meiner Einladung gefolgt ist«, fügte er mit einem leisen Lachen hinzu. »Hallo, Swayne, hier ist noch ein Glas. Haben Sie schon allen erzählt, dass Sie nach Hollywood engagiert worden sind?«
»Ja, die Metro Goldwyn Mayer hat mich für zwei Hauptrollen engagiert«, antwortete der Schauspieler laut und lächelte geschmeichelt. »Übrigens eine unbescheidene Frage: keine Frauen heute hier?«
Henry Swayne, ein gutaussehender Mann von dreißig Jahren, etwas affektiert in seinen Bewegungen, hatte allen Grund, diese Frage zu stellen. Niemand der Anwesenden hatte ihn bis jetzt angehimmelt, und da er zu den Schauspielern gehörte, die, wo sie auch gehen oder stehen, ihr Publikum brauchen, kam er sich vor, als wenn er vor einem leeren Zuschauerraum spielte.
»Bedaure, Mr. Swayne. Ich habe mir diesmal lauter Junggesellen ausgesucht. Und das hat natürlich einen besonderen Grund. Ich habe nämlich ein paar ausgezeichnete Weinsorten bekommen... ah, guten Abend, Mr. Fryatt! Freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.«
Anthony Fryatt war ein großer, hagerer Mann mit einer Habichtsnase, buschigen Augenbrauen und weißem Haar. Die Leute, die seine Kurzgeschichten wegen ihres Witzes schätzten, kamen nicht auf ihre Rechnung, wenn sie glaubten, dass Fryatt im persönlichen Umgang ebenso witzig sei wie seine Novellenfiguren. Er war ziemlich kalt und zurückhaltend, taute aber auf, wenn er ein größeres Quantum alkoholischer Getränke zu sich genommen hatte, vorausgesetzt, dass die Personen, mit denen er zusammen war, ihm behagten. Mit geradezu ängstlicher Scheu mied er Menschen, die einem überspannten Intellektualismus huldigten. Er zog es vor, sich primitiven, aber aufrechten Naturen wie dem Obersten anzuschließen. Gespräche über Literatur waren ihm verhasst, er liebte den Alkohol und ein Kartenspiel mit bescheidenen Einsätzen. Offenherzig genug gestand er, dass er Kennedys Romane nicht gelesen habe und auch nie lesen werde und dass er seinen Einladungen nur Folge leiste, weil es in Kennedys Haus einen guten Tropfen zu trinken gab, den er ja nie verschmähte.
»Ich sagte eben zu Mr. Swayne, dass wir heute Abend verschiedene Sorten 1927er Jahrgang probieren wollen.«
»Ausgezeichnet«, knurrte Fryatt. »Hoffentlich befindet sich kein weißer Bordeaux darunter.«
»Keine Sorge«, lächelte Kennedy. »Es gibt natürlich auch weißen, aber keinen 1927er. Mir ist gesagt worden, der schmecke wie Essig.«
»Essig? Vitriol ist das. Sie kämen unweigerlich auf die Anklagebank, wenn Sie ihn ihren Gästen vorsetzten.«
Der Antiquitätenhändler Edwin Lemmon, ein mittelgroßer, glatzköpfiger Mann mit großem, fleischigem Mund, einer schiefen Nase und sehr dunklen Augen, unter denen die schlaffe Haut faltige Säcke bildete, und Rechtsanwalt James Anderson traten auf Kennedy zu. Anderson, groß, stiernackig, plump in seinen Bewegungen, sah aus wie der Inhaber eines Dorfwirtshauses, aber nicht wie ein Rechtsanwalt. Er hatte ein ziegelrotes Gesicht, listige Augen und streckte beim Gehen den Kopf vor, als sei er gewohnt, alle Hindernisse mit den Schultern aus dem Wege zu räumen.
Ein unsympathischer Bursche, dachte Braddoc, der sich in eine Ecke des großen Raumes zurückgezogen hatte und von dort aus Kennedys Gäste, die ihm zum größten Teil bekannt waren, beobachtete.
Alan Gardiner, der Bühnenmaler eines großen Revuetheaters, der Schriftsteller Fryatt und Ralph Curtis, der Neffe Kennedys, Student in Oxford, standen in einer Gruppe beisammen und blickten belustigt auf Jim Burke, der ihnen, seinen Fuß- und Handbewegungen nach zu urteilen, den Spielverlauf irgendeines sensationellen Fußballmatches schilderte.
Braddoc zählte die anwesenden Personen und stellte fest, dass es elf waren. Er wunderte sich gerade darüber, dass Miss Marjorie Banks noch nicht erschienen war, als er sah, wie der Butler Roberts auf Kennedy zutrat und leise mit ihm sprach. Kennedys Gesicht drückte Überraschung aus - peinliche Überraschung, wie es Braddoc schien -, dann folgte er dem Butler schnellen Schrittes in die Halle. Nach einigen Augenblicken betrat er an der Seite einer großen, schlanken Dame das Zimmer, bei deren Erscheinen verschiedene der Herren in beifällige Ahs ausbrachen.
Braddoc kannte die Dame. Es war Sybil Alcock, eine nicht mehr ganz junge, aber immerhin noch fabelhaft aussehende Schauspielerin vom Kleinen Theater. Sie trug ein blaues Abendkleid, ihre tiefroten Lippen kräuselten sich in leisem Spott, als sie die Herrengesellschaft mit etwas zusammengekniffenen Augen überflog. William Braddoc wusste, dass Sybil gar nicht abgeneigt sein würde, die sicherlich dankbare Rolle einer Mrs. Kennedy zu spielen, und er wusste auch, dass John die Schauspielerin sehr schätzte. Im Augenblick aber sah der Hausherr alles andere als glücklich aus. Er hatte Sybil nicht eingeladen und fürchtete, dass ihre Anwesenheit den ungezwungenen Verlauf des Tages etwas beeinträchtigen würde. Wenn Frauen Kleider probieren, setzen sie sich nicht gern Männerblicken aus, und die Männer lieben es nicht, in Gegenwart von Frauen weise Urteile über die Qualität von Weinsorten abzugeben. Frauen würden dann zu ihrer Bestürzung feststellen müssen, dass sogar die phantasielosesten und trockensten Männer ohne Mühe sehr blumenreiche und zärtliche Ausdrücke finden, wenn es sich darum handelt, die Vorzüge alkoholischer Getränke zu preisen.
»Fabelhaft zurechtgemacht«, flüsterte der Oberst dem Schriftsteller Fryatt ins Ohr, der sich den ganzen Nachmittag in der Nähe einer Whiskyflasche aufgehalten haben musste, denn seine Augen glitzerten und sein Gesicht trug nicht mehr den gewohnten mürrischen Ausdruck.
»Ja, sie sieht gut aus«, lispelte Fryatt. »Ich möchte gern wissen, wie sie in Wirklichkeit aussieht?«
Der Oberst fand keine Gelegenheit mehr, auf die nicht von übermäßiger Höflichkeit zeugende Äußerung etwas zu erwidern, denn die zum Speisesaal führenden Rolltüren wurden beiseitegeschoben und gaben den Blick auf die im matten Schimmer der Kerzen erstrahlende Tafel frei.
»Zum Teufel, John, was haben Sie angestellt?«, flüsterte Braddoc lächelnd seinem Freunde zu, als er die Schwelle des Speisezimmers überschritt. »Wir sind ja dreizehn Personen.«
Kennedy zählte.
»Ein Irrtum, William. Wir sind nur zwölf, denn Miss Banks speist heute Abend nicht mit uns. Sie liegt auf ihrem Zimmer und lässt sich Umschläge machen. Gottlob nichts Ernstes. Ein bisschen Kopfschmerz. Wahrscheinlich durch die Hitze.«
In feierlichem Zuge begaben sich die Gäste auf ihre Plätze.
Drittes Kapitel
Braddoc wurde dadurch munter, dass jemand heftig gegen seine Tür klopfte.
Er richtete sich schlaftrunken hoch. Die Sonne schien ins Zimmer, durch die geöffneten Fenster drang der würzige Geruch des Waldes. Ein Blick auf die Uhr belehrte Braddoc, dass es kurz vor sechs Uhr war. Wer zum Teufel...
Wieder das Klopfen. Fünf-, sechsmal. Und eine heisere Stimme: »Mr. Braddoc! Mr. Braddoc!«
Das war doch die Stimme des Butlers Roberts!
William Braddoc meldete sich, stand auf, zog seinen Morgenrock über und öffnete die Tür.
»Ich bitte vielmals um Verzeihung, Mr. Braddoc, aber... es ist etwas Entsetzliches passiert.« Das Gesicht des Mannes war bleich, und er starrte Braddoc hilfesuchend und verzweifelt an.
Braddoc strich sich das Haar aus der Stirn und zog ihn ins Zimmer.
»Was ist denn los, Roberts?«, fragte er mit unterdrückter Stimme. »Sie sehen ja aus...«
Der Butler empfand diese Worte offenbar als Tadel, denn er tastete mit zitternder Hand nach seiner Krawatte und rückte sie grade.
»Verzeihung, Mr. Braddoc. Mr. Kennedy liegt unten im Bibliothekszimmer. Er ist tot und hat eine Wunde am Kopf. Ich weiß nicht...«
»Du lieber Himmel!« William Braddoc nahm sein Monokel vom Nachttisch, klemmte es ein und betrachtete den alten Butler bestürzt. »Tot, sagen Sie?«
»Ja, er ist schon steif und...«
»Kommen Sie. Das ist ja schrecklich.«
Im Hause war noch alles ruhig, offenbar hatte das Klopfen des Butlers keinen der Gäste im Schlummer gestört.
Braddoc eilte die Treppe hinunter, durchquerte die Halle und betrat den großen Bibliotheksraum, auf dessen Schwelle er einen Augenblick wie gebannt stehenblieb. Dann ging er schnellen Schrittes auf den Clubsessel zu, in dem der Oberkörper John Kennedys ruhte. Der Kopf lag auf der linken Seitenlehne des Sessels, die rechte Hand des Toten hatte sich in das weiche Polster gekrallt.
Still, mit unbewegtem Gesicht blickte Braddoc auf die Gestalt seines Freundes. Er sah, dass hier keine Hilfe mehr möglich war, dass nichts auf der Welt John Kennedy ins Leben zurückrufen konnte. Dann kniete er nieder und betrachtete den Kopf des Toten, die gelbe Schädelhaut, die durch einen Schlag zerrissen war; er starrte mit einem Gefühl des Grauens auf die Blutkruste und auf den dunklen Fleck im Teppich.
Braddoc erhob sich, sein Blick schweifte durchs Zimmer, er presste die Lippen fest aufeinander.
»Verzeihung, Mr. Braddoc.« Der Butler wies mit dem Finger auf den Kopf des Toten. »Ich meine... muss ich nicht die Polizei benachrichtigen?«
Braddoc zuckte wie unter einer unerwarteten körperlichen Berührung zusammen. Dann straffte er sich, schüttelte das lähmende Gefühl der Bestürzung von sich ab.
»Natürlich, Roberts. Rufen Sie sofort die Polizei an. Oder nein, stellen Sie die Verbindung her, ich werde mit dem Beamten sprechen. Und dann...« Braddoc nahm sein Monokel aus dem Auge und rieb es mit einem Zipfel seines Morgenrockes blank. »Und dann wecken Sie Mr. Curtis, er ist der Neffe... nein, wecken Sie lieber Mr. Manners. Sagen Sie ihm, ich bäte ihn, sofort herunterzukommen.«
Während Braddoc einem verschlafenen und mürrischen Beamten der Polizeistation den Sachverhalt schilderte, bemühte sich Roberts, dem Obersten klarzumachen, welch schreckliches Ereignis sich im Hause zugetragen hatte. Manners, der am Abend vorher stark gezecht hatte, brauchte geraume Zeit, bis er die Situation begriff. Dann aber kleidete er sich schnell an und stand zehn Minuten später in der Halle.
»Guten Morgen, Braddoc. Roberts erzählt mir...« Er unterbrach sich und warf einen Blick ins Bibliothekszimmer. »Armer Kerl. Wie lange mag er schon tot sein?«
Braddoc zuckte die Achseln.
»Drei, vier Stunden vermute ich. Die Leichenstarre ist bereits eingetreten. Aber ich bin kein Mediziner. Welcher Schweinehund mag das bloß getan haben?«
Der Oberst prallte zwei Schritte zurück.
»Was?«, fragte er scharfen Tones. »Sie meinen doch nicht etwa...«
»Pst, nicht so laut, Manners. Es ist nicht nötig, dass die Leute munter werden, bevor die Polizei im Hause ist.« Er fasste den Obersten unter und führte ihn zu einigen in der Halle stehenden Sesseln. »Eine sehr traurige Geschichte. Soweit ich die Sache übersehen kann, handelt es sich hier um einen ganz gemeinen Mord. Kennedy wurde erschlagen, als er im Sessel saß.«
Der Oberst blickte Braddoc starr an. »Unglaublich. Wer soll denn...« Er wandte den Kopf zum Eingang. »Da kommt ja ein Wagen.«
»Das werden die Polizeibeamten sein. Ich habe ihnen Roberts entgegengeschickt, damit er ihnen das Tor öffnet.«
»Na, das kann ja eine schöne Schweinerei geben«, brummte Manners, erhob sich schwerfällig und blickte auf die Beamten, die die Halle betraten.
»Detektiv-Inspektor Bennett«, stellte sich ein noch junger, sehr intelligent aussehender Beamter vor und musterte William Braddoc, der ihm bis zur Tür entgegengegangen war, scharf.
Braddoc verbeugte sich und nannte seinen Namen.
»Braddoc? Sind Sie vielleicht der Herr, der gemeinsam mit Inspektor Sanderson den Mord in Gravesend aufgeklärt hat?«
»Ganz recht, Inspektor.«
Das ernste Gesicht Bennetts hellte sich etwas auf, er wies auf einen kleinen bebrillten Herrn, der eine Tasche in der Hand trug und ungeduldig nach der offenen Tür des Bibliothekszimmers schielte.
»Das ist Dr. Tribe, der Polizeiarzt. Und das dort Sergeant Donald. Ich hoffe, dass die anderen Beamten in einer Viertelstunde hier sein werden.«
Nun wurde auch Oberst Manners vorgestellt, und nachdem der junge Inspektor seinem Sergeanten den Auftrag erteilt hatte, an der Tür stehenzubleiben und darauf zu achten, dass niemand das Haus verlasse, wandte er sich an Braddoc:
»Zeigen Sie mir bitte, wo der Tote liegt.«
Die Bibliothek war ein großer Raum, dessen Wände mit Mahagoniholz verkleidet waren, während die Decke auf sichtbaren Balken ruhte. Die linke Wand völlig verdeckend, stand ein großer Schrank, in dem sich prachtvolle Lederbände befanden. Die weniger wertvollen Bücher hatten auf Regalen Platz gefunden, die neben der breiten Tür und auf der rechten Zimmerseite standen. In der Mitte des Raumes befanden sich ein großer runder Tisch und einige Clubsessel. Zwei breite Fenster und eine Glastür führten auf die Rasenfläche hinaus. Ein breiter Strahl Sonnenlicht fiel jetzt durch den oberen Teil der Fenster in den Raum.
Braddoc und Manners blieben vor der Tür stehen und beobachteten den Arzt, der sich über den leblosen Körper Kennedys neigte. Sie sahen, wie er dem Inspektor die Kopfwunde zeigte, konnten aber nicht verstehen, was die beiden Männer miteinander sprachen.
Plötzlich näherte sich der Butler Braddoc.
»Ich habe Walker ans Tor geschickt, um die anderen Herren hereinzulassen. Dürfen Mary und Patrick den Salon und das Speisezimmer aufräumen?«
»Ich werde den Inspektor fragen, Roberts. Wo ist denn die Dienerschaft überhaupt?«
»Walker steht am Tor. Patrick Murphy, Barbara Carnie und ihre Tochter sind in ihren Zimmern. Ich habe ihnen natürlich gesagt, was vorgefallen ist. Ich wollte aber nicht, dass sie hier im Hause herumrennen, und habe deshalb angeordnet, dass sie auf ihren Zimmern bleiben.«
»Sehr vernünftig, Roberts. Ich würde Ihnen aber doch empfehlen, die Frauen in die Küche zu schicken, damit sie das Frühstück zubereiten. Wir werden die Gäste bald wecken müssen... ja, sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Miss Banks?«
Der Butler räusperte sich verlegen.
»Es wäre vielleicht meine Pflicht gewesen, sie als erste von dem traurigen Vorfall zu benachrichtigen, aber da sie gestern krank war...«
»Verstehe, verstehe«, mischte sich der Oberst ins Gespräch. »Das hier ist Männersache; lassen wir die Frauen, solange es möglich ist, aus dem Spiel.«
In diesem Augenblick trat der Inspektor in die Türöffnung, blickte die Männer der Reihe nach an und sagte trockenen Tones:
»Mord, wie Sie vermuteten, Mr. Braddoc. Man hat Mr. Kennedy, als er im Sessel saß, mit einem stumpfen Gegenstand von hinten über den Schädel geschlagen. Ich brauche jetzt eine Liste aller im Hause anwesenden Personen, vielmehr aller Personen, die sich gestern hier als Gäste befanden. Dann bitte ich, mir einen Raum anzuweisen, in dem ich die Anwesenden der Reihe nach verhören kann. Das Bibliothekszimmer darf von niemand betreten werden. Besitzt Mr. Kennedy Verwandte?«
»Soweit ich unterrichtet bin, nur einen Neffen. Er schläft noch.«
Der Inspektor blickte auf seine Taschenuhr und schüttelte den Kopf.
»Die Beamten müssten eigentlich längst hier sein. Wir müssen draußen alles absuchen, und im Hause wartet ja auch noch eine Menge Arbeit. Mr. Braddoc... hm... ich weiß nicht, wie mein Vorgesetzter darüber denken wird, aber ich möchte Sie gern zur Tatbestandsaufnahme hinzuziehen. Sie sind ja, wie Sie bewiesen haben, in kriminalistischen Dingen nicht unerfahren, außerdem kennen Sie ja wohl jeden der Anwesenden. Sie können mir vielleicht einen nützlichen Fingerzeig geben...«
William Braddoc neigte zustimmend den Kopf. Die ruhige, bestimmte Art des Inspektors gefiel ihm.
»Ich stehe selbstverständlich zu Ihrer Verfügung, Inspektor. Ich muss Sie aber gleich darauf aufmerksam machen, dass ich die Mehrzahl der Gäste nur oberflächlich kenne. Außerdem zog ich mich gestern Abend verhältnismäßig früh auf mein Zimmer zurück. Es waren wenigstens noch sieben oder acht Personen im Salon und im Speisezimmer, als ich nach oben ging. Wie lange waren Sie unten, Oberst?«
Diese Frage schien Gregory Manners peinlich zu berühren.
»Hm... ja... ich war wohl einer der letzten«, sagte er zögernd. »Ich saß mit Fryatt zusammen in einer Ecke, wir... na, wir tranken ziemlich viel. Wir hatten uns von John einen ausgezeichneten 23er Portwein geben lassen, weil... hm... fürchte, wir waren ziemlich beschmort. Ich jedenfalls weiß nicht mehr, wie ich dann später ins Bett gekommen bin.«
»Es handelte sich also - verzeihen Sie den harten Ausdruck - um eine solenne Sauferei?«
Gregory Manners warf dem Inspektor einen verweisenden Blick zu.
»Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen. Es wurde weder mit Gläsern geworfen, noch fanden Ringkämpfe statt...«
»Aber das wissen Sie ja gar nicht, Oberst Manners«, sagte Bennett mit einem leichten Lächeln. »Es steht doch nun einmal fest, dass Mr. Kennedy erschlagen worden ist.