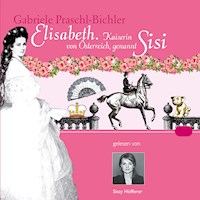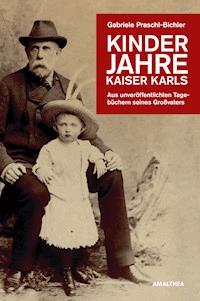Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
So war Kaiser Franz Joseph wirklich In dem vergnüglichen Lesebuch wird die Geschichte eines Menschen beschrieben, dem das Schicksal das Amt des Kaisers von Österreich zugedacht hatte. Es erzählt von dem hohen Beamten, vom Zigarrenraucher, Jäger und Theaterliebhaber und läßt den Leser als Zaungast in den kaiserlichen Alltag Einblick nehmen. Dem Leser offenbart sich bei der Lektüre ein Unbekannter - ein liebevoller Ehemann, Freund, Vater und ein pedantisch arbeitender Beamter. Hätte die Thronfolge nicht für ihn das Amt des Kaisers bereitgehalten, wäre er ein ganz normaler Bürger geworden. Mit 32 Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Praschl-Bichler
Kaiser Franz Joseph ganz privat
Gabriele Praschl-Bichler
KaiserFranz Josephganz privat
»Sie haben’s gut, Sie könnenins Kaffeehaus gehen!«
Mit 32 Abbildungen
Alles im Buch veröffentlichte Bildmaterialentstammt einem Privatarchiv.
3. Auflage 2005
© 1994 by Amaltheain der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,Wien · München · BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Wolfgang HeinzelUmschlagabbildung: Österreichische Nationalbibliothek, WienHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 10,5 Punkt Simoncini GaramondDruck und Binden: Ueberreuter Buchproduktion, KorneuburgPrinted in AustriaISBN 3-85002-547-0eISBN 978-3-902998-31-6
Inhalt
Vorwort
1Leben, Lieben und Sterben nach Zeremoniell
Die Habsburger und die Hofetikette
2Wie viele Gulden schenkt man zum Geburtstag: fünf oder fünfzigtausend?
Über Geldverständnis und Taschengeld des Kaisers
3Wenn alle aufstehen, muß es wohl die Kaiserhymne sein …
Über die musischen und handwerklichen Talente des Kaisers
4»… da legte der Monarch dann sofort die Gabel weg«
Über das tägliche Arbeitsprogramm des Kaisers
5Punkt vier Uhr früh sauber, rasiert und in voller Adjustierung zum Dienst
Der tägliche Dienst des kaiserlichen Personals
6»Man sollte nicht glauben, daß weder in der Hofburg, noch in Schönbrunn … ein Badezimmer vorhanden war«
Von den Gegenständen und Einrichtungen des täglichen Lebens
7»Der Kaiser war mit der Jagd richtig aufgelebt …«
Bad Ischl und die Jagd
8Zur Visite in Frack und weißer Krawatte
Krankenpflege, Hausmittel und Arzneien
9»Die Herumrutscherei beim Fußwaschen hat meinem Rücken nicht geschadet …«
Gründonnerstag in der Hofburg
10Conte Don José Maroto de Fresno y des Landres und andere Goldmacher Kaiser Franz Josephs
Über alchimistische Versuche im 19. Jahrhundert
11»Die Autofahrt war mir ganz angenehm, aber meine Lipizzaner sind mir doch lieber«
Über die Reisen des Kaisers
12Kaiserliche Gemächer als Schafställe und Schlachtbänke
Kaiser Franz Joseph als Gastgeber
13»Soviel Glut, beim Zeus, ich schwör es, ein verliebtes Aug nur hat«
Kaiser Franz Joseph und die Frauen
14Der Kaiser ist nicht tot, im Sarg liegt eine Puppe
Über die letzten Lebenstage
15»Ich weiß nicht, was ich nach dem Tod Pachmayers anfangen soll«
Über die kaiserlichen Bediensteten
16Der Kaiser ist schon lange tot, für ihn regiert ein Doppelgänger
Über die Doubles Kaiser Franz Josephs
17»Schöpfer des Menschen Glücks. Gieße Segen und Heil über seine Majestät herab.«
Der Kaiser im Herzen seiner Untertanen
Uniformen des Kaisers
Kurzbiographien
Quellen und Literatur
Dank
Nachwort
Personenregister
Vorwort zur dritten Auflage
Als ich vor etlichen Jahren das Buch »Sie haben’s gut, Sie können ins Kaffeehaus gehen!« über das Privatleben Kaiser Franz Josephs schrieb, habe ich nicht gedacht, daß dieses Werk und die folgenden achtzehn Bände über die Habsburger einen so großen Erfolg erzielen würden. Die meisten dieser Bücher haben – dem Interesse der Leser entgegenkommend – das Leben der zwei »Publikumslieblinge« Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth zum Inhalt. Als solche sind die beiden unumstritten, und ich möchte nun einmal die Frage erörtern, was sie aus der Masse ihrer Familien heraushob und sie so besonders gemacht hat. Denn Habsburger Kaiser und Wittelsbacher Prinzessinnen hat es schon früher gegeben, und – mit Verlaub gesagt – es waren interessantere Charaktere darunter. Eine erste Erklärung liegt auf der Hand: Die beiden waren das »letzte«*) österreichische Herrscherpaar und damit das uns zeitlich am nächsten liegende. Hinzukommt, daß Kaiser Franz Joseph mit 68 Jahren Regentschaft einer der am längsten regierenden Monarchen aller Zeiten war. Drei bis vier Generationen Menschen kannten Österreich nur unter seiner Herrschaft. Bei Kaiserin Elisabeth liegt der Fall ähnlich. Als Frau eines der längst dienenden Regenten der Welt war auch sie eine lange Wegstrecke – immerhin 44 Jahre – mit dabei. Daß sie während dieser Zeit nicht einmal alterte, erhebt sie zur ewig schönen Kaiserinnen-Ikone (selbstverständlich ist auch sie gealtert, doch ließ sie sich ab ihrem etwa 35. Lebensjahr nicht mehr photographieren). Das macht sie so nachhaltig attraktiv. Denn wer wollte nicht »ewig schön« sein wie sie?
Doch wieder zurück zum Phänomen Kaiser Franz Joseph, auf den zunächst ähnliche Merkmale wie bei seiner Ehefrau zutrafen: Er war gutaussehend, sportlich – und zudem maßlos wohlhabend. Im Unterschied zu Elisabeth führte er sogar ein zufriedenes Leben: als glücklicher Ehemann, Vater, Großvater und in allererster Linie als fleißigster Beamter seines Staates. So viele Akten, wie Kaiser Franz Joseph in seinem Leben bearbeitet hat, hat sicherlich kein anderer Regent je durchgesehen, wahrscheinlich nicht einmal ein Beamter. Hier sind wir beim Kernpunkt der Geschichte angelangt, damit ist nun die jahrzehntelange, hingebungsvolle Verehrung erklärt: Beinahe jeder vermeint ein Stück dieses Biedermannes, dieses Familien- und pflichtbewußten Menschen in sich wiederzuerkennen. Und wenn er es nicht in sich wiedererkennt, dann würde er gerne einige dieser Eigenschaften besitzen. Und falls er noch nicht darüber nachgedacht hat, dann wünsche ich ihm viel Erfolg bei der Suche.
Gabriele Praschl-Bichler
im Juli 2005.
*) Selbstverständlich ist mir bewußt, daß Kaiser Karl und Kaiserin Zita das letzte Regentenpaar war. Doch konnten die beiden in den zwei kurzen Jahren ihrer Herrschaft, die noch dazu in die letzten Jahre des Ersten Weltkriegs fielen, nicht annähernd so viel Popularität erlangen.
1Leben, Lieben und Sterbennach Zeremoniell
Die Habsburger und die Hofetikette
Die Geschichte vom König, der in einer prachtvollen Burg, von großem Luxus umgeben, glücklich lebte und der sich die Zeit mit Kahnfahrten, Picknicks und Tanzvergnügungen vertrieb, ist – eine Geschichte. Genauso wie die Idee, daß er nach Belieben eine Gänsemagd oder ein einsames Aschenputtel zur Gemahlin nehmen und mit ihr bis ans Ende seiner Tage in seliger Zweisamkeit leben konnte.
In Wahrheit waren Könige beschränkt in ihrer Zeiteinteilung, verpflichtet dazu, eine gewisse Gesellschaft dauernd um sich herum zu ertragen, kurzum sie waren Gefangene des höfischen Zeremoniells. Und was die Wahl einer Ehefrau anbelangte, so konnte der Regent keinesfalls nach eigenem Gutdünken und Wohlgefallen entscheiden, sondern mußte sich den Einflüsterungen hoher Staatsbeamter und (tages)politischen Interessen fügen.
Das galt auch für Kaiser Franz Joseph, der – eingesponnen in ein dichtes Netz von Terminen, Zeremoniell und Etikette – kaum etwas unternehmen konnte, wonach ihm spontan der Sinn stand. In allen Belangen des Privat- oder Hoflebens unterlag er dem Hofzeremoniell, das erfunden worden war, um die Person des Herrschers zu »entmenschlichen« (oder zu vergöttlichen). Sie sollte aus der Masse der Normalsterblichen erhoben werden, damit sie ebenso unerreichbar wie unantastbar würde. Das verlangte dem Erwählten – oder besser dem Betroffenen – ein lebenslang in Disziplin geführtes Leben ab, das ein auf den Beruf Unvorbereiteter kaum durchgehalten hätte.
Kaiser Karl V. hatte das Hofzeremoniell im 16. Jahrhundert mit allem beschwerlichen und umständlichen Pomp ausgestattet, sein Enkel, Kaiser Rudolf II., machte es am Wiener Hof heimisch. Unter dem spanischen König Philipp II., dem Sohn Kaiser Karls V., bildete das Studium der Hofetikette der aristokratischen Jugend eine Pflichtlektüre, die zu beherrschen von großer Vornehmheit zeugte. Die Etikette klärte darüber auf, wieviele Schritte vor einer Verbeugung wem gegenüber zu gehen und wie tief Verbeugungen im einzelnen Fall auszuführen waren.
Als die Königin von Spanien eines Tages vom Pferd glitt, blieb sie unglückselig mit einem Fuß im Steigbügel hängen und wurde vom weitertrabenden Pferd mitgeschleift. Der Erste Stallmeister, der als einziger das Recht gehabt hätte, den königlichen Fuß zu berühren, war nicht zugegen, weshalb keiner der dreiundvierzig anwesenden Hofkavaliere wagte, der Königin zu Hilfe zu eilen. Nachdem – außer mit Entsetzen – niemand auf den Unfall reagiert hatte, faßte sich ein hoffremder Kavalier ein Herz, nahm die Verfolgung von Königin und Pferd auf und befreite die Dame aus der mißlichen Lage. Zur Belohnung wurde er mit einer lebenslangen Verbannung aus Spanien belegt.
Der König von Spanien unterlag denselben umständlichen Regelungen und durfte seine Gemahlin zum Beispiel nur nach vorgeschriebenem Zeremoniell in ihren Privaträumen besuchen. Zuallererst hatte der Tag und die Stunde der Zusammenkunft festgelegt zu werden. Dann mußte der König das schwarze Hofkleid mit Mantel anlegen (so wie man es aus den zeitgenössischen Porträts kennt, auf denen die Dargestellten sehr steif und unbeweglich erscheinen) und darauf warten, daß ihn der Obersthofmeister abhole und zur Gemahlin geleite. Unter Vortritt eines Granden, der einen Kerzenleuchter trug, und eines zweiten, der ihm mit einer Karaffe reinen Wassers folgte, begab sich der König – flankiert von den höchsten Staatschargen und einer Abteilung von Hellebardieren – durch eine Flucht von Vorzimmern, in denen der Hofstaat, nach Rangklassen abgestuft, versammelt war, zu den Gemächern der Königin. Auch sie war von ihrer Obersthofmeisterin auf den bevorstehenden Besuch vorbereitet worden. In einer dem Anlaß entsprechenden Robe schritt sie mit ihrem Gefolge aus ihren Privaträumen dem König entgegen, sodaß beide in einem ebenfalls vorbestimmten Gemach zum möglichst selben Zeitpunkt eintrafen. Dieser Raum war dem Zweck der Zusammenkunft entsprechend möbliert und vorbereitet worden. Licht und Karaffe wurden darin abgesetzt, das beiderseitige Gefolge zog sich, wieder genau nach Rängen geordnet, in angrenzende Räume zurück und harrte dort geduldig aus, bis das königliche Ehepaar, durch verschiedene Türen tretend, wieder erschien und den ebenfalls zeremoniell geregelten Rückweg antrat. Es ist nicht auszudenken, welcher Wirrwarr entstanden wäre, wenn der König seine Ehefrau aus einer plötzlichen Laune heraus spontan besucht hätte, und es ist weiters fraglich, ob er überhaupt bis zur Gemahlin vorgedrungen wäre.
Eine kuriose Blüte trieb das Hofzeremoniell auch mit den vielen per procurationem (in Stellvertretung) zu verheiratenden Paaren. Da Eheschließung und Beilager vor Zeugen stattzufinden hatten und man letzteres mit dem Vertreter des Bräutigams oder der Braut aber nicht durchführen konnte und durfte, erfand man als Ersatz eine symbolische Notlösung. In einem prunkvoll ausgestatteten Bett, in dem sich die – bekleidete – Braut unter einer Decke befand, wurde in Anwesenheit des Hofstaats die Ehe sinnbildmäßig »vollzogen«, indem der Stellvertreter des Bräutigams das ebenfalls bekleidete, aber unbeschuhte rechte Bein für kurze Zeit unter dieselbe Decke steckte.
Besonders genau hielt sich der barocke Kaiser Leopold I., ein Großneffe Kaiser Rudolfs II., an die steife spanisch-burgundische Regelung. Seine Regierungszeit, eine ganz auf Form hin ausgerichtete Epoche, war geradezu geschaffen, ein nach Gesellschaftsschichten, Sitten und Tätigkeiten geordnetes Leben vorzuspielen. Unter Kaiserin Maria Theresia wurde die strenge Form des Hofzeremoniells mit einer gemütlich-wienerischen Note versehen, ihr Sohn und Nachfolger, Kaiser Josef II., reduzierte es auf ein – von der Gesellschaft gefordertes – nötiges Mindestmaß. Unter Kaiser Franz Joseph huldigte man der bürokratisch-pedantischen Auslegung des Zeremoniells. Das Wiener Hofzeremoniell umfaßte allgemein die Etikette (Regelung des Verhaltens bei Hof), die Kleiderordnung (in Bezug auf Feste, Hoftrauer usw.), die Rangabstufungen innerhalb der Gesellschaftsschichten (Alter, Titel und Würden der einzelnen Personen) sowie den Hofzutritt, der vorsah, daß die Hofwürdenträger an feierlichen Prozessionen in einer bestimmten Reihung teilnehmen durften. Am Wiener Hof galt die Regelung des Hofstaates aus dem Jahr 1527 bis zum Ende der Monarchie im Jahr 1918. Weiters beinhaltete das Hofzeremoniell die wichtigsten Punkte der Vorbereitungsarbeit und Gestaltung von Festlichkeiten, die Klärung der Sicherheitsbelange sowie die der Hofreise- und Quartierangelegenheiten. Wenn ein Mitglied des Kaiserhauses starb, wurde die Hoftrauer angesagt, und die sogenannte Hoftrauer-Regelung trat in Kraft. Kaiserin Maria Theresia hatte am 22. Dezember 1767 eine Hofklag-Tragungsverordnung erlassen, eine Regelung, die Vorschriften für sieben verschiedene Klassen enthielt.
Bei den Audienzen, die Kaiser Franz Joseph gewährte – es sollen im Laufe seiner Regentschaft an die einhunderttausend gewesen sein –, unterschied man die allgemeinen Audienzen von den Privataudienzen. Die Reihenfolge bei den privaten Audienzen bestimmte der Rang des Bewerbers. So hatten beispielsweise Kammerherren Vortritt vor den Rittern des Goldenen Vlieses und diese wiederum vor den Inhabern anderer hoher Orden. Kardinäle, die Mitglieder des Klerus im allgemeinen, hatten vor allen anderen den Vortritt. Was die Kleidervorschriften anbelangte, so hatte eine Zivilperson im Frack zur Audienz zu erscheinen, die Militärperson in voller Paradeuniform.
Einige Minuten, bevor der Audienzbewerber zum Kaiser vorgelassen wurde, unterrichtete ihn der Zeremonienmeister vom Begrüßungs- und Eintrittsritual der drei immer tiefer werdenden Verbeugungen: die erste hatte stattzufinden, wenn sich die Flügeltüre vom Wartesaal (Großer Audienzsaal) ins Audienzzimmer auftat, die zweite zwischen der Türe und dem Kaiser, die dritte vor dem Kaiser in gebührend respektvollem Abstand, jedenfalls noch so weit vom Herrscher entfernt, daß der Besucher keinen Händedruck erwarten konnte. Nur bei ganz besonderer Auszeichnung reichte der Kaiser dem Audienznehmer die Hand. Eine noch größere Schwierigkeit als der Eintritt ins Audienzzimmer stellte der ordnungsgemäße Rückzug dar: Laut Anweisung des Zeremonienmeisters mußte sich der Besucher vom Kaiser rückwärtsgehend und unter Ausführung von zwei Verbeugungen verabschieden. »Mit dem Rücken zur Türe« bedeutete, »blind« auf sie zuzusteuern. Meist gestaltete sich dieser Abgang tragikomisch und im Zickzackkurs, was nicht selten zur Folge hatte, daß man irgendwann an die mit riesigen Porzellan-Vasen beladenen Konsoltische stieß. Wer Glück hatte, wurde von einem mitleidigen Hofbediensteten an den Frackschößen unauffällig in Sicherheit gezogen.
Selbst bei gering erscheinenden Anlässen wurde an althergebrachten Sitten und Vorschriften festgehalten, so wie die alljährlich stattfindende Ankunft zum Frühsommeraufenthalt des Kaisers in Schloß Laxenburg – der den Auftakt zur Ischler Reise bildete – seit den Tagen der Kaiserin Maria Theresia nach immer demselben Zeremoniell erfolgte: eine Abordnung der Gemeinde, der Schuljugend, der Geistlichkeit und der Chef der Bezirksbehörde hatten sich zur Ankunft des Kaisers einzufinden und ihn mit immer denselben Ritualen, Aufregungen und Reden willkommenzuheißen.
Obersthofmeister Fürst Montenuovo zählte zu den eifrigsten Verfechtern bei Beachtung möglichst vieler zeremonieller Vorschriften, obwohl er selbst große Schwierigkeiten gehabt hätte, einen korrekten Standesnachweis zu erbringen. Streng genommen ein Neffe zweiten Grades Kaiser Franz Josephs, durfte er sich doch nie als reguläres Mitglied der Familie betrachten, da sein Vater aus einer ziemlich unstandesgemäßen und wenig einwandfreien Verbindung hervorgegangen war: Die Großmutter des Fürsten Montenuovo, Erzherzogin Marie Luise, eine Tochter Kaiser Franz’ II. (I.), erhielt als Nochehefrau des verbannten Exkaisers der Franzosen, Napoleons I., auf Lebenszeit die aus einer bourbonischen Nebenlinie stammenden Herzogtümer Parma, Piacenza und Guastalla übertragen, wohin sie sich als Regentin begeben durfte. Ihr Vater stellte ihr als Begleiter den Grafen Adam Albert Neipperg zur Seite, an dem Marie Luise bald so sehr Gefallen fand, daß sie ihm in der Folge – als Nochehefrau Napoleons – einige Kinder schenkte. Diese Nachkommen wurden trotz einer später folgenden Heirat von beiden Familien als »nicht standesgemäß« anerkannt und durften nicht einmal den Namen Neipperg tragen. So italianisierte man Neipperg in Montenuovo (Neuberg), und der Enkel der ältesten männlichen Linie sollte diesem Namen als (später gefürsteter) Obersthofmeister noch zweifelhafte Ehre angedeihen lassen. Peinlich genau versah er das Amt und nahm gesellschaftliche Rangordnungen so wichtig wie Staatsgeschäfte. Den Status der Gemahlin des Thronfolgers Franz Ferdinand, einer geborenen Gräfin Chotek (später Herzogin Hohenberg), behandelte er mit aller »gebührenden« Strenge: Sie durfte bei Empfängen, Bällen und anderen offiziellen Anlässen nicht an der Seite des Gemahls erscheinen, sondern mußte am Ende des Zugs hinter den jüngsten Erzherzoginnen einziehen. Selbst bei der Aufbahrung des 1914 in Sarajewo ermordeten Paares in der Hofburgkapelle hielt sich Montenuovo streng an die Etikette und ließ den Sarg der Herzogin von Hohenberg um einige Zentimeter tiefer stellen als den ihres Ehemanns.
2Wie viele Gulden schenkt man zumGeburtstag: fünf oder fünfzigtausend?
Über Geldverständnis und Taschengeld des Kaisers
Eigentlich brauchte dieses Kapitel nicht geschrieben zu werden, denn weder der Kaiser, noch seine Gemahlin, noch ein anderes Mitglied seiner Familie verfügte als privat auf der Straße Spazierender über Taschengeld. Kaiser Franz Joseph durfte selbst keinen Einkauf tätigen, weshalb ihm jedes Wissen vom Verhältnis des Geldes zum Warenwert fehlte. Als ihn sein jüngster Brüder, Erzherzog Ludwig Viktor, anläßlich eines Geburtstags anstatt eines Geschenks um Geld bitten ließ, wies der Kaiser einen Beamten an, ihm fünf Gulden zu übergeben. Auf den Einwand des Obersthofmeisters Prinz Hohenlohe, daß das recht wenig sei, erhöhte der Kaiser den Betrag kurzfristig auf fünfzigtausend Gulden, worauf Hohenlohe entgegnete, daß dieser Betrag die Großzügigkeit weit überschreite. Dem Kaiser war die Diskussion um eine so unwichtige Angelegenheit zu lange und zu kompliziert geworden, weshalb er zuletzt eine Überweisung von fünfzig Gulden verfügte, ohne eine weitere Bemerkung anzuhören oder gar gelten zu lassen.
Im Vergleich dazu eine Episode aus dem Leben der Kaiserin Elisabeth, die im Unterschied zu ihrem Gemahl zum Geld wohl ein Verhältnis hatte, das aber eher als philosophisch zu bezeichnen ist: »Heute ist etwas Interessantes passiert. Wir (Kaiserin Elisabeth und ihr Griechischlehrer, der die Geschichte erzählt) sind über die Abhänge, die vom Achilleion (Privatvilla der Kaiserin auf der Insel Korfu) zu der Bucht von Kanoni hinunter führen, bis an den Strand gekommen. Die Kaiserin wollte, daß der Fährmann … uns auf seinem Boot nach Kanoni hinüberbringe. Ich frug ihn, was er dafür begehre … Er verlangte zwei Papiertaler. Er hatte nämlich die Kaiserin erkannt, auf die in Korfu jedes Kind mit dem Finger weist … Ich sagte, das wäre doch zu viel, wir würden einen Taler geben. Doch er blieb fest und begann endlich mich mit Schmähungen zu überhäufen … Die Kaiserin lachte und sagte: ›Lassen Sie – wir gehen zu Fuß die Küste entlang.‹
Während wir gingen, trafen wir einen kleinen Fischerjungen, der sich erbot, uns einen trockenen Pfad zu zeigen. Wie wir an Ort und Stelle waren, hieß mich die Kaiserin dem Jungen ein Goldstück geben … Man sagt, daß die Herrscher den Geldwert nicht kennen – ich glaube, sie (die Kaiserin) hat dem Gelde jenen Kurswert gegeben, den es einzig und allein haben soll; er hängt von der Intensität ihres Wunsches ab.« (Aus dem Tagebuch des Griechischlehrers der Kaiserin, Constantin Christomanos, März-April 1892, S. 152 f.)
Kaiser Franz Joseph war ein sehr sparsamer Mensch, vor allem sich selbst gegenüber. Laut einer Aussage seines Leibkammerdieners Ketterl hätte man ihn mit fünf Gulden am Tag »durchgebracht«.
Als Privatmann verfügte der Kaiser über ein großes Vermögen, das jährlich um die Einkünfte aus jeder der beiden Reichshälften bedeutend vermehrt wurde (in der sogenannten Zivilliste, das ist der für den Landesherrn bestimmte Betrag im Staatshaushalt, scheinen im Jahr 1904 19,323.000 Mark 1) auf). Nur Zar Nikolaus II. von Rußland soll mehr aus der Staatskasse, nämlich 27,000.000 Mark1), erhalten haben. Das Privatvermögen des Erzhauses basierte auf dem Habsburger Familienfonds, das sich aus dem Erbe Kaiser Franz’ I. Stephan aufgebaut hatte. Der Gemahl der Kaiserin Maria Theresia hatte sich als geschickter Geschäftsmann entpuppt, der mit privaten Transaktionen ein riesiges Vermögen geschaffen und ständig erweitert hatte. Sein Sohn und Nachfolger, Kaiser Josef II., konnte sogar mit einem Teil seines Erbes die Staatsschulden decken. Noch bis zum Jahr 1918 verfügten die Habsburger über immense private Reichtümer (Schlösser, Land- und Forstwirtschaften, Zinshäuser usw.), die nach dem Ersten Weltkrieg großteils – dem ärarischen Vermögen gleichgesetzt – enteignet wurden.
1)Die Mark-Beträge scheinen im Cachée’schen Manuskript auf und wurden wahrscheinlich einem deutschen Buch entnommen, denn in Österreich rechnete man 1904 in Kronen. Eine Anfrage beim Statistischen Zentralamt in Wien brachte keine genaueren Umrechnungsdaten.
3Wenn alle aufstehen, muß es wohldie Kaiserhymne sein …
Über die musischen und handwerklichen Talente des Kaisers
Trotz der vielen hochmusikalischen Vorfahren (sehr viele Habsburger sind aus der großen Menge der Familienmitglieder als anerkannte Komponisten hervorgetreten, unter denen Kaiser Leopold I. eine besondere Rolle einnimmt: seine Opern finden sich bis heute auf den Spielplänen der Opernhäuser) scheint Kaiser Franz Joseph nicht die geringste Begabung für Musik gehabt zu haben, so soll er die Kaiserhymne nur daran erkannt haben, daß sich schon während der ersten Takte alle Anwesenden von ihren Plätzen erhoben.
Für die Zeichenkunst zeigte Kaiser Franz Joseph seit seiner Jugend ein wesentlich größeres Talent, wie verschiedene erhaltene Blätter – vorzugsweise Landschaften und Genrebilder – dokumentieren. Außerdem liebte er es, militärische Szenen und typische Volkscharaktere mit dem Zeichenstift festzuhalten. Im Alter von dreizehn Jahren machte er eine solche Sammlung seinem Erzieher, dem Grafen Timotheus Ledochowski, zum Geschenk. Als er mit sechzehn Jahren eine Reise durch Dalmatien unternahm, hielt er seine Eindrücke aus diesem Land mit dem Stift fest, die 1888 anläßlich seines vierzigjährigen Regierungsjubiläums bei der Wiener k.k. Hof- und Kunstdruckerei Reiffenstein & Uhl veröffentlicht wurden. Wie aus dem Vertrag mit dem Kunstverlag hervorgeht, scheint Kaiser Franz Joseph ein Förderer und Anhänger der in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts noch jungen Kunst der Lithographie gewesen zu sein: »Daß Wien an der Spitze dieses Kunstzweiges war, mag wohl auch die damalige kaiserl. und königl. Hoheit, den jungen Erzherzog Franz Joseph, unseren jetzigen hochsinnigen und kunstbegeisterten Kaiser, veranlaßt haben, diese Kunst durch eigene Lithographien zu ehren … Zweiundvierzig Jahre ruhen diese für uns so werthvollen Steine unter besonderer Obhut in unserem Geschäfte, und jetzt zum vierzigjährigen Regierungs= Jubiläum Seiner Majestät wurde uns auf unsere allerunterthänigste Bitte Allerhöchst gestattet, diese Lithographien in einem Album vereinigt der Jubiläums= Ausstellung einzuverleiben, wo sie unzweifelhaft eines der interessantesten Ausstellungsobjecte bilden werden …« (Wien, 1888)
In den Appartements der Erzherzogin Sophie, der Mutter Franz Josephs, fanden für die kleinen Söhne Theateraufführungen, Kinderjausen, Kinderbälle und allerlei Spiele statt, zu denen junge Erzherzoge und ihre Freunde aus hochadeligen Familien geladen wurden. Die einzige Schwester Franz Josephs, Maria Anna, die 1835 geboren worden war, erlebte nicht viele dieser Kinderfeste, da sie 1840 im Alter von kaum viereinhalb Jahren verstarb.
Ein bunter Bericht über einen dieser Kinderbälle ist aus der Feder einer Hofdame der Prinzessin Amalie von Schweden (eine Tochter des Exkönigs Gustav IV. Adolf, dessen Familie sich nach dem Thronverlust Prinzen von Wasa nannte), Sophie Baronin von Scharnhorst erhalten: »Gestern war Kinderball bei der Erzherzogin Sophie, wo eben soviel Große1) als Kinder tanzten. Der Kinderball war durch eine sehr komische Episode verherrlicht. Es entstand auf einmal in der Mazurka – wo der kleine siebenjährige blondlockige Lobkowitz2) tanzte, Sohn von Leopoldine Lobkowitz, geborene Liechtenstein – ein großer, spiegelheller See, auf dem die Puppen hätten eine brillante Wasserfahrt machen können.
Der Kleine war gar nicht überrascht – desto mehr die Mittänzer und Zuschauer. Die Mutter des kleinen Verbrechers stürzte kokelrot auf ihr Kind und führte es zur großen Belustigung des schaulustigen Publikums quer durch die Mazurka hinaus ins Toilettezimmer, wo eine Manipulation mit Servietten den Kleinen instandsetzte, sich wieder zu zeigen und mit den anderen Knaben zu soupieren, eine Naivität, die die Mutter durch allgemeine Heiterkeit büßen mußte, denn die Herren sagten ihr manches ins Ohr, was sie einmal über das andere erröten ließ.« (Brief, März 1851)
Zurück zum jungen Franz Joseph, der traditionsgemäß wie jeder Habsburger ein Handwerk erlernen mußte: Er hatte den Beruf des Buchbinders erwählt. Der Sinn dieser Ausbildung läßt sich auf die Geschichte zahlreicher Herrscher zurückführen, deren Regentschaft durch Umsturz geendet hatte. Daraus hatte man gelernt, daß eine Herrschaft bestenfalls ein Gottesgeschenk ist, daß man für ihre Beständigkeit aber keine Garantie erhalten konnte. Viele Staatsumwälzungen haben abgesetzte Regenten und deren Familien – so man sie am Leben gelassen hatte – ins finanzielle Elend gestürzt. Dem wollten die Habsburger entgegenwirken, indem alle männlichen Familienmitglieder Berufe erlernten, um im Notfall in ein bürgerliches Leben »einsteigen« zu können.
Der Buchbinder Franz Joseph zeigte allerdings wenig Interesse für das Produkt seiner Zunft – er hatte mit Lyrik, Prosa, Noten oder Libretti wenig im Sinn. Musikalisch ist er nur ein einziges Mal, im Bubenalter, hervorgetreten, als er sich während eines Diners in Reichenau vor den diensttuenden Kapellmeister aufstellte und dessen Handbewegungen nachahmte. Für Musik konnte er sich aber im Zusammenhang mit Militärparaden begeistern, zu welcher Vorliebe sich seit Kindesalter ein stark ausgeprägter Ordnungssinn gesellt hatte. So wie er die exakt ausgerichteten Reihen der (musizierenden) Soldaten bewunderte, genauso liebte er Ordnung auf dem Schreibtisch, im Familienleben und im Staatsbetrieb. Ihr widmete er sich mit dienender Hingabe, weshalb er Tausende Male lieber auf das Leben und die pulsierende Wirklichkeit verzichtete, als unerledigte Akten liegenzulassen.
Unter allen Künsten bevorzugte Kaiser Franz Joseph das Theater (seltene Operetten- und Opernbesuche miteingeschlossen), in seiner Kindheit hatte er sogar als Darsteller in von seiner Mutter arrangierten, familiären Theateraufführungen in den Räumen der Hofburg mitgewirkt. Der erwachsene Franz Joseph besuchte mit viel Leidenschaft professionelle Darbietungen, wobei ihm einige Stücke oder deren Darsteller so gut gefielen, daß er einige Vorstellungen sogar mehrmals ansah.
Im Herbst des Jahres 1894 war ein kleines Mädchen, Camilla Gerzhofer, in den vielbegehrten Status der Hofschauspielerin aufgenommen worden. Nach einer längeren Probezeit hatte sie einen fixen Vertrag als Kinderdarstellerin am kaiserlichen Burgtheater mit fünfundzwanzig Gulden Monatsgage, acht Wochen bezahlten Urlaubs und der Kostenvergütung für einen Fiaker zu allen Proben und Vorstellungen erhalten. Ihre Mutter, eine Offizierswitwe, hatte das Mädchen im Alter von zweieinhalb Jahren ans Burgtheater gebracht, wo sie der Komparsenchef Ferrari, dem auch die Besetzung der Kinderrollen oblag, spontan engagierte. Den Ausschlag dazu hatte ihr natürliches Auftreten vor dem erwachsenen Mann gegeben, der als einer der ersten ihrem Charme erlag.
Als sie während des »Vorstellungsgesprächs« auf ein großes Wandgemälde deutete, das Kaiser Franz Joseph im Krönungsornat darstellte, und Ferrari ganz offenherzig fragte, ob denn der Kaiser zu Hause auch immer eine Krone aufhabe, mußte er darüber so lachen, daß dem weiteren Erfolg des Mädchens – zumindest von seiner Seite her – nichts mehr im Wege stand.
Camilla Gerzhofer gab am Burgtheater Tells Sohn, das Kind Carl im Götz und Klein Eyolf in dem gleichnamigen, selten gespielten Stück von Ibsen. Es erzählt vom Schicksal eines gehbehinderten Knaben, der sich nur auf Krücken fortbewegen kann. Mit seiner Darstellung hatte man das begabte Mädchen betraut. Die Eltern Klein Eyolfs waren mit den damaligen Burgtheatergrößen Friedrich Mitterwurzer und Adele Sandrock besetzt.
Klein Eyolf geriet zu einem großen Publikumserfolg, und Kaiser Franz Joseph war von dem Spiel des Kindes so entzückt, daß er der Aufführung insgesamt siebenmal beiwohnte. Und es war vorwiegend die kleine Schauspielerin, die den Kaiser ins Theater lockte, denn er verließ stets nach dem ersten Akt, an dessen Ende das Kind verstirbt, seine Loge. Ein anderer Grund des frühen Aufbruchs mag auch die Angewohnheit des Kaisers gewesen sein, sich gegen neun Uhr abends ins Bett zu begeben, um den darauffolgenden Arbeitstag wie üblich um vier Uhr früh beginnen zu können. Die schon damals in der Gunst des Kaisers stehende Schauspielerin Katharina Schratt wurde anläßlich der großen künstlerischen Leistung des Kindes beauftragt, der Mutter des Mädchens die besten Empfehlungen zu übermitteln und in Erfahrung zu bringen, womit man der kleinen Darstellerin eine Freude bereiten könnte.
Die damals Siebenjährige wünschte sich nichts sehnlicher als eine Puppe, und so übergab Frau Schratt eines Tages dem Mädchen eine Pariser Puppe der Marke Bébé Jumeau, die ein besonderes Modell dieser berühmten Puppenherstellungsfirma war: eine Polichinelle, in deren Brust – von einer abnehmbaren Blechplatte verdeckt – ein Phonograph mit Schlüssel und Federantrieb eingebaut war, auf dem zwölf verschiedene besprochene oder besungene Hartgummirollen abgespielt werden konnten. Es waren durchwegs französische Kinderlieder, die von Yvette Guilbert, der von Toulouse-Lautrec verewigten Chansonette, vorgetragen wurden. Außerdem konnte Bébé ihre Puppenmutter auf französisch begrüßen, was – ins Deutsche übersetzt – etwa bedeutete: »Guten Tag, meine liebe, kleine Mama! Ich bin sehr gescheit, und Papa ist sehr zufrieden mit mir. Wir werden Guignol (ein französischer Kasperl) besuchen, um ihn singen zu hören. Pardauz, pardauz! Wer ist denn dort? Das ist Polichinelle, mein Fräulein. Pardauz, pardauz! Auf Wiedersehen, meine liebe, kleine Mama!«
Die Puppe war im Original mit einem rosa Ripsseidenkleid und einem unter dem Kinn gebundenen Bébéhut bekleidet. Prominente Firmen machten es sich in der Folge zur Aufgabe, diese von Kaiserhand überbrachte Puppe mit Kleidern, Wäsche, Schuhen und sogar mit Schmuck reich auszustatten, sodaß eine Ausfahrt der Puppenmutter mit Puppenkind jedesmal gewaltiges Aufsehen erregte. Die Puppe gelangte, wie alle Erinnerungsstücke der Camilla Gerzhofer, 1948 in die Theatersammlung der Wiener Nationalbibliothek. Vor ein paar Jahren wurde sie dort mit noch vollständig erhaltener Ausstattung wieder entdeckt.
1)Franz Joseph und seine drei Brüder lagen altersmäßig weit auseinander. Der Kaiser war 1851 (aus welcher Zeit der Brief stammt) einundzwanzig Jahre alt und ein leidenschaftlicher Tänzer, sein jüngster Bruder Ludwig Viktor zählte neun Jahre.
2)Vermutlich Ludwig Lobkowitz, der damals acht Jahre alt war und der mit fünfundzwanzig Jahren unverheiratet verstarb.
4»… Da legte der Monarch dann sofortdie Gabel nieder«
Über das tägliche Arbeitsprogramm des Kaisers
Das Tagesprogramm Kaiser Franz Josephs verlief mit der Genauigkeit einer militärischen Übung. Der Leibkammerdiener hatte um vier Uhr früh das »allerhöchste« Schlafzimmer zu betreten, ihn mit der Floskel »Lege mich Eurer Majestät zu Füßen!« zu begrüßen und ihm danach beim Anziehen behilflich zu sein. Nach der Morgentoilette begab sich der Monarch in sein Arbeitszimmer an den Schreibtisch. Er bearbeitete dort stundenlang alle Eingänge, die ihm, in »Schönschrift« und ohne jede Korrektur, vorgelegt worden waren. Maschingeschriebene Eingaben lehnte er grundsätzlich ab. Diese Eigenart läßt sich auf die Verachtung des Kaisers den meisten neueren technischen Errungenschaften gegenüber zurückführen. Obwohl man bei der Schreibmaschine im 19. Jahrhundert auch nicht mehr von neuer Erfindung sprechen konnte, weil an dem Buchstabendrucksystem seit dem 17. Jahrhundert gearbeitet wurde und 1872 schon eine von Thomas Alva Edison entwickelte elektrische Schreibmaschine auf dem Markt war.
Zurück zum Kaiser, dem der Leibkammerdiener um fünf Uhr das erste Frühstück servierte, das aus Kaffee, Butter, Gebäck und – mit Ausnahme von Freitagen und anderen Fasttagen – aus Schinken bestand. Zum persönlichen Dienst des Kaisers waren jeweils drei Personen abgestellt: ein Leibkammerdiener für die persönliche Bedienung und Garderobe, vor allem aber zur Wartung der fünfzig verschiedenen Uniformen einschließlich des Zubehörs; ein Kammertürhüter, der für die Ordnung am Schreibtisch des Monarchen zu sorgen hatte; und ein Hausdiener, der für die Heizung und kleinere Verrichtungen zuständig war. In Schönbrunn war jahrelang die Kammerfrau Friedl mit der Aufgabe betraut, alles für die Toilette des Kaisers Notwendige vorzubereiten.
Nach dem Frühstück empfing Kaiser Franz Joseph, mit einem leichten, graublauen Militärmantel, dem sogenannten »Bonjourl«, bekleidet, den Vorstand der Militärkanzlei. Ihm folgten der Kabinettsdirektor, der Zweite Generaladjutant und schließlich der Erste Generaladjutant, General der Kavallerie, welchen Dienst jahrelang Eduard Graf Paar innehatte.
Allmorgendlich um sieben Uhr überprüfte der jeweilige Leibarzt des Kaisers, zuerst Dr. Widerhofer, später Hofrat Dr. Kerzl, in Frack und mit weißer Krawatte, den Gesundheitszustand des Monarchen. Dr. Kerzl hatte zu seinem hohen Patienten ein besonders herzliches Verhältnis und wurde von ihm sogar oft zu Tarockpartien gebeten.
An Audienztagen empfing der Kaiser bis zu hundert Parteien. Auf einem Stehpult lag die dafür vorbereitete Audienzliste, die den Namen des Bittstellers und den Grund des Erscheinens anführte. Der erfolgreiche Abschluß der Audienz wurde mit einem Rotstiftstrich durch den Namen bestätigt.
Vor der Mittagsstunde wurde ein kleiner Tisch ins Arbeitszimmer getragen, an dem der Kaiser sein zweites Frühstück einnahm. Das einfache Mahl bestand meist aus Suppe, dünngeschnittenem Rindfleisch, Beefsteak oder Geflügel mit Gemüse und einem Glas Spaten-Bier. Wenn wenig Freizeit zu erübrigen war, nahm der Kaiser das Essen am Schreibtisch zu sich, wo es in der Mitte – zwischen den rechts abgelegten erledigten und den links sich stapelnden unerledigten Akten – postiert wurde. »Rücksichtslos, wie man oft dem Kaiser gegenüber war, ließ die Kabinettskanzlei gerade zu dieser Stunde des öftern Minister mit ›dringlichen‹ Berichten vor. Da legte der Monarch dann sofort die Gabel nieder und ich mußte das Tablett – die Speisen waren manchmal noch kaum berührt – sofort hinaustragen.« (Ketterl, S. 27)
Punkt zwölf Uhr mittags fand die Ablöse der Burgwache statt, wobei die neue Kompanie mit Militärmusik, dem sogenannten »Burgmurrer«, in den Burghof, der damals noch nach der ihn schmückenden Kaiserstatue Franzensplatz hieß, einzog. Oft trat der Kaiser auf den Balkon des Reichskanzleitraktes, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Wachablöse zu überprüfen.
Das Diner wurde in Schönbrunn oder in der Hofburg meist im engen Familienkreis oder »à la camera« (d. h. allein) zwischen fünf und sechs Uhr abends eingenommen und unterschied sich in nichts vom schlichten bürgerlichen Nachtmahl. Wenn es durch einen kleinen Luxus aus der Menge der übrigen Diners herausragte, bot das den am Essen Beteiligten sofort eine Diskussionsgrundlage, um die Ursache dafür herauszufinden:
»An diesem Tage speiste ich mit der Kaiserin und Valérie allein und war sehr erstaunt, Champagnergläser auf dem Tisch zu sehen, da wir uns gewöhnlich den Luxus dieses Weins nicht gönnen. Die Kaiserin klärte mich auf, daß sie den Champagner bestellt habe, damit wir auf Ihr Wohl (das der Katharina Schratt, die an diesem Tag in Wien ihren Namenstag feierte, während sich das Kaiserpaar in Gödöllö aufhielt) trinken können, was denn auch in der herzlichsten Weise geschah. Das war eine gelungene und hübsche Überraschung.« (Brief Kaiser Franz Josephs an Katharina Schratt, 19.11.1887)