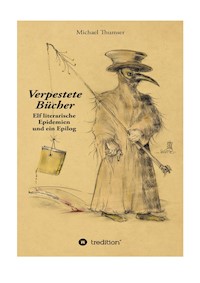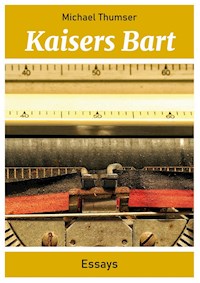
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dem Gewicht nach halten sich die Themen der dreizehn kürzeren und längeren Essays irgendwo zwischen Haupt- und Staatsaktionen einerseits und den Kleinigkeiten des Alltags andererseits auf. Den ernsten Zeiten ihrer Veröffentlichung angemessen, behandeln manche von ihnen internationale oder persönliche Katastrophen (wie den Tod eines Kindes), andere hingegen wenden sich, freudvoller, erfüllenden Beschäftigungsmöglichkeiten des Geistes oder gar dem höheren Humbug zu. Sogenannte große Männer treten auf – Scheusale wie Genies – und starke Frauen auch, dicke Bücher finden zwischen den Seiten Platz, und bedeutsame Musik tönt aus ihnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© Michael Thumser M.A., 2022
Einbandgestaltung: Carolina Schlak
(Foto: Hannibal Height/Pixabay)
Printed in Germany
Eine Publikation des Hochfranken-Feuilletons, Hof
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Hardcover:
978-3-347-74943-6
ISBN Softcover:
978-3-347-74939-9
ISBN E-Book:
978-3-347-74947-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für jede elektronische oder anderweitige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter tredition GmbH, Abteilung Impressumservice (Anschrift wie oben).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Michael Thumser
Kaisers Bart
Essays
Inhalt
Die gewaltigste der Welten
Bemerkungen über das Buch, das Lesen und das Schreiben
Symphonien des Grauens
Bram Stokers DRACULA und die Schwarze Romantik
Poesie der Luft
Jean Paul und die Musikalität des Erzählens
Die verhunzte Welt
Georg Büchner zwischen Empathie und Pessimismus
Beruf: Klassiker
Beethoven oder Die Romantik der Aufldärung
„Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen“
Das tote Kind und die Musik
„…doch will ich alles wissen“
Was ist ein Universalgenie? Am Beispiel Leonardos da Vinci
Groß um jeden Preis
Napoleon: Popanz und Ikone
Die Faust im Nacken
Eine kurze Geschichte des deutschen Kolonialismus 1871 bis8
Verständige Weiber
Aus der Frühzeit des Kampfs um die Rechte der Frau
Auf alten Pferden lernt man reiten
Die Quadriga – Mythos und Nationaldenkmal
Wolle im Gesicht
Über den Bart
Die Weisheit der Einfältigen
Über Narren
Ich glaube, zum Wissen gehört, dass es sich zeigen will und sich mit einer bloßen verborgenen Existenz nicht begnügt. Gefährlich scheint mir das stumme Wissen, denn es wird immer stummer und schließlich geheim und muss sich dann dafür, dass es geheim ist, rächen. Das Wissen, das in Erscheinung tritt, indem es sich anderen mitteilt, ist das gute Wissen, wohl sucht es Beachtung, aber es wendet sich gegen niemanden. Man schreibt ihm die Eigenschaften des Lichtes zu, die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreiten möchte, ist die höchste, und man ehrt es, indem man es als Aufklärung bezeichnet.
Elias Canetti,
DIE GERETTETE ZUNGE
Vorwort
Auch Bärte kommen vor in diesem Buch, auch, auf Seite 316, Kaisers Bart, der ihm den Titel gab: die Manneszier des Stauferkaisers Friedrich I. – den wir bis heute besser als Barbarossa, Rotbart, kennen – und die des letzten deutschen Kaisers, Wilhelms II. Solche royale Gesichtsbehaarung war keine Kleinigkeit: Sie sollte sprießen und gedeihen als eines unter vielen Zeichen erlauchter Glorie und Hochwohlgeborenheit. Wenn wir uns indes heute „um des Kaisers Bart streiten“ (worüber mehr auf Seite 313 zu erfahren ist), dann geraten wir keineswegs wegen Angelegenheiten aneinander, die schwerwie monarchische Haupt- und Staatsaktionen wögen; dann geht es um Kleinig- und Nichtigkeiten, Bagatellen und Nebensächliches. Dem Gewicht nach irgendwo dazwischen halten sich die Themen der folgenden dreizehn kürzeren und längeren Essays auf. Den ernsten Zeiten ihrer Veröffentlichung angemessen, behandeln manche von ihnen internationale oder persönliche Katastrophen, andere hingegen wenden sich, freudvoller, erfüllenden Beschäftigungsmöglichkeiten des Geistes oder gar dem höheren Humbug zu. Sogenannte große Männer treten auf – Scheusale wie Genies – und starke Frauen auch, dicke Bücherfinden zwischen den Seiten Platz, und bedeutsame Musik wird aus ihnen tönen. Methodische Forschung und strenge Gelehrsamkeit sollen nicht in trockener Schreibart das Wort ergreifen; vielmehr wollen die Texte, die (von zwei Ausnahmen abgesehen, zwischen 2019 und 2022 entstanden) in populärwissenschaftlicher Verständlichkeit mal mehr, mal weniger eingehend, im Einzelnen womöglich fehlbar, im Ganzen jedoch gewissenhaft Schlaglichter werfen auf Menschen und Momente der Kulturgeschichte, auf Schauplätze und Schubkräfte der Kultur. Worüber dabei erzählt wird, scheint teils lang vergangen, behält aber trotzdem sein Anrecht auf Interesse. Über alle Stoffe dieses Buchs mag auch andernorts, oft viel ausführlicher und klüger, berichtet werden – „sooo einen Bart“ aber hat keiner von ihnen.
Hof, im Herbst 2022
Die gewaltigste der Welten
Bemerkungen über das Buch, das Lesen und das Schreiben
Nimm und lies!
Das Buch des Lebens ist mit nur vier Buchstaben geschrieben: A – T – C – G. Für Adenin und Thymin, Cytosin und Guanin stehen die Lettern. Und nicht mehr als zwei Wörter können die Buchstaben bilden: Ausschließlich in den Paarungen A mit T und C mit G treten die vier Moleküle auf. In uns Menschen wie in allen, selbst den kleinsten Lebewesen formen sie die Sprossen der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, des submikroskopischen, doppelt in sich verschraubten Riesengebildes in den Zellen, auf dem lückenlos alles aufgeschrieben steht, was unsere höchst komplexe Leiblichkeit von der abrieselnden Hautschuppe bis zum Wunderwerk unseres Gehirns ausmacht.
Mit so viel Beschränkung in der Natur hält unsere menschliche Einfallskraft schwerlich mit. Auf über sieben Mal so viele Buchstaben müssen deutschsprachige Autorinnen und Autoren zurückgreifen: Wenn man die drei Umlaute und das Eszet mitzählt, sinds dreißig. Je nach Kulturkreis dürfen es auch mehr oder weniger sein: Mit 74 Schriftzeichen lernen die Khmer in Kambodscha umzugehen; mit lediglich elf kommt das Rotokas aus, mit dem sich gut viertausend Bewohner der pazifischen Salomonen-Insel Bougainville verständigen.
Aber bleiben wir im eigenen Land. Seit mindestens zwölf– bis dreizehnhundert Jahren ernährt es unsere Köpfe redlich mit einer nicht mehr zu überschauenden Masse an Literatur unterschiedlichster Anlässe und Anliegen, Umfänge und Qualitäten. Wer rät uns wozu, und warum? So einfach wie Augustinus, dem noch ziemlich frühchristlichen Bischof von Hippo, wird es uns nicht gemacht. Als 31-jähriger Intellektueller strebte er nach geistiger und geistlicher Orientierung, nach Sinn und Ziel seines weiteren Lebens, als ihn im Jahr 386 die Stimme eines arglos spielenden Kindes unverhofft auf Schrift und Buch, nämlich die Heilige Schrift der Bibel, des Buchs der Bücher, verwies: „Tolle! Lege!“ (so berichtete Augustinus später in seinen BEKENNTNISSEN) rief das Kind seinen Kameraden zu, „Nimm und lies!“ Da griff er nach einer scheinbar x-beliebigen Schriftrolle aus Papyrus oder Pergament – denn „Bände“, gebundene Bücher im heute gebräuchlichen Wortsinn, kamen erst im fünften Jahrhundert auf –, und was ihm dabei in die Finger geriet, war der RÖMERBRIEF des Apostels Paulus. Dort stieß sein wahlloser Blick auf eine Stelle, die ihm riet, aller Maßlosigkeit abzuschwören, den leiblichen Begierden zu wehren und den „Herrn Jesus Christus anzuziehen“. So konnte aus dem Gottsucher mit der Vorgeschichte eines Genussmenschen doch noch ein Heiliger und Kirchenvater der katholischen Christenheit werden.
Nun rangiert zwar die Bibel auf Platz eins der am häufigsten gedruckten und am weitesten verbreiteten Bücher der Welt, doch verlangen die wenigsten Druckwerke von uns, wie Augustinus zu Asketen zu werden. Überhaupt gelingt es einer vergleichsweise verschwindenden Zahl von Büchern, uns überhaupt unter die Augen zu kommen: 2019 erschienen etwa 70.400 Neuveröffentlichungen allein auf dem deutschen Markt, 2020 waren es mit 69.200 geringfügig weniger – wer kennt die Titel, nennt die Namen der Verfasserinnen und Verfasser? Im Jahr 2017 fluteten gar stolze 86.000 Neuerscheinungen den Handel. Die Statistik umfasst Broschüren von achtzig oder 120 Seiten ebenso wie schwergewichtige Wälzer von acht- oder dreizehnhundert. Manche Seite nimmt elegant mit dreißig Druckzeilen vorlieb, auf anderen drängen sich unübersichtlich 42 oder mehr. (In diesem Buch sinds meist gefällige 32.) Etwa dreihundert Wörter fassen wir – vorausgesetzt, wir sind durch regelmäßige Lektüre geübt – je Minute auf, mithin fünf Wörter pro Sekunde, je nachdem, wie lesefreundlich uns das Druckbild entgegenkommt und, vor allem, welche Hindernisse der Text unserem Verständnis in den Weg stellt.
Jeder Blick in die Buchempfehlungen der Zeitungsfeuilletons, erst recht jeder Besuch einer Bibliothek, aber auch schon der Blick, der über die Regale unserer eigenen Buchbestände schweift, scheint uns aufzufordern: „Nimm und lies!“; und uns zugleich abzustoßen: Du kannst lesen, so viel und lang du magst, du wirst günstigstenfalls das Eingangstor zur Welt der Literatur passieren und höchstens ein paar Schritte weit in ihr Reich vorstoßen. So betrachtet – freilich: nur so betrachtet –, wird das Riesenangebot des Geschriebenen uns nicht bloß einschüchtern, sondern erschlagen. Sollen wir aus zwei oder drei Titeln einen für uns auswählen, entscheiden wir uns vielleicht geschwind; reihen sich zweihundert oder zwanzigtausend vor uns auf, greifen wir verschreckt womöglich nach keinem einzigen. Für den Dichter Heinrich Heine war „von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, die der Bücher die gewaltigste“. Wir haben allen Grund, sie zu bestaunen; aber sie kann uns bremsen, lähmen, niederzwingen.
Jedoch, wo uns das widerfährt, sitzen wir einem Missverständnis auf. Nicht als Meer zahlloser geschlossener Buchblöcke zwischen doppelt so vielen Buchdeckeln breitet sich jene Welt vor uns aus, sondern sie tut es im Buch, in jedem einzelnen, sobald wir es öffnen oder als E-Book digitalisiert auf Bildschirm oder Display laden. „Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne“: Schöner, zudem treffender als Jean Paul, der besessene Bücherexzerpierer, Bücherschreiber und Büchernarr, kann mans nicht sagen. Und jede dieser „Welten“ gehört jedem von uns ganz allein, weil ein jeder kraft seiner unaustauschbar vielschichtigen Eigenheiten einen Text zwangsläufig ganz individuell und also anders wahrnimmt, deutet und begreift als irgendein anderer. Schon jedes simple Wort unserer sich aus gerade mal dreißig Buchstaben formierenden Sprache versteht und gebraucht jeder auf seine eigene Weise. Ein Wunder, dass unserer Verständigung mit- und unserem Verständnis füreinander die Kraft nicht ausgeht.
Eine Chance, von uns für gut befunden zu werden, geben wir einem Buch überhaupt erst dann, wenn wir annehmen dürfen, es in Inhalt und Form einigermaßen begreifen zu können. Dann öffnen wir uns als Leser mit derselben Haltung, aus der heraus Jean Paul seine Bücher schrieb: Er verfasste sie wie „Briefe an Freunde“, nur eben wie „dickere“. Natürlich bleiben einem, wie im Leben überhaupt, auch beim Lesen Enttäuschungen nicht erspart, bei Büchern aber lassen sie sich recht leicht verkraften, hat doch, wie der britische Dramatiker John Osborne trostreich vermerkte, „auch das schlechteste Buch seine gute Seite: die letzte“.
Ob gut, ob schlecht: Von der literarischen Qualität eines Manuskripts hängt sein Erfolg auf dem Buchmarkt erfahrungsgemäß nur teilweise ab. Um dessen Launenhaftigkeit zu belegen, liefert das besonders unberechenbare Phänomen des Bestsellers ein prägnantes Beispiel. Für ihn gibt es zwar keine verbindliche wissenschaftliche Definition, Verlage und Handel setzen den Begriff jedoch zumeist ein, sobald hunderttausend Exemplare eines Titels verkauft worden sind; ein Wert, der folglich lediglich das Interesse der Kunden abbildet. Übrigens gibt es das Lehnwort Bestseller länger als man denken sollte: Seit 1889 ist es belegt, 1895 erschien in den Vereinigten Staaten erstmals eine „Bestsellerliste“. Die des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL beeinflusst das Branchengeschäft hierzulande stark.
Als Musterstück darf etwa DER NAME DER ROSE gelten, der von vielen Codes durchzogene Mittelalter-Kriminalroman des italienischen Semiotikers Umberto Eco. 1980 kam er als IL NOME DELLA ROSA in Mailand heraus und wurde seither zigmillionenfach in aller Welt verkauft. Doch noch 1982 wollte nicht jeder Fachmann an einen Triumph glauben. Für lächerliche fünfzehntausend Euro hätte der Suhrkamp-Verlag die deutschen Übersetzungsrechte kaufen können – und schlug sie aus. „Das war Pech“, gab später das Lektorat zu, wahrscheinlich habe niemand im Premium-Haus das Original gelesen. Stattdessen griff Hanser zu und machte ein grandioses Geschäft.
Die fatale Fehleinschätzung erinnert an eine ganze Reihe von Autoren, die ausersehen waren, berühmt zu werden, obwohl zunächst Verlage reihenweise nichts von ihnen wissen wollten. Der geläufigste Fall: die Streiche des Zauberlehrlings Harry Potter – zum Schluss siebenbändig, in etwa siebzig Sprachen übersetzt, über eine halbe Milliarde Mal verkauft. Der einstigen Sozialhilfe-Empfängerin Joanne K. Rowling beschied der Hype ein Vermögen, größer als das der royalen Windsors. Dabei druckte der kleine Verlag Bloomsbury 1997 vorsichtig erst einmal nur hundert Exemplare von Band eins, und auch die nur, weil das achtjährige Töchterchen des Verlegers als Erstleserin dem skeptischen Papa verzaubert dazu riet. Mindestens acht Verlage hatten zuvor Nein gesagt.
Über die Häufigkeit von Ablehnungen berichtet die Mythologie des Buchmarkts oftmals wenig glaubhaft. Mehr als tausend Absagen will der US-Amerikaner Ray Bradbury Anfang der Fünfzigerjahre mit FAHRENHEIT 451 erhalten haben. Petra Hammesfahr erzählt von 159 Zurückweisungen, bis das Haus Rowohlt ihre SÜNDERIN akzeptierte, die ihr 1999 den Durchbruch bescherte. Sieben Jahre zuvor hatte SCHLAFES BRUDER reißenden Absatz gefunden; nur dass 24 Verlage das Buch vordem dankend an Robert Schneider zurückgeschickt hatten, bis sich Reclam in Leipzig erbarmte – und die Nebenrechte alsbald profitabel in alle Welt veräußerte. Sehr ähnlich erging es Patrick Süskind mit seinem tödlich duftenden, schließlich von Diogenes in Zürich edierten PARFÜM, dem Überraschungshit des Jahres 1985; neun Jahre lang führte der SPIEGEL es auf seiner Bestsellerliste. Sogar PIPPILANGSTRUMPF geriet für die Schwedin Astrid Lindgren zur schweren Geburt: Im Verlag Bonnier graute dem Chef vor der anarchischen Titelheldin bei der Vorstellung, was wohl geschähe, „nähmen sich Kinder diese Göre zum Vorbild“; fügsam entschärfte Lindgren die Abenteuer, überließ sie dann aber trotzdem einem anderen Verlag. Den Griff zur Schere verweigerte hingegen Thomas Mann: Als er 25-jährig die weit mehr als tausend Manuskriptseiten seiner BUDDENBROOKS dem Verleger Samuel Fischer offerierte, fand der sich zwar zur Veröffentlichung bereit, aber nur, wenn der noch fast namenlose Jungdichter sein Werk um die Hälfte kürze. Mann blieb mannhaft – und das Buch erschien in der Urgestalt. Eine Zeit lang verbreitete es sich, wie befürchtet, zögerlich, dann umso rascher und trug seinem Verfasser den Nobelpreis ein. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Immer wieder ergeben sich Anlässe, die Kompetenz der Publizistenzunft und der Verlagsbranche anzuzweifeln. Sie auszutesten, wagte 1968 die Redaktion der Satirezeitschrift PARDON. Zum Versuchsobjekt erkor sie Robert Musils MANN OHNE EIGENSCHAFTEN, der es nach seiner Veröffentlichung 1931 und 1933 zwar nicht zum Bestseller per definitionem brachte, aber schon früh als einer der wichtigsten deutschsprachigen Romane des zwanzigsten Jahrhunderts firmierte. Aus dem (Fragment gebliebenen) Mammutwerk zogen die Journalisten zentrale Episoden heraus und veränderten die Namen der Figuren, kaschierten behutsam einige wenige allzu verräterische Situationen und tippten die fakeFassung mit der Schreibmaschine ab. Dann schickten sie – unter dem Verfassernamen eines „Technischen Abteilungsleiters“ – die acht Seiten an namhafte Autoren, Rezensenten und Universitätslehrer sowie an Verlage im deutschsprachigen Raum. Von den 46 Adressaten antworteten zehn überhaupt nicht; keiner von den 36 übrigen durchschaute den Streich, keiner erkannte Musil als Autor und die Außerordentlichkeit der Prosa. Als „Unterhaltungsliteratur“ von teils „primitiver Ausdrucksweise“ zerrissen sie die Textprobe und schickten sie, schon mal mit dem Ausdruck der Häme und Verärgerung, zurück; darunter, wohlgemerkt, auch der Rowohlt-Verlag, der Musils Hauptwerk allein vertrieb und gutes Geld damit verdiente.
Der verstörende Vorfall hätte postum den verzweifelten Herman Melville, heute hochgerühmten Klassiker englischsprachiger Erzählkunst, trösten können: Mit Pauken und Trompeten fiel 1850 sein ozeantiefes, teils dokumentarisches Walfänger-Epos MOBY DICK bei der Kritik durch – und wird seither als eine der weltgrößten Prosaschöpfungen und als Wegweiser für den Roman der Klassischen Moderne gefeiert. Den sensationellen Aufschwung erlebt Melville nicht mehr, geknickt endete er als Zöllner. Nicht anders erging es Giuseppe Tomasi di Lampedusa mit seinem einzigen Roman. DER LEOPARD entstand 1954, blieb aber liegen, weil kein Verlagshaus ihn der Veröffentlichung für wert erachtete. 1957 starb der Autor – und wurde im Jahr darauf zum Star, nachdem sein Schriftstellerkollege Giorgio Bassani das Manuskript entdeckt und die Herausgabe veranlasst hatte. 1959 legte man dem Verblichenen den begehrten Strega-Preis gleichsam aufs Grab. Der Neurologin Lisa Genova war das Glück da holder: Für 450 Dollar ließ sie 2009 ihren Erstling STILL ALICE– um eine demente Harvard-Professorin – auf eigene Kosten drucken und verkaufte die Bände aus ihrem Auto heraus. Dann machte das Internet den Roman zum Superseller. An die Verfilmung von 2014 ging gar ein Oscar. Dazu hat es Jean-Jacques Annauds Leinwandfassung vom NAMEN DER ROSE nicht gebracht.
Das Auge liest mit
Wer Linda Genovas Unternehmungsgeist nacheifern will, darf sich darüber freuen, dass ein Druckwerk aus dem Selbstverlag längst nicht mehr zwingend wie die Jahresberichtsbroschüren provinzieller Sport- oder Kleingärtnervereine aussieht. In puncto Erscheinungsbild und Einbandgestaltung, buchbinderischer Stabilität, Güte des Papiers und Drucks halten Veröffentlichungen aus dem book on demand- oder self publishing-Segment problemlos mit den Produktionen nobler Häuser mit, zumindest sofern Durchschnittsanforderungen nicht überschritten werden. Gut so, denn beim Lesen isst das Auge mit (um einen Kalauer zu wagen) und blitzt gern begeistert auf. In anderen Momenten wendet es sich mit Grausen, so, wenn wir auf Dachböden, in Kellern oder Speicherräumen auf Reste der Buchkollektionen unserer Eltern und Großeltern stoßen. Die einen Bände scheinen gut in Schuss, weil haltbar in Halbleder oder Leinen gebunden, andere aber, in schlichten oder schlechten Karton geklebt, wurden morsch oder fielen der Feuchtigkeit von Jahrzehnten zum Opfer, wenn sie sich nicht gar zu breiigen Zerfallsprodukten auflösten. Dann richtet schon der Bucheinband, abgenutzt, ein- oder aufgerissen, speckigfleckig, Moderdüfte von sich gebend, Ekelbarrieren vor uns auf, die wir auch als hartgesottene Verehrer von Gedrucktem und Geschriebenem nicht leicht überwinden.
Dagegen erzählen uns Museen und andere Auffanglager für vergangene Pracht aus der Geschichte der hohen Buchkultur, indem sie uns in sparsam erleuchteten, luftdichten, weil klimatisch austarierten Vitrinen exquisite Handschriften und seltene frühe Drucke zeigen. Oft genug wurden die Hüllen solcher Schaustücke von Silber oder Goldblech zum Glänzen animiert, mit Edelsteinen besetzt, durch eindrucksvoll geschnitzte Holz- oder Elfenbeinreliefs veredelt. Solche Einbände wollen als Kleinod Ehrfurcht erwecken oder durch geprägte Eleganz zum Lesen verführen. Ob Fibel oder Foliant, Bibel oder Bestseller: Wie bei allen Konsumgütern kommt es auch bei Büchern auf die Verpackung an.
Zusätzlich offenbaren Bindung und Hülle, neben künstlerischen und kulturgeschichtlichen Details, Grundsätzliches: Der Buch-Einband veranschaulicht die Idee von etwas Zusammenfassendem, das auch uns als Leser einbindet; der Buch-Umschlag mag auf Heilsamkeit verweisen wie der Umschlag um eine heiße Stirn, ein schmerzhaftes Gelenk; der Buch-Deckel besagt, dass wir es mit einem vielfassenden Gefäß zu tun haben, das wir, um an Substanz, Kern und Gehalt zu gelangen, aufmachen und bei Nichtgefallen wieder schließen dürfen. Zu den zugänglichsten Außenreizen – und zugleich zu den ersten Informationsangeboten für das suchende Auge – gehört der Rücken des Buchs, der bescheiden seinen Inhalt benennt und durch Schmalheit oder Breite dessen Fülle andeutet, auf sympathische Weise: Anders als so mancher unliebsame Zeitgenosse kehrt uns ein Buch im Wandregal den Rücken ja nicht unnahbar zu; der seine lädt uns ein.
Mehr aber auch nicht. Kaum Detaillierteres als den Autorennamen und den Titel gibt er uns kund. Wie also sollen wir, namentlich bei einer Neuerscheinung, ahnen, ob es sich für uns lohnt, ihr unwiederbringliche Stunden unserer Lebenszeit zu widmen, ohne vorher wenigstens andeutungsweise über Stoff und Stil des Werks Bescheid zu bekommen? Da hilft – manchmal – der Klappentext. Ohne Weiteres könnte dies schöne Wort von einem Dada-Poeten oder von einem Unikum wie Christian Morgenstern oder Joachim Ringelnatz erfunden sein, bezeichnet aber durchaus hochsprachlich ein traditionsreiches Werbemittel der Verlage: Bei gebundenen Büchern auf den eingefalteten Klappen des Schutzumschlags, ansonsten auf dem hinteren Buchdeckel stehen Auskünfte über die Verfasserin oder den Verfasser, das Thema, die Schreibart, über weitere Werke oder gewonnene Preise. Nicht selten erheben dabei Medien in kurzen Zitaten die Stimmen, um empfehlend die Leselust zu wecken. So mancher Erzähler, manche Essayistin mag Klappentexte nicht, weil sie nivellierend ein Etikett auf etwas kleben, das sich – mit jedem gesuchten und gefundenen Ausdruck und jedem poetischen Moment mehr – als viel zu differenziert erweist, um sich derart auf das vereinfachen zu lassen, ‚worum es geht‘. Provozierend wirken Klappentexte, wenn ihre Verfasser aufgeblasen den Eindruck eigener Gelehrsamkeit zu erwecken trachten oder prätentiös, bruchstückhaft und verklausulierend den Inhalt vernebeln statt erhellen. Vielleicht empfiehlt es sich, auf einheimische Lektoren jene Maßnahme auszuweiten, die im totalitär regierten Tadschikistan den Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen 2016 blühte: Sie mussten für sprachlich Unverständliches 180 Euro Strafe zahlen.
Für ein altehrwürdiges Buchjuwel in Samt und Seide, Pergament oder Leder, Edelholz oder Elfenbein verbieten sich Profanationen wie ein Klappentext. Einen hohen Bildungsanspruch repräsentiert es, für den einst glanzvolle Bibliotheken als Tempel des Geistes errichtet wurden. Viele alte Buchhüllen haben eine Aura der Vornehmheit gemein, splitternackt kommt im Kontrast dazu das neuzeitliche E-Book daher. Desungeachtet sagt eine Nobelverpackung über den Inhalt so wenig aus wie ein teures haute couture-Kleid oder eine prunkende Hausfassade. „Außen hui, innen pfui“, das gibts bei Büchern auch. Was man dann zwischen zierlichen Buchdeckeln zu lesen bekommt, geht (um noch einen Kalauer zu wagen) zum einen Auge hinein und zum andern wieder heraus. Wo allerdings Inhalt und Schmuck in ihrer Güte in eins fallen, gerade in den „illuminierten“, das sind die durch elaborierte Malereien „erleuchteten“ Handschriften aus dem Mittelalter, da lässt der Text seine Funktion als Lesestoff und die Ausstattung die des bloßen Zierrats weit hinter sich.
Buchschmuck: ein schönes Wort. Zweierlei verbindet es, das Wert besitzt und Freude macht: das Buch als Gefäß für Einsichten, Aufschlüsse, Vergnügen; und den Schmuck als eine Zutat, die das Leben und Lesen verfeinert, ohne unverzichtbar zu sein. Vor die Wahl gestellt, ein preiswert-pragmatisches Taschenbuch oder edel gebundenes Schrifttum, die reine Textversion eines Werks oder eine illustrierte Ausgabe zu erwerben, entscheiden sich Bibliophile nicht ungern für die teurere, ansehnlichere Variante. Denn ein schönes Buch verschönt seinerseits unseren Wohn-, Arbeits-, Lebensraum, über seine literarische oder informationelle Substanz hinaus.
In den Epochen, da Bücher grundsätzlich rare Wertgegenstände, meist Heiligtümer waren – und ihre malerische Auszierung eine Art Gottesdienst –, da verherrlichten die beigegebenen Bilder Episoden aus dem Leben Jesu oder der Heiligen, führten Evangelisten, aber auch weltliche Potentaten in überhöhender Zeichenhaftigkeit vor. Besonders gilt dies für die liturgischen und biblischen Schriftrollen und Codices aus den Jahrhunderten vor der Erfindung des neuzeitlichen Buchdrucks durch Johannes Gensfleisch alias Gutenberg in Mainz ums Jahr 1440.
Der weltberühmten Malschule auf der Klosterinsel Reichenau im Bodensee entstammen unumstrittene Gipfelleistungen der Buchkunst vor allem des zehnten und elften Jahrhunderts. Voller Symbole, oft auf Goldgrund, stecken die erhabenen Darstellungen in den prächtigen Sakramentaren oder Perikopen, Evangeliaren oder Evangelistaren (also den gottesdienstlichen Gebetbüchern und Bibellesen, den vollständigen oder teilweisen Abschriften der neutestamentlichen Evangelien). Obendrein war die Kultur des Mittelalters nicht nur eine der Bilder, auch der Kalligrafie: Die Schrift selbst diente den heiligen Texten zur Zier. Gutenberg strebte nicht danach, die Ästhetik vieler mönchischer Hand- und Schönschriften mit Hilfe seiner beweglichen Lettern zu überbieten; er bezweckte, ihrem faszinierenden Ebenmaß möglichst nahezukommen.
Umso schmerzlicher, wenn dem Urheber das Wort, der Satz gelungen ist, doch seine Reproduktion missrät. Unausrottbar lebt der „Druckfehlerteufel“ fort, mögen auch die Wenigsten von uns noch an den leibhaftigen Beelzebub glauben. Zeugnisse seines satanischen Übelwollens enthält jedes Buch, erst recht jede Zeitung, ungeachtet der Sorgfalt, die Autoren und Redakteurinnen, Lektorinnen und Drucker auf ihr Produkt verwenden.
„Es irrt der Mensch, solang er strebt“, lässt Johann Wolfgang von Goethe in seinem FAUST Gottvater zu Mephisto, dem Teufel, sagen – ein kluger Satz: Irrtum ausgeschlossen. Wir irren zum Beispiel, wenn wir Otto als Vornamen des Bundeskanzlers Scholz vermuten; einen Fehler hingegen begeht, wer den richtigen, Olaf, versehentlich mit zwei 1 statt einem schreibt. Im Buchwesen bezeichnet der lateinische Begriff Erratum das eine wie das andere: einerseits die sachlich-fachliche Falschinformation, etwa eine unzutreffende Jahreszahl oder Ortsangabe, zum andern den falsch gesetzten Buchstaben, das vergessene oder unbeabsichtigt stehengebliebene Wort. Früher pflegte man wichtigen Büchern Listen der Errata beizugeben, die sich in sie eingeschlichen hatten: Um getreulich bis zum Schluss der Wahrheit die Ehre zu geben, enthielten die Verzeichnisse Richtigstellungen von Mängeln, die erst unmittelbar vor Auslieferung des fertig produzierten Titels aufgefallen waren. Dergleichen ist heute kaum mehr üblich, gleichwohl pfuscht der „Druckfehlerteufel“ weiter der Gattung Printprodukt ins Handwerk. Tut ers, wie viele jammern, heutzutage schlimmer als einst? Er tat es immer, und nach Kräften. Als Beleg mag ein tausendseitiges, erstmals 1869 erschienenes Standardwerk des Wiener Gelehrten Gustav Roskoff dienen: Bevor der Leser in den beiden Bänden den jeweils ersten Satz lesen darf, bitten ihn Register um Nachsicht, die keineswegs unmaßgebliche „Berichtigungen“ aufführen, zum Beispiel: „statt: Schriftstellern, lies: Kirche.“ Titel des Standardwerks: GESCHICHTE DES TEUFELS.
Nichts und niemand von uns ist perfekt. Doch ist das Buch imstande, zu unserer Optimierung beizutragen. So wie Schmuck das Buch adelt und veredelt, schmücken wir uns mit dem Buch. Unter den mancherlei Möglichkeiten, Wohnungswände herauszuputzen, halten bis heute wenigstens ältere Bildungsbürger Bücher (zusammen mit CDs) für die ansehnlichste. Dabei dürfen sie sich von Hermann Hesse bestätigt fühlen: Der fand ein Haus ohne Bücher „arm, auch wenn schöne Teppiche seine Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken“. Ob nun die Bände in den Borden geordnet neben- oder genialisch durcheinander stehen, sie schinden bedeutsam Eindruck; ob verdientermaßen oder nicht – eine wohlbestückte Privatbibliothek stellt dem Bewohner das Zeugnis aus, ein informierter Kopf und kultivierter Zeitgenosse zu sein.
Indes kennt wohl jeder, der Bücher liebt, das lustvolle Problem: Liebend gern kaufen wir mehr von ihnen, als wir lesen können. Macht nichts. Denn in den Bücherregalen, die uns daheim umgeben, lagert ja nicht einfach zentnerweise bedrucktes Papier. Sondern als Nachbarn wohnen die vielen Bände bei uns, als Informanten, Herausforderer oder Widersprecher, Realisten und Fantasten, Fluglehrer oder Tiefbohrer – von ein paar Ausnahmen abgesehen lauter wohlgelittene Gefährten. Gern führen wir den durch Jahre gepflegten und vermehrten Schatz Besuchern vor und genießen ihr Staunen: „Was? So viele? Hast du die alle gelesen?“ Müßige Frage: Auch Regalböden sind Bretter, „die die Welt bedeuten“. Einer Rechnung des Schriftstellers und besessenen Schmökerers Arno Schmidt zufolge schaffen es nicht einmal die hartnäckigsten Leser während ihres, sagen wir: 75 Jahre währenden Lektüre-getriebenen Lebens, mehr als allerhöchstens fünftausend Bücher zu verschlingen. Und selbst, wenn wir das zu leisten vermögen, entscheiden wir uns doch mit unserer individuellen Auswahl gegen ganze Bibliotheken voller anderer Bücher, die wir notgedrungen links liegen lassen, obwohl sie unserer Aufmerksamkeit womöglich ebenso wert wären oder sie noch mehr lohnten.
Aber muss uns das verunsichern? Wohl nicht. Der Platz vor der Bücherwand, wo die Qual der Wahl süßen Druck auf uns ausübt, ist ein Ort vollkommener Freiheit. Zu welchem Band greifen wir als Nächstes: zu diesem? Oder zieht uns jener Rücken doch mehr an? Oder greifen wir zurück auf ein Werk, das wir schon einmal durchquerten? Dass wir kaum mit einem Minimalbruchteil von der Welt des Geschriebenen und Gedruckten vertraut werden, dieser Gedanke soll uns nicht schrecken.
Papier ist nicht von Pappe
Über Schrift verfügen die Menschen seit mindestens fünftausend Jahren, über Kleinbuchstaben die Deutschen erst seit zwölfhundert. Ums Jahr 800 kam die „Karolingische Minuskel“ auf, die der handverlesenen Schar der Schreibkundigen in den klösterlichen Skriptorien eine bis ehedem ungekannte Flüssig- und Geschwindigkeit im Verfertigen ihrer Kunst bescherte. Von 1838 an entschieden sich die Brüder Grimm in ihrem DEUTSCHEN WÖRTERBUCH für die konsequente Kleinschreibung. Seither kämpfen deren Verfechter unermüdlich, wiewohl fruchtlos für ihre generelle Einführung.
Mancherorts setzte sich eine andere Art von Kleinstschreibung durch, die sich nicht dem freien Wort und Geist verdankt. Im Fall des Schweizer Dichters Robert Walser ging sie aus einer psychischen Krise hervor: Zwischen 1924 und 1933 bedeckte er ein „Bleistiftgebiet“ von über fünfhundert Schreibblättern mit sogenannten Mikrogrammen, dramatischen Szenen, Lyrik- und Prosastücken auf kerzengeraden Zeilen in winzigster Schrift fast ohne Korrekturen. Bis weit nach seinem Tod im Schnee 1956 hielt man die Notate für undechiffrierbar; dann gelang es drei geduldigen Forschern, sie zu transkribieren: „Was ich schreibe, wird vielleicht einmal ein Märchen sein …“ Zu denken ist hier auch an den Marquis de Sade, der, 1785 in der Pariser Bastille einsitzend, auf einer zwölf Meter langen Papierrolle den brutalpornografischen Roman DIE 120 TAGE VON SODOM verfasste, in eng gesetzten Zeilen und in Chiffren, die aussehen wie die schmutzigen Hinterlassenschaften des die Zelle bevölkernden Ungeziefers.
Gebräuchlicher findet sich Kleinstschreibung in den Botschaften von Gefangenen, denen zu schreiben verboten war und ist und die es also heimlich tun müssen. Wenn sich Häftlinge unerlaubt miteinander oder mit der Außenwelt schriftlich in Verbindung setzen, so heißt das Medium Kassiber: eine Nachricht meist auf Papierfetzen in beinah unsichtbaren Minuskeln. Aus dem Rotwelsch, dem Jargon der Gauner, kommt das Wort, das im hebräischen kethibha (das Geschriebene) wurzelt. Für Verbrecher – oder solche, die dafür ausgegeben wurden –, auch für von den Nationalsozialisten internierte Juden waren derlei Miniatur-Episteln nicht selten die einzige Chance, sich eine Freiheit herauszunehmen, die ehrbare Schreiber für die höchste halten: die Wahrheit mitzuteilen. Wo sich der denkende Mensch, sozusagen entzivilisiert, auf sein Ursprüngliches zurückgeworfen sieht, ist ihm Papier als Lebensmittel unerlässlich wie Nahrung, Kleidung, ein trockener Schlafplatz. In Verliesen überall auf Erden, in den Gefangenenlagern aller Kriege, erst recht in den Gulags der Diktaturen kursieren Kassiber, will heißen: Auch im Geheimen, allen Verboten und Bedrohungen trotzend, besteht der Verstand auf Kommunikation.
Das Mädchen Anne Frank, im Versteck seiner Familie in der Amsterdamer Prinsengracht 263, verdankt dem Papier seines Tagebuchs, dass es im Bewusstsein von uns erschütterten Nachgeborenen überdauert als Alltagszeugin des Holocaust, dem es fünfzehnjährig 1945 im KZ Bergen-Belsen zum Opfer fiel. Die Geschichte solchen stummen Schreibens unter der Hand verweist allgemein auf die einstige Exklusivität von Beschreibstoffen und speziell auf den unterschätzten Wert des Mediums Papier als des heute mit weitem Abstand weltweit gebräuchlichsten. Vor fünftausend Jahren gruben die gelehrten Schreiber Mesopotamiens ihre Keil-Siglen mit Griffeln in kleine, weiche Kissen aus Ton. Andernorts waren Leisten aus Holz oder Horn und nicht zuletzt Stein ausersehen, Schriften und Inschriften aufzunehmen. Als Quellen dienen Altphilologen, -historikern und Archäologen heute zumeist Schriftrollen, die aus zweilagig miteinander verleimten Streifen aus dem Mark des Grases Cyperus papyrus bestehen und darum der Einfachheit halber selbst Papyri heißen. (Dass de Sade seinen sodomitischen Skandalroman zwar auf Papier abfasste, aber wie einen langen Papyrus zur Rolle aufwickelte, ist der Heimlichkeit auch dieses Schreibprozesses und dem Fehlen jeder buchbinderischen Option geschuldet. Und dass ausgerechnet dieses Manuskript, dem man ohne Prüderie eine gewisse Unappetitlichkeit nachsagen darf, stark an eine Rolle Toilettenpapier gemahnt, zählt zu den Treppenwitzen der Literaturgeschichte.) Antike Kaufleute, Dichter, Verwaltungsbeamte hielten, was sie nicht vergessen durften, zwischendurch – und später löschbar – gern auf holzgerahmten, zusammenklappbaren Wachstäfelchen fest. Im Mittelalter kam gebeizte und reingeschabte, getrocknete und in gleichgroße Blätter geschnittene, dünne Tierhaut in Gebrauch, das Pergament, das sich, anders als die Papyri, falten und folglich zu Büchern binden ließ.
Seit weit über zweitausend Jahren also speichern wir Menschen unser Wissen irgendwie im Format „schwarz auf weiß“. Indes tragen wir, „was man schwarz auf weiß besitzt“, schon lange nicht mehr nur auf dem Papier „getrost nach Hause“. Der herzhafte Studiosus, der in Goethes FAUST dies sprichwörtlich gewordene Bekenntnis zum Manuskript, zur Handschrift im ursprünglichen Sinn ablegt, er würde sich in seinen Nachfahren nicht wiedererkennen. In Hörsaal, Seminarraum, Bibliothek packen Schülerinnen und Studenten der Gegenwart kaum noch Heft und Stifte aus. Vorlesungen mitzuschreiben, Hausarbeiten abzufassen, Stunden- und Studienpläne zu erstellen, Quellen aufzuspüren, Dokumente auszutauschen – das alles machen elektronische Hilfsmittel ihnen so leicht wie noch keinem Kopfarbeiter vor ihnen. Notebook oder Netbook, Tablet oder I-Pad und allemal Smartphone heißen die Zauberdinge.
Zeitgenossen, die lieber am Display oder Bildschirm lesen, als ein Buch zur Hand zu nehmen, luden allein in Deutschland während des Jahres 2020 fast 36 Millionen E-Books für jeweils durchschnittlich 6,45 Euro aus dem Netz; 2021 übersprangen sie vermutlich die Vierzig-Millionen-Marke – während sie sich zehn Jahre zuvor noch mit 4,6, im Jahr 2010 gar mit nur 1,9 Millionen Downloads begnügten. Automatisch empfehlen E-Mail-Programme ihren ökologisch mitdenkenden Nutzern, von Fall zu Fall zu prüfen, ob eine Nachricht ausgedruckt werden muss. Der Kosten und wohl auch der Umwelt wegen üben immer mehr Unternehmen Verzicht in „papierlosen Büros“. Papierfabrikanten, Verlage und Schreibwarenverkäufer, Buchhändler und -binder, Restauratoren, Bibliotheken und Archive müssen sich neu definieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten durchläuft die 1650 in Leipzig erfundene Tageszeitung, heutzutage schwarz und farbig auf weißem Papier gedruckt, ihre tiefste Krise, bedroht von fremden wie eigenen Online-Angeboten: Die Zukunft des Printprodukts als Morgengabe zum Auseinanderfalten und Aufschlagen steht in den Sternen.
Hat also das Papier als Aufbewahrungsort für Geistiges, Kreatives, Künstlerisches demnächst ausgespielt? Bleibend unentbehrlich macht es sich den Menschen heute als Helfer bei der Entsorgung abstoßender Körperausscheidungen, auf der Toilette, als Babywindel oder Taschentuch. Dabei stand es durch Jahrhunderte, in denen sich unsere Ahnen durch die Finger schnäuzten, als Selten- und Besonderheit und Wert für sich, wenn nicht im Ruch eines heiligen Substrats. Daran erinnert heute bestenfalls der Geldschein oder das kostspielige Autograf.
Papier ist aber nicht von Pappe. Im Lauf von 2000 Jahren behauptete es sich als maßgeblicher Schriftträger der zivilisierten Menschheit. Seit bald sechshundert Jahren betreibt die „weiße Kunst“ der Papierherstellung im Verein mit der „schwarzen Kunst“ des Druckens eine zuvor nie dagewesene Demokratisierung durch die Verbreitung von Informationen, Wissen, Bildung. Wenn der Schriftsteller Heinrich Böll einst die „Totenblässe“ des Papiers monierte, so wussten doch gerade er und seinesgleichen, dass eine einschüchternd leere Seite rasch Farbe bekommt durch Gedanken, Worte, Stil.
Von den Chinesen, die schon vor Christi Geburt Papier aus einem Hanf-Brei schöpften und es für eine überweltliche Segensgabe hielten, brachten im achten Jahrhundert die Araber die „weiße Kunst“ nach Spanien und damit nach Europa. Als Grundstoff dienten zunächst hauptsächlich Kleiderlumpen, zerfasert in Papiermühlen, deren erste deutsche 1390 vor Nürnbergs Mauern den Betrieb aufnahm. In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts setzten sich Methoden durch, Holz in Zellstoff und also in Papier zu verwandeln. Den Wäldern in vielen, gerade armen Ländern bekam und bekommt der rasch wachsende Rohstoffbedarf nicht gut. Alljährlichen am 25. April führt unser nationaler Gedenkkalender den „Tag des Baumes“ auf, der Literaten und Leserinnen daran erinnert, dass sich Geist und Kultur der meisten Länder an das hölzerne Baumaterial jener botanischen Klassen binden, unter deren mythischen Vorläufern sich nicht umsonst der Baum der Erkenntnis aus dem Garten Eden findet. Für alles, Heiliges wie Profanes, Beseligendes wie Beleidigendes, Schönes wie Schlimmes bietet sich Papier als stoffliche Unterschicht an. „Ich habe mir“, bekannte der argentinische Literaturnobelpreisträger Jorge Louis Borges, „das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.“ Wer von uns Bücher liebt, sollte auch die Bäume lieben.
Das Wissen der Welt und ihre Geschichte hielten die Menschen auf Papier fest: jede Seite ein Neuron im unüberschaubaren Nervennetz des kollektiven Gehirns. Ein wunderbares Symbol dafür fand Umberto Eco in seinem ROSENRoman: Als Herzzentrum des fiktiven Klosters, darin vordergründig seine krasse Kriminalgeschichte sich ereignet, errichtete er den Turm einer gewaltigen Bibliothek; am innersten Knotenpunkt ihrer labyrinthischen Gänge hockt ein greiser Mönch im Dunkeln, wohlverstanden ein Blinder, der die um ihn herum vollständig versammelte Weltkenntnis des Menschengeschlechts gleichwohl wie mit Argusaugen bewacht. Ein Raum unausmesslicher Wunder, Geistkleinodien, Schöpferkräfte – und freilich als papierenes Gedächtnis von jedem achtlos geschlagenen Funken bedroht. Tatsächlich lässt der Semiotiker Eco, zeichenhaft Feuer legend, jenes Schatzhaus der Abertausend Bände niederbrennen. In der Wirklichkeit soll ein ähnliches Schicksal der legendären Bibliothek von Alexandria widerfahren sein, der umfangreichsten der Antike: Wie, wann und ob überhaupt die kolossale Kollektion mit ihren ungezählten Schriftrollen in einer einzigen Katastrophe unterging, ist und bleibt zwar Gegenstand widersprüchlicher Expertentheorien; einhellig aber beklagen Historiker bis heute ihren unersetzbaren Verlust.
Papier ist nicht von Pappe, doch auch nicht von Dauer. Darum gilt es nicht allein, haltbare Sorten zu entwickeln, sondern zugleich Bücher und Manuskripte, sofern Zerfall sie bedroht, für künftige Generationen zu bewahren – durch Konservierung des Materials; ferner durch ihre elektronische Speicherung. Beste Dienste leisten dabei mobile digitale Datenträger, allerdings ist auch Festplatten, CD-ROMs und DVDs, Speichersticks und -karten kein ewiges Leben beschieden, weswegen sich die Datenmassen, gleichsam schwebend, zunehmend in Clouds verteilen. Erweisen muss sich noch, dass sie sich dort nicht irgendwann, wie wirkliche Wolken, in Luft auflösen.
Hat Papier also seinen Sinn und Wert verloren? Das bestreiten Leserinnen und Leser der reinen Lehre entschieden und unternehmen alles, die Ehre des erprobten Schwarzauf-Weiß zu retten und ihm Überlebensrechte einzuräumen: der Bücherfreund als ‚Papier-Tiger‘. Dies Wort, so verstanden, verspottet nicht länger einen aufgeblasenen Schwächling, sondern zeichnet jeden aus, der mit Zähnen und Klauen am geliebten Grundstoff festhält. Ein gutes Buch – mit Seiten, Einband, Umschlag zeitlos ein Genuss – lässt sich mit Gewinn noch in hundert Jahren lesen; derselbe Inhalt, nüchtern auf einem Stick, in einem Kindle verstaut, aus der Cloud gezapft, auch? Die Hoffnung ist erlaubt, dass, was sich bewährt, auch bleibt oder wiederkommt. Papier ist geduldig.
Lesen und lesen lassen
Wer auf Bücher nicht verzichten, aber nur möglichst wenig Papier an den Wänden dulden will, erwirbt im Fachhandel oder via Internet die Tapete mit aufgedruckter Bücherwand, wahlweise in „Retro“-Dunkelbraun Marke „Magic Book“ (dem Werbefoto zufolge für ältere Herren) oder in Lifestyle-Weiß (Marke „Büro“, mit junger Frau im Homeoffice), oder einen artgleichen textilen Wandbehang, oder wenigstens ein einschlägiges Türposter. Einer anderen Kohorte von Mitmenschen kommen Bücher zwar gelegen, als Meterware aber, nur zu dem Zweck aufgestellt, die Behausung wie ein Potemkinsches Dorf der Literatur zu inszenieren; wer so handelt, achtet sie nicht höher als die hohlen Attrappen, mit denen Möbelhäuser ihre Stellagen füllen: eine Kulissenoberfläche, hinter der sich vermutlich ein eher schlichtes Gemüt verbirgt.
Es zeigt sich: Man kann Bücher lesen, man kanns aber auch lassen. Mit den umgangenen, vermiedenen und ausgelassenen Büchern setzt sich Julius Deutschbauer auseinander: In Wien – und im Internet – hat der 61-jährige Performance- und Plakatkünstler eine BIBLIOTHEK UNGELESENER BÜCHER versammelt. Bis zum Herbst 2020 kristallisierten sich bei über siebenhundert Interviews als top five heraus: Robert Musils MANN OHNE EIGENSCHAFTEN mit 22 Nennungen auf Platz eins, gefolgt von James Joyce und seinem ULYSSES, der Bibel, Marcel Prousts gigantischem fin de siècle-Panorama AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT sowie dem KAPITAL von Karl Marx und Adolf Hitlers MEIN KAMPF, beide mit jeweils zehn Nennungen auf dem fünften Platz. Auch Ratschläge, wie in gebildeten Kreisen über Ungelesenes überzeugend geplaudert werden könne, hat Deutschbauer parat: „Sprechen Sie am besten sehr fantasievoll“, empfiehlt er. „Sie müssen nicht die Handlung referieren. Erzählen Sie stattdessen eine eigene Geschichte, formulieren Sie Ihre Mutmaßungen über den Inhalt und Ihre Vorstellungen vom Autor.“
Wers ernster meint mit dem Lesen, wer also Bücher nicht bloß einreiht, sondern auch zur Hand nimmt, setzt sich beständig unter Druck: kommt er doch mit dem Lesen nie nach. Trösten darf er sich damit, dass er durch seine Zukäufe einer Branche einen Dienst erweist, die sich schwertut. Seit 1998 erteilt die JIM-Studie – die Abkürzung steht für Jugend, Information und (Multi-)Media – Auskunft darüber, welche Medien junge Leute zwischen zwölf und neunzehn Jahren im Lande nutzen oder inwieweit sie es unterlassen; fürs Jahr 2021 ermittelte der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest in Zusammenarbeit mit dem SÜDWESTRUNDFUNK, dass nicht einmal mehr ein Drittel – nämlich 32 Prozent – der Jugendlichen regelmäßig zum gedruckten Buch greift; bei der ersten Erhebung waren es noch 44 Prozent. Am bibliophilsten zeigten sich die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Umgekehrt erhöhte sich seit 2020 die Zahl der bekennenden Nichtleser: von fünfzehn auf achtzehn Prozent. Das war übrigens nicht immer so, gab es doch (zugegeben ferne) Zeiten, in denen ungezügelte Leselust unter jungen Leuten für ein Laster galt und bekämpft wurde, namentlich auf dem Land, wo sich weit weniger sinnvolle Möglichkeiten zu abwechslungsreicher Freizeitbeschäftigung fanden als in den Städten.
Dem schwindenden Vergnügen an beständiger Lektüre wollen alljährlich die Aktivisten zuwiderhandeln, die seit 1995 immer am 23. April den „Welttag des Buches“ feiern. Die Auswahl des Datums verdankt sich dem Schöpfer des DON QUIJOTE, Miguel de Cervantes Saavedra, und zugleich dem englischen Dramatiker und Lyriker William Shakespeare, denn lange hielt die gelehrte Welt an der Einbildung fest, beide Klassiker seien im Jahr 1616 an ein und demselben Tag, eben dem 23. April, gestorben. Was nicht zutrifft: Cervantes tat bereits tags zuvor den letzten Atemzug; und Shakespeares Geist verließ die Welt zwar am Stichtag, der jedoch in Spanien bereits der 3. Mai war, weil das Land damals nicht mehr nach dem antiken julianischen Kalender rechnete, sondern nach dem gregorianischen der Neuzeit.
Gleichviel – nichts hängt am Datum, an Wort und Schrift alles. Global tauglich dient der „Welttag des Buches“ als offizieller Anlass, das Lesen, die Leserschaft, das stets greifbare und doch letztlich unbegreifliche Wunder des bedruckten Papiers zu feiern. Und das des beschrifteten Computeroder Reader-Displays. Ganz zu Recht zwar hegen Leser, Handel und Verlage schon immer sorgenvoll Bedenken angesichts einer seit jeher schwierigen Urheberrechtslage und wegen der immer unüberschaubareren Masse von digitalisierten Titeln, die sich jederzeit von jedem kostenlos abrufen lassen, darunter allerlei Ausgaben der Bibel genauso wie MEIN KAMPF und DAS KAPITAL. Allein GOOGLE BOOKS scannte bis 2019 mehr als vierzig Millionen Publikationen in über vierhundert Sprachen ein. Den Normalbürger kann es trotzdem erst einmal freuen und den Kulturpessimisten besänftigen: Auf welche Art von Datenträger auch immer gebannt – Papier, Hörbuch oder Server –, das geschriebene Wort zählt noch was. Wahrscheinlich hieße der „Welttag des Buches“ treffender „Welttag des Lesens“.
Nebenbei bemerkt bricht, wer das Lesen als intime Beschäftigung – nicht zuletzt mit sich selbst – schätzt und betreibt, mit einer vermutlich jahrtausendelangen Tradition. Leises Lesen kam frühestens im Mittelalter auf. Zuvor lasen in vielen Kulturen die Menschen laut, sich selbst und naturgemäß auch anderen vernehmlich. Folglich lasen sie bedeutend langsamer als wir heute, die wir, wie Wissenschaftler beobachteten, mit unseren Augen etwa im selben Rhythmus über den Text streifen, in dem unser Gehirn gesprochene Sprache verarbeitet. Auch glauben Experten nachweisen zu können, dass mit dem Erwachen der Schrift spätestens vor sechs- bis fünftausend Jahren im Zweistromland die Wahrnehmungsfähigkeit der Spezies Mensch ganz allgemein wuchs. Das mag damit Zusammenhängen, dass ein Text und das Gehirn, als Textur, in ihrer Mehrdimensionalität prinzipiell vergleichbar sind. Zwar übertrifft das Zerebrum mit seinen etwa hundert Milliarden Nervenzellen und hundert Billionen synaptischen Schaltstellen das wortreichste und komplizierteste aller denkbaren Bücher in astronomischem Maß; dennoch steht, so wie jede Nervenzelle, auch jedes Wort im Buch nie nur für sich, sondern gibt seine augenblickliche Bedeutung erst im Kontext mit vielen, ja allen anderen Wörtern und Sätzen, mit ihren Ursache-Wirkung-Zusammenhängen, der gedanklichen Chronologie, dem argumentativen Diskurs oder der erzählerischen Dramaturgie preis. Im Gehirn bildet sich das Netzwerk, materiell und mikroskopisch sichtbar, durch die sich zahllos verästelnden Fortsätze der Nervenzellen, in der Literatur liegt es unstofflich unter dem Text und zwischen den Zeilen. Erst durch solches Höchstmaß an Konnektivität dockt ein Text an die Wirklichkeit an, nicht anders als es unser Gehirn, wenngleich ungemein vielschichtiger, mit der Außenwelt tut. Als eines der Mysterien unseres Verstandes darf gelten, dass er in der Lage ist, sich eine erfundene Wirklichkeit und Außenwelt auszudenken, eine, die nicht der Realität entspricht, wohl aber in die wirkliche Welt vorzudringen vermag; ganz real ruft auch sie in uns Menschen unsere Grundgefühle der Freude und Trauer, des Zorns und der Angst, des Ekels und der Überraschung hervor, allein durch das offen erzählende oder lyrisch verschlüsselnde, jedenfalls das gesprochene und geschriebene Wort.
Um Kraut und Rüben der gleichmäßig übers Jahr verteilten bibliophilen Ehrentage fett zu machen, haben die Wochenzeitung DIE ZEIT, die Stiftung Lesen und die Deutsche-Bahn-Stiftung den dritten Freitag im November jedes Jahres zum „Bundesweiten Vorlesetag“ deklariert und halten ihn seit 2004 mit allerlei löblichen Aktivitäten hoch. Dann darf jeder, der sich berufen fühlt, ausschwärmen, um in Kitas und Kindergärten, Schulen, Büchereien und Buchgeschäften aus kind- und jugendgerechten Werken vorzutragen. Besonders gern machen sich dabei Prominente verdient. Tags darauf kann man dann die Presseberichte über ihre Auftritte wiederum den solcherart bespaßten Kids vorlesen. Was naturgemäß bevorzugt im Elternhaus geschieht: Viele von uns, die als Kinder Erwachsenen beim Lesen zusahen, wurden später selbst zu Lesern – erst recht solche, denen mit Verstand und Herz vorgelesen wurde.
Seit 2007 kommt aus derselben Quelle, immer drei Wochen vorher, die jährliche „Vorlesestudie“ heraus. Erwartungsgemäß weist sie, seit Jahren ziemlich gleichbleibend, sowohl Befriedigendes als auch Bedenkliches aus. Zum Beispiel: Bis zu vierzig Prozent der Eltern nehmen selten oder nie ein Buch zur Hand, um dem Nachwuchs daraus vorzulesen oder ihm die zu den Bildern passende Geschichte zu erzählen. Immerhin besagt dies auch, dass die deutliche Mehrheit von bis zu zwei Dritteln dergleichen zu tun pflegt. Viele von denen, die es bleiben lassen, nennen als Grund, dass ihnen Beruf und Haushalt für derlei Gefälligkeiten weder Kraft noch Zeit ließen. Andere Eltern reden sich damit heraus, sie verstünden nicht gut vorzulesen, oder es sei ihnen unangenehm oder bereite ihnen keine Freude, oder sie hielten es für wenig wichtig, wenn nicht, unter Verweis auf die modernen Medien, sogar für veraltet, oder ihr Kind sei zu unruhig, um aufzupassen, oder wolle gar nicht vorgelesen bekommen oder sei noch zu jung dafür oder schlafe längst, wenn Mama oder Papa endlich bereit dazu seien. Um Ausreden waren wir noch nie verlegen.
Vielfach versteckten sich die Befragten hinter der irrigen Annahme, das Vorlesen empfehle sich nur bei den Kleinsten und nur, solange sie die Kita besuchten. Wirklich bereitet es dort die wie Schwämme saugstarken Gehirne spielerischunterhaltsam auf die Schule vor. Zugleich aber und in vielen folgenden Jahren schafft und festigt es, in der Familie praktiziert, deren Zusammenhalt und den Austausch zwischen den Generationen. Dabei führt es eine über viele Jahrhunderte gepflegte spezielle Kulturtechnik fort, eine aus den vielen und langen Epochen, in denen kein Kino, Fernsehen und Radio, weder Videospiele noch Streaming-Plattformen zeitvertreibend zur Hand waren. Bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein war das vorgelesene Buch das Mittel der Wahl für (mit Goethes Worten) „Genuss und Belebung oder zur Erkenntnis und Belehrung“, zumal am Abend. Egal, ob bildungsferne Leute zu Geschichten aus Kalendern oder Almanachen griffen oder vornehme Herrschaften einen Band aus den Memoiren des Herzogs von Saint-Simon aufschlugen – einer oder eine aus dem Familien- und Bekanntenkreis trug vor, während die anderen handwerkten oder den Haushalt besorgten, spannen, woben, Handarbeiten machten … Oder einfach nur lauschten.
Wie gründlich dies allerdings auch schiefgehen kann, ist in einer herrlichen Szene aus Wolfgang Staudtes Film ROSEN FÜR DEN STAATSANWALT von 1959 zu besichtigen: Da greift Martin Held als Ex-Nazijurist und strenger Anklagevertreter im westlichen Nachkriegsdeutschland, umgeben von den zur Andacht verdonnerten Seinen, erst zu Fichtes REDEN AN DIE DEUTSCHE NATION, dann doch lieber zu einem Band von Matthias Claudius, um Vaterländisches vorzudeklamieren, wofür er den harschen Ton des weiland Wehrmachtsoffiziers für angemessen hält: „Därrr – Monnt --- ist – aufffgegangen.“ Vergnüglich bezieht sich die Satire, unbeschadet ihrer entlarvenden Schärfe, auf eine dritte geistvolle Kulturtechnik neben dem Umgang mit der Schrift und dem Vorlesen: auf jene, in aller Ruhe die Ohren offenzuhalten. Mal mehr, mal weniger bereitwillig wird das Zuhören gepflegt; weniger zum Beispiel in manchen Fernsehtalkshows, wenn die Diskutanten vor einem Millionenpublikum einander rüde in die Parade fahren. Umso mehr bewährt sich die Tugend, wenn etwa während eines Rezitationsabends ein Sprechkünstler für stilvolle Prosa oder Poesie menschlichen Atem, Seele und Bedeutung findet; eine (leider) aus der Zeit gefallene Kunstform, zugegeben, und doch in ihrer Reichweite und Nachwirkung der Schauspielerei oft ebenbürtig. Durchaus ähnliche, moderne Medien verbaler Präsentation boomen heutzutage unaufhörlich: das Hörbuch, ob es nun den jüngsten Fitzek-Thriller oder Goethes WAHLVERWANDTSCHAFTEN zur Sprache bringt; auch der Audio-Podcast; auch das sich ausbreitende Angebot vieler Zeitungen und Zeitschriften an ihre Online-Kunden, sich Artikel vorlesen zu lassen. Das besorgen maschinelle Stimmen, die zusehends humaner und seriöser klingen. Am besten aber betreiben wir das Vorlesen aus eigenem Antrieb und in eigener Regie, ist es doch beides: fürsorgliche Zuwendung an andere und zugleich erhellende Beschäftigung mit uns selbst; beides: eine Schule des Lesens und eine des Hörens.
Unter sieben Siegeln
Regelmäßig fällt in den „Vorlesestudien“ zweierlei bezeichnend ins Gewicht. Zum einen berichteten in den vergangenen Jahren viele Muffel und Verweigerer, ihnen selbst sei in der Kindheit nicht vorgelesen worden. Zum andern gibt eine bemerkenswert große Gruppe zu, dafür im Lesen einfach nicht firm genug zu sein. In der Bundesrepublik bleibt die Zahl der „funktionalen Analphabeten“ seit Längerem mehr oder weniger konstant: 6,2 Millionen sind es und also sage und schreibe gut zwölf Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Für sie trifft zu, was die Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Birte Egloff 2011 in eine seither vielzitierte Definition fasste: Sie sind „nicht in der Lage, aus einem einfachen Text eine oder mehrere direkt enthaltene Informationen sinnerfassend zu lesen, und/oder sie befinden sich beim Schreiben nicht auf einem vergleichbaren Kompetenzniveau“.
Weil die Folgen oft zwanghaft verheimlicht werden, bleiben sie für die meisten von uns Nebenmenschen unentdeckt, sind darum aber um nichts weniger beängstigend. Vielfach sehen sich die Betroffenen – die nicht selten in bereits analphabetischen Familien aufwuchsen – auf Gedeih und Verderb an Bezugs- und Vertrauenspersonen gebunden, die das Manko für sie kompensieren, so gut es geht. Nicht erst eine Führerscheinprüfung, schon die Auswahl des Stadtbusses, der sie zur Fahrschule oder Stadtverwaltung bringen soll, wächst als kaum überwindliche Hürde vor ihnen auf. Anstellungsverträge und Dienstanweisungen zeichnen sie ab, ohne sie prüfen zu können. Zwar geht über die Hälfte der Analphabeten einer bezahlten Beschäftigung nach, doch meist als Hilfskräfte in Küchen, auf dem Bau, im