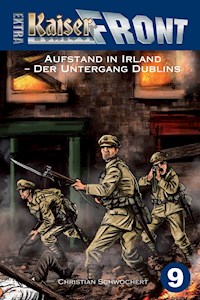9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: KAISERFRONT Extra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach der Eroberung Ägyptens und des Sudan streben die deutschen Truppen mit aller Kraft die Eroberung des Rests des britischen Kolonialreiches in Afrika an. Gleichzeitig beauftragt der Kaiser den jungen Kastrup-Spion Reinhard Gehlen damit, einen massiven Schlag des deutschen Geheimdienstes gegen die eigentlichen Hintermänner des Krieges zu führen. Als den Deutschen die Eroberung Nairobis gelingt, setzen sie ihren Siegeszug nach Kapstadt fort. Doch die Briten geben trotz ihrer Niederlagen nicht auf. Sie stellen in Indien ein riesiges Heer zusammen, das auf dem afrikanischen Kontinent die Entscheidung erzwingen soll. An der afrikanischen Küste entbrennt eine blutige Abwehrschlacht gegen diese Invasoren. Und die Briten haben noch weitere Asse im Ärmel. So schifft die britische Regierung in Südafrika neu gebaute Panzer ein, um sie im Norden Afrikas gegen die Truppen des Reichs einzusetzen. Hans von Dankenfels und seine Elitetruppe erhalten den Spezialauftrag, diese neuen britischen Panzer bereits bei ihrer Ausschiffung in Kapstadt zu zerstören, bevor sie in den Fronteinsatz kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Ähnliche
Kaiserfront Extra
Band 3
Kampf um Afrika – Siegeszug nach Kapstadt
von
Christian Schwochert
Inhalt
Titelseite
Vorgeschichte
Kapitel 1: Die Eroberung Nairobis
Kapitel 2: Die Rückeroberung Deutsch-Ostafrikas
Kapitel 3: Die Schlacht am Sambesi und andere Gefechte
Kapitel 4: Die Rückeroberung Deutsch-Südwestafrikas und andere Heldentaten
Kapitel 5: Die Schlachten am Oranje und der Einmarsch in Kapstadt
Kapitel 6: Die Seeschlacht vor Helgoland und der Friedensschluss
Nachspiel
Empfehlungen
Tom Zola: Stahlzeit
Heinrich von Stahl: Kaiserfront 1949
Heinrich von Stahl: Kaiserfront 1953
Axel Holten: Viktoria
Norman Spinrad: Der Stählerne Traum
Heinrich von Stahl: Aldebaran
Clayton Husker: T93
Impressum
Vorgeschichte
Der Krieg gegen Frankreich war im Jahre 1919 mit einem Sieg der kaiserlichen Armee erfolgreich beendet worden. Um Revanchebedürfnisse von Seiten Frankreichs von Anfang an zu verhindern und auch um die Franzosen als künftige Verbündete zu gewinnen, hatte Kaiser Wilhelm III. sowohl auf Reparationszahlungen als auch auf Gebietsabtritte verzichtet. Seine einzige Bedingung für einen Frieden mit Frankreich war die Wiederherstellung der Monarchie gewesen; eine Forderung, auf welche die Franzosen sehr schnell eingegangen waren.
Damit war der Weltenbrand zumindest teilweise gelöscht, allerdings befand sich das Deutsche Kaiserreich noch immer mit England, Amerika und Italien im Krieg.
Mit der Offensive vom 29. Juni 1919 gelang es der deutschen Armee, in Italien einzufallen und die an der Isonzo-Wacht durch Österreich-Ungarn gebundenen italienischen Truppen von Süden her einzukesseln. Dies hatte die Kapitulation des italienischen Generalstabes zur Folge und führte dazu, dass alle Gebiete bis 50 km nördlich von Rom Österreich angegliedert wurden.
Süditalien wurde zum Königreich Sizilien und schwor dem deutschen Kaiser den Lehenseid. Libyen wurde eine deutsche Kolonie, was die Libyer nicht weiter störte, da sie ohnehin keine allzu feste Bindung an Italien hatten, zu welchem sie damals ja auch erst seit gerade einmal sieben Jahren gehörten. Was die Libyer hingegen sehr störte, war der Einmarsch britischer Truppen in die ehemalige italienische Kolonie.
Am 15. Juli 1919 machte Kaiser Wilhelm III. England und Amerika ein ehrenvolles Friedensangebot, in dem auf gegenseitige Ansprüche verzichtet wurde. Beide lehnten jedoch ab.
Im November scheiterte der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, woraufhin Kaiser Karl I. abdankte und Österreich, Norditalien, Kroatien und die Tschechei an das Deutsche Reich angeschlossen wurden.
1920 fanden keine nennenswerten Kampfhandlungen statt und Deutschland kümmerte sich um eine Verbesserung der Versorgung des Volkes. Aber im Geheimen arbeiteten der Kaiser und sein Generalstab bereits an den Plänen für den Afrikafeldzug.
Die deutsche Marine wurde massiv aufgerüstet, und der amerikanische Präsident Wilson schloss aufgrund von innenpolitischem Druck Frieden mit Deutschland. Deswegen konnte sich das Reich nun voll und ganz auf den Krieg gegen das britische Empire konzentrieren. Und um besagtes Empire in die Knie zu zwingen, mussten dessen afrikanische Kolonien erobert werden.
Also startete das Reich 1921 einen großangelegten Afrikafeldzug. Zuerst besetzten die Deutschen am 3. März 1921 Malta, um die dortige britische Flotte auszuschalten und ein gefahrloses Übersetzen der Invasionsarmee zu gewährleisten. Am 28. März landeten sie in Ägypten und besiegten bei den Pyramiden einen Großteil der britischen Armee. Bei dieser Schlacht bewährte sich besonders der junge Hans von Dankenfels, als er einen Briten in einem vorher von den Befehlshabern ausgemachten Zweikampf besiegte. Der erbitterte Zweikampf hatte, wie einst der Kampf zwischen Achilles und Hektor, der Schlacht ein schnelles Ende setzen und dadurch weiteres Blutvergießen verhindern sollen. Allerdings weigerten sich einige britische Offiziere, den Sieg der Deutschen im Zweikampf anzuerkennen, und so musste die Schlacht bis zum bitteren Ende ausgefochten werden. Am Ende siegte die heldenhafte deutsche Armee ausgerechnet an dem Ort, an welchem über 100 Jahre zuvor schon der große Kaiser Napoleon I. erfolgreich gefochten hatte.
Im Laufe des Jahres brachten die Deutschen dann ganz Ägypten unter ihre Kontrolle, holten sich Libyen zurück und erreichten anschließend den Sudan. Auch dieses Gebiet konnte der Schlagkraft des deutschen Heeres nicht lange widerstehen, und im Laufe des Jahres 1922 erreichten die Deutschen Britisch-Ostafrika. Zwar war es ihnen nicht gelungen, das im Sudan gelegene Fort Charles zu erobern, doch man beschloss, den Feldzug dadurch nicht verzögern zu lassen. Die Deutschen schafften es bis Nairobi, wo sich ihnen die Briten und ihre Vasallen entgegenstellten, und eine blutige Schlacht entbrannte.
Kapitel 1: Die Eroberung Nairobis
Berlin, 23.09.1922
Wilhelm III. hatte fast eine Stunde Modell gesessen, um ein Bild von sich für die Nachwelt zeichnen lassen. Der Künstler Arthur Kampf, von dem auch das Bild »Karfreitag in einer französischen Kirche« stammte, hatte die Zeit benötigt, um erste Skizzen anzufertigen. Der Kaiser hätte auch Elk Eber beauftragen können, doch besagter Künstler verweilte derzeit in Ägypten, wo er deutsche Soldaten in den neuen Kolonien malen wollte. Beide waren sie hervorragende Künstler, die dem Deutschen Reich noch viele wunderschöne Bilder schenken würden; davon war der Kaiser überzeugt. Und sicherlich würden ihre zahlreichen Bilder eines Tages neben den Schlachtgemälden von Leuthen, Waterloo, Königgrätz, Sedan und der Kaiserausrufung in Versailles hängen.
Nun musste Kaiser Wilhelm III. sich jedoch einer unangenehmen Sache annehmen. Und nach langem Suchen hatte er auch den geeigneten Mann für diesen Job gefunden. Es handelte sich um einen jungen Soldaten der Kastrup namens Reinhard Gehlen. Der 1902 auf die Welt gekommene Soldat hatte sich 1919 freiwillig für die Kastrup gemeldet. Darüber, dass er erst 17 war, sahen die Offiziere hinweg, weil sie schnell merkten, dass man ihn für ganz besondere Aufträge einsetzen konnte. Nämlich für Tötungsmissionen. Dadurch schaffte es Gehlen immer wieder, dank seiner Begabung fürs Spionieren und Unterwandern, kommunistische Zellen aufzufinden und auszuschalten.
Und das Beste ist, dass Gehlen sowohl die Kommunisten als auch die Kapitalisten hasst. Ich finde, das macht ihn nicht nur zu einem guten, sondern auch zu einem klugen Mann. Denn lässt man diese Gauner ungehindert treiben, was sie wollen, zerstören sie ganz schnell Volk und Vaterland. Also muss man sie bekämpfen, denn sonst vernichten sie alles, was einem lieb und teuer ist. Und das kann kein anständiger Mann tatenlos zulassen, dachte der Kaiser und bekam allein beim Gedanken an all die gottlosen und vaterlandslosen Unholde einen grimmigen Gesichtsausdruck.
Er schaute auf seine Uhr und stellte fest, dass er zu spät kommen würde, wenn er sich nicht beeilen würde. Also beschleunigte er seine Schritte, da Gehlen mit Sicherheit schon am vereinbarten Treffpunkt wartete. Der Treffpunkt war auf einer vorher bestimmten Parkbank im Tiergarten, denn der Kaiser war nicht unbedingt daran interessiert, dass allzu viele Leute von dem Treffen erfuhren. Selbst Hindenburg und seinem Vater hatte er nicht viel davon erzählt; Gehlen hatte ihm im Vorfeld gesagt, dass absolute Geheimhaltung nötig sei. Dabei wusste der Kastrup-Spion nicht einmal, worum genau es eigentlich ging. Oder doch? Aber wie könnte er es wissen?, fragte sich der Kaiser in Gedanken.
Der Herrscher des deutschen Reiches kratzte sich am falschen Bart. Noch so eine Sache, auf der Gehlen bestanden hatte, als er Kontakt zu ihm aufgenommen hatte. Ob man ihm überhaupt trauen kann? Einige seiner Vorgesetzten meinten, dass selbst sie zeitweise nicht wissen, wo er ist. Aber sie sagten auch, er würde immer alle Aufträge zuverlässig erledigen, versuchte der Kaiser in Gedanken schlau aus dem Mann zu werden.
Dann kam er endlich an der vereinbarten Parkbank an und setzte sich hin. Gehlen war offenbar noch nicht da. Der Kaiser schaute sich etwas um und stellte fest, dass der Park im Moment relativ verlassen war. Etwa zwanzig Meter entfernt ging eine junge Frau mit Kinderwagen spazieren, aber sonst war niemand zu sehen.
»Guten Morgen, Euer Hoheit«, sagte plötzlich eine Stimme neben dem Kaiser.
Ein uralter Mann hatte sich neben ihn gesetzt, ohne dass Wilhelm III. es bemerkt hatte. Und der uralte Mann hatte ihn offenbar erkannt. Ist das etwa Gehlen? Nein, das kann nicht sein. Unmöglich. Ich habe doch ein Foto gesehen, dachte der Kaiser ein wenig verunsichert.
»Sie fragen sich, ob ich es bin? Nicht wahr?«, fragte der alte Mann, wobei seine Worte mehr eine Feststellung, als eine Frage waren.
»Ja, ich bin’s. Gehlen«, fügte er hinzu.
Der Kaiser sah nun ganz genau hin und stellte bei intensiver Betrachtung der Gesichtszüge fest, dass sie tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Reinhard Gehlen aufwiesen.
»Schon schön, was ein falscher Bart, ein wenig Schminke vom Theater und die richtige Kleidung ausmachen, nicht wahr?«
Der Kaiser nickte.
»Nun, wie Sie mir gesagt haben, haben Sie einen heiklen Auftrag für mich.«
»Ja. Und es war wirklich nicht leicht, Sie zu kontaktieren. Ihre Vorgesetzten haben zeitweise selbst nicht gewusst, wo Sie zu erreichen sind. Und dann mussten wir auch noch unter größter Geheimhaltung diesen Treffpunkt ausmachen …«
»Ich weiß. Aber wir sollten keine Zeit verlieren, denn je länger wir hier sitzen und reden, desto eher wird man Sie im Schloss vermissen und sich fragen, wo Sie sind«, unterbrach Gehlen den Kaiser.
»Hier«, sagte der Kaiser und reichte drei Listen an Gehlen weiter.
»Auf der ersten Liste sind 25 Namen. Es handelt sich fast nur um britische Mitglieder der Hochfinanz; zwei amerikanische sind auch dabei. Sie alle sind in London und treiben den Krieg gegen unser Land mit voran. Während britische und deutsche Soldaten gegeneinander kämpfen, sitzen sie in ihren Luxusvillen und schlürfen Weine, die so teuer sind, dass ein einfacher Arbeiter ein Jahr schuften muss, um sie sich leisten zu können. Auf der zweiten Liste sind 10 Namen. Es sind britische Zeitungsverleger, die den Krieg mit ihrer Propaganda vorantreiben und sich von den Bankiers und Spekulanten der Hochfinanz dafür bezahlen lassen. Auf der dritten Liste sind 5 Namen. Es sind die Namen der wichtigsten von den eben erwähnten Schuften bestochenen Politiker. Zusammen also 40 Personen, die aus dem Weg geräumt werden müssen«, erklärte der Kaiser, woraufhin Gehlen eine Frage stellen wollte. Doch der Kaiser kam ihm zuvor: »Ich weiß, was Sie jetzt fragen wollen: Ist es nicht falsch, unsere Todfeinde einfach so mir nichts, dir nichts ermorden zu lassen? Natürlich ist es falsch. Ich war ja auch erst gegen diese Idee, habe mich dann jedoch umentschieden. Denn wir befinden uns mitten im Krieg. Ein Krieg, den diese Verbrecher uns aufgezwungen haben. Es sind Leute, die sich für unsterblich und unbesiegbar halten. Sie denken, ihre Verbrechen werden sie niemals einholen. Sie feiern ihre rauschenden Feste und leben im Luxus, während die einfachen Bürger mit den Konsequenzen der Taten dieser Geldgeier leben müssen. Das muss aufhören! Ich weiß, wenn es gelungen ist, diese Leute auszuschalten, werden ihnen andere nachfolgen. Aber zuerst einmal werden die nachfolgenden Mistkerle etwas Zeit benötigen, um sich einzuarbeiten und so mächtig wie ihre Vorgänger zu werden. Und zum anderen müssen wir der Welt und ganz besonders diesen machtgeilen Verbrechern endlich einmal beweisen, dass sie nicht unsterblich und unbesiegbar sind. Und wir beweisen dadurch auch, dass ihre abscheulichen Taten Folgen haben, die auch sie erreichen. Es ist falsch, dies zu tun; ich weiß. Aber es ist notwendig. Und wenn wir es nicht tun, werden sie immer weitermachen. Aber wenn wir es tun, werden sie es sich in Zukunft vielleicht zweimal überlegen, ob sie ihre Schandtaten nicht doch lieber bleiben lassen. Denn, wenn Verbrecher nicht hart bestraft werden, hören sie nie auf. Und da sie in absehbarer Zeit wohl kaum vor einem englischen Gericht landen werden, müssen wir eben Richter, Staatsanwalt und Henker sein. Ich weiß, das ist abscheulich. Aber es geht nun einmal nicht anders, und ich hoffe, Sie verstehen das. Manchmal muss man als Herrscher auch Entscheidungen treffen, die einem selbst zuwider sind und für die man sich schuldig fühlen wird.«
Gehlen nickte verständnisvoll. Dann sagte er: »Ich wollte eigentlich fragen, bis wann ich diese Leute umbringen soll?«
»So schnell wie möglich«, antwortete der Kaiser.
»Gut. Dann breche ich gleich morgen nach England auf.«
»Aber wie wollen Sie da hinkommen?«
»Das sollten Sie nicht wissen. Je weniger Sie über meine Methoden wissen, desto besser«, antwortete Gehlen, steckte die Listen ein und ging.
Der Kaiser sah ihm kurz nach, stand dann auf und ging zurück ins Stadtschloss. Ob der Gehlen das hinbekommt? Talentiert ist er auf jeden Fall. Die Zukunft wird sehr bald zeigen, ob ich mit ihm die richtige Wahl getroffen habe, dachte der Monarch auf dem Rückweg.
Nairobi, 23.09.1922
Die Stadt war umzingelt und der Kommandant der Briten wusste nichts Besseres, als noch mehr Afrikaner als Kanonenfutter zu verheizen. Wieder ließ dieser unfähige Befehlshaber tausende von ihnen mit lächerlicher Bewaffnung gegen die Deutschen anrennen, was natürlich das vorhersehbare Ergebnis hatte, dass nach kurzer Zeit alle tot waren.
General von Lindenheim stand bei seinen Soldaten in den Sandsackbauten und beobachtete durch sein Fernglas die Stadt. Er machte einige interessante Entdeckungen. So sah er ein paar Gebäude, vor denen sehr viele britische Soldaten mit Gewehren standen.
Der General zeigte die von ihm entdeckten Gebäude durch sein Fernglas einem seiner Soldaten und befahl ihm, die Kanonen der Briten umdrehen und auf diese Häuser schießen zu lassen.
»Da ist sicherlich etwas sehr Wichtiges drin. Vielleicht die Offiziere der Armee, Vorräte oder sogar Munition. Aber was auch immer da drinnen ist, wir sollten es auf jeden Fall unter Beschuss nehmen, denn es ist dem Feind offenbar sehr wichtig«, meinte der General, woraufhin sich der Soldat sofort daranmachte, den Befehl auszuführen.
Im selben Moment flog eine Kugel dicht an von Lindenheims Kopf vorbei und er ging rasch in Deckung. Mist. Offenbar haben die Engländer gemerkt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, auf die Deutschen zu schießen, die Ferngläser haben. Ein Wunder, dass diese Vollidioten überhaupt bemerkt haben, dass der Kerl mit dem Fernglas irgendwie wichtig ist. Immerhin sind die so dumm, tausende ihrer Leute mit Speeren gegen MG zu schicken. Andererseits hat mir der Deserteur beim Rudolfsee erklärt, was General Burns dazu gesagt hat: ›Wir haben Massen an Menschen für den Kampf. Aber wir können sie nicht ausreichend bewaffnen, weil es nicht genug Geld für Waffen gibt. Und es gibt nicht genug Geld, weil Lord Spasti von Dummbeutel sich noch eine zehnte Villa bauen musste und weil Kriegsminister Faulenzius Seltenda unbedingt ein Schloss am See haben wollte.‹ – Wahrscheinlich denken die Kriegstreiber in London, sie könnten den Krieg gewinnen, ohne selbst Opfer bringen zu müssen. Aber Krieg bedeutet immer auch Aufopferung. Für alle, auch für die Leute, die ihre Pflicht nicht an der Front tun, weil sie anderswo gebraucht werden. Aber solche ehrenvollen Eigenschaften wie zum Beispiel Selbstaufopferung sind den hohen Herren der Finanzelite natürlich schon immer fremd gewesen. Sie laufen in ihren schicken Anzügen herum, tun auf nett und freundlich und verraten ständig ihre eigenen Völker. Und gleichzeitig beschimpfen sie unsere Uniform tragenden Monarchen als Kriegstreiber und Militaristen, obwohl diese tapferen und anständigen Leute immer für unser Land und Volk da sind und sich um uns kümmern, dachte von Lindenheim.
Dann hörte er hinter sich Kanonenschüsse, und einen Moment später sah er eines der ins Visier genommenen Häuser explodieren. Mit Genugtuung dachte er: Das war wohl ihr Munitionslager.
Sein Befehl war ausgeführt worden und die gewaltige Explosion hatte den Feind für einen Moment abgelenkt. Eine solche Gelegenheit konnte von Lindenheim natürlich nicht ungenutzt lassen. Also brüllte er: »Großangriff!« Dabei sprang er mit gezogener Pistole aus dem Graben und seine Soldaten folgten ihm und wiederholten seinen Schrei: »Großangriff!«
So ging der gebrüllte Befehl innerhalb weniger Sekunden um die ganze Stadt, und die Deutschen griffen von allen Seiten an. Die Engländer waren so geschockt, dass viele von ihnen wegrannten. Andere warfen einfach die Waffen weg und ergaben sich.
Die wenigen Mutigen, die ihre Stellung hielten, wurden überrannt. Immer mehr Briten flohen ins Zentrum von Nairobi, während sich der Kessel um sie immer enger zog. »Bildet einen Gewalthaufen!«, schrie einer der britischen Offiziere, woraufhin wenigstens ein paar Soldaten seinem Befehl folgten.
Der Gewalthaufen war eine seit dem Mittelalter angewandte Militärtaktik, die oftmals kurz vor einer Niederlage genutzt wurde. Man rief alle noch verbliebenen Truppen auf einen Haufen zusammen, um sich gemeinsam dem Feind noch einmal entgegenzustellen. Und genau das taten einige Briten jetzt, während andere die Waffen wegwarfen und sich klugerweise dem deutschen Gegner ergaben.
*
Nach kurzer Zeit kamen die deutschen Truppen im Zentrum an. Leutnant von Dankenfels war ganz vorne mit dabei und schrieb später in sein Kriegstagebuch:
»Wir erreichten das Zentrum der Stadt Nairobi. Etwas mehr als 100 Briten und ein paar ihrer einheimischen Vasallen hatten sich auf einem Haufen versammelt und wollten sich nicht ergeben. Als General von Lindenheim vortrat und ihnen anbot, sich gefangennehmen zu lassen, rief der kommandierende Offizier so etwas wie: ›Wir werden niemals aufgeben! Und bald werdet ihr diesen Krieg verlieren! 100 Völker des britischen Weltreiches werden über euch herfallen und euch zermalmen!‹
Offensichtlich hatte der Mann einen Sonnenstich. ›Wenn die Briten wirklich noch eine Chance gegen uns hätten, wären wir wohl kaum so weit gekommen‹, dachte ich damals.
Andererseits … was uns noch erwartete, wusste ich ja nicht. Auf jeden Fall befahl von Lindenheim den Angriff, und wir schossen die Briten und ihren großmäuligen Kommandanten in Grund und Boden. Wenn dieses brutale Gemetzel irgendwann einmal verfilmt wird, werden Mütter ihren Kindern die Augen zuhalten, sobald dieser Kampf im Lichtspielhaus gezeigt wird.
Ein paar völlig wahnsinnig gewordene Soldaten brachen mit Gewalt aus diesem Haufen aus und stürmten trotz etlicher Treffer auf uns zu. Ich schaffte es lediglich, sie aufzuhalten, indem ich ihnen in den Kopf schoss. Während des Kampfes verlor ich jedes Zeitgefühl. Und als das Gefecht vorbei war und die Stadt uns gehörte, stellte ich fest, dass es schon wieder Abend war. Ein paar meiner Kameraden hissten die Flagge des Reiches, und von Lindenheim, der zufällig neben mir stand, sagte: ›Und der Einsatz der Luftwaffe war nicht einmal nötig. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mit dem Vorstoß nicht so lange gewartet.‹
›Sie konnten ja nicht wissen, dass der Feind die meisten seiner Soldaten als Kanonenfutter verwenden würde‹, tröstete ich ihn.
Er schaute mich an und sagte: ›Ja. Sicher.‹
Dann ging er. Offenbar waren seine Worte zuvor eher an sich selbst gerichtet gewesen und nicht an mich. Ich machte mich auf, um meinen Fähnrich zu suchen, und hoffte, dass er noch lebte. Nachdem ich ihn gefunden hatte, sahen wir uns etwas in der Stadt um und gingen anschließend schlafen.«
*
Weil die Briten viele Truppen aus Deutsch-Ostafrika zur Verteidigung von Britisch-Ostafrika abgezogen hatten, hatte Lettow-Vorbeck jetzt wesentlich mehr Spielraum für seine Operationen. Deswegen ließ er seine Leute mehrere gut bewaffnete feindliche Truppen überfallen, die auf dem Weg nach Nairobi gewesen waren. Die dabei gefallenen britischen Soldaten fehlten dann natürlich bei der Verteidigung der Stadt. Ebenso fehlten die Waffen, die Lettow-Vorbeck durch seine Männer stehlen ließ. »Je mehr Gewehre wir von unseren Gegnern stehlen, desto weniger Kampfkraft bringen sie auf und desto stärker werden wir«, hatte der deutsche General gesagt.
Ludwig Deppe hatte dem nur zustimmen können. Und er sah das noch immer so, auch wenn er vom vielen Kistenschleppen enorme Rückenschmerzen hatte. Aber mit jeder Kiste, die er aus feindlichen Lagern stahl, rettete er etlichen deutschen Soldaten bei Nairobi das Leben. Und als die Meldung hereinkam, dass die Deutschen Nairobi erobert hatten, wussten die Männer des Lettow-Vorbeck, dass dieser Sieg auch ihr Verdienst war. Denn ohne ihre Sabotage hätten die Deutschen vielleicht trotzdem gewonnen, aber dafür wesentlich mehr Verluste gehabt.
Ist es eigentlich ein ehrenhafter Sieg, wenn er nur durch Sabotage zustande gekommen ist? Sabotage durch uns. Und vor allem Sabotage durch die eigenen Leute in London, die schlicht und einfach zu geizig sind, ihren Leuten hier mehr ordentliche Waffen zu geben; wahrscheinlich auch, weil sie auf ihrer Insel Angst haben und deshalb viele Waffen dort behalten … Ja. Ich denke, es ist trotzdem ein ehrenhafter Sieg. Unsere Männer haben besser gekämpft und unsere Offiziere haben besser befehligt. Und unsere Regenten haben bessere Entscheidungen getroffen. Und die Taktik der 1.000 Nadelstiche des Lettow-Vorbeck hat Erfolg gehabt, und die Taktik der Briten, mit zahlenmäßiger Überlegenheit zu kämpfen, ist gescheitert. Das heißt, hier bei uns waren sie überlegen; ob sie’s in Nairobi waren, weiß ich nicht. Und selbst wenn: Gewonnen haben wir Deutschen. Zwar auch durch Tricks, aber Tricks gehören im Krieg dazu. Wer im Krieg keine Tricks anwendet, der verliert. Und ich denke mal, es ist der deutschen Mutter egal, mit welchen Mitteln die Schlacht gewonnen wurde – Hauptsache, sie kann am Ende des Krieges ihren Sohn wieder in die Arme schließen, dachte Deppe.
Kapitel 2: Die Rückeroberung Deutsch-Ostafrikas
London, 01.10.1922
Die britischen Zeitungen berichteten über die Eroberung Britisch-Ostafrikas, über die englische Niederlage in Kamerun und den Einfall der Deutschen in Nigeria. Natürlich berichteten sie nicht objektiv; sie logen dem britischen Volk etwas von angeblichen Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung vor und behaupteten das Blaue vom Himmel, was die Heldenhaftigkeit der eigenen Leute betraf.
Man merkte beim Lesen, dass sie am liebsten die Niederlagen in den Kolonien ganz verschwiegen hätten. Aber da das nicht ging, wurden sie auf die hinteren Seiten verbannt und durch unwichtige Schlagzeilen verdeckt. Damit schwiegen die Medien die Niederlagen nicht tot, aber sie verbargen sie so geschickt, dass, wenn einmal der Vorwurf »Lügenpresse!« aufkam, sie berechtigterweise sagen konnten: »Wieso Lügenpresse? Wir haben es euch doch gesagt. Nur eben nicht auf der ersten Seite.«
Diese englischen Zeitungen sind lächerlich. Alle sind schuld an der Niederlage: die bösen Franzosen, die nun mit den Deutschen zusammenarbeiten, der böse deutsche Kaiser, und viele mehr. Nur an die eigene Nase fassen sich die hohen Herren nicht. Es ist schon gut und richtig, dass der neue Kaiser alle englischen Blätter in Deutschland aus dem Verkehr gezogen hat. Sein Vater war da viel zu tolerant; unter ihm durften die ›London Times‹, die ›New York Times‹ und viele andere Zeitungen sogar mitten im Krieg in Deutschland erscheinen. Das ist natürlich sehr pressefreiheitlich von ihm gewesen, aber ich hätte die Zeitungen verboten. Und der neue Kaiser hat das dann auch umgehend gemacht. Und deshalb ist es jetzt auch für mich Zeit, diese Zeitung angemessen zu behandeln, dachte Reinhard Gehlen, während er die Zeitung zusammenfaltete und in einen Mülleimer warf. So. Dort gehört der Müll schließlich hin, dachte er zufrieden.
Anschließend ging Gehlen zu seinem ersten und letzten Ziel. Denn er hatte großes Glück gehabt; alle Leute auf seiner Liste trafen sich zufällig am Abend zu einer kleinen Feierlichkeit.
Eine Feierlichkeit, die ich selbstverständlich auch besuchen werde. Und es ist nicht weiter schwer, sich als Mitglied des Personals auszugeben; man muss sich nur verkleiden. Und vor allem muss man den ›Teetest‹ bestehen, dachte Gehlen, während er zu Fuß in Richtung der schicken Villa am Stadtrand ging, die sein Ziel war. Der Koffer, den er bei sich trug, war alles was er brauchte. Ja, ja … der gute alte Teetest. So versuchen die Briten, deutsche Spione zu enttarnen. Sie bieten ihnen Kaffee oder Tee an; meistens zur Teezeit. Und wenn der Deutsche darauf hereinfällt und Kaffee nimmt, wissen sie, dass er ein Spion ist. Dann wird er verhaftet. Ist der Deutsche jedoch schlau, nimmt er den Tee. Der Nachteil ist, dass er den englischen Tee dann auch trinken muss. Und da ziehen viele Spione dann doch lieber die Verhaftung vor, dachte Gehlen.
*
Einige Zeit später erreichte der junge Reinhard Gehlen die Villa und schlich sich hinein. Diese stinkreichen Narren. Sie halten sich für so mächtig und unnahbar, dass sie kaum Wachleute aufgestellt haben, dachte er, während er sich ins Haus schlich.
Dort suchte er die Räume der Dienstboten auf, schnappte sich eine der Ersatzuniformen und begann, die Bombe in seinem Koffer zu aktivieren.
Anschließend schlich er sich unbeachtet mit seinem Koffer in den großen Ballsaal, legte den Koffer unter einen der bereits reich gedeckten Tische und freute sich, dass die Tischdecken bis zum Boden reichten. Er war gerade wieder aufgestanden, als Schritte zu hören waren. Schnell machte er sich davon, während ein echter Diener noch einmal die Tischgedecke kontrollierte.
Es war schlau von mir, die Bombe mit einer Uhr zu verbinden. In einer halben Stunde geht das Fest los, und eine Stunde danach fliegt hier alles in die Luft. Die feine Gesellschaft hat also eine Stunde Zeit für ihre Henkersmahlzeit. Nein … eigentlich nur eine halbe Stunde, denn viele der feinen Herren halten es ja für schick, zu spät zu kommen, dachte der Deutsche, während er das Haus unauffällig wieder verließ.
Während Gehlen verschwand, stellte er fest, dass die Wachleute inzwischen Verstärkung erhalten hatten. Offenbar kamen im Laufe des Abends immer mehr Wachen dazu. Wachen, die, hätte man sie von Anfang an aufgestellt, sein Eindringen vielleicht hätten verhindern können. Aber die Wachleute waren offenbar nicht beim Hausherren, sondern bei dessen Gästen angestellt. Und deshalb trafen sie zusammen mit ihren Schützlingen ein.
Besagte Schützlinge werden morgen früh ihr Frühstück in der Hölle einnehmen können. Der Tee dort unten dürfte ihnen ja bereits vertraut sein, dachte Gehlen, während er sich daranmachte, die Stadt zu verlassen.
Er war nicht daran interessiert, zu sehen, ob die Villa tatsächlich in die Luft folg. Entweder es klappte, oder es scheiterte wegen technischem Versagen, oder weil die Bombe zufällig entdeckt wurde. Darauf hatte der Kastrup-Mann keinen Einfluss mehr, und er wusste das selbstverständlich auch. In jedem Fall war es besser, nun nicht mehr in der Nähe der Villa zu sein, sondern außerhalb von London.
Gehlen suchte sich eine schicke kleine Pension und legte sich ins Bett. Er würde morgen früh alles in der Zeitung lesen, was er wissen musste; vermutlich auf einer der hinteren Seiten, wo die wirklich wichtigen Dinge standen. Bevor er einschlief, ließ er in Gedanken ein Lied erklingen, welches er auf den Straßen des Deutschen Reiches schon sehr oft gehört hatte:
Als der Weltkrieg ward verkündet
alle Feinde sich verbündet
zu dem Krupp der Kaiser meint:
›Wie ich oft im Blatt gelesen
Fabrizierst du Eisenbesen
hast du einen für den Feind?‹
Sagt der Krupp: ›Ich helfe dir immer
ich hab da ein Frauenzimmer
die ist nicht von Porzellan
Ja, die macht kein Federlesen
wo die fegt mit ihrem Besen
da ist immer freie Bahn‹
Lüttich, Namur und Antwerpen
tat sie mit dem Besen gerben
als ob sie Getreide mäht
Sprach der Kaiser ›Tapfere Dame
Wie ist denn ihr werter Name?‹
›Dicke Berta, Majestät!‹
Und der Kaiser tat sie preisen
schenket ihr ein Kreuz von Eisen
dicke Berta knickst und lacht
Kaiser sagt: ›Solch Frauenzimmer
sah ich doch mein Lebtag nimmer
Krupp, das hast du gut gemacht!‹
Als Gehlen das Lied in Gedanken hatte verklingen lassen, schlief er mit der beruhigenden Gewissheit ein, dass er alles getan hatte, was er tun konnte.
*
Während der ganzen Nacht und des darauf folgenden Morgens war London in Aufruhr. Die Zeitungen würden angesichts der gewaltigen Explosion und der vielen hochrangigen Toten gar nicht anders können, als darüber zu berichten. Und bestimmt würden sie den Anschlag den Deutschen in die Schuhe schieben. Gut, es waren ja auch die Deutschen gewesen. Aber das konnten die britischen Medien nicht wissen. Und weder Gehlen noch der Kaiser hatten vor, ihnen das zu offenbaren. Wichtig war nur, dass nun zumindest einige Feinde der Menschheit tot waren. Und natürlich, dass den restlichen von ihnen ein Zeichen gegeben worden war, welches besagte: Seht her! Ihr seid nicht unbesiegbar! Die hat es erwischt und euch kann es ebenso ergehen! Also ändert besser schnell euer mieses und asoziales Verhalten!
Reinhard Gehlen blieb noch ein paar Wochen in England, bis er die Tat und ihre sicherheitstechnischen Folgen für abgeklungen genug hielt, um unauffällig dieses Land zu verlassen.
Berlin, 02.10.1922
Ein Adjutant überbrachte dem deutschen Kaiser die Nachricht, was in London passiert war. Der Kaiser nahm dies mit ausdruckslosem Gesichtsausdruck zur Kenntnis, und als er wieder alleine in seinem Büro war, lächelte er. Nun hat der gute Gehlen die Zielpersonen alle auf einmal erledigt, dachte Wilhelm III. und griff zum Telefon. Er ließ sich mit Paul von Hindenburg verbinden und fragte, wie die Sicherung von Britisch-Ostafrika voranging.
»Meinen Informationen nach läuft es sehr gut. Nach der Einnahme Nairobis war der Rest ein Kinderspiel. Laut von Lindenheim überhaupt kein Widerstand bei der Sicherung des restlichen Gebietes. Außerdem haben die Osmanen in Hadramaut gesiegt und durch die Eroberung Kuweits und Katars gleich alle britischen Besitzungen in Arabien unter ihre Kontrolle gebracht. Äthiopien war bei der Eroberung von Britisch-Somaliland ebenso erfolgreich und daher haben wir von dort keine Probleme mehr zu befürchten. Ich habe auch gute Nachrichten, was den Sueskanal betrifft; er ist nach wie vor sicher«, erklärte Hindenburg.
»Das ist ja toll, aber warum sagen Sie mir das?«, fragte der Kaiser.
»Na, weil wir den Sueskanal benötigen werden, um unsere Unterseeboote dort durchzuschicken. Ich habe bereits bei den Deutschen in Port Sudan nachgefragt; sie können dort auftanken«, erklärte Hindenburg.
»Sehr schön. Aber warum sollten wir unsere U-Boote durch das rote Meer schicken?«
»Tja … damit muss ich wohl zur schlechten Nachricht kommen: Die Briten haben offenbar in Indien eine gewaltige Flotte aufgestellt. Etliche Boote, die meisten davon aus Holz, und nur wenige Schlachtschiffe als Begleitung, werden sich in den kommenden Tagen mit einem gewaltigen Heer, bestehend hauptsächlich aus Indern, auf den Weg nach Afrika begeben. Ich rechne mit mehr als 2.000.000 Männern unter Waffen«, berichtete Hindenburg. Dem Kaiser fiel der Hörer aus der Hand. »Euer Hoheit! Euer Hoheit! Sind Sie noch dran?«
Der Kaiser nahm den Hörer wieder in die Hand und sagte: »Bin dran. Haben Sie schon Ludendorff und von Lindenheim Bescheid gesagt?«