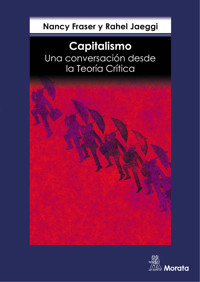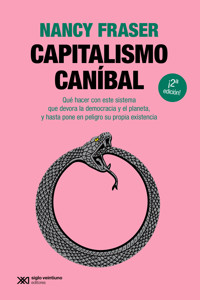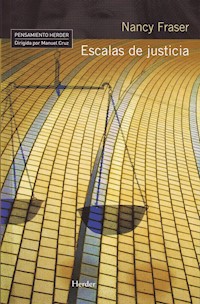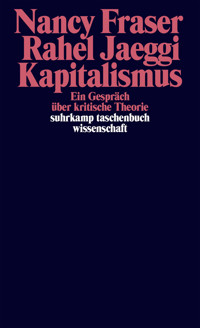
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Worum handelt es sich eigentlich bei dieser eigenartigen Gesellschaftsform, die wir als »Kapitalismus« bezeichnen? Nancy Fraser und Rahel Jaeggi stellen uns im so intensiven wie kontroversen Gespräch seine verschiedenen historischen Formen vor, die stets auf der Trennung von Ökonomie und Politik, Produktion und Reproduktion, menschlicher Gesellschaft und Natur beruhten. Dabei verwerfen sie althergebrachte Vorstellungen vom Wesen des Kapitalismus und wie dieser zu kritisieren sei. Stattdessen liefern sie präzise Diagnosen der gegenwärtigen Krisen und Aufstände und analysieren die Handlungsspielräume linker Politik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Nancy Fraser . Rahel Jaeggi
Kapitalismus
Ein Gespräch über kritische Theorie
Herausgegeben von Brian Milstein
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schröder
Suhrkamp
5Für
Daniel Zaretsky Wiesen
Julian Zaretsky Wiesen
Jakob Jaeggi
Erben unserer Geschichte
Träger unserer Hoffnungen
auf eine bessere Zukunft
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1 Der Begriff des Kapitalismus
2 Die Geschichte des Kapitalismus
3 Die Kritik des Kapitalismus
4 Der Kampf gegen den Kapitalismus
Anmerkungen
Register
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
9Vorwort
Wir schrieben dieses Buch in einer turbulenten Zeit und auf unkonventionelle Weise. Überall um uns herum brachen fest gegründete Gewissheiten zusammen. Finanz- und Umweltkrisen verschlimmerten sich vor unseren Augen und wurden auf der ganzen Welt zum Gegenstand offener Proteste. Gleichzeitig brodelten andere gesellschaftliche Probleme, die mit Familie, Gemeinschaft und Kultur zu tun haben, etwas tiefer unter der Oberfläche – noch keine maßgeblichen Brennpunkte sozialer Kämpfe, aber doch heraufziehende Krisen, die kurz davor stehen, vor unserem Blick zu explodieren. Schließlich schienen die sich häufenden Turbulenzen im Jahr 2016 zu einer Großkrise politischer Hegemonie zu verschmelzen, als Wähler auf der ganzen Welt massenhaft gegen den Neoliberalismus revoltierten und die Parteien und Eliten, die diesen unterstützt hatten, zugunsten populistischer Alternativen auf der Linken und der Rechten zu verdrängen drohten. Es handelte sich um das, was die Chinesen (und Eric Hobsbawm) als »interessante Zeiten« bezeichnen.
Interessant – vor allem für Philosophinnen, die sich mit der Entwicklung einer kritischen Theorie der kapitalistischen Gesellschaft befassen. Jede von uns hatte sich mehrere Jahre lang getrennt in dieses Projekt vertieft, bevor wir uns zusammenschlossen, um dieses Buch zu schreiben. Wir entschieden uns dazu aufgrund der Annahme, dass die sich verschärfenden Turbulenzen um uns herum ausdrücklich als Krise der kapitalistischen Gesellschaft gelesen werden könnten oder vielmehr als Krise der besonderen Form kapitalistischer Gesellschaft, in der wir heute leben. Es schien uns, dass die Zeit unbedingt nach dieser Art von Analyse verlangte. Und was wäre wohl eine bessere Vorbereitung auf die Aufgabe als unser gemeinsamer Hintergrund in kritischer Theorie und westlichem Marxismus, unsere Geschichte der leidenschaftlichen politisch-intellektuellen Auseinandersetzung miteinander und die kapitalismuskritische, philosophische Arbeit, die jede von uns eine ganze Zeit lang einzeln geleistet hat?
Als John Thompson vorschlug, wir sollten ein Buch für die Reihe »Gespräche« von Polity Press schreiben, witterten wir unsere 10Chance. Aber wir haben seinen Vorschlag an unsere eigenen Zwecke angepasst. Anstatt uns auf die übergreifende Stoßrichtung von Nancy Frasers Denken zu konzentrieren, beschlossen wir, unsere »Gespräche« eigens auf die Frage nach dem Kapitalismus und die Arbeit zu zentrieren, die wir beide zu diesem Thema geleistet haben.
Nachdem die Entscheidung getroffen war, vollzog sich der Prozess des Schreibens dieses Buches mit seinen eigenen überraschenden Wendungen. Wir bewegten uns zwischen zwei Auffassungen unserer Arbeit hin und her. Am Anfang stand die Idee, eine Reihe von hinreichend gut geplanten Gesprächen über verschiedene Aspekte des Themas aufzuzeichnen – mündlich miteinander zu sprechen und die Mitschriften so abzufassen, dass sie ihren halb spontanen Gesprächscharakter bewahrten. Diese Auffassung hat in einigen Kapiteln des fertigen Buches mehr oder weniger überlebt, insbesondere in der Einleitung und in Kapitel 4. Aber in anderen Kapiteln wurde sie durch eine andere Auffassung ersetzt, die eine intensivere Überarbeitung und erhebliche Neufassungen beinhaltete. Diese Veränderung spiegelte die Art und Weise wider, wie unsere Arbeit an diesem Buch sich mit der Arbeit überschnitt, die jede von uns gleichzeitig jeweils für sich durchführte. Die Kapitel 1 und 2 konzentrierten sich am Ende weitgehend auf Nancy Frasers »erweiterte« Sicht des Kapitalismus als »einer institutionalisierten Gesellschaftsordnung«, die vielfache Krisentendenzen in sich birgt. Diese Kapitel wurden erheblich überarbeitet, und zwar zum größten Teil von Nancy Fraser. Kapitel 3 folgt dagegen Rahel Jaeggis Darstellung der unterschiedlichen Gattungen, die eine Kritik des Kapitalismus umfassen, ihrer jeweiligen inneren Logik und ihrer Wechselbeziehungen. Dieses Kapitel, das hauptsächlich von ihr überarbeitet wurde, präsentiert außerdem Jaeggis »praxistheoretische« Sicht des Kapitalismus als »Lebensform«.
Abgesehen von diesen individuellen Schwerpunkten, war dieses Buch durch und durch ein Gemeinschaftswerk. Wie unkonventionell es auch sein mag, entspricht sein Format doch dem wirklichen Schaffensprozess, an dem wir uns gemeinsam beteiligten – in Form von aufgezeichneten Diskussionen, Privatgesprächen und öffentlichen Präsentationen in Berlin, Frankfurt, Paris, Cambridge (England) und New York; im Laufe von Familienurlauben in Vermont; und innerhalb des Graduiertenseminars über Kritiken am Kapitalismus, das wir gemeinsam im Frühjahr 2016 an der New School 11for Social Research unterrichteten. Es ist unsere feste Überzeugung, dass das Buch als ganzes viel größer ist als die Summe seiner Teile. Es entstand aus einer glücklichen Kombination von Umständen und spiegelt diese wider: dass wir viele intellektuelle Bezugspunkte und politische Ansichten teilen; dass unsere philosophischen Ansätze sich dennoch voneinander unterscheiden; und dass wir eine tiefe Freundschaft genießen, die sich um einen intensiven, wenn auch gelegentlich unterbrochenen Austausch zentriert. Das Ergebnis ist ein Buch, das reichhaltiger und tiefer ist als etwas, das die eine oder andere von uns für sich allein hätte hervorbringen können.
Auf dem Weg fielen für uns mehrere Dankesschulden an, sowohl gemeinsam als auch einzeln. Nancy Fraser bedankt sich für die Forschungsunterstützung seitens der Einstein-Stiftung der Stadt Berlin und des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin; der Rosa-Luxemburg-Stiftung; der Kolleg-Forschergruppe »Justitia Amplificata« (Frankfurt) und des Forschungskollegs Humanwissenschaften (Bad Homburg), des Centre for Gender Studies, Clare Hall, University of Cambridge; der Forschungsgruppe für Postwachstumsgesellschaften, Friedrich-Schiller-Universität (Jena); des Collège d’études mondiales und der École des hautes études en sciences sociales (Paris); und der New School for Social Research. Außerdem dankt sie Cinzia Arruzza und Johanna Oksala für anregende Diskussionen über Marxismus, Feminismus und Kapitalismus im Laufe eines gemeinsam gehaltenen Seminars an der New School; Michael Dawson dafür, dass er sie dazu drängte, den Ort rassistischer Unterdrückung in der kapitalistischen Gesellschaft theoretisch zu bestimmen; und Robin Blackburn, Hartmut Rosa und Eli Zaretsky für großartige Gespräche und nachbohrende Rückmeldungen.
Rahel Jaeggi bedankt sich für die Forschungsunterstützung durch das Programm der deutschen Heuss-Professur, die New School for Social Research, die Forschungsgruppe für Postwachstumsgesellschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und die Humboldt-Universität in Berlin. Außerdem dankt sie Eva von Redecker und den anderen Mitgliedern ihrer Forschungsgruppe (Lea Prix, Isette Schumacher, Lukas Kübler, Bastian Ronge und Selana Tzschiesche) für ihre Beiträge in verschiedenen Stadien und auf unterschiedliche Weisen; Hartmut Rosa, Stephan Lessenich und Klaus Dörre für ermutigende Diskussionen und dafür, dass 12sie das Thema wieder auf die Tagesordnung zurückbrachten; Axel Honneth und Fred Neuhouser für kontinuierliche Anregungen; und Martin Saar und Robin Celikates dafür, dass sie die intellektuellen Gefährten sind, ohne die das akademische Leben nicht dasselbe wäre.
Wir beide danken Blair Taylor und Dan Boscov-Ellen für hervorragende Forschungsassistenz, die weit über das nur Technische hinausging; Brian Milstein für fachkundige Redaktionsarbeit und die Vorbereitung des Manuskripts in den Endstadien; John Thompson für den ursprünglichen Vorschlag, dass wir dieses Buch schreiben sollten, und für die Geduld, mit der er auf seine Fertigstellung wartete; Leigh Mueller für das Lektorat, und Victoria Harris sowie Miriam Dajczgewand Świętek für ihre Hilfe beim Korrekturlesen.
Nancy Fraser und Rahel Jaeggi
13Einleitung
Jaeggi: Die Kapitalismuskritik befindet sich neuerdings in einer Art von »Boomphase« oder, wie wir im Deutschen sagen, »sie hat Konjunktur«. Lange Zeit war der Kapitalismus in politischen und intellektuellen Debatten abwesend. Er fehlte sogar auf der Tagesordnung der »kritischen Theorie« – der Tradition, der wir beide angehören. Aber jetzt schwillt das Interesse am Kapitalismus an – und ich meine nicht nur das Interesse an der Marktökonomie, an der Globalisierung, an der modernen Gesellschaft oder Verteilungsgerechtigkeit, sondern das Interesse am Kapitalismus. Und natürlich gibt es dafür gute Gründe – darunter nicht zuletzt die Finanzkrise von 2007/2008. Wie wir wissen, breitete sich diese Krise rasch von der Sphäre der Finanz in die Bereiche des Staatshaushalts und der Wirtschaft aus und von dort in die Politik und Gesellschaft, indem sie Regierungen, die Europäische Union, die Institutionen des Sozialstaats und in manchen Hinsichten das eigentliche Gefüge der gesellschaftlichen Integration erschütterte. Niemals seit der Zwischenkriegszeit haben sich Menschen in westlichen Gesellschaften im Hinblick auf die Instabilität und Unvorhersagbarkeit unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung so preisgegeben gefühlt – ein Gefühl des Preisgegebenseins, das nur noch verstärkt und verschlimmert wurde durch die Reaktionen ihrer angeblich demokratischen Regierungen, die von völliger Hilflosigkeit bis zu kalter Gleichgültigkeit zu reichen schienen.
Bemerkenswert ist, wie schnell die Kapitalismuskritik wieder in Mode gekommen ist. Es ist überhaupt noch nicht lange her, dass das Wort »Kapitalismus« fast völlig in Verruf stand, sowohl in der akademischen Welt als auch in der Öffentlichkeit. Gewiss sind einige der Kritiken, die wir seitdem beobachten konnten, diffus oder rudimentär, grob vereinfachend oder gar inflationär. Aber du und ich stimmen darin überein, dass eine erneuerte Kritik des Kapitalismus genau das ist, was wir heute brauchen, und es ist wichtig, dass Vertreter der kritischen Theorie wie du und ich sich wieder auf den Kapitalismus konzentrieren sollten.
Fraser: In der Tat, die Rückkehr des Interesses am Kapitalismus ist eine sehr gute Nachricht für die Welt im Allgemeinen, aber auch 14für dich und mich. Wir beide waren getrennt mit dem Versuch beschäftigt, das Interesse an diesem Thema wiederzuerwecken. Seit langem hat jede von uns versucht, Schlüsselideen aus der Kritik der politischen Ökonomie in die kritische Theorie zurückzutragen: In deinem Fall mit dem Begriff der »Entfremdung«; in meinem mit den Begriffen der »Krise« und des »Widerspruchs«.1 Und jede von uns hat sich auch bemüht, den eigentlichen Begriff des Wesens des Kapitalismus neu zu denken: in deinem Fall eine »Lebensform«; in meinem eine »institutionalisierte Gesellschaftsordnung«.2 Aber bis vor kurzem waren wir einsame Rufer. Heute hat sich das jedoch geändert. Nicht nur du und ich, sondern eine Menge Leute wollen heute über den Kapitalismus sprechen. Es gibt eine weit verbreitete Übereinkunft, dass der Kapitalismus (wieder) ein Problem ist und ein würdiger Gegenstand politischer und intellektueller Aufmerksamkeit. Wie du schon sagtest, ist das auch völlig verständlich. Es spiegelt das verbreitete Gefühl wider, dass wir in den Wehen einer äußerst tiefen Krise stecken – einer heftigen systemischen Krise. Womit wir es, mit anderen Worten, zu tun haben, ist nicht bloß eine Menge diskreter punktueller Probleme, sondern eine tiefenstrukturelle Dysfunktion, die im Zentrum unserer Lebensform angesiedelt ist.
Daher ist die bloße Tatsache, dass Menschen das Wort »Kapitalismus« wieder benutzen, ermutigend, auch wenn sie nicht genau wissen, was sie damit meinen. Ich lese sie als einen Hinweis auf ein Verlangen nach der Art von kritischer Theorie, die die tiefenstrukturellen Wurzeln einer bedeutenden systemischen Krise freilegt. Und das ist entscheidend – auch wenn es stimmt, dass die Verwendung des Wortes »Kapitalismus« in vielen Fällen hauptsächlich rhetorisch ist und weniger wie ein wirklicher Begriff fungiert, sondern vielmehr als ein Hinweis auf die Notwendigkeit eines Begriffs. In diesen Zeiten sollten wir als Vertreter der kritischen Theorie diese Frage ausdrücklich stellen: Was genau bedeutet es, wenn man heute vom Kapitalismus spricht? Und wie lässt er sich theoretisch am besten bestimmen?
Jaeggi: Wir sollten uns darüber im Klaren sein, was wir mit der Vorstellung meinen, dass der Kapitalismus ein Comeback feiert. Zwar hat es schon immer soziale Bewegungen und Interessenverbände gegeben, denen es um verschiedene Formen sozialer oder wirtschaftlicher Gerechtigkeit ging; und das Thema der »Vertei15lungsgerechtigkeit« hatte in bestimmten Teilen der akademischen Welt eine Blütezeit erlebt. Außerdem sind ökonomische Fragen häufig in Debatten über »Globalisierung«, die Zukunft der staatlichen Autonomie und die Ungleichheit und Armut in den Entwicklungsländern aufgetaucht. Dann schwebt der Begriff »Kapitalismus« auch in manchen Kreisen als Synonym für »Moderne« umher, wobei die »Kritik des Kapitalismus« sich am Ende auf Kulturkritik im Sinne von Baudrillard und Deleuze bezieht. Aber keiner dieser Ansätze erfasst den Kapitalismus in dem Sinne, in dem wir hier über ihn sprechen. Keiner betrachtet ihn als übergreifende Lebensform, die – wie Marx sagen würde – in einer Produktionsweise gründet und eine ganz spezifische Menge von Voraussetzungen, Dynamiken, Krisentendenzen und grundlegenden Widersprüchen und Konflikten aufweist.
Fraser: Ja, einverstanden. Glücklicherweise geht das gegenwärtige Interesse am Kapitalismus jedoch über die begrenzten, einseitigen Ansätze, die du gerade erwähnt hast, hinaus. Wie gesagt, wird es von einem weit verbreiteten Gefühl einer tiefen und allgegenwärtigen Krise angetrieben – nicht nur einer bereichsspezifischen Krise, sondern einer solchen, die jeden bedeutenden Aspekt unserer Gesellschaftsordnung umfasst. Das Problem ist also nicht einfach »ökonomisch« – es ist nicht »bloß« Ungleichheit, Arbeitslosigkeit oder Ungleichverteilung, so gravierend diese Dinge auch sind. Es ist auch nicht »nur« das 1 % gegenüber den 99 % – obwohl diese Rhetorik viele Menschen dazu anregte, Fragen zum Kapitalismus zu stellen. Nein, das Problem geht tiefer als das. Über die Frage hinaus, wie Wohlstand »verteilt« wird, gibt es das Problem, was überhaupt als Wohlstand gilt und wie dieser Wohlstand produziert wird. In einem ähnlichen Sinne liegt hinter der Frage, wer wie viel für welche Art von Arbeit bekommt, die tiefere Frage, was als Arbeit gilt, wie sie organisiert ist und was ihre Organisation jetzt von den Menschen verlangt und ihnen antut.
In meinen Augen sollte es um Folgendes gehen, wenn wir über den Kapitalismus sprechen. Nicht nur, warum manche mehr und andere weniger haben, sondern auch, warum so wenige Menschen jetzt ein stabiles Leben und ein Gefühl von Wohlergehen haben; warum so viele um prekäre Arbeit konkurrieren und mit mehreren Jobs jonglieren, die mit weniger Rechten, Absicherungen und Vergünstigungen ausgestattet sind, während sie sich gleichzeitig 16schwer verschulden. Aber das ist nicht alles. Ebenso grundlegende Fragen umgeben die sich verschärfenden Belastungen des Familienlebens: warum und wie die Zwänge bezahlter Arbeit und Schulden die Bedingungen der Kindererziehung, der Altenpflege, der Haushaltsverhältnisse und Gemeinschaftsbindungen verändern – kurz, die gesamte Organisation der sozialen Reproduktion. Tiefgreifende Fragen stellen sich auch mit Bezug auf die zunehmend alarmierenden Auswirkungen unserer Ausbeutungsbeziehung zur Natur, die der Kapitalismus sowohl als »Zapfhahn« für Energie und Rohmaterialien als auch als »Ausguss« zur Aufnahme unseres Abfalls behandelt. Schließlich sollten wir auch politische Fragen nicht vergessen, beispielsweise mit Bezug auf die Aushöhlung der Demokratie durch Kräfte des Marktes auf zwei Ebenen: einerseits der Unternehmenszugriff auf politische Parteien und öffentliche Einrichtungen auf der Ebene des Territorialstaats; andererseits die Usurpation politischer Entscheidungsgewalt auf der transnationalen Ebene durch die globale Finanz, eine Kraft, die keinem Demos gegenüber verantwortlich ist.
All dies spielt eine zentrale Rolle dafür, was es heißt, heute über den Kapitalismus zu sprechen. Eine Implikation davon ist, dass unsere Krise nicht nur eine ökonomische ist. Sie umfasst auch Pflegedefizite, Klimawandel und Entdemokratisierung. Aber selbst diese Formulierung ist noch nicht gut genug. Das tiefere Problem besteht darin, was all diesen hartnäckigen Schwierigkeiten zugrunde liegt: das zunehmende Gefühl, dass ihr gleichzeitiges Auftreten kein bloßer Zufall ist, dass es darauf hinweist, dass etwas Grundlegenderes an unserer Gesellschaftsordnung faul ist. Das ist es, was so viele Menschen wieder auf den Kapitalismus zurückverweist.
Jaeggi: Diese vielfachen Krisen zwingen uns zu der Frage, ob es nicht eine Art von tieferem Versagen in der kapitalistischen Gesellschaftsformation gibt. Viele Menschen haben jetzt den Verdacht, dass es nicht mehr ausreicht, nur diese schlimmen Auswirkungen im Blick zu haben, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine gesamte Lebensform dysfunktional geworden ist. Und das bedeutet, dass sie bereit sind, die verschiedenen gesellschaftlichen Praktiken, die diese Gesellschaftsformation umfasst, genauer unter die Lupe zu nehmen – nicht nur Ungleichheit oder Umweltzerstörung oder Globalisierung, wie du gesagt hast, sondern die Praktiken selbst, die das System ausmachen, das diese Konflikte hervorbringt, bis 17hinab zu der Art und Weise, wie wir solche Dinge wie Eigentum, Arbeit, Produktion, Austausch, Märkte und so weiter verstehen.
Aber auch, wenn wir darin übereinkommen, dass die Kritik des Kapitalismus wieder zurück auf der Tagesordnung ist und dass es sich dabei um eine begrüßenswerte Entwicklung handelt, sollten wir doch die Frage stellen, wohin diese Kritik überhaupt verschwand. Was ist geschehen, dass der Kapitalismus so lange marginalisiert wurde? Wie könnten wir sein Verschwinden aus der kritischen Theorie verstehen? Es scheint, dass wir im Laufe der letzten Jahrzehnte eine »Black-Box«-Auffassung der Wirtschaft erlebt haben. Das gilt sicherlich für den philosophischen Liberalismus und andere Denkrichtungen, die eng auf Fragen der »Verteilung« fokussiert sind. Nehmen wir beispielsweise linke Rawlsianer oder Sozialisten wie G. A. Cohen: Sie vertreten zwar einen Ansatz hinsichtlich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der im Übrigen radikal und egalitär ist, aber sie neigen dazu, Fragen mit Bezug auf die Wirtschaft selbst zu vermeiden.3 Sie sprechen davon, was aus der »Black-Box« der Wirtschaft herauskommt und wie man diese Ergebnisse verteilen soll, aber sie sprechen nicht darüber, was in ihr selbst vorgeht, wie sie funktioniert und ob diese Vorgänge wirklich notwendig und wünschenswert sind.
Aber der Trend ist nicht auf den Liberalismus und Theorien der Gerechtigkeit beschränkt. Der Kapitalismus war in der Regel ein Kernproblem für die kritische Theorie. Für nahezu alle großen Denker in dieser Tradition – von Marx über Lukács bis Horkheimer und Adorno und den frühen Habermas – war der Kapitalismus zentral. Aber irgendwann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre fiel er so gut wie vollständig aus dem Bild heraus. Was war geschehen? Sind wir alle einfach nur so ideologisch »eindimensional« geworden, dass selbst Vertreter der kritischen Theorie die Quellen unserer Unfreiheit aus dem Blick verloren haben? Als Erklärung klingt das ziemlich plump. Ich vermute, dass es intrinsische Gründe für die theoretische Entwicklung unserer intellektuellen Tradition gibt, die zur Aufgabe des Themas geführt haben. In einem gewissen Sinn war Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns mit ihrer kontroversen These über die »Kolonialisierung der Lebenswelt« der letzte Versuch, die kritische Theorie auf eine umfassende Gesellschaftstheorie zu gründen.4 Sie ist sicherlich von Marx, Lukács und den Intuitionen der früheren kritischen Theorie auf 18eine solche Weise inspiriert, wie es sich nicht von einigen seiner späteren Schüler behaupten lässt. Trotzdem stützt sich Habermas in solchem Maße auf systemtheoretische Ideen über die funktionale Differenzierung, dass er die Sphäre der Wirtschaft aus dem Bereich der Kritik praktisch ausklammert. Die Wirtschaft wird als etwas verstanden, das autonom funktioniert, als ein »normenfreier« Bereich, der von seiner eigenen Logik angetrieben wird.5 Das läuft auf eine andere Art von »Black-Box«-Ansatz hinaus, da alles, was wir tun können, darin besteht, uns gegen das Eindringen des Ökonomischen in andere Lebensbereiche zu schützen. Die kapitalistische Ökonomie ist ein »Tiger«, der durch politische oder andere externe Mittel »gezähmt« werden soll, aber wir haben keinen kritischen Zugang mehr zur Ökonomie selbst.
Dadurch soll nicht die alte Debatte zwischen der Transformation des Kapitalismus durch Reformen und seiner Überwindung durch radikalere Mittel wieder aufgewärmt werden. Inwiefern ein gezähmter Kapitalismus immer noch »Kapitalismus« sein kann, ist weitgehend eine semantische Frage, die uns jetzt nicht zu beschäftigen braucht. Gleichzeitig könnten uns die Exzesse und Bedrohungen, die vom heutigen Kapitalismus ausgehen, im Hinblick darauf zu denken geben, ob die Idee der »Zähmung« des Kapitalismus immer noch angemessen ist. »Die historische Verbindung von Demokratie und Kapitalismus«6 steht heute zutiefst in Frage, und vielleicht ist das der Grund, warum sich neue Interpretationen ökonomischer Fragen erst jetzt zu entwickeln beginnen.
Fraser: Ich stimme dir voll und ganz zu, dass Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns einen Wendepunkt in der kritischen Theorie markierte. Wie du gesagt hast, war sie zwar der letzte große systematische Versuch, aber es gelang ihr nicht, Nachfolgewerke mit vergleichbaren Zielsetzungen und ähnlicher Breite anzuregen. Stattdessen stellte sich ihr Vermächtnis als eine gewaltige Zunahme der Fachspezialisierung unter Habermas’ Nachfolgern heraus. In den folgenden Jahrzehnten fuhren die meisten von denen, die sich als Vertreter der kritischen Theorie ansehen, damit fort, freistehende moralische, politische oder rechtliche Theorien zu entwickeln (die Forschungsgruppe zu Postwachstumsgesellschaften in Jena ist eine jüngere und begrüßenswerte Ausnahme). Das Ergebnis war, dass man die ursprüngliche Idee der kritischen Theorie als eines interdisziplinären Projekts, das darauf abzielt, die Gesellschaft als 19Gesamtheit zu erfassen, fallenließ. Da man normative Fragen nicht mehr mit der Analyse gesellschaftlicher Tendenzen und mit einer Zeitdiagnose verband, hörte man einfach auf mit dem Versuch, den Kapitalismus als solchen zu verstehen. Es gab keine Bemühungen mehr, seine Tiefenstrukturen und Antriebsmechanismen, seine charakteristischen Spannungen und Widersprüche oder seine typischen Formen von Konflikten und emanzipatorischen Möglichkeiten zu bestimmen. Das Ergebnis war nicht nur, dass man das zentrale Feld der kritischen Theorie aufgab; es bestand außerdem darin, die einst scharfe Grenze, die sie vom egalitären Liberalismus trennte, zu verwischen. Heute haben sich diese beiden Lager einander so sehr angenähert, dass sie kaum mehr zu unterscheiden sind, weshalb es schwierig ist zu sagen, wo der Liberalismus aufhört und die kritische Theorie anfängt. Vielleicht ist das Beste, was man sagen kann, dass die (sogenannte) kritische Theorie zum linken Flügel des Liberalismus geworden ist. Und in Bezug darauf habe ich schon lange ein ungutes Gefühl.
Jaeggi: Tatsächlich hat Axel Honneth diese Tendenz, an einen freistehenden Normativismus zu glauben, ebenfalls seit langem kritisiert. Er ist einer derjenigen, die in Hegelscher Manier im Kontakt mit der Gesellschaftstheorie geblieben sind, und hat im Zuge der Rekonstruktion der Institutionslandschaften moderner Gesellschaften damit begonnen, das »System der Bedürfnisse«, die Sphäre des Markts und der Wirtschaft im Allgemeinen neu zu denken.7
Fraser: Das ist ein wichtiger Punkt. Aber er ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die überwältigende Mehrheit der Vertreter der kritischen Theorie hat wenig Interesse an der Gesellschaftstheorie gezeigt. Und wenn wir die relative Abwesenheit der Kapitalismuskritik in den letzten Jahren verstehen wollen, müssen wir auch den spektakulären Aufstieg des poststrukturalistischen Denkens im späten 20. Jahrhundert berücksichtigen. Zumindest in der akademischen Welt der USA ist der Poststrukturalismus zur »offiziellen Opposition« gegenüber der liberalen Moral- und politischen Philosophie geworden. Und doch hatten diese vermeintlichen Gegner eine grundlegende Gemeinsamkeit: Sowohl der Liberalismus als auch der Poststrukturalismus waren Wege zur Auslagerung der Problematik der politischen Ökonomie, und tatsächlich auch des Gesellschaftlichen selbst. Es handelte sich um eine sehr mächtige Konvergenz – sozusagen um einen Doppelschlag.
20Jaeggi: Könnte man sagen, dass wir von beiden Seiten aus, vom liberalen Kantschen Normativismus und der poststrukturalistischen Kritik der Normativität, jetzt eine Situation vorfinden, in der die Einheit von Analyse und Kritik auseinandergefallen ist? Über die explizite Sorge um den Kapitalismus hinaus bestand die zentrale Idee der kritischen Theorie von Anfang an in ihrer Fortsetzung des hegelschen-marxistischen Rahmens zur Analyse und Kritik der Gesellschaft. Sie wurde durch jene ganz besondere Vorstellung motiviert, dass die Gesellschaftsanalyse, ohne moralistisch zu sein, bereits ein umgestaltendes und emanzipatorisches Ziel in sich enthalten sollte. Aber jetzt scheint es anhand der Dominanz des politischen Liberalismus und des gewaltigen Einflusses von Rawls, dass diese Einheit zerbrochen ist, sodass wir jetzt eine empirische Gesellschaftstheorie auf der einen Seite und eine normative politische Theorie auf der anderen Seite haben.
Fraser: Mit Bezug auf den Rawlsschen Liberalismus hast du völlig Recht – und, so würde ich hinzufügen, auch mit Bezug auf die poststrukturalistische Opposition. Die intellektuelle Dominanz, die durch die Kombination dieser beiden Lager erreicht wurde, tötete praktisch das linkshegelianische Projekt, zumindest zeitweise. Die Verbindung zwischen Gesellschaftsanalyse und normativer Kritik wurde durchtrennt. Das Normative wurde vom Reich der Gesellschaft abstrahiert und als etwas Freistehendes behandelt, unabhängig davon, ob das eigene Ziel darin bestand, es zu bekräftigen (wie im Falle der Liberalen) oder es abzulehnen (wie im Falle der Poststrukturalisten).
Jaeggi: Aber vielleicht gab es gute Gründe dafür, sich vom Kapitalismus und der Ökonomie abzuwenden. Vielleicht musste diese Abwendung vollzogen werden, selbst von Denkern der Linken und Vertretern der kritischen Theorie. Ältere vom Marxismus inspirierte Theorien neigten dazu, eine übermäßig »ökonomistische« Sicht der Gesellschaft zu unterstützen, und wir mussten eine gewisse Distanz dazu erlangen. Während der Kapitalismus also aus dem Bild herausfiel, entstand dadurch auch Raum für die Erforschung eines breiten Spektrums kultureller Fragen, wie soziales Geschlecht, Rasse, Sexualität, und Identität. Und die kritische Untersuchung dieser Dinge auf eine solche Weise, dass sie nicht der Ökonomie untergeordnet wurden, war etwas, was wir dringend brauchten. Aber ich würde sagen, dass es Zeit ist, das Gleichgewicht wiederherzustellen. 21Es genügt nicht, den Ökonomismus zu vermeiden. Wir müssen auch Sorge dafür tragen, die Bedeutung der ökonomischen Seite des gesellschaftlichen Lebens nicht aus dem Blick zu verlieren.
Fraser: Ich schließe mich deinem Vorschlag an, dass die Abwendung von der politischen Ökonomie nicht einfach ein Fehler war – und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste ist, dass es echte Gewinne beim Angehen von Fragen der fehlenden Anerkennung, Statushierarchie, Ökologie und Sexualität gegeben hat. All dies waren Fragen, die ein orthodoxes, sklerotisches und reduktiv ökonomistisches Paradigma vom Tisch gefegt hatte. Ihre Wiedergewinnung und Zuweisung an eine zentrale Stelle in der kritischen Theorie stellt eine wichtige Errungenschaft dar. Aus diesem Grund habe ich immer auf einem Ansatz des »sowohl als auch« beharrt – sowohl Klasse als auch Status, sowohl Umverteilung als auch Anerkennung. Das ist auch der Grund, warum ich darauf bestanden habe, dass wir nicht einfach zu einer älteren überkommenen Kritik der politischen Ökonomie zurückkehren können, sondern vielmehr diese Kritik komplexer machen, vertiefen und bereichern müssen, indem wir die Einsichten des feministischen Denkens, der Kulturtheorie und des Poststrukturalismus, des postkolonialen Denkens und der Ökologie einbeziehen.
Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum die Abwendung von der politischen Ökonomie nicht einfach ein Fehler war. Vielmehr war sie eine Reaktion, wie wenig bewusst sie auch gewesen sein mag, auf einen wichtigen geschichtlichen Wandel der Eigenart des Kapitalismus. Wir wissen, dass die kapitalistische Gesellschaft während der fraglichen Zeit eine gewaltige Umstrukturierung und Neuausrichtung erfuhr. Ein Aspekt dieses Wandels war das neue Hervorstechen des »Symbolischen« (des Digitalen und des Bildes, des Handels mit Derivaten und Facebook), was so verschiedene Denker wie Fredric Jameson und Carlo Vercellone theoretisch zu erfassen gesucht haben.8 Das ist natürlich verknüpft mit der Dezentrierung der Produktion im Globalen Norden, dem Aufstieg der »Wissensökonomie« oder des »kognitiven Kapitalismus«, der zentralen Stellung von Finanz, IT und symbolischer Arbeit im allgemeineren Sinne. Es mag ironisch klingen, aber es gibt eine politisch-ökonomische Geschichte, die zur Erklärung dessen beiträgt, warum man die politische Ökonomie aufgab und anfing, sich einseitig auf Fragen der Kultur, Identität und des Diskurses zu konzentrieren. 22Obwohl diese Fragen etwas anderes als politische Ökonomie zu sein scheinen, lassen sie sich wirklich nicht unabhängig von ihr verstehen. Das ist also nicht einfach ein Fehler; es ist auch ein Hinweis auf etwas, was in der Gesellschaft vor sich geht.
Jaeggi: Es gibt ein altes Zitat von Horkheimer, in dem er sagt: »Der Ökonomismus […] besteht nicht darin, das Ökonomische zu wichtig, sondern darin, es zu eng zu nehmen.«9 Mit anderen Worten, wir sollten uns nicht von der Ökonomie abwenden, sondern vielmehr müssen wir die Ökonomie und ihre Rolle in der Gesellschaft in einem »weiteren« Sinne neu denken. Meines Erachtens sind wir noch nicht bei einer Auffassung angelangt, die weit genug wäre, und ein Teil der Neigung, das Thema des Kapitalismus aufzugeben, stammt von dieser »Furcht vor dem Ökonomismus«, die wir seit den frühen Tagen der Frankfurter Schule verinnerlicht haben. Das ist der Antrieb für einen Großteil meines Interesses an der Sozialontologie, an Lebensformen und meines Versuchs, die Ökonomie als »gesellschaftliche Praxis« zu verstehen.10 In einem praxisorientierten Ansatz umfassen die Ökonomie und ihre Institutionen eine Teilmenge gesellschaftlicher Praktiken, die mit anderen Praktiken auf vielfältige Weise verknüpft sind und die zusammen einen Teil des sozio-kulturellen Gefüges der Gesellschaft bilden. Diese Denkweise hat den Vorteil, den Gegensatz zwischen »dem Kulturellen« und »dem Ökonomischen« zu vermeiden, eine Dichotomie, die ich nicht besonders hilfreich finde.
Wie würdest du dein eigenes Werk mit Bezug auf diese Dichotomie und diese Trends verorten? Du hast dein Projekt lange Zeit so formuliert, dass es sich sowohl auf »Umverteilung« als auch auf »Anerkennung« bezieht. Würdest du deine jüngsten Arbeiten zum Kapitalismus als eine Wegbewegung von diesem »Black-Box«-Denken, das sich auf die Umverteilung konzentriert, verstehen? Oder würdest du sagen, dass deine vergangene Arbeit über die Debatte zu Umverteilung versus Anerkennung bereits ein Interesse am Kapitalismus beinhaltete?
Fraser: Ich habe immer versucht, dem zu widerstehen, was du als »Black-Box«-Ansatz bezeichnet hast. Und die Frage nach dem Kapitalismus hat in meinen bewussten Gedanken nie gefehlt, auch wenn sie nicht der ausdrückliche Fokus eines bestimmten Projekts war. Da ich aus dem demokratisch-sozialistischen Flügel der Neuen Linken kam, hielt ich es immer für ein Axiom, dass der Kapitalis23mus der grundsätzliche Rahmen war, in dem jede Frage der Sozialphilosophie und politischen Theorie verortet werden musste. Für meine Generation war das selbstverständlich. Als ich in den 1980er Jahren über den »Kampf um die Bedürfnisse«, den Androzentrismus des »Familieneinkommens« oder die Idee der sogenannten »Abhängigkeit vom Sozialstaat« schrieb, versuchte ich daher, Aspekte dessen zu klären, was damals als »Spätkapitalismus« bezeichnet wurde – und was ich jetzt »staatlich verwalteten Kapitalismus« nennen würde.11
Analoges gilt für meine Arbeiten in den 1990er und 2000er Jahren. In jener Zeit rang ich mit einer wichtigen Veränderung der politischen Struktur in der kapitalistischen Gesellschaft, die ich als den Wandel von der »Umverteilung zur Anerkennung« bezeichnete.12 Weit davon entfernt, eine Übung in freistehender Moralphilosophie zu sein, war diese Arbeit ein früher Versuch, eine epochemachende geschichtliche Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft zu erfassen, von der »staatlich verwalteten« Variante der Nachkriegszeit zum »finanzialisierten« Kapitalismus der Gegenwart. Mit anderen Worten, für mich bedeutete »Umverteilung« nie einen Euphemismus oder einen Ersatz für »Kapitalismus«. Vielmehr handelte es sich um meinen Begriff für eine Grammatik zum Stellen politischer Ansprüche, der zwar auf einen strukturellen Aspekt der kapitalistischen Gesellschaft hindeutete, ihn aber ideologisch sozusagen als eine ökonomische »Black-Box« vorstellte und der unter dem staatlich verwalteten Regime zu einem wichtigen Brennpunkt sozialer Kämpfe und des Krisenmanagements wurde. Mich interessierte die Aufklärung dessen, wie und warum die kapitalistische Gesellschaft diese Art von ökonomischer Black-Box der Verteilung erzeugte, und zwar getrennt von dem ebenso problematischen kulturellen Feld der Anerkennung. Weit entfernt davon, die Black-Box-Auffassung der Verteilung zu befürworten, versuchte ich also zu klären, woher sie stammte und warum sie der Anerkennung gegenübergestellt wurde. Ich führte die Herkunft dieser beiden Kategorien (sowie ihren wechselseitigen Gegensatz) eindeutig auf den Kapitalismus zurück, den ich als die umfassendere Ganzheit betrachtete, innerhalb deren Umverteilung und Anerkennung, Klassen und Status verstanden werden mussten.
Dennoch fasse ich deinen Punkt, dass meine gegenwärtige Arbeit das Problem des Kapitalismus beleuchtet, noch auf eine andere 24und nachdrücklichere Weise auf. Heute ist die kapitalistische Gesellschaft der explizite Vordergrund meiner theoretischen Bemühungen, der unmittelbare Gegenstand meiner Kritik. Das ist zum Teil deshalb so, weil die Eigenart des finanzialisierten Kapitalismus als ein System, das zutiefst krisengeschüttelt ist, für mich jetzt viel deutlicher ist. Aber auch deshalb, weil ich zum ersten Mal seit den 1960er Jahren die greifbare Zerbrechlichkeit des Kapitalismus sehen kann, die sich jetzt offen durch sichtbare Risse zeigt. Diese Zerbrechlichkeit ist mein Ansporn dafür, ihn frontal zu fixieren – und mich insbesondere auf seine »Krisentendenzen« und »Widersprüche« zu konzentrieren.
Jaeggi: Zu dieser Art der theoretischen Betrachtung zurückzukehren ist vielleicht jedoch gar nicht so leicht, insbesondere wenn wir über die Rückkehr zu jener Art von »großer Theorie« sprechen, die die meisten Vertreter der kritischen Theorie und Gesellschaftstheoretiker seit langem aufgegeben haben – diejenige Art nämlich, die sich mit großen geschichtlichen Prozessen, systemischen Konflikten und tief sitzenden Widersprüchen sowie Krisentendenzen befasst. Marx suchte nach der Entfaltung einer einzigen Art von Krise, aber heute haben wir es mit einer Vielfalt von Krisen und Konflikten zu tun. Brauchen wir eine Gesellschaftstheorie im Großmaßstab, um über den Kapitalismus in der Krise nachzudenken?
Fraser: Meines Erachtens brauchen wir die »Bildung großer Theorien« – und wir haben sie immer gebraucht. Aber du hast Recht: Es ist keineswegs leicht, eine Gesellschaftstheorie des Kapitalismus im großen Maßstab für unsere Zeit zu entwickeln. Wie du gesagt hast, besteht ein Problem in der Mehrdimensionalität der gegenwärtigen Krise, die nicht nur eine ökonomische und finanzbezogene, sondern auch eine ökologische, politische und soziale ist. Diese Situation lässt sich durch ökonomistische Theorienbildung nicht angemessen erfassen. Wir können uns aber auch nicht mit vagen Hinweisen auf »Vielfältigkeit« zufriedengeben, die so sehr in Mode gekommen sind. Stattdessen müssen wir die strukturellen Grundlagen der vielfältigen Krisentendenzen in ein und derselben gesellschaftlichen Ganzheit aufdecken: in der kapitalistischen Gesellschaft. Hier gibt es viele Fallstricke. Weder die Ausreizung überkommener Marxscher Modelle noch ihre völlige Ablehnung wird ausreichen. Irgendwie müssen wir ein neues Verständnis des Kapitalismus schaffen, das die Einsichten des Marxismus mit denen 25aus neueren Paradigmen vereint, u. a. aus dem Feminismus, der Ökologie und dem Postkolonialismus – während man zugleich die jeweiligen blinden Flecke jedes einzelnen vermeidet.
Jedenfalls ist die Art von Gesellschaftstheorie im Großmaßstab, die ich gegenwärtig entwickle, auf das Problem der Krise hin zentriert. Damit lege ich vielleicht meinen Kopf ins Maul des Löwen, weil keine Gattung der kritischen Theorie so heftig kritisiert worden ist wie die »Krisentheorie«. Diese Gattung wurde weitgehend abgelehnt und von der Hand gewiesen als wesentlich mechanistisch, deterministisch, teleologisch, funktionalistisch, was auch immer. Und dennoch leben wir in einer Zeit, die buchstäblich nach einer Krisenkritik schreit. Ich würde noch weiter gehen und sagen, dass wir in den Wehen einer epochalen Krise des Kapitalismus leben, weshalb wir heute das dringende Bedürfnis nach einer Rekonstruktion von Krisentheorien haben. Das ist die Gattung der Gesellschaftstheorie im Großmaßstab, die ich gegenwärtig verfolge und über die ich hier mit dir diskutieren möchte.
Jaeggi: Wir haben hier gewiss viele Gemeinsamkeiten. In meinem Buch Kritik von Lebensformen argumentierte ich ebenfalls für eine Krisenkritik von Lebensformen, die ich als eine Form von immanenter Kritik verstehe, die ihren Ausgangspunkt nicht »positiv« in bereits geteilten Werten findet, sondern in den immanenten Krisen und Widersprüchen, die der Dynamik von Lebensformen innewohnen – der Tatsache, dass Lebensformen »scheitern« können, selbst wenn das Scheitern selbst normativ durchdrungen ist.13
Und doch stützt sich die Fokussierung auf Krisen und Widersprüche auf eine Menge von Annahmen. Etliche Vertreter der kritischen Theorie haben seit langem ihre Aufgabe mit Bezug auf die altehrwürdige Zeile von Marx an Arnold Ruge bestimmt, nämlich mit Bezug auf die »Selbstverständigung der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche«.14 Sie meinten, dies impliziere die Konzentration auf die sozialen Bewegungen und die Menschen, die sich an diesen Arten von Kämpfen beteiligen, wobei die Rolle des Vertreters der kritischen Theorie die von jemandem ist, der die Probleme klärt, die sie umgeben. Nun könnte das eine gewissermaßen »leichtgewichtige« Interpretation der geschichtlichen Dynamik sein, die Marx im Sinn hatte, als er von den »Kämpfen und Wünschen« der Gegenwart sprach. Schließlich hatte er vor allem einen ganz bestimmten Kampf im Sinn – den Klassenkampf –, mit einer ausge26prägten geschichtlichen und materialistischen Dynamik als Triebkraft im Hintergrund.
Du hast selbst diese Passage zitiert, und deine Arbeit hat immer auf großartige Weise die stattfindenden gesellschaftlichen Kämpfe und Bewegungen widergespiegelt. Aber deine Ausrichtung scheint sich jetzt gewandelt zu haben. Nicht dass du dich jetzt von der Dimension des Kampfs abwendest – das tust du gewiss nicht –, aber du hast angefangen, über die »subjektiven« Elemente des Kampfes und der Sprachen, in denen Ansprüche gestellt werden, hinauszugehen zu den stärker »objektiven« Dimensionen von Widersprüchen und Krisen, die mehr von der Dynamik systemischer Elemente abhängen, welche unabhängig davon operieren, ob Menschen sie tatsächlich durch den Kampf thematisieren oder nicht. Es gibt also Implikationen, derer wir uns bewusst sein sollten, sowie eine Menge neuer Fragen, die sich aus dieser Art von Wandel von einer Dimension zur anderen ergeben.
Mich würde interessieren, wie man diese beiden Dimensionen in ein Gleichgewicht bringt. Eine Möglichkeit könnte sein, das Objektiv der heutigen sozialen Kämpfe als Diagnoseinstrument zu verwenden, um die zugrunde liegenden Widersprüche zu verfolgen. Eine andere könnte darin bestehen, in einem grundsätzlicheren Sinne die Bedingungen gesellschaftlicher Integration und Spaltung als Grundlage für die Reflexion über systemische Widersprüche zu betrachten – obgleich die Theorienbildung auf dieser Art von Ebene häufig heikel ist.
Fraser: Ja, das stimmt. In der Tat hat es in meinen jüngeren Arbeiten eine Schwerpunktverlagerung gegeben. Als jemand mit einer gründlichen Schulung im Marxschen Denken habe ich zwar immer geglaubt, dass der Kapitalismus »reale« objektive Krisentendenzen in sich trägt, aber in der Vergangenheit habe ich den Versuch nicht auf mich genommen, sie zu analysieren. Vielleicht war der Grund dafür, dass meine prägenden politischen Erfahrungen die sozialen Bewegungen und Kämpfe der 1960er Jahre waren – ich gelangte dazu, mich mit Fragen des Kampfs und Konflikts zu einer Zeit zu beschäftigen, als die Krisentendenzen des Kapitalismus nicht diejenige Form annahmen, die Marx in Das Kapital beschrieb.
In der jüngeren Vergangenheit bin ich vom ökologischen Denken beeinflusst worden, insbesondere von der ökologischen Kritik am Kapitalismus, die bestimmte reale, anscheinend objektive 27Grenzen für die Entwicklung des Kapitalismus postuliert und die die Widersprüche und sich selbst destabilisierenden Tendenzen eines Gesellschaftssystems zu bestimmen versucht, das seine eigenen natürlichen Bedingungen der Möglichkeit aufzehrt. Diese Art von Denken spielte in meinen früheren Arbeiten keine Hauptrolle, ist für mich jedoch in den letzten Jahrzehnten ins Zentrum gerückt. Das ökologische Paradigma versteht die kapitalistische Krise auf eine Art und Weise, die ebenso systemisch und ebenso tief strukturell ist wie das Marxsche Paradigma, fast als ob die beiden Krisenkomplexe parallel wären. Ich bin jedoch nicht zufrieden mit der Vorstellung, dass sie parallel sind, und glaube, dass wir ihre Verschränkung miteinander verstehen müssen – sowie mit anderen ebenso »objektiven« Tendenzen zu politischen und sozialen Krisen. Darüber werden wir sicherlich später noch sprechen.
Aber du hast nach der Beziehung zwischen den »objektiven« und »subjektiven« Strängen einer kritischen Theorie gefragt. (An irgendeiner Stelle sollten wir diese Terminologie problematisieren; es könnte durchaus bessere Möglichkeiten geben, die Unterscheidung zu benennen, die dir vorschwebt.) Ich bin überzeugt, dass wir einerseits sowohl die »realen Widersprüche« oder systemischen Krisentendenzen betrachten müssen als auch andererseits die Formen von Konflikten und Kämpfen, die sich als Reaktion darauf entwickeln. In manchen Fällen sind die Kämpfe explizite und bewusste »subjektive« Reaktionen auf die »objektive« Dimension. In anderen Fällen sind sie Symptome davon. Und in noch anderen mögen sie etwas ganz anderes sein. Mit anderen Worten, die Beziehung zwischen den beiden Ebenen, der »objektiven« und der »subjektiven«, ist ein Problem. Wir können nicht die perfekte Synchronisierung zugrunde legen, die Marx vermeintlich zwischen der Systemkrise des Kapitalismus einerseits und dem sich verschärfenden Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital andererseits erkannt hatte, der zufolge Letzterer die Erstere vollkommen widerspiegelte oder auf sie reagierte. Da eine solche Selbstharmonisierung fehlt, müssen wir die Beziehung zwischen diesen beiden Polen als offene Frage und als theoretisch zu durchdringendes Problem behandeln. Das ist heute eine besonders dringliche Frage, da wir es mit einer offensichtlich strukturellen Krise zu tun haben, aber (jedenfalls bislang) nicht mit einem entsprechenden politischen Konflikt, der die Krise angemessen auf eine Weise zum Ausdruck bringt, die zu 28einer emanzipatorischen Auflösung führen könnte. Die Beziehung zwischen Systemkrise und sozialen Kämpfen muss also ein Schwerpunkt unseres Gesprächs in den folgenden Kapiteln sein.
291 Der Begriff des Kapitalismus
Was ist Kapitalismus? Das Problem des Einen und der Vielen
Jaeggi: Was ist Kapitalismus? Diese Frage verlangt nach einer bestimmten Wesensdefinition, einer Menge zentraler Merkmale, die kapitalistische Gesellschaften von nichtkapitalistischen unterscheiden. Ich denke, wir sind uns beide darin einig, dass der Kapitalismus gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Dimensionen hat, die man so auffassen sollte, dass sie in einer bestimmten Art von miteinander verknüpften Beziehungen stehen. Ein Skeptiker könnte jedoch behaupten, dass sich die Kernbestandteile des Kapitalismus nicht so leicht angeben lassen. Haben wir schließlich nicht von der Debatte über die »Spielarten des Kapitalismus« gelernt, dass der Kapitalismus nicht überall auf der Welt gleich aussieht?1 Sollten wir daraus nicht schließen, dass kapitalistische Gesellschaften so unterschiedlich aussehen, dass es keinen gemeinsamen Nenner gibt? Wenn das der Fall wäre, haben wir ein echtes Problem. Wenn wir die Kernbestandteile nicht angeben können, die eine Gesellschaftsformation zu einer kapitalistischen machen, wie können wir dann noch von einer Krise des Kapitalismus sprechen? Denn ohne diese Kernbestandteile gäbe es keine Möglichkeit festzustellen, dass die gegenwärtige Krise wirklich eine Krise des Kapitalismus ist und nicht eine Krise von etwas anderem. Dasselbe gilt für unsere Ressourcen, mit denen wir den Kapitalismus kritisieren: Wie können wir behaupten, dass die Beispiele sozialen Leidens, die wir ansprechen wollen, tatsächlich mit dem Kapitalismus verknüpft sind, wenn wir nicht einmal einen hinreichend deutlichen und kohärenten Begriff des Kapitalismus haben, der uns gestattet, dessen Kernbestandteile zu bestimmen?
Fraser: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich selbst gehe von der Annahme aus, dass die gegenwärtige Krise als eine Krise des Kapitalismus verstanden werden kann. Aber diese Annahme muss bewiesen werden. Und der erste Schritt besteht gewissermaßen darin, eine Antwort auf den Kapitalismus-Skeptiker zu geben, indem man 30zeigt, dass wir trotz seiner vielen Spielarten tatsächlich vom »Kapitalismus« als solchem sprechen können. Dazu müssen wir erklären, was wir unter Kapitalismus verstehen, und ihn anhand von bestimmten zentralen Merkmalen definieren, die über das breite Spektrum von Gesellschaften hinweg gelten, die wir als »kapitalistische« bezeichnen. Schließlich hat es keinen Sinn, von Spielarten des Kapitalismus zu sprechen, wenn sie nicht bestimmte zugrunde liegende Merkmale teilen, aufgrund derer sie alle Spielarten des Kapitalismus sind. Die Herausforderung für uns besteht also darin zu sagen, was eine Gesellschaft zu einer kapitalistischen macht, ohne die große Vielfalt von Hinsichten zu vereinheitlichen, in denen kapitalistische Gesellschaften sich potenziell und aktuell voneinander unterscheiden. Anschließend müssen wir die Beziehung zwischen den zentralen Merkmalen, die wir identifizieren, und den vielfältigen Formen klären, in denen sie über Raum und Zeit hinweg instanziiert sind.
Jaeggi: Dieses Problem weist mindestens zwei Dimensionen auf: eine vertikale und eine horizontale. Es gibt nicht nur die Frage nach den Spielarten des Kapitalismus mit Bezug auf die These, dass wir es mit gleichzeitigen Kapitalismen im Plural zu tun haben, die zur selben Zeit in verschiedenen Gesellschaften koexistieren. Darüber hinaus haben wir es mit der historischen Entwicklung verschiedener Stadien des Kapitalismus zu tun. Es gibt gewaltige Unterschiede zwischen früheren Gestalten des Kapitalismus und dem heutigen Kapitalismus, und wir könnten die Frage stellen, ob es immer noch ein guter theoretischer Zug ist, all diese Dinge als »Kapitalismus« zu bezeichnen. Wie können wir die frühen Stadien des Industriekapitalismus mit dem modernen neoliberalen und globalen Kapitalismus gleichsetzen oder in Beziehung bringen? Ist es überhaupt angemessen, denselben Begriffsrahmen zu verwenden, um sowohl den Wettbewerbskapitalismus des 19. Jahrhunderts als auch den »Monopolkapitalismus« des 20. Jahrhunderts, den die frühe Frankfurter Schule als »Staatskapitalismus« bezeichnete, zu analysieren? Ich meine, unsere erste Aufgabe sollte in der Erfassung dessen bestehen, welche Kernbestandteile vorliegen müssen, damit eine Gesellschaftsformation als Instanziierung des Kapitalismus gelten kann.
Fraser: Der historische Punkt ist wichtig. Ich neige der Ansicht zu, dass der Kapitalismus wesentlich historisch ist, was immer er 31sonst noch sein mag. Weit entfernt davon, mit einem Mal gegeben zu sein, entwickeln sich seine Eigenschaften über die Zeit hinweg. Wenn das stimmt, müssen wir sorgfältig vorgehen und jede vorgeschlagene Definition cum grano salis und innerhalb der Entwicklungslinie des Kapitalismus als modifizierbar betrachten. Merkmale, die zu Beginn als zentral erscheinen, können später an Auffälligkeit einbüßen, während Eigenschaften, die zunächst als marginal oder gar abwesend erscheinen, später wesentliche Bedeutung erlangen könnten.
Wie du gerade gesagt hast, war der Wettbewerb zwischen Kapitalisten eine treibende Kraft für die Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert wurde er zumindest in führenden Branchen mehr und mehr durch das abgelöst, was gemeinhin als »Monopolkapitalismus« galt. Umgekehrt, während das Finanzkapital in der Ära des Fordismus nur eine unterstützende Rolle zu spielen schien, ist es im Neoliberalismus zu einer wichtigen Triebkraft geworden. Schließlich haben sich die Steuerungssysteme, in die der Kapitalismus eingebettet ist und die ihn in jedem Stadium strukturieren, im Lauf der letzten 300 Jahre immer wieder gewandelt, vom Merkantilismus zum Laissez-faire-Liberalismus über staatlich betriebenen Dirigismus zur neoliberalen Globalisierung.
Diese Beispiele verweisen auf die wesentliche Geschichtlichkeit des Kapitalismus. Es geht hier nicht einfach um unterschiedliche »Spielarten des Kapitalismus«, die nebeneinander existieren könnten, sondern vielmehr um historische Momente, die in einer pfadabhängigen Folge miteinander verbunden sind. Innerhalb dieser Folge wird zwar jede gegebene Wandlung politisch angestoßen und lässt sich auf Kämpfe zwischen Verfechtern unterschiedlicher Projekte zurückführen. Aber diese Folge kann auch als gerichteter oder dialektischer Prozess rekonstruiert werden, in dem eine frühere Form auf Schwierigkeiten oder Grenzen stößt, die ihre Nachfolgerin überwindet oder umgeht, bis auch sie in einer Sackgasse landet und ihrerseits abgelöst wird.
Betrachtungen wie diese machen die Suche nach einer Kerndefinition komplizierter. Ich glaube nicht, dass sie eine solche Definition unmöglich machen, aber sie deuten darauf hin, dass wir mit Sorgfalt vorgehen sollten. Vor allem müssen wir es vermeiden, relativ flüchtige historische Formen mit der beständigeren Logik zu verquicken, die ihnen zugrunde liegt.
32Kernmerkmale des Kapitalismus: ein orthodoxer Anfang
Jaeggi: Wir könnten mit folgendem Vorschlag beginnen. Postulieren wir drei Grundmerkmale des Kapitalismus: (1) Privateigentum von Produktionsmitteln und die Klasseneinteilung zwischen Eigentümern und Produzenten; (2) die Institution eines freien Arbeitsmarkts; und (3) die Dynamik der Kapitalakkumulation, die auf einer Orientierung an der Expansion des Kapitals im Gegensatz zum Konsum basiert, im Verein mit einer Ausrichtung an der Profitgewinnung anstatt an der Befriedigung von Bedürfnissen.
Fraser: Das ist ganz nahe an Marx. Wenn wir so anfangen, kommen wir zu einer Auffassung des Kapitalismus, die zumindest auf den ersten Blick recht orthodox erscheinen wird. Aber wir können sie später weniger orthodox gestalten, indem wir zeigen, wie diese Kernmerkmale sich zu anderen Dingen verhalten und wie sie sich in realen historischen Umständen manifestieren.
Beginnen wir mit deinem ersten Punkt: mit der gesellschaftlichen Aufteilung zwischen denjenigen, die die Produktionsmittel als ihr Privateigentum besitzen, und denjenigen, die nichts als ihre »Arbeitskraft« besitzen. Ich möchte nicht unterstellen, dass die kapitalistische Gesellschaft keine anderen konstitutiven gesellschaftlichen Aufteilungen beinhaltet; einige andere möchte ich schon bald besprechen. Aber diese ist sicherlich zentral: ein Grundmerkmal des Kapitalismus und eine seiner »Errungenschaften«, wenn das das geeignete Wort ist. Diese Klassenaufteilung setzt das Zerbrechen von zuvor bestehenden Gesellschaftsformationen voraus, in denen die meisten Menschen, wie unterschiedlich sie auch gestellt waren, einen gewissen Zugang zu Subsistenz- und Produktionsmitteln hatten – Zugang zu Nahrung, Unterkunft und Kleidung und zu Werkzeugen, Land und Arbeit –, ohne sich durch Arbeitsmärkte zu bewegen. Der Kapitalismus hat diesen Zustand zerstört, die überwältigende Mehrheit von den Subsistenz- und Produktionsmitteln getrennt und sie von dem ausgeschlossen, was zuvor gemeinsame gesellschaftliche Ressourcen waren. Er hat die Gemeingüter eingezäunt, gewohnheitsmäßige Nutzungsrechte abgeschafft und gemeinsame Ressourcen in das Privateigentum einer kleinen Minderheit verwandelt. Infolge dieser Klassenaufteilung zwischen Eigentümern und Produzenten muss die Mehrheit sich einem ganz besonderen Theater unterziehen (dem Arbeitsmarkt), um arbeiten 33zu können und das zu bekommen, was sie braucht, um weiterzuleben und ihre Kinder großzuziehen. Das Wichtige daran ist, wie sonderbar, wie »unnatürlich«, wie historisch anomal und eigentümlich das ist.
Jaeggi: Ja, und das führt uns zum zweiten Punkt: Der Kapitalismus hängt vom Vorhandensein freier Arbeitsmärkte ab. Kapitalistische Gesellschaften, wie wir sie kennen, neigten dazu, unfreie Arbeit von der Art, wie man sie in feudalen Gesellschaften kennt, abzuschaffen. Sie institutionalisierten freie Arbeit aufgrund der Annahme, dass die Arbeiter frei und gleich sind. Das ist zumindest die offizielle Version, ihr widerspricht jedoch in der Wirklichkeit die über zweihundertjährige Koexistenz des Kapitalismus mit der Sklaverei in der Neuen Welt. Aber abgesehen davon, wird die Arbeitskraft der »freien Arbeiter« als Ware behandelt, die die eine Seite eines rechtsgültigen Vertrags (der Arbeiter) besitzt und an die andere Seite (den Arbeitgeber-Kapitalisten) verkauft.
Historisch betrachtet, ist das eine enorme Veränderung mit gewaltigen Implikationen, die das Alltagsleben ebenso wie die Wirtschaftsstruktur der betroffenen Gesellschaften umgestaltet. Auch wenn wir Gesellschaften nicht in einem reduktionistischen Sinne so auffassen, dass sie in eine ökonomische Basis und einen ideologischen Überbau zerfallen, können wir doch sagen, dass sich ihre Form als Ganzes ändert, sobald dieser Wandel vollzogen ist. Da außerdem der freie Arbeitsmarkt für den Kapitalismus konstitutiv ist, finden die normativen Ideale von Freiheit und Gleichheit ihren Platz in einer wirklichen Institution. Sie sind nicht nur eine verschleiernde Verzierung; in gewissem Maße sind sie objektiviert und vorhanden. Der kapitalistische Arbeitsmarkt würde ohne rechtlich freie und unabhängige Vertragspartner nicht funktionieren. Das gilt sogar auch dann, wenn diese Ideale gleichzeitig gerade in und durch den Arbeitsmarkt korrumpiert werden. Was uns zu dem Umstand bringt, den Marx so eindringlich hervorhob: Im Kapitalismus ist die Arbeit in einem doppelten Sinne frei.2 Die Arbeiter haben die Freiheit zu arbeiten, aber auch »die Freiheit zu verhungern«, wenn sie keinen Arbeitsvertrag eingehen.
Fraser: Genau. Diejenigen, die als »Arbeiter« gelten, sind erstens frei im Sinne eines gesetzlichen Status. Sie sind nicht versklavt, keine Leibeigene, kein Erbbesitz oder auf andere Weise an einen gegebenen Ort oder bestimmten Herrn gebunden. Sie sind mobil 34und in der Lage, einen Arbeitsvertrag einzugehen. Aber die »Arbeiter« sind auch noch in einem zweiten Sinne frei: Wie wir eben gesagt haben, sind sie frei vom Zugang zu Subsistenz- und Produktionsmitteln, unter anderem von gewohnheitsmäßigen Nutzungsrechten mit Bezug auf Land und Werkzeuge. Mit anderen Worten, sie werden nicht von denjenigen Ressourcen und Berechtigungen behindert, die ihnen erlauben könnten, dem Arbeitsmarkt fern zu bleiben. Ihre Freiheit im ersten Sinne geht Hand in Hand mit ihrer Verletzlichkeit durch Zwänge, die der zweite Sinn mit sich bringt.
Gleichwohl möchte ich deinen Punkt unterstreichen, dass die Auffassung des Arbeiters als freien Individuums nicht schon die ganze Geschichte ist. Wie du sagtest, hat der Kapitalismus immer mit einer Menge unfreier und abhängiger Arbeit koexistiert – ich würde sogar sagen, dass er auf sie angewiesen war. Und wie ich gleich erläutern werde, wurde nicht jeder, der arbeitet oder produziert, als Arbeiter betrachtet, und es wurde ihm auch nicht der Status eines freien Individuums zugestanden – weshalb ich das Wort »Arbeiter« zuvor in Anführungszeichen setzte. Der entscheidende Punkt ist also, dass wir bei der Diskussion über die doppelte Freiheit des Arbeiters nur über einen Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirklichkeit des Kapitalismus sprechen – auch wenn es sich dabei um einen sehr wichtigen oder gar bestimmenden Ausschnitt handelt.
Jaeggi: Richtig. Wir müssen später auf diesen Punkt zurückkommen. Im Augenblick möchte ich jedoch hervorheben, dass der Begriff der Freiheit in einem »doppelten Sinne« nicht bedeutet, dass Freiheit und Gleichheit im Kapitalismus Fiktionen oder eine Art von Lippenbekenntnis sind. Diese Begriffe sind in dem tiefen Sinne ideologisch, auf den sich Adorno berief, als er sagte, dass Ideologien gleichzeitig wahr und falsch sind.3 Entscheidend ist, dass Freiheit und Gleichheit im Kapitalismus tatsächlich verwirklicht sind und freilich auch verwirklicht sein müssen, damit das System funktioniert. Und doch sind sie zugleich auch nicht verwirklicht: Die Wirklichkeit der kapitalistischen Arbeitsverhältnisse scheint diese Normen auszuhöhlen und ihnen zu widersprechen – und zwar nicht zufällig.
Fraser: Ich würde sagen, dass der Kapitalismus schmale, liberale Interpretationen von Freiheit und Gleichheit verwirklicht, während er systematisch die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung tieferer und angemessenerer Interpretationen ver35neint – Interpretationen, zu denen er gleichzeitig auffordert und die er kaltschnäuzig frustriert.
Jaeggi: Sprechen wir über unser drittes Merkmal: die Dynamik der Akkumulation des Kapitals. Das scheint eines der definierenden Merkmale des Kapitalismus zu sein.
Fraser: Ja, ganz gewiss. Hier finden wir das ebenso sonderbare Theater eines sich erweiternden Werts. Eine Eigentümlichkeit des Kapitalismus besteht darin, dass er eine objektive systemische Stoßrichtung oder Gerichtetheit hat: die Akkumulation von Kapital. Alles, was die Eigentümer tun, zielt auf die Erweiterung ihres Kapitals ab und muss darauf abzielen. Nicht zu expandieren, bedeutet zu sterben, den Konkurrenten zum Opfer zu fallen. Es handelt sich also nicht um eine Form von Gesellschaft, in der die Eigentümer sich einfach vergnügen und eine großartige Zeit erleben. Ebenso wie die Produzenten stehen auch sie unter einem besonderen Zwang. Und die Bemühungen von allen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse sind indirekt und eingespannt in etwas anderes, das den Vorrang übernimmt – ein übergeordneter Imperativ, der in ein unpersönliches System eingraviert ist –, der eigene Antrieb des Kapitals zu endloser Selbsterweiterung. Mit Bezug auf diesen Punkt ist Marx brillant. In einer kapitalistischen Gesellschaft, sagt er, wird das Kapital selbst zum Subjekt. Die Menschen sind seine Bauern, dazu verurteilt herauszufinden, wie sie das, was sie brauchen, in den Hohlräumen bekommen können, indem sie die Bestie füttern.
Jaeggi: Max Weber und Werner Sombart haben ebenfalls ausbuchstabiert, wie sonderbar diese Lebensform wirklich ist. Von Weber haben wir die berühmte Bemerkung, der zufolge das kapitalistische »Erwerbsstreben« zu einem Zweck an sich geworden ist, der gerade nicht auf die Erfüllung von Bedürfnissen, Wünschen, geschweige denn Glück, gerichtet ist.4 Und trotz seines nostalgischen und prämodernen Tenors ist Sombarts Buch über den modernen Kapitalismus im Hinblick auf dieses Problem besonders interessant, weil es voller Skizzen im Hinblick darauf ist, wie schwer sich die kapitalistische Dynamik aufrecht- bzw. am Leben erhalten lässt. In Frankreich zum Beispiel verkauften etliche erfolgreiche kapitalistische Unternehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Fabriken, um riesige Villen zu kaufen und ihr Leben zu genießen – um aus der Tretmühle und dem Hamsterrad herauszukommen. Sombart bezeichnet dieses Phänomen als »die Verfettung des Kapitalismus«, 36bei der die Kapitalisten ihre Initiative zur Akkumulation verlieren.5 Wir können auch die vielen Romane anführen, wie beispielsweise Gaskells Norden und Süden, die sich mit dem Übergang von einer vorkapitalistischen zu einer kapitalistischen Lebensform befassen.6
Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass diese Einstellungen und der »Geist des Kapitalismus« weit davon entfernt sind, selbstverständlich zu sein. Wenn wir also mit Marx davon sprechen, dass das Kapital zum wirklichen Subjekt wird, lässt das immer noch entscheidende philosophische Fragen mit Bezug darauf offen, ob wir es wirklich mit einer rein systemischen Selbstverewigung zu tun haben oder ob diese Redeweise nicht doch manche feinkörnigeren Voraussetzungen verschleiert, unter anderem die gesellschaftlichen Einstellungen, die die Aufrechterhaltung des Profitstrebens unterstützen. Ökonomische Praktiken sind immer schon in Lebensformen eingebettet, und wenn wir dies berücksichtigen, wird die Bemühung komplizierter, den Kapitalismus als System zu bestimmen, das unabhängig von ihnen beschrieben werden könnte – insbesondere dann, wenn wir die krasse Aufteilung zwischen einer unschuldigen »Lebenswelt« und einem freilaufenden »System« wirtschaftlicher Dynamik, die du selbst kritisiert hast, vermeiden wollen.7 Diese Aufteilung behandelt den Kapitalismus als eine sich selbst verewigende »Maschine«, die sich zwar von Menschen ernährt, aber keineswegs von ihnen angetrieben wird. Aber vielleicht sollten wir die Frage, was den Kapitalismus »nährt«, für den Augenblick zurückstellen.
Märkte: ein Grundmerkmal des Kapitalismus?
Jaeggi: Vielleicht sollten wir jetzt unserer Liste einer immer noch ziemlich orthodoxen Definition des Kapitalismus ein viertes Merkmal hinzufügen: die Zentralität von Märkten in der kapitalistischen Gesellschaft. Abgesehen von den Arbeitsmärkten scheinen Märkte im Allgemeinen die wichtigsten Institutionen zur Materialversorgung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu sein. Im Kapitalismus werden Güter typischerweise durch Marktmechanismen bereitgestellt.
Aber die Beziehung zwischen dem Kapitalismus und den Märkten ist kompliziert: Obwohl beide miteinander verschränkt sind, 37sind sie weit entfernt davon, identisch zu sein. Der Kapitalismus ist mehr als eine »Marktgesellschaft«. Märkte gab es in nicht- oder vorkapitalistischen Gesellschaften, und umgekehrt könnten wir uns eine sozialistische Gesellschaft vorstellen, die Marktmechanismen beinhaltet. Daher ist es wichtig, die Beziehung zwischen beiden zu untersuchen.
Fraser: Einverstanden. Die Beziehung zwischen Kapitalismus und Märkten ist meines Erachtens recht kompliziert und muss sorgfältig entwickelt werden. Ich würde wieder damit beginnen, Marx ins Gedächtnis zurückzurufen. Für Marx ist der Markt eng verknüpft mit der Warenform. Und die Warenform ist bloß der Ausgangspunkt für die theoretische Durchdringung des Kapitalismus, nicht deren Endpunkt. In den Eröffnungskapiteln von Das Kapital wird sie als das Reich der Erscheinungen dargestellt, als die Gestalt, in der die Dinge ursprünglich erscheinen, wenn wir den Standpunkt des gesunden Menschenverstands der bürgerlichen Gesellschaft einnehmen, die Perspektive des Austauschs auf dem Markt. Von dieser ursprünglichen Perspektive führt uns Marx rasch zu einer anderen und tieferen, die der Gesichtspunkt der Produktion und Ausbeutung ist. Die Implikation lautet, dass es für den Kapitalismus etwas Fundamentaleres gibt als den Markt: nämlich die Organisation der Produktion durch die Ausbeutung der Arbeit als Motor, der den Mehrwert generiert. Mit anderen Worten, das Kapital expandiert nicht durch den Austausch von Äquivalenten, sondern gerade durch sein Gegenteil: durch die Nicht-Vergütung eines Teils der Arbeitszeit der Arbeiter. Das zeigt uns bereits, dass der Austausch auf einem Markt an sich nicht der Kern der Sache ist.
Jaeggi: Aber meinst du nicht, dass in die ersten drei Kernmerkmale des Kapitalismus, die wir eben bestimmt haben, schon eine vermarktlichende Tendenz eingebaut ist? Wenn man sich vorstellt, dass diese drei zusammenkommen, um ein dynamisches System zu bilden, erhält man schließlich ein Bild von der Welt, in dem immer mehr Dinge auf Märkten gekauft, verkauft und gehandelt werden.
Fraser: Vielleicht. Aber für mich ist die entscheidende Frage: welche Art von Märkten? Wie du sagtest, gibt es Märkte in vielen nicht-kapitalistischen Gesellschaften, und sie nehmen eine verblüffende Vielfalt von Formen an – ein Punkt, der für Karl Polanyi zentral ist.8 Unsere Frage sollte daher lauten: Was ist das Besondere an Märkten in kapitalistischen Gesellschaften?
38Jaeggi: Ja, einverstanden, vor allem weil diese Sache sich leicht zur ideologischen Mystifizierung eignet. Ist dir klar, dass in Deutschland der Begriff »Kapitalismus« mehr abwertende Konnotationen hat als in der englischsprachigen Welt und dass deutsche Ökonomen daher lieber überhaupt nicht von Kapitalismus sprechen? Ihrer Auffassung zufolge ist man schon zu kritisch, wenn man das Wort »Kapitalismus« benutzt. Lehrbücher verwenden typischerweise den euphemistischen Ausdruck »Marktgesellschaft«. Ein ähnlicher Zug wurde (in deinem Land) vom Bildungsrat in Texas gemacht, indem angeordnet wurde, dass alle Geschichtslehrbücher nicht länger von »Kapitalismus« sprechen, sondern ihn stattdessen als »das System freier Unternehmen« bezeichnen.9
Diese Ausdrucksweise ist ideologisch – nicht zuletzt deshalb, weil sie eine wichtige Frage verschleiert: Worin besteht