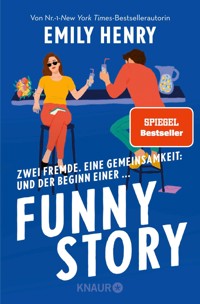9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei beste Freunde – zehn gemeinsame Urlaube – eine letzte Chance für die Liebe? Die romantische Komödie der amerikanischen Bestseller-Autorin Emily Henry ist ein Roman wie ein perfekter Sommer: heiter, heiß, und voller verlockender Möglichkeiten! Eigentlich hat die abenteuerlustige Poppy in New York alles, was sie sich schon immer gewünscht hat. Wirklich glücklich war sie trotzdem seit jenem Sommer-Urlaub vor zwei Jahren nicht mehr, als sie zum letzten Mal mit ihrem besten Freund Alex verreist ist. Seitdem haben sie nicht mal mehr miteinander gesprochen. Also fasst Poppy sich ein Herz und bittet Alex, noch einmal mit ihr in Urlaub zu fahren, um über alles zu reden. Wie durch ein Wunder sagt er zu. Jetzt darf nur diese eine Wahrheit nicht zur Sprache kommen, die seit zehn Jahren still und heimlich im Zentrum ihrer scheinbar perfekten Freundschaft steht … »Kein Sommer ohne dich« stand auf Platz 1 der »New York Times«-Bestseller-Liste. Entdecke auch Emily Henrys romantische Komödie »Verliebt in deine schönsten Seiten« über die frisch getrennte Romance-Autorin January und den arroganten Literaten Gus, die versuchen, den Roman des jeweils anderen zu schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Emily Henry
Kein Sommer ohne dich
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwei beste Freunde. Zehn gemeinsame Urlaube. Eine letzte Chance für die Liebe?
Eigentlich hat die abenteuerlustige Poppy in New York alles, was sie sich schon immer gewünscht hat. Wirklich glücklich war sie trotzdem seit jenem Sommerurlaub vor zwei Jahren nicht mehr, als sie zum letzten Mal mit ihrem besten Freund Alex verreist ist. Seitdem haben sie nicht mal mehr miteinander gesprochen. Also fasst Poppy sich ein Herz und bittet Alex, noch einmal mit ihr in Urlaub zu fahren, um über alles zu reden. Wie durch ein Wunder sagt er zu. Jetzt darf nur diese eine Wahrheit nicht zur Sprache kommen, die seit zehn Jahren still und heimlich im Zentrum ihrer scheinbar perfekten Freundschaft steht …
»Eine warmherzige, liebevolle und witzige Alltagsflucht, von der man sich wünscht, sie würde nie enden.«
Jodi Picoult
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Danksagung
Das letzte habe ich hauptsächlich für mich selbst geschrieben.
Dieses hier ist für euch.
Prolog
Im Urlaub kann man sein, wer immer man sein will.
Wie ein gutes Buch oder ein tolles Outfit lässt einen der Urlaub zu einer anderen Version seiner selbst werden.
Im Alltag schafft man es vielleicht nicht einmal, mit dem Kopf im Takt zu einem Song aus dem Radio zu nicken, ohne dass es einem peinlich ist, aber auf der richtigen, mit glitzernden Lichtern geschmückten Terrasse, mit der richtigen Band im Hintergrund, wirbelt man herum wie ein Profi.
Im Urlaub verändert sich auch das Haar. Das Wasser ist anders, vielleicht auch das Shampoo. Vielleicht wäscht oder bürstet man sich überhaupt nicht mehr die Haare, weil das Salzwasser sie so schön lockt.
Man denkt: Vielleicht könnte ich das zu Hause auch so machen. Vielleicht kann ich auch dort dieser Mensch sein, der sich die Haare nicht kämmt, dem es egal ist, ob er verschwitzt ist oder überall Sand hat.
Im Urlaub spricht man völlig Fremde an und vergisst die Risiken. Wenn es ganz schrecklich peinlich wird – völlig egal! Man sieht sie ohnehin nie wieder.
Man ist, wer man sein will. Kann tun, was man will.
Na gut, vielleicht nicht alles. Manchmal zwingt einen das Wetter in eine bestimmte Situation wie zum Beispiel die, in der ich mich gerade befinde, und man muss einen Plan B finden, um Spaß zu haben, während man das Ende des Regens abwartet.
Auf meinem Weg zurück von der Toilette bleibe ich stehen. Teilweise deshalb, weil ich immer noch an meinem Plan tüftele. Hauptsächlich aber, weil der Fußboden so klebrig ist, dass ich meine Sandale verliere und zurückhumpeln muss, um sie zu holen. Theoretisch liebe ich alles an diesem Lokal, aber praktisch bin ich mir sicher, dass ich hier gute Chancen habe, mir eine von diesen seltenen Krankheiten einzufangen, die sie in den tiefgefrorenen Reagenzgläsern eines geheimen Seuchenzentrums aufbewahren, sobald ich mit dem bloßen Fuß das schmutzige Laminat berühre.
Halb hüpfend, halb tanzend, gelange ich zurück zu meinem Schuh, gleite mit den Zehen durch die dünnen orangefarbenen Riemchen und drehe mich zur Bar um: die Menge klebriger Körper, die Ventilatoren an der Decke, die sich träge drehen, die aufgesperrte Tür, die hin und wieder einen regennassen Windstoß aus der schwarzen Nacht in die verschwitzte Menge durchlässt. In der Ecke spielt eine Jukebox, die in allen Neonfarben leuchtet, »I Only Have Eyes for You« von den Flamingos.
Es ist zwar ein Feriendorf, doch die Bar ist für Einheimische – ohne bedruckte Strandkleidchen und Tommy-Bahama-Shirts, aber leider auch ohne Cocktails mit Spießchen, auf denen tropische Fruchtstückchen stecken.
Wenn das Unwetter nicht wäre, hätte ich meinen letzten Abend hier woanders verbracht. Die ganze Woche lang hat es ununterbrochen wie aus Eimern gegossen und ständig gedonnert, sodass meine Träume von schneeweißen Stränden und glänzenden Schnellbooten zerstört wurden. Zusammen mit den anderen enttäuschten Reisenden habe ich meine Tage damit verbracht, Piña Coladas in jeder brechend vollen Touristenfalle zu kippen, die ich finden konnte.
Aber heute konnte ich keine Menschenmengen, langen Wartezeiten oder grauhaarige Männer mit Eheringen mehr ertragen, die mir über die Schultern ihrer Ehefrauen zuzwinkerten. Deshalb bin ich heute hier.
In einer Bar mit klebrigem Fußboden, die schlicht BAR heißt, suche ich in der Menschenmenge nach meinem Ziel.
Es sitzt in der Ecke der BAR-Bar. Ein Mann, ungefähr in meinem Alter, fünfundzwanzig, sandfarbenes Haar und groß gewachsen mit breiten Schultern, wobei er so zusammengesunken dasitzt, dass man die letzten beiden Eigenschaften vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Er hat sich über sein Handy gebeugt. Ich sehe den konzentrierten Ausdruck in seinem Profil. Er kaut auf seiner vollen Unterlippe herum und streicht langsam über das Display.
Obwohl es hier nicht so voll ist wie in Disney-World, ist es dennoch laut. Auf halbem Weg zwischen der Jukebox, aus der schreckliche Songs aus den späten Fünfzigern jaulen, und dem an der Wand befestigten Fernseher gegenüber, aus dem der Wettermann schreiend über alle Rekorde brechende Regenfälle informiert, steht eine grölende Männergruppe, in der immer wieder plötzlich lautes Gelächter aufbrandet. Hinter dem Tresen klatscht der Barmann mit der Hand auf die Theke, um zu betonen, was er einer gelbhaarigen Frau erzählt.
Das Unwetter macht die ganze Insel unruhig, und das billige Bier macht die Leute rauflustig.
Aber der Mann mit dem sandfarbenen Haar, der in der Ecke sitzt, ist so ruhig, dass er auffällt. Eigentlich schreit alles an ihm: Ich gehöre nicht hierher. Trotz der fast dreißig Grad und einer Million Prozent Luftfeuchtigkeit trägt er ein zerknittertes langärmeliges Hemd und eine marineblaue Hose. Er hat außerdem verdächtig wenig Sonnenbräune, lacht nicht, benimmt sich nicht lustig oder leichtsinnig. Bingo.
Ich schiebe mir die blonden Locken aus dem Gesicht und mache mich auf den Weg zu ihm. Er schaut weiter auf sein Handy, die Finger ziehen langsam nach oben, was er liest. Ich kann die fett geschriebenen Worte Kapitel neunundzwanzig erkennen.
Der liest doch tatsächlich ein Buch in einer Bar.
Ich gleite neben ihn, stütze die Ellbogen auf die Theke und wende mich ihm zu. »Hallo, Tiger.«
Seine haselnussbraunen Augen sehen mich an und blinzeln. »Hallo?«
»Bist du häufiger hier?«
Er betrachtet mich eine Weile, offenbar wägt er die möglichen Antworten darauf gegeneinander ab. »Nein«, sagt er schließlich. »Ich wohne hier nicht.«
»Oh«, sage ich, aber bevor ich weitersprechen kann, fährt er schon fort.
»Und selbst wenn ich hier wohnte – ich habe eine kranke Katze, die besonderer Pflege bedarf. Da kann ich schwer ausgehen.«
Ich muss bei jedem Teil dieses Satzes die Stirn runzeln. »Tut mir ja so leid«, bringe ich endlich heraus. »Es muss schrecklich sein, sich um all das zu kümmern, während man gleichzeitig mit einem Todesfall fertigwerden muss.«
Er zieht die Brauen zusammen. »Einem Todesfall?«
Ich beschreibe einen Kreis mit der Hand und zeige auf sein Outfit. »Bist du nicht für eine Beerdigung in dieser Stadt?«
Er presst die Lippen fest aufeinander. »Bin ich nicht.«
»Und was führt dich dann hierher?«
»Eine Freundin.« Sein Blick fällt wieder aufs Handy.
»Wohnt sie hier?«
»Hat mich hierhergezerrt«, korrigiert er mich. »Um Urlaub zu machen.« Die letzten Worte spricht er voller Verachtung aus.
Ich verdrehe die Augen. »Du meine Güte! Sie hat dich von deiner Katze fortgezerrt? Ohne eine gute Entschuldigung, nur zum Vergnügen und zur Erheiterung? Bist du sicher, dass du sie wirklich eine Freundin nennen kannst?«
»Mit jeder Sekunde weniger«, versetzt er, ohne aufzuschauen.
Er gibt mir nicht viel, womit ich arbeiten kann, aber ich gebe nicht auf. Also hake ich nach: »Wie ist diese Freundin denn so? Heiß? Klug? Reich?«
»Klein«, antwortet er und liest weiter. »Laut. Hält nie den Mund, labert Ewigkeiten über jedes Kleidungsstück, das sie oder ich anziehen, hat eine schreckliche Vorstellung von Romantik, schluchzt sich durch die Werbeclips für die Volkshochschule – die, in denen die alleinerziehende Mutter spätnachts an ihrem Computer arbeitet, und wenn sie einschläft, kommt ihr Sohn und legt ihr lächelnd eine Decke über die Schultern, weil er so stolz auf sie ist. Was noch? Oh, sie ist besessen von beschissenen Spelunken, die schon von Weitem nach Salmonellen stinken. Ich fürchte mich schon davor, hier nur das Bier aus der Flasche zu trinken – hast du die Rezensionen auf Yelp gesehen?«
»Soll das jetzt ein Witz sein?« Ich verschränke die Arme vor der Brust.
»Na ja, Salmonellen haben keinen Geruch, aber ja, Poppy, du bist ziemlich klein.«
»Alex!« Ich gebe ihm einen Klaps auf den Oberarm. Damit habe ich meine Rolle verlassen. »Ich versuche doch, dir zu helfen.«
Er reibt sich den Arm. »Wie willst du mir denn helfen?«
»Ich weiß, dass Sarah dir das Herz gebrochen hat, aber du musst wieder rausgehen. Und wenn dich eine heiße Braut an der Bar anspricht, solltest du auf gar keinen Fall die Abhängigkeitsbeziehung zwischen dir und deiner Arschlochkatze erwähnen.«
»Erst einmal, Flannery O’Connor ist kein Arschloch. Sie ist nur schüchtern.«
»Sie ist fies.«
»Sie mag dich einfach nicht«, beharrt er. »Du hast eben eine starke Hundeenergie.«
»Ich habe nur versucht, sie zu streicheln. Wozu ein Haustier haben, wenn es nicht gestreichelt werden will?«
»Sie will gestreichelt werden«, erwidert Alex. »Du näherst dich ihr nur immer mit diesem, na ja, wölfischen Glitzern in den Augen.«
»Tu ich nicht.«
»Poppy, du näherst dich allem mit einem wölfischen Glitzern in den Augen.«
In diesem Moment stellt die Kellnerin den Drink auf die Theke, den ich bestellt habe, bevor ich aufs Klo musste. »Miss? Ihre Margarita.« Sie schubst das eisgekühlte Glas die Theke entlang zu mir, und in meiner Kehle entsteht sofort ein begeisterter Durst, als ich es abfange. Ich hebe es so hastig an, dass ein ziemlich großer Schluck Tequila über den Rand schwappt, und mit übernatürlicher und erprobter Schnelligkeit reißt mir Alex den anderen Arm von der Theke, bevor ich Alkohol darüberkleckere.
»Siehst du? Wölfisches Glitzern.« Alex sagt es leise und ernsthaft, so, wie er so ziemlich jedes an mich gerichtete Wort ausspricht, außer an jenen seltenen und heiligen Abenden, an denen Weirdo-Alex ausbricht und ich ihn zum Beispiel beim Karaoke auf dem Boden liegen sehe, wie er mit wirrem Haar und zerknittertem Anzughemd so tut, als schluchzte er in ein Mikrofon. Nur ein theoretisches Beispiel. Von etwas, das tatsächlich ganz genau so schon passiert ist.
Alex Nilsen ist der Inbegriff von Selbstkontrolle. In diesem hochgewachsenen, breitschultrigen, ständig gebeugten und/oder zu einer Brezel zusammengeringelten Körper befinden sich ein Übermaß an Stoizismus (vermutlich die Folge davon, dass er das älteste Kind eines Witwers ist, der so viel über seine Sorgen spricht, wie ich es noch von niemandem gehört habe), eine Riesenmenge Verdrängung (die Folge einer streng religiösen Erziehung, die in direktem Gegensatz zu den meisten seiner Leidenschaften steht; vor allem der Wissenschaft), und außerdem der merkwürdigste, insgeheim albernste und absolut weichherzigste Dussel, den ich je das Vergnügen hatte kennenzulernen.
Ich nehme einen Schluck von der Margarita, und ein freudiges Summen entringt sich mir.
»Hund in einem Menschenkörper«, murmelt Alex vor sich hin, bevor er sich wieder seinem Handy zuwendet.
Ich schnaube, um ihm zu zeigen, dass ich seinen Kommentar missbillige, und nehme einen weiteren Schluck. »Übrigens besteht diese Margarita zu ungefähr neunzig Prozent aus Tequila. Ich hoffe, du wirst diesen schwer zufriedenzustellenden Leuten auf Yelp sagen, sie sollen sich ihre Kommentare in den Allerwertesten schieben. Und dass es hier überhaupt nicht nach Salmonellen stinkt.« Ich setze mich auf den Barhocker neben ihm und drehe mich so, dass sich unsere Knie berühren. Ich mag es, dass er immer so sitzt, wenn wir zusammen ausgehen: mit seinem Oberkörper der Bar zugewandt, die langen Beine in meine Richtung gedreht, als versuchte er, nur für mich eine geheime Tür zu sich selbst offenzuhalten. Und nicht nur eine Tür, die zu dem reservierten, niemals voll lächelnden Alex Nilsen führt, den der Rest der Welt sieht, sondern einen Weg direkt zum Weirdo-Alex.
Dem Alex, der solche Reisen mit mir unternimmt, Jahr für Jahr, obwohl er Fliegen und Veränderung und jedes andere Kissen hasst, das nicht dasjenige ist, auf dem er zu Hause schläft.
Ich mag es, dass er, wenn wir ausgehen, immer sofort auf den Tresen zugeht, weil er weiß, dass ich da gern sitze, obwohl er mal zugegeben hat, dass es ihn furchtbar stresst, ständig überlegen zu müssen, ob er zu langen oder zu kurzen Blickkontakt zum Barpersonal hält.
Um ehrlich zu sein, mag und/oder liebe ich so ziemlich alles an meinem besten Freund Alex Nilsen, und ich möchte, dass er glücklich ist. Obwohl ich seine früheren Freundinnen nicht besonders mochte – was besonders für seine Ex Sarah gilt –, sehe ich es als meine Aufgabe an, ihn daran zu hindern, sich nach der Enttäuschung mit ihr vollständig in einen Eremiten zu verwandeln. Er würde immerhin dasselbe für mich tun, was er auch schon bewiesen hat.
»Also, sollen wir noch mal von vorn anfangen? Ich bin die sexy Fremde an der Bar, und du bist ganz du selbst, nur in charmant und ohne das Katzenzeug. Dann bekommen wir dich sofort wieder zurück auf den Dating-Markt.«
Er schaut von seinem Handy auf und schmunzelt beinahe. Ich nenne es schmunzeln, denn mehr bekommt man von Alex nicht. »Du meinst, die Fremde, die das Gespräch mit einem gut platzierten ›Hallo, Tiger‹ beginnt? Wir haben womöglich unterschiedliche Vorstellungen davon, was ›sexy‹ ist.«
Ich drehe mich auf meinem Hocker um. Unsere Knie stoßen aneinander, als ich mich von ihm ab- und wieder zuwende, wobei ich ein flirty Lächeln aufsetze. »Hat es wehgetan …«, sage ich, »… als du vom Himmel gefallen bist?«
Er schüttelt den Kopf. »Poppy, es ist mir wirklich wichtig, dass du weißt«, er hält kurz inne, eher er langsam weiterspricht, »dass es absolut nichts mit deiner sogenannten Hilfe zu tun haben wird, sollte ich tatsächlich irgendwann wieder auf ein Date gehen.«
Ich stehe auf, kippe dramatisch den Rest meines Glases und knalle es auf die Theke. »Na gut, was meinst du, sollen wir von hier verschwinden?«
»Wie kann es bloß sein, dass du mehr Erfolg beim Daten hast als ich?«, sagt er, als handele es sich um ein großes Rätsel.
»Oh, das ist leicht. Ich habe einfach niedrigere Erwartungen. Und keine Flannery O’Connor, die dazwischenkommen kann. Und wenn ich in Bars gehe, verbringe ich nicht die ganze Zeit damit, finster auf die Yelp-Rezensionen zu starren und mit aller Kraft SPRICH MICH BLOSS NICHT AN auszustrahlen. Außerdem bin ich wohl von manchen Blickwinkeln aus betrachtet ziemlich hinreißend.«
Er steht auf, legt einen Zwanziger auf die Theke und steckt die Brieftasche dann zurück in die Hosentasche. Alex hat immer Bargeld dabei. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ihn bestimmt schon dreimal danach gefragt. Er hat auch geantwortet. Ich weiß es aber immer noch nicht, weil seine Antwort entweder zu langweilig oder zu intellektuell fordernd für mein Hirn war, als dass ich sie mir hätte merken können.
»Ändert nichts an der Tatsache, dass du echt ein Freak bist.«
»Du hast mich lieb«, betone ich, klinge dabei aber ein winziges bisschen defensiv.
Er legt mir den Arm um die Schulter und schaut auf mich herunter, wieder liegt ein kleines, zurückhaltendes Lächeln auf seinen vollen Lippen. Sein Gesicht ist wie ein Filter, der jeweils nur einen Hauch Ausdruck durchlässt. »Ich weiß das.«
Ich grinse ihn an. »Ich hab dich auch lieb.«
Er kämpft gegen sein Lächeln an, bemüht sich, es klein und nur angedeutet zu halten. »Das weiß ich auch.«
Ich fühle mich leicht schläfrig und faul vom Tequila und lehne mich an ihn, während wir zur offenen Tür gehen. »Das war eine schöne Reise«, sage ich.
»Die beste bisher«, stimmt er zu. Der kühle Regen wirbelt wie Konfetti um uns herum. Er zieht mich ein wenig näher an sich heran, warm und schwer, und sein sauberer Zedernholzduft legt sich mir über die Schultern wie ein Umhang.
»Ich habe eigentlich gar nichts gegen den Regen«, sage ich, als wir in die stockdunkle, nasse Nacht treten.
»Ich fand ihn sogar besser als die ewige Sonne.« Alex nimmt mir den Arm von der Schulter und hebt ihn an, um sich in einen provisorischen menschlichen Regenschirm zu verwandeln. Wir rennen über die überflutete Straße und auf unser kleines rotes Mietauto zu. Als wir es erreichen, löst er sich von mir und öffnet mir die Tür – wir haben eine Ermäßigung bekommen, weil wir ein Auto ohne Verriegelungsautomatik und automatische Fensterheber genommen haben –, rennt dann um den Kühler herum und setzt sich hinters Lenkrad.
Alex startet den Motor. Die Klimaanlage läuft auf vollen Touren und zischt ihren eiskalten Strahl auf unsere nassen Kleider. Er fährt vom Parkplatz und biegt auf die Straße.
»Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja in der Bar gar keine Fotos für deinen Blog gemacht haben.«
Ich beginne zu lachen und merke dann, dass er keinen Scherz gemacht hat. »Alex, die Leute wollen auf meinem Blog ganz bestimmt keine Bilder von der BAR-Bar sehen. Sie wollen nicht einmal über sie lesen.«
Er zuckt mit den Achseln. »Ich fand die BAR gar nicht so übel.«
»Du hast gesagt, dass es dort nach Salmonellen stinkt.«
»Davon mal abgesehen.« Er setzt den Blinker und fährt den engen, von Palmen gesäumten Weg entlang, der zu unserem Haus führt.
»Ich habe eigentlich überhaupt keine brauchbaren Bilder von dieser Woche.«
Alex zieht die Brauen zusammen und reibt sich die Stirn. Auf der Schottereinfahrt wird er langsamer.
»Abgesehen von denen, die du gemacht hast«, füge ich hastig hinzu. Die Bilder, die Alex für meine Social-Media-Accounts gemacht hat, sind wirklich scheußlich. Aber ich finde es so lieb von ihm, dass er sie überhaupt gemacht hat, dass ich bereits das am wenigsten scheußliche ausgewählt und gepostet habe. Er hat mein Gesicht darauf erwischt, als ich gerade vor Lachen gekreischt habe, weil er – ziemlich unbeholfen – versucht hat, mir beim Posieren Anweisungen zu geben. Man sieht, wie sich die Unwetterwolken über mir zusammenballen, und es wirkt, als wäre ich diejenige, die die Apokalypse über Sanibel Island heraufbeschwört. Aber immerhin sehe ich darauf glücklich aus.
Wenn ich mir das Foto ansehe, weiß ich gar nicht mehr, was Alex so Lustiges zu mir gesagt hat oder was ich zurückgeschrien habe. Aber ich spüre wieder dieselbe Wärme, die mich immer erfüllt, wenn ich an unsere Sommerurlaube denke.
Dieser Schwall von Glück, dieses Gefühl, dass es genau das hier ist, worum es im Leben geht: an einem wunderschönen Ort zu sein, mit jemandem, den man mag.
Ich habe versucht, in der Bildunterschrift so etwas in der Richtung zu schreiben, aber es war dann doch zu schwierig zu erklären.
Normalerweise geht es in meinen Posts darum, mit möglichst wenig Geld zu reisen, aber wenn einem hunderttausend Menschen folgen, um einen Strandurlaub zu sehen, ist es am besten, ihnen … einen Strandurlaub zu zeigen.
In der letzten Woche waren wir insgesamt ungefähr vierzig Minuten am Ufer von Sanibel Island. In der restlichen Zeit haben wir uns in Bars und Restaurants verzogen, in Buchläden und Secondhandshops. Ansonsten haben wir uns viel in dem schäbigen Bungalow aufgehalten, den wir gemietet haben. Wir haben Popcorn gegessen und Blitze gezählt. Wir sind nicht braun geworden, haben keine tropischen Fische gesehen, sind nicht geschnorchelt, haben uns nicht auf Katamaranen gesonnt. Wir haben überhaupt nicht viel anderes gemacht, als auf dem durchgelegenen Sofa immer wieder zu den Geräuschen von Twilight Zone einzuschlafen und wieder aufzuwachen.
Es gibt Orte, die man immer in ihrer vollen Pracht sieht, ob es nun sonnig ist oder nicht, aber dieser hier gehört nicht dazu.
»Hey«, sagt Alex und stellt das Auto ab.
»Hey, was?«
»Komm, wir machen ein Foto. Von uns beiden.«
»Du hasst es, fotografiert zu werden«, wende ich ein. Was ich immer merkwürdig fand, weil Alex rein theoretisch extrem gutaussehend ist.
»Ich weiß. Aber es ist dunkel, und ich möchte mich später daran erinnern.«
»Okay«, willige ich ein. »Ja. Wir machen ein Foto.«
Ich greife nach meinem Handy, aber er hat seins schon in der Hand. Doch statt es so hochzuhalten, dass das Display auf uns gerichtet ist, damit wir uns sehen können, hat er es umgedreht, sodass die richtige Kamera auf uns zeigt. »Was machst du da?«, frage ich und greife nach seinem Handy. »Dafür gibt es doch den Selfie-Modus, Opa.«
»Nein!« Er lacht und reißt es aus meiner Reichweite. »Es soll nicht für deinen Blog sein – wir müssen darauf nicht gut aussehen. Wir müssen nur aussehen wie wir selbst. Wenn wir es mit dem Selfie-Modus machen sollen, will ich überhaupt keins.«
»Du musst dir mit deinem krankhaften Körperbild wirklich helfen lassen.«
»Wie viele tausend Bilder habe ich schon für dich gemacht, Poppy? Lass uns dieses eine so machen, wie ich es will.«
»Na gut.« Ich beuge mich über die Gangschaltung und schmiege mich an seine feuchte Brust. Er neigt den Kopf etwas, um unseren Größenunterschied auszugleichen.
»Eins … zwei …« Der Blitz geht los, bevor er bei drei angekommen ist.
»Du Monster!«, schimpfe ich.
Er dreht das Handy, um sich das Foto anzusehen, und stöhnt. »Neeeeiiin. Ich bin wirklich ein Monster.«
Ich verschlucke mich fast vor Lachen, als ich mir unsere geisterhaft verschwommenen Gesichter ansehe: Sein nasses Haar steht stachelig zu allen Seiten ab, meins klebt in dünnen Strähnen an meiner Wange. Alles an uns glänzt und ist von der Hitze gerötet. Ich habe die Augen geschlossen, seine blinzeln und sind verquollen. »Wie kann es sein, dass man uns kaum erkennen kann und wir trotzdem so schlimm aussehen?«
Er lacht und lehnt sich an die Kopfstütze. »Na gut, ich lösche es.«
»Nein!« Ich entwinde ihm das Handy. Er greift danach, aber ich lasse es nicht los, weshalb wir es schließlich beide über der Gangschaltung festhalten. »Darum ging es doch, Alex. Du wolltest dich an diese Reise erinnern, wie sie wirklich war. Und wir sollten auf dem Bild aussehen wie wir selbst.«
Sein Lächeln ist jetzt wieder so klein und schwach wie immer. »Poppy, du siehst überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild.«
Ich schüttele den Kopf. »Du auch nicht.«
Einen langen Augenblick schweigen wir, als gäbe es nichts mehr zu sagen, jetzt, da wir das geklärt haben.
»Nächstes Jahr fahren wir wohin, wo es kalt ist«, sagt Alex. »Und trocken.«
»Gut«, erwidere ich grinsend. »Wir fahren wohin, wo es kalt ist.«
1
Poppy.« Swapna blickt mich vom Kopf des stumpf grauen Konferenztisches aus an. »Was hast du für uns?«
Als gütige Herrscherin über das Rest + Relaxation-Imperium könnte Swapna Bakshi-Highsmith die zwei Werte unseres feinen Magazins kaum weniger ausstrahlen.
Als Swapna sich das letzte Mal etwas Ruhe und Entspannung gegönnt hat, war sie im neunten Monat schwanger und wurde vom Arzt zur Bettruhe gezwungen. Das war vor drei Jahren. Und selbst da verbrachte sie die ganze Zeit mit Videochats mit ihrem Büro, den Laptop auf dem Bauch balancierend. Daher glaube ich kaum, dass sie sich dabei entspannt hat. Alles an ihr ist scharf und spitz und klug, von ihrem zurückgekämmten, topmodischen Bob bis hin zu ihren mit Nieten besetzten Alexander-Wang-Pumps.
Mit ihrem geschwungenen Lidstrich könnte sie eine Aluminiumdose zerschneiden und sie anschließend mit einem Blick aus ihren smaragdgrünen Augen zermalmen. In diesem Augenblick sind beide direkt auf mich gerichtet. »Poppy? Hallo?«
Ich blinzele, fasse mich wieder und rücke auf die Stuhlkante vor. Dann räuspere ich mich. Das hier passiert mir in letzter Zeit oft. Wenn man einen Job hat, für den man nur einmal die Woche ins Büro kommen muss, ist es nicht gerade ideal, fünfzig Prozent der Bürozeit gedanklich abzuschalten wie ein Kind im Algebraunterricht, und schon gar nicht sollte man das vor seiner gleichermaßen furchterregenden wie inspirierenden Chefin tun.
Ich studiere das Notizbuch vor mir. Früher bin ich zu den Freitagsmeetings immer mit massenweise aufgeregt hingekritzelten Einfällen gekommen. Ideen für Geschichten über unbekannte Feste in anderen Ländern, hiesige Restaurants mit frittierten Desserts, über Naturphänomene an bestimmten Buchten Südamerikas, trendige Weingüter in Neuseeland – über neue Trends für abenteuerlustige Leute oder für diejenigen, die sich lieber in Spas erholen.
Ich schrieb mir diese Notizen früher immer in einer Art panischem Rausch auf, als wäre jedes Erlebnis, das ich eines Tages machen wollte, ein lebendiges Wesen in meinem Körper, das sich ausbreitete und dann, wenn es groß genug war, aus mir herausbrechen wollte. Drei Tage vor den Meetings im Büro verbrachte ich in einer Art schwitzigen Google-Trance, scrollte mich durch Bilder von Orten, an denen ich noch nie gewesen war, und dabei breitete sich ein Gefühl wie Hunger in meinen Eingeweiden aus.
Heute habe ich mir nur zehn Minuten genommen, um ein paar Ländernamen aufzuschreiben.
Länder, nicht einmal Städte.
Swapna sieht mich an und wartet, dass ich ihr von meinem großen Sommer-Feature fürs nächste Jahr erzähle, und ich starre das Wort Brasilien an.
Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde. Die Fläche von Brasilien nimmt 5,6 Prozent der Erdoberfläche ein. Man kann keinen kurzen, schmissigen Artikel über einen Urlaub in Brasilien schreiben. Dafür müsste man zumindest erst einmal eine bestimmte Region auswählen.
Ich blättere die Seite in meinem Notizbuch um und tue so, als betrachtete ich die nächste. Sie ist leer. Als sich mein Kollege Garrett zu mir herüberbeugt, als wollte er über meine Schulter hinweg mitlesen, knalle ich das Buch zu. »St. Petersburg.«
Swapna zieht eine Augenbraue hoch und geht um den Tisch herum.
»Wir haben St. Petersburg schon vor drei Jahren in unserer Sommerausgabe gemacht. Die Feiern zu den Weißen Nächten, erinnerst du dich?«
»Amsterdam?«, wirft Garrett neben mir in die Runde.
»Amsterdam ist eine Frühlingsstadt.« Swapna klingt leicht verärgert. »Niemand schreibt über Amsterdam, ohne über die Tulpen zu berichten.«
Ich habe mal gehört, dass sie schon in mindestens fünfundsiebzig Ländern war, in einigen von ihnen sogar zweimal.
Sie hält ihr Handy in der einen Hand und schlägt es gegen die Handfläche der anderen, während sie nachdenkt. »Außerdem ist Amsterdam so … trendy.«
Es ist Swapnas tiefste Überzeugung, dass im Trend bedeutet, den Trend schon wieder verpasst zu haben. Wenn sie spürt, dass der Zeitgeist sich für Toruń in Polen erwärmt, ist Toruń für die nächsten Jahre gestrichen. Es gibt tatsächlich eine Liste, die mit einer Heftzwecke an einer Wand bei den Arbeitsplätzen angebracht ist (Toruń steht allerdings nicht darauf), auf der all die Orte aufgeführt sind, über die R+R nicht berichtet. Jeder Ort ist handschriftlich von ihr notiert und mit einem Datum versehen worden, und es gibt eine geheime Tippgemeinschaft, die Wetten darauf abschließt, wann eine Stadt wieder von der Liste verschwindet. Nie herrscht so große, wenn auch stille Begeisterung im Büro wie an jenen Morgen, wenn Swapna mit ihrem Designer-Laptop unter dem Arm ins Büro und mit gezücktem Stift direkt zur Liste marschiert, um eine von diesen mit einem Bann belegten Städte wieder zu streichen.
Alle schauen dann mit angehaltenem Atem zu und fragen sich, welche Stadt sie aus der Unsichtbarkeit für R+R befreit, und kaum ist Swapna in ihrem Büro und hat die Tür hinter sich geschlossen, rennt derjenige, der am nächsten sitzt, zur Liste, liest den durchgestrichenen Eintrag und flüstert ihn allen in der Redaktion zu. Normalerweise feiern wir das alle sehr still.
Als letzten Herbst Paris von der Liste gestrichen wurde, öffnete jemand eine Flasche Champagner, und Garrett holte eine rote Baskenmütze aus der Schublade seines Schreibtisches, die er ganz offensichtlich für genau diese Gelegenheit dort versteckt hatte. Er trug sie den ganzen Tag, nur um sie sich jedes Mal hastig vom Kopf zu reißen, sobald wir das Klicken und Knatschen von Swapnas Tür hörten. Er dachte schon, damit davongekommen zu sein, bis sie am Abend auf dem Weg aus dem Büro neben seinem Schreibtisch stehen blieb und sich mit »Au revoir, Garrett« verabschiedete.
Sein Gesicht war so tiefrot geworden wie die Baskenmütze, und obwohl ich nicht glaube, dass Swapna es irgendwie anders als scherzhaft gemeint hatte, war er danach niemals mehr so selbstbewusst wie vorher.
Jetzt, da sie Amsterdam als »trendy« bezeichnet hat, werden seine Wangen nicht mehr so tiefrot wie die Mütze, sondern gleich dunkelviolett wie Rote Bete.
Jemand anders wirft Cozumel in die Runde. Und dann gibt es eine Stimme für Las Vegas, worüber Swapna kurz nachdenkt. »Vegas könnte lustig sein.« Sie sieht mich direkt an. »Poppy, findest du auch, dass Vegas lustig sein könnte?«
»Es könnte eindeutig lustig sein«, stimme ich zu.
»Santorini«, sagt Garrett und klingt dabei ein bisschen wie eine Zeichentrickmaus.
»Santorini ist hübsch«, sagt Swapna, und Garrett gibt einen erleichterten Seufzer von sich. »Aber wir wollen natürlich etwas Inspirierendes.«
Sie sieht mich erneut an. Demonstrativ, und ich weiß auch, warum. Sie will, dass ich das große Feature schreibe. Weil ich deshalb hier bin.
Mein Magen zieht sich zusammen. »Ich denke noch mal nach und arbeite etwas aus, das ich am Montag präsentiere«, schlage ich vor.
Sie nickt. Garrett sackt auf dem Stuhl neben mir zusammen. Ich weiß, dass er und sein Freund unbedingt umsonst nach Santorini wollen. Genau wie es jeder Reisejournalist möchte. Wie es vermutlich überhaupt jeder Mensch will.
Wie ich es wollen sollte.
Gib nicht auf, möchte ich ihm sagen. Wenn Swapna Inspiration will, bekommt sie sie sicher nicht von mir.
Ich habe schon lange keine mehr.
»Ich glaube, du solltest dich für Santorini einsetzen.« Rachel schwenkt ihr Roséglas auf der Mosaikfläche des Cafétisches. Es ist der perfekte Sommerwein, und wegen ihrer Social-Media-Plattform bekommen wir ihn umsonst.
Rachel Krohn: Style-Bloggerin, Fan von französischen Bulldoggen, geboren und aufgewachsen an der Upper West Side (aber zum Glück nicht die Sorte, die so tut, als wäre es ungeheuer süß, dass man aus Ohio stammt, oder dass es Ohio überhaupt gibt – hat davon überhaupt schon mal jemand gehört?) und meine beste Freundin.
Obwohl sie die allermodernsten Geräte besitzt, wäscht Rachel ihr Geschirr immer mit der Hand ab, weil sie das beruhigt, und zwar tut sie das auf Zehn-Zentimeter-Absätzen, weil sie findet, dass flache Schuhe fürs Reiten oder für die Gartenarbeit gemacht sind, oder für den Fall, dass man keine passenden Stiefel mit Absatz gefunden hat.
Rachel war die erste Freundin, die ich fand, als ich nach New York zog. Sie ist eine »Influencerin« (sprich: Sie wird dafür bezahlt, sich in ihrem wunderschönen Marmorbadezimmer zu fotografieren und dabei bestimmte Make-up-Marken zu tragen). Ich hatte vorher zwar noch nie eine Freundschaft mit einer Internet-Kollegin, aber das hat durchaus seine Vorteile (sprich: Keine von uns muss sich schämen, wenn wir die jeweils andere bitten, kurz zu warten, bis wir das Foto von unserem Sandwich hochgeladen haben). Und obwohl ich eigentlich nicht erwartet hatte, viel mit Rachel gemeinsam zu haben, gab sie mir gegenüber bereits beim dritten Treffen (in derselben Weinbar in Dumbo, in der wir gerade sitzen) zu, all ihre Fotos für die Woche schon dienstags aufzunehmen, indem sie ihre Outfits und ihre Frisuren bei Stopps zwischen Parks und Restaurants ändert, um dann den Rest der Woche Essays schreiben und die Social-Media-Aufgaben für ein paar Tierheime übernehmen zu können.
Sie ist einfach an diesen Job geraten, weil sie fotogen ist, ein fotogenes Leben führt und zwei sehr fotogene (wenn auch ständig tierärztliche Behandlung benötigende) Hunde hat.
Ich dagegen habe meine Social-Media-Präsenz aufgebaut, um das Reisen zu einem Vollzeitjob machen zu können. Unterschiedliche Wege, die zum selben Ziel führen. Ich meine, sie wohnt immer noch in der Upper West Side und ich in der Lower East Side, aber wir sind dennoch beide praktisch Werbespots auf zwei Beinen.
Ich trinke einen Schluck vom spritzigen Wein, bewege ihn in meinem Mund und denke über ihre Worte nach. Ich war noch nie auf Santorini. Irgendwo im vollgestopften Haus meiner Eltern, in einer Tupperware-Dose mit Dingen darin, die absolut nichts miteinander zu tun haben, liegt eine Liste mit Traumzielen, die ich im College geschrieben habe. Santorini steht darauf ganz weit oben. Die edlen weißen Linien und das glitzernde blaue Meer der Insel waren ungefähr so weit entfernt von unserem vollgeramschten Haus in Ohio, wie ich es mir nur irgend vorstellen konnte.
»Das kann ich nicht«, sage ich schließlich. »Garrett würde spontan in Flammen aufgehen, wenn es dann von Swapna genehmigt würde und ich reisen dürfte. Es war ja sein Vorschlag.«
»Verstehe ich nicht«, sagt Rachel. »Wie schwierig kann es denn sein, ein Reiseziel auszusuchen, Pop? Es ist ja nicht so, als ginge es ums Geld. Such dir ein Ziel aus. Fahre hin. Dann such dir ein anderes aus. Das tust du doch die ganze Zeit.«
»So einfach ist das nicht.«
»Ja, ja.« Rachel winkt ab. »Ich weiß, deine Chefin will einen ›inspirierenden‹ Urlaub. Aber wenn du an irgendeinem wunderschönen Ort bist, zusammen mit der Kreditkarte deines Arbeitgebers, dann kommt die Inspiration schon von allein. Es gibt buchstäblich niemanden auf der Welt, der besser dazu geeignet ist, einen wunderbaren Urlaub zu verleben, als eine Reisejournalistin mit dem Scheckbuch eines riesigen Medienkonzerns. Wenn du keine schillernde Reise haben kannst, wie zum Teufel soll das dann dem Rest der Welt gelingen?«
Ich zucke mit den Achseln und breche mir ein Stückchen Käse vom Aufschnittbrett ab. »Vielleicht ist das genau der Punkt.«
Sie zieht eine dunkle Augenbraue hoch. »Was ist der Punkt?«
»Ganz genau!«, sage ich, und sie wirft mir einen Blick voller Abscheu zu.
»Spiel jetzt nicht die launische Süße«, versetzt sie trocken. Für Rachel Krohn sind süß und launisch ungefähr so schlimm wie trendy für Swapna Bakshi-Highsmith. Trotz der sanften Ästhetik ihrer Frisur, ihrem Make-up, ihrer Wohnung und ihrer Social-Media-Präsenz ist Rachel ein zutiefst pragmatischer Mensch. Für sie ist das Leben unter den Augen der Öffentlichkeit ein Job wie jeder andere, einer, den sie behält, weil er ihre Rechnungen bezahlt (zumindest, was Käse, Wein, Make-up, Kleider und alles andere angeht, was die Unternehmen ihr gern schicken), und nicht, weil sie den künstlichen Halbruhm genießt, den ihre Tätigkeit mit sich bringt. Am Ende des Monats postet sie immer die schlimmsten unbearbeiteten Fotos ihrer Shootings und schreibt dazu: Dies ist ein Account mit ausgewählten Fotos, die dafür sorgen sollen, dass du nach einem Leben strebst, das es nicht gibt. Ich werde dafür bezahlt.
Ja, sie hat Kunst studiert.
Und irgendwie schmälert diese Sorte Pseudo-Performance-Kunst ihre Beliebtheit kein bisschen. Immer wenn ich am letzten Tag des Monats zufällig in der Stadt bin, versuche ich, mich mit ihr auf einen Wein zu verabreden, damit ich zusehen kann, wie sie ihre Nachrichten liest und beim Eintrudeln der neuen Likes und Follower die Augen verdreht. Hin und wieder kreischt sie unterdrückt und sagt: »Hör dir das mal an! ›Rachel Krohn ist so mutig und echt, dass ich wünschte, sie wäre meine Mom.‹ Ich sage ihnen ständig, dass sie mich nicht kennen, und sie kapieren es trotzdem nicht!«
Mit rosaroten Brillen kann sie nichts anfangen, mit Melancholie noch weniger.
»Ich tu nicht süß«, beteuere ich. »Und launisch bin ich schon gar nicht.«
Ihre Augenbraue bewegt sich noch ein wenig weiter nach oben. »Sicher? Weil du nämlich zu beidem neigst, Kleine.«
Ich verdrehe die Augen. »Du willst bloß sagen, dass ich nicht besonders groß bin und bunte Sachen trage.«
»Nein, du bist winzig«, verbessert sie mich, »und du trägst laute Muster. Dein Stil ist ungefähr der einer Pariser Bäckerstochter aus den Sechzigern, die frühmorgens auf dem Fahrrad Baguettes ausliefert und dabei Bonjour, le monde! ruft.«
»Jedenfalls«, sage ich, um auf unser Thema zurückzukommen, »was ich meine, ist: Welchen Sinn hat es, diese lächerlich teure Reise zu unternehmen und dann für die zweiundvierzig Menschen auf der Welt darüber zu schreiben, die die Zeit und das Geld hätten, um sie ebenfalls zu unternehmen?«
Ihre Brauen senken sich wieder, weil sie darüber nachdenkt. »Also, zuerst einmal glaube ich kaum, dass die Artikel in R+R als Reiseplan benutzt werden, Pop. Ihr bietet den Leuten hundert Orte an, die sie bereisen können, und sie suchen sich vielleicht drei davon aus. Und zweitens wollen die Menschen nun mal Fotos von idyllischen Urlauben in Hochglanzmagazinen sehen. Sie kaufen sie, um davon zu träumen, nicht, um sie zu planen.« Die zynische Kunststudentinnen-Rachel übernimmt jetzt die pragmatische Rachel und lässt ihre Worte ein wenig härter klingen. Kunststudentinnen-Rachel ist ein bisschen wie ein alter, übellauniger Mann, ein Stiefdad am Abendbrottisch, der sagt: »Könnt ihr die Handys mal eine Weile weglegen, Kinder?«, um dann eine Schüssel herumzureichen, in die jeder sein Telefon hineinlegen soll.
Ich liebe Kunststudentinnen-Rachel und ihre Prinzipien, aber ich bin auch entnervt davon, dass sie so plötzlich hier im Lokal aufgetaucht ist. Denn jetzt kommen mir Worte in den Sinn, die ich bisher noch nie laut ausgesprochen habe. Empfindliche, geheime Gedanken, die sich in den vielen Stunden, die sich auf dem immer-noch-so-gut-wie-neuen Sofa meiner ungemütlichen, unbelebten Wohnung in den Zeiten zwischen meinen Reisen nie so recht greifen ließen.
»Welchen Sinn hat das?«, wiederhole ich frustriert. »Ich meine, hast du nicht auch manchmal das Gefühl? Ich habe so hart gearbeitet, habe absolut alles richtig gemacht …«
»Na ja, nicht alles«, merkt sie an. »Du hast immerhin das College abgebrochen, Süße.«
»… um meinen Traumjob zu bekommen. Und ich habe ihn tatsächlich bekommen. Ich arbeite für eins der besten Reisemagazine! Ich habe eine hübsche Wohnung! Und ich kann mir ein Taxi leisten, ohne allzu viel darüber nachdenken zu müssen, wofür ich das Geld eigentlich bräuchte, und trotz allem …« – ich atme zittrig durch, weil ich mir der Worte nicht ganz sicher bin, die ich aus mir herauszwinge, obwohl mich ihr ganzes Gewicht wie ein Sandsack trifft – »… bin ich nicht glücklich.«
Rachels Gesicht wird ganz weich. Sie legt ihre Hand auf meine, schweigt aber, um mir den Raum zu geben, weiterzureden. Ich brauche eine Weile, bis ich das schaffe. Ich fühle mich undankbar, weil ich überhaupt solche Gedanken habe, ganz zu schweigen davon, dass ich sie auch noch laut ausspreche.
»Es ist alles ziemlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe«, sage ich schließlich. »Die Partys, die Zwischenlandungen, die Cocktails an Bord, die Strände und die Boote und die Weingüter. Und es sieht auch alles aus, wie es aussehen sollte, aber es fühlt sich ganz anders an. Ehrlich, ich glaube, es fühlt sich anders an als früher. In den Wochen vor einer Reise bin ich früher vor Vorfreude praktisch im Quadrat gesprungen, weißt du? Und wenn ich dann am Flughafen war, hatte ich das Gefühl, dass mein Blut summt. Da war ein Surren in der Luft um mich herum angesichts all der Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Vielleicht bin ich es.«
Sie streift sich eine dunkle Locke hinters Ohr und zuckt mit den Achseln. »Du wolltest es, Poppy. Du hattest es nicht, und du wolltest es. Du warst hungrig.«
Ich weiß, dass sie recht hat. Sie hat einfach durch den verbalen Brechdurchfall hindurchgesehen und den Kern der Sache erkannt. »Ist das nicht lächerlich?« Ich stöhne und lache gleichzeitig. »Mein Leben ist genauso geworden, wie ich es mir erhofft habe, und jetzt vermisse ich es so, etwas zu wollen.«
Unter dem Gewicht der Verantwortung zu zittern. Vor lauter Vorfreude zu summen. Die Decke meiner miesen Bude im fünften Stock ohne Fahrstuhl anzustarren, vor R+R, nach einer Doppelschicht als Kellnerin im Garden, und von der Zukunft zu träumen. Die Orte, die ich sehen, die Menschen, die ich kennenlernen würde – wer ich werden würde. Was bleibt noch übrig, wenn man seine Traumwohnung, seine Traumchefin und seinen Traumjob schon hat (der jede Angst vor der unanständig hohen Miete im Keim erstickt, weil man die meiste Zeit ohnehin in Sternerestaurants auf Kosten des Unternehmens isst)?
Rachel trinkt ihr Glas aus und schmiert sich ein Stück Brie auf einen Cracker. Sie nickt wissend. »Die Langeweile der Millennials.«
»Ist das ein echtes Ding?«
»Noch nicht, aber wenn du es dreimal wiederholst, gibt es noch heute Nacht eine Kolumne im Slate-Magazin darüber.«
Ich werfe ein wenig Salz über die Schulter, um dieses Böse abzuwehren, und Rachel prustet, ehe sie uns ein weiteres Glas einschenkt.
»Ich dachte, die Sache mit den Millennials wäre, dass wir eben nicht bekommen, was wir wollen. Die Häuser, die Jobs, die finanzielle Freiheit. Wir gehen einfach ewig weiter zur Schule und kellnern dann bis zu unserem Tod.«
»Ja«, sagt sie. »Aber du hast das College abgebrochen und hast dir genommen, was du wolltest. Also bitte sehr.«
»Ich will aber nicht unter der Langeweile der Millennials leiden. Ich fühle mich wie ein Arschloch, weil ich mich nicht mit meinem tollen Leben zufriedengeben kann.«
Rachel prustet erneut. »Zufriedenheit ist eine Lüge, die sich der Kapitalismus ausgedacht hat«, sagt Kunststudentinnen-Rachel, aber vielleicht hat sie damit recht. Das hat sie meist. »Denk mal drüber nach. All die Fotos, die ich poste? Sie verkaufen etwas. Einen Lifestyle. Die Leute sehen sich die Bilder an und denken: ›Wenn ich doch nur diese High Heels von Sonia Rykiel hätte, diese tolle Wohnung mit dem französischen Fischgrätparkett aus Eichenholz, dann wäre ich glücklich. Ich würde durch die Räume rauschen, meine Zimmerpflanzen gießen und meinen endlosen Vorrat an Jo-Malone-Duftkerzen anzünden. Dann hätte ich das Gefühl, dass in meinem Leben die perfekte Harmonie herrscht. Ich würde endlich mein Zuhause lieben. Ich würde meine Tage auf diesem Planeten genießen.‹«
»Du verkaufst das sehr gut, Rach, du wirkst ziemlich glücklich.«
»Bin ich auch, verdammt noch mal. Aber ich bin nicht zufrieden, und weißt du, warum?« Sie nimmt ihr Handy in die Hand, scrollt zu einem bestimmten Foto und hält es mir hin. Ein Schnappschuss von ihr, wie sie auf ihrem Samtsofa liegt, begraben unter Bulldoggen mit Narben von ihren lebensrettenden Schnauzen-OPs. Sie trägt einen SpongeBob-Pyjama und kein bisschen Make-up.
»Weil illegale Massenzuchtbetriebe jeden Tag mehr von diesen kleinen Kerlchen fabrizieren. Sie schwängern die armen Hündinnen immer und immer wieder, produzieren Wurf um Wurf mit genetischen Mutationen, die den Welpen das Leben schwer und schmerzvoll machen. Mal ganz abgesehen von all den Pitbulls, die in Zwinger gequetscht werden und ihr Leben im Welpenknast verbringen müssen!«
»Willst du damit sagen, dass ich mir einen Hund besorgen sollte?«, frage ich. »Denn diese ganze Reisejournalismus-Sache schließt Haustiere im Grunde aus.« Um ehrlich zu sein, selbst wenn das nicht so wäre, wäre ich mir nicht ganz sicher, ob ich mit einem Tier zurechtkäme. Ich liebe Hunde, aber ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es von ihnen nur so wimmelte. Mit Haustieren kommen auch Haare und Gekläffe und Chaos. Für eine ohnehin schon chaotische Person wie mich ist das gefährlich. Wenn ich zu einem Tierheim ginge, um mir einen Hund auszusuchen, könnte ich nicht dafür garantieren, nicht mit sechs Hunden und einem wilden Kojoten zurückzukommen.
»Ich will damit sagen, dass Sinn wichtiger ist als Zufriedenheit. Du hattest einen Haufen Karriereziele, die dir Sinn stifteten. Jetzt hast du eines nach dem anderen erreicht. Et voilà: kein Sinn mehr.«
»Also brauche ich neue Ziele.«
Sie nickt eifrig. »Ich habe mal einen Artikel darüber gelesen. Offenbar führt das Erreichen eines lang ersehnten Ziels oft zu Depressionen. Der Weg ist das Ziel, Süße, oder wie das auf diesen Wurfkissen immer steht.«
Ihr Gesicht wird wieder ganz weich, und sie sieht so ätherisch aus wie auf ihren am meisten gelikten Fotos. »Weißt du, meine Therapeutin sagt …«
»Du meinst, deine Mom.«
»Sie war Therapeutin, als sie das gesagt hat«, wendet Rachel ein, und damit meint sie, dass Sandra Krohn in dem Moment entschlossen Dr. Sandra Krohn war, ebenso, wie Rachel manchmal entschlossen Kunststudentinnen-Rachel ist. Sie meint damit nicht, dass sie wirklich bei ihr in Therapie war. Sosehr Rachel vielleicht auch bettelt, lehnt ihre Mutter es dennoch entschieden ab, Rachel als Patientin zu behandeln. Rachel ihrerseits lehnt es entschieden ab, zu jemand anderem zu gehen, was die Situation zu einer Sackgasse macht.
»Jedenfalls«, fährt Rachel fort, »hat sie mir gesagt, dass es manchmal am besten ist, nach dem Glück genauso zu suchen wie nach allem anderen, was man verloren hat.«
»Indem man stöhnt und wütend mit Kissen um sich wirft?«, rate ich.
»Indem man seinen Weg langsam zurückgeht«, sagt Rachel. »Also, Poppy, du musst jetzt nur zurückdenken und dich fragen, wann du zum letzten Mal wirklich glücklich warst.«
Das Problem ist, dafür muss ich gar nicht zurückdenken. Und zwar keine Sekunde.
Ich weiß ganz genau, wann ich zum letzten Mal wirklich glücklich war.
Vor zwei Jahren, in Kroatien, mit Alex Nilsen.
Aber dorthin führt kein Weg zurück, weil wir seitdem kein Wort mehr miteinander gewechselt haben.
»Denk einfach mal darüber nach, okay? Dr. Krohn hat immer recht.«
»Ja«, sage ich. »Ich denke mal darüber nach.«
2
Ich denke tatsächlich darüber nach.
Während der gesamten U-Bahn-Fahrt. Auf dem vier Häuserblocks weiten Weg nach Hause. Während der heißen Dusche, der Haarmaske und der Gesichtsmaske, und dann die paar Stunden, die ich auf dem Sofa verbringe.
Ich bin einfach nicht oft genug hier, daher ist es noch kein richtiges Zuhause, und außerdem bin ich das Produkt eines knauserigen Vaters und einer sentimentalen Mutter, was bedeutet, dass ich in einem Haus aufgewachsen bin, das bis unters Dach mit Müll vollgestopft war. Mom hat die angeschlagenen Becher aufgehoben, die meine Brüder und ich ihr als Kinder geschenkt hatten, und Dad parkte unsere alten Autos im Vorgarten für den Fall, dass er irgendwann einmal lernen würde, wie man sie repariert. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie viel Krimskrams in einem Haus angemessen ist, aber ich weiß, wie andere Leute normalerweise auf das Haus meiner Kindheit reagieren, daher halte ich es für sicherer, lieber etwas minimalistischer zu sein, als zu viele Dinge aufzubewahren.
Abgesehen von einer ziemlich schwer in den Griff zu bekommenden Sammlung von Secondhand-Kleidung (erste Regel in der Familie Wright: Kauf nie etwas neu, wenn du es für den Bruchteil des Preises auch gebraucht kaufen kannst), gibt es in meiner Wohnung nicht viel zu sehen. Daher starre ich nur an meine Decke und denke nach.
Und je länger ich über die Reisen nachdenke, die Alex und ich früher zusammen unternommen habe, desto mehr sehne ich mich danach. Aber nicht auf die heitere, vorfreudige, energische Art und Weise, wie ich mich früher danach gesehnt habe, Tokio während der Kirschblüte zu sehen, oder die Fasnacht-Feiern in der Schweiz mit ihren Maskenumzügen und peitschenschwingenden Narren, die die bonbonübersäten Straßen entlangtanzen.
Was ich jetzt fühle, ist mehr ein Schmerz, eine Traurigkeit.
Und das ist schlimmer als das fade Gefühl, nicht mehr viel vom Leben zu wollen. Es ist mehr der Wunsch nach etwas, von dem ich mir nicht einmal einreden kann, dass es noch möglich wäre.
Nicht nach zwei Jahren Funkstille.
Okay, nicht Funkstille. Er schickt mir immer noch eine Textnachricht zu meinem Geburtstag. Ich schicke ihm eine zu seinem. Wir beide schicken dann ein »Danke schön« oder »Wie geht es dir?« hinterher, aber diese Worte laufen ins Leere.
Früher dachte ich, dass er nach dem, was zwischen uns passiert ist, ein wenig Zeit brauchen würde, um darüber hinwegzukommen, dass danach alles wieder normal und wir wieder beste Freunde werden würden. Dass wir später vielleicht sogar über diese Zeit der Trennung lachen würden.
Aber die Zeit verging, Handys wurden aus- und wieder angeschaltet, für den Fall, dass man eine Nachricht verpasst hatte, und nach einem ganzen Monat zuckte ich auch nicht mehr jedes Mal zusammen, wenn eine Textnachricht einging.
Wir führten unsere Leben ohne einander einfach weiter. Das Neue und Merkwürdige wurde zu dem Vertrauten, dem anscheinend Unveränderbaren, und daher bin ich jetzt hier, an einem Freitagabend, und starre ins Nichts.
Ich rappele mich auf, hole mir den Laptop vom Couchtisch und trete auf den winzigen Balkon hinaus. Ich lasse mich in den einsamen Stuhl fallen, der gerade eben daraufpasst, und lege die Füße auf das Geländer, das trotz der Uhrzeit noch warm von der Sonne ist. Unter mir läuten die Glocken über der Tür zur Bodega an der Ecke. Menschen gehen nach einem langen Abend nach Hause, und ein paar Taxen warten vor meiner Lieblingsbar in der Nachbarschaft, der Good Boy Bar (einem Lokal, das seinen Erfolg nicht seinen Drinks, sondern der Tatsache verdankt, dass darin Hunde erlaubt sind; so ertrage ich mein haustierloses Dasein).
Ich klappe den Laptop auf und wedele eine Motte weg, die sich vom blauen Licht seines Bildschirms angezogen fühlt. Dann rufe ich meinen alten Blog auf. R+R interessiert dieser Blog kein bisschen – ich meine, sie haben sich zwar meine Textproben davon angesehen, bevor ich meinen Job bekam, aber jetzt ist er ihnen völlig egal. Sie wollen Geld mit meiner Reichweite als Influencerin machen, nicht mit der kleinen, aber ergebenen Leserschaft, die ich mit meinen Posts über Reisen mit minimalem Budget erreiche.
Das Rest + Relaxation-Magazin schreibt nicht über Rucksacktourismus. Und obwohl ich geplant hatte, Pop Around the World neben meiner Arbeit für das Magazin zu führen, wurden meine Einträge nach der Kroatien-Reise immer seltener.
Ich scrolle zurück zu meinem Post darüber und öffne ihn. Damals arbeitete ich schon bei R+R, weshalb jede einzelne luxuriöse Sekunde davon von der Spesenabteilung bezahlt war. Es sollte die beste Reise werden, die wir je unternommen hatten, und einige kurze Episoden davon waren das auch.
Aber jetzt, da ich meinen Post erneut lese – und obwohl ich jede Spur von Alex und dem, was damals passierte, daraus gelöscht habe –, merkt man sofort, wie elend es mir ging, als ich wieder zu Hause war. Ich scrolle weiter zurück, suche nach jedem Post über den Sommertrip. So nannten wir ihn, wenn wir uns in unseren Textnachrichten darüber unterhielten, meist schon lange bevor wir schließlich festlegten, wohin es gehen sollte oder wie wir es bezahlen würden.
Der Sommertrip.
So wie in Die Schule bringt mich noch um – ich will endlich auf unseren Sommertrip, und in Vorschlag für unsere Sommertrip-Uniform, mit einem angehängten Screenshot von einem T-Shirt mit der Aufschrift »Jawohl, die sind echt« auf der Brust, oder von ultrakurzen Shorts, die im Grunde nicht mehr als ein Jeans-Stringtanga sind.
Ein warmer Windstoß weht den Geruch nach Müll und billiger Pizza von der Straße herauf und zerzaust mein Haar. Ich drehe es im Nacken zu einem Knoten, klappe den Laptop zu und hole so schnell mein Handy hervor, dass man denken könnte, ich hätte wirklich vor, es zu benutzen.
Das kannst du nicht tun. Es ist einfach zu schräg, denke ich.
Aber ich habe bereits Alex’ Kontakt aufgerufen, der immer noch ganz oben in meiner Favoritenliste gespeichert ist. Mein Optimismus hat ihn dort stehen lassen, bis so viel Zeit vergangen war, dass die Vorstellung, ihn zu löschen, mir jetzt wie der tragische letzte Schritt vorkommt, den ich einfach nicht übers Herz bringe.
Mein Daumen schwebt über der Tastatur.
Hab gerade an dich gedacht,
tippe ich. Ich starre meine Worte eine Weile an und lösche sie dann wieder.
Denkst du vielleicht zufällig gerade darüber nach, aus der Stadt rauszukommen?,
schreibe ich. Das klingt gut. Es wird deutlich, wonach ich frage, aber es ist trotzdem noch ziemlich lässig, außerdem kann er ohne Probleme wieder aus der Sache rauskommen. Aber je länger ich den Nachrichtenentwurf ansehe, desto seltsamer kommt mir diese Lässigkeit vor. Desto seltsamer kommt es mir vor, so zu tun, als wäre nichts passiert, als wären wir immer noch eng befreundet, zwei Personen, die mit einer einfachen Textnachricht nach Mitternacht eine Reise planen können.
Ich lösche den Text, atme tief durch und tippe:
Hey.
»Hey?«, rüge ich mich. Ich ärgere mich über mich selbst. Draußen auf dem Bürgersteig zuckt ein Mann zusammen, als er meine Stimme hört. Er schaut hoch zu meinem Balkon, beschließt, dass er nicht gemeint sein kann, und eilt davon.
Ich werde auf keinen Fall eine Nachricht an Alex Nilsen schicken, in der nur das Wort Hey steht.
Aber dann markiere ich das Wort, um es zu löschen, und etwas Schreckliches passiert.
Ich drücke aus Versehen auf Senden.
Die Nachricht geht mit einem Zischgeräusch raus.
»Mist, Mist, Mist!« Ich schüttele mein Handy, als könnte ich das armselige Wort herausfallen lassen, bevor es verschickt wird. »Nein, nein, n…«
Pling.
Ich erstarre. Der Mund steht mir offen. Mein Herz rast. Der Magen zieht sich zusammen, und meine Eingeweide fühlen sich an wie Spiralnudeln.
Eine neue Nachricht, darüber steht in fetter Schrift: Alexander der Größte.
Ein Wort.
Hey.
Ich bin so überrascht, dass ich beinahe wieder Hey zurücktippe, als hätte ich nicht zuerst eine Textnachricht geschickt, als hätte er mich einfach so aus heiterem Himmel angeheyt. Aber das hat er natürlich nicht – er ist nicht der Typ dafür. Ich bin der Typ dafür.
Und weil ich so eine Person bin, die die schlimmste Textnachricht der Welt schickt, habe ich jetzt eine Antwort bekommen, die jeden lässigen Gesprächsübergang unmöglich macht.
Was soll ich bloß sagen?
Klingt Wie geht es dir? zu ernsthaft? Klingt es so, als erwartete ich von ihm so etwas wie Na ja, Poppy, ich habe dich schon vermisst. Ich habe dich SCHLIMM vermisst?
Vielleicht etwas Unverfänglicheres wie: Was gibt’s?
Aber wieder habe ich das Gefühl, dass es das Schrägste wäre, zu ignorieren, dass es allerdings schräg ist, ihm nach so langer Zeit eine Textnachricht zu schreiben.
Tut mir leid, dass ich dir eine Nachricht geschrieben habe, in der nur hey steht,
tippe ich. Ich lösche den Text wieder und versuche es auf die lustige Tour:
Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hergerufen habe.
Eigentlich nicht lustig, aber ich stehe am Rand meines winzigen Balkons und zittere tatsächlich vor nervöser Anspannung. Ich habe Angst, zu lange mit einer Antwort zu warten. Also schicke ich den Text ab und beginne, auf und ab zu gehen. Weil der Balkon aber so klein ist und der Stuhl die Hälfte von ihm einnimmt, drehe ich mich eigentlich nur wie ein Kreisel um die eigene Achse. Ein Schwarm Motten schwirrt dem blauen Licht meines Handys hinterher.
Es macht erneut ping, und ich setze mich auf den Stuhl und öffne die Nachricht.
Schreibst du mir wegen der verschwundenen Sandwiches im Pausenraum?
Einen Augenblick später kommt die nächste Nachricht.
Die hab ich nämlich nicht geklaut. Es sei denn, es gibt dort eine Sicherheitskamera. In dem Fall tut es mir leid.
Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus, Wärme durchflutet mich und lässt den ängstlichen Knoten in meiner Brust schmelzen. Es gab mal eine kurze Zeit, in der Alex überzeugt war, seinen Lehrerjob zu verlieren. Er war spät aufgewacht, schaffte es nicht mehr zu frühstücken und hatte einen Arzttermin in der Mittagspause. Danach hatte er keine Zeit mehr, sich etwas zu essen zu besorgen, also war er ins Lehrerzimmer gegangen, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand Geburtstag hatte und es dort Donuts oder trockene Muffins geben würde.
Aber es war der erste Montag im Monat, und eine Geschichtslehrerin namens Ms Delallo – Alex bezeichnete sie heimlich als seine Arbeitsplatz-Erzfeindin – bestand darauf, den Kühlschrank und die Küchenflächen am letzten Freitag jeden Monats auszuräumen und zu putzen. Sie veranstaltete immer ein großes Gewese darum, dass man ihr nicht genug danke, obwohl das Kollegium bei der Prozedur ziemlich oft einige noch vollkommen genießbare eingefrorene Mittagessen verlor.
Jedenfalls war das Einzige, was noch im Kühlschrank zu finden war, ein Thunfischsalat-Sandwich. »Delallos Visitenkarte«, hatte Alex gescherzt, als er mir später die Geschichte erzählte.
Er hatte das Sandwich aus Trotz (und aus Hunger) gegessen. Dann verbrachte er drei Wochen in der Überzeugung, dass es jemand herausfinden und er seinen Job verlieren würde. Es ist jetzt nicht so, dass es sein Traumjob war, Literatur an der Highschool zu unterrichten, aber der Job war gut bezahlt, es gab gute Arbeitgeberleistungen, und die Schule war in unserer Heimatstadt in Ohio, was bedeutete, dass er in der Nähe zweier seiner drei jüngeren Brüder und deren Kinder sein konnte. Für mich war allerdings genau das ein Grund, der dagegensprach.
Außerdem gab es die Jobs an der Universität, die Alex wirklich wollte, nicht mehr sehr häufig. Er konnte es sich nicht leisten, diesen Lehrerjob zu verlieren, und zum Glück war es auch nicht dazu gekommen.
SandwichES? PLURAL?,
tippe ich jetzt.
Bitte, bitte, bitte sag mir, dass du jetzt ein vollwertiger Riesensandwich-Dieb geworden bist.
Delallo ist kein Fan von Riesensandwiches. In letzter Zeit ist sie ganz heiß auf Reuben-Sandwiches mit Sauerkraut und Pastrami.
Und wie viele von diesen Reubens hast du geklaut?
Da ich annehme, dass die Nationale Sicherheitsbehörde das liest, keinen.
Du bist Highschool-Lehrer in Ohio, natürlich liest die NSA mit.
Er antwortet mit einem traurigen Emoji.
Willst du damit andeuten, dass ich nicht wichtig genug für die US-Regierung bin, um beobachtet zu werden?
Ich weiß, dass das als Witz gemeint ist, aber die Sache ist die: Obwohl Alex Nilsen hochgewachsen, einigermaßen breitschultrig, süchtig nach täglichem Sport und gesundem Essen und allgemein der Inbegriff von Selbstkontrolle ist, hat er außerdem das Gesicht eines verletzten Welpen. Oder zumindest die Fähigkeit, sein Gesicht so aussehen zu lassen. Sein Blick ist immer ein wenig schläfrig, die Falten unter seinen Augen weisen auf die Tatsache hin, dass er bei Weitem nicht so gern schläft wie ich. Seine Lippen sind voll, mit einem beinahe übertriebenen, einen Hauch unebenen Amorbogen, und zusammen mit seinem glatten, aber ständig zerzausten Haar – der einzige Teil seines Körpers, auf den er nicht so akribisch achtet – verleiht all das seinem Gesicht eine Jungenhaftigkeit, die, wenn sie geschickt eingesetzt wird, irgendeinen biologischen Instinkt in mir weckt, ihn zu beschützen, koste es, was es wolle.
Wenn ich sehe, wie seine schläfrigen Augen groß werden, sich mit Tränen füllen und seine vollen Lippen sich zu einem weichen O formen, ist es fast so, als hörte ich einen Welpen wimmern.
Wenn mir andere Leute das Emoji mit der gerunzelten Stirn schicken, lese ich es als milde Enttäuschung.
Wenn Alex es schickt, weiß ich, dass es das digitale Äquivalent seines Trauriger-Welpe-Gesichts ist, das er benutzt, um mich zu ärgern. Als wir früher betrunken am Tisch saßen und versuchten, unser Schach- oder Scrabble-Spiel durchzuziehen, das ich im Begriff war zu gewinnen, sah er mich so lange mit diesem Gesichtsausdruck an, bis ich vollkommen hysterisch lachte, von meinem Stuhl fiel und versuchte, ihn daran zu hindern oder zumindest sein Gesicht zu bedecken.
Natürlich bist du wichtig,
tippe ich.
Wenn die NSA von der Macht deines traurigen Welpengesichts wüsste, wärst du schon längst in einem Labor und würdest geklont.
Alex tippt, hört auf, tippt erneut. Ich warte noch ein paar Sekunden.
War es das? Ist das die Nachricht, auf die er nicht mehr antwortet? Kommt jetzt die große Konfrontation? Ich kenne ihn, eigentlich ist es wahrscheinlicher, dass er irgendeine nichtssagende Floskel benutzt wie War nett, mit dir zu reden, aber ich muss jetzt ins Bett. Gute Nacht.
Ping!
Ein Lachen bricht aus mir heraus, so heftig, dass es sich anfühlt wie ein Ei, das in meiner Brust zerbricht. Wärme strömt aus ihm heraus und beruhigt meine angespannten Nerven.
Es ist ein Foto. Ein verschwommenes, ungeschickt aufgenommenes Selfie von Alex unter einer Straßenlaterne, auf dem er sein berühmtes Gesicht macht. Wie jedes der wenigen Selfies, die er je gemacht hat, ist es leicht von unten aufgenommen, sodass sein Kopf lang wirkt und oben am Scheitel in einer Spitze endet. Ich werfe lachend den Kopf zurück, ich bin schon ganz aufgedreht.
Du Schweinehund! Es ist ein Uhr nachts, und jetzt muss ich dringend zum Tierheim, um Leben zu retten.
Na klar,
versetzt er.
Du würdest nie einen Hund haben.
Etwas wie Schmerz kneift mich ganz tief in meinem Magen. Obwohl er der sauberste, gründlichste, organisierteste Mann ist, den ich kenne, liebt Alex Tiere, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine Unfähigkeit, mich auf eins einzulassen, als Charaktermakel ansieht.
Ich lasse meinen Blick zu der vertrockneten Pflanze auf dem Balkon wandern. Dann schüttele ich den Kopf und tippe die nächste Nachricht:
Wie geht es Flannery O’Connor?
Tot,
schreibt Alex zurück.
Die Katze, nicht die Autorin!
Auch tot.
Mein Herz stolpert. So sehr ich diese Katze auch gehasst habe (nicht mehr oder weniger, als sie mich gehasst hat) – Alex hat sie geliebt. Die Tatsache, dass er mir nichts von ihrem Tod gesagt hat, durchfährt mich wie ein sauberer Schnitt, wie eine Guillotinenklinge vom Scheitel bis zur Sohle.
Alex, das tut mir ja so leid,
schreibe ich.
Gott, es tut mir leid. Ich weiß ja, wie sehr du sie geliebt hast. Diese Katze hatte ein wunderbares Leben.
Darauf schreibt er nur:
Danke.