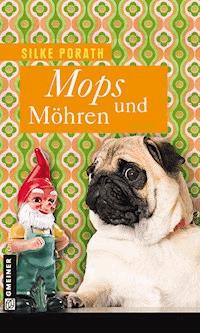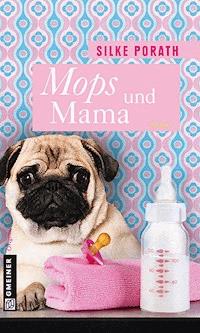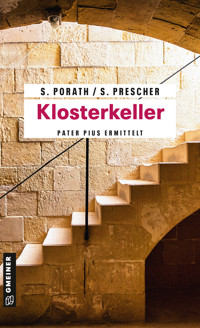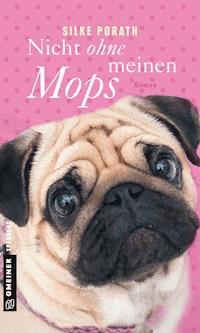6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Als Silke Porath zum ersten Mal von Herzrasen und schwerer Atemnot heimgesucht wird, befürchtet sie einen Infarkt. Doch als sich die Attacken häufen, wird ihr klar, dass nicht ihr Körper die Ursache des Problems ist, sondern ihr Kopf - oder besser gesagt ein urzeitlicher Fluchtinstinkt, der bei ihr jederzeit meist völlig grundlose Panikattacken auslösen kann. Mit der Hilfe eines Therapeuten und einer Selbsthilfegruppe gelingt es ihr, sich Schritt für Schritt von der Angst zu lösen. Die Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat, schildert sie in diesem Buch. Mit unterhaltsamen Ausflügen zu den geschichtlichen Ursprüngen des Angstreflexes und praktischen Tipps für den Alltag ist Keine Panik vor der Panik! ein ermutigender Ratgeber für Betroffene, der zeigt: Die Panik ist kein Feind, sondern ein Verbündeter, der wachrüttelt und hilft, das eigene Leben bewusster und stressfreier zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Silke Porath
Keine Panik vor der Panik!
Kleine Tipps gegen die große Angst
Ein persönlicher Ratgeber
INHALT
Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst.
Karl Valentin
Wie alles begann
Panikattacke – die erste
Die Handflächen tropfen vor Schweiß. Die Zunge pappt staubtrocken am Gaumen. Irgendwer scheint mir einen Stahlring um die Kehle gelegt zu haben. Jedenfalls geht herzlich wenig Luft in die Lungen. Dafür steigt der Puls bis an die Schmerzgrenze. Das Herz wummert von innen gegen den Brustkorb, mein Magen fährt Achterbahn. Die Knie verwandeln sich in Pudding, und weil das alles so schön ist, beginnt das Blut in den Ohren zu rauschen und vor den Augen wird es schwummerig und schwarz.
Das ist eine Panikattacke.
An meine erste erinnere ich mich noch ganz genau. Auch wenn ich damals nicht mit der kleinsten Gehirnzelle an eine Panikattacke dachte. Es war der Klassiker: Seit Wochen war da dieses Pochen und Ziehen im Backenzahn. Erst nur ein wenig und ganz kurz. Dann immer heftiger. Aber wer geht schon zum Zahnarzt, wenn es gerade noch zum Aushalten ist? Ich jedenfalls nicht.
Schließlich gibt es in der Apotheke jede Menge Salben und Tabletten – und auch die scheußlich schmeckende Nelke hilft. Bis dann … genau: das dicke Ende in Form einer dicken Backe kommt.
Schon der Anruf beim Zahnarzt war ein mehrtägiges Projekt. Wieder und wieder bin ich ums Telefon herumgeschlichen. Habe den Hörer in die Hand genommen und zurück auf die Gabel gelegt.
An guten Tagen habe ich sogar die Nummer gewählt. Dann aber sofort wieder aufgelegt. Denn – kurios! – jedes Mal, wenn ich an den Zahnarzt dachte, hörte das Pochen im Zahn sofort auf.
An sehr guten Tagen schaffte ich es sogar, den Hörer mit schweißnasser Hand so lange festzuhalten, bis am anderen Ende der Leitung die Arzthelferin dranging. Während sie ihren Begrüßungsspruch herunterleierte, begann mein Herz zu rasen.
Meine Kehle schnürte sich zu, mein Mund war trockener als die Sahara. Irgendwer schien mir einen Strick um den Hals gelegt zu haben. Ich konnte gerade noch ein mickriges »Tschuldigung, verwählt« zwischen den nicht pochenden Zähnen hervorquetschen.
Dieses Spiel wurde bald zur Gewohnheit.
Sieben, acht Wochen lang ging das so, und hätte mich in jener Zeit jemand mitten in der Nacht geweckt, ich hätte mich vielleicht nicht sofort an meinen eigenen Namen, dafür aber mit Sicherheit an die Telefonnummer des Dentisten erinnert (meine grauen Zellen haben diese Nummer bis heute, auch nach über 15 Jahren, gespeichert; was mir nichts mehr nützt, denn der Doktor ist längst in Rente).
Irgendwann aber kam, was kommen musste. Die Wange wurde immer dicker und ich ahnte, dass ich das Übel an der Wurzel packen musste.
Wie und wann ich es geschafft habe, den Termin zu machen und in die Praxis zu gehen, weiß ich nicht mehr. Meine Erinnerung setzt in dem Moment ein, als ich im Wartezimmer sitze. In der Luft liegt der antiseptische Arztgeruch, untermalt von einer großen Portion Angstschweiß und dem Staub, der vom aufgedrehten Heizkörper aufgewirbelt wird. Ich bin allein. Nur ich, zehn orangefarbene Plastikstühle und ein Berg abgegriffener Zeitschriften. Ich entscheide mich für ein buntes Magazin, auf dessen Titelbild eine neue Blitzdiät angepriesen wird. Einige Minuten blättere ich mich durch die Seiten und versuche zu vergessen, wo ich bin.
Dann kommt sie.
In dem Augenblick, als im Behandlungsraum der Bohrer angeworfen wird, beginnt mein Herz zu rasen. Ich registriere erstaunt, dass das Herz mehr mittig denn links liegt. Das wusste ich bis dahin nicht. Schweiß bricht aus, mir wird schwindelig, meine Ohren sausen, ich japse nach Luft, hechele wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Mein Herz schlägt noch schneller. Noch heftiger. Herzinfarkt.
Ich habe einen Herzinfarkt.
Denke ich. Und warte darauf, dass ich vom Stuhl kippe. Exitus beim Dentisten. Was wird meine Familie auf den Grabstein schreiben?
Die Tür zum Wartezimmer fliegt auf. Herein stolpert ein Opi. Seine Backe ist noch dicker als meine. Er lächelt freundlich und im selben Moment scheint mein Herz sich selbst an die Kammern zu tippen. Der Puls geht runter, so weit er eben runtergehen kann, wenn man darauf wartet, dass der Zahnarzt das Gebiss behandelt, und die Schweißdrüsen stellen endlich die Arbeit ein.
Das war sie. Meine erste Panikattacke.
Fast fünfzehn Jahre ist das her, und dass ich damals keinen Infarkt hatte, sondern »nur« eine Panik, weiß ich erst seit Kurzem.
An meinen Beinahe-Herztod habe ich nämlich in den folgendenJahren nicht mehr gedacht – war ich doch schon eine halbe Stunde später um einen Backenzahn und um eine große Portion Furcht leichter. Es sollten erst noch ein weiterer entzündeter Backenzahn und viele andere abscheuliche Dinge wie die Besteigung eines Stahlturmes, das Sprechen vor vielen Menschen, der Besuch einer Party, auf der ansonsten nur fremde Leute eingeladen sind, und ein Flug auf die Kanaren folgen, ehe ich den Gedanken zuließ, dass ich nicht am Herzen leide, keine Kreislaufprobleme habe, niemals einen Hörsturz hatte, der Schwindel rein psychisch ist und dass die meisten meiner Ängste irrational und vor allem: zu besiegen sind.
Das war ein hartes Stück Arbeit.
Aber es hat sich gelohnt!
Einleitung
Wie ich die Panik verstehen lernte
Meine Panik – mein Freund? Auch wenn Sie es sich in diesem Moment nicht vorstellen können, eins ist sicher: Je mehr Sie die Attacken zu Ihren Feinden erklären, desto häufiger werden Sie von ihnen heimgesucht.
Ich weiß, dass eine Panikattacke alles andere als ein Spaziergang ist. Dennoch: Die Angst an sich ist Ihr Freund. Sie hilft Ihnen, Ballast abzuwerfen, Ihren Platz im Leben zu finden, sich neu zu definieren. Schwer zu glauben, wenn man meint, jeden Augenblick zu sterben; schwer zu glauben, wenn die Panik der Feind ist, der einen mit aller Macht von innen heraus zerstören will.
Aber die Macht liegt bei Ihnen – und wenn Sie der Angst die Hand reichen, werden Sie sehen, wie sie von Tag zu Tag kleiner wird.
Als Erstes hilft zu verstehen, was Angst eigentlich ist. Nämlich ein ganz natürlicher Vorgang, der schon den Mammutjägern in den Genen steckte. Wenn die, nur bekleidet mit einer Fellschürze, im Steppengras auf der Lauer lagen, dann ging es um Leben und Tod: Ich (verhungern) oder das Mammut (erlegen).
Leider ließ so ein behaarter Elefant sich nicht so einfach erbeuten wie heutzutage ein fertig verpacktes Schweinefilet aus der Kühltheke. Und dann waren da noch die Säbelzahntiger (heute: die Kollegen, die Nachbarn, der Chef) und andere bissige Viecher.
Taucht nun also Gefahr am steinzeitlichen Horizont auf, dann spannen sich alle Muskeln des Steinzeitmenschen an. Ganz sicher auch solche, von denen Herr Sapiens nicht einmal wusste, dass er sie hat. Gleichzeitig beginnt sein Herz, mehr Blut und damit Sauerstoff durch die Adern zu pumpen. Was wiederum den Muskeln hilft, wenn sie gleich zum rettenden Spurt ansetzen müssen. Zu den aktiven Muskeln in dieser Situation gehört leider auch der Schließmuskel. Beim modernen Menschen heißt das: Durchfall (und zwar über Monate, ich habe mehr als zehn Kilogramm abgenommen, Panik sei Dank). Bei Herrn Sapiens hieß das: Durchfall. Aber bei ihm hat es noch Sinn gemacht – denn mit weniger Gewicht in der Wampe konnte er deutlich schneller wegrennen.
Mammuts gibt es heute nur noch tiefgefroren, irgendwo in Sibirien.
Meine Mammuts hießen: Flugzeuge, Zahnärzte, der Gang zum Postamt, das Klingeln des Telefons … Mein Körper stand seit Jahren ständig unter Strom, Stress und Hektik waren der Normalzustand. Ich war quasi seit Jahren auf Mammutjagd.
Das Dumme an der Panik ist: Hat sie einmal erkannt, dass sie in einer bestimmten Situation zuschlagen kann, dann tut sie das immer wieder. Einmal Fracksausen im Flugzeug – immer Fracksausen im Flugzeug.
Und: Die Angst verselbstständigt sich, will wachsen, immer mehr Bereiche austesten. Kann ich Silke auch im Supermarkt an der Kasse in Panik versetzen? Klar, klappt bestens.
Also ging ich nicht mehr einkaufen.
Aber die Angst war damit nicht weg. Sie sitzt im Gehirn. Das ist wie Fahrradfahren: Wer einmal Panik »gelernt« hat, der kann sie. Für immer (schlechte Nachricht). Aber wer sie verstanden hat, der wird sie auch wieder los (sehr! gute Nachricht).
Aus einem kleinen Schrecken wird also eine gigantische Panik. Und unsere Fantasie füttert das Paniktier im Sekundentakt. Ziehen im Bauch? Kann von den Zwiebeln in der Bolognese kommen. Kann aber auch Magenkrebs sein. Die Panik entscheidet sich für den Krebs, die Alarmsignale wie Schwindel, Übelkeit, flache Atmung und Herzrasen springen sofort an. Mich hat das über viele Wochen in Todesangst versetzt. So, wie es Herrn Sapiens sicher auch geschockt hat, wenn das Mammut mit seinen riesigen Stoßzähnen direkt auf ihn zugeprescht kam.
Herr Sapiens ist dann gerannt, was die Fellschuhe hergaben.
Und auch ich rannte – zum Kardiologen. Seine Praxis war das, was einst die Höhle mit den Felszeichnungen oder später das Zelt aus Fell war. Da kam kein Mammut rein, das musste vorm Eingang warten. Heute sind es die Ärzte, welche für ein paar Minuten oder Stunden mit Ultraschall, Stethoskop und EKG das wilde Paniktier in Schach halten. Der Befund ist grundsätzlich negativ. Also sehr positiv. Für einen Moment kann man in die sichere Höhle zurückkriechen und sich gesund fühlen. Aber seien Sie sicher: Die Panik steht vor der Praxistür, wenn Sie wieder auf die Straße treten.
Die Straße ist übrigens einer der Bereiche, in denen für den Homo sapiens des dritten Jahrtausends die gesunde Angst noch überlebenswichtig ist. Oder würden Sie unerschrocken über eine sechsspurige Autobahn rennen?
Angst, die gesunde, rettet also Leben. Und Panik ist Angst.
Nur heftiger. Viel heftiger. Panik ist Todesangst.
Das macht Ihnen Angst? Keine Bange – wenn ich, die ich schon immer chaotisch und nie wirklich konsequent war, es geschafft habe, mich mit meiner Panik zu arrangieren, dann können Sie das auch.
Vielleicht ist der eine oder andere Tipp gegen die Panik etwas für Sie. Und mit der Zeit werden Sie Ihren ganz eigenen Schlachtplan entwickeln, um aus der großen Todesangst, dem Mammut, einen vertrauten Freund, einen kuscheligen Teddybären, zu machen, und Sie sich sagen können: »Halt, wenn du jetzt weitergehst, dann tut es dir nicht mehr gut.«
Heute bin ich meiner Panik dankbar. Denn ohne sie hätte ich so weitergemacht wie all die Jahre zuvor: zu viel Kaffee, zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, zu wenig Bewegung. Zu viele Pflichten, zu wenig Freude und zu wenige Freunde. Dann, da bin ich sicher, hätte ich wirklich eines Tages einen Herzinfarkt bekommen. So aber war es »nur« ein Burn-out. Und die Panik meine innere Notbremse.
Meine Erfahrungen auf dem Weg zurück in ein »normales« Leben gebe ich gern weiter. Ich hoffe, das eine oder andere hilft Ihnen und bringt Sie an den Punkt, an dem ich heute bin. Und der heißt: »Keine Panik vor der Panik!«
Silke Porath
Der starke Helfer
Während der Arbeit an meinem zweiten Roman (als hauptberufliche Autorin heißt das für mich: Heimarbeit) habe ich keine Nacht länger als vier, fünf Stunden geschlafen. Mit Matsch im Kopf bin ich durch die Vormittage geschlittert, mehr als einmal musste ich mich vor lauter Schwindel beim Kochen an der Herdkante festhalten.
Nur mit einer ausgiebigen Siesta habe ich den Tag überstanden – dem Himmel sei Dank für die Erfindung des Fernsehers. Meine Kinder habe ich in dieser Zeit vor der Mattscheibe geparkt. Danach Kinderbespielprogramm, Abendessen, und kaum war Ruhe im Haus eingekehrt, habe ich den PC wieder hochgefahren. Getippt bis ein, zwei Uhr nachts. Manchmal länger. Das ging über ein Jahr so. Und konnte nicht gut gehen.
War ich bei Freunden eingeladen, packte mich spätestens um 21 Uhr die Unruhe. Wie verschwendet kam mir jede einzelne Stunde vor, die ich bei einer Party saß. Was hätte ich in dieser Zeit alles tippen können!
Urlaub? Wir waren in Holland und zum Glück war das Wetter mies.
Keine Ausflüge, Nieselregen, kalter Wind.
Jeden Tag der zwei Wochen verbrachte ich mehrere Stunden mit meinem Manuskript, las Korrektur, machte Anmerkungen. Meine Familie machte Ferien, Mama saß in der Stube und arbeitete.
Irgendwann war das Buch fertig. Gedruckt. Die erste Buchpräsentation, Lesereisen. Stets begleitet von einem flauen Gefühl im Magen, Schwindel im Kopf und der inneren Stimme, die sagte: Schreib was Neues, mach schon, vergeude nicht deine Zeit!
Das Rauschen in meinen Ohren wurde lauter und lauter. Ich habe es ignoriert. Irgendwo hatte ich gelesen, dass sich so ein Hörsturz anfühlt. Und dass man dagegen eigentlich sowieso nichts machen kann.
Mein Immunsystem ging in den Keller. Kaum eine Woche, in der ich nicht mit Triefnase oder Fieber durchs Leben getappt bin. Irgendwann pfiff ich auf dem letzten Loch. Mein Hausarzt verordnete mir Antibiotika.
Einen halben Tag legte ich mich auf die Couch, dann schienen schon die Medikamente anzuschlagen. Ein halber Tag ohne Arbeit!
Wie viel ich nachzuholen hatte … Rasch Nudelwasser fürs Mittagessen aufsetzen, zwischendurch Notizen machen, dann in die Waschküche rennen, die Wäsche aus dem Trockner nehmen.
Als es passierte, wollte ich gerade ein Unterhemd meiner Tochter zusammenlegen: Mein Herz begann zu rasen, ich schnappte nach Luft. Alles drehte sich, der Wäscheberg verschwamm vor meinen Augen zu einer bunten schwankenden Masse. Meine Knie gaben nach und ich hangelte mich zum Sofa.
Dort fand mein Mann mich, als er eine Viertelstunde später mit den Kindern nach Hause kam.
»Mit mir passiert irgendwas.« Ich heulte. Schnappte nach Luft. Fühlte diesen Ring um meine Brust. Die Übelkeit.
»Ich vertrag die Medikamente nicht«, schrie ich meinen Mann an. »Ich hab einen Herzinfarkt! Hol einen Arzt!« Meine Kinder wichen entsetzt zurück. In der Küche sprudelte das Nudelwasser über. »Und meine Mutter«, hechelte ich. Ich wollte nicht sterben, ohne dass meine Mutter bei mir war. Mein Mann hetzte zum Telefon. Er rief einen Krankenwagen und danach meine Mutter und meinen Hausarzt an. Der traf zwei Minuten nach dem Notarzt ein.
Die Sanitäter hatten mich mit einem Blutdruckmessgerät verkabelt und wollten eben die Trage holen, um mich in die Notaufnahme zu karren. Der Hausarzt horchte meine Brust ab: »Mit Ihrem Herzen ist alles in Ordnung.« Als er den Krankenwagen fortschickte, war ich entsetzt. Das Letzte, was ich sah, bevor die Beruhigungsspritze wirkte, war meine Mutter, die zur Haustür hereintaumelte.
Am selben Abend, nach einem ausgiebigen Schlaf, war ich hellwach. Und noch am Leben. Eingewickelt in eine Kuscheldecke lag ich auf dem Sofa und versuchte, meinem Mann (und vor allem mir selbst) klarzumachen, dass ich mir die Übelkeit, das Herzstolpern und den Schwindel nicht eingebildet hatte. Das »Da ist nichts« des Arztes konnte und wollte ich nicht akzeptieren.
»Ich bin doch nicht irre«, sagte ich immer wieder. Wie ein Mantra. »Ich bin nicht irre, ich bin nicht irre, ich bin …«
Und mein Mann erwiderte: »Nein, du bist nicht irre.«
Auch ihm wurde dies zum Mantra. Sei es, weil er mich beruhigen wollte – sei es, weil er selbst an eine gesunde Frau an seiner Seite glauben wollte.
Die Übelkeit kam nicht wieder. Für mich war damals glasklar, warum nicht: Ich hatte trotz Abraten des Arztes die Antibiotika abgesetzt. Denn ich war mir sicher, dass das, was ich erlebt hatte, nur eine allergische Reaktion auf das Medikament sein konnte. Mein Arzt war anderer Ansicht. Diese Art von Nebenwirkungen, sagte er, gäbe es bei diesem Medikament nicht.
Ich machte einen Termin bei einem anderen Arzt, diesmal bei einem Professor. Der residierte in einem beeindruckenden Büro. Er saß hinter einem massiven Schreibtisch in einem riesenhaften Lederstuhl, der ihn samt weißem Kittel glatt zu verschlucken schien.
Ich hielt dem Professor die Medikamentenpackung unter die Nase. Schilderte meine Symptome. Hier ein Nicken, dort ein Räuspern der Koryphäe. Schließlich griff er, begleitet von meinem selbstsicheren Lächeln, hinter sich ins Regal und holte einen beeindruckend dicken, rot eingebundenen Folianten hervor.
»Sehen Sie, ich bin nicht verrückt«, verkündete ich triumphierend. Der Professor blätterte, räusperte sich, blätterte weiter.
Er nahm ein zweites, dieses Mal ein grünes, Buch zur Hand.
Um mir nach etwa zehn Sekunden zu sagen: »Was Sie erlebt haben, wird nirgendwo in der Literatur bestätigt.«
»Dann bin ich eben ein Präzedenzfall«, sagte ich. Allerdings mit deutlich weniger Triumph in der Stimme.
»Das glaube ich nicht«, sagte der Professor. »Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Sie unter einer Angststörung leiden?«
»Ich. Bin. Nicht. Verrückt.«
»Das sage ich auch nicht, aber allein Ihre verkrampfte Körperhaltung, wie Sie hier sitzen, und die körperlichen Symptome …«
»Ich! Bin! Nicht! Irre!«
»Sie sollten einen Psychologen zurate ziehen«, sagte der Professor, milde lächelnd. Ich sagte nichts mehr.
Ich verdrängte dieses Gespräch und versteifte mich in den kommenden Monaten darauf, dass ich unter einer Medikamentenunverträglichkeit der extrem seltenen Art litt. Wann immer ein Schnupfen in der Luft lag, griff ich zu heißer Zitrone und Hustenbonbons. Keine Chemie, keine Antibiotika. Was ich mit einer üblen Bronchitis büßte. Doch trotz des Verzichts auf jegliche Pharmazeutika wurde mein Schwindel immer heftiger. Immer öfter bekam ich scheinbar keine Luft, schien der Boden unter meinen Füßen wackliger zu sein als die Bohlen eines Hochseedampfers.
Der Schwindel und die Übelkeit kamen bei Partys, die ich – mit der Ausrede, nur mal eben eine Zigarette rauchen zu wollen – beinahe komplett an der frischen Luft und abseits anderer Menschen verbrachte.
Sie kamen bei der Post, wenn ich in der Schlange stand. Gegen die Anzeichen eines vermeintlichen Herzinfarkts ankämpfend, sah ich dann auf die Uhr und stürzte mit den Worten »Oh, so spät schon« aus der Schalterhalle. Die Briefe und Päckchen nahm ich wieder mit nach Hause.
Sie kamen beim Metzger. Der Fleischer meines Vertrauens möge mir verzeihen, dass ich monatelang nicht bei ihm eingekauft habe. Ich konnte nicht. Denn an jenem Montag, dem 19. Juni 2006, starb ich so heftig, dass ich meinte, in die Auslage neben die Schnitzel zu fallen.
Was ich gekauft habe? Wie ich bezahlt habe und wie ich nach Hause kam? Ich weiß es nicht mehr.
Offenbar habe ich noch gekocht. Und meine Kinder nach dem Essen ins Auto gepackt, um mit ihnen zum vereinbarten Termin beim Kinderarzt zu fahren. Doch auf der Fahrt legte sich der eiserne Ring um meine Brust, alles verschwamm und ich konnte nicht anders – statt des Kinderarztes steuerte ich die Praxis meines Hausarztes an.
Stolpernd und schwankend, meine verwirrten Kinder im Schlepptau, taumelte ich in die Praxis.
Die Arzthelferin bettete mich auf eine Liege, die für mich damals eher einer Bahre gleichkam. Panik stieg in mir auf, meine Kinder starrten mich mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen an. Dann kam der Arzt. Als ich das Stethoskop an seinem weißen Kittel baumeln sah, brach ich in Tränen aus. Schnappte nach Luft. Und würgte die Worte hervor, mit denen ich schließlich meinen Kampf gegen das Mammut begann: »Ich gebe es zu, ich habe eine Panikattacke!«
Vom Arzt bekam ich dafür ein wohlwollendes Nicken, eine Beruhigungsspritze und die Überweisung zum Nervenarzt.
Die folgenden drei Wochen erlebte ich im Halbschlaf, wenn überhaupt. Die Psychopharmaka, diese kleinen rosa Pillen, hatten mich derart sediert, dass ich nicht einmal dazu in der Lage war, mir die Zähne zu putzen (mein armer Mann) oder mich zu duschen (meine arme Familie). Aber, Leber sei Dank, irgendwann hatte mein Körper sich so weit an die Müdemacher gewöhnt, dass ich wieder aufstehen konnte.
Ich weiß mittlerweile, wie schwer es ist, einen guten Psychologen zu finden. Wie beinahe unmöglich es ist, überhaupt einen Therapeuten zu bekommen, der einen freien Platz hat. Was ich also hatte, war unverschämtes Glück.
Nicht nur, dass ich rasch zum Erstgespräch gehen durfte, ich bekam auch sofort weitere Stunden, die Chemie zwischen mir und dem Therapeuten stimmte und es war die richtige Therapie für mich und mein Mammut: eine Verhaltenstherapie.
Wie auch immer Sie es anstellen, setzen Sie Himmel und Hölle, und wenn es gar nicht anders geht, auch das Fegefeuer in Bewegung, um eine Therapie machen zu können.
»Ich und ein Psychologe? Nie!« – Das dachte ich. Jahrelang.