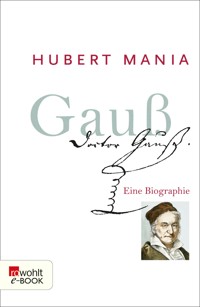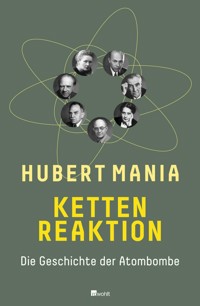
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
1896 spürte Henri Becquerel im Uran eine seltsame Strahlung auf, die Marie Curie Radioaktivität nannte. In den folgenden Jahrzehnten lieferten die deutschen Physiker Max Planck, Albert Einstein und Werner Heisenberg grundlegende Beiträge zum Verständnis der Prozesse im Atomkern. In Göttingen, dem Zentrum der internationalen Kernphysikergemeinde, ließ sich auch der amerikanische Student J. Robert Oppenheimer auf diese Disziplin ein. Anfang 1939 elektrisierte die Nachricht von Otto Hahns Kernspaltung die Forscher. Der erste Schritt zur Entfesselung der Atomenergie war getan. Ein halbes Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Und plötzlich standen sich die bisher befreundeten und eifrig kommunizierenden Physiker als Geheimnisträger in verfeindeten Machtblöcken gegenüber. Hubert Mania erzählt in diesem spannenden Buch die Geschichte der ersten Atombombe als eine Kettenreaktion von Ideen, Entdeckungen und Visionen, von Freundschaften, Neid und Intrigen der Wissenschaftler, Abenteurer und Genies.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hubert Mania
Kettenreaktion
Die Geschichte der Atombombe
Über dieses Buch
1896 spürte Henri Becquerel im Uran eine seltsame Strahlung auf, die Marie Curie Radioaktivität nannte. In den folgenden Jahrzehnten lieferten die deutschen Physiker Max Planck, Albert Einstein und Werner Heisenberg grundlegende Beiträge zum Verständnis der Prozesse im Atomkern. In Göttingen, dem Zentrum der internationalen Kernphysikergemeinde, ließ sich auch der amerikanische Student J. Robert Oppenheimer auf diese Disziplin ein. Anfang 1939 elektrisierte die Nachricht von Otto Hahns Kernspaltung die Forscher.
Der erste Schritt zur Entfesselung der Atomenergie war getan. Ein halbes Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Und plötzlich standen sich die bisher befreundeten und eifrig kommunizierenden Physiker als Geheimnisträger in verfeindeten Machtblöcken gegenüber.
Hubert Mania erzählt in diesem spannenden Buch die Geschichte der ersten Atombombe als eine Kettenreaktion von Ideen, Entdeckungen und Visionen, von Freundschaften, Neid und Intrigen der Wissenschaftler, Abenteurer und Genies.
Vita
Hubert Mania, geboren 1954, lebt als freier Autor und Übersetzer in Braunschweig. 2004 erschien die Rowohlt-Monographie «Stephen Hawking», 2008 veröffentlichte er seine vielbeachtete Biographie über Carl Friedrich Gauß.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2010
Covergestaltung Anzinger Wüschner Rasp, München
Coverabbildung © Emilio Segrè Visual Archives/American Institute of Physics/SPL/Agentur Focus; Keystone/laif; Keystone Schweiz/laif; Alfred Eisenstaedt/Getty Images; Corbis; dpa picture-alliance
ISBN 978-3-644-00801-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kapitel 1Radioaktivität
Das Fauchen im Windofen des Labors klingt fast bedrohlich. Der mächtige Luftzug facht das Feuer an, damit es genügend Hitze entwickelt, um Metalle zu schmelzen. Mit der Wärme verfliegt auch allmählich der modrige Dunst aus den dunklen Steinen, die in der Kiste vor dem Ofen liegen. Sie schwitzen die Feuchtigkeit des Bergwerks aus, den Schwamm der verfaulten Schalhölzer. Selbst die saure Luft des aufgegebenen Silberstollens ist – so scheint’s – in die Ritzen der Mineralien gekrochen und wird jetzt von der behaglichen Wärme im Raum wieder hervorgelockt. Aber bald schon wird sich der Muff ohnehin restlos verflüchtigt haben wie die rasch verblassende Erinnerung an einen Dauerregen im Herbst. Denn gegen die hier aufgefahrene Batterie ätzender Flüssigkeiten in Flaschen, Glasröhrchen und Ampullen kann nichts auf der Welt anstinken.
Der Berliner Apotheker Martin Heinrich Klaproth hat seinen kompletten Bestand bewährter Substanzen und Mixturen in Position gebracht, um den neuen Gesteinsproben aus dem Erzgebirge auf den Leib zu rücken. Mit Feuer und Säuren will er sie spalten und zerbröckeln, sie mit Salzen anlösen und mit Wasser erweichen. Während er leuchtend rote Klumpen Blutlaugensalz im Mörser zerknirscht, überwacht er die Färbung der frisch angesetzten Galläpfeltinktur. Sie wird aus den grob gemahlenen, apfelförmigen Kokons von Gallwespenlarven gewonnen, deren Mütter die Eier in Eichenblätter hineinbohren. Ihre Gerbsäure wird so manche Unreinheit im Erz fortspülen. Mit der schwarzen Tinte, die aus demselben Sud produziert wird, schreiben im fernen Paris der leidenschaftliche Demokrat Lafayette und der radikale Robespierre gerade ihre Entwürfe zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, in der sie so unerhörte Forderungen wie gleiches Wahlrecht für alle Männer und gar die Abschaffung der Monarchie stellen.
In diesen revolutionären Sommermonaten des Jahres 1789 herrscht auch in Klaproths Bärenapotheke im Schatten der wuchtigen Nikolaikirche an der Spandauer Straße, Ecke Probststraße eine ziemlich brenzlige Atmosphäre. In respektvollem Abstand zu den Schmelz- und Porzellanöfen bläst der Experimentator durch das Lötrohr fortwährend so viel Luft in eine offene Flamme, wie seine Lungen eben hergeben. Er hat den Docht einer Kerze in zwei Teile geschnitten und hält nun sein Blasrohr mitten in die Gabelung hinein. So kann er die Flamme modulieren, sie lang und spitzig blasen, bis sie genau die haselnussgroße Erzprobe umzüngelt, die auf einer aus Birkenholz hergestellten, knisterfreien Holzkohle liegt. Hier, im beengten Labor, können unkontrollierter Funkenflug oder winzige Körner aufspritzenden Metalls in Reichweite leicht entzündlicher Chemikalien und Kohlen selbst dem umsichtigsten Praktiker schon mal zum Verhängnis werden. Aber Martin Heinrich Klaproth ist mit riskanten Situationen beim Ablauf chemischer Prozesse vertraut. Als Mitglied der Loge «Zur Eintracht» ist er sogar im «Handbuch der Freimaurerei» von 1787 lobend erwähnt worden. Bei einem schlampig vorbereiteten alchemistischen Großexperiment bewahrte er seine Logenbrüder vor einer Explosionskatastrophe.
Mit der Geheimniskrämerei der Alchemistenfraktion will er nichts zu tun haben. Er distanziert sich klar vom mystischen Brimborium der Adepten, die noch immer auf der Suche nach dem Stein der Weisen sind, mit dem sie unedle Metalle in Gold verwandeln wollen. Als vorbildlicher Verfechter der wissenschaftlich begründeten Chemie lässt Klaproth nur gelten, was er in seinen Tiegeln und Retorten sehen, riechen und wiegen kann. Manchem Hersteller von Wunderarznei weist er betrügerische Absichten nach. So identifiziert er das beliebte «wunderthätige Luftsalz» als simples, zusatzfreies Glaubersalz, und das zu Wucherpreisen verkaufte «Pneumalkali» des Begründers der Homöopathie Samuel Hahnemann entlarvt er als gewöhnliches Borax [Dan:60].
Der Mineralkörper, den der Apotheker und Chemiker Klaproth in seine Bestandteile zergliedern will, wird von den Bergleuten des Erzgebirges Pechblende genannt. Sie schimmert gräulich bis tiefschwarz und erinnert ein wenig an den fetten Glanz von Pech. Die schweren Klumpen sind spröde und zerbrechen in muschel- und nierenförmige Stücke. Wegen ihres hohen Gewichts glaubten zu Beginn des 17. Jahrhunderts die ersten Silberschürfer in den niedrigen Stollen des böhmischen St. Joachimsthal noch an einen massiven Metallgehalt des Gesteins. Aber sie entdeckten nichts. Also hielt man die pechschwarzen Fundstücke eben für «Blende», die den verborgenen Schatz nur vorgaukele. In Wirklichkeit sei die Pechblende – so lautete das abschließende Urteil der Experten – taub, zu nichts nutze und behindere obendrein nur die Suche nach abbauwürdigen Erzen. Seitdem wirft man sie in den Silberstollen des Erzgebirges als Abfall beiseite.
Klaproth jedoch will es jetzt genauer wissen und das allseits verschmähte Mineral gründlicher untersuchen. Neugierig zerreibt er kleinere Brocken der Pechblende zwischen den Fingern, krümelt sie in Kalisalz hinein und bringt die Mischung im Schmelztiegel zum Fließen. Die schwarzgraue Masse bleibt starr und unauflöslich. Auch in der vom Lötrohr verstärkten Flamme erweist sich die Pechblende als unschmelzbar. Und so glüht er denn seine Steine, auf der Suche nach ihrer Essenz, aus und äschert sie ein, backt sie mit Blutlaugensalz zusammen, alkoholisiert und destilliert, färbt und filtriert sie, lässt sie verglimmen und trocknen, bis aus einer Mischung mit Phosphorsalz überraschenderweise eine klare grüne Perle hervorgeht – ein erster Hinweis auf die richtige Intuition des Experimentators. Da hält sich offenbar doch etwas Besonderes im Inneren des Gesteins versteckt.
Die vielversprechendsten Proben stammen aus der kleinen Silbergrube «Georg Wagsfort» im sächsischen Johanngeorgenstadt, nahe der Grenze zu Böhmen. In diesem Sommer hat Klaproth häufig in Karlsbad zu tun gehabt – ein beliebter Kurort für Zaren, Könige und den europäischen Adel. Gerade hat er einen Aufsatz über die Mineralquellen des weltberühmten böhmischen Thermalbads vollendet. Seine chemische Analyse des heilsamen Mineralwassers genügt hohen wissenschaftlichen Standards und soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden.
Johanngeorgenstadt liegt 25 Kilometer nördlich von Karlsbad. Mitte des 17. Jahrhunderts hatten einige protestantische Familien die böhmische Bergbaustadt St. Joachimsthal verlassen, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Auf der sächsischen Seite des Erzgebirges, am Fuß des Fastenbergs, bauten sie eine neue Stadt, die sie nach ihrem Landesherrn, dem Kurfürsten Johann Georg II., benannten. Eine Brauerei mit Schankstube war eher fertig als Rathaus und Kirche.
Die Stadt liegt 850 Meter über dem Meeresspiegel am fast abgeholzten Osthang des Fastenbergs. Als Martin Klaproth im Juli 1789, von Karlsbad kommend, hier Station macht, ist sie in den Qualm der Tag und Nacht brennenden Kohlefeuer der Hammerwerke und Hüttenbetriebe eingehüllt. Seine beste Zeit erlebte der Ort Mitte des 17. Jahrhunderts, als bis zu 180 Silbergruben in der näheren Umgebung rentabel waren. Inzwischen sind die meisten von ihnen zwar erschöpft, aber es arbeiten hier immerhin noch mehr als 600 Bergleute. Kilometerlange, von Quecksilber und Schlacke trübe Wassergräben und hohe, zum Teil noch schwelende Abraumhalden prägen die Landschaft. Der Schwefelgeruch scheint hier nie zu verfliegen. Mit geschultem Blick erkennt Klaproth auf dem Weg zur Grube «Georg Wagsfort» die Lichtlöcher von einem Meter Durchmesser am Berghang. Sie spenden den Arbeitern unter Tage frische Luft und Sonnenlicht. Aus vielen Öffnungen quillt Rauch. Er registriert die ordentlich gebauten Grubeneingänge – in manchen steht das Wasser kniehoch – und die von Glücksrittern hastig gegrabenen und dürftig wieder zugeschütteten Erdlöcher.
Im Berliner Labor kommt jetzt die Allzweckwaffe Salpetersäure zum Einsatz. Automatisch hält Klaproth respektvollen Abstand zur weißen Glasflasche mit dem «starken Wasser», aqua fortis, wie die mittelalterlichen Alchemisten die Auflösungskraft der Salpetersäure rühmten. Einen Brocken der matt glänzenden Pechblende übergießt er damit so lange, bis unter roten Dämpfen die schwarze Farbe völlig verschwindet – ein Ereignis, das Klaproth als vollständige Zerlegung seiner Probe wertet. Mit Wasser verdünnt, hat die Auflösung eine «hellweingelbe, ins Grünliche schimmernde Farbe» [Kla:203] angenommen.
Auch an der kuriosen Rathausuhr von Johanngeorgenstadt fährt Klaproths Kutsche vorbei. Bei jedem Viertelstundenschlag springen zwei blecherne Steinböcke aus dem Uhrenkasten und stoßen mit den Hörnern zusammen. Gleichzeitig lüftet ein Bergmann den Schachthut – ein Zylinder ohne Krempe – und klopft mit seinem Stock auf den Boden. Mancher Hausbesitzer klagt hinter vorgehaltener Hand über die Folgen des «Berggeschreys», wie man hier den inzwischen verflüchtigten Silberrausch nennt. Die vielen, kaum mehr überschaubaren Schächte und horizontalen Erzgänge unter der Stadt sollen verantwortlich sein für die ersten feinen Risse in den Hausmauern und die vermeintliche Absenkung der Fundamente – Schäden, die offenbar nur die Besitzer selbst wahrnehmen können. Sie sind Opfer der Furcht, auch bald zu den Verlierern des Berggeschreys zu gehören. Hinter dem Hammerwerk von Wittingsthal, einem Bergflecken von sieben Häusern am Rand von Johanngeorgenstadt, liegen an besonders matschigen Stellen, wo der Breitenbach in das Schwarzwasser mündet, dünne Fichtenstämme quer über der Fahrspur. Hier ist der Eingang zu der verlassenen Fundgrube «Georg Wagsfort», die Klaproth empfohlen wurde. Die Namen der benachbarten Schächte – Gottes Segen, Unverhofft Glück und Gottes Gnade – lassen noch die ursprüngliche Freude der Bergleute des 17. Jahrhunderts über die Silberschätze in der Erde ahnen. Sie ist bereits vor hundert Jahren aufgegeben worden, wird aber hin und wieder von feinen Herrschaften besucht, die bunte Mineralien für ihre Sammlungen kaufen wollen. Vor vier Jahren war erstmals auch der Geheimrat Goethe aus Weimar, ebenfalls aus Karlsbad kommend, hier aufgetaucht, hatte ein schönes Stück Rotgüldenerz erworben und im Lauf der Zeit immer wieder einmal hier haltgemacht und neue Prachtstücke für seine Sammlung gesucht.
Nach dem mühseligen Abstieg über Leitern strömt Klaproth auf der ehemaligen Abbausohle der vertraute Geruch von nie endendem Herbstregen und Fäulnis entgegen. Der Steiger weiß genau, wohin er seine Grubenlampe schwenken muss. Überall in die Klüfte und Risse leuchtet er hinein, damit der Logenbruder des preußischen Königs sich an der Herrlichkeit des kristallisierten Grünglimmers berauschen kann. Der haftet in Gestalt dünner, vierseitiger Täfelchen und Würfel in Smaragdgrün, Zitronengelb und Zeisiggrün an der Pechblende. Das Gestein ist von ziegelroten und schwefelgelben metallischen Erden durchzogen. In einem mürben, fettglänzenden Bruchstück entdeckte Klaproth in zart schimmernden Adern und feinkörnigen Flecken sogar bläulich-grauen Bleiglanz.
Im Labor verwandelt ein Schuss Salzsäure das aqua fortis in Goldscheidewasser. Diesen Dreh beherrscht Klaproth inzwischen mit perfektem Schwung aus dem Handgelenk, ohne sich um genaue Abmessungen zu kümmern. Damit in Berührung gebracht, erhitzt sich die Pechblende und schäumt stark auf. Nachdem er die Mischung verdünnt, gefiltert und Schwefelreste abgebrannt hat, kommen wunderschöne Kristalle in verschobenen, sechsseitigen Tafeln zum Vorschein, die ebenfalls zwischen Hellgrün und Gelb changieren. Nach weiteren Versuchen mit Laugensalzen und geschwefeltem Ammoniak bleiben zitronen-, licht- und safrangelbe Abscheidungen übrig, die er als Metallkalk identifiziert. Das gelbe Mehl mit Leinöl zu einer Art Kuchenteig angerührt und bei mittlerer Hitze im Porzellanofen gebacken, bringt einen feinen schwarzbraunen Staub von metallischem Glanz hervor, den er zwischen den Fingern zerreiben kann. Erneut mit Salpetersäure übergossen, erhitzt sich die Mischung. Wieder steigen rote Dämpfe auf, und Klaproth zweifelt nun nicht mehr daran, seinem Metallkalk den Sauerstoff ausgetrieben zu haben. Im stärksten Feuer des Porzellanofens geschmolzen, ist daraus eine feinschaumig poröse Masse aus gesinterten, matt schimmernden Metallkörnern geworden. Und als er den Klumpen mit der Feile bearbeitet, blitzt unter der eisengrauen Farbe der erhoffte Metallglanz auf. Klaproth ist jetzt überzeugt, die metallische Substanz der Pechblende isoliert zu haben. Er hat einen neuen «Metallkörper» entdeckt.
Der Apotheker Martin Heinrich Klaproth hat sich ganz und gar der experimentellen Chemie verschrieben. Als Mitglied der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften und Professor der berühmten Bergakademie Freiberg wäre er wohl kaum der exzellente Praktiker mit dem ausgezeichneten Ruf, wenn er nicht über die Fähigkeit verfügte, aus ähnlichen Reaktionen in längst bekannten Zusammenhängen Erkenntnisse für seine neuen Arbeiten zu gewinnen und obendrein über die eine oder andere praktische Anwendung nachzudenken. Deshalb will er jetzt einer Vermutung nachgehen und testet die Eignung der metallischen Pechblendenessenz als Glas- und Porzellanfärbemittel. Dafür rührt er unterschiedliche Mischungen aus dem gelben Metallkalk und Phosphorsäure an. Sie wird auch Knochensäure genannt, weil sie aus pulverisierten Tierknochen hergestellt wird. Phosphorsäure ist außerordentlich feuerbeständig und zerfließt in der Glut zu einer Art durchsichtigem Glas. Und so erhält Klaproth zunächst eine klare, smaragdgrüne Glassimulation, während bei einer Mischung mit einem zusätzlichem Anteil Kieselerde ein undurchsichtiges Glas entsteht, dessen helle apfelgrüne Farbe ihn an den Halbedelstein Chrysopras erinnert. Gelinde ausgeglühter Metallkalk der Pechblende, mit Schmelzfluss versetzt, auf Porzellan aufgetragen und in Emailfeuer eingebrannt, ergibt eine satte «oraniengelbe» Farbe.
Die alten Alchemisten stellten häufig – vermutlich nicht selten berauscht von den anregenden Dämpfen in ihrem Labor – Verbindungen her zwischen Dingen und Vorgängen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten. In den Jahrhunderten, bevor Kopernikus und Galilei mit ihren revolutionären Thesen über die Bewegung der Planeten für Aufregung bei den Hütern der christlichen Lehre sorgten, stand die Erde noch im Mittelpunkt des Universums. Sie wurde von sieben Planeten umrundet, zu denen auch die Sonne gehörte. Über eine lange Zeit hinweg waren ebenfalls sieben Metalle bekannt – eine fraglos gottgewollte, auf ewig unveränderliche Ordnung wie das Planetensystem. Und so kam irgendwann ein kluger Kopf, auf Augenhöhe mit dem Wissen seiner Zeit, auf die Idee, diese sieben Metalle den sieben Planeten zuzuordnen. Die Strahlen der zum Erdsatelliten degradierten Sonne bringen das Gold in der Erde hervor. Geheimnisvolle Astralschwingungen des Mondes lassen das Silber unter den Häusern von St. Joachimsthal und Johanngeorgenstadt wachsen. Eisen passt am besten zum Mars, Kupfer zur Venus, Blei zum Saturn.
Im Revolutionsjahr 1789 nimmt kein seriöser Wissenschaftler solche auf Ähnlichkeiten beruhenden Systeme mehr ernst, zumal sich inzwischen die Zahl der bekannten Metalle auf siebzehn erhöht hat, ohne dass sich die entsprechenden Planeten zu erkennen gegeben hätten. Nun aber hat der deutsche Astronom Wilhelm Herschel vor acht Jahren erst einen neuen Himmelskörper entdeckt, der sich tatsächlich als Planet erwies und den er Uranus genannt hat. Uranus ist vor allem deshalb eine astronomische Sensation, weil er in einer bisher unvorstellbaren Ferne zur Erde um die Sonne kreist. Wird die Strecke zwischen Erde und Sonne mit einer astronomischen Einheit gleichgesetzt, so war der Saturn bis zu Herschels Entdeckung mit rund neun astronomischen Einheiten am weitesten vom Zentralgestirn entfernt. Uranus aber zieht in einer Distanz von sagenhaften neunzehn astronomischen Einheiten oder drei Milliarden Kilometern zur Sonne seine einsame Bahn. Und so hat sich mit diesem unvermuteten Verkehrsteilnehmer das beobachtbare Universum gleich um das Doppelte vergrößert – zumindest im Bewusstsein der eifrig kommunizierenden Mitglieder akademischer Zirkel.
Auch Martin Heinrich Klaproth wird sich über die schockierenden kosmischen Dimensionen im Klaren gewesen sein, die der neue Planet erschlossen hat. Womöglich werden sie ihn sogar beflügelt haben. Denn in den letzten acht Jahren seit Herschels Uranus-Entdeckung hat niemand ein neues Metall gefunden. Also steht es ihm jetzt frei, das Recht des Entdeckers in Anspruch zu nehmen und an die alte Tradition anzuknüpfen, einen bis dahin unbekannten Metallkörper nach einem Planeten zu benennen. Er hätte das neue Element auch Klaprothium nennen können, doch es soll Uranium heißen. Ein ziemlich pompöser Name für ein zitronengelbes und zeisiggrünes Glasfärbemittel.
Schwere schwarze Vorhänge an den Fenstern lassen keinen Sonnenstrahl ins Labor dringen. Seit nunmehr sechs Wochen arbeitet, isst und schläft der Herr Professor nur noch in seiner Dunkelkammer im Erdgeschoss des Physikalischen Instituts der Universität Würzburg und hütet sein Geheimnis. Nicht einmal seine geliebte Frau Bertha, mit der er die Dienstwohnung im ersten Stock teilt, weiß von seiner seltsamen Entdeckung. Bei allem Verständnis für seinen Beruf muss sie sein Schweigen als Kränkung empfinden. Was sie schmerzt, ist die Ahnung, dass ihr Mann diese freiwillige, an Besessenheit grenzende Isolation in seiner finsteren Höhle da unten offenbar auch noch genießt. Wenn sie einmal – selten genug – diesem blassen Gespenst, das ihr Wilhelm sein soll, kurz auf dem schmalen Korridor begegnet, macht es sich im Eilschritt Notizen oder seine müden Augen schauen glatt durch sie hindurch. Hin und wieder ist er sich der häuslichen Misere bewusst. Aber es hilft ja nichts. Er muss jetzt weiter arbeiten, darf sich auf keinen Fall durch vorzeitige Äußerungen lächerlich machen. Weder vor Bertha, noch in der Öffentlichkeit. Erst muss er endgültige Gewissheit haben. Immerhin steht sein guter Ruf als Physiker auf dem Spiel.
Im Laborjournal von Professor Dr. Wilhelm Conrad Röntgen ist der Abend des 8. November 1895 als Datum jener Entdeckung festgehalten, die den quecksilbrigen Wissenschaftler in diesen Arbeitsrausch gestürzt hat. Er untersucht, wie viele Physiker seiner Generation, die vielfältigen Erscheinungsformen des Elektromagnetismus. Vor genau 30 Jahren hat der schottische Physiker James Clerk Maxwell mit vier genialen Gleichungen gezeigt, dass sowohl sichtbares und ultraviolettes Licht als auch elektrische und magnetische Phänomene allesamt zum Spektrum der elektromagnetischen Wellen gehören. Röntgen interessiert sich insbesondere für die Leuchterscheinungen der Elektrizität in Glasröhren. Von der knapp einen Meter langen Röhre mit minimalem Gasgehalt führen zwei Drähte zu einer zylinderförmigen Stromquelle. An diesem denkwürdigen Freitagabend hat er seine Spezialröhre gerade mit einem lichtundurchlässigen schwarzen Karton umhüllt, um herauszufinden, ob er sie dadurch vollständig isolieren kann. Als er in dem abgedunkelten Raum den Starkstrom einschaltet, bemerkt er ein schwaches Leuchten auf dem Tisch in der Nähe der Apparatur. Dort liegt zufällig ein Papierschirm, der mit einer chemischen Substanz überzogen ist, die Licht abgibt, wenn eine geeignete Strahlung auf sie trifft.
Röntgen ist verblüfft. Aus seiner Glasröhre kann die Strahlung doch nicht kommen. Der enganliegende schwarze Karton hält das elektrische Licht zuverlässig zurück. Er schaltet den Strom aus. Das Leuchten ist augenblicklich vorbei. Er schaltet den Transformator wieder ein. Prompt leuchtet der Schirm auf dem Tisch wieder auf. Röntgen glaubt seinen Augen nicht zu trauen, denn er kennt keine Strahlung, die unter diesen experimentellen Bedingungen seinem Glaskolben entweichen könnte. Er wiederholt die Prozedur einige Male und schiebt dabei den Tisch mit dem Schirm immer weiter von der Röhre weg. Noch bei zwei Metern Entfernung stellt sich die Lumineszenz ein, sobald eine Gasentladung in der Röhre stattfindet. Schwarzer Karton scheint also die Strahlen nicht aufhalten zu können. Jetzt stellt er ihnen Stanniolstreifen, Papierhefte, ein Brett aus Tannenholz und schließlich ein Buch von 1000 Seiten in den Weg. Mühelos durchdringen unbekannte Strahlen auch diese Hindernisse und hinterlassen ihre Spuren auf dem Leuchtschirm.
Erst jetzt, nach vielleicht zwei Dutzend schnellen, nervösen Versuchen, hat Röntgen ein Auge für die fremdartige Schönheit der Leuchterscheinung. Im Rhythmus der schwankenden Entladungen rollen Wellen zarten, gelbgrünen Lichts über die Oberfläche des Schirms oder ziehen wie Wolken langsam darüber hinweg. Doch am Ende dieses aufregenden Abends glaubt der verunsicherte Wissenschaftler noch immer, das Opfer einer Täuschung geworden zu sein. Allzu phantastisch erscheint ihm die sich aufdrängende These, es hier mit bisher unbekannten Strahlen zu tun zu haben. In den nächsten Tagen geht er systematisch vor und fährt mit dünnen Blechen aus Aluminium und Zink, aus Kupfer, Silber und Gold schwerere Geschütze auf. Doch selbst diese Metalle können der Strahlungskraft keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen. Erst Blei- und Platinbleche von einigen Millimetern Stärke versperren den Strahlen den Weg von der Glasröhre zum Leuchtschirm.
Allmählich gewöhnt sich Röntgen an den Gedanken, tatsächlich eine neue Art von Strahlen entdeckt zu haben, und kommt auf eine verwegene Idee. Er ersetzt den Leuchtschirm aus beschichtetem Papier durch eine fotografische Platte. Der Versuch gelingt. Die unsichtbaren, in der Glasröhre erzeugten Strahlen dringen durch ein verschlossenes Holzkästchen, in dem ein Satz Metallgewichte aufbewahrt wird. Auf der Belichtungsplatte, die während der Bestrahlung unter dem Kasten lag, zeichnen sich die dunklen Rundungen der Gewichte deutlich ab. Auch eine Kompassnadel, die von einer Blechbüchse umhüllt ist, wird mit diesem neuen Ablichtungsverfahren sichtbar. Als zufällig einmal seine Hand in den Strahlenstrom gerät, erschrickt er. Die Strahlen können offenbar Materiestrukturen durchdringen und dort Dinge fotografieren, die dem menschlichen Blick verborgen bleiben. Und da sie bisher so zuverlässig demonstriert haben, wie souverän sie alle möglichen Substanzen durchdringen, kann die fotografische Platte in ihrer Lichtschutzhülle aus Papier oder Blech eingeschlossen bleiben. Dieser glückliche Umstand lässt unmittelbares Fotografieren ohne den Umweg über eine Kamera auch bei Tageslicht oder in beleuchteten Räumen zu. So fliegen die Tage und Wochen im Labor dahin. Was in Würzburg und in der Welt geschieht, interessiert Röntgen wenig. Am 27. November 1895, auf dem Höhepunkt seiner Versuche, gründet der schwedische Chemiker Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, eine Stiftung, die jedes Jahr einen Preis für herausragende Leistungen in der Chemie, Medizin, Physik, Literatur und bei Bemühungen um den Weltfrieden verleihen soll.
So sensationell die ersten Beweise für einen strahlenunterstützten Blick durch feste Materie hindurch auch sein mögen, am eindrucksvollsten sind zweifellos die Aufnahmen menschlicher Körperteile. Als Wilhelm Conrad Röntgen am 22. Dezember 1895 endlich seine Bertha einweiht und ihre Hand eine Viertelstunde lang bestrahlt, verschafft er ihr, auch ohne viele Worte, den denkbar spektakulärsten Einblick in das Durchleuchtungsvermögen seiner X-Strahlen, wie er sie jetzt nennt. Wobei er sich das X von den Mathematikern als Universalbezeichnung für eine unbekannte Größe ausleiht. Die X-Strahlen lassen Haut, Muskeln und Nervengewebe von Bertha Röntgens Hand als schwachen Schatten in den Hintergrund treten, bilden dafür aber die Knochenstruktur umso deutlicher ab. Doch beim Blick auf einen Teil des eigenen, lebendigen Skeletts mischen sich in das ungläubige Staunen und in die Begeisterung unausweichlich auch Gedanken an den Tod.
Am 28. Dezember überreicht Wilhelm Conrad Röntgen dem Sekretär der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft an der Universität Würzburg den ersten Forschungsbericht über seine eigenartigen Lichtspiele in der Abgeschiedenheit seines Instituts. Er trägt den Titel «Über eine neue Art von Strahlen». Die Arbeit geht sofort in Druck und wird an 90 Kollegen in ganz Europa geschickt. Die Zeitungen reagieren blitzartig auf die neue Entdeckung. Auf der ganzen Welt, vor allem in England und in den USA, bricht in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung eine wahre Röntgen-Manie aus. Das Foto von Berthas Handskelett regt eine unübersehbare Schar von Medizinern, Physikern und Unternehmern zur Herstellung qualitativ hochwertiger Abbildungen lebender Menschenhände an. Besonderes Aufsehen erregt in diesen ersten Wochen des neuen Jahres 1896 ein Bild aus dem Physikalischen Staats-Laboratorium in Hamburg, auf dem ein Ehering schwerelos um den Ringfingerknochen zu schweben scheint.
Am 24. Januar berichtet das «Fränkische Volksblatt» über die vermutlich erste praktische Anwendung der X-Strahlen in England. Seit Monaten liegt ein aus unerklärlichen Gründen gelähmter Matrose in einem Londoner Krankenhaus. Da Arzt und Patient nichts zu verlieren haben, wird der Rücken mit X-Strahlen durchleuchtet. Dabei entdeckt der Arzt einen Fremdkörper zwischen zwei Wirbeln, der sich nach der Operation als abgebrochene Messerspitze erweist. Kurze Zeit später steht es dem Matrosen frei, aufrechten Ganges in die nächste Keilerei zu geraten. Es sind solche Meldungen, die die Phantasie befeuern und den Unternehmergeist beflügeln. So kündigt der berühmte Erfinder der Glühbirne, Thomas Alva Edison, an, mit den X-Strahlen ein Gehirn durchleuchten zu wollen. Drei Wochen lang wird sein Haus von Reportern umlagert, bis er schließlich kleinlaut sein Scheitern eingestehen muss. In einer amerikanischen Zeitung regt jemand an, Röntgenstrahlen auf das Gehirn von Verbrechern zu richten, um sie von ihren kriminellen Neigungen zu heilen. Eine nur vermeintlich harmlosere Variante dieser Idee wird sich allerdings tatsächlich durchsetzen, nämlich die Bekämpfung unerwünschten Haarwuchses auf Oberlippen, Leberflecken und Waden des schönen Geschlechts. In Schönheitssalons und Arztpraxen wird bestrahlt, was die Röntgenröhre hergibt. Noch ist die Euphorie groß.
In Braunschweig schneidet bereits Mitte Januar 1896 der Zahnarzt Otto Walkhoff ein rundes Stück aus einer fotografischen Platte zurecht, wickelt es in lichtabweisendes Papier und klemmt es dann «bei weit geöffnetem Munde hinter beide Zahnreihen. Die Belichtung geschah durch die Wange … Die notwendige Expositionszeit von je 25 Minuten war eine Tortur», schreibt der unerschrockene Röntgenpionier und erkennt schließlich anhand der «Abbildung der Pulpakammern und der in den Knochen steckenden Wurzeln, dass diese Strahlen für unser Fach von Bedeutung sein müssten» [Fri2: 68].
Auch in Frankreich lässt sich ein Physiker von den X-Strahlen zu eigenen Versuchen anregen. Allerdings wiederholt er nicht einfach Röntgens Verfahren, sondern findet einen naheliegenden, neuen Ansatz. Auf ihrer Januarsitzung 1896 stehen die Mitglieder der Pariser Akademie der Wissenschaften unter dem Vorsitz des berühmten Mathematikers Henri Poincaré ganz im Bann der aufregenden Nachrichten und Fotos aus Würzburg. Henri Becquerel, Physikprofessor an der Polytechnischen Hochschule von Paris, ist von einem Detail fasziniert. Ausgangspunkt der X-Strahlen müsse – das bestätigt ihm auch Poincaré – der hellgrüne Leuchtfleck auf der Wand der von Röntgen benutzten Glasröhre sein. Becquerel ist seit langem mit lumineszierenden Substanzen vertraut. Das sind Stoffe, die selbst Licht abgeben, nachdem sie der Sonne ausgesetzt gewesen sind. Vielleicht ließen sich ja mit diesen eigenartigen Mineralien, so spekuliert Becquerel, ähnliche Ergebnisse erzielen, wie Röntgen sie beschreibt. Er möchte herausfinden, ob sie ebenfalls Fotoplatten schwärzen können. Sein Vater Alexandre Edmont Becquerel hat mit dem Phosphoroskop einen empfindlichen Apparat gebaut, der auch noch minimale Leuchtfähigkeiten von Körpern nachweist. Und so steht dem Sohn des Erfinders ein breites Spektrum an Substanzen für seine Versuche zur Verfügung. Noch am selben Tag beginnt er mit den Experimenten und legt erwiesenermaßen nachleuchtende Kristalle auf die Fotoplatten. Die wiederum sind, um Lichteinwirkung zu verhindern, in schwarzes Papier oder in Aluminiumfolie eingewickelt.
Und so strömen in Becquerels abgedunkeltem Labor Wasserproben, in denen frische Rosskastanienrinde gelegen hat, Flussspat, seltene Platincyanmetalle und Naphtalinrot das eingesogene Sonnenlicht in unterschiedlich intensiven grünen, blauen, violetten und orangegelben Farbtönen wieder aus. Doch die beeindruckenden Farblichtspiele bringen nicht den erhofften Erfolg. Eine Schwärzung der Platten wie bei den X-Strahlen stellt sich, auch nach wochenlangen Versuchen, bei keiner bekannten lumineszierenden Substanz ein. Ende Februar will es Becquerel dann mit Uransalzkristallen versuchen, die für ihre starke Lumineszenz bekannt sind. Er setzt sie dem Sonnenlicht aus, wickelt sie anschließend in zwei Lagen schwarzes Papier und schiebt eine dünne Silberfolie zwischen Präparat und fotografische Platte. Nach einer Expositionszeit von zwei Stunden zeigen sich erstmals tatsächlich dunkle Flecken auf der Platte. Es sind eindeutig die Umrisse der Uransalzkrümel.
Als Antoine Henri Becquerel seine Entdeckung am 24. Februar 1896 der Akademie der Wissenschaften in Paris mitteilt, vertreten alle Mitglieder die Meinung, die Strahlung des Urans müsse auf seine Nachleuchtfähigkeit zurückzuführen sein. Man habe es wohl auch hier mit Röntgenstrahlen zu tun, die lichtabweisendes Material durchdringen können. Uran ist, gut hundert Jahre nach seiner Entdeckung, ein durchaus bewährtes und beliebtes Glas- und Keramikfärbemittel. Nun aber erweist es sich erstaunlicherweise als das einzige Metall, das Strahlen aussendet, die kein gewöhnliches Licht sein können.
Die eigentliche Überraschung aber erlebt Becquerel erst ein paar Tage später. Da der Himmel über Paris in diesen letzten Februartagen einfach nicht aufklaren will, stehen auch die Chancen schlecht, eine weitere Uransalzprobe mit Sonnenlicht zu bestrahlen. Deshalb verstaut Becquerel die in Metallfolie verpackte Fotoplatte mit dem daraufliegenden Uranbrocken erst einmal in einer Schublade. Ein paar Tage später – die Sonne scheint immer noch nicht – kramt er sie wieder hervor. Ob Ungeduld im Spiel ist oder die plötzliche Eingebung, das Uran könnte eine Restlumineszenz verströmt haben, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Becquerel entwickelt die Platte und registriert verblüfft auch hier den schon bekannten fotografischen Effekt: Der Umriss des Urankristalls hat sich auf der Fotoplatte als Schatten abgebildet. Fieberhafte Gegenproben mit allen erreichbaren Uranverbindungen, selbst mit nur schwach oder gar nicht lumineszenzfähigen Präparaten, führen alle zu demselben Ergebnis: Die Strahlung des Urans wird eindeutig nicht vom Sonnenlicht angeregt. Sie hat nichts mit dem Phänomen der Lumineszenz zu tun. Selbst monatelang im Dunkeln aufbewahrte Uransalze geben unablässig durchdringende Strahlung ab.
Diese wahrhaft bedeutsame Eigenschaft der sogenannten «Becquerelstrahlen» wird von der Pariser Akademie der Wissenschaften am 2. März 1896 veröffentlicht. Erst vier Monate sind seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen vergangen, und schon hat sich eine zweite unbekannte Strahlenart dem Spektrum der elektromagnetischen Strahlung hinzugesellt. Zunächst aber gehen Becquerels neue Erkenntnisse im Lärm der globalen Begeisterung für die Röntgenstrahlen sang- und klanglos unter. Die Physiker sind viel zu sehr mit der allmählichen Verbesserung des Ablichtungsverfahrens nach Röntgen beschäftigt, um die Nachrichten aus Paris ernst zu nehmen oder gar die Versuche Becquerels zu wiederholen. Wie im Rausch fotografieren sie die «Totenköpfe» und Handknochen ihrer Kinder und Ehefrauen, ohne sich über die enormen Expositionszeiten Gedanken zu machen, oder sie arbeiten bereits gemeinsam mit Medizinern an Strahlentherapiekonzepten.
Die Uranstrahlen mögen zwar durch Metallfolien dringen und einen leidlich erkennbaren Fotoeffekt auslösen, aber das ändert offenbar nicht die vorgefassten Meinungen in den Köpfen der Kollegen. Die wollen aus der Arbeit Becquerels nicht die Konsequenz ziehen, es mit einer neuen Eigenschaft der Materie zu tun zu haben. Sie sehen lediglich eine schwache Variante der Röntgenstrahlen am Werk. Die Becquerelstrahlen benötigen bis zu 24 Stunden, um einen brauchbaren Abdruck auf der Fotoemulsion zu hinterlassen. Sie können nicht annähernd die spektakulären Bilder liefern, die Röntgenstrahlen bei ihrer Passage durch Materie erzeugen. Was ist schon der schwach ausgeprägte Schatten eines Uranklumpens gegen den Blick durch den Lauf von Wilhelm Röntgens Jagdwaffe auf die glänzenden Gewehrkugeln? Mit Röntgenstrahlen lassen sich die in Schienbeinen und Schulterblättern von Kriegsveteranen stecken gebliebenen Patronen, gebrochene Arm- und Beinknochen, verschluckte und nun anscheinend frei im Beckenraum schwebende Münzen deutlich erkennen. Amerikanische X-Ray-Enthusiasten können Radiographien einer Niere für einen halben Dollar kaufen – mit Nierensteinen: 75 Cent [Gla: 232].
Die wenigen Kollegen, die sich dann doch mit den Becquerel’schen Thesen auseinandersetzen, melden Vorbehalte an. Viel zu phantastisch klinge die Behauptung, ein unbedeutender Porzellanfarbenzusatz habe ohne Einwirkung von Licht oder Elektrizität ähnlich durchdringende Eigenschaften wie die X-Strahlen. Und die wahnwitzige Vorstellung, das Uran könne sich gar «spontan», also aufgrund eigener Strahlen, auf der Fotoplatte abgebildet haben, passt Ende des 19. Jahrhunderts so ganz und gar nicht ins physikalische Weltbild. Seriöse Wissenschaft muss schon den Umweg über birnenförmige, teilevakuierte und gasgefüllte Glasröhren, Starkstrom und Leuchtschirme gehen, wie Röntgen es vorgemacht hat.
Die Wolfenbütteler Gymnasiallehrer Julius Elster und Hans Geitel gehören zu den wenigen Forschern, die bereits im April 1896 Becquerels Versuche wiederholt, seine Ergebnisse in allen Punkten bestätigt und dem Skeptiker Wilhelm Röntgen ein Protokoll ihrer Arbeit geschickt haben. Der zeigt sich zwar beeindruckt von der zuverlässigen Beobachtungsgabe des norddeutschen Forschergespanns. Aber in seinem Antwortbrief vom 23. Februar 1897, genau ein Jahr nach Becquerels erster Veröffentlichung, schreibt er: « … ich muss nämlich gestehen, dass ich nicht recht daran glaubte …» Und an anderer Stelle kommt er zu dem Schluss: «Freilich will es mir nicht so recht in den Kopf …» [Fri1:80]. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits mehr als 1000 Artikel und 50 Bücher über die X-Strahlen. Angesichts dieser Papierlawine nimmt kaum noch jemand Notiz von Becquerels Veröffentlichung. Mit Ausnahme einer aus Polen stammenden, 30 Jahre alten Chemikerin. Sie ist auf der Suche nach einem Dissertationsthema und hat die kaum beachteten Aufsätze gelesen, die Becquerel bis Mitte 1897 über die Uranstrahlung veröffentlicht hat. Mehr Literatur scheint es zu diesem Thema nicht zu geben, das sie ungemein spannend findet. Aber gerade dieser Umstand spornt sie an, denn so bleibt ihr genügend Raum für selbständige Forschungen. Und deshalb beschließt sie, ihre Dissertation über die Uranstrahlen zu schreiben.
Ihr Hochzeitskleid bekommt Marya Sklodowska von einer Verwandten geschenkt. Schwarz und schlicht wünscht sie es sich, damit sie es später als Laborkittel auftragen kann. Denn auf dem dunklen Stoff fällt der ständig vom Hof hereinwehende Kohlenstaub nicht weiter auf. Die junge Frau aus Warschau hat als Dienstmagd und Gouvernante bei feinen Leuten in der polnischen Provinz für einen Hungerlohn gearbeitet und ihre intellektuellen Fähigkeiten verleugnen müssen. Doch mit Selbstdisziplin und Hartnäckigkeit hat sie es schließlich bis an die Sorbonne geschafft. Sie studiert Physik, Mathematik und Chemie und lernt Pierre Curie kennen, der sich auf Anhieb in die etwas spröde, ehrgeizige Frau mit dem traurigen Blick verliebt.
Curie unterrichtet an der Hochschule für Industrielle Physik und Chemie in Paris und verdient nicht viel mehr als ein Arbeiter. Aber das kümmert Marie nicht. Sie ist Geldnot gewohnt und weiß, wie man mit knapper Kasse über die Runden kommt. Zur Hochzeit verzichtet das junge Paar sogar auf den Luxus von Ringen. Madame und Monsieur Curie lassen sich Geld schenken und erfüllen sich einen Traum: Sie kaufen neue Fahrräder und unternehmen ausgedehnte Landpartien. Noch im Sommer 1897 steigt die im achten Monat schwangere Marie aufs Rad, um ihren Pierre auf einen Ausflug nach Brest zu begleiten. Doch sieht sie nach ein paar Kilometern ein, dass sie mit dieser rigorosen Schwangerschaftsgymnastik vielleicht doch eine Spur zu forsch unterwegs ist.
Ihre Tochter Irène ist gerade drei Monate alt, da beginnt Marie Curie im Dezember 1897 mit den ersten Untersuchungen der Becquerelstrahlen. Aber sogar im liberalen Paris wollen Professoren und Institutsleiter eines nicht verstehen: Warum ausgerechnet eine junge Mutter, die sich doch in erster Linie um ihr Kleinkind kümmern sollte, den Ehrgeiz entwickelt, eine Dissertation zu schreiben. Bisher hat noch keine europäische Universität einer Frau einen Doktortitel verliehen. Pierres Chef überlässt ihr einen kleinen, verglasten Werkraum im Erdgeschoss des Hochschulgebäudes. Ein bisschen feucht und zugig ist es hier zwar, aber über solche Kleinigkeiten beklagt sich die genügsame Doktorandin nicht.
Zunächst einmal wiederholt sie Becquerels Versuche und bestätigt seine Ergebnisse. Er hat ja bereits eine weitere wichtige Eigenschaft der Uranverbindungen festgestellt: Die von ihnen ausgehenden Strahlen machen die Umgebungsluft elektrisch leitfähig. Mit einem von Pierre erfundenen Apparat, einem speziellen Elektrometer, misst sie jetzt die elektrisierte Luft über der jeweiligen Uranprobe und kann daraus indirekt auf die Strahlungsaktivität schließen. So hat sie mit der Stromstärke ein einfaches Maß für die Strahlungsaktivität ihrer Uranpräparate gefunden. Äußere Umstände wie die heftigen Temperaturschwankungen in Maries Arbeitsraum, die Luftfeuchtigkeit sowie künstliche oder natürliche Beleuchtung haben keinerlei Einfluss auf die Höhe der Strahlungsaktivität. Den mit Abstand stärksten Stromfluss misst sie bei Pechblendenproben aus dem sächsischen Johanngeorgenstadt, dicht gefolgt von denen aus dem böhmischen St. Joachimsthal.
Eine weitere wichtige Beobachtung erregt ihre Aufmerksamkeit. Ob sie nun die Substanzen extremer Hitze oder Kälte aussetzt, ob sie Uran als Oxid, Salz oder Phosphat in wässriger Lösung, als Klumpen oder in Pulverform untersucht, spielt bei der Ermittlung der Strahlung keine Rolle. Sie kann daher keine Eigenschaft der jeweiligen Verbindung sein, sondern muss direkt mit dem Element Uran zusammenhängen. Denn je größer der Urananteil der Substanz ist, desto intensiver ist die Strahlung. Sie lässt sich auch nicht beseitigen. Weder durch aggressive Chemikalien, noch durch starke elektrische Entladungen. Jetzt will Marie Curie systematisch vorgehen und alle bekannten chemischen Elemente des Periodensystems untersuchen. Dafür plündert sie erst einmal die Mineraliensammlung von Pierres Fachhochschule. Dabei stellt sie fest, dass auch Verbindungen, die das Element Thorium enthalten, Strahlung abgeben und die Luft elektrisieren. Um künftig eine gemeinsame Bezeichnung für die Strahlungsstärke von Uran und Thorium zu haben, prägt Marie Curie den Begriff «Radioaktivität».
Nach dieser bedeutsamen Entdeckung im Frühjahr 1898 stößt sie beim Messen zweier Uranmineralien auf einen seltsamen Umstand. Die Strahlung der Pechblende übertrifft nämlich die des reinen Urans um das Vierfache. Auch wenn sie noch zögert, die Konsequenz daraus anzuerkennen, so bleibt ihr letztlich doch nur eine einzige Schlussfolgerung: In den natürlich vorkommenden, unbearbeiteten Uranmineralien muss noch eine andere Substanz verborgen sein, die stärker strahlt als Uran und Thorium. Da aber Madame Curie schon alle 1898 bekannten Elemente mit dem Apparat ihres Ehemanns Pierre auf Strahlung untersucht hat, kann diese verborgene Substanz nur ein neues chemisches Element sein.
Im Sommer des Revolutionsjahres 1789 hatte Klaproth in Berlin ein neues Element aus der Pechblende isoliert und es nach dem sonnenfernsten Planeten Uranus benannt. Es gibt den Gläsern, Vasen und Flakons des gerade reüssierenden Jugendstils den typischen gelbgrünen Schimmer in allen Tönen von sattem Bernsteingelb bis zu dunklem Apfelgrün. Und nun ist Marie Curie, mehr als hundert Jahre später, offenbar einem weiteren unbekannten Element in der Pechblende auf der Spur. Welch ein Triumph nach vier Monaten Arbeit. Noch kann sie es nicht als materielle Substanz präsentieren, denn seine Existenz in diesem Gestein ist flüchtiger als ein Windhauch. Aber sie ist zuversichtlich, den Stoff bald auch als etwas Sicht- und Wägbares in ihren Mörsern zerknirschen zu können.
Jetzt steht sie gemeinsam mit ihrem Mann im Labor. Pierre Curie hat die Arbeit an Kristallen aufgegeben, um seine Marie bei der Suche nach dem neuen Element zu unterstützen. Mit dem Optimismus von Pionieren opfern sie von ihrem gutgehüteten Pechblendenschatz stolze hundert Gramm für das mühselige Geschäft der Auflösung, Trennung und Reinigung des Minerals. Sieben Wochen später kann Marie Curie ihren hypothetischen Stoff von allen anderen in der Pechblende enthaltenen Substanzen abtrennen. Zuletzt hatten sie und Pierre Schwefelwasserstoff und Feuer so effektiv eingesetzt, dass die Probe dreihundertmal stärker strahlte als Uran. Und mit jeder weiteren Reinigung steigt die Radioaktivität weiter an. Nun sind die letzten Zweifel beseitigt.
Am 18. Juli 1898 erhält die Akademie der Wissenschaften in Paris einen Aufsatz des Ehepaars Curie mit dem Titel «Über eine neue, in der Pechblende enthaltene radioaktive Substanz». Die einunddreißigjährige Marie Curie hält das neue chemische Element für die bedeutendste Entdeckung ihres Lebens und nennt es zu Ehren ihres Heimatlandes «Polonium». Aber die Pechblende hält eine noch größere Überraschung mit weitreichenden Folgen für sie bereit. Nach der Poloniumisolierung ist nämlich noch eine geringe Menge des Leichtmetalls Barium übrig geblieben. Und auch die weist noch eine erhebliche radioaktive Strahlung auf. In dem mattgrauen Stoff muss also noch eine zweite, unbekannte radioaktive Grundsubstanz verborgen sein.
Doch unerklärlicherweise ermüden die Curies jetzt schnell, wenn sie mit den strahlenden Substanzen hantieren, und müssen gegen eine seltsame Lethargie ankämpfen. Außerdem klagt Pierre seit kurzem über Gliederschmerzen, die er als rheumatische Erkrankung deutet, während Marie an rissigen, entzündeten Fingerspitzen leidet. Offenbar brauchen sie eine Erholungspause. So bleiben denn auch ihre Laborjournale bis zum 11. November geschlossen. Bis Weihnachten hilft ihnen der renommierte Chemiker Eugène Demarçay, eine sogenannte Spektroskopie des neuen Stoffs zu machen. Jedem chemischen Element lässt sich eine eigene charakteristische Spektrallinie zuordnen. Sie stellt das Licht dar, das von erhitzten Atomen dieses Elements abgegeben wird, und ist sozusagen der unverwechselbare Fingerabdruck dieser speziellen Atomsorte. Und auf diesen eindeutigen Beweis für die Existenz des neuen Elements arbeitet Demarçay hin. Auf Elektroden streicht er eine winzige Probe davon, durch die er einen elektrischen Funken leitet. So gelingt es ihm, das Funkenspektrum der Substanz zu fotografieren. Auf dieser Fotografie findet er eine Spektrallinie, die zu keinem bekannten Stoff gehört [Rei:73]. Nach jedem weiteren Reinigungsschritt ist die unbekannte Spektrallinie schärfer zu erkennen.
Und so kann das erfolgreiche Trio am 26. Dezember der Akademie eine weitere Arbeit vorlegen. Darin nennen sie das neue radioaktive Element «Radium». Es strahlt neunhundertmal stärker als Uran, scheint aber ein noch viel größeres Radioaktivitätspotenzial zu haben. Eine weitere Reinigung und Verfeinerung des Radiums ist allerdings nicht mehr möglich, weil die Curies ihren Pechblendenvorrat restlos aufgebraucht haben. Durch die guten Beziehungen zu dem Wiener Geologen Professor Eduard Süß gelangen sie an hundert Kilogramm Pechblende, die ihnen die staatliche Uranfabrik im böhmischen St. Joachimsthal großzügigerweise ohne Berechnung überlässt.
Die bessere Abstellkammer, in der das Forscherpaar bisher gearbeitet hat, wird den neuen Arbeitsanforderungen nicht mehr gerecht. Sie brauchen mehr Platz und bekommen die Erlaubnis, einen ehemaligen Sezierraum der Schule zu benutzen. Marie Curie beschreibt den Schuppen: «Das Glasdach bot keinen vollkommenen Schutz vor Regen. Im Sommer war es heiß und schwül; im Winter bereitete der zum Glühen erhitzte Ofen nur Enttäuschung. Direkt am Ofen war es unerträglich heiß, doch einige Schritte weiter konnte man erfrieren» [Cur2:34]. Tochter Éve erzählt von eigens markierten Stellen auf Arbeitstischen und Fußboden, auf die der Regen durchs beschädigte Glasdach fiel. Dort durften keine Apparate hingestellt werden. Wegen der «schädlichen Gase», die im Schuppen nicht abziehen können, muss ein großer Teil der Arbeit ohnehin auf dem kleinen Innenhof erledigt werden. Der berühmte Chemiker Wilhelm Ostwald hält bei einem Besuch des Labors das Ganze für einen schlechten Scherz – «eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller» [Rei:78f.].
Madame Curie steht also vor ihrem gusseisernen Bottich und rührt stoisch mit einem Eisenstab, der fast so groß ist wie sie selbst, die dampfende Flüssigkeit um. In einer langwierigen Folge immer gleicher Schritte zerkleinert sie das Material, löst es in warmer Salzsäure und Schwefelwasserstoff auf, versucht vergeblich, den giftigen Dämpfen auszuweichen, filtert, reinigt und kristallisiert die strahlende Brühe. Es ist auch ein Kampf gegen den stets vom Hof hereinwehenden Kohle- und Eisenstaub, der die sorgfältig geschützten Kristallisationsgefäße auf den Tischen dennoch hin und wieder verunreinigt und damit die Arbeit vieler Stunden oder gar Tage ruiniert. Marie und Pierre Curie wissen inzwischen, dass auch hundert Kilogramm Pechblende viel zu wenig Ausgangsmaterial sind, um eine ausreichende Menge Radium für die Bestimmung seines Atomgewichts zu destillieren. Sie müssen in industriellen Maßstäben denken. Mindestens eine Tonne sollte schon in den Kristallisationsprozess eingehen. Sie finden einen Industriepartner, die Societé Centrale des Produits Chimiques, die ihnen die Schwerarbeit der Abscheidung abnehmen will. Als Gegenleistung wünscht sich die Pariser Chemiefabrik offenbar nur ein kleines Quantum Radium als Leihgabe, um es auf der Weltausstellung 1900 in Paris zu präsentieren [Bra:46].
Die einst für ihren Silberreichtum berühmte böhmische Bergbaustadt St. Joachimsthal gehört inzwischen zur Doppeladlermonarchie Österreich-Ungarn. Die Uranfabrik bereitet seit nunmehr knapp fünfzig Jahren die Pechblende auf, die vor Klaproths Zeiten als Abfall galt. Hier werden sämtliche Uranverbindungen aus dem zerkleinerten Erz abgeschieden und für die heimischen Glashütten und Porzellanmanufakturen zu Färbemitteln verarbeitet. Die uranfreien Rückstände ihrerseits sind jahrzehntelang als wertlos erachtet und in einen an der Fabrik vorbeifließenden Bach geworfen worden. Neuerdings aber werden diese sogenannten Laugerze in einem Kiefernwald hinter dem Fabrikgelände gehortet – ein Glücksfall für die Curies, denn in ihren Augen ist dieser Abfallhaufen am Waldrand natürlich ein strahlender Schatz, der Polonium und Radium enthält. Außerdem haben die Joachimsthaler das mühselige Geschäft der Uranabscheidung bereits für sie erledigt. 150 Francs für eine Tonne plus Speditionskosten sind ein annehmbarer Preis. Die schweren Säcke, die bald auf dem Hof der Physikschule in Paris abgeladen werden, enthalten ein braunes Pulver, in dem lauter Zapfen und Nadeln von Kiefern stecken.
Marie Curie empfindet die Pionierarbeit der fortschreitenden Reinigung des Radiums in ihrem windschiefen und undichten Labor als eine glückliche Zeit. Hin und wieder kocht sie sogar das Mittagessen in ihrer Strahlenküche, wenn sie einen wichtigen Versuch nicht unterbrechen will. In seinen festen Salzen strahlt Radium fünf Millionen Mal stärker als Uran. Womit die Curies allerdings kaum gerechnet haben: Alle Laborgegenstände, die mit dem hochaktiven Radium in Berührung kommen, werden ebenfalls radioaktiv und hinterlassen durch schwarzes Papier hindurch ihre Schatten auf fotografischen Platten. «Der Staub, die Zimmerluft, die Kleider sind radioaktiv … das Übel [ist] dermaßen akut geworden, dass wir keinen Apparat mehr in gut isolierendem Zustand halten können» [Cur1: 109]. Wenn das Labor derart verstrahlt ist, werden die Messungen verfälscht, sodass sie anderswo durchgeführt werden müssen.
Aber die beiden können diesem Effekt auch etwas Positives abgewinnen. Denn je mehr sich das Radium seiner reinen Form nähert, umso stärker wird sein spontanes Leuchten. Und so gehört es bald schon zu den beliebten «Zerstreuungen» des Paars, wie Marie sich ausdrückt, spätabends noch einmal die Tür zum Labor zu öffnen, um sich an dem phantastischen Anblick zu erfreuen: «Überall sahen wir dabei die schwach leuchtenden Umrisse der Gläser und Beutel, in denen unsere Präparate untergebracht waren. Dies war ein wirklich herrlicher Anblick, der uns stets neu erschien. Die glühenden Röhrchen sahen wie winzige Zauberlichter aus» [Cur2:35].
In Deutschland wird die Arbeit der Curies selbst ein Jahr nach der Entdeckung des Radiums von der Gelehrtenwelt kaum zur Kenntnis genommen. Nur eine Hand voll Außenseiter wie Julius Elster und Hans Geitel bleiben Becquerel und den Curies auf der Spur. Sie beteiligen sich auch an den Spekulationen über die Ursache der Strahlen. So vermutet Marie Curie noch im Sommer 1898, die radioaktiven Substanzen könnten als einzige Elemente des periodischen Systems in der Lage sein, kosmische Strahlen aus dem Weltraum zu absorbieren und in die beobachtete Strahlung zu verwandeln. Zur Überprüfung dieser sogenannten Sekundärstrahlentheorie fahren Elster und Geitel in einem Bergwerk bei Clausthal im Harz mit einem Uranpräparat 850 Meter tief unter die Erde. Dabei gehen sie von der Vorstellung aus, die Erd- und Gesteinsschicht müsse die kosmische Strahlung absorbieren, sodass sie in dieser Tiefe nicht mehr messbar sei. Aber sie stellen fest, dass das Uran in 850 Metern Tiefe genauso stark strahlt wie am Schachteingang. Und so kommen sie zu dem Schluss, dass kosmische Strahlung als Ursache für die Radioaktivität «in höchstem Grade unwahrscheinlich ist» [Fri1:115]. Auch Marie Curie selbst nimmt von dem Experiment der Deutschen Notiz und wertet es als Beweis für die Unrichtigkeit der kosmischen Sekundärstrahlentheorie [Cur1:128].
Anfang 1899 liegt die richtige Lösung in der Luft. Auf einer Versammlung des Braunschweiger Vereins für Naturwissenschaften vom 19. Januar 1899 berichten Elster und Geitel über ihre Forschungen auf dem Gebiet der Radioaktivität und nehmen dabei folgenden erstaunlichen Standpunkt ein: « … man wird vielmehr aus dem Atome des betreffenden Elementes selber die Energiequelle ableiten müssen. Der Gedanke liegt nicht fern, dass das Atom eines radioaktiven Elements [von] einer instabilen Verbindung unter Energieabgabe in einen stabilen Zustand übergeht» [Fri1:115]. Damit deuten sie erstmals nicht nur die atomare Quelle der Strahlen, sondern auch die Möglichkeit eines Atomzerfalls als Erklärung für die Strahlung an – eine These, die schon bald von Ernest Rutherford und Frederick Soddy in Montreal präzise ausgearbeitet wird. Zu dem Forscherkreis im Braunschweiger Land gehört auch der Zahnarzt Otto Walkhoff, der schon zwei Wochen nach der bahnbrechenden Veröffentlichung Röntgens seinen Ober- und Unterkiefer mit den X-Strahlen abgebildet und damit erstmals den therapeutischen Nutzen der neuentdeckten Strahlung für die Zahnheilkunde demonstriert hat. Im Zentrum aber steht zweifellos Professor Friedrich Giesel, der leitende Chemiker der Braunschweiger Chininfabrik Buchler. Er entwickelt ein raffiniertes Trennungsverfahren für Radium, das erheblich schneller zum Erfolg führt als die Reinigungsmethode von Marie Curie. Giesel korrespondiert lebhaft mit dem Forscherehepaar in Paris. Man schickt sich gegenseitig hochradioaktive Präparate mit der Post und tauscht Forschungsberichte aus. Für seine Firma spezialisiert er sich auf die kommerzielle Herstellung von Radiumpräparaten, um die allmählich steigende Nachfrage in den Labors zu befriedigen.
Schon im Jahr 1896, als alle Welt sich auf die X-Strahlen stürzt und die Becquerel’sche Entdeckung ignoriert, hat Giesel die Eigenstrahlung eines Uranerzes benutzt, um das Bild eines Frosches auf die Fotoplatte zu bannen. Die ähnliche Abbildungsfähigkeit von Röntgen- und Becquerelstrahlen legt die Frage nahe, ob es auch eine vergleichbare physiologische Wirkung beider Strahlenarten geben könnte. Nach mittlerweile vier Jahren Erfahrung mit den Röntgenstrahlen wissen die Radiologen und Apparatebauer um die gesundheitlichen Gefahren einer Überdosierung. Sie arbeiten an Schutzvorkehrungen, um die Strahlenstärke zu verringern. Denn Fälle von hartnäckigen Beschwerden und gar schweren Verbrennungen mit tödlichen Folgen dämpfen die X-Strahlen-Euphorie unter Physikern und Medizinern erheblich. Niemand weiß genau, wie hoch die Strahlendosis sein darf.
Auch der unerschrockene Zahnarzt Otto Walkhoff weiß natürlich über die schädlichen Wirkungen der Röntgenstrahlen Bescheid, als er im Herbst 1900 den ersten dokumentierten Selbstversuch mit Radioaktivität wagt. Dafür stellt ihm Giesel 0,2 Gramm seines Radiumpräparats zur Verfügung. Vielleicht, so hofft Walkhoff, ist auch diese Art der Strahlung therapeutisch nutzbar. Er legt das in einer Zelluloidkapsel eingeschlossene Präparat auf seinen Unterarm und bestrahlt ihn zweimal 20 Minuten lang, worauf sich seine Haut entzündet. Friedrich Giesel, der täglich im Labor Hautkontakt mit Radium hat, ist verblüfft, nimmt aber die Herausforderung Walkhoffs an und wiederholt den Versuch mit leicht erhöhter Dosis. Um ganz sicherzugehen, lässt er die Kapsel auch gleich zwei Stunden auf der Innenfläche des Oberarms liegen. Vierzehn Tage später hat er eine «sehr heftige Hautentzündung mit Pigmentierung an der betreffenden, genau umschriebenen Stelle davongetragen, der ein Blasigwerden und Abstoßen der Oberhaut wie nach einer Verbrennung folgte, worauf Heilung eintrat» [Fri2:126]. Eineinhalb Jahre später ist noch immer eine Narbe sichtbar. Auch die Haare wachsen an dieser Stelle nicht mehr nach. Das Phänomen müsste ihn eigentlich an seine frühen Versuche mit den X-Strahlen erinnern, als er leidenschaftlich um eine bessere Darstellung der Röntgenaufnahmen bemüht gewesen war und seinem neunjährigen Sohn Fritz nach ungezählten Schädeldurchleuchtungen die Haare ausgefallen waren.
In Paris werden die Berichte von Walkhoff und Giesel begeistert aufgenommen und mit sportlichem Ehrgeiz übertrumpft. Wenn Giesel zwei Stunden Bestrahlungszeit vorgelegt hat, will Pierre Curie sich nicht lumpen lassen und schraubt den Rekord auf brenzlige zehn Stunden hoch. Das danach entstehende Wundmal macht sehr viel mehr her als die vergleichsweise harmlose Verbrennung des Deutschen. Die verwundete Hautoberfläche wird exakt vermessen, die Entzündungstage werden gezählt, Verbandszeug kommt zum Einsatz, und die Wunde scheint sich tief ins Fleisch eingebrannt zu haben, da sie «einen ins Graue spielenden Ton annimmt», wie Curie mit Wohlgefallen beobachtet [Kso:69]. Bald schildert auch Henri Becquerel seine Erfahrungen mit vergleichbaren Hautverbrennungen, sobald man die Radiumkapseln zu lange in der Jackentasche mit sich herumträgt. Man präsentiert seine Wunden also mit einem gewissen Forscherstolz, denn noch überwiegt der Optimismus die Bedenken: Der beobachtete Effekt könnte womöglich einmal zu einer Bestrahlungstherapie für Krebs und Hautflechten führen.
Giesel entwickelt sich derweil zum Radium-Derwisch und wirbelt, auf der Suche nach Opfern, durch Haus und Garten. Die Topfpflanzen seiner Frau nehmen nach kurzer Bestrahlung mit Radium eine herbstliche Farbe an und gehen ein. Er zerstört – im Namen der Wissenschaft – die Keimfähigkeit von Blumensamen und schaltet gezielt das Chlorophyll aller grünen Lebewesen aus, die sich ihm und seinen Radiumkapseln in den Weg stellen.
Der sorglose Umgang und tägliche Kontakt mit immer reineren und stärker strahlenden Radiumpräparaten lässt die Pioniere zu lebenden Strahlenquellen werden. Was sie berühren, wird selbst radioaktiv. Die Notizbücher von Marie und Pierre Curie sind auch im 21. Jahrhundert noch so stark kontaminiert, dass sie in Bleikisten aufbewahrt werden müssen. Auch Briefe und Dokumente aus dem Nachlass von Giesel dürfen nur unter Beachtung der Strahlenschutzbestimmungen eingesehen werden. Für einen ganz speziellen Versuch seiner Freunde Elster und Geitel stellt sich im Sommer 1904 der deutsche Radiummeister selbst als Versuchsperson zur Verfügung. Die Experimentatoren gehen von folgender Überlegung aus: Da Radium permanent das radioaktive Edelgas Radon verströmt, müsse Giesel nach nunmehr sechs Jahren Arbeit mit seinen Präparaten mittlerweile so viel Radon in seinen Körper aufgenommen haben, dass seine Atemluft messbar elektrisch leitfähig sein müsse. Sie lassen ihn kräftig Luft unter die Glocke eines Apparates blasen, der auch tatsächlich die Existenz einer weit über dem Durchschnitt liegenden elektrischen Ladung anzeigt. Ein heikles Detail ihrer Untersuchung verbannen Elster und Geitel schamhaft ins Kleingedruckte einer Fußnote: «Auch der Urin der Versuchsperson (ca. 220 ccm) gab beim Durchperlen von Luft an diese eine Emanationsmenge ab, die ihre Leitfähigkeit auf das 7-Fache der normalen erhöhte» [Fri2:127].
Friedrich Giesels Hände sind jetzt ständig entzündet. Es bilden sich Schuppen auf der Haut, und die Fingerspitzen verhärten sich. Die maßlosen Selbstversuche geschehen aus wissenschaftlicher Neugier und in dem Bewusstsein, als Pionier etwas wagen zu müssen. Auch Marie und Pierre Curie glauben zunächst nicht an eine ernsthaft schädigende Wirkung der aufgenommenen Strahlung. Marie geht im Frühjahr 1903 die Arbeit im Strahlenschuppen nicht gemächlicher an, nur weil sie wieder schwanger ist. Selbst nach einer Fehlgeburt ahnt sie nicht, dass der Tod ihrer Tochter höchstwahrscheinlich mit der Radiumstrahlung zu tun hat. Denn die zerstört mit Leichtigkeit ausgerechnet Zellen im Teilungsprozess – der zelluläre Normalzustand im Embryo.
Kapitel 2Atomkern
Die spektakulären Umstände der Radiumgewinnung, die Berichte vom magischen Leuchten des neuen Elements und nicht zuletzt die Verleihung des Physiknobelpreises an Henri Becquerel und das Ehepaar Curie 1903 verbreiten den Ruhm der Pariser Forscher auf dem Gebiet der Radioaktivität über die Grenzen der wissenschaftlichen Fachzeitschriften hinaus. In der Physikergemeinde aber führt vor allem eine ganz spezielle, unerklärliche Eigenschaft des Radiums zu aufgeregten Diskussionen. Ein Stück Kohle verbrennt in kürzester Zeit seine gesamte Wärmeenergie. Zurück bleibt eine Prise ausgeglühter Asche. Auch Schießpulver oder Dynamit entladen ihre Energie in einer heftigen Explosion und hinterlassen nicht weiter verwertbare Reste. Beim Radium ist alles anders. Mit seiner Strahlung ist nämlich eine offenbar fortwährende Wärmeentwicklung verbunden. Sie übertrifft die Energie, die mit der chemischen Reaktionswärme bei molekularen Umwandlungen einhergeht, um das Zwanzigtausendfache. Seit knapp drei Jahren versorgt Friedrich Giesel als einziger Radiumhersteller weltweit von Braunschweig aus Forscher mit Radiumbromidproben in Mengen, die sich für Untersuchungen im Labor eignen. Zur Freude der Wissenschaftler nutzt er sein Weltmonopol nicht aus. Großzügig verleiht und verschenkt er auch Präparate. Seither berichten Franzosen, Deutsche, Engländer und Amerikaner übereinstimmend, dass die Strahlung des hochradioaktiven Elements nicht abnimmt. Es gibt seine Energie ununterbrochen und mit stets gleicher Rate ab: Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und ein Ende ist nicht absehbar. Pierre und Marie Curie halten die Strahlung zwar für eine atomare Eigenschaft, aber sie können die rätselhafte in der Materie schlummernde Energie nicht erklären.
Parallel zur Arbeit der Curies ist im kanadischen Montreal der aus Neuseeland stammende Physiker Ernest Rutherford bereits mit einer gründlichen Bestandsaufnahme des noch jungen Forschungsgebiets beschäftigt. Gemeinsam mit seinem englischen Assistenten Frederick Soddy hat er eine Theorie entwickelt, die alle bekannten Strahlungsphänomene befriedigend erklärt. Es finde nämlich, so behaupten sie, eine allmähliche Umwandlung der Atome radioaktiver Substanzen statt. Begleitet von energiereicher Strahlung, zerfielen Uran, Radium und Thorium über mehrere Zwischenstufen in Atome anderer Elemente. Die bei diesem Umwandlungsprozess freigesetzte Energie ströme unmittelbar aus den Atomen heraus. Unerschöpflich allerdings sei diese Energiequelle nicht. Denn gleichzeitig mit der Energieabstrahlung verlieren die Atome eben auch einen Teil ihrer materiellen Substanz. Es findet also ein Zerfall der Atome statt, der nach einer bestimmten, wenn auch manchmal sehr langen Zeit wieder aufhört. Danach ist die Umwandlung beendet, die Atome des Endprodukts sind wieder stabil und geben keine Strahlung mehr ab. Die Energiequelle ist dann versiegt. Und darum verstoßen radioaktive Vorgänge auch nicht gegen den geheiligten Energieerhaltungssatz. Keine Energie geht verloren, keine zusätzliche Energie wird erzeugt. Die Energieabstrahlung steht also in direkter Beziehung zum Masseschwund im Atom.
Rutherford und Soddy werten ihre Daten statistisch aus und erkennen, dass der Zerfall aller bekannten radioaktiven Substanzen und ihrer Zwischenprodukte einer mathematischen Gesetzmäßigkeit unterliegt. Jedes Element benötigt eine genau festgelegte Zeit, um die Hälfte seiner Atome in Atome anderer Elemente umzuwandeln. Diesen Zeitraum nennen sie Halbwertszeit. Mit dieser Größe lassen sich auch chemisch kaum auffindbare Wandlungsprodukte zumindest mathematisch erfassen. Zunächst sind es nur Näherungsrechnungen. Schließlich pendelt sich die Halbwertszeit des Radiums auf 1620 Jahre ein. Jetzt dämmert es den beiden Strahlenpionieren auch, warum bisher keiner der Beobachter weltweit eine Veränderung der Zerfallsrate von Radium und seiner Energieabgabe wahrgenommen hat. Von den 30 Milligramm Radium in Soddys Besitz werden in 1620 Jahren noch 15 Milligramm übrig sein, in 3240 Jahren 7,5 und in 4860 Jahren 3,75 Milligramm.
Unvorstellbar langsam, stellen Rutherford und Soddy erstaunt fest, zerfallen hingegen die Uranatome. Die Halbwertszeit erstreckt sich über viereinhalb Milliarden Jahre. Damit stoßen die Wissenschaftler in Dimensionen vor, die selbst phantasievolle Geologen bisher noch nie mit dem Alter irdischer Materie in Verbindung gebracht haben. Keinem Wissenschaftler zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind solche großen Zahlen geheuer. Manche Umwandlungsprodukte des Urans verlieren hingegen bereits nach wenigen Mikrosekunden, Stunden oder Tagen die Hälfte ihrer Substanz und Strahlung. Das direkt aus dem Radiumzerfall entstehende Gas Radon hat zum Beispiel eine Halbwertszeit von knapp vier Tagen. Auch wenn die Thesen von Rutherford und Soddy im Einklang mit den Labordaten stehen, so bringen sie in diesem dritten Jahr des 20. Jahrhunderts mit der Zerfallstheorie und der Umwandlung von Elementen einen Stützpfeiler der Chemie ins Wanken, nämlich die Lehre von der Unzerstörbarkeit der chemischen Elemente. Lebloser Materie eine Wandlungsfähigkeit zuzuschreiben, klingt verdächtig nach dem alchemistischen Traum von der Transmutation der Stoffe. Nach diesem unerhörten Angriff auf ein chemisches Dogma müssen Rutherford und Soddy darauf gefasst sein, als Ketzer beschimpft zu werden.
Noch einmal untersucht Frederick Soddy die Eigenschaften des Radiums, die Marie Curie bereits beschrieben hat. In seinen öffentlichen Vorträgen über das Phänomen Radioaktivität zeigt er sich vor allem fasziniert von der völligen Unabhängigkeit des Zerfallsprozesses gegenüber äußeren Einwirkungen. Ob er seine Radiumprobe nun mit Hilfe hochmodernen Laborequipments extremer Kälte aussetzt oder auf 2500 Grad Celsius erhitzt, ob er sein Präparat in einer Stahlbombe unter einem Druck von 1000 Atmosphären zur «Explosion» bringt oder es mit aggressiven Säuren behandelt: Die Strahlung des Radiums bleibt stets konstant. Selbst die stärksten elektrischen Entladungen, Magnetfelder und Zentrifugalkräfte können die Zerfallsrate des Radiums nicht verändern und schon gar nicht stoppen. Soddy wird hier zum machtlosen Beobachter, dessen Versuche, in den atomaren Wandlungsprozess einzugreifen, lächerlich wirkungslos bleiben.
Deshalb fühlt er sich an ein kosmisches Phänomen erinnert, das ihn ebenfalls in die Rolle des staunenden Zuschauers versetzt. Denn entzieht sich das seit Urzeiten unaufhörlich brennende Feuer der Sonne nicht ebenfalls ganz und gar menschlicher Kontrolle? Und so erscheint ihm das verschwindend winzige Radiumkörnchen in seiner Kapsel – dieses wertvolle Destillat aus einem mit Pechschwärze assoziierten Erzgebirgsstein – wie eine Miniatursonne in seiner Hand, deren Licht und Wärme er wahrnehmen, aber nicht beeinflussen kann. Angeregt von diesem Gedankenspiel, macht er eine einfache Rechnung auf und kommt zu einem verblüffenden Ergebnis. Sein von Friedrich Giesel präpariertes Radium strahlt, relativ zu seiner Masse, mehr Energie ab als unser Zentralgestirn und jeder andere Stern im bekannten Universum. Bestünde die Masse unserer Sonne aus reinem Radium, würde sie eine Million Mal mehr Licht und Wärme verbreiten [Sod:36f.].
Bei genaueren Untersuchungen radioaktiver Substanzen macht Ernest Rutherford eine bedeutende Entdeckung. Er identifiziert zwei Strahlungsarten, die Materie mit unterschiedlichem Erfolg durchdringen. Er nennt sie Alpha- und Betastrahlen. Die 20000 Kilometer pro Sekunde schnelle Reise der Alphastrahlen ist schon nach wenigen Zentimetern beendet. Sie werden von der Luft absorbiert. Schon ein Blatt Papier genügt, um die Alphastrahlung einer radioaktiven Quelle vollständig abzuschirmen. Betastrahlen sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, bleiben aber in einem fünf Millimeter starken Aluminiumblech stecken. Dieses Hindernis ist kein Problem für die von dem Franzosen Paul Villard entdeckten Gammastrahlen. Für sie ist aber nach fünf Millimetern durch Blei Schluss.