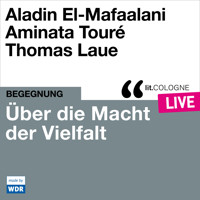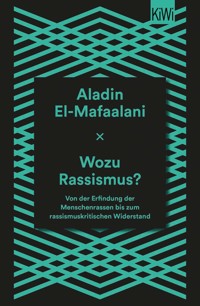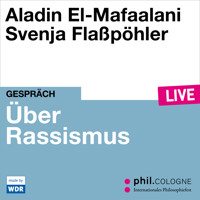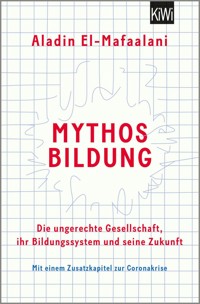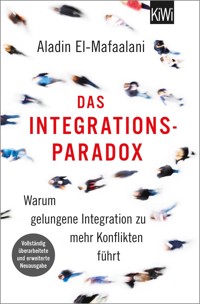19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die alternde Gesellschaft ist weder kindergerecht noch ist sie gerecht zu Kindern. Für Kinder und Jugendliche ist der Krisenzustand zum Normalzustand geworden. Die junge Generation wird politisch übersehen und gesellschaftlich vernachlässigt. Kinder müssen ins Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Denkens gerückt werden. Das Buch vereint eine umfassende Problemanalyse mit vielen Lösungsansätzen. Die Herausforderung ist so groß, dass alle einen Beitrag leisten können. Deutschland steht an einem Wendepunkt: Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter und die damit einhergehenden demografischen Veränderungen stellen das Land vor ungeahnte Herausforderungen. Doch die junge Generation, die demnächst Verantwortung übernehmen soll, ist eine Minderheit, deren Lebensrealität geprägt ist von Bildungsungleichheit, Dauerkrisen und dem stetigen Gefühl, politisch und gesellschaftlich übersehen zu werden. Dieses Buch fordert ein Umdenken: Kinder müssen aus ihrer Außenseiterposition ins Zentrum gerückt werden, nicht nur als moralische Verpflichtung, sondern als essenzielle Notwendigkeit für eine lebenswerte Zukunft. Mit umfassenden Analysen zeigt es auf, welche enormen Veränderungen heute Kindheiten prägen und wie wir den Jüngsten gerecht werden können. Davon hängt auch die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aladin El-Mafaalani / Sebastian Kurtenbach / Klaus Peter Strohmeier
Kinder – Minderheit ohne Schutz
Aufwachsen in der alternden Gesellschaft
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Aladin El-Mafaalani / Sebastian Kurtenbach / Klaus Peter Strohmeier
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Aladin El-Mafaalani / Sebastian Kurtenbach / Klaus Peter Strohmeier
Aladin El-Mafaalani, geboren 1978 im Ruhrgebiet, ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der Technischen Universität Dortmund. Seine bisherigen Bücher bei Kiepenheuer & Witsch wurden zu Bestsellern: »Das Integrationsparadox« 2018, »Mythos Bildung« 2020 und »Wozu Rassismus« 2021.
Sebastian Kurtenbach, geboren 1987 in Köln, ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpolitik an der Fachhochschule Münster.
Klaus Peter Strohmeier, geboren 1948 im Ruhrgebiet, ist Professor emeritus für Soziologie mit Schwerpunkt Stadt, Region und Familie an der Ruhr-Universität Bochum.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Deutschland steht an einem Wendepunkt: Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter, und die damit einhergehenden demografischen Veränderungen stellen das Land vor ungeahnte Herausforderungen.
Doch die junge Generation, die demnächst Verantwortung übernehmen soll, ist eine Minderheit, deren Lebensrealität geprägt ist von Bildungsungleichheit, Dauerkrisen und dem stetigen Gefühl, politisch und gesellschaftlich übersehen zu werden.
Dieses Buch fordert ein Umdenken: Kinder müssen aus ihrer Außenseiterposition ins Zentrum gerückt werden, nicht nur als moralische Verpflichtung, sondern als essenzielle Notwendigkeit für eine lebenswerte Zukunft. Mit eingehenden Analysen zeigt es auf, welche enormen Veränderungen heute Kindheiten prägen und wie wir als Gesellschaft handeln müssen, um den Jüngsten gerecht zu werden und ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie dringend benötigen, damit die Gesellschaft zukunftsfähig bleibt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
ISBN978-3-462-31313-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Schieflagen in der alternden Gesellschaft
Demografische Schieflage
Demokratische Schieflage
Sozialstaatliche Schieflage
Prekäre Kindheiten
Falsche und richtige Schlussfolgerungen
Kapitel 2 Kinder sind Außenseiter der modernen Gesellschaft
Strukturen der modernen Gesellschaft
Plätze für Kinder in der modernen Gesellschaft
Humanvermögen und Humankapital
Kinder als diverse Minderheit
Familien unter Stress
Zunehmende interne Differenzierung des Bildungssystems
Entdifferenzierung als Lösung?
Kitas und Schulen unter Stress
Muss die Schule heute die Familie ersetzen?
Kapitel 3 Superdiverse Kindheiten
Ausgangslage in Deutschland
Entwicklung der Zuwanderung in Deutschland und weltweit
Exkurs: Kritische Würdigung des Begriffs »Migrationshintergrund«
Superdiversität als Befund und Perspektive
Superdiversität ist Alltag
Welche weiteren Treiber für Heterogenität gibt es?
Generation superdivers
Kapitel 4 Fragmentierte Kindheiten
Fragmentierung statt Polarisierung
Fragmentierte Kindheiten in der Stadt und auf dem Land
Fragmentierte Kindheiten in einer alternden Gesellschaft
Auf die Adresse kommt es an!
Ein präsenter Sozialstaat für eine gute Kindheit?
Fragmentierte Kindheiten als komplexe Normalität
Kapitel 5 Was brauchen Kinder?
Kinder und ihr Wohlbefinden
Ressourcen des Wohlbefindens – welchen Kindern geht es gut?
Schulen als superdiverse Lernorte – Durchschnitt ist nirgends
Der Einfluss der Schule auf das Wohlbefinden der Kinder
Unsere Schulen sind unterschiedlich gut für Kinder
Zusammen essen – Bindungen in der Familie brauchen Rituale
Was muss anders werden?
Kapitel 6 Kitas und Schulen als multifunktionale Institutionen
Neue Herausforderungen für Erziehungs- und Bildungsinstitutionen
Investitionen in Bildung
Die zentralen Anknüpfungspunkte eines Kulturwandels
»Kinder dort abholen, wo sie stehen«
In allen Handlungsbereichen systematisch vorgehen
Kapitel 7 Sozialraum und Nachbarschaft
Gemeinschaft und Gesellschaft
Nachbarschaft als Gemeinschaft
Organisationen als Gesellschaft
Kinder brauchen Gemeinschaft und Gesellschaft
Kinder in einer fragmentierten Gesellschaft sehen und wirksam fördern
Kapitel 8 »Die Boomer« – Potenzial und Chance für Kinder
Das lange dritte Lebensalter
Wozu Großeltern?
Das wandelbare Bild der Großeltern in der Gesellschaft
Herausforderungen im dritten und vierten Lebensalter
Anreize für mehr Engagement
Kapitel 9 Plädoyer für einen Minderheitenschutz für Kinder
Die »2007er« – Aufwachsen in Krisenzeiten
Kinder gerade in schweren Zeiten ins Zentrum rücken
Gesellschaftlicher Minderheitenschutz
Politischer und rechtlicher Minderheitenschutz
Potenziale und Chancen sehen und nutzen
Literaturverzeichnis
7 Vorwort
Die alternde Gesellschaft ist weder kindergerecht noch ist sie gerecht zu Kindern. Die Lage der jungen Generation ist in vielfacher Weise prekär. Im Hinblick auf Bildung und Gesundheit lässt sich ein ausgeprägter Negativtrend erkennen. Das Armutsrisiko ist in Kindheit und Jugend besonders hoch. Migration, Digitalisierung und die Pluralisierung der Familie haben Kindheit grundlegend verändert. Kinder sind biografisch immer früher und täglich immer länger in Bildungsinstitutionen. Zugleich ist das Bildungssystem in keinem guten Zustand. Kinder sind wenige, und doch wird ihnen die Gesellschaft immer weniger gerecht. Kinder sind eine Minderheit ohne wirksamen Minderheitenschutz.
Für Kinder und Jugendliche ist heute der Krisenzustand zum Normalzustand geworden. Ihr Alltag ist geprägt von gestressten Eltern, überforderten Lehrkräften, orientierungslosen Erwachsenen und nicht zuverlässig funktionierenden Institutionen. All das ist für sie genauso normal wie polarisierte Diskurse und Populismus. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, in der vieles nicht funktioniert. Gleichzeitig hören sie, dass Deutschland sich durch Verlässlichkeit, Ordnung und Pünktlichkeit auszeichnen soll – nur erleben sie das kaum. Im Gegenteil, vieles deutet darauf hin, dass es aufgrund von Klimawandel, gesellschaftlichen 8 Krisen und internationalen Konflikten in Zukunft noch schlimmer kommen könnte. Kinder und Jugendliche erleben keine gesellschaftliche Stabilität und erst recht keine allgemeine optimistische Grundstimmung.
Diese Erfahrungen und die Stimmungslage der jungen Menschen werden aber kaum wahrgenommen und diskutiert. Die junge Generation wird politisch übersehen und gesellschaftlich vernachlässigt. Dabei geht es nicht darum, dass die Gesellschaft bewusst kinderfeindlich wäre, ganz im Gegenteil. Für die allermeisten Menschen sind Kinder wichtig und schützenswert. Aber in der alternden Gesellschaft werden sie nicht mitgedacht, und mit der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung ist davon auszugehen, dass sich die gesellschaftlichen Schieflagen weiter zu Ungunsten der Jüngsten entwickeln.
Dass Kinder und Jugendliche nicht ausreichend in ihren Bedürfnissen und Interessen berücksichtigt werden, ist keine unausweichliche Folge der demografischen Entwicklung. Ja, man kann etwas dagegen tun.
Kinder müssen in einer alternden Gesellschaft ins Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Denkens gerückt werden. Das ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Dies in die Tat umzusetzen, ist aber nicht einfach, denn Kinder sind keine Wählergruppe, und selbst wenn sie es wären, hätten sie wesentlich weniger Gewicht als die Älteren. Auch ihre Eltern können sie nicht vor den gesellschaftlichen Entwicklungen und der strukturellen Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft schützen, die sie zu Außenseitern macht. Denn die alternde Gesellschaft erzeugt genau genommen zwei Minderheiten: Kinder werden eine 9 Minderheit in der Bevölkerung und Eltern von Minderjährigen werden eine Minderheit unter den Wahlberechtigten. Damit stehen Familien insgesamt unter Druck.
Dass Deutschland altert, ist nichts Neues. Vorausberechnungen, Prognosen und Studien dazu gab es in den letzten Jahrzehnten zuhauf. Doch jetzt wird es ernst. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre gehen bald in Rente, überall fehlen Arbeitskräfte, während die Sozialausgaben steigen. Auf diese veränderte Situation muss reagiert werden. Doch für Pessimismus ist keine Zeit und für Optimismus gibt es zumindest auf den ersten Blick wenig Anlass. Es gilt, angemessen und zukunftsorientiert mit der Situation umzugehen, und das heißt vor allem, dass wir als Gesellschaft wirklich alle Kinder optimal fördern. Ein Kulturwandel steht an, denn ein alterndes Land muss ein kinderorientiertes Land sein, um Wohlstand und Lebensqualität für alle zu erhalten. Darum geht es in diesem Buch.
Aus verschiedenen Perspektiven legen wir Analysen vor, die die Lage der jungen Generation in der alternden Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Diese Verschiebung des Fokus auf die Minderheit ermöglicht eine Schärfung des Problembewusstseins. Ein ausgeprägtes gesellschaftliches Problembewusstsein ist auch deshalb wichtig, weil die vielen Lösungsansätze, die wir vorstellen, durchweg davon abhängen, dass die prekäre Lage von Kindern und Jugendlichen allgemein erkannt wird und dass alle gesellschaftlichen Akteure ihren Beitrag dazu leisten, Kinder als Minderheit zu schützen und besonders zu fördern, denn sie sind es, die diese Gesellschaft in Zukunft am Leben halten müssen.
10 In neun Kapiteln haben wir die wichtigsten Erkenntnisse, Herausforderungen und Ansätze zusammengetragen. Zu Beginn werden die aus der demografischen Entwicklung folgenden Schieflagen für Demokratie, Sozialstaat und Kindheit dargestellt (Kapitel 1). Anschließend wird der strukturelle Außenseiterstatus von Kindern rekonstruiert (Kapitel 2), um daran anknüpfend durch die Beschreibung von superdiversen Kindheiten (Kapitel 3) und fragmentierten Kindheiten (Kapitel 4) aufzuzeigen, dass Kinder von gesellschaftlichen Veränderungen besonders stark betroffen sind und dass sie eine außergewöhnlich heterogene Minderheit darstellen. Vor diesem Hintergrund wird dann gezeigt, dass Kinder trotz all dieser Heterogenität sehr ähnliche Bedürfnisse und Interessen haben (Kapitel 5). Die Notwendigkeit von Bildungsinvestitionen und eines Kulturwandels in Kitas und Schulen wird anschließend begründet und skizziert (Kapitel 6). Daneben ist das gesamte alltägliche Umfeld von Kindern, insbesondere Sozialraum und Nachbarschaft, von zentraler Bedeutung, um ein kindergerechtes Aufwachsen zu ermöglichen (Kapitel 7). Anschließend behandeln wir die Chancen, die in der demografischen Alterung liegen, wenn sich Senioren aktiv für eine kindgerechte Gesellschaft engagieren (Kapitel 8). Am Schluss folgt ein Plädoyer für einen Minderheitenschutz von Kindern (Kapitel 9).
Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach, Klaus Peter Strohmeier
Oktober 2024
11 Aladin El-Mafaalani Sebastian Kurtenbach Klaus Peter Strohmeier
Kapitel 1Schieflagen in der alternden Gesellschaft
Kinder sind eine Minderheit in Deutschland. Seit vielen Jahren gehen jährlich mehr Menschen in Rente, als eingeschult werden. Diese Tendenz wird sich weiter verschärfen. Im Jahr 2024 feierten mehr als doppelt so viele Menschen ihren 60. Geburtstag, wie Kinder geboren wurden. Etwa 5 Jahre später werden die einen ins Rentenalter übergehen, bei den anderen beginnt die Schulpflicht.[1] Dieses Verhältnis von 2:1 ist in seinem Ausmaß neu und hat Folgen. Wir wollen in diesem Buch der Frage nachgehen, wie (und welche) Kindheiten in einer alternden Gesellschaft möglich sind. Die Mitte der 2020er-Jahre markiert den Beginn einer fragilen demografischen Phase, die Jahrzehnte andauern wird. Es geht uns in diesem Buch darum zu zeigen, was heute im Hinblick auf Kindheit und Generationengerechtigkeit gesamtgesellschaftlich diskutiert werden muss: Kinder sind eine Minderheit ohne wirksamen Minderheitenschutz.
In einer alternden Gesellschaft werden Themenfelder rund um das Altern automatisch in den Mittelpunkt 12 gerückt. Senioren werden immer mehr, und sie werden älter. Das wirkt sich auf die gesamte Gesellschaft aus: Man kann sagen, dass die Alterung schon jetzt das zentrale Charakteristikum der deutschen Gesellschaft ist – und noch viel stärker sein wird. Der Begriff »Überalterung« enthält eine negative Bewertung, die wir nicht teilen. Wenn man den Begriff jedoch als Beschreibung der Tatsache versteht, dass gesellschaftliche Strukturen und Demografie nicht zusammenpassen, kann er sinnvoll sein. Was also richtig ist: Es gibt auf vielen Ebenen Schieflagen, weil keine angemessenen Strukturanpassungen mit der demografischen Entwicklung einhergegangen sind. Mittlerweile ist der demografische Wandel aber schon so weit fortgeschritten, dass kaum noch Spielraum für vorausschauende Anpassungen vorhanden ist. Das bedeutet aber nicht, dass alles zu spät ist.
Die Schieflagen lassen sich heute deutlich erkennen, werden ihre ganze Tragweite aber erst in einigen Jahren entfalten. Dabei sind alle wichtigen Säulen unserer Gesellschaft von der demografischen Schieflage betroffen: Demokratie, Wirtschaft, Sozialstaat, Bildungs- und Gesundheitssystem und Generationenverhältnis.
Demografische Schieflage
Bereits seit den 1970er-Jahren wird die Alterung der Gesellschaft prognostiziert. Zunächst waren es nur Analysen, die vor dem Hintergrund des Geburtenrückgangs das vorausberechnet haben, was nun, also ab Mitte der 2020er-Jahre, eintrifft: Die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, kommen ins Rentenalter. Es handelt sich, 13 vereinfacht ausgedrückt, um die Generation, die in den 1960er-Jahren geboren wurde (auch wenn die Geburtenzahl schon in den 1950ern im Vergleich zu heute relativ hoch war). In dem Zeitraum wurden jährlich über 1 Million Kinder geboren, in einigen Jahren sogar über 1,3 Millionen. Mitte der 1960er-Jahre wurden wesentlich mehr Menschen geboren, als gestorben sind: Geburten übertrafen die Sterbefälle jährlich um 400.000 bis 500.000.
Dann folgte ein Einbruch, häufig auch als »Pillenknick« bezeichnet.[2] Allerdings ist die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln (»Pille«) nur ein sehr kleiner Teil der Erklärung. Der Knick in der Geburtenzahl fiel auch deshalb so stark aus, weil es vorher ein Hoch gab. Der Babyboom hing durchaus mit einem gewissen Optimismus, der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der vollständigen Überwindung der schwierigen Nachkriegszeit zusammen. Die Geburtenzunahme fällt aber deshalb so stark aus, weil viele Kinderwünsche und Familiengründungen nachgeholt wurden.[3]
Es ist ein Mythos, dass der Geburtenrückgang mit Kinderlosigkeit erklärbar ist.[4] Tatsächlich ist der Rückgang der Geburten pro Frau von Mitte der 1960er-Jahre (2,5) bis Mitte der 1970er-Jahre (1,5) hauptsächlich auf einen Rückgang kinderreicher Familien mit 3 oder mehr Kindern zurückzuführen. Im Vergleich dazu hatte die leichte Zunahme an kinderlosen Männern und Frauen einen geringen Einfluss auf die Geburtenzahl. Die »Pille« hat den Geburtenrückgang wahrscheinlich etwas beschleunigt, aber ein Rückgang der Geburten pro Frau ist seit über 120 Jahren festzustellen.[5]
14 Diese Entwicklung führt nun dazu, dass es seit dem Jahr 1972 in Deutschland (Ost und West zusammengefasst) jedes Jahr mehr Sterbefälle gibt als Geburten. Damit handelt es sich um das weltweit erste dauerhafte Geburtendefizit. Ohne stetige Zuwanderung wäre die Bevölkerung jährlich geschrumpft. Aufgrund von Zuwanderung ist sie aber gewachsen – nicht nur direkt, weil Menschen zugewandert sind, sondern auch indirekt, weil Zugewanderte in Deutschland Kinder bekommen – und zwar etwas mehr als Nichtzugewanderte (die dann bereits in der Kinderzahl pro Frau berücksichtigt sind). Migration hat also dazu geführt, dass es keinen Bevölkerungsrückgang gab und dass die Alterung der Bevölkerung etwas abgebremst wurde.
Durch den Babyboom in den 1960ern und das anschließende dauerhafte Geburtendefizit ist die Bedeutung dieser geburtenstarken Jahrgänge enorm: Der Geburtsjahrgang 1964 ist bis heute der zahlenmäßig stärkste Jahrgang. Diese größte Gruppe wurde 2024sechzig Jahre alt (Altersmodus = häufigster Wert). Der Altersmedian lag im Jahr 2023 bei genau 45,1 Jahren,[6] d.h., die Hälfte der Bevölkerung ist älter, die andere Hälfte jünger als 45. Lediglich Japan liegt mit 49 Jahren deutlich darüber, unter 40 ist das Durchschnittsalter etwa in Großbritannien und den USA.[7] Für die Weltbevölkerung liegt das Durchschnittsalter bei 30 Jahren.
Der Altersmedian gibt mehrere weitere Hinweise auf die Altersstruktur: Zum einen sind Kinder nicht nur eine Minderheit, sondern auch immer weiter entfernt von Altersmodus (größter Jahrgang) und Altersmedian (mittleres Alter). Zum anderen wird ersichtlich, dass die Anzahl 15 von potenziellen Eltern, also insbesondere Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, gering ist.D.h., dass bei einer stabilen Kinderzahl pro Frau die gesamte Anzahl an Kindern rückläufig sein wird.
Wie stark die demografische Schieflage durch Migration abgefedert wurde, zeigen die folgenden Daten: Im Jahr 2023 weisen in Deutschland 30 % der Gesamtbevölkerung einen Migrationshintergrund auf.[8] Bei den Menschen im Rentenalter (über 65-Jährige) sind es allerdings lediglich 14 %, in der Generation der Babyboomer sind es etwa 19 %, bei den unter 20-Jährigen sind es bereits 39 % und bei den unter 5-Jährigen 43 %.[9] Im öffentlichen Diskurs, der weitgehend durch und für die ältere Hälfte der Bevölkerung geführt wird, erscheint Migration immer noch als etwas Fremdes oder Außergewöhnliches, während sie im Kindes- und Jugendalter weder fremd noch außergewöhnlich ist.
Wenn im Laufe der nächsten 10 Jahre die größten Jahrgänge ins Rentenalter übergehen, hat dies auf mehreren Ebenen Effekte auf die Wirtschaft: Einerseits weisen sie eine besonders hohe Kaufkraft auf, sodass der Binnenmarkt stärker von Rentner:innen geprägt sein wird als jemals zuvor, andererseits steuern wir auf einen enormen Arbeits- und Fachkräftemangel zu, da in relativ kurzer Zeit etwa 13 Millionen Erwerbstätige in den Ruhestand gehen (und mit ihnen Erfahrungen und Kompetenzen) und diese Lücke rein zahlenmäßig nicht durch Jüngere gefüllt werden kann.[10]
16 Demokratische Schieflage
Die demografische Schieflage hat starke Auswirkungen auf die Demokratie. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten war bereits bei der Bundestagswahl 2021 über 53 Jahre alt – Tendenz steigend. Nur 14 % der Wahlberechtigten sind unter 30 Jahre alt. Selbst eine Absenkung des Wahlalters auf 16 würde an dem Medianalter der Wahlberechtigten lediglich eine Nachkommastelle ändern. Das ist der Status quo. Wenn in einigen Jahren die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter übergehen, verschieben sich die demokratischen Kräfteverhältnisse, denn dann bilden Rentner:innen die größte Wählergruppe, und Wahlen können von denjenigen maßgeblich entschieden werden, die weder im Erwerbsalter sind noch die Entscheidungen umsetzen. Daher sind verschiedene Zukunftsszenarien denkbar, etwa: die Vergreisung der Demokratie, bei der sich die Älteren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückziehen, oder die Gerontokratie, bei der die Alten die Gesellschaft dominieren, oder eine Seniorendemokratie, in der sich die gesellschaftliche Rolle von Senioren grundlegend wandelt und sich die Alten aktiv und umfassend für den Zusammenhalt engagieren.[11] Auf diese Möglichkeit, in der Senior:innen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind, werden wir noch näher eingehen.
Bereits heute sind Ältere in allen politischen Institutionen überrepräsentiert: Als Parteimitglieder, innerhalb der Gewerkschaften sowie in den Parlamenten. Ältere werden nicht nur ein immer größerer Teil der Bevölkerung, sondern sie sind auch in den relevanten 17 politischen Instanzen deutlich stärker vertreten und verfügen entsprechend über eine wachsende Organisations- und Staatsmacht.[12]
Kinder und Jugendliche sind eine demografische Minderheit. Wählen durften sie nie. Natürlich kann man anmerken, dass ihre Eltern sie politisch repräsentieren. Nur ist es so, dass Eltern von Minderjährigen selbst eine demokratische Minderheit darstellen. Unter den Wahlberechtigten haben sie zum einen kein besonders großes Gewicht. Würden alle Eltern von Minderjährigen (Mütter und Väter zusammengerechnet) einen deutschlandweiten Verband gründen, hätten sie viele Millionen Mitglieder weniger als der ADAC. Während der ADAC nach wie vor wächst, nimmt die Zahl der Eltern von Minderjährigen langsam ab. Das liegt an der Alterung der Bevölkerung sowie an der stabilen Kinderlosenquote (ca. 20%). Zum anderen sind Eltern kein einheitlicher politischer Akteur, zu unterschiedlich sind ihre Lebensverhältnisse und Interessen aufgrund der Pluralisierung der Familienformen, der sozioökonomischen Verhältnisse sowie migrationsbedingter und regionaler Unterschiede. Sie könnten sich daher gar nicht schlagkräftig organisieren. Die wahrscheinlich stärkste Gemeinsamkeit von Eltern Minderjähriger ist, dass sie über ein eingeschränktes Zeitbudget verfügen, was die politische Schlagkraft weiter verringert.
Und: Viele Eltern sind gar nicht wahlberechtigt. Von allen Menschen mit Migrationshintergrund sind lediglich 36 % wahlberechtigt (Bundestagswahl 2021). Das liegt neben der fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft vieler 18 Erwachsener (darunter viele Eltern) insbesondere auch an dem hohen Anteil Minderjähriger innerhalb der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund. Der Vergleichswert: Menschen ohne Migrationshintergrund sind zu 86 % wahlberechtigt. Migration hat als demografische Größe komplexe Auswirkungen auf die demokratische Schieflage: Kinder und ihre Eltern sind Minderheiten, sind selbst eine heterogene Gruppe, aber insgesamt drastisch unterrepräsentiert.
Man könnte darauf hoffen, dass die Rentner:innen ihre Kinder und Enkel bei politischen Entscheidungen mitdenken – also nicht die Eigeninteressen in den Vordergrund rücken, sondern gesamtgesellschaftliche Herausforderungen im Blick haben. Das wäre überaus wünschenswert, erfordert jedoch ein ausgeprägtes Problembewusstsein, insbesondere über die eigene politische Macht und die prekären Verhältnisse von Kindern. Darauf allein sollte man sich nicht verlassen, denn wie in diesem Buch gezeigt werden wird, gelingt das Mitdenken von Interessen der nachwachsenden Generationen bereits heute nicht gut. Und es gibt historische Beispiele dafür, dass auch trotz engster persönlicher Beziehungen das Mitdenken der anderen nicht adäquat gelingt. Man denke nur an das Geschlechterverhältnis: Obwohl jeder Mann eine Mutter hat(te), meist auch eine Partnerin, Schwester oder Tochter, kann die politische Berücksichtigung von Frauen(-Rechten) durch Männer in einer historischen Perspektive nicht gerade als gelungen gelten. Frauen mussten schon selbst dafür kämpfen. Kinder können das aber nicht.
19 Die demografische Entwicklung der nächsten 10 Jahre zwingt zu grundsätzlichen politischen Fragen hinsichtlich der Generationengerechtigkeit: Wie werden zukünftig Verteilungs- und Zielkonflikte aufgelöst? Wohin werden knappe Ressourcen gehen, und wo wird eingespart? Aber auch noch grundsätzlicher: Wie risikobereit, zukunftsorientiert, nachhaltig, dynamisch und generationengerecht kann die Demokratie dann noch sein?
Dass die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nicht adäquat berücksichtigt werden, erkennt man schon jetzt. Warum wurden Kinder und Jugendliche während der Pandemie, obwohl sie vom Virus am wenigsten gefährdet waren, durch die Gegenmaßnahmen am stärksten und unnötig und nachhaltig belastet?[13] Auch jenseits dieses Beispiels in einer akuten Krise: Dass Kinder übersehen werden, ist heute schon ein strukturelles Problem.
Sozialstaatliche Schieflage
Das Zusammenfallen von demografischer und demokratischer Schieflage hat eine fiskalische Schieflage zur Folge, weil der Staat immer mehr Geld für die Versorgung Älterer aufbringen muss. Dabei tritt ein starkes Spannungsfeld auf, denn der Sozialstaat ist so teuer wie nie und die Ausgaben werden in den nächsten Jahrzehnten noch steigen, und zwar deutlich. Aber es wird dann weniger erwerbstätige Menschen geben als heute, die den Wohlstand und den Sozialstaat finanzieren müssen. Und trotz all der hohen Kosten werden Altersarmut und Pflegenotstand auch für die 20 zukünftige Seniorengeneration ein Problem darstellen. In dieser Gemengelage muss gewährleistet werden, dass die Jüngsten nicht unter die Räder kommen. Die sozialstaatlichen Herausforderungen werden bis weit in die 2040er-Jahre hinein virulent bleiben.
Wie groß die Schieflage heute schon ist, zeigt der Bundeshaushalt. Im Jahr 2024 umfasst der gesamte Bundeshaushalt rund 477 Milliarden Euro. Jeder vierte Euro, also 127 Milliarden Euro, geht in den Zuschuss der Rentenversicherung, der Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung, weil die Rentenversicherungsbeiträge nicht reichen, um die Rentenauszahlungen zu decken. Die Kosten für die Pensionen von Beamten im Ruhestand sind hier noch gar nicht berücksichtigt. Auch die Kosten für die gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen sind bereits heute nicht durch die Beitragszahlungen abgedeckt und müssen steuerlich bezuschusst werden.
Um es noch mal deutlicher zu formulieren: Dieser Wert im Bundeshaushalt ist wesentlich höher als das Sondervermögen für die Bundeswehr (100 Milliarden), aber ein Sondervermögen ist einmalig, die Lücke in der Rentenversicherung entsteht jährlich, wächst stetig und muss in jedem Bundeshaushalt über Steuern befüllt werden. Das ist die Situation heute, also bevor die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, im Alter dann gesundheitlich versorgt und noch später spezifisch gepflegt werden müssen.
Zur Diskussion stünden also Erhöhungen der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, Anpassung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung (also Verlängerung der Erwerbstätigkeit) oder Kürzung der Rentenhöhe. Aber: Rentner:innen werden bald die größte Wählergruppe sein. 21 Zu ihren Lasten wird man keinen Wahlkampf gewinnen können.[14]
Irgendwoher muss das Geld also kommen, wenn alles in etwa so bleiben soll, wie es ist. Und hier gibt es zwei Logiken, die sich auch nicht widersprechen. Es kann Geld innerhalb des Sozialstaats umgeschichtet werden, oder es wird Geld aus einem anderen Bereich abgezogen und dann in den Sozialstaat investiert. Beides verdient eine nähere Betrachtung, um wirklich zu verstehen, wie tiefgreifend das Problem ist. Wenn man Geld innerhalb des Sozialstaats verschieben will, blickt man auf das sogenannte Sozialbudget. Das meint alle Ausgaben, die der Staat für soziale Belange ausgibt, wodurch nicht mehr zwischen steuer- oder beitragsfinanzierten Leistungen unterschieden wird. Im Jahr 2023 lagen die Ausgaben bei 1,249 Billionen (1.249.000.000.000) Euro. Ein Drittel des Sozialbudgets bezahlen Arbeitnehmer, ein Drittel Arbeitgeber, jeweils durch Beiträge, und ein Drittel wird durch Steuern zusätzlich bereitgestellt. Die Rente macht etwa ein Drittel der Kosten aus, die Pflege- und Gesundheitskosten zusammen auch etwa ein Drittel. Der Rest verteilt sich auf Mittel für die Jugendhilfe, Arbeitslosenhilfe, Elterngeld u.v.a.m. Hier könnte man nicht in relevanten Größenordnungen umschichten – und es wäre auch nicht sinnvoll.
Doch wie sieht es mit der Umschichtung aus anderen Bereichen aus? Man könnte dort Geld einsparen und es in den Sozialstaat geben, wie z.B. Ausgaben für den Klimaschutz, die Infrastruktur, Bildung oder Verteidigung. In diesen Bereichen liegen eher Investitionsbedarfe als 22 Sparpotenziale vor, und eine weitere Verschuldung ist wegen der Schuldenbremse im Grundgesetz bis auf Weiteres kaum machbar.[15] Zudem muss berücksichtigt werden, dass im Jahr 2024 für den Bund Zinszahlungen in Höhe von etwa 37 Milliarden Euro anfielen, weit mehr, als beispielsweise für Bildung und Forschung durch den Bund ausgegeben wird.[16]
Um die sozialpolitischen Herausforderungen der demografischen Veränderungen der nächsten Jahre abschließend deutlich zu machen: Während in den 1960er-Jahren auf einen Rentner sechs Beitragszahler kamen, kommen im Jahr 2022 auf einen Rentner nur noch zwei Beitragszahler. Und: In den 1960er-Jahren bezog eine Person nach Renteneintritt durchschnittlich knapp 10 Jahre lang Rente. Die durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs ist durch die wesentlich höhere Lebenserwartung heute mit 20 Jahren doppelt so hoch. In Zukunft werden weniger als 2 Beitragszahler auf einen Rentner kommen, wahrscheinlich sogar weniger als 1,5. Selbst wenn die durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs nicht mehr stark steigen wird, handelt es sich um ein ernst zu nehmendes strukturelles Problem.
Prekäre Kindheiten
Altersarmut ist ganz sicher ein großes Thema, aber das höchste Armutsrisiko haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (d.h. die unter 25-Jährigen).[17] Die Schieflage im Alt-Jung-Verhältnis lässt sich auch anhand der Ausgaben des Staates darstellen. Für die 23 Alterssicherung wird doppelt so viel Geld aufgewendet wie für das Bildungssystem. Auch im internationalen Vergleich lässt sich zeigen: Je höher die Ausgaben für die Alten, desto geringer die Ausgaben für die frühkindliche Bildung.[18]
Entsprechend darf es nicht überraschen, dass Hunderttausende Kita-Plätze fehlen.[19] In der Schule fehlen nicht nur Ganztagsplätze, sondern Tausende Schulplätze. Damit kann seit Jahren die Schulpflicht nicht vollständig eingehalten werden.[20] Seit Anfang der 2010er-Jahre zeigen alle relevanten Bildungsstudien (IQB, IGLU, PISA) eine negative und zum Teil desolate Entwicklung der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen.[21] Dies gilt für jedes Bundesland und alle Jahrgangsstufen, man könnte auch sagen: Das Schulsystem befindet sich in großen Teilen im »freien Fall«. Mittlerweile wurden die desolaten Ergebnisse der ersten PISA-Studie aus dem Jahr 2001 deutlich unterboten. Entsprechend diesem negativen Trend seit den 2010er-Jahren steigt in den 2020er-Jahren die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss. In Zukunft drohen also zusätzlich zu den hohen Rentenausgaben steigende Kosten aufgrund von (Jugend-)Arbeitslosigkeit.
Dass es bei diesen katastrophalen Befunden keinen Aufschrei gibt, lässt sich nur damit erklären, dass Kinder eine Minderheit in einer stark alternden Gesellschaft sind. Die Gesellschaft wird den wenigen Kindern und Jugendlichen immer weniger gerecht.
Man muss sich vor Augen führen, dass nach der ersten PISA-Studie der Bildungsnotstand ausgerufen wurde – und anschließend tatsächlich eine Phase folgte, in der 24 Verbesserungen messbar waren. Das war im Jahr 2001. Damals waren die Babyboomer die Eltern der Schulkinder. Der geburtenstärkste Jahrgang 1964 war bei Erscheinen der ersten PISA-Studie 37 Jahre alt.
Nun ist es so, dass sich Kindheiten substanziell verändert haben. Heute besuchen Kinder biografisch früher Bildungsinstitutionen und bleiben in diesen täglich wesentlich länger.[22] Diese Expansion der Institutionen der Kindheit wurde politisch verstärkt. Im Jahr 1996 trat der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für über 3-Jährige in Kraft, 2013 folgte der Rechtsanspruch auch für unter 3-Jährige; ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule wirksam. Leider ist zu konstatieren: Selbst diese Reformen wurden auch indirekt für die Senioren vollzogen, nämlich um die (wünschenswerte) Müttererwerbstätigkeit zu steigern, damit die Rentenfinanzierung nicht zusammenbricht.[23] Für Kinder hatten diese – theoretisch guten – Maßnahmen aber bisher keinen messbaren positiven Effekt.
Neben dieser institutionellen Veränderung von Kindheit lassen sich zahlreiche weitere Veränderungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten erkennen. Kinder und Jugendliche sind strukturell von den gesellschaftlichen Veränderungen besonders stark betroffen: Pluralisierung der Familienformen, soziale Ungleichheit und Armutsgefährdung, migrationsbedingte Diversität und Digitalisierung. Kinder sind eine quantitative Minderheit, die zugleich das höchste Maß an Heterogenität aufweist. Dabei werden Räume für Kinder immer knapper – weil Kinder wenige sind, aber auch, weil für sie immer umfassendere Sonderumwelten (Kita und Ganztagsschulen) geschaffen wurden. 25 Umso wichtiger, dass diese Institutionen in einem optimalen Zustand sind.
Zugleich sind die Politik- und Verwaltungsverflechtungen in den Themenfeldern, die für Kinder und Jugendliche relevant sind, besonders hoch: politische und rechtliche Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche sind vertikal auf Bund, Länder und Kommunen sowie horizontal auf verschiedene Ressorts verteilt.[24] Nach frühkindlicher Bildung und Schule sind die relevantesten Bereiche: Familien, Gesundheit, Stadtentwicklung und Wohnen, Kultur, Freizeit und Sport.
Eine systematische Zusammenarbeit über Ressort- und Ebenengrenzen hinweg und eine damit verbundene bundesweite Strategie sind durch die Spreizung der Verantwortlichkeiten zwingend notwendig und enorm anspruchsvoll. Zumindest ein stark ausgeprägtes Problembewusstsein in Politik und Gesellschaft ist unerlässlich, doch genau an diesem grundlegenden Problembewusstsein fehlt es derzeit.
Neben der demografischen Schieflage gibt es aber auch einen anderen Grund dafür, dass es keine ausgeprägten Kontroversen über das Generationenverhältnis gibt: nämlich die guten persönlichen Beziehungen der Kinder zur Eltern- und Großelterngeneration. Diese scheinen besser denn je.[25] Das widersprüchliche Verhältnis zwischen guten unmittelbaren intergenerationalen Beziehungen auf der einen Seite und enormen Schieflagen in den gesellschaftlichen Generationenverhältnissen auf der anderen Seite mag einen offenen Generationenkonflikt unwahrscheinlich werden lassen. Auch die Widersprüchlichkeit zwischen 26 relativ guten individuellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Jüngeren einerseits und großen gesellschaftlichen und weltpolitischen Krisen, Klimawandel und fehlenden positiven Zukunftsperspektiven andererseits kennzeichnen das Aufwachsen heute.
Die Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind entsprechend zunehmend geprägt durch Ängste und Sorgen, Pessimismus und (diffuse) Unzufriedenheit.[26] Dies drückt sich allerdings in sehr unterschiedlicher Weise aus: Politisierung, Protest, soziale Bewegungen, aber auch Resignation, politische Abstinenz, Radikalisierung. Diese Erfahrungen und Gefühle von jungen Menschen werden in der deutschen Gesellschaft kaum wahrgenommen.
Falsche und richtige Schlussfolgerungen
»Wenn wir (zu) wenige Kinder haben, dann müssen wir mehr Kinder kriegen.« Diese Forderung hört man immer noch aus konservativen und insbesondere populistischen Kreisen. Eine Erhöhung der Geburtenrate pro Frau ist kaum möglich – alle familienpolitischen Maßnahmen hatten bisher keine Wirkung auf die Geburtenrate – und sie wäre zudem problematisch: Für die akute demografische Lage hätte sie keine positiven Effekte, aber durchaus negative: Denn wenn mehr Mütter (und Väter) aufgrund von Erziehungszeiten in der Erwerbsarbeit ausfielen, wäre das in Zeiten des Fachkräftemangels kritisch. Zudem würde das zu einem erhöhten Bedarf an Kita- und Schulplätzen führen. Bereits heute, bei relativ wenigen Kindern, können 27 weder der Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung noch die Schulpflicht flächendeckend erfüllt werden. Die Vorstellung, mehr Kinder seien die Lösung dafür, dass man den wenigen Kindern heute nicht gerecht wird, zeugt von einem falschen Problembewusstsein. Es geht darum, die wenigen Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern.
Es gibt in Deutschland also relativ wenige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, gleichzeitig ist das Armutsrisiko in dieser Altersgruppe höher als bei allen anderen. Wenige Kinder, hohes Niveau an Kinderarmut – und es lässt sich bereits jetzt absehen, dass Altersarmut ein wachsendes sozialpolitisches Problem werden wird. Entsprechend wird von den heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen offenbar erwartet, dass sie in den nächsten Jahrzehnten als Erwerbstätige die steigenden Staatsausgaben durch Steuern und Beiträge erwirtschaften, sich aber zugleich um Kinder und Alte kümmern, um die Lücken im Bildungs- und Pflegesystem auszugleichen. Diese rein innenpolitische Problemlage lässt sich neben migrations- und integrationspolitischen Maßnahmen – die hier nicht im Fokus stehen – hauptsächlich durch die umfassende Fokussierung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbau, Verzahnung und Verbesserung der Institutionen der Kindheit und Jugend bearbeiten. Dies hätte positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und damit auf die Tatkraft und die Kompetenzen nachfolgender Generationen, auf die Müttererwerbstätigkeit und damit auf Fachkräftemangel und Staatsfinanzierung sowie auf die 28 Geschlechtergerechtigkeit: denn am Ende ist zu befürchten, dass die nicht nachhaltig organisierte Care-Arbeit für die Kinder und die pflegebedürftigen Senioren wieder an den Frauen hängen bleibt.
29 Klaus Peter Strohmeier
Kapitel 2Kinder sind Außenseiter der modernen Gesellschaft
Die »Sesamstraße«, ein Import aus den USA, startete im »Deutschen Fernsehen« (West) am 1. Januar 1973. Sie war Teil eines allgemeinen Frühförderprogramms für kleine Kinder, das Präsident Lyndon B. Johnson in den Sechzigern in seinem »Krieg gegen die Armut« gestartet hatte, um die Bildungsreserven der Nation zu mobilisieren.[27] Auch in der Bundesrepublik interessierten sich Politik und Öffentlichkeit seit den 1970er-Jahren verstärkt für Kinder, und auch hier ging es um die Ausschöpfung von Bildungsreserven. Erstmals gab es überall ernsthafte Bestrebungen mit dem Ziel, Vorschulkinder besser und möglichst früh zu fördern. Der »Zweite Familienbericht« der Bundesregierung, erschienen 1975, plädierte für eine »Sozialisationspolitik«,[28] mit der die im vorangegangenen Babyboom geborenen vielen Kinder besser gefördert werden sollten.[29] In einem Modellversuch in NRW wurden die Vor- und Nachteile früher Förderung kleiner Kinder im Kindergarten (mit eher spielerischen Curricula) im Vergleich zur (stärker an der Schule orientierten) Vorschule untersucht.[30]
Den Anstoß für das neue Interesse an Kindern hatten Erkenntnisse der Wissenschaft gegeben, nach denen die 30 Familie in Westdeutschland, vor allem die Unterschichtsfamilie, der »Garant sozialer Ungleichheit« war, gemeint ist die soziale Vererbung von schlechter Bildung bzw. »Bildungsarmut« von Generation zu Generation. Studien hatten gezeigt, dass Kinder aus den benachteiligten Milieus der »Unterschicht« erhebliche Entwicklungsrückstände im Vergleich zu Mittelschichtkindern aufwiesen.[31] »Mädchen, Arbeiterkind, katholisch, vom Lande«, das war die damals in Westdeutschland gültige Kumulation von Merkmalen sozialer Benachteiligung. Anfang der 1970er-Jahre entstand eine eigenständige »Sozialpolitik für das Kind … in Differenz zur Familienpolitik«.[32] In diese Zeit fiel auch die »Bildungsexpansion«, in der das Schulwesen in der Bundesrepublik reformiert und reorganisiert wurde.[33] Von ihr haben im Ergebnis vor allem die Mädchen profitiert. Die alte Volksschule wurde abgeschafft. Die Grundschule wurde (und blieb seitdem) die erste und einzige verpflichtende Schulform für alle Kinder. Der Sekundarschulbereich (Haupt-, Realschule und Gymnasium) wurde massiv ausgebaut und weiter differenziert. Gymnasien führten das Kurssystem in der Oberstufe ein. Erste Gesamtschulen erweiterten das traditionell dreigliedrige Schulsystem um eine vierte Säule. Alle Bildungsreserven sollten mobilisiert werden, um Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig – und im »Wettkampf der Systeme« im Kalten Krieg zwischen Ost und West konkurrenzfähig zu machen.[34]
In diesen Zeiten eines politischen Aufbruchs für Kinder, vor allem für ihre Bildung, erschien in der Zeitschrift »Merkur« ein Aufsatz des Soziologen Franz-Xaver Kaufmann mit dem provokanten Titel »Kinder als Außenseiter 31 der Gesellschaft«.[35] Die These war überraschend, und sie ist es auch heute noch. Sie erklärt nämlich, ganz kontraintuitiv, alle