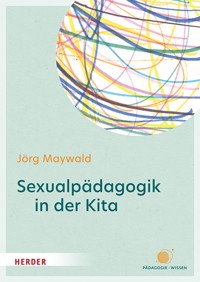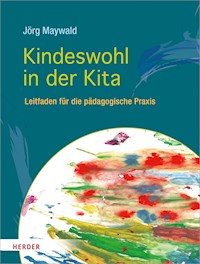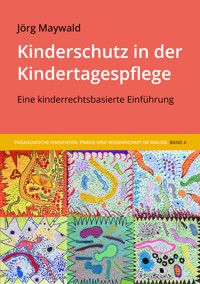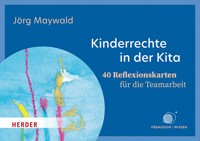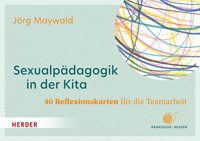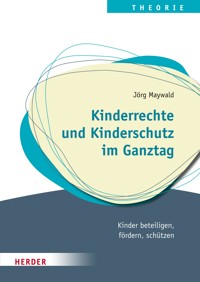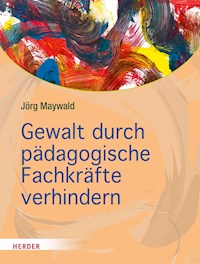Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Rund 35 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention plädiert Jörg Maywald in diesem Buch dafür, die Kita vom Kopf auf die Füße zu stellen: Das Kind mit seinen Rechten und Bedürfnissen – und nicht die Vorstellungen und Wünsche der Erwachsenen – muss Ausgangspunkt aller Überlegungen sein. Die Kita vom Kind her denken bedeutet, sämtliche Abläufe und Angebote auf ihre Kindergerechtigkeit hin zu überprüfen. Dazu bedarf es einer konsequenten Parteinahme für Kinder im Sinne des Vorrangs des Kindeswohls.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Reflexionskarten für die Teamarbeit
Jörg Maywald
Kinderrechte in der Kita
40 Reflexionskarten für die Teamarbeit
ISBN 978-3-451-39775-2
Die Reflexionskarten helfen, das Thema Kinderrechte im Team zu diskutieren, zu reflektieren und umsetzbar zu machen: Was aber heißt das konkret, in der Kita konsequent vom Kind her zu denken? Welche Rechte haben Kinder? Und was bedeutet der Vorrang des Kindeswohls? Auf welche Weise gelingt es, die Eltern für die Rechte ihrer Kinder zu gewinnen? Anhand zahlreichen Anregungen, zeigt Jörg Maywald, wie die Umsetzung des Kinderrechtsansatzes gelingt.
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
Überarbeitete Neuausgabe 2025
(3. Gesamtauflage)
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Lektorat: Caroline Baumer, Freiburg
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Max Weidner
Papierstruktur im Innenteil: © Charunee Yodbun – shutterstock
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-03518-0
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83539-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83508-7
Inhalt
Einführung
1. Die Kita vom Kind her denken
1.1 Das Kind als Rechtssubjekt
1.2 Kinderrechte sind Menschenrechte für Kinder
1.3 Das Gebäude der Kinderrechte: Schutz, Förderung, Beteiligung
1.4 Kindeswohl und Kinderrechte
1.5 Kindeswille und Kindeswohl
1.6 Kinderrechte und Elternrechte
1.7 Der Kinderrechtsansatz in der Kita
2. Kinderrechte und das Bild vom Kind
2.1 Das Bild vom Kind – ein allmählicher Wandel
2.2 Geschichte der Kinderrechte weltweit
2.3 Geschichte der Kinderrechte in Deutschland
3. Kinderrechte im Alltag der Kita
3.1 Kindgerechte Abläufe im Kita-Alltag
3.2 Die erste Begegnung
3.3 Eingewöhnung
3.4 Begrüßung und Ankommen am Morgen
3.5 Das freie Spiel
3.6 Angebote und Projekte
3.7 Gestaltung der Mahlzeiten
3.8 Körperpflege und kindliche Sexualität
3.9 Rückzugsmöglichkeiten und Ruhepausen
3.10 Verabschiedung am Nachmittag
3.11 Übergang in die Schule
4. Mit Beschwerden und Konflikten kindgerecht umgehen
4.1 Beschwerden und Konflikte für Verbesserungen nutzen
4.2 Konflikte mit Kindern
4.3 Konflikte mit Eltern
4.4 Interkulturelle Missverständnisse und Konflikte
5. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zum Wohl des Kindes
5.1 Die Rolle von Eltern und pädagogischen Fachkräften
5.2 Frühe Hilfen und Kinderschutz
6. Gute Qualität in der Kita: Das Kind steht im Mittelpunkt
6.1 Der Vorrang pädagogischer Qualität
6.2 Kinderrechtsbasierte Eckpunkte guter Qualität
7. Zukunft der Kinderrechte
7.1 Ausweitung der Kinderrechte
7.2 Kinderrechte im Grundgesetz verankern
7.3 Ein Mensch – eine Stimme: Wahlrecht für Kinder einführen
Anhang
Selbsttest
Checkliste zur Umsetzung der Kinderrechte in der Kita
UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut
Literatur
Internet-Adressen
Einführung
Würden Kinder sich für den Besuch einer Kita entscheiden, wenn die Wahl ganz allein bei ihnen läge? Vermutlich ja, aber nicht um jeden Preis. Wenn wir einmal versuchen, uns in ein ein-, zwei- oder dreijähriges Kind hineinzuversetzen, so gäbe es gute Gründe für den Kita-Besuch. An erster Stelle wohl die anderen Kinder, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben. Bereits sehr früh erkennt sich das Kind im Gegenüber. Es spürt, dass die anderen Kinder seine Interessen teilen und ebenso neugierig sind wie es selbst. Auch wenn manche anfangs zögerlich sind, so gehen doch alle Kinder – unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft – früher oder später auf ihresgleichen zu und wollen mit ihnen spielen.
Auch die Spielgegenstände, die räumliche Gestaltung, der geordnete und dadurch Sicherheit vermittelnde Tagesablauf sowie die ansteckende Begeisterung der pädagogischen Fachkräfte sind attraktiv für Kinder. Schnell erkennen sie, dass sie willkommen sind und eingeladen, die Welt um sie herum zu erkunden, und dabei von feinfühligen und engagierten Erwachsenen begleitet und unterstützt werden.
Nicht zuletzt fühlen sich die Kinder davon angezogen, Schritt für Schritt die Begrenztheit ihrer Familie zu verlassen. Dies gilt umso mehr, weil sie die Erfahrung machen, am Ende des Kita-Tages in den familiären Raum zurückzukehren, wo sie Vertrautem begegnen und neue Kraft für den nächsten Tag schöpfen. Kinder sind wissbegierig und nutzen jede Gelegenheit, Neues auszuprobieren. Gerade weil sich die Familien-Welt von der Kita-Welt unterscheidet und an beiden Orten nicht die gleichen Regeln gelten, profitieren Kinder von dem geteilten Betreuungssetting.
Das hier gezeichnete Bild ist ein Ideal. Es beschreibt eine Kita, die vom Kind her denkt. Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt. Ausstattung und Abläufe orientierten sich an den kindlichen Bedürfnissen und an den Rechten aller Kinder. Die pädagogischen Fachkräfte begegnen jedem Kind mit großer Feinfühligkeit. Familie und Kita respektieren sich wechselseitig, stehen in einem engen Austausch und orientieren ihr Handeln an den besten Interessen des Kindes.
Die Realität sieht jedoch häufig anders aus. Die Interessen der Erwachsenen und die Belange des Arbeitslebens stehen allzu oft im Vordergrund. Die Kita soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Eltern in ausreichendem Maße dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Nicht die Bedürfnisse der Kinder im Hier und Jetzt, sondern ihre Verwertbarkeit und ihr zukünftiger, durch optimierte Förderung zu erzielender Nutzen stehen häufig im Mittelpunkt. Die Gefahr einer Instrumentalisierung der Kita für Zwecke, die außerhalb der Interessen der Kinder liegen, ist groß.
Auch die Bedingungen in den Einrichtungen sind in vielerlei Hinsicht oft nicht kindgerecht. Akuter Personalmangel, zu große Gruppen, ein unzureichender Fachkraft-Kind-Schlüssel und zu kleine und unzureichend ausgestattete Räumlichkeiten bestimmen vielerorts den Alltag. Hinzu kommt, dass den pädagogischen Fachkräften deutlich zu wenig Zeit für die sogenannten mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung, Beobachtung und Dokumentation, Zusammenarbeit mit den Eltern etc. zur Verfügung steht. Bundesweit verbindliche Qualitätsstandards, die wenigstens Mindestbedingungen vorschreiben, existieren nicht.
Den allenfalls mäßigen und häufig sogar schlechten strukturellen Voraussetzungen stehen stetig wachsende Anforderungen an Bildung, Erziehung und Betreuung gegenüber. Die Kinder werden beim Eintritt in die Kita immer jünger. Die Zeit, die sie dort täglich verbringen, wird länger. Der Katalog an Bildungszielen weitet sich aus, das Angebot an Projekten und Programmen, um diese Ziele zu erreichen, wird zunehmend unübersichtlich. In der Folge sind die Tages- und Wochenpläne in Kindertageseinrichtungen eng getaktet und entfernen sich nicht selten von den Bedürfnissen der Kinder. Hinzu kommen wachsende Anforderungen durch die große Heterogenität der Kinder aufgrund sozialer Unterschiede, individueller Beeinträchtigungen, Zuwanderung oder Flucht aus Krisenregionen.
Das vorliegende Buch will aufzeigen, wie der Abstand zwischen der Realität und dem Ideal einer kindgerechten Kita Schritt für Schritt verringert werden kann. Dafür ist es notwendig, die Kita vom Kind her zu denken und die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Für sich genommen ist diese Forderung nicht neu. Vordenker:innen wie Friedrich Fröbel, Maria Montessori und viele andere haben einen solchen Ansatz bereits weitaus früher formuliert. Ungewohnt und viel zu wenig verbreitet ist allerdings, das Konzept einer kindgerechten Kita mit den internationalen Kinderrechten zu begründen.
Dabei liegt die Verbindung zwischen einer Pädagogik, die vom Kind her denkt, und dem Bezug auf die Rechte der Kinder so nah. Wer als pädagogische Fachkraft mit Kindern arbeitet, braucht einen inneren Wertekompass. Eine klare Orientierung, wo Recht aufhört und Unrecht beginnt. Einen verbindlichen Maßstab dafür, was kindgerecht ist. Traditionelle Überzeugungen – seien sie kulturell überliefert oder religiös begründet – bieten hier wichtige Anknüpfungspunkte. Aber sie haben einen entscheidenden Mangel: Ihre Akzeptanz und Legitimation sind begrenzt. In einer zunehmend multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft können sie keine fraglose Gültigkeit mehr beanspruchen. Während die Verbindlichkeit überlieferter Werte immer weiter abnimmt, steigt zugleich der Bedarf nach einem für alle gültigen Wertekanon. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die Orientierung an den globalen Kinderrechten, wie sie in der praktisch universell ratifizierten und auch in Deutschland uneingeschränkt geltenden UN-Kinderrechtskonvention niedergelegt sind.
GRUNDLAGEN
Kinderrechtsansatz
Der Kinderrechtsansatz bildet den Rahmen zur Ausrichtung des Handelns an den Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention. Damit ist er ein auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern ausgerichteter Menschenrechtsansatz. Ihn kennzeichnet also, dass nicht allein nach den Bedürfnissen, sondern ebenso nach den Rechten der Kinder auf Schutz, Förderung und Beteiligung gefragt wird. Während Bedürfnisse subjektiv und situationsabhängig sind, handelt es sich bei den Rechten der Kinder um objektive, von einzelnen Situationen unabhängige Rechtsansprüche.
Die Orientierung an den Kinderrechten ist ein unverzichtbarer Baustein guter Qualität pädagogischer Einrichtungen und ein wichtiger Beitrag zu einer wertebasierten Pädagogik. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund globaler Migration. Denn die weltweit geltenden Kinderrechte sind der zentrale Bezugspunkt, wenn es darum geht, die Kita vom Kind her zu denken und die Rechte aller Kinder zu verwirklichen.
1.
Die Kita vom Kind her denken
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ die Würde des Kindes und seine unveräußerlichen Rechte
→ das Recht des Kindes auf Schutz, Förderung und Beteiligung
→ die Rolle des Kindeswohls
→ Rechte und Pflichten der Eltern
→ die vier Prinzipien des Kinderrechtsansatzes
1.1 Das Kind als Rechtssubjekt
Jedes Kind ist einzigartig und unschätzbar wertvoll. Es hat eine eigene Würde und ist als Subjekt von Beginn an Träger:in eigener Rechte. Kinderrechte müssen nicht erworben oder verdient werden, sie sind nicht abhängig von bestimmten Eigenschaften, sondern unmittelbarer Ausdruck der jedem Kind innewohnenden und unveräußerlichen Würde.
GRUNDLAGEN
Kinder sind Rechtssubjekte
Jedes Kind hat eine Würde und ist Träger:in eigener Rechte. Es ist rechtsfähig und somit Rechtssubjekt. Kinder dürfen niemals als Rechtsgegenstände (Rechtsobjekte) behandelt werden.
Was aber ist die Würde des Kindes? Wie ist sie zu definieren? Rechtlich handelt es sich bei dem Begriff der Menschenwürde um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der juristisch nicht definiert ist und daher in jedem Einzelfall näher bestimmt werden muss. Bei den sozialphilosophischen Versuchen, die Menschenwürde zu definieren, treten die Aspekte der Subjektstellung und der bedingungslosen Anerkennung jedes Individuums besonders hervor. Die Würde des Menschen anzuerkennen, heißt demnach zu respektieren, dass jeder Mensch und damit auch jedes Kind um seiner selbst willen als Zweck an sich existiert und niemals zum Objekt oder bloßen Mittel herabgewürdigt werden darf.
Besonders markant hat Immanuel Kant den Gegensatz von Mittel und Zweck formuliert: »Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als [auch] in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest« (Kant 1797/1983, S. 61). Kant führt diesen Gedanken wie folgt weiter: »Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat eine Würde« (ebd., S. 68). Die über jeden Preis erhabene menschliche Würde ist demnach mit dem Menschsein gegeben und insofern angeboren. Hierin liegt auch der Grund für die universelle Geltung der jedem Menschen innewohnenden und daher unveräußerlichen Würde. Ohne Ansehen der Person kommt sie jedem Menschen zu.
Um die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, bedarf es grundlegender Menschenrechte. »Der Grund für die Gewährleistung fundamentaler Rechte liegt in der Würde des Menschen«, formuliert Heiner Bielefeldt, ehemaliger Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, den Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Menschenrechten (Bielefeldt 2007, S. 27). Die fundamentalen Menschenrechte sind daher ebenso wie die menschliche Würde untrennbar mit dem bloßen Faktum des Menschseins verbunden. Im Unterschied zu Einzelrechten zum Beispiel von Arbeitnehmern oder Arbeitgebern sind sie nicht die Folge einer bestimmten Eigenschaft oder eines Verdienstes, sondern sie stehen jedem Menschen allein deshalb zu, weil er ein Mensch ist.
GRUNDLAGEN
Die drei Dimensionen der Menschenrechte
Menschenwürde und Menschenrechte haben eine Freiheits-, eine Gleichheits- und eine Inklusionsdimension. »Von der Trias Freiheit, Gleichheit, Inklusion her erweisen sich die einzelnen Menschenrechte als Bestandteil einer sie verbindenden gemeinsamen Zielsetzung« (Bielefeld 2011, S. 166). Die Freiheitsdimension kommt in dem Respekt vor der Fähigkeit jedes Menschen zum Ausdruck, eigenaktiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen und damit selbst- und mitverantwortlich zu handeln. Die Gleichheitsdimension äußert sich darin, dass Würde und Grundrechte jedem Menschen gleichermaßen zukommen. Als Subjekt übernimmt jeder Mensch Verantwortung, und alle Menschen sind hinsichtlich Menschenwürde und Menschenrechte gleich. Die Dimension der Inklusion schließlich macht deutlich, dass Freiheit nur im Miteinander der Menschen praktisch gelebt werden kann und auf die Solidarität der Menschen untereinander angewiesen ist.
Die Forderung nach gleichen und unveräußerlichen Rechten für alle Menschen wurzelt in den Ideen der Aufklärung. Sie ist ein zentraler Bestandteil der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Rahmen der Französischen Revolution von 1789. Auch wenn gleiche Rechte in der Realität noch lange Zeit auf bestimmte Bevölkerungsteile – zunächst vor allem auf Männer mit heller Hautfarbe, später dann auch auf Frauen – begrenzt blieben, war die Vorstellung allgemeiner und gleicher Rechte nicht mehr wegzudenken und wurde zum Bestandteil sämtlicher Emanzipationsbewegungen, die auf die Ideale der Menschenrechte aufbauen.
Universellen Anspruch auf Umsetzung unter Einbeziehung aller Gruppen der Bevölkerung erlangten die Menschenrechte erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem menschenverachtenden Nationalsozialismus und des damit verbundenen Zweiten Weltkriegs verabschiedeten die Vereinten Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In der Präambel heißt es: »Die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen [bildet] die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.« Die bereits drei Jahre zuvor beschlossene Charta der Vereinten Nationen spricht ihrerseits vom »Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit«.
Wenige Monate nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte trat in Deutschland das Grundgesetz in Kraft. Der Bezug auf die Würde und die unveräußerlichen Rechte jedes Menschen ist auch hier zentral: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, lautet der erste Satz in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Absatz 2 ergänzt: »Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.«
Auch die im Jahr 2009 verabschiedete Charta der Grundrechte der Europäischen Union orientiert sich an Menschenwürde und Menschenrechten. In der Präambel heißt es: Die Union gründet sich »auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität«.
RECHT & GESETZ
Auszug aus der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
Die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen [bildet] die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.
Artikel 1 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Auszug aus der Präambel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Die Union gründet sich auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität.
Die Würde des Kindes zu achten und Kinder als Rechtssubjekte zu respektieren, ist Aufgabe aller Akteur:innen in der Arbeit mit Kindern und für Kinder. Mit der Orientierung an den Kinderrechten ist zugleich die Absage an paternalistische Haltungen verbunden. Kinder sind nicht bloß Objekt des Schutzes und der Fürsorge. Kinderrechtsschutz ist daher weitaus mehr als Kinderschutz. Eine an den Kinderrechten orientierte Pädagogik respektiert das Kind als eigenständige:n Träger:in von Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten. Die Umsetzung der Rechte jedes Kindes ist somit ein zentraler Aspekt guter Qualität. Pädagogik in der Kita muss ihren Erfolg daran messen lassen, inwieweit sie zur Verwirklichung der Kinderrechte beiträgt.
1.2 Kinderrechte sind Menschenrechte für Kinder
Friedrich Fröbel, der Gründer des ersten Kindergartens in Deutschland, wies bereits darauf hin, dass Kinder von Beginn an vollwertige Menschen sind. Er betonte, dass die Qualität des Menschseins nicht erst im Verlauf der kindlichen Entwicklung erworben wird, sondern schon bei Neugeborenen vorhanden ist: Das heißt, dass »das neugeborene Kind nicht nachher erst Mensch wird, sondern der Mensch schon, mit all’ seinen Anlagen und der Einheit seines Wesens, im Kinde erscheint und da ist« (Fröbel 1826/2015, S. 138).
Werden der Status des Menschseins und die damit verbundenen Rechte als Maßstab des Vergleichs genommen, sind Kinder somit den Erwachsenen gleich. Zugleich aber unterscheiden sich Kinder zweifellos von Erwachsenen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Als »Seiende« sind sie einerseits Menschen wie alle anderen auch. Als »Werdende« sind sie andererseits Menschen in einer besonderen Entwicklungsphase.
Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern ist daher asymmetrisch: Erwachsene tragen Verantwortung für Kinder, nicht jedoch umgekehrt Kinder in gleicher Weise für Erwachsene. Aufgrund dieser Entwicklungstatsache brauchen Kinder besonderen Schutz, besondere Förderung und besondere, kindgerechte Beteiligungsformen. Für eine gesunde Entwicklung sind sie auf Erwachsene angewiesen, die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Kinder zu ihrem Recht kommen.
In pädagogischen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Kitas, findet die Begegnung zwischen Erwachsenen und Kindern jeweils in zweifacher Weise statt. Einerseits – gemessen am Subjektstatus jedes Menschen – als Begegnung zwischen Gleichen. Dies kommt in der Forderung zum Ausdruck, dass pädagogische Beziehungen auf Augenhöhe erfolgen sollen. Wie alle Menschen sind Kinder als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten zu achten. Sie sind (Rechts-)Subjekte und Expert:innen in eigener Sache, ausgestattet mit einer jeweils individuellen Sichtweise, die es zu respektieren gilt. Kinder bringen ihre besonderen Bedürfnisse in die Beziehung ein und gestalten diese aktiv mit.
Andererseits ist die Beziehung zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern eine Begegnung zwischen Ungleichen. Die Fachkräfte stehen in der Verantwortung, Kinder zu ihrem Recht kommen zu lassen. Diese Verantwortung besteht nicht in gleicher Weise aufseiten des Kindes. Mit dieser Asymmetrie verbunden ist eine strukturelle Machtungleichheit. Erwachsene haben die Pflicht, ihre Macht nicht für eigene Zwecke, sondern ausschließlich an den besten Interessen des Kindes (Kindeswohl) orientiert zu gebrauchen.
Im pädagogischen Alltag ist die Parallelität von Gleichheit und Ungleichheit nicht immer leicht zu balancieren. Eine Reduktion auf das eine oder andere Element wird den Anforderungen an pädagogische Beziehungen nicht gerecht. Wird die Gleichheit überbewertet, so leugnet dies die zwischen Erwachsenen und Kindern notwendigerweise bestehenden Unterschiede. Kinder werden in diesem Fall wie kleine Erwachsene behandelt, und die pädagogische Beziehung pervertiert zur Kumpanei mit allen damit verbundenen Gefahren von Grenzverletzungen zulasten des Kindes.
Verschiebt sich umgekehrt die Balance einseitig in Richtung Ungleichheit, geschieht dies auf Kosten der Gleichwertigkeit von Kindern und Erwachsenen. Kinder werden in diesem Fall auf einen Status des »Noch-nicht« festgelegt. Die sich entwickelnden Fähigkeiten und die wachsende Bereitschaft von Kindern zu Verantwortungsübernahme bleiben unbeachtet. Erwachsene Verantwortung für Kinder verkehrt sich zur Verfügungsmacht über das Kind. Die pädagogische Beziehung erstarrt zu adultistischem Machtmissbrauch.
GRUNDLAGEN
Gleich und verschieden: das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen
Gleichheit
Kinder sind wie Erwachsene Menschen.
Verschiedenheit
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben entwicklungsbedingt spezifische Bedürfnisse.
Bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Kindern und Erwachsenen geht es also sowohl um Gleichberechtigung als auch um Anerkennung der Verschiedenheit. In der Balance von Gleichheit auf der einen und Verschiedenheit auf der anderen Seite liegt die besondere Herausforderung im Umgang der Erwachsenen mit den Kindern. Dieses ambivalente Verhältnis normativ angemessen zum Ausdruck zu bringen, ist die Aufgabe des internationalen wie auch des nationalen Rechts.
Mit der Anerkennung besonderer Bedürfnisse von Kindern, die von denen der Erwachsenen unterschieden werden können, ist die Erkenntnis verbunden, dass Kinder einen eigenen, auf ihre spezielle Situation zugeschnittenen Menschenrechtsschutz benötigen. Rund 40 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben die Vereinten Nationen daher 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, die in spezifischer Weise die jedem Kind zustehenden Menschenrechte normiert. Die Kinderrechtskonvention ist Bestandteil einer Reihe internationaler Konventionen, in denen die Menschenrechte für besonders schutzbedürftige Gruppen der Bevölkerung formuliert wurden. Hierzu gehören unter anderem die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (UN-Frauenrechtskonvention) und das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention).
Die in der UN-Kinderrechtskonvention niedergelegten Rechte sind nicht etwa »andere«, jenseits der allgemeinen Menschenrechte angesiedelte Rechte, denn »der Geist der Kinderrechte kommt aus dem Zentrum menschenrechtlichen Denkens« (Kerber-Ganse 2009, S. 71). Vielmehr spezifiziert und erweitert die Kinderrechtskonvention die allgemeinen Menschenrechte in Bezug auf die besonderen Belange von Kindern. Kinderrechte sind insofern Menschenrechte für Kinder. Die Konvention enthält daher sowohl die für alle Menschen geltenden Rechte (equal rights) als auch eine Reihe spezifischer, auf die besondere Situation von Kindern zugeschnittener Rechte (special rights) (vgl. Hanson 2008, S. 8).
1.3 Das Gebäude der Kinderrechte: Schutz, Förderung, Beteiligung
Ausgangspunkt des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) ist die Stellung des Kindes als Träger eigener Rechte. Gemäß Artikel 1 gilt als Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, also Kinder und Jugendliche. Den Rechten der Kinder stehen Verpflichtungen der Erwachsenen gegenüber. In erster Linie der Staat, aber auch die Institutionen für Kinder und nicht zuletzt die Eltern tragen Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist im Kontext des internationalen Menschenrechtssystems insofern einmalig, als sie die bisher größte Bandbreite fundamentaler Menschenrechte – ökonomische, soziale, kulturelle, zivile und politische – in einem einzigen Vertragswerk zusammenbindet. Die in den 42 Artikeln – ergänzt durch 12 Artikel mit Verfahrensregelungen – dargelegten völkerrechtlich verbindlichen Mindeststandards haben zum Ziel, weltweit die Würde, das Überleben und die Entwicklung von Kindern und damit von knapp 30 Prozent der Weltbevölkerung sicherzustellen. Die UN-Kinderrechtskonvention ist im Wortlaut im Anhang ab Seite 146 abgedruckt.
Die in dem »Gebäude der Kinderrechte« wichtigsten Rechte des Kindes, die der »UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes« als miteinander zusammenhängende Allgemeine Prinzipien (General Principles) definiert hat, finden sich in den Artikeln 2, 3, 6 und 12:
1.Artikel 2 enthält ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Kein Kind darf aufgrund irgendeines Merkmals, wie zum Beispiel der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, einer Behinderung, der Geburt oder seines sonstigen Status bzw. seiner Eltern benachteiligt werden.
2. In Artikel 3 Absatz 1 ist der Vorrang des Kindeswohls festgeschrieben. Demzufolge ist bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen – gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden.
3.Artikel 6 sichert das grundlegende Recht jedes Kindes auf Leben und bestmögliche Entwicklung. Die Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention erkennen das angeborene Recht jedes Kindes auf Leben an und verpflichten sich, das Überleben und die Entwicklung des Kindes in größtmöglichem Umfang zu gewährleisten.
4. In Artikel 12 ist das Recht jedes Kindes auf Beteiligung niedergelegt. Demzufolge hat jedes Kind das Recht, in allen Angelegenheiten, die es betreffen, unmittelbar oder durch eine:n Vertreter:in gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt werden.
RECHT & GESETZ
Allgemeine Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 2
Recht auf Nichtdiskriminierung
Artikel 3
Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls
Artikel 6
Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung
Artikel 12
Recht auf Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung des Kindes in allen es betreffenden Angelegenheiten
Die UN-Kinderrechtskonvention enthält eine große Zahl weiterer Rechte von Kindern, die sich auf unterschiedliche Lebenssituationen und Lebensbereiche beziehen und nach Schutzrechten, Förderrechten und Beteiligungsrechten (im Englischen als die drei »Ps« bezeichnet: Protection, Provision, Participation) unterschieden werden können.
Schutzrechte
Zu den Schutzrechten gehören:
• Recht auf Nicht-Diskriminierung (Artikel 2)
• Recht auf Schutz der Identität (Artikel 8)
• Recht auf Schutz vor unberechtigter Trennung von den Eltern (Artikel 9)
• Recht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre (Artikel 16)
• Recht auf Schutz vor Kindeswohl gefährdenden Einflüssen durch Medien (Artikel 17)
• Recht auf Schutz vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässigung einschließlich des sexuellen Missbrauchs (Artikel 19)
• Recht auf Schutz für Kinder, die von der Familie getrennt leben (Artikel 20)
• Recht von Flüchtlingskindern auf Schutz und Hilfe (Artikel 22)
• Recht von Minderheiten auf Schutz ihrer Kultur, Sprache und Religion (Artikel 30)
• Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung (Artikel 32)
• Recht auf Schutz vor Suchtstoffen (Artikel 33)
• Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Artikel 34)
• Recht auf Schutz vor Entführung und Kinderhandel (Artikel 35)
• Recht auf Schutz vor Ausbeutung jeder Art (Artikel 36)
• Recht auf Schutz vor Todesstrafe und lebenslanger Freiheitsstrafe sowie auf Schutz bei Freiheit entziehenden Maßnahmen (Artikel 37)
• Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten (Artikel 38)
• Recht auf Schutz in Strafverfahren (Artikel 40)
Förderrechte
Die wichtigsten Förderrechte sind:
• Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls (Artikel 3)
• Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung (Artikel 6)
• Recht auf Familienzusammenführung (Artikel 10)
• Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit (Artikel 14)
• Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (Artikel 15)
• Recht auf Zugang zu den Medien (Artikel 17)
• Recht auf beide Eltern und auf Kinderbetreuungsdienste (Artikel 18)
• Recht auf Förderung von Kindern mit Behinderung (Artikel 23)
• Recht auf Gesundheitsfürsorge (Artikel 24)
• Recht auf Leistungen der sozialen Sicherheit (Artikel 26)
• Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Artikel 27)
• Recht auf Bildung (Artikel 28)
• Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung sowie auf Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben (Artikel 31)
• Recht auf Genesung und Wiedereingliederung geschädigter Kinder (Artikel 39)
Mit Blick auf die Kita von großer Bedeutung sind das in Artikel 28 verankerte Recht auf Bildung von Geburt an und die ausdrückliche Verankerung eines eigenständigen Rechts auf Spiel in Artikel 31. Darüber hinaus benennt Artikel 29 die Bildungsziele, die sich an zentralen Werten orientieren, und bezieht sich dabei auf einen umfassenden Bildungsbegriff. Die Bildung des Kindes muss demzufolge darauf gerichtet sein, »a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln; c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln; d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten; e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.«
Beteiligungsrechte
Zu den Beteiligungsrechten gehören insbesondere das Recht auf Berücksichtigung der Meinung des Kindes (Artikel 12), das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie auf Informationsbeschaffung und Informationsweitergabe (Artikel 13) sowie das Recht auf Nutzung der Medien (Artikel 17).
Regelungen zur Umsetzung der Konvention
Neben den materiellen Rechten enthält die UN-Kinderrechtskonvention in den Artikeln 42 bis 45 eine Reihe von Regelungen zur Umsetzung der Konvention. Hierzu gehören:
• die Verpflichtung zur Bekanntmachung der Kinderrechte (Artikel 42)
• die Einsetzung eines Ausschusses für die Rechte des Kindes (Artikel 43)
• die Berichtspflicht der Vertragsstaaten (Artikel 44)
• die Mitwirkung anderer Organe der Vereinten Nationen (Artikel 45)
Von großer Bedeutung ist die in Artikel 42 enthaltene Verpflichtung der Vertragsstaaten, »die Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen«. Mit dieser Verpflichtung bekennen sich die Vertragsstaaten der Konvention zu einer umfassenden Kinder- und Menschenrechtsbildung auf allen Ebenen – sowohl gegenüber Eltern, den mit Kindern und für Kinder tätigen Fachkräften sowie Erwachsenen generell als auch gegenüber Kindern jeder Altersstufe.
Die drei Zusatzprotokolle der UN-Kinderrechtskonvention
Die UN-Kinderrechtskonvention ist durch drei Zusatzprotokolle präzisiert und erweitert worden. Das im Jahr 2002 in Kraft getretene Zusatzprotokoll soll Kinder in bewaffneten Konflikten schützen. Das zweite, im selben Jahr in Kraft getretene Zusatzprotokoll betrifft den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie. Es verbietet diese Formen der Ausbeutung und fordert von den Staaten, sie als Verbrechen zu verfolgen und unter Strafe zu stellen. Im April 2014 trat das dritte Zusatzprotokoll in Kraft, das ein Individualbeschwerdeverfahren betrifft. Demzufolge haben Kinder, deren Rechte verletzt wurden, nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs nunmehr die Möglichkeit, sich mit ihren Beschwerden direkt an den »UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes« in Genf zu wenden. Der Ausschuss prüft die Beschwerden und drängt anschließend gegebenenfalls bei dem betroffenen Staat auf Abhilfe.
Die Konvention gilt uneingeschränkt für jedes in Deutschland lebende Kind
In Deutschland ist die UN-Kinderrechtskonvention am 5. April 1992 völkerrechtlich in Kraft getreten. Durch die Rücknahme der Vorbehaltserklärung am 15. Juli 2010 hat die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass kein innerstaatlicher Anwendungsvorbehalt mehr besteht. Seitdem gilt die Konvention uneingeschränkt für jedes in Deutschland lebende Kind, unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus, also beispielsweise auch für nach Deutschland geflüchtete Kinder. Sie schafft subjektive Rechtspositionen und begründet innerstaatlich unmittelbar anwendbare Normen. Gerichte wie auch die exekutive Gewalt sind in vollem Umfang an sie gebunden. Gemäß Artikel 25 des Grundgesetzes nimmt die Konvention den Rang eines einfachen Bundesgesetzes ein. Sie steht damit allerdings nicht über der Verfassung. Im Falle einer Konkurrenz zwischen Grundgesetz und Kinderrechtskonvention kommt dem Grundgesetz eine Vorrangstellung zu.
Überwachung (Monitoring) der Kinderrechte
Die Verantwortung für die Umsetzung und Überwachung (Monitoring) der UN-Kinderrechtskonvention liegt in erster Linie bei der Bundesregierung. Gemäß Artikel 44 der Konvention hat sich die Regierung verpflichtet, dem »UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes« in Genf alle fünf Jahre einen Bericht zu übermitteln, in dem sie die Maßnahmen und eventuellen Hindernisse bei der Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland darstellt. Am Ende eines umfassenden Dialogs zwischen UN-Ausschuss und Regierung formuliert der Ausschuss sogenannte Abschließende Beobachtungen (Concluding Observations), in denen er die Regierung zu ergänzenden Maßnahmen auffordert.