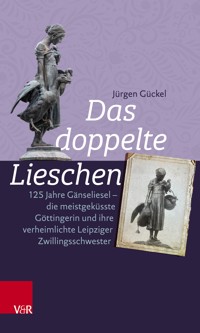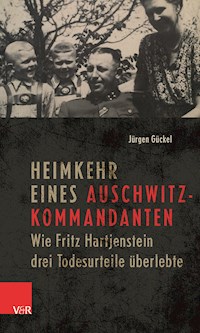Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Niedersachsen, August 1961. Der Klassenlehrer Walter Wilke wird in seiner Dorfschule aus dem Unterricht abgeholt und später in einem der ersten großen Prozesse über deutsche Verbrechen in Osteuropa verurteilt. In seinem kleinen Ort wird über die Sache nicht gesprochen. Später kehrt der Mann zurück und lebt bis zu seinem Tod 1989 zurückgezogen im Dorf. Seine Frau, mit der er über Jahre in Bigamie gelebt hatte, ist die beliebte Landärztin. Jürgen Gückel, mehrfach ausgezeichneter Gerichtsreporter, geht einer Spur nach. Einer Geschichte, die ihn seit der Schulzeit beschäftigt, denn Walter Wilke war sein erster Lehrer. Gückel rekonstruiert einen einzigartigen Lebensweg: "Walter" war in Wahrheit Artur Wilke, der die Identität seines gefallenen Bruders angenommen hatte. Artur selbst war studierter Theologe und Archäologe, im Dritten Reich der SS beigetreten, nachweislich an Massenerschießungen von Juden beteiligt, galt als gefürchteter Partisanen-Jäger und wurde nach dem Krieg dann – Volksschullehrer. Sein Name ist mit grauenhaften Kriegsverbrechen verbunden, doch zur Rechenschaft gezogen wurde er für seine Taten im Partisanenkampf nie. Das Buch zeichnet nicht nur eine spektakuläre deutsche Biografie im 20. Jahrhundert nach – die Entwicklung eines Intellektuellen zum Täter und die Verneinung jeglicher persönlicher Schuld, das Wegsehen der Gesellschaft. Es zeigt auch auf, wie schwierig das Erinnern ist, wie unterschiedlich Erlebtes bewertet wird und wie schwer die Erarbeitung historischer Wahrheit letztlich ist. Auch nach der Sichtung mehrerer zehntausend Seiten Gerichtsakten und anderer Dokumente bleiben scheinbar einfache Fragen offen. Eine wahre Geschichte über Bigamie und Theologie, Verbrechen und Vertuschung, über die deutsche Nachkriegsgesellschaft und über eine familiäre Tragödie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Gückel
Klassenfoto
mit Massenmörder
Das Doppelleben des Artur Wilke –eine Geschichte über Kriegsverbrechen,Verdrängung und die Suche nachder historischen Wahrheit
Mit einem Nachwort von Peter Klein
Vandenhoeck & Ruprecht
2., durchgesehene Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Abbildung auf dem Schutzumschlag und auf dem Frontispiz: Archiv Gückel.
Korrektorat/Lektorat: Volker Manz, Kenzingen
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99937-1
Inhalt
An der Grube
Im Bandenkrieg
Vor dem Richter
Hinter Gittern
Unter neuem Verdacht
Im Alten Testament
In Ewigkeit
Einsatzorte Wilkes im Partisanenkrieg
Nachwort
Anhang
Quellen
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Personenverzeichnis
»Jeder, der hören wollte, hat hören können.Jeder, der wissen will, muß wissen.Wer nicht hörte, wollte nicht hören,wer nicht weiß, will nicht wissen.Wer vergißt, will vergessen.«
Ernst Toller (*1893 †1939)
»Über dieses Leben kann man ein Buch schreiben.«»Man kann über jedes Leben ein Buch schreiben«,antwortete mein Vater
An der Grube
Verhaftung. – Sie haben deinen Lehrer geholt. Einfach mitgenommen, verhaftet. Mitten im Unterricht. Du hast es noch vor Augen, auch heute noch, bald sechs Jahrzehnte danach: Mathestunde, vielleicht auch Deutsch. Rechnen und Schreiben hieß das damals. Ihr wart ja gerade erst in die Schule gekommen – kleines Einmaleins, Schwungübungen und Schreibschrift. Selten, dass ihr auf Papier geschrieben habt. Papier war teuer. Die Schiefertafeln mit dem angebundenen Schwämmchen und die Griffel noch auf den Holzbänken. Die Bänke waren eigens herübergetragen worden, aus der Schule in den Saal des Gasthauses Schönau. Links neben der Holzbaracke des Putzers Köther, des Friseurs, bei dem du so viele Jahre auf den ersten Fassonschnitt hast warten müssen. Pottschnitt hieß das, was er dir bis dahin stets verpasst hatte.
Über den Hof an der Hauptstraße das Wirtshaus. Durch den Eingang, links die rauchimprägnierte Gaststube, rechts durch die Rote Diele in den alten Saal, Clubzimmer des Fußballvereins, Erzrivale deines MTV. Hier hatten sie aus der leergeräumten Schule die Holzbänke aufgestellt, von denen dein Vater später für zehn Mark eine gekauft hat. Ein Jahrzehnt lang stand sie im Garten, und ihr spieltet Schule nach der Schule. Du als Lehrer für deinen kleinen Bruder.
Ihr wart viele, 43 Schüler. Das Klassenfoto zeigt sie vor der Ziegelfassade der Volksschule Stederdorf. Damals wirklich noch ein Dorf. Die Autobahn trennte deine ländliche Idylle noch von der niedersächsischen Kreisstadt Peine. Du in der Mitte mit der Mütze, die du versteckst hinter mageren Beinchen. Neben dir Konrad von der Mühle und Bärbel mit baumelnden Füßen. Ihr sitzt auf viel zu hohen Holzstühlen. Dahinter hölzerne Flügelfenster mit rostigen Eisenwinkeln. Noch war die Schule nicht renoviert.
Ganz links am Rand des ersten Klassenfotos, das dir deine Mutter in das Fotoalbum geklebt hat, steht Walter Wilke. Ein Mann in den mittleren Jahren, Pottschnitt wie du, helles Sakko, Krawatte, die Hand lässig in der Jackentasche. Euer Lehrer – euer falscher Lehrer.
An jenem Sommertag, der dich seither so beschäftigt, fand der Unterricht nicht in der Schule statt. Die wurde umgebaut. Neue Fenster, Toiletten, vor allem aber die Aula unter dem Dach und die Werkräume, deine Lieblingsorte in der Volksschulzeit. Dort hinauf führte die neue Treppe, die dich über Jahrzehnte nachts gequält hat. Immer wenn es eng wurde in der Schule, wenn es auf Prüfungen zuging, wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht oder geschummelt hattest, drückten dich Alpträume, in denen dieses Treppenhaus die Hauptrolle einnahm. Du auf dem Weg hinauf in die Aula, und das Treppenhaus so hoch, die Treppe immer enger, die Stufen immer schmaler, am Ende fehlt das Geländer. Nirgends etwas zum Festhalten. Deine angstbesetzte Bildungsleiter. Erst nach dem Abi war das vorbei.
Für diese Treppe müssen die Maurer noch die Stufen gegossen haben, als es passierte. Ihr also mitten im Unterricht. Mindestens 43 Kinder, vielleicht sogar mehr, denn in der Raumnot wurden mehrere Klassen zusammen unterrichtet. Der Konfirmandensaal im Pfarrhaus, die Räume der Landwirtschaftsschule, auch der Saal des nahen Wirtshauses Winkel und eben die Räume im Gasthaus Schönau dienten dem Unterricht. Nun also passiert es:
Die geflügelte Saaltür geht auf, zwei Männer kommen herein, ein dritter bleibt jenseits der zweiflügeligen Türe stehen. Sie kommen nach vorn, sprechen mit deinem Lehrer Wilke, einer fasst ihn an, führt ihn hinaus – du hast ihn erst ein gutes Jahrzehnt später wiedergesehen und kaum erkannt. Ein alter, kranker Mann.
Die Szene steht dir vor Augen – wie ein Schwarzweißfilm. Die Männer: Kriminalbeamte. Du siehst gegen das Licht der offenen Saaltür lange Mäntel, Hüte, den energischen Schritt der Fremden, wie sie die Klasse durchschreiten und deinen Lehrer ansprechen. Was ihr danach gemacht habt, wie der Unterricht endete, ob jemand eine Erklärung abgab, ob ihr mangels Lehrer einfach nach Hause gingt? Du weißt es nicht. Die Sequenz endet damit, dass die beiden Männer mit eurem Lehrer in der Mitte die Saaltür durchschreiten.
Immer wenn du die Szene erzählst, kommen dir Bedenken. Du erzählst sie zu Ende; du lässt dir deine Zweifel nicht anmerken. Schwarz auf Weiß steht es dir vor Augen. Wie in einem alten Film mit Kriminalbeamten im Trenchcoat und mit Schlapphut. Wie als Kind im Fernsehen gesehen, bei Durbridge oder Stahlnetz.
Es muss im Sommer gewesen sein, August, gleich nach den großen Ferien. Wer trug da Mantel? Und Hut? Wirkt wie ein Klischee! Aber du warst doch dabei!? Sie haben deinen Lehrer verhaftet, und du hast es live erlebt. Oder hast du dir ein Leben lang vorgemacht, etwas miterlebt zu haben, das du dir nur ausgemalt hast? Ein Erklärungsversuch, den du in Schwarzweißbilder aus dem Fernsehen gekleidet hast, weil du nicht ertragen konntest, es verpasst zu haben, worüber danach das ganze Dorf sprach? Der Lehrer Wilke ist verhaftet worden, mitten im Unterricht!
Aber sie haben ja gar nicht darüber gesprochen. Sie haben geschwiegen. Als wäre nichts gewesen. Jedenfalls haben sie höchstens hinter vorgehaltener Hand darüber getuschelt. Euch Kindern wurde das Fehlen des Lehrers Wilke mit Bigamie erklärt. Oder gar nicht. Bigamie – das Wort fiel natürlich nicht. Zu schwer für Grundschüler. Der Lehrer Wilke habe die Frau seines Bruders geheiratet, lautete die Erklärung für die Kinder. Das glauben viele, heute schon im Rentenalter, immer noch. Das war falsch, aber darunter konntet ihr euch etwas vorstellen. »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.« So hattet ihr es im Religionsunterricht gelernt. Eine Sünde. Das wird bestraft. Deshalb also die neue Lehrerin. Fräulein Weiß. Sie machte euch Lehrer Wilke und sein Fehlen schnell vergessen. Ihr liebtet sie. Wilke hattet ihr nur ertragen.
Hölderlin. –
Uns würdigte einst eurer Weisheit Wille,
Der Kirche Dienst auch uns zu weihn,
Wer, Brüder, säumt, dass er die Schuld des Danks erfülle,
Die wir uns solcher Gnade freun?
Gnade? Im Augenblick erfreute er sich an gar nichts. Nicht einmal der Schnaps konnte ihn recht beruhigen. Auch Hölderlin half nicht. Gut, dass er das dicke Buch mitgenommen hatte: das Gesamtwerk. Für ihn, Artur Wilke, älterer Bruder des Lehrers Walter Wilke, 32 Jahre alt, studierter Altphilologe, war Hölderlin sonst immer ein Labsal gewesen. Fast neun Jahre lang hatte er studiert – in Greifswald, Wien und Königsberg. Allein 15 Semester Theologie waren es, dazu die alten Sprachen, schließlich Archäologie. Er hatte Pfarrer werden wollen, dann aber Lehrer, vielleicht auch Archäologe. Die Promotion in diesem Fach hatte er schon begonnen, als er begriff, dass man davon nicht leben kann. Dann also Lehrer. Sogar das erste Staatsexamen und ein Referendariat hatte er schon in Angriff genommen, ehe er seine jetzige Karriere begann. Schuldienst in Riesenberg und in Marienburg, in Ost- und Westpreußen also, das war dann doch nichts für ihn. Auch nicht die Zeit als Hauslehrer auf einem Gut in Pommern. Er warf hin. Dabei hatte er den Lehrerberuf immer geschätzt, sich gern in dieser Rolle gesehen – theoretisch.
Froh eilt der Wanderer, durch dunkle Wälder,
Durch Wüsten, die von Hitze glühn,
Erblickt er nur von fern des Lands beglückte Felder,
Wo Ruh und Friede blühn.
Ruh und Friede – wie lange ist das her? Jetzt saß er hier in Minsk und berauschte sich am Schnaps statt an Hölderlins frühen Versen. »Dankgedicht an die Lehrer« – wie hatte er sich, beseelt durch Alkohol und Hölderlin, immer vorgestellt, dass auch seine Schüler einmal dankbar an ihn denken würden, wenn sie sich nach erfolgreichem Berufsleben ihres Lehrers Artur Wilke erinnern.
Und was ist wohl für euch die schönste Krone?
Der Kirche und des Staates Wohl,
Stets eurer Sorgen Ziel. Wohlan, der Himmel lohne
Euch stets mit ihrem Wohl.
Kirche konnte man im Augenblick vergessen. Es war Krieg. Um Staates Wohl ging es, um das Wohl im künftigen deutschen Lebensraum hier im Osten. Dafür hatte er sich engagiert. Schon seit 1938. Da war er zum Sicherheitsdienst des Reichsführers gegangen. Einer seiner Professoren, glühender Anhänger der NSDAP, hatte ihn motiviert – ihn und seine ganze Studentenverbindung. Dort könne man gebildete Leute gebrauchen, hatte er gesagt. Vielleicht war es auch, weil es im Studium nur schleppend, ziellos, stets nur mit mäßigen Noten voranging. Mit Sicherheit aber – das hatte er blöderweise irgendwann im Suff verraten und das hatten sich die Kameraden gemerkt, ohne dass er es sich selbst je eingestanden hatte –, weil er es den Wehrmachts-Heinis hatte zeigen wollen.
Er hatte immer schon Neigung zu allem Militärischen gehabt. Mit 17 hatte er sich dem Grenzschutz angeschlossen. Das war in seiner grenznahen Heimat keine Seltenheit. Die Heimat galt es zu verteidigen. 1910 war er in Hohensalza bei Posen geboren. Von dort waren die Eltern vertrieben worden, als Deutschland den Krieg verloren hatte und Westpreußen hergeben musste: das Unrechtsdiktat, es machte ihn immer wieder wütend. Nach der Ausweisung 1920, also vom zehnten Lebensjahr an, hatte er in Stolp in Pommern gelebt – grenznah, zwangsausgesiedelt, bereit zur Verteidigung. Ab 1931 übte er freiwillig bei der Reichswehr, später bei der Wehrmacht. Dabei war er nicht einmal wehrpflichtig gewesen: weißer Jahrgang, keine Wehrpflicht. Und brachte es dennoch bis zum Feldwebel der Reserve – als Freiwilliger neben dem Studium. Und das als Kind eines einfachen Lokomotivführers, erzogen zu Ehrgeiz, Fleiß und Gottesfurcht. Und zu Hass auf die Kommunisten. Die hatten ihn, als er sich in den Ferien etwas Geld verdiente, beim Kohletrimmen im Königsberger Hafen als Streikbrecher vermöbelt. Seitdem sann er auf Rache.
Im Sommer 1938 hatte er den Antrag auf Übernahme in das aktive Offizierskorps gestellt. Die Schmach trieb ihm jetzt noch die Zornesröte ins Gesicht. Antrag abgelehnt! Ohne jede Begründung. Elitäre Scheißer! Gut, er war schon früh, 1931, in die NSDAP eingetreten. Den Schnöseln vom Korps hatten die frühen Nationalsozialisten damals noch als Schläger, politische Raufbolde und nicht standesgemäß gegolten. Dieses überhebliche Offiziersvorurteil mochte auf einige Kameraden – auf Stark zum Beispiel, zu jeder Schweinerei und Brutalität ohne Nachdenken bereit – noch heute zutreffen. Er aber war aus anderem Holz. Und heute waren andere Zeiten. Aus der Partei zwar war er nach einem Jahr schon wieder ausgetreten, ab 1933 dann aber Mitglied in der SA.
Euch aber kröne Ruhm und hohe Ehre,
Die dem Verdienste stets gebührt …
Er konnte sich jetzt auf Hölderlin nicht konzentrieren. Seit Herbst 1938, seit er beim SD war, ging es voran. Sogar Lehrer, jedenfalls Lehrkraft, einst sein Traum, war er geworden. Erst im Nachrichtendienst des SD in Elbing, Thorn und Danzig, dann als Schulungsreferent in Polizeischulen in Pretzsch, Bernau und Berlin-Charlottenburg. Sport und Geschichte waren seine Fächer, immer aber auch Ideologie, das, was Sicherheitsdienst und SS zusammenhielt. Jetzt also hier in Weißruthenien, Minks, Dienststelle des KdS, beim Kommandeur der Sicherheitspolizei also, Abteilung III, zuständig für »Lebensgebiete«, also für die Gestaltung des neuen Siedlungsraumes für sein Volk ohne Land.
»Sie haben uns unser Pommern weggenommen, jetzt holen wir uns zurück, was uns zusteht. Und mehr …«, das hatte er sich mehr als einmal geschworen. »Gebildete Männer wie den Wilke können wir hier brauchen«, hatte sein neuer Chef Georg Heuser gesagt, als er ihn bei Kube vorstellte. Wilhelm Kube, seit Sommer 1941 Generalkommissar für den besetzten Bezirk Weißruthenien in Minsk. Der hatte freundlich genickt und weiter geschmunzelt, als Heuser fortfuhr: »Nach dem Krieg, wenn wir das hier alles gesäubert haben, dann ist das Lebensraum für unser Volk, wie wir ihn uns nur wünschen können. Dann werden Sie hier was, Wilke: hohes Tier in der Verwaltung mindestens. Also halten Sie sich ran!«
Vorerst war weiter Krieg, nichts mit beglückten Feldern, wo Ruh und Friede blühn. Auch in der Dienststelle war Unruhe. Gerade hatten sie Kommandeur Hofmann, früher mal Staatsanwalt, abserviert. »Teppichaffäre«, wurde nur gemunkelt. Der neue, Eduard Strauch, war nur ein paar Tage nach Wilke angekommen. Sogar zwischen Kube, dem Generalkommissar des Protektorats, den er gerade kennengelernt hatte, und den KdS-Leuten herrschte Zwietracht. Kube habe sich in Berlin beschwert, mache dort die SS schlecht, habe ihr Vorgehen gegen die Juden als Schande bezeichnet, sei überhaupt ein Juden-Freund und völlig verweichlicht. So wurde es Wilke sogleich von den neuen Kameraden berichtet. Dem müsse man mal, sagte einer, seine Juden-Flausen austreiben. Neulich habe er sogar, empörte sich ein anderer, beim Besuch im Getto einem Juden-Bengel ein Bonbon geschenkt. »Und wir haben dann die Drecksarbeit zu machen – Bollos von Kube, blaue Bohnen von uns!«
Ja, das Getto – er hatte es nur kurz gesehen, aber solche Zustände hatte er sich vorher nicht vorstellen können. Und dann erst die Erschießungen …
Wilke griff wieder zur Flasche. Das konnte man sich gar nicht wegsaufen, was man hier miterleben musste. Erst gestern wieder. Aktion hieß das hier. Erschießungen. Er hatte das Krachen der Pistolenschüsse gehört, gelegentlich eine Gewehrsalve, hatte auch aus der Ferne gesehen, wie die Menschen am Rand einer Grube – die hatte er nur erahnen können – standen und nach vorn kippten, nachdem es aus vielen Mündungen geknallt hatte. Noch war er nicht zu einer solchen Aktion eingeteilt worden, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.
Und jeder künftge Tag erhöhe und vermehre
Den Glanz, der euch schon ziert.
Hölderlin, was weißt denn du …
»Was lesen wir denn da? Schund schon wieder? Oder deutsche Dichter und Denker?« Heuser hatte sich regelrecht angeschlichen. Davor hatten sie ihn schon gewarnt. Der Alte, eigentlich jünger als er, SS-Obersturmführer der Abteilung IV beim Kommandeur der Sicherheitspolizei in Minsk, unausgesprochen auch dessen Stellvertreter, liebte Überraschungseffekte. Niemand sollte sich vor ihm sicher fühlen.
»Hölderlin, sämtliche Werke, Herr Obersturmführer!«
»Nun seien Sie mal locker, Wilke. Morgen brauchen Sie Mut – Mut und Kraft. Ich sage nur: Partisanen.«
Da war sie, die Einteilung ins Erschießungskommando. Er würde sich nicht drücken können. Er hatte noch nie einen Menschen erschossen. An die Front, dorthin hatte er immer gern gewollt. Und dass er dort im Kampf den Gegner tötet, das hatte er sich vielfach vorgestellt. Aber wehrlosen Menschen mit der Pistole ins Genick zu schießen – immerhin ins Genick, human, schneller Tod, so hieß es –, das ängstigte ihn. Bisher hatte er Glück gehabt. Er war hier angekommen, nachdem die Gruppe am 4. Februar in dem kleinen Örtchen Rakow Partisanen gejagt hatte. Viele Tote. Darunter viele Juden. Alles Partisanen? Man sprach nicht darüber, wie viele es waren, wohl aber darüber, wie die Leichen noch über Wochen herumgelegen hatten. Danach waren die Säuberungen, die sich die SS noch vorgenommen hatte, erst einmal verschoben worden. Die Böden waren hart gefroren. Niemand ohne schweres Gerät konnte genügend Gruben für die Leichen ausheben. Aber wenn es wärmer wird, der Boden erst getaut ist, dann würde es große Säuberungsaktionen geben. So viel war sicher. Auch im Getto, so wurde gemunkelt. Dann würde, hatte einer der Kameraden bei der zweiten Flasche Wodka gesagt, »jeder Jude zum Partisanen erklärt«.
Heuser muss es ihm angesehen haben. »Es sind Partisanen, noch dazu alles nur Juden. Sie sind zum Tode verurteilt, ihre gerechte Strafe. Wir haben Krieg. Mensch, Wilke, im Krieg sind wir! Wir töten sie, weil sie sonst uns töten. Deshalb sind wir hier. Unsere Pflicht. Sie wissen doch, Wilke, was Pflicht bedeutet …?« »Aber gab es denn Partisanenangriffe in den letzten Tagen? Wir haben doch …« Heuser ließ ihn nicht ausreden »Partisanen, habe ich gesagt, Partisanen!«
Das Wort »Befehl« fiel nicht.
Befehl. – Der Begriff »Befehl« sollte 20 Jahre später eine zentrale Rolle spielen. Das konnten weder Georg Heuser noch Artur Wilke ahnen – nicht einmal fürchten, denn sie waren überzeugt von einem dauerhaften deutschen Reich bis über Moskau hinaus.
Am Montag, den 15. Oktober 1962, begann vor dem Landgericht Koblenz der sogenannte Heuser-Prozess. Bis zum 21. Mai 1963 verhandelte das Schwurgericht unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor Erich Randebrock dreimal wöchentlich immer montags, dienstags und mittwochs die Verbrechen, die die Gestapo-Abteilung beim Kommandeur der Sicherheitspolizei in Weißruthenien zwischen 1941 und Sommer 1944 begangen hatte. Angeklagt waren 30 356 Morde – so viele, dass schon die Ankläger bei vielen Massenerschießungen die Zahl der Opfer nur geschätzt und abgerundet hatten. Partisanen, mehrheitlich aber Juden, Zigeuner und Geisteskranke hatte die Minsker Sipo-Dienststelle liquidiert. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge.
Allein für das Jahr 1942 standen 25 000 Erschießungen von deutschen und ortsansässigen Juden auf den Listen der Mörderbande. Heimtückisch, grausam und aus niederen Beweggründen, so die Mordmerkmale, die die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz in die Anklageschrift geschrieben hatte. Das Material dafür hatte die Zentralstelle zur Aufdeckung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg zusammengetragen. Es war nach den Nürnberger Prozessen der bisher größte und nach Einschätzung vieler Medienvertreter der denkwürdigste Prozess, den die Ludwigsburger Nazi-Jäger in Gang gesetzt hatten. Denkwürdig auch, weil fast alle Angeklagten, die Täter von einst, es nach dem Krieg geschafft hatten, sich in eine gutbürgerliche Existenz hinüberzuretten.
Allen voran der Kriminalist Dr. Georg Heuser. Zu Prozessbeginn 49, zum Zeitpunkt der ihm angelasteten Morde also 29 bis 30 Jahre alt und SS-Ober-, später Hauptsturmführer der Sicherheitspolizei-Dienststelle in Minsk. Offiziell Minsker Kripo-Chef, inoffiziell Stellvertreter des Kommandeurs Eduard Strauch. Schon seine Verhaftung am 15. Juli 1959 in Bad Orb, wo Heuser gerade zur Kur war und, gerade dem Termalbad entstiegen, festgenommen wurde, machte Schlagzeilen. Er war inzwischen prominent, war einer der führenden Repräsentanten der Exekutive in der jungen Bundesrepublik. Nach steiler Karriere in der Polizei vertrat er von Januar 1958 an bis Mitte 1959 das Land Rheinland-Pfalz bei den Konferenzen der Leiter der deutschen Landeskriminalämter. Er war als Kriminaloberrat sogar zum Chef des LKA geworden. Das Bundesland hatte damit einen Bock zum Gärtner gemacht, war es doch eine seiner Aufgaben, die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg zur Verfolgung von NS-Tätern bei ihrer Suche nach noch unentdeckten Kriegsverbrechern zu unterstützen. Er hätte also sich selbst und alle seine Mordgesellen aus Minsker Tagen ans Messer bundesdeutscher Justiz liefern müssen. Er stand sogar auf der Fahndungsliste: als Georg Häuser – mit »ä«. Der eine falsche Buchstabe schützte ihn, bis Mitte 1959 seine wahre Identität offenbar wurde.
Entsprechend der Bedeutung des Hauptangeklagten das Medien-Echo: »Kriegsverbrechen – Im Schatten der Fackeln«, schrieb das Magazin Spiegel zum Auftakt. Und Dietrich Strothmann von der Wochenzeitung Die Zeit überschrieb sein »Porträt eines Kriegsverbrecherprozesses, der noch nicht der letzte ist« mit der Schlagzeile: »Hölderlin zwischen den Exekutionen« – eine Anspielung auf Wilkes Beruhigungslektüre.
Wie Heuser hatten sich fast alle der Koblenzer Angeklagten auf Befehlsnotstand berufen. Sie hätten den Befehl von oberster Dienststelle gehabt, das besetzte Weißruthenien »judenfrei« zu machen. Sie hätten bei der SS ihren Eid geschworen, den Befehlen zu gehorchen. Befehlen, die sie selbst verabscheut hätten, aber gegen die sie nichts hätten machen können. Sich zu widersetzen, den Befehl zu verweigern und damit den Eid zu brechen, wäre einem Todesurteil gegen sich selbst gleichgekommen. So sinngemäß ihre Verteidigung. Auch die von Artur Wilke.
ABC. – Was war das für ein Mensch, euer Lehrer Walter Wilke? Viel hast du nicht in Erinnerung, auch nicht viel herausbekommen bei der Befragung der Klassenkameraden. Ihr wart ja noch so jung, alles ist so lange her, so viele Lehrer hattet ihr seitdem, so viele andere Menschen, so viele neue Eindrücke. Und dann musst du dich hüten vor Mythenbildung. Man reimt sich als Kind ja so einiges zusammen. Als Erwachsener, wenn man sich an die Kindheit erinnert, noch mehr. Wilkes Kniebundhosen – »Wanderhosen«, hat Jochen sie genannt – hast auch du noch vor Augen. Die grüne Jacke aus grobem Tweed mit den aufgesetzten Taschen ebenso. Manchmal kam er mit Hut. Hager war er und streng. Ihr hattet Angst vor ihm.
Wie er euch das ABC beibrachte, wie das Einmaleins – keine Erinnerung! Aber auf der Schiefertafel schreiben musstet ihr, Stunde für Stunde ohne aufzuschauen. Du hast noch den kreidigen Geschmack auf der Zunge, wenn du mit Spucke auf dem Finger den verschriebenen Krakel von der Schiefertafel löschtest, statt dafür das befeuchtete Läppchen zu nehmen. Du hörst noch den schrecklichen Laut, bekommst noch eine Gänsehaut, wenn du dich erinnerst, wie der Griffel abgebrochen ist oder jemand vorn an der Tafel mit der weißen Kreide schief schreibt und dabei kreischend kratzt. Auch der bissige Ton der silbernen Trillerpfeife – den verbindest du mit deinem ersten Lehrer. Aufstellen zum Sport auf dem Sportplatz: Pfiff! Runden laufen: Pfiff! Dort, aus Wilkes Pfeife, nicht beim Fußball, hast du das erste Trillern gehört und hättest auch gern eine solch glitzernde Kommandohilfe gehabt.
Zweieinviertel Jahre war er euer Lehrer. Das hast du dir jedenfalls so eingebildet. Sehr oft wurde er wegen Krankheit vertreten. Für ABC und Einmaleins muss er den Grundstein gelegt haben. Aber auch für Zucht und Gehorsam in der Schule. Ob er dich je geschlagen hat? Du erinnerst dich nicht daran. Höchstens einmal mit dem Lineal auf die Finger. Aber Angst vor Schlägen hattest du immer. Auch zu Hause galt ja der Kochlöffel – und sei er nur sichtbar platziert – noch als Erziehungsmittel. In der Schule wurde noch pädagogisch gezüchtigt. Fräulein Galdea war streng – mit der Stimme. Geschlagen wurden nur die, meist Mädchen, die beim »Gewaltrechnen«, so nannten es deine Klassenkameraden, stehen blieben – nur wer die Lösung wusste, durfte sich setzen. Und Lehrer Pietsch? »Herr Pietsch, Herr Pietsch, woll’n wir Indianer spielen?«, rief Mecki mitten im Unterricht und kroch auf allen Vieren unter den Schulbänken herum. Pietsch drohte immer nur mit dem Rohrstock und ließ sich doch auf der Nase herumtanzen. Wilke hingegen hat ihn auch benutzt.
Ob er es genossen hat? Dir fällt ein, wie Wilke einem der Klassenkameraden Schläge mit dem Rohrstock für morgen ankündigte. Der Delinquent bekam die Aufgabe, dafür eine Gerte aus dem Trentelmoor zu holen, mit der er dann Schläge auf den Hosenboden bekommen würde. Das Opfer brachte am nächsten Tag brüchiges Binsenrohr mit – es sollte doch ein »Rohrstock« sein. Für die Züchtigung unbrauchbar. Es gab stattdessen welche mit dem Lineal.
Das war doch Wilke!? Oder doch ein anderer Lehrer? Du traust es ihm zu, bist aber nicht mehr sicher.
Dich hat er eher mit Scham gezüchtigt. Einmal vorlaut gewesen – ab in die Ecke. Da stand man nun vorn rechts als Sünder. Die ganze Klasse hatte dich zu ignorieren. Und doch fühltest du dich von jedem angeschaut – durchschaut. Bohrende Blicke im Rücken. »Das war so schambesetzt«, sagt auch Kurt, an dessen Eckenstehen du dich jetzt, wo er davon erzählt, gut erinnerst. »Die ganze Schule war für mich eine einzige Demütigung, den Eltern nicht zu genügen«, bringt Kurt unsere ABC-Schützen-Gefühle auf den Punkt.
Und doch ist Kurt einer der ganz wenigen Klassenkameraden, der positiv an Wilke als Lehrer zurückdenkt, ihn »damals toll fand«. Er habe Witzchen gemacht. »Das war vielleicht ironisch, aber ich habe es nicht gemerkt«. Und er habe den Unterricht auch mal mit Zeichnungen an der Tafel, kleinen Strichmännchen etwa, aufgelockert. Oder mit einem Reim: »A, B, C – die Katze lief im Schnee.« »Ich habe es fast bedauert, als er plötzlich weg war.«
Ob sich Kurt an die Verhaftung erinnere? »Ich hätte gesagt, die haben ihn über den Schulhof abgeführt. Aber ob ich das wirklich gesehen habe …?« »Aber der Unterricht war doch gar nicht in der Schule zu dieser Zeit«, wendest du ein. »Stimmt! Mein Vater hatte ja auch eine alte Schulbank gekauft.«
Genickschuss. – Artur Wilke hatte schlecht geschlafen. »Hinterkopf, einfach in ’n Hinterkopf, zack«, hatte Franz Stark am Abend gesagt und dabei gegrinst. Der wusste, was bevorstand. Jetzt also raus mit den anderen, raus an die Grube. Die hatten die Mannschaften gestern schon schaufeln lassen. Ein Trupp Juden aus dem Getto musste anrücken und graben. Fünf Meter breit, zwei Meter tief, 50 Meter lang – das verhieß nichts Gutes.
Als er an den Grubenrand trat, lag schon ein Leichnam unten im aufgewühlten Dreck: leblos, die Glieder verrenkt, winzig im Verhältnis zu der Dimension des riesigen Lochs in steingrauer Erde. Wilke hatte wohl fragend geschaut – Stark antwortete ungefragt. »Hat nicht arbeiten wollen. Einer der Wachleute hat ihn erschlagen. Muss nachher zum Heuser – gibt ’ne Belobigung.« Die anderen jüdischen Arbeiter seien wieder zurück ins Lager. »Wird ihnen wohl ’ne Lehre sein.«
Sie hatten ihm Stark an die Seite gestellt, das ahnte Wilke gleich. Stark, der Vorführ-Gefolgsmann. Nicht viel in der Birne, aber einer der ersten Stunde. SS-Mann, wie er im Buche steht. Neun Jahre älter als Wilke. Nichts gelernt, nicht studiert, nicht einmal in Deutschland geboren. Die Mutter hatte sich in den USA schwängern lassen, wohin sie 1890 ausgewandert war. Unehelich geboren in St. Louis, als Kind von der eigenen Mutter misshandelt, schlechter Schüler, abgebrochene Lehre, aber schon 1919 mit dabei. Freikorps Roßbach, Baltikum-Einsatz, danach wieder arbeitslos, wieder ins Freikorps, diesmal Korps Oberland, mit dem er am Kapp-Putsch teilnahm und den Ruhraufstand und die Aufstände in Oberschlesien niederschlug. Seit 1920 Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, ein Jahr später gar bei der Gründung der SA dabei. Damals in München, da war Stark Adolf Hitler ganz nahe. Der Putsch des Führers 1923, der Marsch auf die Feldherrenhalle – da war Franz Stark ganz vorn. Gut, vor dem Krieg war er meist in der Registratur des Sicherheitsdienstes in München und Augsburg beschäftigt – zu Friedenszeiten zu sonst nichts zu gebrauchen. Aber wenn es ernst wurde, dann stand er seinen Mann. Jetzt seit Oktober 1941 im Osten. Für die Kameraden war er bereits eine Legende. Alles, was die Geschichte der Bewegung ausmachte, das war Stark in Person. Er war sogar Hausbursche Heydrichs gewesen, als er sich 1933 der SS anschloss.
Ein Söldner, ja, aber einer, an dem man hochschauen konnte. Ein Macher und Haudegen. Jetzt sollte also Wilke an ihm hochschauen, es ihm nachmachen, die eigenen Skrupel vergessen. Jetzt, da er erstmals an der Grube stand mit geladener Pistole in der Hand. »Hinterkopf, zack!«
Die Lastwagen waren schon vorgefahren, wurden gerade entladen. Zerlumpte Gestalten aus dem Getto. Das mussten mehr als 100 sein, mehr als 200, 400 sogar. Alles Partisanen? Schon wurden sie angewiesen, an den Grubenrand zu gehen. Immer 30 Mann in Reih und Glied. So viele Schützen waren eingeteilt, Wilke einer von ihnen. Stark und er standen ziemlich weit rechts; die Gefangenen kamen von links – niedergeschlagen trottend, dem Schicksal ergeben. Als die erste der verlausten Gestalten auf Höhe Starks war, griff dieser zu, riss den vermeintlichen Partisanen herum, sodass das Gesicht in Richtung Grube gezwungen wurde – und drückte ab. »So geht das!« Keinen Schießbefehl abgewartet, keinen Moment des Zögerns, bis alle Opfer vor ihrem Henker standen. Abgedrückt, ein kleiner Schubs, da purzelte der leblose Leib mit einem Genickschuss in die Grube. »Weitergehen!« Sekunden später kam der Schießbefehl – und auch Wilke drückte ab. Noch viele Male an diesem Tag, dem Tag seiner ersten Exekution.
Noch einmal griff Stark ein. Um ihn zu schonen? Fast freundschaftliche, jedenfalls kameradschaftliche Gefühle empfand er, als Stark ihn – ja, rettete. Es muss die dritte oder vierte Gruppe gewesen sein, die da vor den Schützen aufzog, den Tod vor Augen und doch so merkwürdig gottergeben und still. Immer der Vierte in der neuen Gruppe, das war seiner, der hatte die Kugel aus seiner Pistole zu erwarten. Genickschuss, sofortiger Tod, »humane Sache«, sagte Stark. Der Vierte in der neuen Reihe, das war ein Junge, zerlumpt, ausgemergelt, mit eingefallenen Augen und dürren Ärmchen. Vielleicht 13 oder 14, fast noch ein Kind. Sein Blick nicht gottergeben, nur pure Angst. Er schaute nicht zu den Toten in die Grube, nicht auf den Boden, nicht auf den Vordermann, nur auf Wilke, auf den Schützen, der ihn gleich töten würde. Im letzten Moment trat Stark vor, griff sich das Kind, schob den Nächsten weiter zu Wilke und wartete auch diesmal nicht auf den Schießbefehl.
Am Abend half auch Hölderlin nicht mehr. Es musste Härteres sein. Erst der Kater am nächsten Morgen ließ ihn wieder daran denken, aber auch an die unzähligen Schulterklopfer der Kameraden. »Pflicht erfüllt, Wilke. Du weißt doch, was unsere Pflicht ist.«
Christiane. – Was soll das denn? Das hast du dir ausgedacht. Soll das ein Roman werden? Schreibst über Ereignisse vor 75 Jahren, als wärst du dabei gewesen oder hättest deine Helden selbst erfunden. Das mag vielleicht authentisch sein, weil du so etwas irgendwo gelesen hast. Du liest ja nur noch sowas. 24 000 Seiten Akten des Heuser-Prozesses, Zeugenberichte, Bücher, »Die Vernichtung der europäischen Juden« in drei Bänden, die von Jens Hoffmann herausgegebenen Augenzeugenberichte der Massenmorde in Osteuropa, »Kalkulierte Morde« von Christian Gerlach – alles voller Versatzstücke für eine Neukonstruktion der damaligen Wirklichkeit. Kein Wort erfunden, aber alles garantiert so zusammengefrickelt, wie es ganz bestimmt nicht war. Realistisch, aber nicht real. Authentisch, aber nicht die Wirklichkeit. So wie deine Verhaftungsszene womöglich? So wirklich wie deine Erinnerung, an der du ja selbst zweifelst. Klingt überzeugend, aber ist mit nichts bewiesen.
Schon klar, du willst nicht das x-te Historiker-Werk über den Nationalsozialismus, nicht die tausendste Täter-Biografie, nicht eine weitere uninteressante Autobiografie schreiben. Roman kannst du sowieso nicht. Du willst alles vermischen. Denkst, dann wird es vielleicht interessanter. Du willst dich nicht entscheiden und versuchst, das jetzt noch zu rechtfertigen. »Rechtfertigungsneurotiker« hat dich mal eine Volontärin genannt, als du irgendeinem Leser versuchtest zu erklären, warum du dieses und nicht jenes geschrieben hattest.
Du hast immer schreiben wollen, seitdem du bei deinem ersten Lehrer das ABC erlernt hast. Bei jenem Lehrer Wilke. Dann bist du Journalist geworden. Erst Sport, dann Lokales, schließlich Polizei- und Gerichtsreporter. Du hast immer geschrieben, was du miterlebt, und zitiert, was man dir erzählt hat. Saubere Recherche, ob sie dich nun »Gefälligkeitsjournalist« geschimpft oder dich ausgezeichnet haben. Und heute solche Sachen!? Reine Fiktion! Selbst was die Zeugen vor Gericht über Wilke gesagt haben – man kann doch nicht so tun, als wäre das alles wahr.
Du hast dich schon als kleiner Junge damit lächerlich gemacht. Wolltest einen Krimi schreiben. Deine Schulfreundin musste den Quatsch abtippen. Hatte als Einzige Schreibmaschinenunterricht. Christiane – das Mädchen vier Plätze rechts neben dir auf dem Einschulungsfoto. Natürlich hast du sie auch gefragt, ob sie sich an Lehrer Wilke erinnert. »Die Backpfeife werde ich nie vergessen«, hat sie geantwortet. Warum hat er sie geschlagen? »Ich weiß es nicht. Es war die einzige Ohrfeige meiner ganzen Schulzeit.« Und seine Verhaftung? Keine Erinnerung. »Dass er im Unterricht verhaftet wurde, das weiß ich. Aber woher ich das weiß …?« Bei Christiane kommst du nicht weiter.
Unser gemeinsamer Lehrer, der Faschist, das war für Christiane nie ein Thema. Auch nicht, als sie sich nach der Lehre politisch engagierte. In Braunschweig, später mit Cornelia in einer winzigen WG in Hannover. Das Kapital, die Mao-Bibel, DKP-Schriften hat sie studiert, als Antifaschistin hat sie demonstriert, engagiert sich noch heute als Rentnerin im Welt-Laden für eine bessere Gesellschaft. Typisch 68erin. Dabei hatten wir in unseren neun gemeinsamen Schuljahren in der Volksschule Stederdorf niemals auch nur ein Wort gehört über Faschismus, Nationalsozialismus, deutsche Verbrechen, Holocaust – das Wort gab es noch gar nicht – oder womöglich über die Taten unseres mörderischen Lehrers. Einzig Christianes Großvater hat ihr aus dieser Zeit erzählt, dass er als Sozialdemokrat unterdrückt wurde, dass er gar kurz vor Kriegsende ins Konzentrationslager nach Bergen-Belsen gesteckt wurde, weil er sich als Schneider geweigert hatte, den Nazis ihre braunen Uniformen zu nähen. Dass er von der britischen Militärregierung nach der Befreiung kurzerhand zum Stederdorfer Dorfpolizisten gemacht wurde – ihn, den gelernten Schneider – hast du erst aus Anton Görgners Memoiren erfahren. Und je älter er wurde, hat Christiane erzählt, umso weniger wollte Opa Albert über diese schreckliche Zeit sprechen. Ein Nazi-Opfer, das vergessen und lieber schweigen wollte – und dessen Familie bis zuletzt ihrer Hausärztin vertraute, der Ehefrau des Massenmörders, deines falschen Lehrers.
Und nun kommst du und willst alles ans Licht zerren, worüber das ganze Dorf Jahrzehnte geschwiegen hat. Und es dann auch noch bunt ausmalen. Mach dich nicht lächerlich, bleib bei den Fakten.
Fakten. – Dann also die Fakten: Historiker gehen heute davon aus, dass zwischen fünf und sechs Millionen Juden dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Eine genaue Zahl wird es nie geben. Die wohl am häufigsten genannte Zahl von sechs Millionen geht zurück auf eine Äußerung vor dem Nürnberger Militärgericht im November 1945. Ein SS-Führer soll diese Zahl genannt und sich dabei auf Adolf Eichmann berufen haben. Eichmann war als SS-Obersturmbannführer Leiter jenes Referats im Reichssicherheitshauptamt, das die Deportation und letztlich die planmäßige Ermordung der jüdischen Bevölkerung in den von Deutschen besetzten Gebieten in ganz Europa organisiert hat. Anderen SS-Führern gegenüber soll Eichmann von fünf Millionen gesprochen haben.
Sicher ist aber: Selbst Eichmann konnte sich nicht auf eine Statistik berufen. Zum einen beruhten die Zahlen, wie viele Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung in den besetzten Ländern ursprünglich lebten, auf unsicheren Schätzungen aus den 1930er Jahren. Zum anderen war es die Definition des Judentums selbst, die die Statistiken verfälschen musste. Während die Nationalsozialisten Juden als Rasse definierten und eine jüdische Abstammung reichte, um Menschen willkürlich in den Tod zu schicken, selbst wenn sie praktizierende Christen waren, wiesen manche der Statistiken nur die Summe der Menschen aus den jüdischen Gemeinden auf, also die Anzahl der Glaubensjuden.
Ebenso unsicher wie die Berechnung der Differenz zwischen der einstigen Verbreitung des Judentums und der Zahl der Überlebenden ist die Berechnung als Summe der Tötungsmeldungen an das Reichssicherheitshauptamt. Viele kleinere Mordaktionen wurden nie gemeldet, viele Meldungen gingen in der Endphase des Krieges verloren oder wurden vernichtet, viele gefallene Soldaten der gegnerischen Truppen, viele zivile Opfer des Krieges und viele getötete Partisanen waren Juden, wurden aber nicht als solche gemeldet.
Abgesehen davon, dass es weder gesicherte Bevölkerungsstatistiken gab noch die Tötungsmeldungen verlässlich waren, scheitern beide Berechnungsmethoden allein schon, weil die deutschen Einsatztruppen willkürlich alles töteten, was im Verdacht stand, jüdisch zu sein.
Aber spielen Zahlen eine Rolle? Millionen Menschen – Mütter und Väter, Großeltern und Kinder, selbst Säuglinge – mussten sterben. Ganze Gemeinden wurden ausgelöscht. In Polen und den drei baltischen Staaten wurden, soweit diese unsicheren Berechnungen erkennen lassen, rund 90 Prozent aller dort lebenden Juden umgebracht. In den Niederlanden, der Slowakei, Ungarn, Griechenland und den Staaten des späteren Jugoslawiens waren es im Schnitt 80 Prozent. In Belgien, Rumänien und den besetzten Gebieten Norwegens wurde im Schnitt jeder zweite Jude getötet, in Frankreich jeder vierte, in Italien jeder fünfte.
Und in Russland, dort, wo Artur Wilke den Massenmord mit organisierte und selbst tötete? Hier waren – nach Polen – sicher die meisten Opfer zu beklagen. Das Reichssicherheitshauptamt ging von fünf Millionen im Westteil der Sowjetunion lebenden Juden aus – also vom Baltikum bis zur Krim, Bessarabien und Nordbukowina. Davon rund eine Million im annektierten Ostteil Polens sowie zwei Millionen in den Gebieten, die deutsche Truppen besetzten. Aber niemand weiß, wie viele Menschen rechtzeitig ins Innere der Sowjetunion fliehen konnten. Anders als in den westlichen Ländern wurden die russischen Juden meist gar nicht erst deportiert und in Konzentrationslagern zusammengefasst, sondern binnen kürzester Zeit ganz in der Nähe ihrer Heimat bei Massenexekutionen getötet. 700000 bis eine Million sollen es gewesen sein.
Jenseits jeder Statistik bleibt der Fakt: Die Vernichtung der europäischen Juden war der erste und einzige staatlich angeordnete Versuch der industriell organisierten Massentötung einer ganzen »Rasse«. Als solche jedenfalls definierten die Nazis Menschen, die jüdischen Glaubens waren oder auch nur von Vorfahren jüdischen Glaubens abstammten.
Überlebende. – Wenn es keine Erzählung sein darf, dann eben ein Zitat. Hier eine Zeugenaussage: Die Jüdin Esther Rubinstein, die die Räumung des Lagers Poniantow überlebte. So, wie diese Überlebende es beschreibt, ging es bei den Aktionen der SS-Einsatzkommandos in Minsk zu. Man muss sich nur Artur Wilke, Georg Heuser, Franz Stark und die anderen Angeklagten des 20 Jahre später in Koblenz stattfindenden Prozesses in der Rolle jener vorstellen, die auf dicht vor ihnen am Rande einer Grube stehende Menschen schossen und ihre abgestumpfte, entmenschlichte, an unsägliche Brutalität gewöhnte Mannschaft aus deutschen SS-Leuten und ukrainischen Freiwilligen auf die wehrlosen Opfer hetzten. Dann ist das auch nicht die reine Wahrheit, aber es bleibt authentisch:
»Ende Oktober 1943 fand ein Gemeinschaftsappell statt. Wir bekamen den Befehl, Gräber auszuheben. Unter Peitschenschlägen der SS-Männer arbeiteten wir vom Morgen bis in die Nacht, um die Arbeit schnell zu beenden. Es war zehn Tage vor der Exekution. (…) Die Deutschen sagten uns, dass es sich um Fliegergräben handele, und um uns irrezuführen, befahlen sie, die Gräben im Zick-Zack zu graben, und wir wiegten uns in der Hoffnung, dass man uns am Leben lassen werde. Am Donnerstag, den 4. November, um 4.30 Uhr (…) wurden alle auf den Platz getrieben. (…) Man sprach davon, es komme eine Selektion. Jeder bemühte sich, gut auszusehen. Die Frauen kniffen sich in die Backen (…). Es sammelten sich ungefähr 40000 Menschen (spätere Erkenntnisse sprechen von 8000 bis 10000 Personen). (…) Um uns herum war es voll von Militär mit Waffen in den Händen. Auf der Straße war ein furchtbares Gewirr. Etwas weiter sah ich einen Haufen Schuhe und hörte, wie sie riefen »Schuhe ausziehen!«. Von da ab lief ich barfuß weiter. Ich wurde ganz irre. In der Ferne sah ich nackte Frauen, ich dachte, es sei eine Selektion. Ich kam näher und hörte schreien, wir sollten uns ausziehen. Sie befahlen, Gold, Brillanten und Geld abzugeben. Ich suchte ständig nach Rettung (…). Es gelang mir, mich unter die Männer zu mischen, die Kleider sortierten. (…) Mütter nahmen Abschied von ihren Kindern, alle wussten inzwischen, dass es in den Tod geht und dass es keinen Ausweg mehr gibt. Alle gingen gefasst, und keiner weinte. Die Menschen gingen mit Musik, denn die Deutschen hatten zu diesem Feiertag Radiolautsprecher angebracht. (…) Ich sprang vor den Augen der Soldaten durch ein Fenster in die Baracke, in die die Kleidungsstücke hineingeworfen wurden. Schlagend und an den Haaren ziehend holte man mich zurück. Ich wusste kaum noch, was mit mir geschah. Ich weiß nur noch, dass man uns an die Gräben trieb, und ich sah, dass an den Gräben SS-Männer mit Maschinenpistolen standen und die nackten Frauen in den Kopf schossen. Die Gräben waren schon voll von Leichen. Ich wollte nicht zusehen, wie man mich erschießt, daher hielt ich mir die Hände vor das Gesicht und warf mich mit dem Schrei ›Schma Israel‹ (›Höre, Israel‹, ein jüdisches Glaubensbekenntnis) in die Tiefe. In diesem Augenblick verspürte ich einen Schmerz und wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, ich weiß nur, dass mir kalt wurde, und ich wühlte mich in die Leichen ein. Ich hörte Stöhnen der noch lebenden Menschen. Ein paarmal wollte ich schreien, aber ich konnte es nicht, es war, als ob mir jemand die Kehle zuschnürt. Plötzlich spürte ich, wie jemand meinen Kopf hochhob. Ich lag an der Oberfläche, und ein Deutscher prüfte, ob ich tot sei. Da mein Kopf vom Blut anderer Leichen überströmt war, dachte er, ich sei tot und ging weiter. Ich hörte, wie sie herumgingen und totschlugen. Ich hörte das Ächzen von Frauen, und eine rief um Hilfe. Man zog sie unter den Leichen vor und schlug sie tot. Später kamen noch mehr. Sie liefen auf uns herum und deckten uns mit Tannen zu. Ich hörte das Orchester und verschiedene Schreie. Unter Ächzen und Schmerzen schlief ich ein. Plötzlich kam ich wieder zu mir, und als ich mit Mühe den Kopf hob, wusste ich zuerst nicht, wo ich mich befinde. Ich sah ein großes Flammenmeer. In diesem Moment erinnerte ich mich der Erzählung meines Bruders, dass die Deutschen Menschen lebendig verbrennen. (…) Ich begann, auf dem Bauch über die Leichen hinwegzukriechen und entkam über das Feld in den Wald. Im Wald traf ich eine zweite nackte Frau wie mich. Wir sahen uns schweigend an und krochen weiter.«
Das Zitat stammt aus dem Buch »Die Gehilfen« von Barbara Just-Dahlmann und ihrem Mann Helmut. Sie war als Staatsanwältin und polnischsprechende Dolmetscherin dabei, als im April 1960 in der gerade gegründeten Zentralen Stelle in Ludwigsburg die Akten aus Polen eintrafen. Aktenberge voller Leichenberge, Grausamkeiten unvorstellbaren Ausmaßes. In einen Abgrund, schreibt Just-Dahlmann, habe sie geschaut – und das Gelesene nie vergessen. Danach setzte sie sich ein für die Strafverfolgung, vor allem aber für ein Aussetzen der drohenden Verjährung.
Friseure. – Stark war dann bald weg vom Fenster. Wilkes anbefohlenes Vorbild war, schon wenige Tage nachdem sich beide kennengelernt hatten, in Ungnade gefallen. Stark hatte wahr gemacht, was die Kameraden vorher nur halb im Ernst angedroht hatten: dem Judenfreund Kube mal eins austeilen.
Ausgangspunkt war die Getto-Aktion am 1. März gewesen. Tausende Juden waren quer durch die Stadt getrieben und in Eisenbahnwaggons zur Erschießungsstätte bei Koidanow gebracht worden. Generalkommissar Kube hatte Wind davon bekommen und sich am Nachmittag mächtig aufgeregt. Mit SS-Obersturmführer Burkhardt hatte es einen Wortwechsel gegeben, weil Kube dessen Leuten Rücksichtslosigkeit, ja Brutalität vorwarf. Im Getto hätten sich regelrechte Jagdszenen abgespielt, es sei geschossen worden, Querschläger seien gar außerhalb des Gettos eingeschlagen. Der »Ton des Gauleiters (Kube war bis 1936 Gauleiter des Gaus Brandenburg gewesen) war außerordentlich scharf«, schrieb der Kommandoführer später in seinen Bericht. Seine Leute seien von Kube mit Vorwürfen überschüttet worden. Und Strauch, der neue SD-Kommandeur, nutzte den Vorfall, um seinerseits den missliebigen Gauleiter Kube eineinhalb Jahre später in Berlin schlecht zu machen: Der habe seine Männer »erheblich beschimpft« und es seien Worte wie »Schweinerei« gefallen. Und auch Strauch gab das, wie er schrieb, »nicht hundertprozentig verbürgte« Gerücht wieder, Kube habe »an jüdische Kinder Bonbons verteilt.«
Einer der Beschimpften vom 1. März war Franz Stark. Kube hatte ihn erwischt, als er wie beim Viehtrieb mit einer Peitsche auf die Juden einschlug, um sie zur Eile anzutreiben. Kube hatte gar eingegriffen, war Stark in den Arm gefallen und hatte versucht, ihm die Peitsche zu entreißen. »Schämen sie sich nicht, als SS-Führer mit einer Peitsche herumzustehen?«, soll Kube Stark angeschnauzt haben.
Stark sann auf Rache. Wie konnte er den so viel Ranghöheren besser treffen, als ihm seine liebsten jüdischen Schützlinge zu nehmen? Denn Kube galt als eitler Mann. In seinem Haus beschäftigte er gleich drei jüdische Friseure, einen Vater namens Steiner und dessen Söhne. Die drei Deportierten aus Wien frisierten seit Herbst 1941 alle Beschäftigten des Generalkommissariats, auch Kube selbst. Sie waren Stark schon vorher aufgefallen, als er in der Friseurstube zufällig entdeckt hatte, dass an den Kitteln der Friseure die gelben Sterne fehlten. Darauf angesprochen, erklärte der Friseur, Kube habe das erlaubt. Stark war umgehend zu Kube marschiert und hatte ihn zur Rede gestellt. Der räumte auch ein, die Erlaubnis erteilt zu haben, weil den deutschen Kunden nicht zuzumuten sei, ständig den Judenstern vor der Nase sehen zu müssen, wenn sie frisiert werden. Aber dass sie von Juden frisiert werden, konterte Stark, das sei in Ordnung!? Das sei ihm egal, habe Kube geantwortet. Er wolle, dass seine Frauen und Mädchens schön aussehen, da brauche man eben gute Friseure.
Starks Schluss daraus: Kube mussten die Wiener Coiffeure am Herzen liegen – ideale Objekte für eine persönliche Rache. Einem wie ihm, Stark, einem Nationalsozialisten der ersten Stunde, fällt keiner in den Arm, schon gar nicht auf offener Straße und vor den Augen jüdischer und russischer Zeugen. Noch in der Nacht nach dem Anschiss marschierte Stark mit einem weiteren SS-Mann in das Getto, ließ sich von einem Wachhabenden die Wohnung der drei Steiners zeigen und erschoss alle drei. Vermutlich – klären ließ sich das später nicht mehr – wurden die drei Juden zuvor noch verprügelt.
Als Kube tags darauf hochoffiziell nach seinen vermissten Friseuren suchen ließ und gar den Minsker Landrat zur SD-Dienststelle schickte, um über deren Schicksal etwas zu erfahren, trat Stark dreist die Flucht nach vorn an: Er meldete sich bei Kube, räumte die Tötung der drei Juden ein und muss dem Generalkommissar unter vier Augen noch einiges andere erklärt haben. Was? Wir wissen es nicht. Spürbare Folgen blieben zunächst aus. Kube belangte Stark nicht, sorgte nur dafür, dass er im Mai 1942 die Dienststelle Minsk verlassen musste.
Erst 20 Jahre später sollte die Friseur-Geschichte im Landgericht ernste Folgen haben. Auch wenn Stark in Koblenz mal bestritt, mal einräumte, mal nur einen Friseur verprügelt, dann wieder alle drei mit nach draußen genommen und nur geschlagen haben wollte – am Ende war er des Mordes überführt. Denn schließlich hatte der damalige SD-Kommandeur schon Tage nach der Tat den Tod der »drei Friseure des Gauleiters« und Starks Beteiligung daran zu Protokoll genommen. Die Rache an einem verhassten Vorgesetzten, indem dessen Schützlinge erschossen wurden, war kaltblütiger Mord. Die einzige Mordtat übrigens, auf die das Landgericht erkannte. Alle anderen Tötungen wurden nur als Beihilfe beurteilt. Über eine Verjährung der Taten Starks musste in Koblenz also nicht lange nachgedacht werden. Für ihn gab es »lebenslänglich«.
Verjährung. – Es waren nur noch wenige Tage Zeit. Die damalige Rechtslage begünstigte die Mörder, Totschläger und Folterknechte des NS-Regimes. Für Mord galt seit 1871 in Deutschland eine Verjährung von 20 Jahren, für Verbrechen mit einer Höchststrafe von zehn Jahren Haftandrohung galten 15 Jahre Verjährungsfrist, für alle anderen nur zehn Jahre. Nun waren die Taten der SS und auch der Wehrmacht aber im sogenannten Dritten Reich nicht verfolgt worden. Deshalb herrschte Einigkeit, dass erst am Kriegsende, ab 8. Mai 1945, dem Datum der Wiederherstellung angeblich rechtsstaatlicher Bedingungen, die Verjährungsfrist zu laufen begonnen hatte. Das hieß: Schon am 9. Mai 1960 sollten Taten mit einer Höchststrafandrohung von zehn Jahren verjährt sein. Alle Delikte außer Mord und Totschlag wären mit einem Schlag nicht mehr strafbar, niemand hätte die Folterer, die Vergewaltiger, die Helfer der Verbrechen mehr verfolgen können.
Es folgte ein fast 20 Jahre währender parlamentarischer Streit um die Verjährung, der in zwei Parlamentsdebatten vom 13. März 1965 und vom 26. Juni 1969 seine Höhepunkte erreichte. Sie gelten als »Sternstunde des Parlaments«, stellte der namhafte Politologe Peter Reichel später fest. Zunächst gelang es 1960 der SPD-Fraktion mit einem Gesetzesantrag nicht, den Beginn der Verjährungsfrist neu festzulegen. Die rechtsstaatliche Strafverfolgung sollte erst mit dem Stichtag 16. September 1949 wieder möglich gewesen sein, weil zuvor die Strafverfolgungsbehörden im zerschlagenen Deutschland noch gar nicht arbeitsfähig waren. Der Antrag scheiterte ohne Aussprache im Rechtsausschuss. Justizminister Fritz Schäffer (CDU) machte Bedenken geltend und behauptete, es seien »alle bedeutsamen Massenvernichtungsaktionen der Kriegszeit systematisch erfasst und weitgehend erforscht«. Welch ein Irrtum – oder eine Lüge. Statt »nur noch wenige Nachzügler-Prozesse« zu führen, so wie der Justizminister behauptete, begann die Aufarbeitung nach 1960 überhaupt erst. Zum Beispiel 1962 im Heuser-Prozess, danach im Auschwitz-Prozess.
Doch Schäffer hatte sich durchgesetzt: Alle Taten wie etwa Körperverletzung mit Todesfolge verjährten im Sommer 1960. Und fünf Jahre später sollten dann auch die Mordtaten der Nazis verjähren. Sie galten ja nicht als Mord, sondern für die, die nicht in Nürnberg schon verurteilt worden waren, die also angeblich nur Befehle empfangen hatten, nur als Beihilfe.
Politisch befeuert haben die weitere Debatte die DDR und die Sowjetunion. Das sollte beim Heuser-Prozess in Koblenz erstmals deutlich werden. Dort wurden im laufenden Verfahren neue Beweise vorgelegt. Und auch immer wieder neue Enthüllungen der DDR, die belastendes Material gegen Politiker, hohe Beamte oder Richter der Bundesrepublik lancierten, sorgten international für Druck. 1962 etwa wurde auf diesem Wege bekannt, dass Generalbundesanwalt Wolfgang Fränkel in der Nazizeit an mindestens 30 Todesurteilen beteiligt war. Israel und die USA drängten nach solchen Enthüllungen auf eine vertiefte Aufarbeitung der Massenmorde.
Just-Dahlmann, die SPD-Parlamentarier und alle, die weiterkämpften, hatten letztlich doch Erfolg. Mit dabei Ernst Benda (CDU) und weitere 49 CDU-Abgeordnete, die im Januar 1965 den Antrag stellten, die Verjährung für Mord auf 30 Jahre zu verlängern. Die SPD wollte die Verjährung für Mord und Völkermord sogar ganz abschaffen. Erneut nur Wochen vor dem Ende der Verjährungsfrist dann jene historische Debatte. Am 23. März 1965, zehn Tage nach der Parlamentsaussprache, erhielt ein Kompromissvorschlag eine Mehrheit. Jetzt sollte die Verjährungsfrist erst mit Ende des Jahres 1969 beginnen.
Die Folge: Auch jene NS-Täter, die bis dahin noch unentdeckt geblieben waren, mussten weiter bangen – vorerst bis 1969. Und zugleich hatte das deutsche Parlament damit ein historisches Schuldbekenntnis abgegeben. So wie Thomas Dehler (FDP) wörtlich in der Debatte: »Jeder von uns, der damals Verantwortung getragen hat, hat das Empfinden, dass er zuwenig für das Recht gekämpft hat, dass er zuwenig Mut zur Wahrheit gehabt hat, nicht stark genug war für die Macht des Bösen.«
Noch zwei Verjährungsdebatten beschäftigten den Bundestag. Am 26. Juni 1969 wurde eine generelle Verjährungsfrist bei Mord auf 30 Jahre festgelegt. Am 29. März 1979 kam dann der Durchbruch, wie ihn die SPD schon 1965 gefordert hatte: Wegfall der Verjährungsfrist bei Mord. Das gilt noch heute.
Jede dieser Debatten fand auf den letzten Drücker statt. Spät, letztlich nicht zu spät, fielen die Entscheidungen.
Konrad. – Und du? Du wartest ebenfalls, bis es fast zu spät ist. Verjährt vor dem eigenen Gewissen? Mit Konrad wolltest du über Wilke sprechen. Konrad, mit dem du als katholischer Schüler so viele Stunden kniend vor dem Altar als Messdiener, zu Gast in der evangelischen Kirche, und so viele Nachmittage im katholischen Religionsunterricht verbracht hast. Konrad lebt nicht mehr. Er hätte dein Zeuge sein können – Zeitzeuge des Schweigens. Ein Flüchtlingskind wie du. Zur Weihnachtsfeier beim Flüchtlingsverein, später Bund der Vertriebenen, dessen Ortsvorsitzender dein Vater war, durften Konrad und du schlesische Gedichte aufsagen: »Gruußes Schlachtfest war gewaast …« oder etwas über die »Schniikoppe, die der Zupten ne’ aale Gaake gehießa hot«. Was ihr bei diesen Feiern aus der Vergangenheit aufschnapptet, hatte stets mit der Flucht zu tun, mit Entbehrungen der Vertriebenen, mit von Russen erschossenen Großvätern und mit denen, die überlebt hatten und nun in der Fremde leben mussten.
Alles Opfer, kein Wort von deutschen Tätern. Der Krieg kam gar nicht vor, wenn sich die Vertriebenen trafen, nur dessen Folgen: das Elend der Flucht, der Verlust der Heimat, die Schikane durch jene, die Flüchtlinge hatten aufnehmen müssen. Auch die Missgunst der Einheimischen gegenüber Lastenausgleich und staatlichen Krediten für den Bau neuer Siedlungshäuser. »Hatten wohl alle ein Rittergut«, war so ein spöttischer Satz, den du als Kind über deine Eltern und ihre Freunde vom Flüchtlingsverein aus den Mündern der Einheimischen hast hören müssen. Dein Vater hat noch Jahrzehnte gestaunt, dass du, das Flüchtlingskind, mit den alteingesessenen Bauernsöhnen befreundet warst. Auch Konrads Eltern waren fleißige Neusiedler. Fünfzig Jahre lang hättest du ihn fragen können, wie das war mit der Verhaftung eures Lehrers – und hast gewartet, bis es zu spät ist.
Vielleicht hätte sich Konrad an die Verhaftung erinnert, bestimmt aber daran, dass das Wort »Judenmord« nur dann fiel, wenn man sich im Flüchtlingsverein empört gegen die »Auschwitz-Lüge« verteidigte. Das könne ja gar nicht sein, da hätte man doch was von mitkriegen müssen!? Das sei doch alles eine Lüge. Und über allem hing die Landkarte mit Deutschland in den Grenzen von 1937 und dem Text: »Dreigeteilt – niemals!«
Mit allen deinen Klassenkameraden wolltest du über euren ersten Lehrer sprechen. So viele, die an deiner Seite in die Kamera des Einschulungsfotografen lächeln, leben nicht mehr. Von einigen kannst du dir sicher sein, dass sie nie erfahren haben, was der Nationalsozialismus bedeutete. Und schon gar nicht, welche Rolle euer Lehrer dabei spielte. Zum Beispiel Wolfgang, dein damals bester Freund. Kaum aus der Schule – er in der Lehre, du in der Handelsschule –, habt ihr euch aus den Augen verloren. Eines Nachts stand er vor dem Fenster deines selbstgebastelten Partykellers und verlangte nach Hilfe. Ob du was hättest, irgendwas? Als du ahnungslos reagiertest, wollte er Hustensaft, Schmerztabletten, irgendwas mit Codein vielleicht. Wochen später war er verschwunden. Irgendwann ging die Kunde, er habe sich in Berlin am Bahnhof Zoo den Goldenen Schuss gesetzt. Wieder so ein Klischee aus jener Zeit: Drogen, Berlin, Bahnhof. Gerade hatte der Stern über die »Kinder vom Bahnhof Zoo« geschrieben. Du hättest vielleicht die Wahrheit erfahren, wenn du es hättest wissen wollen. Aber du hast nicht gefragt. Seitdem ist das Klischee über den Tod des Freundes dir zur Wahrheit geworden.
Auch viele andere, die das Klassenfoto zeigt, kannst du nicht mehr befragen: Dirk oder Günter. Beide Opfer des Krebses. Ebenso Louis und Cornelia. Auch Ingrid, die sich das Leben nahm, ohne dass du dich je gefragt hast, warum. Ebenso die andere Ingrid, nach der Schule Bauersfrau und Jägerin. Sie kam mit ihrer Jagdflinte an einem Schützenfest-Sonntag dem qualvollen Ende ihrer schrecklichen Krankheit zuvor. Helmut ist bei der Heimfahrt von der Bundeswehr ein Rübenanhänger in die Quere gekommen. Konrad von der Mühle starb ausgerechnet auf dem Weg zur Hochzeitsfeier seiner Nichte. Woran der andere Helmut gestorben ist, weißt du bis heute nicht.
Aktionen. – Wilke hatte den Tod täglich vor Augen. Jetzt war er schon vier Wochen in Minsk – in hervorgehobener Position, dem Kommandeur direkt unterstellt, bei Einsätzen dem jeweiligen Kommandoführer aber doch untergeben. Eigentlich zuständig für den Kontakt mit den Kirchenvertretern im besetzten Weißruthenien, dem künftigen deutschen Lebensraum. Aber das war Theorie. Mehrmals war er schon von Heuser eingeteilt worden. Es war wärmer geworden, die Böden nicht mehr so hart gefroren. Jetzt könne »es endlich rund gehen«, hatte Stark gesagt. Schließlich müsse man »aufräumen, was die Einsatzkommandos letztes Jahr liegen gelassen haben«.
Liegen gelassen? Wilke wusste inzwischen, was gemeint war. So hatte er sich das nicht vorgestellt; nun war es Realität, an der er mitwirkte: »Endlösung der Judenfrage«. Und zwar durch physische Vernichtung. Das »jüdische Problem« sollte sich nach Himmlers Vorstellung »nie wieder stellen«. Deshalb war der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung schon vor dem Überfall auf die Sowjetunion akribisch geplant worden. In zwei Phasen sollten die Juden in den besetzten Gebieten regelrecht ausgerottet werden. Schon mit der ersten Angriffswelle sollten mobile Einsatzkommandos von SS und Sicherheitspolizei die besetzten Dörfer und Städte durchkämmen und die jüdischen Bewohner aussondern und unauffällig exekutieren.
Dafür war das im Oktober 1939 ins Leben gerufene Reichssicherheitshauptamt unter Führung von Reinhard Heydrich zuständig. Der war als Himmlers Stellvertreter sowohl Kommandeur der Sicherheitspolizei als auch Chef von Geheimer Staatspolizei und Kriminalpolizei. Elf Monate vor dem Überfall war der Mord an den Juden also schon beschlossene Sache und wurde mit deutscher Gründlichkeit geplant. Doch erst kurz vor dem 22. Juni 1941, dem Beginn des Russlandfeldzugs, akzeptierten Wehrmacht und Heer die Eingliederung der neu aufgestellten Tötungseinheiten in ihre Verbände. Im Mai 1941 einigte man sich, dass diese Einsatzgruppen nicht nur im rückwärtigen Heeres- und Armeebereich, sondern sogar dort, wo die Truppen noch kämpften, also direkt an der Front, zum Einsatz kommen sollten. Die Juden sollten nicht gewarnt und ihnen so jede Fluchtmöglichkeit genommen werden.
Als das Heer vorrückte, folgten vier Einsatzgruppen (A, B, C, D) auf den Fuß, jeweils in Bataillonsstärke. Insgesamt also rund 3000 Mann. Sie gliederten sich in jeweils vier bis sechs Einsatz- und Sonderkommandos in Kompaniestärke. An deren Spitze standen meist junge Offiziere – karrierebewusst, glühende Nationalsozialisten, meist Akademiker wie Wilke, die nach Macht und Ruhm strebten. Die Mannschaften kamen aus Sicherheitspolizei und SS, aber auch ein ganzes Bataillon der Ordnungspolizei aus Berlin war abkommandiert worden, weil Heydrich um die Schlagkraft der Kommandos fürchtete. Mit angeworbenen Esten, Letten, Litauern und Ukrainern wurden die Kommandos verstärkt.
Auch wenn nach außen hin der Kampf gegen Partisanen und kommunistische Führer vorgeschoben wurde – den Kommandos war die Aufgabe klar: die Beseitigung der jüdischen Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder. Dabei soll Heydrich im Kreis von SS-Führern in einer Zusammenkunft in Berlin kein Blatt vor den Mund genommen haben: »Wir sollen die Juden erschießen?«, habe einer der Gestapo-Leute zweifelnd gefragt. Heydrichs Antwort: »Selbstverständlich!«
Doch die erste Tötungswelle, so überfallartig, blutig und grausam sie war, verlief aus Sicht der Mörder weniger erfolgreich als geplant. Gewusst, aber unterschätzt hatte man, dass sich die jüdischen Gemeinden überwiegend in den Städten konzentrierten (fast zu 90 Prozent), dass diese länger und hartnäckiger verteidigt wurden und viele der Verfolgten hatten fliehen können oder ihre schiere Vielzahl eine sofortige Exekution unmöglich machte. Etwa in Odessa, wo mehr als jeder dritte Bewohner Jude war und deren Zahl mit 153 000 angegeben wurde. In Kiew waren es 140000, in Lemberg 99600 und in einer Stadt wie Chisinau, wo die Juden mit 60 Prozent gar in der Mehrzahl waren, immerhin noch 80000.
Bis zu fünf Millionen Juden lebten 1941 in der Sowjetunion und den sogenannten Puffergebieten, davon vier Millionen in jenen Regionen, die von deutschen Truppen überrannt und besetzt wurden. Allein in Polen waren es 1,35 Millionen, im Baltikum etwa 260 000, in Bessarabien und der Bukowina rund 300 000. Die ukrainischen Juden zählten allein gut 1,5 Millionen, die in Weißrussland 375000 sowie weitere 50 000 auf der Krim.
Auf die Urbanisierung der Juden hatten sich die Einsatzgruppen eingestellt. Deshalb wurden die jüdischen Stadtteile schon beim ersten Einrücken deutscher Truppen eingekesselt. Dennoch, so weiß man heute, hatten rund 1,5 Millionen Juden vor dem ersten Zugriff fliehen können. Die Einsatzgruppe C etwa meldete am 12. September 1941 nach Berlin: »Bei den Juden scheint sich auch jenseits der Front herumgesprochen zu haben, welches Schicksal sie bei uns erwartet.« Es sei aufgefallen, »dass sich (…) viele jüdische Gemeinden zu 70 bis 90 Prozent, einige gar zu 100 Prozent abgesetzt« hatten.