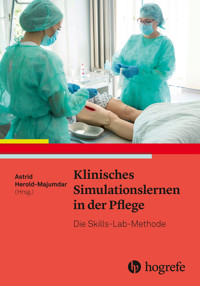
Klinisches Simulationslernen in der Pflege E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die praktische Pflegearbeit mit Patient_innen erfordert gut ausgebildete klinische Fertigkeiten und Skills, die vor der Umsetzung am Patientenbett in simulierten Lernsituationen erlernt werden -sollten. Das klinische Simulationslernen ist ein integraler Bestandteil der hochschulischen und beruflichen Ausbildung. Mit der Reform des Pflegeberufegesetzes und den generalistischen Ausbildungsgängen sind Lehrkonzepte für die praktische Ausbildung bedeutsamer geworden. Die Autorinnen des Praxisbuchs für klinisches Simulationslernen: •beschreiben die pflegefachlichen, evidence-basierten Hintergründe und die didaktisch-pädagogischen Grundlagen des Simulationslernens in der fachpraktischen Pflegeausbildung stellen die Entwicklung evidence-basierter Szenarien und deren methodischen Elementen mit Kurzanleitungen vor gliedern jedes Szenarium bezüglich des theoretischen Hintergrunds, den Anforderungen und Zielsetzungen, des Designs, der vermittelten Simulationserfahrungen, des Briefings/ Debriefings, der Lehr-/Lernziele und der verwendeten Literatur liefern evidence-basierte Szenarien für die Pflegeberatung von älteren Menschen mit Diabetes mellitus, zur Kontrakturenprophylaxe älterer Menschen, für die enterale Sondenernährung von Früh- und Neugeborenen sowie den aseptischen Verbandwechsel zentralvenöser Katheter und verbale Deeskalationsstrategien in der Notaufnahme stellen für die Kurzanleitungen alle notwendigen Materialien, Requisiten, Handlungsbewertungslisten, Drehbücher, Ereigniskarten und Hinweise zusammen. "Vom Dummy zum Profi": Pflegerische Handlungskompetenzen mit der Methode des Simulationslernens systematisch erwerben. Pflegerische Fertigkeiten und Skills gekonnt und sicher an und mit Patient_innen ausführen in Skills-Labs und Pflegepraxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Astrid Herold-Majumdar
(Hrsg.)
Klinisches Simulationslernen in der Pflege
Die Skills-Lab-Methode
Unter Mitarbeit von
Selina Baumann
Kathrin Hofmann
Julia Kämmer
Debora Küllsen
Valentina Müller
Klinisches Simulationslernen in der Pflege
Astrid Herold-Majumdar
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur, Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Astrid Herold-Majumdar (Hrsg.) Prof. Dr. rer. medic., MScN (Universität Halle-Wittenberg), Dipl. Pflegewirtin (FH), TQM-Auditorin, Krankenschwester; Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften. Mitbegründerin und Prüfungskommissionsvorsitzende des Bachelor Angewandter Pflegewissenschaft (B.Sc. Pflegefachfrau/-mann)
Campus Pasing, Am Stadtpark 20, DE-81243 München
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z. Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Rita Madathipurath, Caroline Suter
Redaktionelle Bearbeitung: Martina Kasper
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Astrid Herold-Majumdar
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2023
© 2023 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96226-9)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76226-5)
ISBN 978-3-456-86226-2
https://doi.org/10.1024/86226-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Dank
Vorwort
Literatur
1 Simulationslernen in der fachpraktischen PflegeausbildungAstrid Herold-Majumdar
1.1 Literatur
2 Das klinische Simulationslabor als ExperimentariumAstrid Herold-Majumdar
2.1 Literatur
3 Entwicklung evidence-basierter Szenarien (Methodik)Astrid Herold-Majumdar
3.1 Literatur
4 Szenarien mit KurzanleitungAstrid Herold-Majumdar
4.1 Pflegeberatung für ältere Menschen mit Diabetes mellitus Julia Kämmer
4.1.1 Bezugsrahmen und theoretischer Hintergrund
4.1.2 Anforderungen und Zielsetzung des Szenarios
4.1.3 Design und Simulationserfahrung
4.1.4 Briefing
4.1.5 „Opa hat genug vom Zucker“
4.1.6 Debriefing
4.1.7 Lern-/Lehrzielerreichung
4.1.8 Literatur
4.2 Kontrakturprävention bei älteren, pflegebedürftigen MenschenValentina Müller
4.2.1 Bezugsrahmen und theoretischer Hintergrund
4.2.2 Anforderungen und Zielsetzung des Szenarios
4.2.3 Design und Simulationserfahrung
4.2.4 Briefing
4.2.5 „Morgengymnastik mit Helene Fischer“
4.2.6 Debriefing
4.2.7 Lehr-/Lernzielerreichung
4.2.8 Literatur
4.3 Enterale Sondenernährung in der NeonatologieDebora Küllsen
4.3.1 Bezugsrahmen und theoretischer Hintergrund
4.3.2 Anforderungen und Zielsetzung des Szenarios
4.3.3 Design und Simulationserfahrung
4.3.4 Briefing
4.3.5 „Baby Leo hat Hunger“
4.3.6 Debriefing
4.3.7 Lern-/Lehrzielerreichung
4.3.8 Literatur
4.4 Aseptischer Verbandswechsel zentralvenöser KatheterKathrin Hofmann
4.4.1 Bezugsrahmen und theoretischer Hintergrund
4.4.2 Anforderungen und Zielsetzung der Simulationseinheit
4.4.3 Design und Simulationserfahrung
4.4.4 Briefing
4.4.5 Simulation „Bitte nicht berühren!“
4.4.6 Debriefing
4.4.7 Lern-/Lehrzielerreichung
4.4.8 Literatur
4.5 Verbale Deeskalationsstrategien in NotaufnahmenSelina Baumann
4.5.1 Bezugsrahmen und theoretischer Hintergrund
4.5.2 Anforderungen und Zielsetzung des Szenarios
4.5.3 Design und Simulationserfahrung
4.5.4 Briefing
4.5.5 „Jetzt bin ich aber erst dran!“
4.5.6 Debriefing
4.5.7 Lern-/Lehrzielerreichung
4.5.8 Literatur
5 Diskussion und Entwicklung der LehreAstrid Herold-Majumdar, Selina Baumann, Kathrin Hofmann, Julia Kämmer, Debora Küllsen und Valentina Müller
5.1 Literatur
6 Praktische Hilfen für die tägliche LehrpraxisAstrid Herold-Majumdar
6.1 Zusammenfassung zu Kapitel 4.1Julia Kämmer
6.1.1 Kurzanleitung
6.1.2 Material und Requisiten
6.1.3 Handlungsbewertungsliste
6.1.4 Labor-Kit
6.1.5 Szenariospezifische Lehrmaterialien
6.1.6 Literatur
6.2 Zusammenfassung zu Kapitel 4.2Valentina Müller
6.2.1 Kurzanleitung
6.2.2 Material und Requisiten
6.2.3 Handlungsbewertungsliste
6.2.4 Labor-Kit
6.2.5 Szenariospezifische Lehrmaterialien
6.2.6 Literatur
6.3 Zusammenfassung zu Kapitel 4.3Debora Küllsen
6.3.1 Kurzanleitung
6.3.2 Material und Requisiten
6.3.3 Labor-Kit
6.3.4 Übergabedialog
6.3.5 Drehbuch
6.3.6 Handlungsbewertungsliste
6.3.7 Ereigniskarten
6.3.8 Hinweise
6.3.9 Literatur
6.4 Zusammenfassung zu Kapitel 4.4Kathrin Hofmann
6.4.1 Kurzanleitung
6.4.2 Material und Requisiten
6.4.3 Handlungsbewertungsliste
6.4.4 Labor-Kit
6.4.5 Beispielhafter Handlungsablauf
6.4.6 Ereigniskarten
6.4.7 Hinweise
6.4.8 Literatur
6.5 Zusammenfassung zu Kapitel 4.5Selina Baumann
6.5.1 Kurzanleitung
6.5.2 Material und Requisiten
6.5.3 Handlungsbewertungsliste
6.5.4 Labor-Kit
6.5.5 Szenariospezifisches Lehrmaterial
6.5.6 Literatur
NachwortPatrick Muijsers
Autorinnenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
|9|Dank
Basis einer guten professionellen Pflege ist eine wissenschaftlich fundierte und gute praktische Ausbildung sowie eine Lehrperson mit großem Engagement. Neben Fachwissen und didaktischer Kompetenz gehört dazu auch die Fähigkeit, den Lernenden in Simulationsszenarien mit Einfühlungsvermögen zu begegnen. Diese Eigenschaften zeichnen Frau Prof. Herold-Majumdar aus, weshalb wir ihr unseren Dank in diesem Buch widmen.
Bereits während des Studiums hat sie uns mit ihrer Expertise bereichert, gefordert und immer wieder aufs Neue zu kritischem Denken angeregt. Es hat uns großen Spaß gemacht, geleitet von und gemeinsam mit ihr die Versorgung pflegebedürftiger Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken und dabei stets ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, bestmögliche professionelle Pflege zu gewährleisten und voranzubringen.
Frau Prof. Herold-Majumdar hatte die Idee, mit uns als Mitautorinnen dieses Buch zu schreiben – für uns das absolute Neuland. Mit ihrem Mut und ihrer Energie hat sie uns zur Mitarbeit motiviert und durch dieses Buchprojekt geleitet.
Vielen herzlichen Dank für alles, Astrid!
Julia, Valentina, Debora, Kathrin und Selina
|11|Vorwort
Wir können dankbar sein, dass sich junge oder in einer zweiten Berufslaufbahn nicht mehr so junge Menschen für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege entscheiden. Was gibt es Schöneres als zu wissen, dass das eigene Fach mit samt den Haltungen, dem Wissen und den Erfahrungen aus der jahrhundertelangen Geschichte der Pflege weitergetragen und weiterentwickelt wird.
Wir Lehrende leiten Nachwuchskräfte an, schulen sie und sind dafür verantwortlich, dass wir ihr Potenzial ausschöpfen, ohne sie zu erschöpfen. Vielmehr müssen wir den Lernenden das Rüstzeug mitgeben, dass sie sich selbst pflegen, betriebliche Gesundheitssorge einfordern und möglichst ein Berufsleben lang gesund bleiben. Als Vertrauenspersonen, die Berufsanfängerinnen und Anfänger behutsam und einfühlsam begleiten, stärken und ermutigen wir sie, ihren eigenen Weg in der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen zu finden. Unsere Haltung, unser Selbstverständnis und unser Wissen werden von den Lernenden stets kritisch überprüft. Dieser Prüfung müssen wir uns stellen, um das beste Wissen zur Sicherheit und zum Wohle der pflegebedürftigen Menschen weiterzugeben sowie das Fach weiterzuentwickeln. Wir ermutigen und ermächtigen die Lernenden, den Wissensbestand kritisch zu prüfen und halten es aus, nicht recht zu haben.
Fortschritt ist nur möglich, wenn wir der nachrückenden Generation Gestaltungsraum lassen. Das verlangt von uns Lehrenden Standhaftigkeit und Offenheit gegenüber der Erfahrung, dass man die Dinge auch anders sehen, interpretieren und lösen kann. Nicht zuletzt deswegen wird in diesem Buch empfohlen, das klinische Simulationslabor nicht nur als Trainingsraum, sondern als Experimentarium zu nutzen. Wir Anleitenden und Lehrenden sollten uns nicht mit dem Nachwuchs messen, dürfen uns aber reiben, denn aus Reibung entsteht Energie, die wir brauchen, um die Pflege weiterzuentwickeln.
Mit Absolventinnen des dualen Bachelorstudiengangs Pflege der Hochschule München habe ich es gewagt, dieses Buch zu verfassen. Es war kein großes Wagnis, denn die Autorinnen erwiesen sich als zuverlässige, hoch motivierte und wissenschaftlich gewissenhaft arbeitende Kolleginnen, die mich als Herausgeberin hervorragend unterstützt, ja mit ihren Qualifizierungsarbeiten das Buch erst möglich gemacht haben. Der Inhalt der Szenarien basiert auf den systematischen Literaturanalysen, die im Rahmen der Bachelorarbeiten durchgeführt wurden. Alle Abschlussarbeiten zeichneten sich durch ihre hervorragende Qualität aus. Die Arbeit von Julia Kämmer wurde sogar in der Kategorie Abschlussarbeiten des Healthademics Wettbewerbs 2020/21 von der AOK Rheinland/Hamburg ausgezeichnet.
Die Autorinnen waren während ihres Bachelorstudiums 2300 Stunden in der Pflegepraxis tätig und arbeiten aktuell als Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegerinnen in verschiedenen Einrichtungen der Pflege. Sie engagieren sich für eine professionelle und evidence-basierte Pflegepraxis in patientennahen Bereichen. Anders als vielfach angenommen, sind sie Beispiele für Absolventinnen eines primärqua|12|lifizierenden Pflegestudiengangs, die ihr ganzes Wissen und Können sowie ihre Leidenschaft zum Wohle der Patienten bzw. Patientinnen und pflegebedürftigen Menschen einsetzen. Wir wissen mittlerweile aus Studien (Baumann & Kugler, 2019), dass 78 Prozent und damit die große Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen von Pflegestudiengängen in der patientennahen Versorgung verbleiben, um dort die wissenschaftlichen Erkenntnisse, ihr berufsethisch gefestigtes Selbstverständnis sowie ihre menschliche Zuwendung zu den pflegebedürftigen Menschen zu tragen.
Die Arbeit mit Pflege-Studierenden hat meine Sicht auf die Dinge und die Phänomene der Pflege wesentlich erweitert und bereichert. Sie ist ein großes Geschenk, das ich jeden Tag dankbar annehme.
Für das Buch wurden die Szenarien aufwändig aufbereitet, sodass die interessierten Leserinnen und Leser für ihre Lern- und Lehrpraxis leicht anwendbare und umsetzbare Anleitungen für das klinische Simulationslernen zur Verfügung haben. Wir haben außerdem großen Wert daraufgelegt, dass die Entwicklung der Szenarien gut nachvollziehbar und verständlich beschrieben werden, sodass für jedes andere Thema die Leserin bzw. der Leser selbst ein evidence-basiertes Szenario erstellen kann. Die hier beschriebenen Szenarien sind Beispiele aus der vielgestaltigen Welt der generalistischen Pflege.
Nun wünsche wir unseren Leserinnen und Lesern, dass sie sich inspirieren lassen, von den spannenden, praxisrelevanten Fragestellungen hinter den Szenarien und von den kreativen Vorschlägen für die Schaffung eines realitätsnahen und die Experimentierfreude anregenden Simulationsraums.
Astrid Herold-Majumdar
August 2022
Literatur
Baumann, A.-L. & Kugler, C. (2019). Berufsperspektiven von Absolventinnen und Absolventen grundständig qualifizierender Pflegestudiengänge − Ergebnisse einer bundesweiten Verbleibstudie. Pflege, 32(1), 7–16.
|13|1 Simulationslernen in der fachpraktischen Pflegeausbildung
Astrid Herold-Majumdar
Abstract
Simulationslernen in der fachpraktischen Pflegeausbildung schlägt die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Pflegetheorien und -modelle, wissenschaftlich überprüftes Wissen (externe Evidence) sowie standardisierte Diagnosen, Interventionen und Outcomes werden in die Szenarien integriert. In diesem Kapitel wird erklärt, was unter einem evidence-basierten Szenario zu verstehen ist. Die Lehrpraxis steht vor der Herausforderung, die aktuelle Studienlage zu einer spezifischen Frage in Verbindung mit einem berufspraktischen Problem zu ermitteln und in der spezifischen Pflegesituation entweder im Labor oder in der realen Praxis anzuwenden.
Schlüsselbegriffe: Simulationslernen, Skills Lab, interne und externe Evidence, Pflegeklassifikationssysteme
Klinisches Simulationslernen ist in der Medizin und in den medizinischen Fachberufen sowie in der Pflege ein wichtiger, integraler Bestandteil der Ausbildung. In der Simulation werden Theorie und Forschungsstand mit der beruflichen Pflegesituation unter Laborbedingungen zusammengeführt. Die Theorie setzt sich aus den Pflegetheorien und -modellen, der externen Evidence (Studienlage) sowie den standardisierten Diagnosen, Interventionen und Outcomes, die in den pflegerischen Klassifikationssystemen (z. B. ICNP, NANDA-I, NIC, NOC) hinterlegt sind, zusammen.
Im Januar 2020 ist in Deutschland das neue Pflegeberufegesetz (PflBG) in Kraft getreten. Die spezialisierten Berufsausbildungsgänge der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden zu einer generalistischen Pflegeausbildung vereint. Zudem wurde die primärqualifizierende, hochschulische Pflegeausbildung (Teil 3 PflBG) integriert und damit von der Modellphase in die Regelausbildung überführt. Die Studierenden und Auszubildenden erlernen Kompetenzen, die für pflegebedürftige Menschen aller Altersstufen und für diverse Versorgungsarrangements bzw. Settings (u. a. akutstationäre Pflege, ambulante und stationäre Langzeitpflege) von Bedeutung sind. An die generalistische Basisausbildung können spezialisierte Ausbildungen beispielsweise in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie weiterführende Masterstudien beispielsweise der Master Advanced Nursing Practice angeschlossen werden.
Die primärqualifizierende, hochschulische Pflegeausbildung beinhaltet einen genauso hohen Anteil an Berufspraxis bzw. Praxiseinsätzen wie die berufliche Ausbildung. Sowohl in der beruflichen als auch in der hochschulischen Ausbildung besteht ein hoher Anspruch an die berufspraktischen Kompetenzen, die im Rahmen der Praxiseinsätze in diversen Pflegeeinrichtungen erworben werden sollen. Ein geringer Teil der Praxiseinsätze kann durch fachpraktische Lehre im Simulationslabor (Clinical Simulation Lab oder auch als Skills Lab bezeichnet) ersetzt werden (gem. § 38 Abs. 3 PflBG i. V. m. § 136 Abs. 6 AVSG). Das Ziel der Praxiseinsätze zum |14|Erwerb berufspraktischer Kompetenzen muss dabei erreicht werden. Zugleich ist die Ausrichtung der Lehre am aktuellen Stand des wissenschaftlich überprüften Wissens (evidence-basierte Lehre) als erweitertes Ziel in der Fachpraxis zu erreichen. Hier setzt das Sammelwerk an, indem beispielhaft ausgeführte Szenarien für das klinische Simulationslabor aufzeigen, wie die fachpraktische Lehre theoretisch und wissenschaftlich fundiert aufgebaut werden kann. Dazu werden die im Rahmen von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten entwickelten Szenarien aufbereitet, um die Lehrenden und Lernenden im Labor praktisch zu unterstützen. Methodisch basiert jedes Szenario auf einer systematischen Literaturanalyse (engl. systematic review) nach Cochrane Standard.
Der Wissensstand entwickelt sich mit der Forschung dynamisch, sodass sich die Lehr-Lernkonzepte an den Stand der Bildungsforschung und die Inhalte an den Stand der klinischen sowie Versorgungsforschung stetig anpassen müssen. Die Lehrpraxis steht vor der Herausforderung, die aktuelle Studienlage zu einer spezifischen Frage in Verbindung mit einem berufspraktischen Problem zu ermitteln und in der spezifischen Pflegesituation entweder im Labor oder in der realen Praxis anzuwenden.
Die Methode des Simulationslernens überbrückt die Schnittstelle zwischen Bildungseinrichtung und Praxis. Das klinische Simulationslabor bietet eine relativ risikofreie Lernumgebung, die zum Experimentieren und Üben einlädt. Bevor Studierende und Auszubildende Interventionen an realen Patientinnen und Patienten ausführen, können sie diese im Labor erlenen und üben. Darüber hinaus können Selbsterfahrungsübungen die Fähigkeit, sich in die Lage der pflegebedürftigen Person zu versetzen, erhöhen. Dadurch kann eine qualitativ hochwertige und sichere Versorgung, wie sie gesellschaftlich und vom Leistungsrecht gefordert wird, sichergestellt werden, sofern die Rahmenbedingungen die Umsetzung des Erlernten ermöglichen.
Das Rahmencurriculum der Pflegefachkommission nach § 53 PflBG sieht das Lernen nach dem Situationsprinzip in der simulativen Umgebung vor. Das Lernen erfolgt im Kontext realistischer, beruflicher Problemstellungen und Fallkonstellationen. Diese Situationen dienen als Schablonen für ähnliche Situationen in der Berufspraxis, sodass die Übertragung des Wissens und der Kompetenzen von der Theorie in die Praxis erleichtert wird (Situated-cognition-Ansätze) (Breuer, 2018).
Kasten 1-1: Hochkomplexe Pflegeprozesse
Die Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse ist neben anderen Zielen nach § 37 PflBG ein erweitertes Ausbildungsziel der hochschulischen Pflegeausbildung. Die hohe Komplexität kann durch die nachfolgend aufgelisteten und durch viele weitere Faktoren zustande kommen:
Dynamik und Vielschichtigkeit der Forschungs- und Rechtslage sowie des Gesundheits- und Versorgungssystems, in dessen Rahmen der Pflegeprozess gestaltet werden muss
Instabilität der Gesundheitssituation und der Selbstpflegekompetenzen des Subjektes (Individuum, Familie, Gemeinschaft), auf das sich der Pflegeprozess bezieht
Vielschichtigkeit und Dynamik des Versorgungsarrangements mit Überleitungen zwischen unterschiedlichen Settings
Erschwerte, verstehende Annäherung an das Situationsverstehen des Subjektes durch kommunikativ schwierige Situationen (z. B. bei Demenz und kognitiven Einschränkungen) und unterschiedliche, lebensgeschichtlich und im Akkulturationsprozess gewachsene Bedeutungszuschreibungen
Ethische Dilemmata.
Das Kompetenzlevel nimmt mit Komplexitätssteigerung der Situationen und Problemstellungen zu. Während im ersten Ausbildungsjahr bzw. im Grundstudium einfache, in sich |15|abgeschlossene Aufgaben mit dem Ziel des Fertigkeitentrainings (engl. skill training) bearbeitet werden, werden die Auszubildenden und Studierenden zunehmend vielschichtigen Versorgungsarrangements und Gesundheitssituationen ausgesetzt bis hin zu hochkomplexen Pflegeprozessen in der hochschulischen Pflegeausbildung.
Im Skills Lab erfahren und erleben Lernende am eigenen Leib die Verschmelzung des theoretisch Gelernten mit der beruflichen Handlungsrealität. Die Fachpraxis bildet die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Diese Brücke muss von beiden Seiten überquert werden. Die Theorie und wissenschaftlichen Erkenntnisse werden auf den Fall angewendet und aus der praktischen Arbeit mit realen, pflegebedürftigen Menschen in der natürlichen Umgebung werden Inhalte und Fragestellungen auf den simulierten Fall im Labor und von da ggf. weiter auf die Theorie übertragen.
Deshalb sprechen wir von Theorie-Praxis-Theorie-Transfer, der sich anschaulich in der „Fachpraxis-Brücke“ (Abb. 1-1) darstellen lässt.
Professionelle Pflege zeichnet sich dadurch aus, dass berufliches Handeln kritisch-reflektierend hinterfragt wird: Was ist die Wissensbasis für klinische Entscheidungen? Wie können wir pflegebedürftige Menschen unterstützen, ihre Sichtweise und ihre Prioritäten in die klinische Entscheidungsfindung einzubringen? Welche Rolle spielen berufliche und persönliche Vorerfahrungen oder finden gar Übertragungen im psychologischen Sinne statt? All das und viele weitere Fragen können beispielhaft Ansatzpunkte sein, mit denen das professionelle Handeln zu reflektieren ist.
Abbildung 1-1: Fachpraxis-Brücke (Quelle: Eigendarstellung)
Als Lehrende müssen wir unsere Lehrpraxis kritisch hinterfragen, was wissenschaftlich nachgewiesene, wirksame Strategien sind, um die Kompetenzen für professionelles und evidence-basiertes Handeln den Lernenden zu vermitteln (evidence-basierte Lehre). Die Lehrenden sind also gefordert, den Maßstab der Evidence-Basierung nicht nur an die Lern-Inhalte, sondern auch an ihr pädagogisch-didaktisches Handeln anzulegen.
Hierzu ist nun erst einmal der Evidence-Begriff näher zu betrachten. Nachfolgend wird auch erläutert, warum die englische Schreibweise für diesen Begriff verwendet wird.
|16|Evidence-Begriff
In der Literatur finden sich diverse Definitionen des englischen Begriffs der „Evidence“, der häufig mit „Evidenz“ ins Deutsche übersetzt wird. Das deutsche Wort „evident“ (Adjektiv des Substantivs Evidenz), also selbsterklärend oder offensichtlich auf der Hand liegend, ist jedoch diametral zu der Bedeutung des englischen Wortes „Evidence-based“. Was auf der Hand zu liegen scheint und routiniert in der beruflichen Praxis durchgeführt wird, ist eben oft nicht evidence-basiert, also wissenschaftlich überprüft. Beispielsweise glaubten Pflegefachpersonen lange daran, dass die Verwendung von Bauchgurten eine effektive Schutzmaßnahme zur Verhütung von Stürzen aus dem Bett oder aus dem Rollstuhl seien. In Deutschland brachten erst Studien einer Gerichtsmedizinerin die Wende in der Versorgungspraxis, in denen Todesfälle im Zusammenhang mit Bauchgurt-Fixierungen rekonstruiert und analysiert wurden (Berzlanovich et al., 2012). Heute werden Bauchgurt-Fixierungen möglichst vermieden und nur noch als Ultima Ratio eingesetzt.
Wir verwenden in diesem Werk die englische Schreibweise für Evidenz, weil es uns darum geht, die Szenarien für die fachpraktische Lehre auf Basis von wissenschaftlichen Studien zu entwickeln. Die Forderung nach der Evidence-Basierung stößt in der Praxis auch auf Widerstand. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wenn das Wissen und Können basierend auf der eigenen Berufserfahrung als weniger wert wahrgenommen wird oder wenn bei der Anwendung von evidence-basierten Leitlinien und Standards die Individualität der pflegebedürftigen Person keinen Raum mehr zu finden scheint, kann dies verständlicherweise Ablehnung der EBP bei den Praktikern erzeugen. Vertreterinnen und Vertretern der EBP wird häufig auch vorgeworfen, dass sie nur Wissen, das auf Basis analytischer, experimenteller Studienansätze (z. B. randomisiert-kontrollierte Studien) generiert wurde, berücksichtigen und qualitative, verstehende Ansätze vernachlässigen. Diese Kritik wollen wir in unsere Arbeitsdefinition der evidence-basierten Praxis aufnehmen (s. Kasten 1-2).
Kasten 1-2: Arbeitsdefinition Evidence-basierte Praxis (EBP)
Die Arbeitsdefinition der Evidence-basierten Praxis (EBP), die uns in diesem Buch leitet, geht von einem erweiterten Verständnis von EBP aus. Für die Generierung von relevantem Wissen für die klinische Praxis müssen verschiedene, dem Gegenstand der Pflege angemessene Methoden herangezogen und gemixt werden. In der klinischen Entscheidungsfindung verschmelzen in der Praxis wissenschaftlich überprüftes Wissen (externe Evidence) mit dem Erfahrungswissen der Pflegefachperson und dem Wissen über das Situationsverstehen der pflegebedürftigen Person (interne Evidence), das durch verstehende Annäherung an das innere Erleben der pflegebedürftigen Person in der jeweils individuellen Pflegesituation erworben wird. Die Expertise und Einschätzung der pflegebedürftigen Person und ggf. der pflegenden Zu- und Angehörigen ist vor allem in der Langzeitpflege ebenfalls als wichtige Wissensquelle einzubeziehen. Das soziale, kulturelle, physische und natürliche Umfeld wird dabei einbezogen. Das soziale Umfeld der pflegebedürftigen Person und das intra-interprofessionelle Team der Pflegeeinrichtung wirken dabei als zusätzliche Reflexions- und Kontrollinstanzen.
Diese Definition integriert also wissenschaftlich fundiertes Wissen, das auf Basis unterschiedlicher, einschließlich qualitativer Methoden generiert wurde, mit dem Erfahrungswissen der Pflegefachperson, das sich aus der Analyse vieler, selbst erlebter Fälle entwickelt hat, mit der Perspektive der pflegebedürftigen Person. An diese Perspektive kann sich die Pflegefachperson immer nur annähern, indem sie sich empathisch und verstehend der pflegebedürf|17|tigen Person zuwendet. Wie die Situation von der Patientin/dem Patienten erlebt wird und welche Bedeutung die Situation für die Patientin/den Patienten hat, muss in die klinische Entscheidung über Interventionen einfließen, wenn wir wollen, dass pflegebedürftige Menschen unser Hilfeangebot annehmen und an der Therapie mitwirken. Das sog. Shared Decision Making (selbstbestimmte und einvernehmliche klinische Entscheidungsfindung mit der Patientin/dem Patienten) ist wissenschaftlich als effektive Maßnahme zur Steigerung der Therapieanhaftung (engl. adherence) in Medizin und Pflege sehr gut belegt (Truglio-Londrigan & Slyer, 2018).
Methodenadäquatheit und externe Evidence
Von Dritten, im Rahmen wissenschaftlicher Studien überprüftes Wissen nennen wir externe Evidence. Mit „wir“ ist hier jene Gruppe von Forschenden und Wissenschaftstheoretikerinnen gemeint, die der Unterscheidung von interner und externer Evidence (Behrens & Langer, 2006) zustimmen. Diese Unterscheidung ist in der Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht unumstritten. Qualitativ gutes, theoretisches Wissen entsteht ja auch aus der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Auffassungen, die sich in „Denkschulen“ kategorisieren lassen. Werden die Positionen konsequent argumentiert, kann sich die Theorie weiterentwickeln und ggf. durch die Empirie überprüft werden. An dieser Stelle können die wissenschaftstheoretischen Überlegungen nicht weiter vertieft werden, jedoch muss der „Evidence“-Begriff wissenschaftstheoretisch fundiert geklärt werden, um ihn auf die Fachpraxis adäquat anwenden zu können. Dazu ist es erforderlich, sich damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich wissenschaftlich überprüftes Wissen entsteht.
Die Methodenadäquatheit ist eines der wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Qualität einer Studie. Je nach Erkenntnisinteresse und Gegenstand ist diejenige Methode zu wählen, die diesem Gegenstand gerecht wird. Beispielsweise können Phänomene im Zusammenhang mit dem subjektiven Erleben einer neuen Krankheit schwerlich mit quantitativen, statistischen Methoden untersucht werden. Hier sind zunächst qualitative und offene Methoden einzusetzen, um überhaupt erst einmal annähernd zu verstehen, wie Menschen, die von dieser neuen Erkrankung betroffen sind, die mit der Krankheit verbundenen Symptome und Funktionseinschränkungen wahrnehmen. Um hingegen die Wirksamkeit einer neuen Intervention gegenüber der herkömmlichen Intervention nachzuweisen, muss mit großen Studiengruppen quantitativ gearbeitet werden. Der Gegenstandsbereich der Pflege ist vielschichtig und häufig muss im Feld unter dem vielfältigen Einfluss der sozialen, kulturellen, natürlichen und physischen Umgebung geforscht werden, sodass die Pflegeforschung aus dem gesamten Methodenpool der Sozial-, Geistes-, Natur- und anderer Bezugswissenschaften schöpft. Natürliche Einflüsse können meist nur begrenzt kontrolliert werden, sodass das experimentelle Design mit zahlreichen Verzerrungsmöglichkeiten und systematischen Fehlern behaftet ist. Die Methodenwahl darf keine dogmatische Frage der wissenschaftstheoretischen und philosophischen Grundüberzeugung der Forschenden sein, sondern richtet sich allein an den Subjekten und am Gegenstand aus, der angemessen zu untersuchen ist. Auch hier haben sich u. a. in der Pflegewissenschaft unterschiedliche „Schulen“ im Akademisierungsprozess herausgebildet. Diese Denkschulen reichen von den Hardlinern der Analytikerinnen und Analytiker, die sich stark an den naturwissenschaftlichen Methoden ausrichten, bis hin zu qualitativ Forschenden, die rein induktiv aus dem Feld Erkenntnisse generieren und die Phänomene ausschließlich mit der Sprache der Akteurinnen und Akteure im Feld beschreiben und erklären wollen. Die sog. qualitativen Methoden, die eine verstehende Annäherung an die Lebenswelt der Handelnden in der Pflege ermöglichen, haben hier eine herausragende Bedeutung, können aber keinesfalls |18|experimentelle, analytische Methoden ersetzen, wenn es z. B. darum geht, die Wirksamkeit einer Pflegeintervention zu überprüfen. Angenommen, es soll ein Unterstützungsprogramm für pflegende Angehörige entwickelt werden, kommt die Forscherin nicht umhin, sich der Lebenswelt dieser Gruppe anzunähern, um zu verstehen, was eigentlich die Situationen sind, die von pflegenden Angehörigen als belastend erlebt werden. Dazu muss die oder der Forschende mit den Menschen sprechen, ihnen zuhören, ihnen Raum geben, das Erlebte mit ihrer eigenen Sprache so zu beschreiben, wie es subjektiv wahrgenommen wurde. Das können qualitative Methoden leisten.
Von Dritten mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden nachvollziehbar überprüftes Wissen, also externe Evidence (Behrens & Langer, 2006), soll uns im beruflichen Handeln als eine Quelle des Wissens leiten. Sie ist jedoch nicht die einzige Quelle des Wissens, denn zusammen mit der pflegebedürftigen Person müssen wir „interne Evidence“ (Behrens & Langer, 2006) im Arbeitsbündnis aufbauen. Im intra- und interprofessionellen Team ist die Anwendung externer Evidence im jeweils individuellen Einzelfall zu diskutieren und es sind gemeinsam Interventionsentscheidungen zu treffen. In sog. Cancer-Boards werden solche Therapieentscheidungen beispielsweise getroffen, denn es reicht keinesfalls aus, nach „Schema F“ eine Behandlungsleitlinie auf Basis wissenschaftlicher Studien eins zu eins bei einem Patienten mit einer Krebserkrankung anzuwenden. So individuell wie die Menschen sind, reagieren sie auch unterschiedlich auf Krankheiten und Therapien. Die gleiche, medizinische Diagnose nach der internationalen Klassifikation (ICD) kann beim Patienten oder bei der Patientin unterschiedlich ausgeprägte Symptomatiken entwickeln, die von dem Patienten höchst individuell wahrgenommen werden. Während der Eine bei einer Krebserkrankung die Chemotherapie gut verträgt, entwickelt der Andere erhebliche Nebenwirkungen bzw. können die gleichen, objektiv von außen zu beobachtenden Nebenwirkungen von den Patienten ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Noch individueller werden die Funktionseinschränkungen auf die tägliche Lebenspraxis erlebt.
Kasten 1-3: Anwendung von Studienergebnissen im individuellen Einzelfall
Externe Evidence (Behrens & Langer, 2006; Behrens, 2010) ist durch Dritte in wissenschaftlichen Studien überprüftes Wissen. In Studien ist eine bestimmte Gruppe von Personen (Studien-Population) einbezogen. In dieser Gruppe sind bestimmte Merkmale (Charakteristika, z. B. Alter, Geschlecht, Bildung) vertreten. Da jede pflegebedürftige Person höchst individuelle Merkmalskombinationen aufweist, über einzigartige, lebensgeschichtlich gewachsene Eigenschaften und Bewältigungsstrategien verfügt sowie in einem spezifischen Umfeld lebt, können Studienergebnisse nicht eins-zu-eins auf den Einzelfall übertragen werden.
Pflegeklassifikationssysteme, die – ähnlich wie die International Classification of Diseases, ICD-10_GM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022) der Medizin – Pflegediagnosen, Interventionen und Ergebnisse (Outcome) systematisch listen, beruhen auch auf externer Evidence. Wissenschaftlich fundierte Simulationsszenarien und -einheiten beziehen sich deshalb auf diese Klassifikationssysteme. An dieser Stelle kann kein kompletter Überblick über die Pflegeklassifikationssysteme gegeben werden, sodass auf das Werk von Müller Staub und Kolleginnen (2017) verwiesen wird.
Bei den NANDA-I Pflegediagnosen (Herdman et al., 2022) ist z. B. der Evidence-Grad – der „Level of Evidence“ – (Herdmann & Kamitsuru, 2019, S. 24) für jede Pflegediagnose angegeben. Das NANDA-I-Komitee, das sich aus Pflegewissenschaftlerinnen bzw. -wissenschaftlern und Praktikerinnen bzw. -praktiker zusammensetzt, überprüft die wissenschaftli|19|che Fundierung der Diagnosen alle drei Jahre und aktualisiert die Angaben bei verändertem Forschungsstand oder bei der Eingabe neuer Pflegediagnosen. Es ist kein unerheblicher Aufwand für die bestimmenden Merkmale und beeinflussenden Faktoren sowie für die Risikopopulation, den jeweils aktuellen Stand des Wissens zu erheben, denn dazu muss die Literatur systematisch nach relevanten Forschungsergebnissen durchsucht werden. Die zutreffenden Forschungsberichte müssen hinsichtlich Qualität kritisch bewertet und auf die Diagnose hin ausgewertet werden. Pflegeklassifikationssysteme verdichten das wissenschaftlich überprüfte Wissen zu den relevanten Phänomenen der Pflege und stellen somit einen wertvollen Wissenskanon dar. Der Blick wird von dem sozialversicherungsrechtlich sehr eingeengten Begriff der Pflegebedürftigkeit auf pflegetheoretisch und empirisch begründete Phänomene, Risiken und Entwicklungspotenziale geweitet. So findet z. B. das Konzept „Hoffnung“ im Szenario zur verbalen Deeskalation (Kap. 4.5.5) Anwendung. Unter der Domäne 6 findet sich die Pflegediagnose „Bereitschaft für verbesserte Hoffnung“, ein „Muster von Erwartungen und Wünschen zur Mobilisierung von Energien, um positive Ergebnisse zu erzielen, oder eine potenziell bedrohliche oder negative Situation zu vermeiden, welches gestärkt werden kann“ (Herdman et al., 2022, S. 386). Es werden bestimmende Merkmale genannt, wie die pflegebedürftige Person „drückt den Wunsch aus, die Fähigkeit zu verbessern, sich erreichbare Ziele zu setzen“ (Herdman et al., 2022, S. 386). Wir arbeiten in der Pflege viel mit dem Phänomen der Hoffnung, jedoch meistens, ohne dies explizit in der Pflegeprozessplanung zu formulieren. Dabei ist die Förderung der Bereitschaft für eine verbesserte Hoffnung für pflegebedürftige Menschen oft von entscheidender Bedeutung. Ohne Hoffnung lassen sich Ressourcen für die Bewältigung der täglichen Aktivitäten oder für die Erreichung von Rehabilitationszielen nicht mobilisieren. Die in diesem Buch beschriebenen evidence-basierten Szenarien greifen bewusst Diagnosen, Interventionen und Ergebnisse auf, die über die leistungsrechtlichen Begriffe hinausgehen. Schließlich soll den Studierenden und Auszubildenden der gesamte Wissenskanon der Pflege vermittelt werden, um alle Dimensionen der menschlichen Reaktion auf gesundheitliche Prozesse und Lebensprozesse zu erfassen. Diese Reaktionen sind höchst individuell. Gesundheits- bzw. Krankheits- und Lebensprozesse werden von pflegebedürftigen Menschen mit individuellen, lebensgeschichtlich und kulturell gewachsenen Bedeutungen verknüpft. Das pflegerische Hilfsangebot muss an diese Bedeutungen anschließen, um von der pflegebedürftigen Person angenommen zu werden. Dazu nähert sich die Pflege verstehend an die Lebenswelt der pflegebedürftigen Person an und baut „Interne Evidence“ (Behrens & Langer, 2006; Behrens, 2010) auf.
Interne Evidence
Sich empathisch der Lebenswelt der pflegebedürftigen Person anzunähern und zu versuchen zu verstehen, wie die pflegebedürftige Person ihre Situation sieht und erlebt, ist eine wichtige Voraussetzung für ein adäquates Hilfeangebot. Das Krank-sein wird bei der gleichen Krankheit oft höchst unterschiedlich erlebt und interpretiert sowie in die eigene Lebenspraxis integriert. Während der eine an der Krankheit verzweifelt und seine Lebensperspektive verliert, entwickelt der Andere Strategien, mit der Krankheit und den Folgen in der Alltagspraxis fertig zu werden, ja sogar persönlich an der Krankheit zu wachsen. An dieses jeweils individuelle Erleben muss das Hilfeangebot und die Pflegeintervention anknüpfen, damit die pflegebedürftige Person das Hilfsangebot annehmen und daran mitwirken kann (Adherence). Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung, dass Patientinnen und Patienten im Behandlungsprogramm mitgehen können. Wer kennt das nicht, dass der Hausarzt oder die Hausärztin ein neues Medikament verschreibt, weil es nach der Studienlage das wirkungsvollste Mittel bei einer bestimmten Erkrankung ist (externe Evi|20|dence) und der Patient nach dem Durchlesen des Beipackzettels das Medikament nicht, wie empfohlen, einnimmt, sondern wegwirft. Wenn es dem Hausarzt bzw. der Hausärztin bei der Konsultation nicht gelingt, die Abwägung von Risiken und Nutzen mit dem Patienten bzw. der Patientin vor dem Hintergrund der jeweils individuellen Verständnisse und Gesundheitstheorien sorgfältig vorzunehmen, landen teure Medikamente im Müll und es können zusätzliche Behandlungskosten entstehen. Wenn es uns in der Pflege nicht gelingt, das jeweils individuelle Situationsverstehen der pflegebedürftigen Person zu erschließen und unser Hilfsangebot danach auszurichten, werden Ressourcen schwerlich zu fördern sein und wir werden vergeblich auf die Mitwirkung unserer Patienten und Patientinnen hoffen. Tritt eine sog. „Non-Compliance“ (mangelnde Mitarbeit) ein, eine Pflegediagnose, die mittlerweile aus dem Klassifikationssystem der NANDA-I gestrichen ist, müssen wir zuerst selbstkritisch unser Angebot überprüfen. [Pflegediagnostisch lässt sich das treffender und positiver mit den Pflegediagnosen „Bereitschaft für eine verbesserte Gesundheitskompetenz“ und „Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement“ beschreiben (Herdman et al., 2022, S 221, 238). Anm. d. Lek.] Menschen entwickeln eigene Theorien und ein eigenes Verständnis über Gesundheit und Krankheit im Lebenslauf und in der jeweiligen sozialen und kulturellen Umgebung, die es zu erschließen gilt (s. Kasten 1-4).
Kasten 1-4: Aufbau interner Evidence
Interne Evidence (Behrens & Langer, 2006, Behrens, 2010) wird mit der pflegebedürftigen Person in der unmittelbaren Interaktion aufgebaut. Dazu nähert sich die Pflegefachperson verstehend an die Lebenswelt der pflegebedürftigen Person an, um nachvollziehen zu können, wie die pflegebedürftige Person ihre pflege- bzw. gesundheitsrelevante Situation selbst sieht, was ihr wichtig und für sie von Bedeutung ist. Das Interventionsangebot wird darauf hin mit der Person abgestimmt. Die interne Evidence ist deshalb die Voraussetzung für die angemessene Anwendung externer Evidence.
Bei mangelnder Mitwirkung („Non-Compliance“) sind die Ursachen vielfältig und nicht nur bei der pflegebedürftigen Person zu suchen. Die Herausforderung für die Praktikerin ist, das wissenschaftlich überprüfte Wissen auf die jeweils einzigartige und individuelle Situation mit der pflegebedürftigen Person anzuwenden. Donabedian (2003) spricht in seinem Modell „Components of quality in health care“ (Donabedian, 2003, S. 5) hier von „the application of that science and technology“, also die Übertragung und Anwendung wissenschaftlich überprüften Wissens und von Technologien auf die jeweils individuelle Situation des Patienten. Dies erfordert nicht nur Kenntnis vom aktuellen Stand des Wissens, sondern auch darüber, wie zuverlässig Forschungsergebnisse einzuschätzen sind und welche Relevanz Forschungsergebnisse für den jeweiligen Einzelfall haben. Liefert doch eine randomisiert-kontrollierte Studie (RCT) bestenfalls die Erkenntnis, dass mit einer hohen, meist 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Intervention in einer bestimmten Personengruppe (Population) unter Laborbedingungen eine erwünschte Wirkung erzielt hat. Häufig werden Risiken und Nebenwirkungen von pflegerischen Interventionen dabei sogar vernachlässigt. Denn auch augenscheinlich einfache pflegerische Interventionen, wie das Fixieren einer Magensonde an der Nase, haben Risiken und Nebenwirkungen, in diesem Fall ein erhöhtes Dekubitusrisiko am Nasenflügel. Die Übertragung dieses Wirkungsnachweises auf die individuelle Situation des jeweils einzigartigen, pflegebedürftigen Menschen, obliegt den Praktizierenden und der pflegebedürftigen Person selbst.
Übertragungsproblem externer Evidence
Die Forderung nach Evidence-Basierung darf Probleme und Herausforderungen bei der Übertragung von Forschungsergebnissen auf |21|die jeweils individuelle Pflegesituation nicht ausblenden. Die Eigenschaften der Studienpopulation einer randomisiert-kontrollierten Studie stimmen meist nicht eins zu eins mit den jeweils individuellen Eigenschaften der pflegebedürftigen Person, mit der in der Praxis eine Interventionsentscheidung getroffen werden soll, überein. Das birgt ein nicht zu unterschätzendes Übertragungsproblem, vor dem die Praktikerinnen und Praktiker mit der pflegebedürftigen Person stehen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei auch, dass die Umgebungsfaktoren, also das soziale, physische und kulturelle Umfeld höchst unterschiedlich sind und Einfluss nehmen. Während beispielsweise in Japan die Pflege eines sturzgefährdeten Patienten am Boden kulturell gut akzeptiert wird, bedeutet es in den westlichen Ländern ggf. ein unwürdiges Dasein, wenn die Person nicht einmal eine Liegestatt zur Verfügung hat. Wie das Erfahrungswissen und die interne Evidence der praktisch Handelnden in die klinische Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung der externen Evidence eingebracht werden kann, darüber schweigt sich die Methodenliteratur häufig aus. In der Praxis herrscht jedoch ein hoher Handlungsdruck, sodass sich die Frage stellt, wie nun wissenschaftliche Erkenntnisse in den individuellen Pflegeprozess zu integrieren sind und welche Stellung diese in der Entscheidung über Interventionen einnehmen sollen. Diese Übertragungsprobleme können nun im konkreten, simulierten Fall in der Fachpraxis analysiert werden. Dabei entwickeln die Auszubildenden und Studierenden ein Verständnis für den klinischen Entscheidungsprozess, der in der Realität viel komplexer ist, als dies so manche Leitlinie vermittelt.
Evidence-basierter Empfehlungsgrad und klinische Entscheidungsfindung
Auf der Suche nach Wirksamkeitsnachweisen für eine bestimmte pflegerische Intervention stößt die Forscherin und interessierte Praktikerin meist auf unterschiedliche Studientypen und Ergebnisse. In der Wissenschaft ist es normal, dass es bei der Untersuchung von Interventionen heterogene, nicht übereinstimmende sogar sich widersprechende Ergebnisse gibt. Während die einen Studien die Wirksamkeit belegen, kommen andere Studien zu dem Ergebnis, dass es zwischen Interventionsgruppe, in der die zu untersuchende Intervention angewendet wurde, und Vergleichsgruppe keinen Unterschied gibt. Übersichtsarbeiten (Systematic Review), die zu einer bestimmten Fragestellung alle verfügbaren Studien sammeln und auswerten, liefern häufig verzerrte Ergebnisse, weil Studien, die keinen Effekt belegen konnten, erst gar nicht publiziert werden (publication bias). Im besten Fall wurden die aktuellen Studien zu einer bestimmten Fragestellung oder zur Untersuchung einer bestimmten Intervention in einer Metaanalyse zusammenfassend statistisch ausgewertet und eine Empfehlung für die Anwendung der Intervention mit einem bestimmten Empfehlungsgrad ausgesprochen. Der Empfehlungsgrad richtet sich nach dem Evidence-Grad, für den Evidence-Hierarchien Anwendung finden. Die klassische Evidence-Hierarchie orientiert sich an experimentellen Studien, wobei die Metaanalyse, also die statistische Auswertung und Zusammenfassung mehrerer randomisiert-kontrollierter Studien, als höchste Evidence-Stufe gilt. Qualitative Studien, die u. a. das individuelle Erleben der Akteure bei der Anwendung von Interventionen untersuchen, werden dabei häufig vernachlässigt. So können beispielsweise mehrere randomisiert-kontrollierte Studien eine gute Wirkung einer bestimmten Maßnahme zur Dekubitusprävention (Vorbeugen des Wundliegens) belegen, jedoch wurde die Akzeptanz dieser Maßnahme bei den Pflegenden und pflegebedürftigen Menschen ggf. nicht untersucht. Es ist eine höchst individuelle und selbstbestimmte Entscheidung, ob eine pflegebedürftige Person die Belastungen, die Risiken und Nebenwirkungen einer pflegerischen Intervention auf sich nehmen will, um mit einer gewissen, bestenfalls hohen Wahrscheinlichkeit, eine erwünschte Wirkung, in diesem Beispiel die Reduktion des |22|Dekubitusrisikos, zu erzielen. Wenn jede Mobilisation mit starken Schmerzen verbunden ist, kann es sein, dass sich die pflegebedürftige Person lieber für ein erhöhtes Dekubitusrisiko entscheidet, auch in dem Bewusstsein, dass ein möglicherweise entstehendes Druckgeschwür schmerzhaft sein kann. Je nach Empfehlungsgrad kann externe Evidence die klinische Entscheidungsfindung mit der pflegebedürftigen Person leiten. Je stärker die wissenschaftlichen Nachweise für die Wirkung einer Intervention sind, desto mehr kann die Maßnahme empfohlen werden und desto weniger Spielraum bleibt für individuelle Maßnahmenanpassungen oder alternative Maßnahmen. Die selbstbestimmte Entscheidung der pflegebedürftigen Person bleibt davon unberührt. So kann sich die pflegebedürftige Person auch unvernünftig entscheiden und eine Pflegeintervention, für die die Wirkung sehr gut wissenschaftlich nachgewiesen ist, ablehnen.
Wenn der Forschungsstand ermittelt wurde, also beispielsweise die relevanten Studien zur Untersuchung einer bestimmten Pflegeintervention identifiziert und ausgewertet wurden, muss im nächsten Schritt überlegt werden, ob eine Pflegeintervention empfohlen werden kann und wie stark diese Empfehlung sein kann. Das ist das Prinzip der Leitlinienentwicklung in Pflege und Medizin. Die Empfehlungen sind mit großer Sorgfalt auszusprechen, da sie unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit und das Leben der von der klinischen Entscheidung betroffenen pflegebedürftigen Person haben. Der Empfehlungsgrad ist umso höher (starke Empfehlung), je stärker der wissenschaftliche Beleg dafür ist, dass die Intervention gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise in der Kontrollgruppe wirkungsvoller ist. Zu beachten sind dabei auch immer die Risiken und Nebenwirkungen, die Pflegeinterventionen haben können. Im klassischen Evidence-System ist der stärkste wissenschaftliche Beweis die sog. Metaanalyse. Bei der Metaanalyse werden die Ergebnisse mehrerer randomisierter kontrollierter Studien (RCT) statistisch zusammengefasst, sodass die Studienpopulationen sehr groß sind. Es ist die Aufgabe von sog. Reviewern bzw. Reviewerinnen, die Studienlage zu ermitteln und entsprechend auszuwerten. Die Qualität der Studienberichte muss hierbei berücksichtigt werden. Oft sind es dann Gremien (häufig sog. Konsensuskonferenzen) aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Praktikerinnen und Praktiker sowie aus Mitgliedern angrenzender Disziplinen und Professionen, die über den Empfehlungsgrad entscheiden. Das hier stark verkürzt dargestellte Verfahren wird z. B. bei der Entwicklung der DNQP-Expertenstandards (DNQP, 2022) angewandt.
Je sicherer der Nutzen und die Anwendbarkeit für eine bestimmte Population eingeschätzt wird, desto eher wird eine starke Empfehlung ausgesprochen (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. AWMF, 2022). Die Empfehlungen sind vor dem Hintergrund der jeweils individuellen Eigenschaften der pflegebedürftigen Person und ihrer spezifischen Situation im klinischen Entscheidungsprozess abzuwägen.
|23|Tabelle 1-1: Vierstufiges Schema zur Graduierung von Empfehlungen (Eigendarstellung in Anlehnung an AWMF, 2022)
Studienlage
Empfehlungsgrad
Beschreibung
Formulierung
Viele, qualitativ hochwertige Studien belegen eine Wirksamkeit der untersuchten Intervention
A
starke Empfehlung
soll/soll nicht
Wenige qualitativ hochwertige Studien oder mehrere Studien geringer Qualität belegen eine Wirksamkeit der Intervention oder es liegen widersprüchliche Studienergebnisse vor: Einige Studien belegen die Wirksamkeit, während andere Studien keinen, statistisch nachweisbaren Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe feststellen
B
(schwache) Empfehlung
sollte/sollte nicht
Es gibt keine qualitativ hochwertigen Studien, die eine Wirksamkeit belegen.
0
Empfehlung offen
kann erwogen werden/kann verzichtet werden
Es gibt keine qualitativ hochwertigen Studien, die eine Wirksamkeit belegen. Zudem liegen Studien vor, die erhöhte Risiken für unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit der Intervention belegen.
–
keine Empfehlung
soll verzichtet werden
Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) schlägt ein zwei- oder dreistufiges Schema für die Empfehlung im Rahmen von Leitlinien vor. Hierbei stehen meist Interventionen, also medizinische Behandlungsverfahren im Mittelpunkt der Betrachtung. Bei der dreistufigen Version wird bei hohem Evidence-Grad (viele, qualitativ hochwertige Studien belegen beispielsweise die Wirksamkeit einer Intervention in einer Population mit bestimmten Eigenschaften, z. B. hinsichtlich des Alters) eine starke Empfehlung mit der Formulierung „soll/soll nicht“ ausgesprochen. Wird die Intervention nicht entsprechend der Empfehlung angewandt, obwohl eine Indikation vorliegt, kann dies bei unerwünschten Behandlungsergebnissen zu einem Behandlungsfehler führen. Bei mittlerem Evidencegrad (wenige hochwertige Studien belegen eine Wirksamkeit oder die Studien, die eine Wirksamkeit belegen, sind methodisch schwach oder es gibt neben Studien, die eine Wirksamkeit belegen, auch Studien, die keine Wirksamkeit belegen) werden Empfehlungen mit „sollte/sollte nicht“ formuliert. Für die klinische Entscheidungsfindung besteht also ein größerer Handlungsspielraum. Wenn sich der Behandler bzw. die Behandlerin gegen die Intervention im Einzelfall entscheidet und es zu unerwünschten Wirkungen beim Patienten kommt, ist es umso schwerer einen Behandlungsfehler nachzuweisen. Wenn keine qualitativ hochwertigen Wirksamkeitsbelege vorliegen, wird keine Empfehlung ausgesprochen, d. h. die in Frage stehende Intervention kann erwogen werden. Es kann aber auch auf die Intervention verzichtet werden. Hier ist der Freiraum für die klinische Entscheidungsfindung im Einzelfall besonders hoch (Tab. 1-1). Entsprechend kann den Lehrenden und Lernenden ein Spielraum für die situationsspezifische Gestaltung der pflegerischen Intervention und für die klinische Entscheidungsfindung mit der pflegebedürftigen Person bzw. mit dem Simulationspatienten gegeben werden. Liegen zudem qualitativ hochwertige, wissenschaftliche Belege vor, dass die als nicht wirksam belegte Intervention zudem mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist, kann nicht nur keine Empfehlung ausgesprochen werden, sondern es muss von der Intervention auch abgeraten werden. Lange glaubte man beispielsweise in der Pflege daran, dass Bauchgurte vor einem Sturz aus dem Rollstuhl schützen, bis Studien belegten, dass Personen mit einer bestimmten Körperform, der sog. „Birnenform“, besonders gefährdet sind, durch den Bauchgurt hindurchzurutschen und sich zu strangulieren (Berzlanovich et al., 2012). Es gibt keine oder nur sehr schwache Belege für die Verringerung des Risikos für sturzbedingte Verletzungen durch die Anwendung von Bauchgurten, zudem liegen |24|wissenschaftliche Belege vor, dass durch die Immobilisierung das Sturzrisiko durch die Bauchgurtfixierung sogar erhöht sein kann. Des Weiteren belegen Studien, dass das Risiko einer Strangulation mit Todesfolge erhöht ist, sodass die Intervention, Bauchgurtfixierung im Rollstuhl zur Sturzvermeidung, nicht empfohlen werden kann, ja sogar von ihr abgeraten werden muss. Wir ergänzen deshalb die Tabelle der AWMF mit einer weiteren, vierten Kategorie „keine Empfehlung“ (Tab. 1-1).
Diese Empfehlungsgrade sind also für die fachpraktische Lehre von hoher Bedeutung, weil in der simulierten Situation die Anwendung von Evidence exemplarisch geübt werden kann. Die Moderatorin/der Moderator muss die Studienlage kennen und den Empfehlungsgrad entweder selbst einschätzen oder den von den Reviewern vorgegebenen Empfehlungsgrad in der jeweiligen Simulationssituation umsetzen. Der Simulationspatient übernimmt dabei stellvertretend die Perspektive der pflegebedürftigen Person. Die lernende Person übernimmt die Rolle der Pflegefachperson, welche die Studienlage und den Empfehlungsgrad in der individuellen Situation anwenden muss. Entscheidungsspielräume eröffnen sich je nach Studienlage und Empfehlungsgrad sowohl für die simulierte, klinische Entscheidungsfindung als auch für die Bewertung der Leistung der Lernenden. Die Lehrperson kann bei schwacher oder offener Empfehlung individuellen Lösungen der Lernenden mehr Spielraum geben. Ein „richtig“ oder „falsch“ ist aber auch umso schwieriger zu entscheiden. Positiv zu bewerten ist jedoch in jedem Fall, wenn Lernende den Evidence- und Empfehlungsgrad kennen und im simulierten Einzelfall kritisch und reflektiert anwenden. Eine gewisse Unsicherheit auf beiden Seiten, sowohl aufseiten der Lehrenden als auch aufseiten der Lernenden bleibt bei schwacher oder sich widersprechender Forschungslage bestehen. Wenn jedoch die externe Evidence unklar ist, wird die interne Evidence umso wichtiger. Die Akteurinnen und Akteure können sich darauf konzentrieren, was in der jeweils individuellen Situation den Prioritäten der pflegebedürftigen Person und der klinischen Expertise entspricht.
Das Besondere evidence-basierter Szenarien ist also nicht nur, dass sich die im Mittelpunkt sehende Intervention am aktuellen Stand des Wissens ausrichtet, sondern auch, dass mit diesem Szenario die Anwendung von Empfehlungsgraden auf Basis der Studienlage im simulierten Einzelfall geübt werden kann und somit wichtige Kompetenzen für das Evidence-based Nursing ausgebildet werden können. Nachfolgend soll nun näher erläutert werden, was unter einem evidence-basierten Szenario zu verstehen ist.
Evidence-basiertes Szenario
Szenarien sind Konstellationen von Fällen, in deren Fokus in der Pflege in der Regel die pflegebedürftige Person steht. Diese Fallkonstellationen werden für den Lernprozess konstruiert. Dabei werden Fälle didaktisch vorbereitet und skizziert und in der Simulation durch die Lernenden bearbeitet und entwickelt. Fallskizzen beschreiben grob die Fallsituation und die Rahmenbedingungen. Sie können, müssen aber nicht auf realen Fällen aus der klinischen Praxis beruhen. Regieanweisungen führen in die jeweiligen Rollen ein, die von den Lernenden und ggf. von Schauspielpatienten kreativ und interaktiv gestaltet werden können. Das klinische Simulationslabor wird dabei zum Experimentierraum, denn anders als bei der Arbeit mit realen, pflegebedürftigen Menschen, können Handlungen ausprobiert werden, ohne dass die Konsequenzen ernsthafte Folgen für pflegebedürftige Menschen haben. Ganz frei ist dieser Raum jedoch auch nicht, denn die Beanspruchungen der Lernenden, der Schauspielpatientinnen und -patienten und auch der Lehrenden sind teilweise hoch und nicht zu unterschätzen. Wenn ein Lernender beispielsweise das erste Mal mit der Versorgung und den Erscheinungsformen von Wunden konfrontiert wird, können starke Emotionen auftreten, insbesondere bei einer High-emotion Simulation, bei der Wun|25|den realitätsnah geschminkt werden und Gefühle wie Ekel auslösen können. Im geschützten Raum des Labors können Lernende sich jedoch langsam an belastend erlebte Situationen herantasten und in der Reflexion ihre Emotionsarbeit und Resilienz stärken.
Kasten 1-5: Definition evidence-basiertes Szenario
Ein evidence-basiertes Szenario ist eine berufspraktische Fallkonstellation im Labor, bei der mindestens eine zentrale Intervention auf Basis wissenschaftlicher Studien durchgeführt wird. Evidence-basierte Szenarien nehmen Bezug zu validierten Pflegediagnosen, Interventionen und Ergebnissen wissenschaftlich fundierter Klassifikationssysteme. Es wird Wissen auf unterschiedlichen Ebenen, u. a. externe Evidence, Intuition, Erfahrungswissen, interne Evidence, einbezogen. Je nach Stärke der externen Evidence und nach Empfehlungsgrad der geübten Intervention können Spielräume für individuelle Interventionsentscheidungen mit dem Simulationspatienten bzw. der Simulationspatientin experimentell genutzt werden, was auch bei der Leistungsbeurteilung der Lernenden zu berücksichtigen ist.
Komplexitätsstufenmodell
Je nach Lernfortschritt sind Szenarien schrittweise aufzubauen (wie in Tab. 1-1 dargestellt). Anfängerinnen und Anfänger müssen erst einmal mit der Laborumgebung, den Geräten und Materialien vertraut werden. Ihnen sollte zunächst die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von einer konkreten Aufgabe oder einem Szenario das Labor als Experimentierraum zu erkunden. Die Lernkultur muss entwickelt werden, denn lernbiografisch besteht eher die Tendenz der Lernenden zur Fehlervermeidung und zur Eins-zu-eins-Umsetzung des theoretisch Gelernten. Langsam muss das Labor als „Experimentarium“ erschlossen werden. Dabei dürfen Dinge ausprobiert und, falls geeignet, in ihre Bestandteile zerlegt werden. Für Handlungen, die zunächst nicht zielführend oder sogar kontraproduktiv erscheinen, ist Raum, um deren Konsequenz am eigenen Leib erfahren zu können. Neue, bisher nicht ausprobierte Handlungsstrategien dürfen angewendet werden. Die Lernenden sollen ihr ganzes Handlungsrepertoire ausschöpfen und es erweitern. Wie fühlt sich eigentlich ein Venenkatheter an, wie elastisch ist dieser und was bedeutet dies für das Legen eines Venenverweilkatheters? Was passiert, wenn ich nicht freundlich auf einen Patienten reagiere?
Selbsterfahrungsübungen spielen hierbei auch eine große Rolle, um sich in die Situation von pflegebedürftigen Menschen hineinversetzen und die Perspektive wechseln zu können. Wie fühlt es sich an, eine Inkontinenzeinlage zu tragen? Wie verändert sich dabei die eigene Körperwahrnehmung und das Körperbild? Was macht das mit der sozialen Interaktion?
Nach der freien Erkundungsphase folgen einfache Aufgaben, bei denen Abläufe instrumentell-technisch geübt werden können. Mit Hilfe eines Kunststoff-Arms kann beispielsweise das Anschließen einer Infusion an einen Venenverweilkatheter geübt werden.
In einfachen Szenarien werden diese instrumentell-technischen Abläufe und Skills dann mit Simulationspatienten in ein Szenario eingebettet, sodass zu dem handwerklichen Tun die Interkation und Kommunikation mit der pflegebedürftigen Person und anderen Personen z. B. im intra-/interprofessionellen Team hinzukommt. Hier muss dann ggf. auch auf unvorhergesehene Reaktionen des Simulationspatienten eingegangen werden, was bereits eine gewisse Sicherheit im technischen Ablauf der Intervention erfordert. Die Komplexität der Szenarien wird schließlich weiter gesteigert bis dahin, dass ein kompletter Schichtablauf mit verschiedenen Szenarien simuliert wird, den die Lernenden selbst organisieren. Durch die Erhöhung der Dynamik der Interaktion und nicht planbarer Reaktionen der Simulationsgeräte oder der Simulationspatienten kann die Komplexität des Lern-Systems gesteigert werden (Abb. 1-2).
Abbildung 1-2: Komplexitätsstufenmodell Simulationsszenarien (Eigendarstellung)
1.1 Literatur
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. AWMF. (Hrsg.). (2022). AWMF-Regelwerk Leitlinien: Formulierung und Graduierung von Empfehlungen. Verfügbar unter https://www.awmf.org/regelwerk/formulierung-und-graduierung-von-empfehlungen
Behrens, J. & Langer, G. (2006). Das Wichtigste sind Verantwortungsübernahme und Respekt. Die Schwester Der Pfleger, (3), 168–171.
Behrens, J. (2010). EbM ist die aktuelle Selbstreflexion der individualisierten Medizin als Handlungswissenschaft (Zum wissenschaftstheoretischen Verständnis von EbM). Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, 104(8–9), 617–624. Crossref
Berzlanovich, A., Schöpfer, J. & Keil, W. (2012). Deaths due to physical restraint. Deutsches Ärzteblatt international, 109(3), 27–32. Crossref
Breuer, G. (2018). Simulators don’t teach – Lernprozesse und Simulation. In M.St. Pierre &G.Breuer (Hrsg.), Simulation in der Medizin. Grundlegende Konzepte- Klinische Anwendung (2. Aufl., S. 75–80). Springer. Crossref
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022). Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification. Verfügbar unter https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP). (Hrsg.). (2022). Expertenstandards und Auditinstrumente. Verfügbar unter https://www.dnqp.de/expertenstandards-und-auditinstrumente/
Donabedian, A. (2003). An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford University Press.
Herdman, H., Kamitsuru, S. & Takào-Lopes, C. (2022). NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2021–2023 (3. Aufl.). Recom. Crossref
Herdmann, H. & Kamitsuru, S. (2019). NANDA International Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation. 2018–2020.Recom. Crossref
Müller Staub, M., Schalek, K. & König, P. (2017). Pflegeklassifikationen: Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation. Hogrefe.
Truglio-Londrigan, M. & Slyer, J. T. (2018). Shared Decision-Making for Nursing Practice: An Integrative Review. The open nursing journal, 12, 1–14. Crossref
|27|2 Das klinische Simulationslabor als Experimentarium
Astrid Herold-Majumdar
Abstract
Didaktisch-pädagogische Grundlagen sowie aktuelle, wissenschaftliche Erkenntnisse des Simulationslernens werden in diesem Kapitel zusammengefasst. Sie dienen als Grundlage für die jeweils spezifischen Ausführungen in den Beispiel-Szenarien in Kapitel 4.
Schlüsselbegriffe: experimentelles Lernen, Clinical Simulation Lab (CSL), evidence-basierte Lehre, Lernkultur
Didaktisch-pädagogische Grundlagen des Simulationslernens
Simulation ist eine Methode, bei der Situationen aus der klinischen Praxis in einem Labor nachgestellt werden. Mit „klinischer Praxis“ ist hier die Versorgungsrealität in den diversen Settings (akutstationär, ambulant, Langzeitpflege, Rehabilitation, Public Health etc.), in denen Pflege praktiziert wird, gemeint. Das Labor und die Lehrperson geben dabei einen geschützten Rahmen vor, der Person-zentriert (Lernende, Lehrende, pflegebedürftige Person, Personen des Versorgungssystems), kooperativ, experimentell und interaktiv genutzt werden kann (Levett-Jones & Lapkin, 2014; Jeffries et al., 2015). Dafür wird eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen, die ein angstfreies und kreatives Lernen ermöglicht. Kreativ sein wird hier u. a. so verstanden, dass im Labor Handlungsalternativen ausprobiert werden können, die in der realen, klinischen Praxis mit Risiken behaftet wären oder nicht der Norm entsprechen würden. Fehler werden dabei als eine wichtige Quelle des Lernens verstanden. Entsprechend ist eine Fehlerkultur zu entwickeln, die Fehler im Übungsszenario erlaubt, wenn diese im Debriefing reflektiert werden. In der Übung oder in der Prüfung können Fehler, die in der Aktion unterlaufen sind, im Debriefing durch entsprechende Selbstreflexion wieder ausgeglichen werden. Das kann auch den Druck aus der Übungs- bzw. Prüfungssituation nehmen. Das Experimentarium schafft auch Raum für neue Handlungsstrategien, für die noch keine, geringe oder widersprüchliche wissenschaftliche Belege vorliegen, um Innovation zu befördern. Für die Patientensicherheit ist es wichtig, den Evidence- und Empfehlungsgrad der jeweiligen trainierten Intervention transparent darzulegen bzw. zu hinterfragen.
Die anleitende und begleitende Lehrperson, übernimmt dabei eine wichtige Rolle. Wir nennen sie in diesem Buch „Instrukteur“, „Facilitator“ oder „Moderator“. Sie schafft eine sichere und vertrauensvolle Lernumgebung, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Neues ausprobieren, Risiken eingehen, Fehler machen und sich über ihre eigene „Komfortzone“ hinaus entwickeln können (SimNAT Pflege e. V., 2019, S. 15). Der Facilitator versteht sich als Anleiter und Lernbegleiter. Er moderiert das Szenario und den damit verbundenen Lernprozess und fördert das selbstbestimmte Lernen. Das heißt, er lässt dem konstruktivistischen Paradigma (Gerstenmaier & Mandl, 1999) folgende Handlungs- und Experimentierspielräume offen und ermöglicht individuelle Lernstrategien, die individuellen Dynamiken folgen. Die Teil|28|nehmenden nehmen Informationen unterschiedlich schnell auf, können sich mehr oder weniger auf Situationen und Rollen einlassen und brauchen Rückzugsräume. Situationen und Rollen werden unterschiedlich interpretiert. Das bedeutet für die Planung des Szenarios, dass die Fallskizze und die Regieanweisung Gestaltungsspielräume offenlassen sollen. Die Teilnehmenden wechseln in unterschiedliche Rollen mit diversen Anforderungen und können sich entscheiden, ob sie aktiv agieren oder eher im Hintergrund der Beobachtung stehen. Wichtig dabei ist jedoch, dass nicht immer die gleichen Personen an der Frontlinie agieren während sich andere zurückhalten. Teilnehmende sind hier in ihrer Entwicklung zu fördern, indem sie ermutigt werden, sich aktiv einzubringen oder aufgefordert werden, sich zurückzunehmen, um sich aus einer beobachtenden Rolle in die Reflexion zu vertiefen. Die Instrukteurin bzw. der Instrukteur plant die Simulationseinheit und integriert sie sinnvoll in das Curriculum. Sie/er sorgt mit Unterstützung der Laborleitung und der technischen Assistenz für eine sichere und gut ausgestattete Lernumgebung, sichert das Lernergebnis und arbeitet mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Erkenntnisse und den Zugewinn an Kompetenzen heraus. Der positiven Bestärkung, dem Ermutigen zur Übernahme neuer Herausforderungen kommen dabei hohe Bedeutung zu. Der Fokus soll dabei auf gelungene Handlungssituationen gelegt werden. Misslungene Handlungssituationen und Fehler werden als Chance für das Lernen begriffen. In der Lern- und Prüfungssituation können diese vom Teilnehmenden durch die Selbstkritik und Reflexion ausgeglichen werden. Als Coach ist die Instrukteurin bzw. der Instrukteur offen für Lösungsstrategien, welche die Teilnehmenden selbst entwickeln. Die Aufgabe der instruierenden Person ist es lediglich, diese Strategien auf Basis des Wissensstandes und der Praktikabilität zu überprüfen. Dabei können Lernende auch ganz neue Handlungsoptionen entwickeln, die aktuell in der beruflichen Praxis noch nicht umgesetzt werden, jedoch ebenso dem Wissensstand entsprechen. Die Instrukteurin bzw. der Instrukteur sollte das Szenario keinesfalls durch eigene Handlungsroutinen dominieren, sondern muss auf das jeweilige „Lern- und Erfahrungsniveau“ (SimNAT Pflege e. V., 2019, S. 7) der Lernenden eingehen und den Prozess der Entdeckung von Handlungsoptionen zur Erweiterung des individuellen Handlungsrepertoires und der eigenen Kompetenzen durch die Lernenden selbst befördern.
Kasten 2-1: Prinzipien des Miteinanders im Labor
Als Grundlage für eine vertrauensvolle und experimentelle Lernatmosphäre einigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Facilitator auf folgende Prinzipien des Miteinanders im Labor:
Geschehnisse und Leistungen in der Simulationseinheit werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Es wird über das Handeln des Durchführenden in seiner Rolle und nicht seiner selbst gesprochen.
Das Arbeiten im Labor ist getragen von gegenseitigem Respekt, Ehrlichkeit und Wertschätzung.
Humor, Spaß haben und Lachen fördert das Lernen und sind an passenden Stellen erwünscht, jedoch wird nicht über andere gelacht, vor allem nicht, wenn sie sich in einer Rolle in Aktion befinden.
Fehler sind erlaubt, wenn sie im Debriefing reflektiert werden.
Der Facilitator gibt Hinweise (engl. cues, prompts) (SimNAT Pflege e. V., 2019), um die Realitätsnähe des Szenarios zu erhöhen. So können Gerüche und Geräusche im Hintergrund dazu beitragen, dass die Teilnehmenden in die Situation emotional eintauchen. Soll beispielsweise eine häusliche Beratungssituation simuliert werden, könnte Kaffeegeruch und leise Radiomusik im Hintergrund die Atmosphä|29|re des häuslichen Settings unterstützen. Ein akutstationäres Setting auf einer Intensivstation kann durch Monitorgeräusche und Alarmsignale erzeugt werden. Mit der Sprachfunktion der Simulator-Puppe, die über ein Headset gesteuert wird, kann der Instrukteur oder ein Teilnehmer die Interaktion simulieren und stimulieren. Dabei können überraschende Handlungssituationen kreiert werden, welche die Teilnehmenden in der Rolle der Pflegefachperson herausfordern oder es können indirekte Hilfen gegeben werden, wenn Teilnehmende in der Situation nicht weiterwissen oder etwas Wichtiges vergessen.
Ereigniskarten, welche die Wechselfälle des Lebens und der Berufspraxis abbilden, können vom Instrukteur in das Szenario eingespielt werden, um die Dynamik und die Komplexität der Lernsituation zu erhöhen. Ein unerwarteter Zwischenfall, der in der Fallskizze nicht beschrieben ist, stellt die Teilnehmenden vor die Herausforderung, vom Handlungsplan abweichen und das Ereignis in das Szenario einbauen zu müssen. Beispielsweise könnte während einer Beratungssituation der Teilnehmende in der Rolle des Angehörigen plötzlich aggressives Verhalten zeigen. Der inhaltliche Fokus muss dann auf die Bewältigung herausfordernder Verhaltensweisen gelenkt werden. Subjekt des Handelns wird der Angehörige, der zunächst eher in einer Nebenrolle agierte.
Sog. „Life Saver“ (deutsch: Lebensretter) (SimNAT Pflege e. V., 2019, S. 7) retten aus unerwarteten Situationen, wenn z. B. trotz guter Vorbereitung Ereignisse eintreten, die den Handlungsablauf stören oder gar blockieren. So könnte von Teilnehmenden beispielsweise Material vergessen worden sein. Mit den Teilnehmenden kann vor der Aktion im Briefing vereinbart werden, dass sie in einer solchen Situation die Rufanlage betätigen können, um sich Hilfe zu holen. Die Moderatorin und Lernbegleiterin oder eine Tutorin, z. B. eine Studierende eines höheren Semesters bzw. eine fortgeschrittene Auszubildende, kann dann die Rolle einer erfahrenen Pflegefachperson einnehmen.
Das Einfrieren (engl. freezing) ist eine weitere Methode, mit der Störungen (z. B. betritt unerwartet eine nicht beteiligte Person das Labor, der Handlungsablauf kann nicht fortgeführt werden, weil wichtiges Material fehlt, das Simulationsgerät weist eine technische Störung auf) bewältigt oder Lernsituationen vertieft werden können. Dazu sollte ein eindeutiges Signal, das sich deutlich von den Geräuschen des Szenarios und Settings abhebt, vereinbart werden (z. B. ein Glockengeräusch, Regieklappe, Hupe). Sequenzen der szenischen Darstellung, können dann angehalten werden. Nach Behebung der Störung kann die Simulation ab dieser Stelle weitergeführt werden. Auch zur Vertiefung der Lernsituation kann das Einfrieren angewandt werden. Ähnlich wie in einem Film sollen die Teilnehmenden die Aktion stoppen und in der entsprechenden Körperhaltung verharren. Die Methode ist aus der systemischen Aufstellung bekannt. Die Lernenden haben die Gelegenheit, die Sequenz intensiv zu erleben, indem sie sich beispielsweise in eine angespannte Körperhaltung hineinbegeben und gefühlsmäßig vertiefen. Das Einfrieren zur Vertiefung der Lernsituation erfordert von der Instrukteurin oder dem Instrukteur viel Erfahrung, denn sie müssen diejenigen Situationen erkennen, die spannungsgeladen sind oder eine besondere Lernerfahrung für die Teilnehmenden darstellen. Im Debriefing kann diese Situation reflektiert werden. Dazu kann die Sequenz auch erneut dargestellt werden. Die instruierende Person kann die szenische Darstellung zusätzlich unterstützen, indem sie z. B. den Fokus der Teilnehmenden auf die beanspruchten Körperteile und auf belastende Emotionen richtet. In der Reflexion kann weiter an der Sequenz gearbeitet werden, indem die Teilnehmenden Vorschläge zur Entspannung der Situation erarbeiten und diese wiederum szenisch darstellen. Greifen wir hier das Beispiel des Angehörigen, der in der Beratungssituation plötzlich aggressives Verhalten zeigt, auf, so könnte der Moment, in dem das Verhalten erstmals auftritt und von der Teil|30|nehmerin in der Rolle der Pflegefachperson abgewehrt wird, eingefroren werden. Auf Basis der Theorie und aktuellen Forschungslage zu wirksamen Strategien der Deeskalation könnten von den Teilnehmenden Lösungsvorschläge erarbeitet und wiederum szenisch umgesetzt werden. Wird die Sequenz dann nochmals eingefroren, könnten die Teilnehmenden am eigenen Leib erfahren, wie die Spannung nachlässt und belastend erlebte Gefühle wie Angst bewältigt werden können.
Um ihrer tragenden Rolle gerecht zu werden, müssen Instrukteure gemäß der NLN Jeffries Simulation Theory bestimmte Eigenschaften vorweisen (Adamson, 2015). Sie sollten über Selbstsicherheit, Lehrkompetenz, pflegerische Handlungskompetenz, technische Fertigkeiten und Verantwortungsbewusstsein verfügen. Dienlich für die Motivation der Teilnehmenden ist Engagement, Flexibilität und Kreativität (SimNAT Pflege e. V., 2019). Eine offene Haltung sowie Ruhe sind förderlich für Vertrauen und Kommunikation. Zudem sollte der Facilitator eine Ausbildung in Simulationslehre absolviert haben und kontinuierlich supervidiert werden (SimNAT Pflege e. V., 2019).
In der Anleitung und in der Reflexion können vom Instrukteur bzw. der Instrukteurin neben klassischen, didaktischen Methoden auch kreative Methoden (Antosch-Bardohn, 2021) eingesetzt werden, die das forschende Lernen fördern. Dies bietet die Gelegenheit, experimentell neue Handlungsstrategien zu entwickeln und eingefahrene Routinen aufzubrechen. Eine kreative Methode ist beispielsweise die Kopfstand-Methode, bei der überlegt wird, was getan werden müsste, um die Situation der pflegebedürftigen Person zu verschlechtern, anstatt sie zu verbessern. Anders als in der realen, klinischen Situation können diese Handlungen auch tatsächlich im Labor umgesetzt werden, um die Folgen zu erleben. Diese umgekehrte Herangehensweise kann die Lernenden und Lehrenden auf Lösungsstrategien kommen lassen, an die zuvor nicht gedacht wurde. Mit der „Drei-Wünsche Methode“ können Handlungsrestriktionen aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen aufgebrochen werden. Oft werden fehlende Ressourcen und Personalknappheit von Lernenden in der Pflege als Hinderungsgrund für patientenorientierte Lösungen angeführt. Wenn die Instrukteurin/der Instrukteur eine „Fee“ erscheinen lässt, bei der die Teilnehmenden drei Wünsche, egal welcher Art, offen haben, können Lösungsstrategien entwickelt werden, an die bisher nicht gedacht wurde. Anschließend kann der Ressourcenbedarf für diese Lösungsstrategie erhoben und Möglichkeiten zur Deckung dieses Bedarfs diskutiert werden. Kreativitätstechniken fördern den Perspektivenwechsel und lassen das klinische Simulationslabor als Experimentarium nutzen. An dieser Stelle kann nur beispielhaft auf kreative Methoden eingegangen werden. Ihr Potential für das experimentelle Lernen und die Lösungsentwicklung ist hoch, sodass sich das Literaturstudium zur Vertiefung lohnt. Zudem bringen diese Methoden Abwechslung und Spaß in die Lehre.
Innovationen
Neben





























