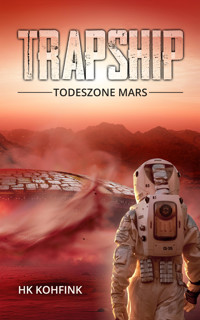Heiko Kohfink
KOLLAPS – Funguszyklus Buch 1
Impressum
ISBN: 9783739453156
Copyright © 2019 Heiko Kohfink
(Pseudonym HK Kohfink)
Uhlandstr.7/72124 Pliezhausen
Kontakt: www.heiko-kohfink.de
Coverdesign: Giusy Ame / Magicalcover
Bildquelle: Depositphoto
Illustration: Markus Kohfink
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Der Autor übernimmt keine Haftung für die Inhalte der genannten Webseiten Dritter, da er sich diese nicht zu eigen macht, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweist.
Zu diesem Buch: Die Welt in naher Zukunft. Die Menschheit steuert mit selbstgeschaffenen Problemen unweigerlich ihrem Untergang entgegen. Doch die tödlichste Bedrohung lauert nicht über, sondern unter der Erde. Der Kollaps, der die Menschheit trifft, kommt schnell und unerwartet. Eine uralte Macht erhebt sich mit aller Kraft gegen die Zerstörung des Planeten. Und sie kennt nur ein Ziel: Die Vernichtung der Menschheit! Die wenigen Verzweifelten, die in einer postapokalyptischen Welt zurückbleiben, sehen sich Gefahren gegenüber, mit denen bisher niemand gerechnet hätte…
Heiko Kohfink, 1967 in Reutlingen geboren, ist Techniker und lebt mit seiner Frau, die ebenfalls schriftstellert, in der Nähe seiner Heimatstadt. Inspiriert durch das Lesen, das schon immer seine größte Leidenschaft war, hat er sich vor einiger Zeit an sein Erstlingswerk KOLLAPS gewagt, den ersten Band der dreiteiligen Funguszyklus-Reihe. Wenn er nicht gerade vor dem Bildschirm sitzt und über neuen Buchprojekten brütet, verbringt er gerne Zeit mit seinen beiden Söhnen, unternimmt lange Spaziergänge, liest viel oder bringt mit seinem oft sehr speziellen Humor seine ganze Familie an den Rand der Verzweiflung.
KOLLAPS
FUNGUSZYKLUS, Buch 1
Heiko Kohfink
Für meine Frau Corinna, die mir,
obwohl Fantasy nicht zu ihrer bevorzugten Lektüre gehört, immer mit Rat und Tat zur Seite stand und meinen Sohn Markus, der die Idee zum Aussehen der Pilzköpfe geliefert hat
Prolog
Dunkelheit… Eisige Kälte… der endlose Weltraum
In der Randzone der Galaxis herrschte Ödnis und Einsamkeit. Hier waren die Sonnensysteme so weit verstreut, dass nur vereinzelte blasse Sterne in der Unendlichkeit glühten. Inmitten dieser trostlosen Leere zog ein dunkler, langsam um sich selbst rotierender lebloser Materieklumpen seine Bahn durch die Finsternis.
Seit Langem schon steuerte er auf ein kleines System am Rande der Galaxis zu. Jahre vergingen, bis er die Flugbahnen der Himmelskörper in der Außenzone gekreuzt hatte und sich nun auf direktem Kollisionskurs zum dritten Planeten befand.
Ohne nennenswerte Eigenrotation umkreiste diese leblose Welt ihre Sonne. Dunkel, grau und kalt auf der sonnenabgewandten Seite, hell erleuchtet, brodelnd und heiß auf der anderen bot er ein beeindruckendes Bild aus dem Weltraum.
Die eine Hälfte glühte in Gelb- und Orangetönen. Hier herrschten ungeheure Hitze und Lebensfeindlichkeit. Eruptionen der wenigen, aber dafür umso größeren Vulkane in der Randzone zwischen Tag- und Nachtseite sprenkelten diese mit rotglühenden Punkten. Ewige Dunkelheit und eisige Temperaturen machten die andere Hälfte dieser Welt genauso unwirtlich und tot.
Leben hatte sich auf diesem Planeten bisher nicht entwickelt, obgleich es im schmalen Gürtel der Übergangszone möglich gewesen wäre.
Der Asteroid trat in die Umlaufbahn ein und näherte sich der dunklen Seite. Große Mengen Eis, aus dem er überwiegend bestand, schmolzen beim Eintritt in die dünne Atmosphäre und fielen als orkanartige Wassermassen zur Planetenoberfläche hinunter. Der riesige Brocken zerbrach in zwei Teile, von denen eines zu über der Hälfte aus Gestein mit einem hohen Anteil an Eisen bestand. Wie ein gigantischer Schmiedehammer schlug dieses ein und verwandelte den Planeten in ein Inferno. Aus der Erdkruste wurde ein großes Stück herausgetrennt und in den Weltraum geschleudert. Die freigesetzte Energie war gewaltig. Massive, grell leuchtende Eruptionswellen breiteten sich von der Einschlagstelle über die gesamte Oberfläche aus. Der Aufprallvektor des Asteroiden sorgte dafür, dass der Planet begann, sich langsam um seine eigene Achse zu drehen.
Das zweite Asteroidenstück, das hauptsächlich aus Eis bestand, verdampfte auf seinem Weg nach unten weit gehend vor dem Einschlag. Der Rest fuhr wie eine Titanenfaust herab und schleuderte Magma, Gestein und Wasser kilometerhoch in die bereits dichter werdende Atmosphäre. Mächtige Dampfwolken erhoben sich in den rotglühenden Himmel, um hier abzukühlen und erneut als monsunartige Regengüsse auf die sich abkühlende Planetenoberfläche zurückzufallen. Innerhalb kurzer Zeit entstand so eine Hülle aus Wasser, Sauerstoff und weiteren Gasen, die den Planeten umgab. Jahrzehnte schüttelte sich die Erde unter den aufgewühlten Elementen, bis wieder Ruhe einkehrte.
Das herausgetrennte Planetenstück hatte nicht genug Energie, um sich aus dem Anziehungsbereich seines Planeten zu befreien. Jahrhunderte dauerte es, bis es in einer immer stabileren Umlaufbahn seine Heimatwelt umkreiste. Seine Gravitation fing viele der kleineren Brocken ein, die wie Satelliten durch das Weltall trieben. Was er nicht an sich zog, fiel zur Planetenoberfläche zurück. Noch Jahrzehnte nach dem Einschlag glühte der Himmel nachts von Meteoriten, die auf ihrem Weg hinab hell leuchtende Bahnen ins dunkle Firmament schnitten.
Doch der Asteroid, der mit seinen Eismassen die Atmosphäre und die Ozeane des Planeten begründet hatte, war keineswegs tot gewesen. Viele der Aminosäuren, die in ihrem tiefgefrorenen Gefängnis durchs Weltall gereist waren, wurden bei der Kollision vernichtet. Aber einige hatten überlebt und begannen nun, sich auszubreiten. Das Leben war auf dem Planeten angelangt. Mit den Aminosäurebausteinen war jedoch noch eine weitere Kreatur von den Sternen gekommen. Und auch diese hatte in den Tiefen des ehemaligen Asteroiden überlebt.
Das Wesen war alt. Es existierte schon Jahrhunderte, bevor die Sonne seines Heimatsystems kollabiert war und seine Welt ins Verderben gerissen hatte. Die Katastrophe hatte den Planeten zerfetzt und es in einem der Fragmente auf eine lange Reise durch den Kosmos geschickt.
Am ehesten war es als eine Art intelligenter Pilz zu bezeichnen. Als das leistungsfähigste Lebewesen, das diesen Teil der Galaxis jemals besiedelt hatte, konnte es sich an nahezu jede Umgebung anpassen. Seine lange Reise durch die Tiefen des Weltraums hatte es tiefgefroren, aber nicht tot, verbracht.
Nun war der Pilz wieder auf einem Planeten angekommen und begann erneut zu leben. Ein winziger überlebender Raumfahrer, der sich von Licht und Wasser ernährte. Er streckte mikroskopisch kleine Fäden nach allen Richtungen aus und wandelte organische Materie in die verschiedenen Baustoffe um, die er für sein Wachstum benötigte.
Als die ersten mehrzelligen Organismen durch die Meere trieben, war er bereits am Neustrukturieren seiner Welt. Er war da, als die Meeresbewohner sich aufmachten, den sicheren Lebensraum der Ozeane zu verlassen. Der Pilz erlebte die Anfänge der Säugetiere, die sich aus der Asche des Kometen erhoben, der die Dinosaurier ausgelöscht hatte.
Stetig und unaufhaltsam wuchs er weiter. Auch vor der Durchquerung der Weltmeere machte er nicht halt, er breitete sich einfach unter dem Meeresgrund aus. Und so überzog sein Geflecht schließlich die gesamte Erde.
Die Synthetisierung von Aminosäuren kannte er seit Jahrtausenden. Nun entwickelte er biogene Amine, die er als Neurotransmitter nutzte. So entstand ein neuronales Netzwerk, das es ihm erlaubte, wichtige Informationen in Sekundenbruchteilen über sein gesamtes Ausbreitungsgebiet weiterzugeben und zu speichern.
Im Laufe der Zeit erlangte er eine kollektive Intelligenz. Erschütterungen der Prärie, wenn diese unter den riesigen Bisonherden erzitterte, nahm er ebenso wahr, wie die Brandung an den Küsten der Ozeane. Er lauschte den Gesängen der Wale und den Gesprächen der Delfine.
Er erspürte die leisesten Vibrationen, die von den Lebewesen auf dem Planeten erzeugt wurden und entwickelte einen Sinn, der jegliche Bewegung auf der Erde zu einem großen Gesamtbild verschmolz.
Die ersten Affen, die sich von den Bäumen der afrikanischen Urwälder schwangen, um sich über Europa und Asien bis in die entferntesten Winkel der Erde auszubreiten, beobachtete er. Er sah Zivilisationen erblühen und wieder im Dunkel der Zeit verschwinden. Er schüttelte sich unter den Kriegen und der Vernichtung, die die Menschen anrichteten und beobachtete zunehmend argwöhnisch, wie diese den Planeten verwüsteten.
Pestizide, die Ernten ergiebiger machten, griffen ihn an. Umweltgifte verpesteten Flüsse und Meere. Schwermetalle, radioaktiver Abfall und Unmengen von Müll wurden im Boden vergraben und vergifteten seinen Lebensraum.
Zunächst versuchte der Pilz, die direkte Bedrohung zu bekämpfen. Gifte wandelte er um, oder transportierte sie in Regionen tief unter der Erde ab. Aus verstrahlten Gebieten zog er sich zurück. Doch letztendlich konnte er sich gegen die fortschreitende Zerstörung seines Lebensraumes nicht dauerhaft zur Wehr setzen. Er begann zu sterben und wie jedes Lebewesen wehrte er sich dagegen. Sein schlummerndes weltumspannendes Bewusstsein erwachte und er beschloss, sich der Quelle seiner Probleme zuzuwenden.
Er war intelligent. Nur wenige Jahre brauchte er, um eine Lösung zu entwickeln, und am Ende hatte er einen Weg gefunden, um zu überleben.
Winter
Zweites Jahr, Januar
Es war saukalt. Ehrlich gesagt konnte ich mich nicht erinnern, je einen so kalten Tag erlebt zu haben. Der Atem gefror direkt, nachdem ich leise und vorsichtig ausatmete und sammelte sich bereits in Form von winzigen Eiszapfen in meinem mittlerweile beachtlichen Bart. Der Rest wehte in einer kleinen, sich auffächernden Wolke über meine Tarnung und senkte sich als glitzernder Eiskristallschauer auf den Unterstand aus Ästen und Blättern ab, hinter dem ich mich versteckt hielt. Trotzdem war es ein wunderschöner Tag. Ein stahlblauer Himmel glänzte über den Bäumen. Wolkenlos und ohne die früher ständig vorhandenen Kondensstreifen von hochfliegenden Flugzeugen.
Dazu herrschte eine Stille, die noch vor kurzer Zeit undenkbar gewesen war. Außer den Geräuschen aus der Natur, gelegentlichem Rascheln im dichten Unterholz, hier und da Vogelgezwitscher und weiter entfernt dem Glucksen und Gurgeln des Neckars, der noch nicht ganz zugefroren war, war nichts zu hören. Die größtenteils kahlen Bäume und Büsche waren von glitzernden Reifpanzern bedeckt, die im Sonnenlicht funkelten als wären die Äste mit Diamantstaub bedeckt.
Es war schön hier und ich genoss die Stille, bis diese von einem leisen Rascheln im Unterholz vor mir gestört wurde. Sofort war ich hellwach und starrte konzentriert in Richtung des Geräusches. Ungefähr vierzig Meter vor mir trat ein Reh misstrauisch aus einem schützenden Gebüsch aus niederen Tannen, um die letzten verbliebenen Grasbüschel auf der kleinen Lichtung vor mir abzuäsen. Die Diamantsplitter auf den Ästen fielen glitzernd zu Boden, als es witternd aus seiner Deckung auf die kleine Lichtung trat, in deren Mitte ich eine beachtliche Menge an Heu aufgeschichtet hatte.
Ein leiser Wind säuselte mir in den Ohren, den ich eben noch so vernahm. Der Tinnitus, welcher mich schon seit Jahren plagte, war lauter. Doch daran hatte ich mich mittlerweile gewöhnt. Während der letzten beiden Jahre hatte ich sogar den Eindruck gehabt, die Ohrengeräusche würden leiser, aber das konnte natürlich täuschen. Schließlich war auch die Welt heute deutlich stiller als noch vor zwei Jahren.
Das Reh fuhr fort, an den Grashalmen zu knabbern, die den strengen Winter bisher überlebt hatten. Dabei näherte es sich immer weiter dem Köder, den ich mitten auf dem Wildwechsel ausgebreitet hatte.
Plötzlich erstarrte es mitten in der Bewegung und schaute aufmerksam in meine Richtung. Ich hielt den Atem an. Hatte es mich trotz meiner Tarnung gewittert? Das wäre auch kein Wunder, wenn es sich über die kleine, etwas streng riechende und leicht dampfende Hecke aus Blättern und Zweigen gewundert hätte. Dass es nicht sofort davonlief, lag erstens vor allem daran, dass der Wind auf mich zukam und das arme Tier deshalb meine Witterung nur schlecht aufnehmen konnte. Zweitens glich ich, wie bereits erwähnt einer ziemlich großen Hecke. Diese Tarnung hatte mich morgens einige Zeit gekostet, sich aber nun zu guter Letzt wohl doch noch gelohnt. Es ging also oberflächlich betrachtet keine Gefahr für das Tier von mir aus. Es konnte den halb gespannten Compoundbogen in meinen Händen auch nicht sehen. Falls doch, wäre es vielleicht geflohen, aber die Waffe war hinter der Tarnung mit viel Tannengrün nicht als solche zu erkennen. Bestimmt hätte das Reh auch einen ungetarnten Bogen nicht als Gefahr wahrgenommen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Nur die Atemwolke, die regelmäßig wie von einer alten Dampflok aufstieg und sich langsam zwischen den Bäumen verteilte, hätte das Tier verschrecken können. Glück für mich, dass der Köder eine geradezu magnetische Anziehungskraft hatte und das Reh darum wohl nicht weiter über Gefahren nachdachte. Der Hunger war zu groß!
Genau genommen gab es in weitem Umkreis außer mir kein Lebewesen, das überhaupt zu vernunftbegabtem Denken fähig gewesen wäre. Jedenfalls soweit ich wusste. Während das Reh also langsam und ziemlich unvorsichtig näherkam, dabei immer wieder stehenblieb, den Kopf senkte und sich nach den wenigen aus dem Schnee ragenden Grashalmen streckte, schweiften meine Gedanken ab. Ich dachte an den Tag, an dem sich mein Leben in wenigen Stunden vollkommen verändert hatte und von dem ich immer noch nicht ganz genau wusste, was zum Teufel damals eigentlich passiert war…
Es war ein ganz normaler Arbeitstag vor mittlerweile fast zwei Jahren, an dem sich das geordnete und ziemlich langweilige Leben von Jan Finke auf einen Schlag in Nichts auflöste. Jan, das bin ich und ich wohnte damals in einem kleinen Dorf namens Neckartailfingen. Da ich kaum davon ausgehe, dass jemand weiß, wo das genau liegt, versuche ich es zu erklären: Wenn Sie sich von Stuttgart ungefähr zwanzig Kilometer nach Süden bewegen, dann sind Sie da. Es liegt, wie der Name schon sagt, am Neckar. Genauer gesagt fließt der Fluss sogar mitten durch den Ort. Ein idyllisches Fleckchen im tiefsten Schwabenland, mitten zwischen kleinen Wäldern, Feldern und vielen Obstwiesen. Eigentlich ein Ort, an dem man sich wohlfühlen könnte, müsste man nicht jeden Tag zur Arbeit gehen.
Ich wohnte damals in der sogenannten Vorstadt, was nicht ganz dem entsprach, was das Wort aussagte. Zwar war das Wohngebiet tatsächlich dem eigentlichen Dorf auf der anderen Seite des Flusses vorgelagert, aber das Ganze als Stadt zu bezeichnen, war mit Sicherheit übertrieben. Ich hatte eine kleine Mietwohnung im ersten Stock eines ziemlich baufälligen Hauses in der Nähe des Dorfrandes. Wohnraum auf dem Land war in den letzten Jahrzehnten nahezu unerschwinglich geworden und selbst die Glücklichen, die ein Haus oder eine Wohnung fanden, mussten horrende Preise bezahlen. So gesehen hatte ich Glück mit meiner Bude. Im Winter war sie kalt. Trotz Heizung und Kaminofen zog es durch die alten Fenster wie Hechtsuppe. Im Sommer – na ja, ich will es mal so formulieren: Wenn Sie gerne in die Sauna gehen, hätten Sie in dieser Wohnung im Sommer nur noch ein Aufgussbecken gebraucht. Dachisolierungen waren zu Zeiten der Grundsteinlegung dieses Hauses wohl noch nicht bekannt gewesen. Aber es war, wie gesagt, eine günstige Wohnung und zudem hatte ich sie mir für meine Begriffe gemütlich eingerichtet. Überdies sorgte der Kamin im Winter für eine sehr heimelige Atmosphäre. Das Beste daran war aber ganz eindeutig die riesige Dachterrasse, auf der man sommers wie winters am Abend draußen sitzen, ein Glas Rotwein genießen und die Sterne beobachten konnte.
Leider – oder vielleicht auch glücklicherweise, wenn man die folgenden Ereignisse bedenkt – war ich zu dieser Zeit auch gerade solo. Das war nicht immer so gewesen. Ich hatte meine Exfrau vor vielen Jahren in einem Urlaub in Spanien kennengelernt. Nach einer stürmischen Affäre und einer überstürzten Heirat hatten wir uns ein kleines Haus gekauft und von Kindern geträumt. Leider wurde dieser Wunsch aber nie Realität. Jedenfalls lebten wir uns mehr und mehr auseinander und nach nur fünf Jahren stand ich wieder allein da. Meine Exfrau, Vater Staat und das Finanzamt hatten bei der Scheidung dafür gesorgt, dass ich mir erst mal keine superteure Luxuswohnung leisten konnte. Also hatte ich mich nach dem Verkauf unseres Hauses, das zum größten Teil sowieso der Bank gehörte auf die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft gemacht und diese in besagtem Dörfchen gefunden. Die offensichtliche Baufälligkeit des Hauses war wohl auch der Grund, warum die Wohnung und auch die darüber schon seit Jahren leer stand. Seit gut zwei Jahren wohnte ich nun hier und war eigentlich nicht unzufrieden mit meinem Leben. Unten im Erdgeschoss hatte ein Zahnarzt seine Praxis vor einem halben Jahr eingerichtet – was mich jeden Tag daran erinnerte, dass auch mein letzter Besuch bei ihm oder einem Vertreter seiner Zunft schon seit längerem überfällig war.
Aber zurück zum Anfang meiner Geschichte: Es war der letzte Tag der alten Zeitrechnung, frühmorgens um fünf. Mühsam kämpfte ich mich aus einem Traum heraus, der bereits verblasste, als ich noch im Halbschlaf den Vögeln zuhörte, die mich mit ihrem Gezwitscher geweckt hatten. Es dauerte einige Sekunden, bis ich realisierte, dass die Töne nicht von vor meinem Fenster, sondern von meinem Nachttisch, genauer gesagt von meinem Handy kamen. Ich hatte einen natürlichen Weckton eingestellt, in der irrigen Annahme, dass man mit Naturklängen entspannter aufwachte. Das funktionierte um acht oder neun Uhr auch ganz gut, früh um fünf blieb dieser Effekt jedoch aus. Müde und verspannt arbeitete ich mich unter der völlig verschwitzten Bettdecke hervor und wuchtete meine knapp neunzig Kilogramm in die Höhe. Ein kleiner Bauchansatz blitzte unter meinem hochgerutschten Pyjamaoberteil hervor, der durch zu viel Essen, zu viel Wein und zu wenig Sport langsam aber sicher bedenkliche Ausmaße annahm. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich war trotz allem mit knapp zwei Metern Körpergröße eher als schlank zu bezeichnen, aber die unästhetische Rundung in meiner Körpermitte störte mich doch. Außerdem hatte ich fast ständig Kreuzschmerzen und meine Lendenwirbel meldeten sich täglich anklagend und schmerzvoll zu Wort - ebenfalls eine Auswirkung der mangelnden Bewegung.
Ich streckte mich und stapfte müde ins Bad um den übernächtigten und unrasierten Kerl, der mir da aus dem Spiegel entgegenschielte, gesellschaftsfähig zu machen. Unterwegs stolperte ich über eine leere Rotweinflasche, die laut klirrend unter dem Flurschrank verschwand. Was machte die denn direkt vor meiner Schlafzimmertür? Ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Auf jeden Fall weckte mich das Geklirr vollends auf.
Die letzten Tage zeigten Wirkung. Ich war es eigentlich gewohnt abends gegen zweiundzwanzig Uhr ins Bett zu gehen, um kurz vor fünf wieder aufzustehen. Dieser Rhythmus ließ sich leicht durchhalten. Ausschlafen konnte ich schließlich am Wochenende genug. Mit wenig Familie und noch weniger Freunden war das nicht weiter schwer. Seit Tagen war nun aber schon die Fußballweltmeisterschaft in vollem Gange und obwohl ich kein großer Fan dieser Sportart, noch irgendeiner anderen war, zog es mich doch in seinen Bann, wie mühelos unsere Nationalelf bislang von Spiel zu Spiel gekommen war. Gestern hatte ich mit zwei Freunden noch lange auf der Terrasse gesessen. Wir unterhielten uns vor allem über das Halbfinale, und sahen uns Ausschnitte davon an, die auf jedem Kanal gesendet wurde. Einige Flaschen Wein waren dabei ebenfalls geleert worden. Leider war es bei mir wohl ein Glas zu viel gewesen. Daher vermutlich auch meine Kopfschmerzen!
Heute Abend nun sollte das Endspiel gegen Frankreich stattfinden und die Vorfreude auf dieses Ereignis zauberte mir bereits zu dieser frühen Stunde ein Lächeln aufs Gesicht. Ich begann also mit der Zahnbürste mein Gebiss zu bearbeiten, um zumindest ein frisches Gefühl im Mund zu bekommen, wenn ich schon keins im Kopf hatte.
Danach tappte ich im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf die Balkonterrasse. Das war bei schönem Wetter mein morgendliches Highlight. Es war herrlich, um diese Uhrzeit hier draußen zu sitzen und über die angrenzenden Dächer zu blicken. Man fühlte sich, als wäre man allein auf der Welt. Leises, diesmal echtes, Vogelgezwitscher von einigen frechen Spatzen, die bereits zu dieser frühen Stunde auf den Terrassensteinen herumhüpften und sich um die Krümel meines gestrigen Abendessens stritten, war zu hören. Ein angenehm kühler Wind wehte hier draußen, als ich mich mit lautem Ächzen in meine Lieblingsliege fallen ließ. Weit über mir zog ein einsamer Habicht seine Kreise. Der war wohl auch auf der Suche nach einem Frühstück. Ich beschattete meine Augen mit der Hand und sah ihm eine Weile zu. Bereits jetzt war die Sonne deutlich zu spüren. Es würde auch heute wieder ein heißer Tag werden. Der strahlend blaue Himmel war schon um diese Tageszeit von den Kondensstreifen der Flugzeuge durchzogen. Und auch auf den Drohnenflugstrecken waren bereits etliche dieser selbstständig steuernden Maschinen unterwegs. Wie Perlen auf einer Kette flogen sie auf ihren vorprogrammierten Pfaden durch den Himmel.
Eigentlich der falsche Tag, um zur Arbeit zu fahren, aber war es das nicht immer? Manchmal hatte ich das Gefühl, mein Leben lief einfach so dahin, ohne große Höhen und Tiefen und ich vermisste das Besondere, das wahrscheinlich gar nie stattfinden würde. Die Highlights in meinem Leben waren die Urlaube, die ich meist in Griechenland verbrachte.
Während ich in Gedanken also schon auf der fernen griechischen Insel war, begann um mich herum der Morgen zu erwachen. Anders gesagt, es wurden Automotoren gestartet, die Menschen fuhren los, um ihren Tätigkeiten nachzugehen, und ein Motorrad knatterte vorbei. Sogar rund hundert Meter von der Straße entfernt, konnte man noch das verbrannte Benzingemisch riechen, lange nachdem das Motorrad schon nicht mehr zu sehen, wohl aber noch zu hören war. Eigentlich hörte man zu jeder Zeit immer irgendwo Automobillärm, Flugzeuge, Drohnen, Kirchenglocken oder Menschen. Es gab mittlerweile einfach zu viele Menschen auf der Welt. Sogar hier im beschaulichen Schwabenländle, mitten auf dem Land, wurde es zunehmend lauter. Obwohl mehr und mehr auf Elektroantriebe und autonomes Fahren gesetzt wurde, waren die Verbrennungsmotoren noch nicht gänzlich verschwunden. Auch mein Hybridwagen lief noch zum Teil mit Benzin, was mir regelmäßig ein schlechtes Gewissen und exorbitant hohe Steuern einbrachte. Nur musste man sich den Umweltschutz eben auch leisten können. Eins der neuen Elektromodelle oder sogar eine Flugdrohne waren in meiner momentanen finanziellen Lage leider nicht drin.
Seufzend wandte ich mich wie jeden Morgen kurz den neuesten Nachrichten auf meinem Tablet zu. Die seit Jahren alles dominierende Müllflut auf dem Planeten war auch heute wieder Thema der Titelseite. Im Atlantik vor der brasilianischen Küste hatte ein Kreuzfahrschiff einen Müllstrudel entdeckt, der die Fläche von Baden-Württemberg bedeckte. Das Video unter dem Text zeigte eine träge Masse aus Kunststoffabfällen, die sich langsam um ihren Mittelpunkt drehte. Diese Art von Strudeln war leider keine Seltenheit mehr. Obwohl schon viele Länder den Kampf gegen die Umweltverschmutzung aufgenommen hatten, entstand der Unrat immer noch schneller als man ihn beseitigen konnte. Riesige Müllsauger schwammen mittlerweile überall auf den Weltmeeren, um mit dem ganzen Dreck fertig zu werden. Sie sammelten den Abfall ein und wandelten ihn wieder in brauchbares Material um. Eine tolle Sache, eigentlich! Aber kaum war ein Müllteppich beseitigt, sammelte sich das Zeug schon an Dutzenden anderen Stellen. Dazu kamen die Deponien überall auf der Welt, deren Inhalt im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel stank. Neue Technologien, neue Werkstoffe und Materialien, die sich durch Bakterien zersetzten und neue Verhaltensweisen der Menschen setzten sich nicht schnell genug durch, um der fortschreitenden Zerstörung überall auf der Welt Einhalt zu gebieten. Ich schüttelte den Kopf und las weiter. Im mittleren Osten gab es mal wieder Mord und Totschlag und unsere Regierung hatte währenddessen nichts anderes zu tun, als ein mehrere hunderttausend Euro teures Grillfest für den amerikanischen Präsidenten auszurichten. Natürlich mit allem, was in Politik und Wirtschaft Rang und Namen hatte. Ich schüttelte angewidert den Kopf. Eine Currywurst hätte es doch auch getan.
Überhaupt war es ein Wahnsinn, was zurzeit auf der Welt abging. Sah man sich die Ereignisse auf unserem Planeten so an, konnte man schon vom Glauben abfallen. Sturmfluten an der Nordsee, Überschwemmungen in Bayern und Österreich, monsunartige Niederschläge in der Schweiz. Dass die Berge nicht weggespült wurden, war ein Wunder. Wirbelstürme über Berlin, die für verheerende Schäden verantwortlich waren. Dazu eine Flüchtlingswelle gigantischen Ausmaßes aus den afrikanischen Ländern und dem mittleren Osten, die unter einer nie dagewesenen Dürreperiode litten. Nicht zuletzt deshalb hatten nahezu alle europäischen Länder wieder Grenzkontrollen eingeführt. An vielen Landesgrenzen waren in den letzten Jahren zudem mehr und mehr Mauern und Stacheldrahtzäune errichtet worden, die wie Pilze aus dem Boden schossen.
Apropos Pilze: die waren seit einigen Tagen auch im Gespräch. Plötzlich und vollkommen zeitsynchron spross auf der ganzen Welt eine unbekannte Pilzart aus dem Boden - interessanterweise auch in Gegenden, in denen zu dieser Jahreszeit eigentlich gar keine Pilze wachsen konnten und auch in entlegenen Gebieten mit klimatischen Bedingungen, die den Pilzen bisher missfallen hatten. Sie wuchsen in ganz Europa, in Asien, Amerika aber auch in der Hitze Afrikas und der Kälte Grönlands. Es handelte sich um einen zirka zehn Zentimeter hohen gräulichen Pilz, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einer aus dem Boden ragenden Faust hatte. Die Biologen und Forscher waren sich über dieses seltsame Gewächs allerdings noch nicht einig geworden. Die meisten führten das plötzliche Erscheinen dieser Gattung auf die vollkommen aus den Fugen geratenen klimatischen Bedingungen zurück. Nur darüber, dass die Pilze ein neuartiges Toxin enthielten, das in hohen Dosen tödlich war, waren sich alle einig. Die Wissenschaftler warnten sogar davor, diesen Gewächsen nicht zu nahe zu kommen!
»Also nicht gerade ein Speisepilz«, dachte ich und wandte mich anderen Themen zu.
Genau genommen interessierte es mich auch nicht wirklich, woher die Dinger auf einmal kamen. Schließlich hatten wir genügend andere Probleme, die uns beschäftigten. Die restlichen Nachrichten überflog ich nur noch, es handelte sich in erster Linie um Klatsch und Tratsch. Nur eine Meldung zog noch einmal mein Interesse auf sich, als ich das Tablet bereits weglegen wollte. In Hamburg war das dritte Kreuzfahrtschiff für einen reichen Investor aus den Emiraten vom Stapel gelaufen. Das Besondere an den drei Schwesterschiffen war, dass sie ausnahmslos ohne Dieselmaschinen auskamen. Es waren die ersten Schiffe dieser Größe, die ihre Energie aus der Spaltung des Wassers in Sauerstoff und Wasserstoff gewannen. Zudem war nahezu der gesamte Decksaufbau mit Solarzellen der neuesten Generation bedeckt, die den Strom für die Energieumwandler an Bord lieferten. Theoretisch, so hieß es in dem Bericht, waren die Schiffe in der Lage, nahezu unbegrenzt die Weltmeere zu durchkreuzen. Na, das war doch mal was Positives. Endlich mal Schiffe, die nicht auch noch zur Umweltverschmutzung beitrugen. Auf jeden Fall sah das riesige Schiff mit dem stilisierten Wolfskopf am Bug und dem dazu passenden Namen Canis Lupus III sehr imposant aus!
Nach einem herzhaften Gähnen legte ich das Tablet endgültig zur Seite und wandte mich wieder meiner morgendlichen Routine zu. Nach meinen obligatorischen Gymnastikübungen und einer anschließenden kalten Dusche, setzte ich mich in mein etwas altersschwaches Auto, um dem alltäglichen permanenten Stau auf der Autobahn ein weiteres Fahrzeug hinzuzufügen.
Ich programmierte den Navcom auf mein Ziel und das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Als ich aus der kleinen Garage herausfuhr, startete gegenüber einer meiner Nachbarn ebenfalls. Er reihte sich jedoch nicht in den Verkehr auf der Straße, sondern in den darüber ein. Seine Drohne schraubte sich Richtung Stuttgart in den Himmel und verschwand nach wenigen Augenblicken aus meinem Sichtfeld. Seufzend schaute ich dem kleinen glitzernden Flugkörper nach. So würde ich auch gerne reisen! Leider waren die Dinger für mich unerschwinglich teuer. Also tuckerte ich mit meinem Auto in Richtung der Autobahn. Diese war damals eigentlich permanent überlastet und schon der kleinste Unfall sorgte für kilometerlange Staus. Und Unfälle gab es hier eigentlich täglich, obwohl schon vor vielen Jahren das autonome Fahren eingeführt worden war. Solange die selbstfahrenden Vehikel aber auch noch manuell gesteuert werden konnten, würde es wohl immer Leute geben, die sich einbildeten, schneller durch den Verkehr zu kommen, wenn sie von Spur zu Spur sprangen. Und dabei reagierte selbst die beste Elektronik oft zu langsam, um Unfälle zu vermeiden. Zwar waren die Politiker dabei, ein Gesetz durchzubringen, das manuelles Eingreifen in den Verkehr verbieten sollte. Aber wie immer in der Politik gab es auch hier ein ständiges Hin und Her und es würde wohl noch einige Zeit dauern, bis es soweit war. Vermutlich war die Lobby der Selbstfahrer einfach zu groß, um hier schnell auf Ergebnisse hoffen zu können.
Auf der Auffahrt zur Bundesstraße überholte mich darum ein knallgrüner Lieferwagen mit einem blauen Roadrunner-Emblem auf der Seite mit geschätzten hundertvierzig Sachen. Man beachte, dass hier maximal hundert Kilometer in der Stunde erlaubt waren. Ich ärgerte mich! Eigentlich war es heute gar nicht mehr möglich, die Tempolimits zu überschreiten. Aber es würde wohl immer Leute geben, die die Elektronik hackten und solche Limits außer Kraft setzten. Immerhin machte der Verrückte mit seinem selbstmörderischen Überholmanöver im letzten Moment noch zwei Wagen gut, um dann auf der vierspurigen Bundesstraße bis zur Autobahnauffahrt vor sich hin zu tuckern. Die meisten Menschen verließen sich eben doch auf die Automatik, die sie sicher und gleichmäßig ans Ziel brachte. Das Autobahnkreuz war das Nadelöhr im Süden Stuttgarts. Vor allem morgens zur Hauptverkehrszeit lief hier trotz manuellem Fahrverbot oft nichts mehr. Dies kümmerte den Lieferwagenfahrer aber nicht weiter und so versuchte er, durch Hin- und Herwechseln auf den Spuren, doch noch ein paar Meter herauszuholen. Wie wenig sich dieses Verhalten lohnte, konnte man auf der Einmündung in die A8 erkennen. Hier hatte ich den Überholspezialisten sogar wieder direkt neben mir. Gehetzt starrte er auf die Straße: Headset auf, in der einen Hand eine Zigarette und ständig in sein Mikro redend. Oder vielleicht auch auf sein Handy, das er in einer Halterung an der Frontscheibe deponiert hatte. Vermutlich nur deshalb, weil ihm nicht drei Hände zur Verfügung standen. Handy, Zigarette und Lenkrad gleichzeitig zu bedienen, wäre dann wohl doch etwas zu viel verlangt gewesen! Genau für solche Menschen waren eigentlich die autonomen Fahrzeuge entwickelt worden, die sich selbstständig und sicher in den Verkehr einreihten und einen ans Ziel brachte. Dass man dabei noch Zeit hatte zu telefonieren, zu lesen oder einfach nur die Landschaft anzusehen war ein zusätzlicher Pluspunkt, den heutzutage nahezu alle Fahrer zu schätzen wussten.
Mein Fahrstil, beziehungsweise der meiner Bordintelligenz, bestand aus entspanntem, gemächlichem Dahintuckern auf meiner Spur mit geschätzten vierzig Stundenkilometern und dem Beobachten meiner Mitmenschen, im Speziellen dem meines neuen Freundes. Ich grinste mehrmals zu ihm rüber, winkte, zeigte auf mein führerloses Lenkrad, was er aber nur mit einem genervten Blick quittierte. So näherten wir uns an diesem Morgen unseren Zielen mehr oder weniger entspannt. Aber bevor mein Wagen von der Autobahn abfahren konnte, musste ich noch durch meine damalige Lieblingsstelle auf der Fahrt zur Arbeit. Ich hasste diese Autobahnbaustelle kurz vor Leonberg. Mittlerweile wurde hier seit gut drei Jahren gebaut und es wurde und wurde nicht fertig. Weder der lächelnde, sich auf seine Schaufel stützende Bauarbeiter auf dem Plakat, der verkündete nur für uns zu bauen, noch die Ankündigung, die Baustelle würde nur ein weiteres Jahr fortbestehen, waren jedoch heute in der Lage, meine Laune komplett in den Keller zu drücken. Zu sehr hatte ich schon den heutigen Fußballabend ins Visier genommen.
Bei meiner Arbeitsstelle angekommen, parkte ich den Wagen auf dem Firmenparkplatz und lief den halben Kilometer in die Fabrik. Die Rollbänder ließ ich links liegen, schließlich bewegte ich mich sowieso nicht genug. Als ich mein Büro betrat, genehmigte ich mir als erstes nochmals einen Kaffee und machte mich dann an die Arbeit.
Ich arbeitete damals bei Ion-Enertec, einem Großunternehmen für innovative Technologie als Testingenieur und war für eine Vielzahl von Versuchsdurchführungen verantwortlich. Mehr oder weniger war es jeden Tag das gleiche, die Arbeit machte mir aber trotzdem Spaß. Zumindest gab sie mir das Gefühl, etwas für die Umwelt und gegen die ganzen Probleme auf der Welt zu unternehmen. Von Bekannten und Freunden in anderen Betrieben wusste ich, dass deren Arbeit teilweise deutlich eintöniger verlief. So gesehen hatte ich es gut getroffen. Bei Ion-Enertec gab es wie überall nettere und weniger nette Kollegen und meine gute Laune erhielt einen gewaltigen Dämpfer, als einer der Letzteren mit Namen Ernesto ins Büro marschierte, als ob es ihm gehören würde. Ein frisch ausgelernter Ingenieur von vielleicht zwanzig Jahren, der noch dachte, er könne die Welt allein aus den Angeln heben. Ich versuchte konzentriert zu wirken, ignorierte ihn und hämmerte weiter auf meine Computertastatur ein. Vielleicht würde er sich ja wieder verziehen, wenn ich ihn mit Missachtung strafte. Aber weit gefehlt, das spornte nur noch mehr seinen Ehrgeiz an, meine Arbeit zu unterbrechen. Er legte sich auch gleich richtig ins Zeug.
»Na, Sidi, was geht, hast du auch ordentlich was zu tun?«
Was fiel ihm ein, mich Sidi zu nennen? Aber die Jüngeren dachten damals wohl, alles mit »Sidi« bezeichnen zu müssen. Ich hatte, ehrlich gesagt, keinen Plan, was das überhaupt heißen sollte. Es war vermutlich einfach nur cool. Wobei cool wiederum auch keiner mehr sagte.
Verkehrte Welt! So merkte ich, dass ich älter wurde. Ernesto jedenfalls redete weiterhin auf mich ein. Er ließ sich auch nicht von meinem hartnäckigen Tippen auf der Tastatur davon abhalten. Hätte der nicht heute mal freimachen können? Oder krank? Oder am besten beides?
Nach wenigen Minuten hatte ich ihn mit dem Versprechen, mich um seinen Versuchsaufbau zu kümmern, hinauskomplimentiert. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Wovon träumte der eigentlich nachts? Als ob ich nichts Wichtigeres zu tun hätte, als mich zuerst um das unwichtigste Experiment im Haus zu kümmern. Wenigstens war ich ihn schnell wieder losgeworden.
Die Zeit verflog schnell und so war es schon kurz vor vier Uhr nachmittags, als ich beschloss, einen abschließenden Rundgang zu machen. Darauf freute ich mich jeden Tag. Die wenigen Mitarbeiter, die man an den Testanlagen traf, waren meist hochkonzentriert und ließen einen ebenfalls seiner Arbeit nachgehen. Es bestand also eine gute Chance, den Rundgang durch die Prüfräume und Umweltsimulationskammern allein und in Ruhe durchzuführen. Ich wurde nur einmal von meinem Kollegen Sahid gestört, der, wie ich, als Ingenieur arbeitete. Er brauchte Hilfe an einer Testanlage, an der eine neue Art von Kraftfeld getestet wurde. Wir aktivierten es gemeinsam und sahen andächtig zu, wie sich das bläulich schimmernde Feld kugelförmig um den Generator herum aufbaute. Das hatte schon viel von Science-Fiction. Sahid schaltete die Sprinkleranlage über dem Feld ein und mit leisem Knistern trafen die ersten Tropfen auf der vollkommen gleichmäßig gewölbten Oberfläche des Feldes auf. Sie perlten einfach ab und flossen an der Kugel nach unten, wo sie im Bodenabfluss verschwanden. Das Kraftfeld war kurz vor der Serienreife. Es hielt sämtliche Wettereinflüsse von dem von ihm umschlossenen Raum ab, selbst kleinere Festkörper wurden abgelenkt. Sahid und ich schauten uns den Versuch noch einige Sekunden an, dann setzte ich meine eigene Arbeit fort.
Meine direkten Kollegen hier mochte ich sehr gerne. Hin und wieder gingen wir nach der Arbeit noch ein Feierabendbier trinken und das Arbeitsklima in unserer Abteilung hätte ich mir nicht besser wünschen können. Auch heute Abend wollten wir uns zur Übertragung des Endspiels bei Sahid treffen, der einen dieser neuen Fernsehschirme hatte, die man wie eine Tapete auf den Wänden aufklebte. Das ganze Wohnzimmer hatte er sich damit auskleiden lassen. Man saß sozusagen mitten im Bild, während die Übertragung um einen herum lief. Das war schon sehr, sehr cool, leider aber auch sehr, sehr teuer!
Dass der Tag dann aber doch nicht ganz so enden würde, wie ich mir das vorstellte, wurde mir etwa eine Stunde später bewusst. Nachdem ich mit dem Aufzug ins dreizehnte Untergeschoss des Testlabors gefahren war, nahm ich einige Prüfungen an Vorrichtungen direkt im Eingangsbereich vor, bevor ich ins Allerheiligste des Versuchs vordrang. Es handelte sich hier um eine spezielle großräumige Umweltsimulationskammer, die von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen war. Diese belegte nahezu die Hälfte des ganzen Geschosses und war riesig. Sie hatte jede nur erdenkliche Abschirmung gegenüber Einflüssen von außen und war mit einer autarken Lufterneuerung ausgestattet. Man erreichte das Innere der Kammer nur durch eine Schleuse, die die gesamte eingeschleppte Luft und Staub herausfilterte, bevor man eintreten konnte – mit einem Wort: Hier hatte die Firma mal richtig Geld liegen lassen. Mitten in der Kammer stand auf einem kleinen Tisch ein noch kleinerer, unscheinbar wirkender grauer Würfel von vielleicht dreißig Zentimeter Kantenlänge, umgeben von ganzen Reihen von Messgeräten. Kabel führten zu einigen Großrechnern im hinteren Teil der Kammer. Dieser kleine Würfel versorgte nun schon seit drei Monaten das komplette Rechenzentrum der ganzen Firma mit Energie und seine Leistung war bisher unverändert geblieben. Im Grunde genommen handelte es sich um eine nahezu unerschöpfliche Batterie, die in Zukunft ganze Städte versorgen sollte.
Ich war etwa eine halbe Stunde mit verschiedenen Tests und Messungen an dem Wunderwürfel beschäftigt gewesen, als plötzlich das Licht ausging. Es ging allerdings nicht aus, weil kein Strom mehr da war, sondern weil ich unvorsichtigerweise an einer aktiven Steuerung gearbeitet hatte. Als ich mit dem Schraubendreher abrutschte und sich als Ergebnis ein mehr als sehenswerter Lichtbogen zwischen der Steuerungsplatine und meinem Werkzeug aufbaute, war ich darum nicht weiter überrascht, dass das Licht flackerte und die Lüftung kurzzeitig ausging. Im nächsten Moment war das Licht wieder an und auch die Frischluftversorgung startete mit beruhigendem Brummen. Auch unserem kleinen Energiewunder war nichts passiert, die Messgeräte zeigten, dass er weiterhin mit nahezu hundert Prozent Wirkungsgrad arbeitete. Dass die Steuerung der inneren Schleusentür wohl durch diesen kleinen Unfall einen Schuss abbekommen hatte, merkte ich erst eine weitere halbe Stunde später, als ich, nachdem ich nochmals gewissenhaft alles kontrolliert hatte, die Kammer verlassen wollte. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen! Das beunruhigte mich zunächst noch nicht sonderlich. Gut, es war lästig in der Kammer gefangen zu sein, aber solange weiterhin ein frischer Luftstrom aus dem Lüftungsgitter kam, drohte mir keine ernsthafte Gefahr. Ich griff zum Notfalltelefon und wählte die Nummer der Instandhaltung. Doch leider meldete sich niemand. Im Gegenteil, das Telefon blieb sogar komplett stumm, kein Frei- und auch kein Besetzzeichen war zu hören. Nacheinander rief ich alle verfügbaren Nummern durch. Alle Versuche blieben ohne Reaktion am anderen Ende der Leitung. Vermutlich war das Telefon ebenfalls durch die von mir herbeigeführte Überspannung in Mitleidenschaft gezogen worden.
Fluchend wandte ich mich wieder der Tür zu, und versuchte, sie mit Gewalt zu öffnen. Ich zerrte an der Klinke, rüttelte an der Tür und setzte mein ganzes Gewicht ein. Ohne Erfolg, die Tür blieb verschlossen. Ich hämmerte mehrere Minuten gegen die Tür, schrie um Hilfe, aber ohne Erfolg. Erschöpft setzte ich mich schließlich neben der Tür auf den Boden und überlegte, wie ich jemanden auf meine missliche Lage aufmerksam machen konnte. Irgendwann musste den Kollegen ja auch auffallen, dass ich von meiner üblichen Runde nicht zurückkehrte und dann würden sie doch hoffentlich anfangen, nach mir zu suchen. In Gedanken versunken schloss ich kurz die Augen. Nur mal kurz ausruhen, dachte ich, und war im nächsten Moment eingeschlafen.
Das Kraftwerk
Erstes Jahr, Tag Null, 01:30
Im Kernkraftwerk Neckarwestheim tat Rolf Gunzen zu dieser späten Stunde noch Dienst. Er war Ingenieur in der sogenannten Leitwarte des Kraftwerks. Der Kontrollraum, in den er momentan blickte, war ungefähr zweihundert Quadratmeter groß. Rundum waren die Wände in Olivgrün gehalten, ebenso wie der Teppichboden, mit dem der ganze Raum ausgekleidet war. Dieser dämpfte die Schritte der wenigen Fachleute, die bedächtig umhergingen und die Monitore aufmerksam musterten. An den Wänden waren überwiegend graue Konsolen und Pulte befestigt. Überall standen Computermonitore, die die unterschiedlichsten Anlagenzustände anzeigten.
Rolf war als Leiter der Nachtschicht für die Funktion der Anlage verantwortlich und arbeitete seit Stunden hochkonzentriert an seinem Computerterminal. Die lange Nacht forderte so langsam ihren Tribut und er war froh, eine kurze Pause antreten zu können. Er hatte sich dafür in das angrenzende Schichtleiterbüro zurückgezogen, das nur durch eine Glastür von dem riesigen Kontrollraum getrennt war. Seine Pausen verbrachte er gerne hier beim Lesen und auch jetzt blätterte er wieder in einem Kriminalroman. Dabei war es möglich, kurz auszuspannen und wieder Kraft zu tanken. Immerhin ging die Nachtschicht über acht Stunden und forderte seine ganze Aufmerksamkeit. Er blickte kurz von seinem Buch auf und runzelte die Stirn. An seinem Pult, auf dem die gesamten Informationen des AKWs zusammenliefen, war ein gelbes Warnlicht angegangen. Er blickte nach oben zu den drei großen Monitoren, die über ihm an der Decke verankert waren. Hier war allerdings kein Fehler zu erkennen. Auch der große Doppelbildschirm vor ihm zeigte die Anlage aktiv und weitgehend fehlerfrei. Die Leistung lag bei konstanten tausendvierhundert Megawatt, Kühlmitteldruck einhundertfünfzig bar, Frischdampfdruck knapp über sechzig bar. Drei der vier Hauptkühlmittelpumpen leuchteten grün. Eine blinkte gelb. Er runzelte die Stirn, aber ein Blick nach draußen genügte ihm, um zu sehen, dass seine Kollegen nicht alarmiert wirkten. Der Kontrollraum wurde zu dieser Stunde von elf Ingenieuren überwacht, einer weniger als üblich. Sein Freund und Kollege Paul Brunner hatte sich kurz vor der Schicht telefonisch krankgemeldet. Aber auch mit reduzierter Mannschaft konnte das Kraftwerk von hier aus ohne weiteres überwacht werden.
Die andere Hälfte der Mitarbeiter, die sogenannten Anlagenwärter, war vor einigen Minuten auf ihre Tour durch das Kraftwerk aufgebrochen. Über die Kameras, die nahezu jeden Winkel der Anlage überwachten, konnte er sie in der Nähe des Reaktorblocks ausmachen.
Rolf war nicht wirklich beunruhigt. Die Kontrollgeräte im Schichtleiterbüro waren so konstruiert, dass zur Not ein einzelner Bediener vollkommen ausreichte. Das gelbe Licht an der Anzeigetafel war allerdings lästig. Sehr lästig! Hielt es ihn doch davon ab, weiter die Erlebnisse seines Lieblingsdetektivs Claus Larsen zu verfolgen, der dem Täter – und somit dem Ende des Buches – gerade gefährlich nahegekommen war. Seufzend legte er seinen Kriminalroman zur Seite und schaute sich an, was die Konsole vor ihm meldete. Die gelbe Anzeige war nicht weiter schlimm, sie gab nur bekannt, dass der Stromverbrauch sich weiter reduziert hatte und die vierte Kühlmittelpumpe nicht mehr benötigt wurde. Zeit, die Leistung des Kraftwerks weiter zu drosseln, um der Notabschaltung der Elektronik zuvorzukommen. Eigentlich war das System wartungsfrei. Obwohl wartungsarm wohl das bessere Wort gewesen wäre. Hätte Rolf Gunzen nicht innerhalb der nächsten Minuten die Leistung angepasst, würde sich das System selbstständig in einen betriebssicheren Zustand gefahren haben. Doch genauso gut konnte sich die kleinste Abweichung auch zu einem größeren Störfall entwickeln. Die Folge wäre ein landesweiter Stromausfall und vermutlich die Entlassung von Rolf gewesen. Darauf war er nicht wirklich scharf. Der Betreiberkonzern, für den er seit einigen Jahren arbeitete, zahlte nicht schlecht und schließlich war der Job interessant. Eigentlich hatte er nicht Energie- und Anlagenelektronik studiert, um nachts in einem Kraftwerk Knöpfe zu drücken und Regler zu bedienen, aber mit seinen fünfundfünfzig Jahren war Rolf froh, hier zu sein. Außerdem war die Arbeit in einem AKW eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Nur durch Zusatzausbildungen war es ihm möglich gewesen, sich zum Anlagenleiter qualifizieren zu können. Und auch so durfte er nur in diesem AKW an diesem speziellen Block die Schicht übernehmen. Für jedes andere Kraftwerk würde er erneut eine zusätzliche Ausbildung benötigen.
Rolf hatte keine Lust, irgendwann in der Nähe einer strahlenden Ruine zu wohnen, nur weil er nicht richtig aufgepasst hatte. Vor einigen Jahren hatte er sich ungefähr zwanzig Kilometer entfernt ein kleines Haus gekauft, in dem er mit seiner Frau wohnte. Und er war sich sehr wohl bewusst, dass diese Entfernung bei einem Reaktorunfall keine ausreichende Sicherheit bedeutete. Schnell hatte er die kleine Störung in den Griff bekommen. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, drehte er sich schließlich zur Kaffeemaschine um. Auch ein Privileg, das er als Leitender Ingenieur hatte. Alle anderen Angestellten mussten sich mit dem Kaffeeautomaten im Flur vor der Leitwarte begnügen.
»Na, mein einziger Freund in dieser trostlosen Nacht.«
Er brachte die drei Schritte bis zur Maschine hinter sich, zog die Warmhaltekanne aus der Halterung und goss sich seine fünfte Tasse ein. Oder war es die sechste? Ehrlich gesagt hatte er den Überblick verloren.
»Egal«, dachte er sich. Die Nachtschicht war so jedenfalls leichter zu ertragen. Drei Schritte zurück und er saß wieder in seinem Sessel vor der Anzeigetafel. Rolf schlürfte lautstark einen Schluck aus seiner Tasse und blickte gelangweilt zur Uhr, die über der Eingangstür zum Kontrollraum der Anlage angebracht war. Kurz vor Zwei. Seine Schicht würde noch bis fünf Uhr morgens gehen, dann konnten er und seine zehn Kollegen endlich nach Hause gehen. Er wandte sich wieder seinem Buch zu, nicht ohne immer wieder einen Kontrollblick über seine Anzeigen schweben zu lassen. Schließlich konnte sich weder die Betreibergesellschaft noch er einen Fehler erlauben, auch nicht in seiner wohlverdienten Pause. Aus den Augenwinkeln heraus nahm er wahr, dass zwei Kollegen die Warte verließen. Vermutlich wollten sie sich ebenfalls einen Kaffee genehmigen. Grundsätzlich war es verboten, den Kontrollraum mit weniger als vier Leuten zu betreiben, aber da war er tolerant. Schließlich war der Automat nur wenige Schritte vor dem Kontrollraum und die Beiden würden gleich wieder an ihrem Platz sein.
Er vertiefte sich wieder in sein Buch, um wenig später erneut auf die Uhr zu blicken. Seine Kollegen waren nun immerhin schon vor zehn Minuten gegangen und bisher nicht zurückgekehrt.
»Wenn sie in einer Viertelstunde nicht wieder auf ihrem Platz sitzen, dann muss ich diese Idioten auch noch suchen. Wahrscheinlich sind sie vor dem Automaten eingeschlafen«, brummte er in sich hinein.
In diesem Moment bemerkte er ein Funkeln neben sich und drehte sich zur Quelle dieser Störung um. Ein feiner Nebelfaden suchte sich eben seinen Weg durch das Lüftungsgitter seines Büros. Rolf blickte verwundert genauer hin. Der Nebel war rot und glitzerte im Licht der Kontrollraumbeleuchtung. Er sprang auf, da er zunächst an ein Feuer dachte, sah dann aber, dass der Nebel keine Flammen reflektierte, sondern selbst rot glühte. Verwundert bückte er sich und griff vorsichtig nach dem seltsamen Rauch, der da in seinen Kontrollraum eindrang. Es roch nach Zimt und er war sich sicher, auch einen leichten Brandgeruch wahrzunehmen. Alarmiert drehte er sich herum, um seine Kollegen im Kontrollraum auf die Gefahr aufmerksam zu machen.
Der Wächter
Erstes Jahr, Tag Null, Uhrzeit 01:30
Oliver Bergmann arbeitete schon seit vielen Jahren als Nachtwächter bei Ion-Enertec. Es war ein guter Job, ordentlich bezahlt und relativ ruhig. In den zehn Jahren seiner Tätigkeit hier hatte es nur eine Handvoll Einbrüche gegeben, die jedes Mal entdeckt wurden, bevor die Täter mit Beute flüchten konnten. Sowieso gab es nur in einigen wenigen Gebäuden Wertvolles zu holen und die waren bestens überwacht. Schwere Türen, automatische Überwachungskameras, die alles und jeden aufzeichneten, und nicht zuletzt eine hochmoderne Alarmanlage, die den Werksschutz nahezu überflüssig machte. Dass es ihn dennoch gab, war auf das Misstrauen der Geschäftsleitung gegenüber allen elektrischen Systemen zurückzuführen und vermutlich auch ein gutes Stück auf den Betriebsrat, der darauf bestand, dass die automatischen Systeme von einer kleinen Wachmannschaft auch nachts kontrolliert wurden. Was Oliver freute, wäre er andernfalls doch arbeitslos gewesen, oder hätte sich seine Brötchen sicher schwerer verdienen müssen, als er es jetzt tat.
Er reckte sich auf seinem Stuhl in dem Pförtnerhäuschen und sah kurz zu Stan Steward hinüber, der auf seinem Stuhl zusammengesunken war. Dessen Füße lagen auf dem Schreibtisch. Leise schnarchte sein Kollege vor sich hin. Stan schlief oft kurz ein, schließlich war er mit seinen sechzig Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Im Fall des Falles konnte sich Oliver aber immer auf ihn verlassen. Stan war vor sechs Jahren zum Werksschutz gekommen und seitdem waren er und Oliver ein gut eingespieltes Team. Stan und Ollie … das war für viele der Kollegen ein Running Gag, aber das machte Oliver mittlerweile nichts mehr aus. Am Anfang hatte er sich noch über diesen Vergleich mit dem berühmten Komiker-Paar geärgert, mittlerweile entlockten ihm die gelegentlichen Frotzeleien seiner Kollegen nicht einmal mehr ein müdes Lächeln. Er gähnte nochmals, streckte seine Glieder und stand leise auf. Kurz überkam ihn das Verlangen, Stan einen Tritt zu verpassen, doch dann ließ er ihn weiterschlafen. Schließlich war Stan mit der zweiten Runde um vier Uhr morgens dran und vielleicht würde er, Oliver, auch ein kleines Nickerchen machen. Dann wäre er ebenfalls froh, wenn Stan ihn nicht wecken würde.
Oliver setzte seine Mütze auf, prüfte den Sitz der Dienstpistole im Halfter, nahm die Keycard vom Schreibtisch und trat leise vor die Tür der Pforte. Seine Lederjacke ließ er am Kleiderständer neben der Tür hängen. Schließlich war es Frühsommer und trotz der fortgeschrittenen Stunde immer noch angenehm warm draußen. Er schnappte sich noch seine Taschenlampe, kontrollierte kurz deren Funktion, und verließ dann leise das Pförtnerhäuschen.
Es war eine laue Nacht und die Grillen zirpten sogar so tief in der Nacht noch.
»Gehen die eigentlich nie schlafen?«
Oliver begann mit seiner Runde durch das Werk. Mehrere Stempeluhren in genau vorgeschriebenem Rhythmus waren abzuklappern und es blieb ihm für seine gesamte Runde eine knappe halbe Stunde Zeit. Während seines Rundgangs ließ er immer wieder den Lichtkegel seiner Lampe hin und her tanzen und vergewisserte sich dabei, dass alles in Ordnung war. Er warf einen Blick auf seine Rolex am Handgelenk. Bei seinem Gehalt war diese natürlich ein Imitat. Genauer gesagt hatte er die Uhr im letzten Urlaub in der Türkei einem Händler auf dem Bazar abgekauft und war sich sicher, trotz allen Feilschens zu viel bezahlt zu haben. Immerhin ging sie genau und er hatte sie immer dabei. Es war kurz vor zwei Uhr nachts. Er blickte sich nochmals wachsam um und lief dann zu seiner letzten Station in der Kantine, einem Gebäude ungefähr hundert Meter entfernt.
Die Hälfte der Strecke war zurückgelegt, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Ein eigenartiges leises Ploppen war zu hören und wiederholte sich tausendfach. Als ob ganze Batterien von Sektflaschen auf einmal geöffnet würden. Erschrocken hielt Oliver inne und überlegte sich, seine Waffe zu ziehen. Aber auf was hätte er zielen sollen, fragte er sich.
»Junge, du bist ganz schön überreizt«, sagte er sich leise und wollte weitergehen, als ihn eine zweite Beobachtung innehalten ließ.
Um ihn herum erhob sich plötzlich eine seltsame Nebelwolke in den Himmel. Sie schien von den entfernten Wiesen und einem Waldstück in der Nähe auszugehen und bewegte sich langsam und stetig auf das Werksareal zu. Gleichzeitig breitete sie sich in die Höhe aus. Kleine Fetzen begannen wie dürre Finger in den Himmel zu greifen, um kurz darauf wieder in sich zusammenzufallen. Der Nebel kam näher und näher. Er breitete sich aus, soweit Oliver sehen konnte. Der Wachmann drehte sich um seine eigene Achse, mehrmals blitzte die Wolke im Licht seiner Taschenlampe rot auf, aber in alle Richtungen war das gleiche Schauspiel zu bewundern. Nebel, der sich ausbreitete, von den sanften Hügeln im Süden der Stadt herunterflutete und sich langsam, aber stetig, auf die Stadt zubewegte. Je näher die Nebelwände kamen, umso mehr Einzelheiten konnte der verdutzte Wachmann wahrnehmen. Es war nicht nur ein einfacher Nebel, vielmehr war er von rötlicher Farbe und schimmerte metallisch, wo er in den Bereich von Straßenlaternen oder anderer Beleuchtung kam.
»Na, das ist jetzt aber doch etwas unheimlich«, murmelte er leise und ließ seine Taschenlampe kreisen. Kurz darauf war er von den wabernden Nebeln umschlossen.
»Verdammter Mist, was ist das nur?«, stieß er noch hervor, bevor ihn der Nebel komplett einhüllte. Er zog sein Taschentuch heraus und hielt es sich vor Mund und Nase.
»Bloß nichts einatmen«, dachte er noch, »Wer weiß, was das für ein Zeug ist«.
Er drehte sich herum und lief auf die Pforte zu. Stan! Bisher hatte er mit keinem Gedanken an ihn gedacht.
»Du musst Stan warnen«, ging es ihm durch den Kopf und er beschleunigte nochmals seine Schritte.
Kaum zwanzig Meter waren geschafft, bevor ihm die Luft ausging und er es nicht mehr aushielt. Seine Lungen schrien nach Luft und mit hochrotem Kopf blieb er stehen. Neben sich konnte er in wenigen Metern Entfernung noch die Umrisse der Kantine in diesem seltsamen Nebel wahrnehmen. Er versuchte, weiter die Luft anzuhalten, aber es gelang ihm nicht länger. Keuchend entließ er den verbrauchten Sauerstoff aus seinen brennenden Lungen und atmete durch den dünnen Stoff des Taschentuches reflexartig ein.
Nichts! Es passierte gar nichts. Gierig nach Luft schnappend stand er da und stützte die Hände erschöpft auf die Oberschenkel. Leichter Brandgeruch und ein Aroma nach Zimt lag in der kühlen Nachtluft. Sein Puls normalisierte sich und er ging langsam weiter auf die Pforte zu. Ein seltsames Hochgefühl ergriff von ihm Besitz. Er fühlte sich so gut wie noch nie, und verstand seine Angst von eben gar nicht mehr. Vor Freude fing er an, leise vor sich hinzulachen. Ja, das Leben war schön. Dass er im nächsten Moment auf dem Boden aufschlug, bemerkte er gar nicht mehr. Auch das Flackern seiner Taschenlampe, die ihm aus der Hand glitt und laut klappernd auf den Boden fiel, nahm er nicht mehr wahr. Mit dem letzten Aufflackern der Taschenlampe erlosch kurz darauf auch sein letzter Lebensfunke.
Der Magnat
Erstes Jahr, Tag Null, 01:45
Direktor Hans Heinzelmann hatte sich nie etwas aus Fußball gemacht. Es war ihm nie klar geworden, warum so viele Menschen so versessen auf diesen Sport waren. Deshalb war ihm auch die Weltmeisterschaft egal. Nicht aber seine Position, die er sich mit Ellenbogen im Laufe seines zweiundsechzigjährigen Lebens erkämpft hatte. Ihm war, zumindest seiner Meinung nach, nie etwas geschenkt worden. Als Sohn eines Großindustriellen hatte er aber auch, realistisch betrachtet, nie Not gelitten. Das sah er allerdings ganz anders. Wer hatte denn aus dem kleinen Industriebetrieb seines Vaters einen weltweit agierenden Konzern aus dem Boden gestampft und sich, wo immer es ging, seine Vorteile erkämpft? Beliebt hatte er sich dabei weiß Gott nicht gemacht, das wusste er auch. Aber es war ihm egal. Solange alle nach seiner Pfeife tanzten, konnten sie über ihn denken, was sie wollten. Ihm waren seine schnellen und teuren Autos, seine Jacht, sein Anwesen auf Mallorca und seine neueste Errungenschaft, die Villa, vor der er momentan auf der Veranda saß, wichtiger.
Mit Geld und Macht konnte man alles erreichen, was interessierten ihn da die Ansichten anderer, meist weniger mächtiger und überwiegend deutlich ärmerer Menschen. Die Villa war ein schönes Beispiel dafür, dass eben doch alles und jeder käuflich war. Trotz Bauverbot in diesem Naturschutzgebiet war es ihm gelungen, ein schönes Grundstück mit See und angrenzendem Wald zu erwerben, nachdem er einigen Leute im hiesigen Gemeinderat diverse Barschecks ausgestellt hatte. Einige Geldbriefe an den richtigen Stellen hatten schließlich gegen den Protest der bereits ansässigen Dörfler dazu geführt, dass er sein Bauvorhaben durchziehen konnte. Und das war alles andere als einfach gewesen. Allein die Entwässerung des Anwesens hatte einen unterirdischen Kanal erfordert, welcher für sich schon Unsummen verschlungen hatte. Aber auf einige Millionen Euro mehr oder weniger auf einem seiner vielen Konten im In- und Ausland kam es Heinzelmann nicht wirklich an. Mitnehmen konnte er sein Geld sowieso nicht, sollte er eines Tages den Weg alles Irdischen gehen. Das wusste er sehr genau und deshalb gab er es lieber für Luxus und Annehmlichkeiten aus, die das Leben bereithielt. Zumindest für die Privilegierten, die es sich leisten konnten.
Einer der renommiertesten Architekten der Region hatte ihm ein prachtvolles Haus mit allem, was seiner Meinung nach dazu gehörte, entworfen und gebaut. Die Proteste vor der Baustelle waren mit Polizeigewalt aufgelöst worden. Die wenigen Störenfriede, die zunächst noch auf der Baustelle ihre Schmierereien mit Farbdosen auf die Wände gesprüht hatten, wurden bald schon von dem knapp drei Meter hohen Zaun zurückgehalten, der zudem noch elektrisch geladen war. Auf diesen Zaun war Heinzelmann besonders stolz. Jeder, der unvorsichtigerweise an die Absperrung geriet, oder über sie hinweg klettern wollte, wurde von einem schmerzhaften Stromschlag zurückgeschleudert. Der Zaun umgab das ganze Anwesen mitsamt dem kleinen Wald, der sich an den See im Süden hinter dem Haus anschloss. Eine komplett autarke Anlage! Solange der Notstromgenerator die Hochleistungsbatterien im Keller speiste, die wiederum den Zaun versorgten, würde kein Einbrecher das Anwesen betreten. Und der Tank für den Generator war groß genug, um über Jahre hinweg die Versorgung des ganzen Anwesens mit Strom zu gewährleisten. Auch diese Anlage war nicht ohne Protest der Bevölkerung installiert worden. Die Leute hatten wohl Angst gehabt, nachdem ein Bauer am Zaun hängengeblieben war. Der hatte wohl nicht gewusst, dass der Zaun bereits unter Strom stand. Unglücklicherweise war der Mann an den Folgen gestorben und so hatte dieses Ereignis in einem Protestmarsch vor seinem Anwesen gegipfelt. Warum hat der Kerl auch die Schilder ignoriert, die alle vier Meter am Zaun hingen und auf die Gefahr hinwiesen? Aber auch hier hatte er sich durchgesetzt und die aufgebrachte Menge von der Polizei vertreiben lassen.
»Wozu hat man schließlich den Polizeichef als guten Bekannten«, lächelte er in sich hinein. Heinzelmann war sich jedenfalls keiner Schuld bewusst.
Er zog an seiner Havanna, die er sich direkt aus Kuba einfliegen ließ, und nahm einen Schluck Wein aus dem erlesenen Kristallkelch, der neben ihm auf dem kleinen Tisch vor der Ebenholzbank stand. Er bewunderte kurz den Schliff des extra für ihn angefertigten Glases aus Italien und gab sich erneut seinen Tagträumen hin. Es war bereits spät geworden, die Sonne schon vor vielen Stunden untergegangen und das spärliche Licht, das ihn beleuchtete, kam von den wenigen Lichtern und Straßenlaternen aus dem Dorf. Die Leute hatten sich letztendlich gefügt und nun residierten Hans Heinzelmann nebst Gemahlin in ihrem Anwesen und nahmen am Dorfleben so wenig Anteil, wie es nur ging. Was in Zahlen Null Komma Null bedeutete. Lebensmittel hatten sie immer ausreichend im Haus. Wozu gab es Lieferdienste? Alles was verderblich war, wurde jeden Tag frisch angeliefert. Was Sie darüber hinaus brauchten, brachte Hans meist mit, wenn er abends von seinem Privathubschrauber auf seinem Grundstück abgesetzt wurde. Natürlich kaufte er nicht selbst ein, das überließ er einem seiner zahlreichen Lakaien, die den ganzen Tag um ihn herumlungerten und um seine Gunst buhlten.
»Schmarotzer allesamt«, dachte er und nahm erneut einen genüsslichen Zug aus seiner Zigarre.
Seine Frau machte sich aus dem Haus heraus bemerkbar. Sie war schon im Schlafzimmer, hatte im Obergeschoss Fenster und Türen geöffnet um die kühle Nachtluft ins Haus zu lassen.
»Hans, kommst du?«, rief sie ihm von der Dachterrasse aus zu. »Es ist schon spät geworden, wir sollten schlafen gehen.«
Er schaute auf seine teure goldene Rolex und sah, dass Irene Recht hatte. Bereits 02:00. Der Hubschrauber würde ihn morgen früh wieder pünktlich um acht abholen. Außerdem hatte er mehrere wichtige Meetings mit Geschäftspartnern aus Übersee. Da sollte er fit und ausgeruht sein. Er seufzte und drückte die halb gerauchte Havanna im Ascher aus, nachdem er einen letzten Zug genommen hatte. Morgen würde er eine neue anbrechen. Einmal angeraucht waren selbst die teuersten Zigarren nichts mehr wert. Er erhob sich, streckte die Glieder und ließ Weinglas und Ascher einfach auf der Veranda stehen. Die Putzfrau würde morgen früh alles wegräumen, wenn er schon längst in der Luft war. Ja, das Leben als reicher Mann brachte schon auch Annehmlichkeiten! Aber schließlich hatte er sich alles hart genug erkämpft.
Die Tür fiel ins Schloss, als ihn ein seltsames Geräusch von draußen aufhorchen ließ. Ein Knallen wie von Tausenden von Champagnerkorken. Neugierig und etwas verärgert machte er die Tür wieder einen Spalt weit auf und spähte hinaus. Vielleicht war die Dorfjugend mal wieder auf eine Attacke auf sein schönes Anwesen aus. Aber das würde er ihnen austreiben. Notfalls mit einem Anruf bei der Polizei. Sollten die sich doch um nächtliche Ruhestörer kümmern. Dass es bereits nach zwei Uhr nachts war, störte ihn nicht. Schließlich zahlte er eine Menge Steuern, zumindest für seine inländischen Umsätze. Er grinste, als er daran dachte, wie er dem Fiskus mit seinen Offshore-Konten in Übersee ein Schnippchen geschlagen hatte. Ihm würden sie nie auf die Schliche kommen, davon war er überzeugt. Mit dem Handy in der Hand begab er sich nach draußen und wählte dabei die Notrufnummer der Polizei. Gleichzeitig schaute er sich auf der Veranda vorsichtig um. Es war wieder alles still und friedlich. Etwas nebelig vielleicht. Das war ihm vor einigen Minuten noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt zog tatsächlich ein dichter Nebel von den umliegenden Feldern auf das Dorf und sein Anwesen zu.
»Verdammt noch mal, kann da vielleicht mal jemand rangehen?«, knurrte er.
Nur die automatische Ansage der Polizei war zu hören, aber niemand ging ans Telefon. Das war ja mal wieder typisch! Da brauchte man im Monat vielleicht zweimal die Polizei und dann meldete sich niemand. Er machte sich eine geistige Notiz, gleich morgen früh seinen Bekannten bei der Polizei anzurufen und sich zu beschweren. So ging es ja nun wirklich nicht!
Mittlerweile hatte der Nebel das Dorf erreicht und kroch langsam den sanften Hügel zu seiner Villa hinauf. Im düsteren Schein der weit entfernten Dorflaternen konnte Hans sehen, dass dieser seltsame Dunst glitzerte und eine eher rötliche Farbe aufwies.
»Was ist denn das jetzt wieder für ein schlechter Scherz?«, stieß er gereizt aus.
Die Schwaden krochen weiter auf die Mauer und das große schmiedeeiserne Tor zu, das sein Anwesen vom Rest der Welt abgrenzte. Allerdings war es nicht dafür gemacht, roten Nebel aufzuhalten und so waberten die ersten Fetzen bereits durch die in sanften Bögen und Kreisen geschmiedeten Stahlstangen, als er drei Schritte hinunter auf den Vorhof machte, um sich die Sache genauer anzusehen. Der Kies der sauber geharkten Auffahrt knirschte unter seinen Füßen, als er sich weiter vom Haus entfernte. Wie rote glitzernde Finger griffen die ersten Nebelschlieren nach ihm und hüllten ihn ein. Ein Geruch von Zimt schoss ihm in die Nase und verwundert machte er noch einige Schritte mehr. Während er langsam auf dem Weg weiterstolperte, hörte er schon nicht mehr, dass seine Frau Irene ihn nochmals lautstark dazu aufforderte, doch endlich ins Bett zu kommen. Er nahm auch nicht mehr war, dass er sich beim Umkippen reflexartig an der Türklinke seines Sportwagens festklammerte, worauf die Tür nach oben aufschwang. Während er langsam an dem teuren Wagen hinabglitt, war sein letzter zusammenhängender Gedanke, dass für diese Unverschämtheit irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden musste.
Ion-Enertec