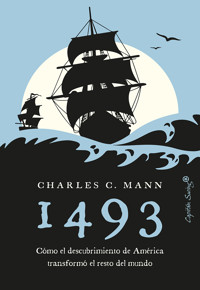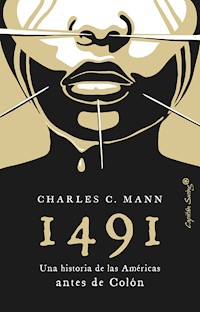9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kolumbus' Erbe: Die folgenreichste Entdeckung seit dem Aussterben der Dinosaurier Die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 veränderte das Leben auf unserem Planeten grundlegend. Zum ersten Mal seit Millionen Jahren traten die lange Zeit isolierten Hemisphären in einen regen Austausch. Menschen, Pflanzen, Tiere und Krankheiten gelangten per Schiff in neue Lebensräume und schufen eine Welt, in der nichts mehr so war wie zuvor. Dieser "kolumbische Austausch" hatte auch gravierende politische Konsequenzen: Er trug maßgeblich dazu bei, dass Europa zur dominierenden Weltmacht aufstieg und China verdrängte. In Kolumbus' Erbe zeichnet Charles C. Mann ein faszinierendes Panorama dieser Vorgänge, das Kontinente und Jahrhunderte umfasst. Er beleuchtet die weitreichenden Folgen für die Umwelt, die Evolution von Flora und Fauna sowie die Verbreitung von Krankheiten. Das Buch vereint auf vorbildliche Weise sprechende Fakten mit fesselndem Geschichtenerzählen und wurde von TIME als "das beste Sachbuch des Jahres" ausgezeichnet. Ein großartiges Lesevergnügen für alle Wissensdurstigen, die sich für die historische Geographie und die Auswirkungen der Entdeckung Amerikas interessieren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Charles C. Mann
Kolumbus’ Erbe
Wie Menschen, Tiere, Pflanzen die Ozeane überquerten und die Welt von heute schufen
Über dieses Buch
«Das beste Sachbuch des Jahres.» TIME
Die Entdeckung Amerikas war für das Leben auf unserem Planeten das folgenreichste Ereignis seit dem Aussterben der Dinosaurier. Denn: Millionen Jahre waren die Hemisphären weitgehend voneinander isoliert gewesen. Mit Kolumbus traten sie in einen Austausch. Menschen und Pflanzen, Tiere und Krankheiten gelangten per Schiff in neue Lebensräume und schufen eine Welt, in der nichts blieb, wie es einmal gewesen war. Das hatte auch gravierende politische Konsequenzen: Der «kolumbische Austausch» trug mehr als alles andere dazu bei, dass Europa zur Weltmacht aufstieg und China verdrängte. Charles C. Mann zeichnet ein spannendes Panorama dieser Vorgänge, das Kontinente und Jahrhunderte umfasst. Ein großartiges Lesevergnügen für alle Wissensdurstigen!
«Herausragend.» The New York Times
«Ein faszinierendes und vielschichtiges Buch, das auf vorbildliche Weise sprechende Fakten mit gutem Geschichtenerzählen vereint.» The Washington Post
Vita
Charles C. Mann, geboren 1955, ist ein preisgekrönter Wissenschaftsjournalist und arbeitet als Korrespondent für The Atlantic, Science und Wired; daneben hat er u.a. für GEO, stern, die New York Times, Vanity Fair und die Washington Post geschrieben sowie für den TV-Sender HBO und die Serie «Law & Order». Sein Buch «1491 – New Revelations of the Americas Before Columbus» verkaufte sich in den USA eine halbe Million Mal und wurde von der National Academy of Sciences als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel «1493. Uncovering The New World Columbus Created» bei Alfred A. Knopf, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«1493. Uncovering The New World Columbus Created» Copyright © 2011 by Charles C. Mann
Redaktion Karin Schneider
Karten Nick Springer und Tracy Pollock, Springer Cartographics LLC; Copyright © 2011 by Charles C. Mann
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildung: Pepin van Roojen)
ISBN 978-3-644-03771-7
Anmerkung: Die Seitenzahlen im Text beziehen sich auf die Seitenzahlen der Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Karte
Prolog
Einleitung Im Homogenozän
Kapitel 1 Zwei Monumente
Pangäas Bruchstellen
Die Fahrt zum Leuchtturm
Schiffe voll Silber
Umkehrung der Vermögensverhältnisse
Teil eins Atlantikreisen
Kapitel 2 Die Tabakküste
Lebewesen auf niedriger Organisationsstufe
Seltsames Land
Die Risikogemeinschaft
Englische Fliegen
«Unermessliche Reichtümer»
Kapitel 3 Schlechte Luft
«Extractive States»
Seasoning
Kehrtwende
«Weder epidemische noch tödliche Leiden»
Villa Plasmodia
Yellow Jack
Krieg und Moskitos
Teil zwei Pazifikreisen
Kapitel 4 Schiffe voller Geld
«Diese kleine Extraanstrengung»
«Kaufleute waren Piraten, Piraten waren Kaufleute»
Abgebrannt
«Die Schatzkammer der Welt»
«Eine ganze Bootsladung von Holznasen»
Zauberberg
Kapitel 5 Liebeskrank-Gras, fremde Knollen und Jadereis
Blinde Passagiere
Malthusisches Zwischenspiel
«Die Berge offenbaren ihre Steine»
Zur Nachahmung nicht empfohlen: Dazhai
Teil drei Europa in der Welt
Kapitel 6 Der agroindustrielle Komplex
Kartoffelkriege
Ein Meer von Genen
Die Guano-Ära
Absolut moderner Hunger
Lazy-beds
«Krieg gegen die Käfer»
Kapitel 7 Schwarzes Gold
Keine Vögel, keine Insekten
«Schmierenchemie»
«Die Schöne im Schaumwein»
Was Wickham bewirkte
Das Ende der Welt
Teil vier Afrika in der Welt
Kapitel 8 Verrückte Suppe
Johann der Stattliche
Schlechte Anfänge
Geburt einer neuen Welt
Der Wert der Familie
Stadt in Aufruhr
Kapitel 9 Wald der Entlaufenen
In Calabar
Autonome Afrikaner
Auf dem Isthmus
«Kapitulation»
Beweg dich, mein Ochse!
Der Blick von Dona Rosarios Farm
Schluss Lebensströme
Kapitel 10 In Bulalacao
Fragmentierte Bewusstseinstätigkeit
Treppen in den Bergen
Auf dem Boot
Anhang
Kampf mit Wörtern
Globalisierung im Werden
Danksagung
Literatur – Abkürzungen
Literatur A–F
Literatur G–K
Literatur L–P
Literatur Q–Z
Karten- und Abbildungsnachweis
Prolog
Wie andere Bücher begann auch dieses in einem Garten. Vor fast zwanzig Jahren stieß ich auf eine Zeitungsnotiz über einige Studenten des örtlichen College, die hundert verschiedene Tomatenvarietäten angebaut hatten. Es hieß, Besucher, die sich ihre Arbeit ansehen wollten, seien willkommen. Da ich Tomaten mag, beschloss ich, mit meinem achtjährigen Sohn hinzugehen. Als wir das Treibhaus des College betraten, war ich erstaunt – noch nie hatte ich Tomaten in so vielen verschiedenen Größen, Formen und Farben gesehen.
Ein Student bot uns auf einem Kunststofftablett eine Auswahl an. Darunter befand sich ein beängstigend unförmiges Exemplar von der Farbe alter Ziegel mit einer ausgedehnten schwarzgrünen Tonsur um den Stängel. Manchmal träume ich von Sinnesempfindungen, die so intensiv sind, dass ich aufwache. Genauso war diese Tomate: Abrupt weckte sie meine Geschmacksnerven auf. Ihr Name sei, so der Student, «Schwarze von Tula». Es handle sich um eine «alte» Tomate ukrainischen Ursprungs, gezüchtet im 19. Jahrhundert.
«Ich dachte, Tomaten kommen aus Mexiko», sagte ich überrascht. «Wieso sind sie in der Ukraine gezüchtet worden?»
Der Student reichte mir einen Katalog mit alten Samen für Tomaten, Chili-Pfeffer und Bohnen, gemeine Bohnen, nicht grüne Bohnen. Zu Hause blätterte ich durch die Seiten. Alle drei Pflanzen stammen aus Amerika. Doch immer wieder kamen Unterarten von anderen Kontinenten: Tomaten aus Japan, Paprika aus Italien, Bohnen aus dem Kongo. In dem Wunsch, mehr solche exotischen, schmackhaften Tomatensorten zu haben, bestellte ich mir Samen, ließ sie in einem Kunststoffbehälter keimen und pflanzte die Sämlinge in den Garten – etwas, was ich noch nie zuvor getan hatte.
Bald nach meinem Besuch im Treibhaus ging ich in die Bücherei. Ich entdeckte, dass meine Frage an den Studenten völlig verfehlt gewesen war. Zunächst einmal liegt der Ursprung der Tomaten vermutlich nicht in Mexiko, sondern in den Anden. In Peru und Ecuador gibt es ein halbes Dutzend wilde Tomatenarten mit Früchten so groß wie Reißzwecken, die bis auf eine Sorte ungenießbar sind. Für Botaniker ist das eigentliche Rätsel weniger die Frage, wie die Tomaten in die Ukraine oder nach Japan gelangten, sondern wie die Vorfahren der heutigen Tomaten von Südamerika nach Mexiko kamen, wo einheimische Pflanzenzüchter die Früchte völlig veränderten: Die Tomaten wurden größer, röter und, vor allem, angenehmer im Geschmack. Warum wurden nutzlose wilde Tomaten Tausende von Kilometern weit transportiert? Warum war die Art nicht in ihrem Heimatgebiet domestiziert worden? Wie war es den Menschen in Mexiko gelungen, die Pflanzen entsprechend ihren Wünschen zu verändern?
Diese Frage berührte ein Thema, für das ich mich schon lange interessierte: die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner. Als Reporter in der Nachrichtenabteilung der Zeitschrift Science hatte ich von Zeit zu Zeit Archäologen, Anthropologen und Geografen zu den immer detaillierteren Erkenntnissen über Größe und Entwicklungsstand längst vergangener indigener Gesellschaften befragt. Die staunende Hochachtung der Botaniker für die indianischen Pflanzenzüchter passte in das Bild. Schließlich bekam ich aus diesen Gesprächen so viele Informationen, dass ich ein Buch über den aktuellen Stand der Forschung zur Geschichte des amerikanischen Kontinents vor Kolumbus schrieb. Ein wenig von dieser Geschichte trugen die Tomaten meines Gartens in ihrer DNA.
Sie enthielten auch ein wenig von der Geschichte nach Kolumbus. Ab dem 16. Jahrhundert verbreiteten die Europäer die Tomaten in alle Welt. Von Afrika bis Asien wurden sie angebaut, nachdem sich die Bauern von ihrer Ungiftigkeit überzeugt hatten. Überall, wo sie hinkam, übte die Pflanze einen bescheidenen, manchmal auch gar nicht so bescheidenen Einfluss aus – Süditalien ohne Tomatensoße ist kaum vorstellbar.
Allerdings wusste ich nicht, dass solche biologischen Transplantate auch jenseits des Tellerrands eine Rolle gespielt haben könnten, bis ich in einem Antiquariat auf ein Taschenbuch von Alfred W. Crosby stieß, einem Geografen und Historiker, der damals an der University of Texas war: Ecological Imperialism [Die Früchte des weißen Mannes, Ökologischer Imperialismus 900–1900, Frankfurt am Main 1991]. Ich fragte mich, was der Titel zu bedeuten habe, daher nahm ich das Buch heraus. Gleich der erste Satz sprang mir ins Auge: «Europäische Auswanderer und ihre Nachkommen sind auf dieser Welt überall anzutreffen. Das bedarf einer Erklärung.»
Ich verstand genau, worauf Crosby hinauswollte. Die meisten Afrikaner leben in Afrika, die meisten Asiaten in Asien und die meisten indigenen Amerikaner in Amerika. Dagegen treffen wir Menschen europäischer Herkunft überaus zahlreich in Australien, Amerika und Südafrika an. Als erfolgreiche Transplantate stellen sie in vielen dieser Regionen die Mehrheit – eine offenkundige Tatsache, über die ich aber vorher nie richtig nachgedacht hatte. Jetzt fragte ich mich: Warum ist das so? Ökologisch betrachtet, ist es genauso rätselhaft wie die Tomaten in der Ukraine.
Bevor sich Crosby und einige seiner Kollegen näher mit dieser Frage befassten, neigten Historiker dazu, Europas Ausbreitung über den Globus fast gänzlich mit der – gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen – europäischen Überlegenheit zu erklären. In seinem Buch Die Früchte des weißen Mannes schlägt Crosby eine andere Erklärung vor: Zwar räumt er ein, dass Europa häufig besser ausgebildete Soldaten und modernere Waffen aufzubieten hatte als seine Gegner, doch langfristig war sein Vorteil biologischer, nicht technischer Natur. Die Schiffe, die den Atlantik überquerten, beförderten nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere – manchmal absichtlich, manchmal zufällig. Nach Kolumbus trafen Ökosysteme, die über Äonen isoliert gewesen waren, plötzlich aufeinander und mischten sich in einem Prozess, den Crosby «Columbian Exchange», kolumbischen Austausch, nennt – der Titel seines vorangegangenen Buchs. Im Zuge dieses Austauschprozesses gelangte Mais nach Afrika, die Süßkartoffel nach Ostasien, Pferd und Apfel kamen nach Amerika und Rhabarber und Eukalyptus nach Europa – und in ihrem Gefolge fanden auch weniger vertraute Organismen wie Insekten, Gräser, Bakterien und Viren neue Verbreitungsgebiete. Dieser kolumbische Austausch, der von den Beteiligten in seinem ganzen Ausmaß weder kontrolliert noch verstanden wurde, ermöglichte den Europäern, große Teile Amerikas, Asiens und, in geringerem Maße, Afrikas in ökologische Abbilder Europas zu verwandeln – in Landschaften, die zu nutzen den Fremden leichter fiel als ihren ursprünglichen Bewohnern. Crosbys These: Dieser ökologische Imperialismus verschaffte den Briten, Franzosen, Niederländern, Portugiesen und Spaniern den permanenten Vorteil, den sie brauchten, um ihre Kolonialreiche zu erobern.
Crosbys Bücher wurden zu den Gründungsschriften einer neuen Disziplin: der Umweltgeschichte. Zur gleichen Zeit etablierte sich eine andere Disziplin, die Atlantic Studies, die sich mit den Wechselbeziehungen zwischen den Anrainerkulturen dieses Weltmeers befassen; unlängst haben zahlreiche «Atlantizisten» ihrem Forschungsfeld auch Pazifiküberquerungen eingegliedert; möglicherweise braucht die Disziplin also einen neuen Namen. Insgesamt trugen die Forscher auf allen diesen Feldern Daten zusammen, die sich zu einem neuen Bild von den Ursprüngen unserer weltumspannenden, vielfältig verflochtenen Zivilisation fügen – jenes Lebensstils, der uns bei dem Begriff «Globalisierung» in den Sinn kommt. In gewisser Hinsicht lassen sich ihre Bemühungen durch die Feststellung zusammenfassen, dass die Geschichte der Könige und Königinnen, die die meisten von uns in der Schule gelernt haben, einer Ergänzung bedarf: Wir müssen die bemerkenswerte Rolle sowohl des ökologischen als auch des ökonomischen Austauschs berücksichtigen. Man könnte auch sagen, diese Forschungsergebnisse zeigen immer deutlicher, dass die Reise des Kolumbus nicht die Entdeckung, sondern die Schaffung einer neuen Welt brachte. Wie diese Welt hervorgebracht wurde, ist Gegenstand des vorliegenden Buchs.
Die Forschungsarbeiten haben erheblich von modernen wissenschaftlichen Werkzeugen profitiert. Satelliten kartieren die Umweltveränderungen, die durch den umfangreichen, weitgehend verborgenen Handel mit Latex, dem Hauptbestandteil des Naturkautschuks, bewirkt wurden. Mit DNA-Proben zeichnen Genetiker den verhängnisvollen Weg der Kartoffelfäule nach. Ökologen simulieren mit mathematischen Modellen die Ausbreitung der Malaria in Europa. Und so fort – es gibt Beispiele in Hülle und Fülle. Auch politische Veränderungen haben ihren Teil beigetragen. Um nur einen Aspekt zu nennen, der von besonderer Bedeutung für dieses Buch war – heute ist die wissenschaftliche Arbeit in China lange nicht mehr so schwierig wie Anfang der achtziger Jahre, als Crosby für sein Buch Die Früchte des weißen Mannes recherchierte. Inzwischen ist der Argwohn der Behörden weitgehend verschwunden; das größte Hindernis, auf das ich bei meinen Besuchen in Peking stieß, war der grauenhafte Verkehr. Sehr zuvorkommend versorgten mich Bibliothekare und Forscher mit frühen chinesischen Dokumenten in Form von Computerscans der Originale, die ich auf meinen kleinen Speicherstift kopieren durfte.
Die Ergebnisse dieser neuen Studien verraten höchst Bemerkenswertes über die nachkolumbische Zeit: Aus dem Zusammenprall der beiden alten Welten – oder der drei, wenn wir Afrika als ein von Eurasien unabhängiges Gebilde betrachten – bildete sich eine einzige neue Welt. Das diesem Austausch zugrundeliegende ökonomische System, das im 16. Jahrhundert aus dem europäischen Wunsch nach Beteiligung an der blühenden asiatischen Handelssphäre geboren wurde, verwandelte den Planeten bis zum 19. Jahrhundert – biologisch betrachtet also fast im Handumdrehen – in ein einziges ökologisches System. Durch die Schaffung dieses Systems war Europa in der Lage, mehrere entscheidende Jahrhunderte hindurch die politische Initiative an sich zu reißen, was umgekehrt die Grundzüge des heutigen erdumspannenden Wirtschaftssystems in seiner ganzen vielfältig verflochtenen, allgegenwärtigen und kaum verstandenen Pracht hervorbrachte.
Seit die Gewaltproteste während der WTO-Konferenz 1999 in Seattle den Globalisierungsbegriff ins öffentliche Bewusstsein brachten, haben Experten jeder ideologischen Provenienz die Öffentlichkeit mit Artikeln, Büchern, Weißbüchern, Blog-Einträgen und Videodokumentationen überschüttet, um ihn zu erklären, zu preisen oder anzugreifen. Von Anfang an kreiste die Debatte um zwei Pole. Auf der einen Seite die Ökonomen und Unternehmer, die leidenschaftlich die Auffassung vertraten, der Freihandel komme jeder Gesellschaft zugute – beide Seiten könnten von einem Austausch ohne Zwänge nur gewinnen. Je mehr Handel, desto besser, sagen sie. Sonst blieben den Menschen an einem Ort jene Errungenschaften versagt, die Erfindungsgabe unserer Art an anderen Orten hervorgebracht habe. Auf der anderen Seite beklagen Umweltschützer, Kulturnationalisten, Gewerkschafter und Konzerngegner lautstark, dass unregulierter Handel zu politischen, gesellschaftlichen und ökologischen Verhältnissen führe, die selten vorhersehbar seien und sich am Ende meist nachteilig auswirkten. Je weniger Handel, so sagen sie, desto besser. Schützt die lokalen Gemeinwesen vor den Kräften, die von multinationaler Gier entfesselt werden!
Im Kreuzfeuer dieser beiden entgegengesetzten Auffassungen ist das globale Netzwerk zum Gegenstand einer wüsten intellektuellen Schlacht geworden, die mit allen Mitteln geführt wird: einander wechselseitig widersprechenden Tabellen, Diagrammen und Statistiken sowie Tränengas und Pflastersteinen auf den Straßen, während die politischen Führer hinter Mauern von Bereitschaftspolizei um internationale Handelsabkommen ringen. Manchmal erscheint der Wirrwarr von Parolen und Gegenparolen, Fakten und Behauptungen vollkommen undurchdringlich, doch je genauer ich mich mit der Sache befasste, desto mehr gewann ich den Eindruck, dass beide Seiten recht haben könnten. Von Anfang an bewirkte die Globalisierung enorme wirtschaftliche Gewinne und gleichzeitig ökologische und soziale Umwälzungen, die diese Gewinne aufzuheben drohten.
Natürlich unterscheidet sich unsere Zeit von der Vergangenheit. Unsere Vorfahren verfügten nicht über Internet, Luftverkehr, gentechnisch veränderte Pflanzen und weltweiten elektronischen Wertpapierhandel. Und doch, wenn wir lesen, wie der Weltmarkt einst entstand, fühlen wir uns zwangsläufig – mal von fern, mal sehr deutlich – an die Auseinandersetzungen erinnert, von denen wir heute in den Fernsehnachrichten hören. Ereignisse, die vierhundert Jahre zurückliegen, prägten maßgeblich, was wir heute erleben.
Eines ist dieses Buch allerdings nicht: eine systematische Darlegung der ökonomischen und ökologischen Ursprünge dessen, was einige Historiker etwas vollmundig, aber zutreffend das «Weltsystem» nennen. Einige Erdregionen lasse ich völlig außer Acht; einige wichtige Ereignisse erwähne ich nur am Rande. Meine Entschuldigung lautet, dass der Gegenstand zu groß für ein einziges Buch ist; jedes Werk, das Anspruch auf Vollständigkeit erhöbe, müsste unhandlich und unlesbar werden. Auch kann ich nicht in Gänze erläutern, wie es zu diesem neuen wissenschaftlichen Konzept kam, wenn ich auch einige Meilensteine auf dem Weg dahin beschreibe. Stattdessen konzentriere ich mich in Kolumbus’ Erbe auf Bereiche, die mir besonders wichtig erscheinen, die besonders gut dokumentiert oder – hier macht sich meine journalistische Ausrichtung bemerkbar – besonders interessant sind. Leser, die sich gründlicher informieren möchten, seien auf die Quellen in den Anmerkungen und der Bibliographie verwiesen.
Nach dem Einführungskapitel ist das Buch in vier Abschnitte unterteilt. Im ersten und zweiten werden gewissermaßen die beiden Hälften des kolumbischen Austauschs beschrieben: die separaten, aber verknüpften Austauschprozesse über den Atlantik und den Pazifik. Der Atlantik-Abschnitt beginnt mit dem exemplarischen Fall von Jamestown, dem Beginn der permanenten britischen Besiedelung des amerikanischen Kontinents. Aus rein wirtschaftlichen Gründen in Angriff genommen, wurde sein Schicksal weitgehend von ökologischen Kräften bestimmt, vor allem durch Einfuhr von Tabak. Ursprünglich aus dem unteren Amazonasgebiet stammend, wurde diese exotische Pflanzenart – anregend, suchterzeugend, leicht verrucht – zum Gegenstand des ersten wirklich globalen Konsum-Hypes. Seide und Porzellan, in Europa und Asien schon lange heiß begehrt, eroberten nun auch Amerika und wurden die nächsten Verkaufsschlager. Das Kapitel schafft die Voraussetzung für das folgende, die Erörterung der eingeführten Arten, die mehr als alle anderen die Gesellschaften von Baltimore bis Buenos Aires prägten: die mikroskopisch kleinen Lebewesen, die Malaria und Gelbfieber verursachen. Nachdem ich ihre Auswirkungen auf Phänomene wie die Sklaverei in Virginia oder die Armut im geteilten Guayana untersucht habe, schließe ich mit der Bedeutung der Malaria für die Entstehung der USA.
Im zweiten Abschnitt steht der Pazifik im Fokus, wo das Zeitalter der Globalisierung mit der Verschiffung riesiger Silberladungen von Hispanoamerika nach China anbrach. Der Abschnitt beginnt mit einer Chronik von Städten: Potosí im heutigen Bolivien, Manila auf den Philippinen, Yueyang in Südostchina. Einst in aller Munde und heute weitgehend im Abseits, waren diese Städte quicklebendige, wichtige Bindeglieder eines wirtschaftlichen Austauschs, der die Welt zusammenwachsen ließ. Dieser Austausch brachte Süßkartoffeln und Mais nach China, mit zufälligen, aber verheerenden Folgen für die chinesischen Ökosysteme. Wie in einer klassischen Rückkopplungsschleife prägten diese ökologischen Folgen die ökonomischen und politischen Verhältnisse. Tatsächlich spielten Süßkartoffeln und Mais eine wichtige Rolle beim Aufstieg und Fall der letzten chinesischen Dynastie. Eine bescheidenere, aber letztlich ähnlich ambivalente Rolle spielten sie für die kommunistischen Herrscher, die schließlich folgten.
Der dritte Abschnitt zeigt, welchen Anteil der kolumbische Austausch an zwei Revolutionen hatte: der landwirtschaftlichen Revolution, die Ende des 17. Jahrhunderts begann, und der industriellen Revolution, die Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. Dabei konzentriere ich mich auf zwei eingeführte Arten: die Kartoffel, die aus den Anden nach Europa gebracht wurde, und den Gummibaum, heimlich aus Brasilien nach Süd- und Südostasien verpflanzt. Beide Revolutionen – die landwirtschaftliche und die industrielle – förderten den Aufstieg des Westens, seine plötzliche Entwicklung zur kontrollierenden Macht. Und beide hätten ohne den kolumbischen Austausch einen ganz anderen Verlauf genommen.
Im vierten Abschnitt greife ich ein Thema aus dem ersten Abschnitt wieder auf. Hier wende ich mich dem Austauschprozess zu, der menschlich betrachtet am folgenreichsten war: dem Sklavenhandel. Bis etwa 1700 waren neunzig Prozent aller Menschen, die den Atlantik überquerten, afrikanische Gefangene; ein Teil des restlichen Prozentsatzes waren, wie ich noch erklären werde, amerikanische Ureinwohner. Infolge dieser umfangreichen Bevölkerungsverschiebungen wurden viele Regionen Amerikas demographisch weitgehend von Afrikanern, Indianern und Afroindianern besiedelt. Ihre Wechselbeziehungen, die den Europäern lange verborgen blieben, sind ein wichtiger Teil unseres menschlichen Erbes, das erst jetzt ans Licht kommt.
Diese Begegnung von Rot und Schwarz, wie man sagen könnte, fand vor dem Hintergrund anderer Begegnungen statt. An den durch Kolumbus ausgelösten Migrationswellen waren so viele verschiedene Völker beteiligt, dass die Welt den Aufstieg der ersten der inzwischen selbstverständlich gewordenen polyglotten, multinationalen Metropolen erlebte: Mexico City. Dieser Mix der Kulturen erstreckte sich von der Spitze der sozialen Hierarchie, wo die Konquistadoren in die Aristokratie der eroberten Völker hineinheirateten, bis zu ihrer untersten Stufe, wo sich die spanischen Barbiere bitterlich über die aus China eingewanderten Niedriglohnfriseure beklagten. Diese große, turbulente Metropole, diese globale Wegkreuzung repräsentiert die Vereinigung der beiden im ersten Teil des vorliegenden Buchs beschriebenen Netzwerke. Ein im Präsens geschriebener Schlussteil soll andeuten, dass diese Austauschprozesse unvermindert fortdauern.
In gewisser Hinsicht ist dieses Bild einer Vergangenheit – einer kosmopolitischen Welt, deren Entwicklung von Ökologie und Ökonomie geprägt wurde – überraschend für Menschen, die, wie ich, mit Berichten über heroische Seefahrer aufwuchsen, über geniale Erfinder und Weltreiche, die dank technischer und institutioneller Überlegenheit gegründet wurden. Seltsam ist auch die Erkenntnis, dass die Welt schon seit fast fünf Jahrhunderten die Früchte der Globalisierung erntet. Andererseits nehmen wir bestürzt zur Kenntnis, dass die Globalisierung eine ebenso lange Geschichte ökologischer Erschütterungen und in ihrem Gefolge menschlichen Leids und politischer Umwälzungen hat. Doch es liegt auch eine gewisse Größe in diesem Verständnis unserer Vergangenheit, führt es uns doch vor Augen, dass jeder Ort, jede Region eine Rolle in der menschlichen Geschichte gespielt hat und dass sie alle in den größeren, unvorstellbar komplexen Fortschritt des Lebens auf diesem Planeten eingebettet sind.
Ich schreibe dies an einem warmen Augusttag. Gestern haben meine Frau und die Kinder die ersten Tomaten in unserem Garten gepflückt – in dem etwas verbesserten Tomatenbeet, das ich vor zwanzig Jahren nach dem Besuch im College angelegt hatte.
Nachdem ich die Samen aus dem Katalog ausgesät hatte, entdeckte ich schon bald, warum viele Menschen so gern in ihrem Garten herumwerkeln. Während ich mir im Tomatenbeet zu schaffen machte, fühlte ich mich an das Burgenbauen in meiner Kindheit erinnert: Ich schuf mir eine Zuflucht vor der Welt und zugleich einen eigenen Ort in dieser Welt. In der Erde kniend, gestaltete ich eine kleine Landschaft in jener trauten, tröstlichen Zeitlosigkeit, die durch Wörter wie Zuhause oder Heimat beschworen wird.
Biologen dürfte das als ziemlich unsinnig erscheinen. Im Laufe der Zeit hat mein Tomatenbeet eine bunte Pflanzenvielfalt aufgenommen: Basilikum, Auberginen, Paprika, Kohl, Mangold, mehrere Arten Kopfsalat und salatartiges Blattgemüse sowie einige Ringelblumen, von denen mein Nachbar behauptete, sie würden Schädlinge vertreiben – die Wissenschaft ist da uneins. Nicht eine dieser Arten hat ihren Ursprung näher als 1500 Kilometer von meinem Garten. Genauso wenig wie der Mais und der Tabak, die auf Farmen in der Nähe angebaut werden; Mais kommt aus Mexiko, Tabak aus dem Amazonasgebiet, diese Art jedenfalls. Es gab eine einheimische Art, die heute ausgestorben ist. Genauso ortsfremd sind übrigens auch die Kühe, Pferde und Hofkatzen meiner Nachbarn. Leute, die wie ich ihren Garten als traut und zeitlos empfinden, sind ein Beweis für die menschliche Anpassungsfähigkeit – oder, weniger euphemistisch, für unsere Fähigkeit, in völliger Unkenntnis zu handeln. Weit entfernt davon, ein Ort der Stabilität und Tradition zu sein, ist mein Garten ein biologisches Dokument früherer Wanderbewegungen und Austauschprozesse der Menschheit.
Doch in einer anderen Hinsicht sind meine Empfindungen durchaus zutreffend. Vor fast siebzig Jahren hat der kubanische Anthropologe und Ethnologe Fernando Ortiz Fernández den sperrigen, aber nützlichen Begriff «Transkulturation» geprägt, um zu beschreiben, was geschieht, wenn eine Gruppe Menschen etwas von einer anderen übernimmt – ein Lied, ein Lebensmittel, ein Ideal. Fast unvermeidlich kommt es dabei, so Ortiz, zu einer Verwandlung; die Menschen machen etwas Eigenes daraus, sie passen es an, bearbeiten es und legen es sich zurecht, bis es ihren Bedürfnissen und Verhältnissen entspricht. Seit Kolumbus befindet sich die Welt im Griff einer fortwährenden, hektischen Transkulturation. Jeder Fleck der Erdoberfläche – vielleicht abgesehen von ein paar Stellen in der Antarktis – wurde von Orten verändert, die bis 1492 viel zu weit entfernt gewesen waren, um irgendeinen Einfluss auszuüben. Seit fünf Jahrhunderten sind jetzt Kollision und Chaos infolge dieser ständigen Kontakte unser Normalzustand; mein Garten mit seiner Auswahl an exotischen Pflanzen ist ein kleines Beispiel dafür. Bleibt die Frage, wie die Tomaten in die Ukraine gelangten. In gewisser Weise ließe sich das vorliegende Buch recht gut durch die Feststellung beschreiben, dass es, lange nachdem ich die Frage zum ersten Mal stellte, meine erfolgversprechendsten Ansätze zusammenfasst, eine Antwort zu finden.
EinleitungIm Homogenozän
Kapitel 1Zwei Monumente
Pangäas Bruchstellen
Obwohl es eben noch geregnet hatte, war die Luft heiß und drückend. Kein Mensch war zu sehen; außer Insekten und Möwen waren nur die karibischen Wellen als leises Hintergrundrauschen zu hören. Auf dem spärlich bewachsenen roten Boden bildeten Steinreihen ein paar verstreute Rechtecke: die von Archäologen ausgegrabenen Umrisse längst verschwundener Gebäude. Dazwischen verliefen Zementwege, von denen nach dem Regen etwas Dampf aufstieg. Ein Gebäude hatte eindrucksvollere Mauern als die anderen. Die Wissenschaftler hatten es mit einem neuen Dach versehen, es war das einzige Bauwerk, das sie auf diese Weise vor dem Regen schützten. Wie ein Posten stand ein handgemaltes Schild am Eingang: «Casa Almirante», Haus des Admirals, und kennzeichnete die erste amerikanische Residenz von Christoph Kolumbus, dem Admiral der Meere und Entdecker der Neuen Welt, wie Generationen von Schulkindern gelernt haben.
La Isabela, wie dieses Gemeinwesen hieß, liegt an der Nordseite der großen Karibikinsel Hispaniola in der heutigen Dominikanischen Republik.[1] Es war der erste Versuch der Europäer, eine dauerhafte Niederlassung auf dem amerikanischen Kontinent zu etablieren, genauer gesagt: La Isabela markierte den Beginn einer ständigen europäischen Besiedlung – Wikinger hatten schon fünfhundert Jahre zuvor ein kurzzeitig bestehendes Dorf in Neufundland angelegt. Der Admiral hatte seine neue Siedlung am Zusammenfluss zweier kleiner Flüsse mit starker Strömung bauen lassen: ein befestigtes Zentrum am Nordufer und eine Reihe Bauernhöfe am Südufer. Für sein Haus hatte Kolumbus – oder vielmehr Cristóbal Colón, um ihn bei dem Namen zu nennen, den er damals trug – den schönsten Standort gewählt, den die Ortschaft zu bieten hatte: eine Felszunge im Nordteil der Siedlung, direkt über dem Wasser gelegen. Das Gebäude war so angelegt, dass es genau dem Nachmittagslicht zugekehrt war.[2]
Steinreihen markieren die Umrisse der längst zerfallenen Gebäude in La Isabela, Christoph Kolumbus’ erstem Versuch, eine dauerhafte Niederlassung auf dem amerikanischen Kontinent anzulegen.
Heute ist La Isabela fast vergessen. Manchmal scheint seinem Gründer ein ähnliches Schicksal zu drohen. Natürlich wird Colón nicht aus den Geschichtsbüchern gestrichen, verliert dort aber offenbar immer mehr an Wertschätzung und Bedeutung. Er sei ein grausamer, verblendeter Mann gewesen, sagen seine Kritiker, den reines Glück in die Karibik geführt habe. Als Erfüllungsgehilfe des Imperialismus habe er sich in jeder Hinsicht als Unglück für die amerikanischen Ureinwohner erwiesen. Allerdings gibt es auch eine andere zeitgenössische Ansicht, nach der der Admiral durchaus unser Interesse verdient: Er sei der einzige Mensch, dem es je gelang, ganz allein ein neues Zeitalter in der Geschichte des Lebens zu begründen.[3]
Nur widerwillig unterstützte das spanische Königspaar, Ferdinand II. und Isabella I., Colóns erste Reise. Ozeanüberquerungen waren damals schwindelerregend kostspielig und riskant – heute vielleicht vergleichbar mit Spaceshuttle-Flügen.[4] Obwohl Colón die Monarchen pausenlos bekniete, vermochte er sie nur zur Unterstützung zu gewinnen, indem er schließlich drohte, sich mit dem ganzen Vorhaben nach Frankreich zu wenden. Er sei schon auf dem Ritt zur Grenze gewesen, so schrieb ein Freund später, als die Königin «Hals über Kopf einen Häscher hinter ihm herschickte», um ihn zurückzuholen. Die Geschichte ist wahrscheinlich übertrieben. Trotzdem haben die Vorbehalte des Herrscherpaares den Admiral veranlasst, seine Expedition – wenn auch nicht seine Ambitionen – auf ein Minimum zu beschränken: drei kleine Schiffe, das größte wohl kaum zwanzig Meter lang, und eine Mannschaft von insgesamt neunzig Mann. Colón selbst musste laut einem seiner Männer ein Viertel der Kosten übernehmen, vermutlich lieh er das Geld von italienischen Kaufleuten.
All das änderte sich mit seiner triumphalen Rückkehr im März 1493, die Schiffe beladen mit Goldschmuck, buntschillernden Papageien und sage und schreibe zehn gefangenen Indianern. Nur ein halbes Jahr später schickten König und Königin, jetzt voller Begeisterung, Colón auf eine zweite, viel größere Expedition: siebzehn Schiffe und insgesamt etwa 1500 Mann Besatzung, darunter mindestens ein Dutzend Priester mit dem Auftrag, in den neuen Ländern den christlichen Glauben zu verbreiten. Da der Admiral glaubte, er habe einen Seeweg nach Asien entdeckt, war er sich sicher, dass China und Japan – nebst ihren reichen Schätzen – nur noch eine kurze Reise entfernt seien. Diese zweite Expedition hatte das Ziel, für Spanien eine dauerhafte Bastion im Herzen Asiens zu schaffen, einen Stützpunkt für weitere Entdeckungs- und Handelsreisen.[5]
Die neue Kolonie werde, so prophezeite einer ihrer Gründer, «weithin gerühmt werden wegen ihrer vielen Einwohner, ihrer prachtvollen Gebäude und ihrer mächtigen Mauern».[6] Stattdessen war La Isabela eine Katastrophe und wurde kaum fünf Jahre nach der Gründung aufgegeben. Im Laufe der Zeit zerfielen die Häuser, ihre Steine wurden abgetragen und zum Bau anderer, erfolgreicherer Städte verwendet. Als ein archäologisches Team von US-amerikanischen und venezolanischen Forschern dort Ende der 1980er Jahre mit Ausgrabungen begann, war die Einwohnerschaft so geschrumpft, dass die Wissenschaftler die ganze Siedlung auf einen Berghang in der Nähe umsetzen konnten. Heute hat sie zwei an der Durchfahrtsstraße gelegene Fischrestaurants, ein schäbiges Hotel und ein kaum besuchtes Museum vorzuweisen. Am Rand der Ortschaft erinnert eine 1994 erbaute, bereits vom Verfall gezeichnete Kirche an die erste katholische Messe, die auf dem amerikanischen Kontinent gefeiert wurde. Als ich vom einstigen Haus des Admirals auf die Wellen blickte, konnte ich mir unschwer die Enttäuschung der Touristen vorstellen, die sicherlich den Eindruck gewinnen, es sei von der Kolonie nichts Bemerkenswertes übriggeblieben – es gebe, vom schönen Strand abgesehen, keinen Grund, La Isabela Beachtung zu schenken. Doch das ist ein Irrtum.
Kinder, die am 2. Januar 1494 geboren wurden, dem Tag, an dem der Admiral La Isabela gründete, erblickten das Licht einer Welt, in der der direkte Handelsverkehr zwischen Westeuropa und Ostasien weitgehend durch die dazwischen liegenden muslimischen Länder – und ihre Handelspartner in Venedig und Genua – blockiert wurde, Schwarzafrika wenig Kontakt mit Europa und so gut wie keinen mit Süd- und Ostasien hatte und in der die östliche und die westliche Hemisphäre fast nichts von der Existenz der jeweils anderen wussten. Als diese Neugeborenen dann Enkelkinder hatten, bauten Sklaven aus Afrika in amerikanischen Bergwerken Silber ab, das zum Verkauf in China bestimmt war, warteten spanische Kaufleute ungeduldig auf die Schiffe, die asiatische Seide und Porzellan aus Mexiko geladen hatten, tauschten niederländische Seeleute in Angola an der Atlantikküste Menschen gegen Kaurimuscheln von den Malediven im Indischen Ozean. Tabak aus der Karibik verzauberte die Reichen und Mächtigen in Madrid, Madras, Mekka und Manila. Smoke-ins gewalttätiger junger Männer in Edo, dem heutigen Tokio, führten rasch zur Bildung zweier rivalisierender Banden, des Brombeer-Clubs und des Lederhosen-Clubs. Der Schogun steckte siebzig ihrer Mitglieder ins Gefängnis und verbot das Rauchen.[7]
Fernhandel gab es seit mehr als tausend Jahren, größtenteils über den Indischen Ozean. Seit Jahrhunderten lieferte China Seide über die Seidenstraße in den Mittelmeerraum, eine Handelsroute, die lang, gefährlich und – für die Überlebenden – äußerst einträglich war.[8] Doch noch nie hatte es etwas gegeben, das mit diesem weltweiten Austausch zu vergleichen gewesen wäre – ganz zu schweigen davon, wie rasch er sich herausgebildet hatte und wie reibungslos er vonstattenging. Keines der bis dahin existierenden Handelsnetze hatte beide Hemisphären umfasst noch Größenordnungen erreicht, die tiefgreifende Umwälzungen in Gesellschaften auf der anderen Seite des Planeten hätten bewirken können. Die Gründung von La Isabela war der Beginn von Europas dauerhafter Inbesitznahme Amerikas. Zugleich leitete Colón damit das Zeitalter der Globalisierung ein – jenes wilden Austauschs von Waren und Dienstleistungen, an dem heute alle bewohnbaren Regionen der Erde beteiligt sind.[9]
Medien behandeln die Globalisierung meist als rein wirtschaftliches Ereignis, obwohl sie auch ein biologisches Phänomen ist. Langfristig betrachtet, könnte sie sogar ein primär biologischer Vorgang sein. Vor 250 Millionen Jahren gab es auf der Erde nur eine einzige Landmasse, in der Wissenschaft Pangäa genannt. Geologische Kräfte brachen diese riesige Fläche auseinander, wodurch sich Eurasien und Amerika voneinander trennten. Im Lauf der Zeit entwickelten die beiden getrennten Hälften Pangäas höchst unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Vor Colón hatten ein paar wagemutige Landspezies das Meer überquert und auf der anderen Seite Fuß gefasst. Erwartungsgemäß überwiegen Insekten und Vögel, aber überraschenderweise sind auch Nutzpflanzen darunter wie Flaschenkürbis, Kokosnuss und Süßkartoffel, die den Forschern heute einiges Kopfzerbrechen bereiten.[10] Ansonsten war die Welt in getrennte ökologische Sphären unterteilt. Colóns besondere Leistung bestand nach den Worten des Historikers Alfred W. Crosby darin, die Bruchstellen Pangäas wieder zusammenzufügen.[11] Als nach 1492 europäische Schiffe Tausende von Arten über die Weltmeere trugen und diese in neuen Gebieten heimisch wurden, prallten die Ökosysteme der Erde aufeinander und mischten sich. Dem kolumbischen Austausch, wie Crosby diesen Prozess nannte, ist zu verdanken, dass es Tomaten in Italien, Apfelsinen in den USA, Schokolade in der Schweiz und Chili-Pfeffer in Thailand gibt. Für Ökologen ist der kolumbische Austausch möglicherweise das wichtigste Ereignis seit dem Aussterben der Dinosaurier.[12]
Wie nicht anders zu erwarten, wirkten sich diese gewaltigen biologischen Umwälzungen auch auf die Menschheit aus. Crosby vertritt die Ansicht, dass der kolumbische Austausch zahlreichen geschichtlichen Ereignissen zugrunde liegt, über die in der Schule gelehrt wird. Er war wie eine unsichtbare Flutwelle, die alle mit sich riss, ohne dass sie es merkten – Könige und Königinnen wie Bauern und Priester. Die These war umstritten; tatsächlich wurde Crosbys Manuskript immer wieder abgelehnt und erschien schließlich bei einem Verlag, der so winzig war, dass Crosby einmal im Scherz zu mir meinte, sein Buch sei vertrieben worden, «indem wir es auf die Straße geworfen und gehofft haben, dass die Leser darüber stolpern». Doch in den Jahrzehnten, nachdem er den Begriff geprägt hatte, kam eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern zu der Überzeugung, dass die ökologischen Eruptionen, die Colóns Reisen ausgelöst hatten, genauso wie die begleitenden wirtschaftlichen Umwälzungen zu den Gründungsereignissen der modernen Welt gehörten.
Am ersten Weihnachtstag 1492 fand Colóns erste Reise ein plötzliches Ende, als sein Flaggschiff Santa Maria vor der Nordküste von Hispaniola auf Grund lief. Da die beiden verbleibenden Schiffe, die Niña und die Pinta, zu klein waren, um die ganze Mannschaft aufzunehmen, sah er sich gezwungen, achtunddreißig Männer zurückzulassen. Colón machte sich auf den Rückweg nach Spanien, während seine Leute in der Nachbarschaft eines Dorfes ein Lager errichteten – eine verstreute Ansammlung provisorischer Hütten, umgeben von einer primitiven Palisade. Das Lager, dessen genauer Standort heute nicht mehr bekannt ist, wurde nach dem Tag seiner unfreiwilligen Gründung La Navidad, Weihnachten, getauft.[13] Die Ureinwohner von Hispaniola werden heute als Taino bezeichnet.[14] Die gemischte Siedlung La Navidad – halb spanisch, halb Taino – war das Ziel von Colóns zweiter Reise. Am 28. November 1493, elf Monate nachdem er seine Männer dort zurückgelassen hatte, kehrte er triumphal an der Spitze einer kleinen Flotte zurück, während seine Besatzung, begierig, das neue Land zu sehen, scharenweise in die Wanten enterte.
Er fand nur noch Ruinen vor; beide Siedlungen, die der Spanier wie die der Taino, waren dem Erdboden gleichgemacht worden.[15] «Wir sahen, dass alles niedergebrannt war und die Kleidung der Christen im Gras lag», schrieb der Schiffsarzt. In der Nähe lebende Taino zeigten den Besuchern die Leichen von elf Spaniern, «bedeckt von der Vegetation, die sie überwuchert hatte». Die Indianer berichteten, die Seeleute hätten ihre Nachbarn erzürnt, als sie Frauen vergewaltigt und einige Männer ermordet hätten. Noch während der Auseinandersetzung sei eine zweite Taino-Gruppe eingefallen und habe beide Parteien überwältigt. Nachdem Colón neun Tage lang erfolglos nach Überlebenden hatte suchen lassen, brach er auf, um eine günstigere Stelle für seinen Stützpunkt zu suchen. Gegen widrige Winde ankämpfend, brauchte die Flotte fast einen Monat, um an der Küste hundertfünfzig Kilometer ostwärts zu gelangen. Am 2. Januar 1494 erreichte Colón die seichte Bucht, an der er La Isabela gründen sollte.
Unmittelbar nach der Ankunft wurden den Kolonisten die Nahrung und, noch schlimmer, das Wasser knapp. Seine Unzulänglichkeit als Organisator unter Beweis stellend, hatte der Admiral es versäumt, die angelieferten Wasserfässer zu inspizieren; natürlich waren sie undicht. Ohne die Klagen über Hunger und Durst zu beachten, hieß der Admiral seine Männer, Land zu roden und mit Gemüse zu bepflanzen, eine zweistöckige Festung zu errichten und die nördliche Hälfte der neuen Exklave – ihren größeren Teil – mit hohen Steinmauern zu umgeben. Im Inneren der Mauern bauten die Spanier vielleicht zweihundert Häuser, «klein wie die Hütten, die wir bei der Vogeljagd benutzen, und mit Grasdächern versehen», beschwerte sich ein Mann.[1] [16]
Die meisten Neuankömmlinge hielten diese Arbeiten für Zeitverschwendung. Kaum einer wollte tatsächlich in La Isabela sesshaft werden, geschweige denn den Boden bestellen. Vielmehr hielten sie die Kolonie für ein vorübergehendes Basislager, von dem aus sie sich auf die Suche nach Reichtümern, vor allem nach Gold, machen wollten. Colón selbst war hin- und hergerissen. Einerseits erwartete man von ihm, eine Kolonie zu regieren und sie zu einem Handelsplatz in Amerika auszubauen. Andererseits sollte er mit seinen Schiffen unterwegs sein, um den Seeweg nach China zu suchen. Die beiden Aufgaben vertrugen sich nicht – ein Konflikt, den Colón nie lösen konnte.
Am 24. April stach der Admiral in See, um das Reich der Mitte zu finden. Vorher hatte er noch Pedro Margarit, seinen militärischen Befehlshaber, angewiesen, vierhundert Mann in das zerklüftete Innere der Insel zu führen und nach indianischen Goldminen zu suchen. Nachdem Margarits Truppen kaum nennenswerte Mengen Gold – und wenig Nahrung – in den Bergen gefunden hatten, kehrten sie zerlumpt und hungernd nach La Isabela zurück, nur um zu entdecken, dass auch die Kolonie wenig zu essen hatte – grollend hatten sich die Zurückgelassenen geweigert, die Gärten zu bestellen. Der zornige Margarit kaperte drei Schiffe und floh nach Spanien, nachdem er gedroht hatte, das ganze Unternehmen als Zeit- und Geldverschwendung zu entlarven.[17] Ohne Nahrungsmittel zurückgeblieben, begannen die Kolonisten, Taino-Lagerhäuser zu plündern. Die erbosten Indianer ließen sich das nicht gefallen und lösten einen chaotischen Krieg aus. Mit dieser Situation sah sich Colón konfrontiert, als er fünf Monate nach seiner Abreise wieder in La Isabela eintraf, schwer krank und ohne China erreicht zu haben.
Ein lockeres Bündnis von vier Taino-Gruppen kämpfte gegen die Spanier, während sich eine Taino-Gruppe auf die Seite der Fremden geschlagen hatte. Die Taino, die kein Metall kannten, hatten den Stahlwaffen nichts entgegenzusetzen. Aber sie verkauften ihre Haut teuer, indem sie eine Frühform chemischer Kriegführung anwendeten. Sie warfen Kürbisse, die sie mit Asche und gemahlenen Peperoni gefüllt hatten, gegen ihre Angreifer, wodurch Wolken von stickigem, in den Augen beißendem Pulver freigesetzt wurden. Schützende Tücher vor dem Gesicht, stürzten sie durch die Tränen treibenden Schwaden vorwärts und töteten die Spanier. So wollten sie die Fremden vertreiben – eine inakzeptable Vorstellung für Colón, der alles auf diese Reise gesetzt hatte. Als die Spanier zum Gegenangriff übergingen, zogen sich die Taino nach dem Prinzip der verbrannten Erde zurück: Sie zerstörten ihre Hütten und Gärten in der Überzeugung, wie Colón verächtlich schrieb, «der Hunger würde uns aus dem Land treiben». So konnte keine Seite gewinnen. Die Taino-Allianz vermochte die Spanier nicht aus Hispaniola hinauszuwerfen, während die Spanier Krieg gegen das Volk führten, das sie mit Nahrungsmitteln versorgte; der totale Sieg musste in einem totalen Desaster enden. Die Spanier gewannen ein Gefecht nach dem anderen und töteten zahllose Einwohner. Derweil ließen Hunger, Krankheit und Erschöpfung den Friedhof von La Isabela immer größer werden.[18]
Von der Katastrophe gedemütigt, brach der Admiral am 10. März 1496 nach Spanien auf, um von König und Königin abermals Geld und Ausrüstung zu erbitten. Als er zwei Jahre später zurückkehrte – es war die dritte von seinen insgesamt vier Atlantiküberquerungen –, war von La Isabela so wenig übriggeblieben, dass er auf der anderen Seite der Insel in der neuen Siedlung Santo Domingo landete, die sein Bruder Bartolomé in der Zwischenzeit gegründet hatte. Nie wieder setzte Colón einen Fuß in seine erste Kolonie, sodass sie fast in Vergessenheit geriet.
Obwohl sie nur so kurz existierte, stellte La Isabela den Beginn einer tiefgreifenden Veränderung dar: die Erschaffung der modernen karibischen Landschaft. Colón und seine Mannschaft reisten nicht allein, sondern wurden begleitet von einer bunten Menagerie aus Insekten, Säugetieren und Mikroorganismen, auch Pflanzen führten sie mit sich. Ab der Gründung von La Isabela brachten europäische Expeditionen Rinder, Schafe und Pferde, Nutzpflanzen wie Zuckerrohr, Weizen, Bananen und Kaffee, die ursprünglich aus Neuguinea, dem Nahen Osten und aus Afrika stammten. Ebenso wichtig: an Bord befanden sich auch Passagiere, die den Spaniern gar nicht auffielen – Regenwürmer, Stechmücken und Kakerlaken, Bienen, Löwenzahn, afrikanische Gräser und allerlei Ratten. Sie alle entströmten den Schiffen Colóns und der nach ihm kommenden Seefahrer, um wie übereifrige Touristen in Küstenstriche auszuschwärmen, die nie von ihresgleichen aufgesucht worden waren.[19]
Rinder und Schafe zermahlten die amerikanische Vegetation zwischen ihren flachen Zähnen, wodurch sie das Nachwachsen einheimischer Sträucher und Bäume verhinderten. Unter ihren Hufen sprossen Gräser aus Afrika, wahrscheinlich durch die Spreulager der Sklavenschiffe eingeschleppt, deren weit gespreizte, dicht über dem Boden liegende Blätter erstickten die einheimischen Gewächse. Zudem konnten die ausländischen Grassorten das weidende Vieh besser ertragen als die karibischen Bodendecker, weil Gräser von der Basis aus wachsen, die meisten anderen Arten dagegen von der Spitze. Bei ihnen werden durch weidende Tiere die Wachstumszonen vernichtet, während Gräser weitgehend unbeschadet bleiben. Im Laufe der Zeit verwandelten sich die Wälder von karibischen Palmen, Mahagoni- und Kapokbäumen in Bestände aus australischen Akazien, äthiopischen Sträuchern und zentralamerikanischem Blauholz. Darunter huschten Mungos aus Indien umher und machten sich eifrig daran, die dominikanischen Schlangen auszurotten. Der Wandel dauert bis heute an. Orangenhaine werden seit einiger Zeit von Limetten-Schwalbenschwänzen verwüstet, Zitrusschädlingen aus Südostasien, die wahrscheinlich 2004 eingeschleppt wurden. Heute weist Hispaniola nur noch kleine Bruchteile seiner ursprünglichen Bewaldung auf.
Einheimische Arten und Neuankömmlinge wirkten auf unerwartete Weise zusammen und richteten ein biologisches Chaos an. Nach einer Theorie des Harvard-Entomologen Edward O. Wilson holten die spanischen Kolonisten, als sie 1516 afrikanischen Wegerich einführten, auch die Schildlaus ins Land, ein kleines Insekt mit einer zähen, wächsernen Hülle, das aus Pflanzenwurzeln und Stängeln Saft saugt. In Afrika kennt man rund ein Dutzend Schildläuse, die Bananen befallen. Auf Hispaniola, so Wilson, hätten sie keine natürlichen Feinde gehabt. Folglich müsse ihre Zahl explosionsartig angestiegen sein – ein Phänomen, das in der Forschung als «Konkurrenzentlastung» bezeichnet wird. Die Ausbreitung der Schildläuse dürfte die europäischen Bananenfarmer entsetzt, aber eine der einheimischen Arten entzückt haben: die tropische Feuerameise, Solenopsis geminata.[2] Die zuckrigen Exkremente der Schildläuse sind ein Festessen für S. geminata; um den Nachschub zu sichern, würden die Ameisen alles angreifen, was ihn gefährden könnte.[20] Eine enorme Zunahme der Schildläuse müsste folglich zu einer entsprechenden Zunahme der Feuerameisen führen.
Bis dahin handelt es sich um eine plausible Annahme. Nicht jedoch bei dem, was 1518 und 1519 geschah. In diesen Jahren seien, so berichtet der Missionar Bartolomé de Las Casas, der das Geschehen mit eigenen Augen verfolgt hatte, spanische Orangen-, Granatapfel- und Kassiaplantagen «von der Wurzel aufwärts» vernichtet worden. «Tausende Morgen Obstländereien» seien «vertrocknet und verdorrt, als ob Flammen vom Himmel gefallen wären und sie verbrannt hätten». Der tatsächliche Sünder, so Wilson, seien die saftsaugenden Schildläuse gewesen. Doch die Spanier erblickten lediglich S. geminata – «eine unendlich Zahl von Ameisen», schreibt Las Casas. Ihre Stiche verursachten «größere Pein als Wespen, die Menschen beißen». Die Ameisenschwärme zogen durch Häuser und bedeckten die Dächer mit schwarzen Schichten, «als wären sie mit Kohlenstaub überzogen», sie bewegten sich in solchen Mengen auf den Fußböden, dass die Kolonisten nur schlafen konnten, indem sie die Beine ihrer Betten in Wasserschüsseln stellten. Sie «waren durch nichts aufzuhalten, durch keine menschlichen Maßnahmen».
Entmutigt und verängstigt überließen die Spanier ihre Häuser den Insekten. Santo Domingo war «entvölkert», wie sich ein Augenzeuge erinnerte. In einer feierlichen Zeremonie bestimmten die zurückgebliebenen Kolonisten per Lotterie einen Heiligen, der bei Gott Fürbitte für sie leisten sollte. Es war der heilige Saturninus, ein Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert. Sie veranstalteten eine Prozession und ein Fest zu seinen Ehren. Die Reaktion war positiv. «Von diesem Tag an», schreibt Las Casas, «konnte man deutlich sehen, dass sich die Plage verringerte.»
Aus menschlicher Sicht betraf die nachhaltigste Wirkung des kolumbischen Austauschs die Menschheit selbst. Spanische Berichte lassen darauf schließen, dass Hispaniola eine dichte indigene Bevölkerung hatte: Bei Colón heißt es, die Taino seien «unzählig, denn ich glaube, es gibt Millionen und Abermillionen von ihnen».[21] Las Casas behauptete, die Bevölkerung umfasse «mehr als drei Millionen». Moderne Forscher konnten die Annahmen nicht präzisieren: Die Schätzungen reichen von 60000 bis zu fast acht Millionen. 2003 kam eine sorgfältige Studie zu dem Ergebnis, dass ihre Zahl «einige Hunderttausend» betragen habe.[22] Doch unabhängig von der tatsächlichen Anzahl waren die Auswirkungen, die die Europäer hervorriefen, entsetzlich. 1514, nach Colóns erster Reise waren zweiundzwanzig Jahre vergangen, ließ die spanische Regierung die Indianer auf Hispaniola zählen, um sie den Kolonisten als Arbeitskräfte zuzuweisen. Volkszählungsbeauftragte durchkämmten die Insel, fanden aber nur 26000 Taino. Vierunddreißig Jahre später waren laut einem gelehrten spanischen Inselbewohner keine fünfhundert Taino mehr am Leben.[23] Die Vernichtung der Taino stürzte Santo Domingo in Armut. Die Kolonisten hatten die eigenen Arbeitskräfte ausgelöscht.[24]
Die Grausamkeit der Spanier trug ihren Teil zur Katastrophe bei, doch die weitaus bedeutendere Ursache war der kolumbische Austausch. Vor Colón gab es keine der in Europa und Asien verbreiteten epidemischen Krankheiten in Amerika. Die Viren, die Pocken, Grippe, Hepatitis, Masern, Enzephalitis und virale Lungenentzündung hervorrufen, und die Bakterien, die Tuberkulose, Diphtherie, Cholera, Typhus, Scharlach und Meningitis verursachen, waren dank eines Zufalls der Evolutionsgeschichte unbekannt in der westlichen Hemisphäre. Per Schiff über den Ozean aus Europa eingeschleppt, rafften diese Krankheiten die Ureinwohner Hispaniolas dahin. Die erste dokumentierte Epidemie – möglicherweise handelte es sich um die Schweinegrippe – wütete 1493. Zu einem schrecklichen Ausbruch der Pocken kam es 1518; sie griffen auf das spätere Mexiko über, breiteten sich über Mittelamerika nach Süden aus und drangen bis nach Peru sowie ins heutige Bolivien und Chile vor. Ihr folgte die apokalyptische Schar der anderen Krankheiten.[25]
Während des 16. und 17. Jahrhunderts breiteten sich neue Mikroorganismen über Amerika aus, sprangen von Opfer zu Opfer und töteten drei Viertel der Menschen auf dieser Erdhalbkugel. Es war, als wäre das Leid, das diese Krankheiten in den vorangegangenen Jahrtausenden über Eurasien gebracht hatten, auf eine Zeitspanne von wenigen Jahrzehnten konzentriert worden. In den Annalen der Menschheitsgeschichte findet sich keine vergleichbare demographische Katastrophe. Die Taino wurden vom Antlitz der Erde gelöscht, wenn auch die neuere Forschung darauf schließen lässt, dass ihre DNA möglicherweise unsichtbar in Dominikanern von afrikanischem oder europäischem Aussehen überlebt hat – miteinander verflochtene genetische Stränge von verschiedenen Kontinenten, biologisch verschlüsselte Vermächtnisse des kolumbischen Austauschs.[26]
Die Fahrt zum Leuchtturm
Ein friedlich murmelnder Fluss verläuft durch Santo Domingo, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Am Westufer stehen die steinernen Überreste der Kolonialstadt, einschließlich des Palastes von Diego Colón, dem Erstgeborenen des Admirals. Am Ostufer erhebt sich ein riesiges Hochplateau aus fleckigem Beton, ein Monolith von fünfunddreißig Meter Höhe und 223 Meter Länge. Das ist der Faro a Colón – der Kolumbus-Leuchtturm. Als Leuchtturm wird der Bau bezeichnet, weil 146 Vier-Kilowatt-Lampen auf ihm angebracht sind. Vertikal ausgerichtet durchbohren sie den Himmel mit gleißenden Lichtspeeren, in den benachbarten Vierteln bricht deshalb immer wieder das Stromnetz zusammen.
Wie eine mittelalterliche Kirche ist der Leuchtturm als Kreuz angelegt – mit einem langen Mittelschiff und zwei kurzen Querschiffen. Am zentralen Schnittpunkt befindet sich in einem gläsernen Sicherheitsbehälter ein reich verzierter goldener Sarkophag, der angeblich die Gebeine des Admirals enthält. Die Behauptung ist umstritten, denn im spanischen Sevilla steht ein anderer, nicht weniger verzierter Sarkophag, von dem es ebenfalls heißt, er berge Colóns sterbliche Überreste. Neben dem Sarkophag gibt es eine Reihe von Exponaten verschiedener Provenienz. Als ich den Ort vor nicht allzu langer Zeit besuchte, betrafen die meisten dieser Ausstellungsstücke die Ureinwohner der Hemisphäre: Sie wurden als die passiven oder sogar dankbaren Empfänger der kulturellen und technologischen Großzügigkeit Europas dargestellt.
Verständlicherweise teilen die indigenen Völker nur selten diese Auffassung von ihrer Geschichte und von Colóns Rolle darin. Ein Heer von Bürgerrechtlern und Wissenschaftlern hat die Öffentlichkeit mit vernichtenden Urteilen über den Mann und sein Werk bombardiert. Man bezeichnete ihn als brutal, was er nach heutigen Maßstäben war, und als Rassisten, der er streng genommen nicht war – der moderne Rassenbegriff war noch nicht erfunden –, als unfähigen Administrator, der er war, und als unfähigen Seefahrer, der er nicht war; als religiösen Fanatiker – der war er aus weltlicher Sicht bestimmt – und als gierigen Monomanen – ein Vorwurf, der, wie die Verteidiger des Admirals vorbringen würden, gegen jeden ehrgeizigen Menschen erhoben werden könnte. Colón wurde von seinen Kritikern vorgeworfen, er habe nie begriffen, was er entdeckt hatte.[27]
Dieses riesige, kreuzförmige Kolumbus-Denkmal in Santo Domingo wurde 1992 nach einem Entwurf des jungen schottischen Architekten Joseph Lea Cleave vollendet, der in Stein auszudrücken versuchte, was er für Colóns wichtigste Rolle hielt: der Mann gewesen zu sein, der das Christentum nach Amerika gebracht hatte. Das Bauwerk, erklärte er in aller Bescheidenheit, sei «eines der größten Denkmäler aller Zeiten».
Wie anders war die Sichtweise 1852 gewesen, als der gefeierte Literat Antonio del Monte y Tejada den ersten seiner vier Bände über die Geschichte Santo Domingos abschloss, indem er Colóns «großes, hochherziges, denkwürdiges und ewiges» Wirken pries. Jede Tat des Admirals «atmet Größe und Erhabenheit», schrieb del Monte y Tejada. «Schulden ihm nicht alle Nationen … ewige Dankbarkeit?» Am besten lasse sich diese Schuld abtragen, indem man eine riesige Kolumbus-Statue errichte, «einen Koloss wie den von Rhodos», finanziert von «allen Städten Europas und Amerikas». Gütig müsse diese Statue ihre Arme über Santo Domingo ausbreiten, «den augenfälligsten und bemerkenswertesten Ort» der Hemisphäre.
Ein großes Denkmal für den Admiral! Für del Monte y Tejada schienen die Gründe für ein solches Vorhaben auf der Hand zu liegen; Colón war von Gott gesandt, seine Reise nach Amerika das Ergebnis einer «göttlichen Fügung» gewesen.[28] Trotzdem dauerte es bis zum Bau des Denkmals fast anderthalb Jahrhunderte. Zum Teil hatte die Verzögerung wirtschaftliche Gründe; die meisten Länder der Hemisphäre waren zu arm, um Geld für ein monströses Standbild auf einer fernen Insel zu erübrigen. Doch es drückte sich darin auch wachsendes Unbehagen gegenüber dem Admiral selbst aus. Die Kritiker fragten, ob es angesichts dessen, was man inzwischen über das Schicksal der indigenen Bevölkerung Hispaniolas wisse, überhaupt vertretbar sei, seinen Reisen ein Denkmal zu setzen. Betrachten wir seine Taten, stellt sich die Frage, was für ein Mensch es war, der da im goldenen Schrein des Denkmals ruht.
Die Antwort fällt nicht leicht, obwohl kaum ein anderer Lebenslauf dieser Zeit so gut dokumentiert ist wie der seine – die neueste Ausgabe seiner gesammelten Schriften umfasst 536 kleingedruckte Seiten.[29]
Zu seinen Lebzeiten kannte ihn niemand als Kolumbus. Der Admiral wurde in Genua als Cristoforo Colombo getauft, änderte seinen Namen aber in Cristóvão Colombo ab, als er sich in Portugal niederließ, wo er ein Genueser Handelshaus vertrat. 1485, als er nach Spanien ging, nachdem es ihm nicht gelungen war, den portugiesischen König zur Finanzierung einer Expedition über den Atlantik zu bewegen, nannte er sich Cristóbal Colón. Später beharrte er wie ein exzentrischer Maler darauf, seine Unterschrift in Form einer unverständlichen Glyphe zu leisten:
• S •
S • A • S
X M Y
: Xpo FERENS./
Niemand weiß genau, was er damit meinte, aber die dritte Zeile könnte «Christus, Maria und Josef» bedeuten – «Xristus Maria Yosephus» –, während die Buchstaben ganz oben für «Servus Sum Altissimi Salvatoris» stehen könnten: «Ich bin ein Diener des höchsten Erlösers», und «Xpo FERENS» wahrscheinlich als «Xristo-Ferens» zu lesen ist, «Christträger».[30]
«Ein wohlgestalteter Mann von überdurchschnittlicher Statur», so eine Beschreibung seines unehelichen Sohns Hernán. Der Admiral hatte vorzeitig ergrautes Haar, «helle Augen», eine Adlernase und blasse Wangen, die leicht erröteten. Er war ein unberechenbarer Mann, launisch und jähen Stimmungsschwankungen unterworfen. Obwohl Colón zu Wutanfällen neigte, wie Hernán berichtete, war er «ein so entschiedener Gegner von Flüchen und Gotteslästerung, dass ich mein Wort darauf geben kann, ihn nie eine andere Verwünschung habe ausstoßen hören als ‹bei San Fernando›» – beim heiligen Ferdinand.[31] Sein Leben wurde von übertriebenem persönlichem Ehrgeiz und, wohl noch wichtiger, tiefer Religiosität bestimmt.[32] Colóns Vater, ein Wollweber, scheint sich von einer Verschuldung zur nächsten geschleppt zu haben, wofür sich sein Sohn offenbar schämte; er verheimlichte seine Herkunft und war sein ganzes Erwachsenenleben hindurch bemüht, eine Dynastie zu begründen, die in den Adelsstand erhoben werden würde. Seine inbrünstige Gläubigkeit vertiefte sich noch in den langen Jahren, in denen er die portugiesischen und spanischen Monarchen vergeblich um Unterstützung seiner Reise westwärts anflehte. Einen Teil dieser Zeit verbrachte er in einem politisch einflussreichen Franziskanerkloster in Südspanien, wo man hingerissen war von den Visionen Joachims von Fiore, eines Mystikers aus dem 12. Jahrhundert, der glaubte, die Menschheit werde in ein Zeitalter spiritueller Glückseligkeit eintreten, sobald die Christenheit Jerusalem wieder in ihre Gewalt gebracht habe, das Jahrhunderte zuvor von den islamischen Heeren erobert worden war. Die Erträge seiner Reise, so glaubte Colón, würden sein eigenes Vermögen mehren und Joachims Traum von einem neuen Kreuzzug erfüllen. Der Handel mit China werde so viel Geld nach Spanien fließen lassen, «dass die Monarchen in drei Jahren in der Lage sein werden, die Eroberung des Heiligen Lands vorzubereiten».[33]
Voraussetzung für Colóns großen Plan war seine Auffassung von Größe und Form der Erde. Als Kind hatte ich – wie zahllose Schüler vor mir – gelernt, Kolumbus sei seiner Zeit voraus gewesen, als er in einer Epoche, in der alle anderen glaubten, unser Planet sei klein und flach, verkündete, die Erde sei groß und rund. In der vierten Klasse zeigte uns unsere Lehrerin einen Kupferstich, auf dem Kolumbus einen Globus vor einem Gremium mittelalterlicher Autoritäten schwenkt. Ein Sonnenstrahl lässt den Globus und das wallende Haar des Admirals erstrahlen; seine Kritiker dagegen hocken wie Schurken im Schatten. Leider hatte meine Lehrerin die ganze Geschichte falsch verstanden. Die Gelehrten wussten seit mehr als fünfzehn Jahrhunderten, dass die Erde groß und rund ist. Colón bezweifelte beides.
Allerdings wich der Admiral von der zweiten These nur geringfügig ab. Der Globus sei nicht vollkommen rund, meinte er, sondern habe «die Form einer Birne, die überall sehr rund ist, ausgenommen dort, wo der Stängel sitzt, dort ist sie höher, als hätte jemand einen sehr runden Ball, auf dem an einer Stelle die Brustwarze einer Frau angebracht wäre».[34] Gewissermaßen ganz oben auf der Brustwarze befinde sich «das irdische Paradies, in das niemand eingehen kann, wenn es nicht Gottes Wille ist». Während einer späteren Reise dachte er, dort, wo heute Venezuela liegt, die Brustwarze gefunden zu haben.
Der König und die Königin von Spanien kümmerten sich keinen Deut um die Vorstellungen des Admirals von der Form der Erde oder der Lage des Paradieses. Aber sie waren höchst interessiert an seinen Vermutungen über die Größe des Planeten. Colón schätzte den Erdumfang mindestens 8000 Kilometer kleiner, als er tatsächlich ist. Hätte er mit seiner Annahme richtig gelegen, wäre der Abstand zwischen Westeuropa und Ostchina – also aus heutiger Sicht die Ausdehnung des Atlantiks, des Pazifiks und der Landmasse zwischen ihnen – weit geringer.
Die Monarchen fanden seine Spekulationen verlockend. Wie die europäischen Eliten überall waren auch sie fasziniert von den Berichten über den Reichtum und die hochentwickelte Kultur Chinas. Sie verlangten nach Textilien, Porzellan, Gewürzen und Edelsteinen aus Asien. Doch die muslimischen Kaufleute und Herrscher bildeten ein kaum zu überwindendes Hindernis. Wenn die Europäer die asiatischen Luxusgüter haben wollten, mussten sie mit jenen verhandeln, gegen die die Christenheit seit Jahrhunderten Krieg führte. Schlimmer noch, die Handel treibenden Stadtstaaten Venedig und Genua hatten bereits Abkommen mit den Gegnern geschlossen und monopolisierten den Handel.[35] Die Vorstellung, mit Vertretern der muslimischen Welt zusammenzuarbeiten, war besonders den Spaniern und Portugiesen zuwider, waren sie doch im achten Jahrhundert von deren Heeren erobert worden und hatten jahrhundertelang einen zuletzt erfolgreichen Krieg zur Vertreibung der Eindringlinge geführt. Doch selbst wenn sie Vereinbarungen mit den Muslimen trafen, standen Venedig und Genua bereit, um ihre Privilegien notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. Um die unerwünschten Zwischenhändler auszuschalten, hatte Portugal versucht, Schiffe um den ganzen afrikanischen Kontinent zu schicken – eine lange, gefährliche und kostspielige Reise. Nun erklärte der Admiral den spanischen Herrschern, es gebe einen schnelleren, sichereren und kostengünstigeren Seeweg: nach Westen, über den Atlantik.
Damit widersprach Colón dem griechischen Universalgelehrten Eratosthenes, der im dritten Jahrhundert v.Chr. den Erdumfang mit einer Methode bestimmt hatte, von der der Wissenschaftshistoriker Robert Crease 2003 schrieb, sie sei «so einfach und einleuchtend, dass sie noch fast 2500 Jahre später jedes Jahr von Schulkindern auf der ganzen Welt wiederholt wird». Eratosthenes gelangte zu dem Schluss, dass die Erdkugel einen Umfang von etwa 40000 Kilometern habe.[36] Von Ost nach West ist Eurasien ungefähr 16000 Kilometer breit. Nach Adam Riese müsste dann der Abstand zwischen China und Spanien rund 24000 Kilometer betragen. Die europäischen Schiffbauer und potenziellen Entdeckungsreisenden wussten, dass kein Schiff des 15. Jahrhunderts eine Fahrt von 13000 Seemeilen aushalten würde, von der Rückreise gar nicht zu reden.
Colón glaubte, er habe Eratosthenes gewissermaßen widerlegt. Ein kundiger, auf seinen nautischen Instinkt bauender Seemann, hatte der Admiral den Ostatlantik von Afrika bis Island befahren. Auf diesen Reisen hatte er versucht, mit einem schiffsüblichen Quadranten den Abstand zwischen zwei Längengraden zu messen. Irgendwie überzeugte er sich davon, dass sein Ergebnis die einem Bagdader Kalifen des 9. Jahrhunderts zugeschriebene Behauptung widerlege, die Ausdehnung eines Längengrades betrage 91,2 Kilometer. Dabei liegt der Wert sogar eher bei 111 Kilometern. Multiplizierte Colón seine Zahl mit 360, um den Erdumfang zu errechnen, kam er auf gut 32000 Kilometer. Durch Kombination dieses Wertes mit einer übertriebenen Schätzung der Ost-West-Ausdehnung Eurasiens vertrat Colón die Ansicht, dass die Reise keine 2700 Seemeilen weit sei, die überdies noch um fast 540 Meilen verkürzt werden könnten, indem man von den kürzlich eroberten Kanaren aufbreche. Diese Entfernung lasse sich leicht von spanischen Schiffen überwinden.[37]
In der Hoffnung, Colón habe recht, unterbreiteten die Monarchen seinen Vorschlag einem Gremium von Gelehrten der Astronomie, der Nautik und der Naturkunde. Die Experten verdrehten kollektiv die Augen. Aus ihrer Sicht war Colón mit seiner Behauptung, dass er – ein kaum gebildeter Mann, der auf einem schaukelnden Schiff mit einem Quadranten hantiert hatte – Eratosthenes widerlegt habe, mit jemandem zu vergleichen, der erklärte, in einer primitiven Hütte bewiesen zu haben, dass die Schwerkraft auf Eisen nicht so stark einwirke, wie die Wissenschaft meine, und dass man daher einen Amboss mit einem dünnen Faden heben könne. Am Ende aber übergingen König und Königin das Expertenurteil und hießen Colón, das Kunststück mit dem Faden zu versuchen.
Nachdem der Admiral 1492 auf dem amerikanischen Kontinent gelandet war, behauptete er natürlich, seine Theorie habe sich bewahrheitet.[3] [38] Die begeisterten Monarchen belohnten ihn mit Ehren und Wohlstand. 1506 starb er als reicher Mann im Kreise der Seinen; und doch starb er verbittert. Als sich die Belege für sein persönliches Versagen und seine geographischen Irrtümer häuften, erkannte ihm der spanische Hof die meisten seiner Privilegien wieder ab und stellte ihn kalt. Der Groll und die Demütigungen seiner späteren Jahre trieben ihn in einen religiösen Messianismus. Schließlich glaubte er, ein «Gesandter» Gottes zu sein, dazu auserwählt, der Welt «den neuen Himmel und die neue Erde» zu zeigen, «von der unser Herr durch die Apokalypse des heiligen Johannes kündete».[39] In einem seiner letzten Berichte an den König behauptete der Admiral, er, Colón, sei der ideale Mann, um den Kaiser von China zum Christentum zu bekehren.[40]
Die gleiche Mischung aus Geltungssucht und Enttäuschung charakterisiert das Kolumbus-Denkmal. Del Monte y Tejadas Vorschlag für ein Ehrenmal des Admirals wurde 1923 endlich auf einer Konferenz der Staaten der westlichen Hemisphäre gebilligt. Und auch dann ging es nur langsam voran – die Ausschreibung für den Entwurf ließ weitere acht Jahre auf sich waren, und der Bau des Denkmals verzögerte sich sogar um sechs Jahrzehnte. Über einen wesentlichen Teil dieser Zeit wurde die Dominikanische Republick von Rafael Trujillo regiert. Der Diktator, offenbar ein klassischer Fall von narzisstischer Persönlichkeitsstörung, errichtete unzählige Standbilder von sich selbst und brachte über dem Hafen von Santo Domingo, das er in Trujillo City umbenannte, ein riesiges Neonschild an, auf dem «Gott und Trujillo» stand. Als sein Regime immer brutaler wurde, schwand der internationale Enthusiasmus für den Leuchtturm – es machte sich die Sorge breit, mit der Unterstützung des Projekts den Diktator zu stützen. Viele Staaten boykottierten auch noch die Einweihung am 12. Oktober 1992. Papst Johannes Paul II. widerrief seine Zusage, bei der Eröffnung eine Messe zu halten, obwohl er einen Tag zuvor in der Nähe war. Derweil setzten Demonstranten Barrikaden in Brand und prangerten den Admiral als «den Vernichter einer Rasse» an. Die Bewohner der abgeschotteten Slums rund um das Denkmal äußerten gegenüber den Journalisten, ihrer Meinung nach verdiene Colón überhaupt kein Gedenken.[41]
Als das Kolumbus-Denkmal 1923 beschlossen wurde, versprach jede amerikanische Nation, ihren Beitrag zu leisten, doch die Schecks trafen nur zögerlich ein – so brauchte der US-amerikanische Kongress weitere sechs Jahre, um eine Summe zu bewilligen. Im Mai 1930 wurde Trujillo, der Oberbefehlshaber der dominikanischen Armee, durch massive Wahlfälschung Präsident des Inselstaats. Drei Wochen später zerstörte ein Hurrikan Santo Domingo und tötete viele tausend Menschen. In der Meinung, das Denkmal werde die Wiederbelebung der Stadt symbolisieren, schrieb Trujillo 1931 einen Wettbewerb für den besten Entwurf aus. Die Jury war mit prominenten Architekten wie Eliel Saarinen und Frank Lloyd Wright besetzt. Mehr als 450 Beiträge wurden eingereicht – darunter die Entwürfe von Konstantin Melnikow, Robaldo Morozzo della Rocca und Gigi Vietti, Erik Bryggman und Iosif Langbard.
Eine These des vorliegenden Buchs lautet, dass die Überzeugung dieser Menschen, so verständlich sie auch sein mag, falsch ist. Der kolumbische Austausch hat so weitreichende Folgen, dass einige Biologen heute sagen, Colóns Reisen seien der Beginn eines neuen biologischen Zeitalters, des Homogenozäns, gewesen.[42]