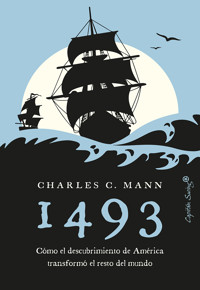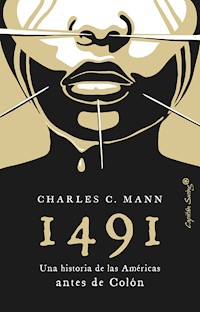17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Charles C. Mann schreibt die Geschichte des vorkolumbischen Amerikas. Er macht deutlich, dass die indianischen Kulturen oftmals weiter entwickelt waren als die europäische. Ihre Boote waren schneller und wendiger als die der Europäer, ihre Städte größer als das damalige Paris. Kolumbus' Ankunft in Amerika veränderte den Kontinent fundamental. Zwei Zivilisationen trafen aufeinander, deren Historie und Kultur unterschiedlicher nicht hätten sein können, und für die Ureinwohner war die Begegnung folgenschwer: Die Masern-, Pocken- und die Grippeviren, welche die Europäer einschleppten, rafften einen Großteil von ihnen dahin, Kriege entmachteten sie. Mann lässt das vorkolumbische Amerika aufleben. Er gewährt uns überraschende Einblicke in die Lebensweise der Ureinwohner und zeigt, wie noch heute ihre Mais-, Kürbis- und Kartoffelanbauflächen weite Teile des Kontinents prägen. «Amerika vor Kolumbus» ist ein wichtiges, mitreißend erzähltes Buch. «Die Indianer waren keine nomadischen, ökologisch vorbildlichen Menschen, die zu Pferde Büffel jagten. Sie erbauten und bevölkerten einige der größten und reichsten Städte der Welt. Keineswegs abhängig von der Großwildjagd, lebten die meisten Indianer auf Farmen. Amerika war unermesslich geschäftiger, mannigfaltiger und dichter bevölkert, als es sich die Forscher früher vorgestellt hatten. Und älter war es auch.» Das Buch wurde von der National Academy of Sciences als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 986
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Charles C. Mann
Amerika vor Kolumbus
Die Geschichte eines unentdeckten Kontinents
Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Charles C. Mann schreibt die Geschichte des vorkolumbischen Amerikas. Er macht deutlich, dass die indianischen Kulturen oftmals weiter entwickelt waren als die europäische. Ihre Boote waren schneller und wendiger als die der Europäer, ihre Städte größer als das damalige Paris. Kolumbus‘ Ankunft in Amerika veränderte den Kontinent fundamental. Zwei Zivilisationen trafen aufeinander, deren Historie und Kultur unterschiedlicher nicht hätten sein können, und für die Ureinwohner war die Begegnung folgenschwer: Die Masern-, Pocken- und die Grippeviren, welche die Europäer einschleppten, rafften einen Großteil von ihnen dahin, Kriege entmachteten sie. Mann lässt das vorkolumbische Amerika aufleben. Er gewährt uns überraschende Einblicke in die Lebensweise der Ureinwohner und zeigt, wie noch heute ihre Mais-, Kürbis- und Kartoffelanbauflächen weite Teile des Kontinents prägen.
«Amerika vor Kolumbus» ist ein wichtiges, mitreißend erzähltes Buch.
«Die Indianer waren keine nomadischen, ökologisch vorbildlichen Menschen, die zu Pferde Büffel jagten. Sie erbauten und bevölkerten einige der größten und reichsten Städte der Welt. Keineswegs abhängig von der Großwildjagd, lebten die meisten Indianer auf Farmen. Amerika war unermesslich geschäftiger, mannigfaltiger und dichter bevölkert, als es sich die Forscher früher vorgestellt hatten. Und älter war es auch.»
Das Buch wurde von der National Academy of Sciences als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet.
Über Charles C. Mann
Charles C. Mann, geboren 1955, ist ein preisgekrönter Wissenschaftsjournalist und arbeitet als Korrespondent für «The Atlantic», «Science» und «Wired»; daneben hat er u.a. für «GEO», «stern», die «New York Times», «Vanity Fair» und die «Washington Post» geschrieben sowie für den TV-Sender HBO und die Serie Law & Order. Sein Buch «1491 – New Revelations of the Americas Before Columbus» verkaufte sich in den USA eine halbe Million Mal und wurde von der National Academy of Sciences als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet.
Kartenverzeichnis
Seite 2: Das indianische Amerika, 1491 n. Chr.
Seite 47: Das indianische Amerika, um 1000 n. Chr.
Seite 69: Massachusett-Bündnis, 1600 n. Chr.
Seite 83: Völker im Land der Morgendämmerung, 1600 n. Chr.
Seite 113: Tawantinsuyu: Land der vier Teile, 1527 n. Chr.
Seite 127: Tawantinsuyu: Ausdehnung des Inkareiches, 1438–1527 n. Chr.
Seite 201: Der Dreibund, 1591 n. Chr.
Seite 249: Paläoindianische Einwanderung: Nordamerika, 10000 v. Chr.
Seite 289: Norte Chico: Der erste urbane Komplex in Amerika, 3000–1800 v. Chr.
Seite 333: Mesoamerika, 1000 v. Chr. – 1000 n. Chr.
Seite 357: Wari und Tiwanaku, 700 n. Chr.
Seite 399: Mound-Erbauer, 3400 v. Chr. – 1400 n. Chr.
Seite 407: Der American Bottom, 1300 n. Chr.
Seite 424: Der mesoamerikanische Hundertjährige Krieg: Kaan und Mutal im Kampf um das Maya-Kernland, 562–682 n. Chr.
Seite 442: Das Amazonasbecken
Für die Frau im Arbeitszimmer nebenan – ohne Cloud wie alles andere
Vorwort
Die Ursprünge dieses Buches lassen sich, jedenfalls teilweise, bis 1983 zurückverfolgen, als ich für die Zeitschrift Science einen Artikel über ein NASA-Programm schrieb, mit dem atmosphärische Ozonwerte überwacht wurden. Während ich mich über das Programm kundig machte, begleitete ich ein Forscherteam in einem NASA-Flugzeug, das dazu ausgerüstet war, der Atmosphäre in zehntausend Meter Höhe Proben zu entnehmen und diese zu analysieren. Einmal landete die Gruppe in Mérida auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Aus irgendeinem Grund hatten die Wissenschaftler einen freien Tag, und wir fuhren alle zusammen mit einem heruntergekommenen VW-Bus zu den Maya-Ruinen von Chichén Itzá. Ich wusste nichts über die mesoamerikanische Kultur; vielleicht war ich nicht einmal mit dem Begriff «Mesoamerika» vertraut, der das Gebiet von Zentralmexiko bis nach Panama umfasst, darunter ganz Guatemala und Belize sowie Teile von El Salvador, Honduras, Costa Rica und Nicaragua, die Heimat der Maya, der Olmeken und einer Menge anderer Völker. Sekunden nachdem wir uns aus dem Bus gezwängt hatten, war ich gefesselt.
Später kehrte ich fünf- oder sechsmal nach Yucatán zurück – um Urlaub zu machen oder aus beruflichen Gründen –, dreimal davon mit meinem Freund Peter Menzel, einem Fotojournalisten. Für eine deutsche Zeitschrift machten wir eine zwölfstündige Fahrt auf einer schrecklichen unbefestigten Straße mit mehr als knietiefen Schlaglöchern und Blockaden aus umgestürzten Stämmen zu der damals noch nicht ausgegrabenen Maya-Hauptstadt Calakmul. Mit uns fuhr Juan de la Cruz Briceño, selbst Maya und Verwalter einer anderen, kleineren Ruine. Juan hatte zwanzig Jahre als chiclero verbracht, was bedeutete, dass er immer wieder wochenlang auf der Suche nach Chicle-Bäumen durch den Wald gezogen war. Den klebrigen Saft der Bäume trocknen und kauen Indianer seit Jahrtausenden, und er wurde im späten 19. Jahrhundert zum Grundstoff der Kaugummiindustrie. Abends am Feuer erzählte Juan uns von den alten, weinüberwucherten Städten, auf die er bei seinen Wanderungen gestoßen war, und von seinem Erstaunen, als Wissenschaftler ihm mitteilten, dass seine eigenen Vorfahren diese Städte gebaut hätten. In jener Nacht schliefen wir in Hängematten zwischen hohen grabsteinartigen Skulpturen, deren Inschriften mehr als tausend Jahre niemand gelesen hatte.
Mein Interesse an den Völkern, die vor Kolumbus in Amerika gelebt hatten, entwickelte sich erst im Herbst 1992. In einer College-Bibliothek entdeckte ich eines Sonntagnachmittags zufällig die Sonderausgabe der Annals of the Association of American Geographers, die dem 500. Jahrestag von Kolumbus’ Ankunft gewidmet war. Ich griff neugierig nach dem Heft, machte es mir in einem Sessel bequem und las einen Beitrag von William Denevan, einem Geografen an der University of Wisconsin. Der Artikel begann mit der Frage: «Wie sah die Neue Welt zur Zeit von Kolumbus aus?» Ja, dachte ich, wie sah sie aus? Wer lebte hier, und was mochte den Einheimischen durch den Kopf gegangen sein, als sie die ersten europäischen Segel am Horizont erspähten? Ich beendete Denevans Artikel, wandte mich anderen Beiträgen zu und hörte erst auf zu lesen, als der Bibliothekar die Beleuchtung aus- und anschaltete, weil er schließen wollte.
Damals wusste ich noch nicht, dass Denevan und eine Vielzahl seiner Kollegen ihr Berufsleben lang versucht hatten, diese Fragen zu beantworten. Das Bild, das sie herausgearbeitet haben, unterscheidet sich stark von der Denkweise der meisten Amerikaner und Europäer und ist außerhalb von Spezialistenkreisen kaum bekannt.
Ein Jahr nachdem ich Denevans Artikel gelesen hatte, besuchte ich eine Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science. Das Thema der Sitzung lautete «Neue Perspektiven zum Amazonas» oder so ähnlich, und zu den Teilnehmern gehörte William Balée von der Tulane University. In seinem Vortrag war von «anthropogenen» Wäldern die Rede, also von Wäldern, die Indianer vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden geschaffen hätten – ein Konzept, das mir völlig neu war. Außerdem erwähnte er einen Aspekt, den auch Denevan angesprochen hatte: Viele Forscher sind inzwischen der Meinung, dass ihre Vorgänger die Zahl der Menschen in Amerika bei Kolumbus’ Eintreffen unterschätzt haben. Die Indianer waren laut Balée weitaus zahlreicher gewesen, als man früher angenommen hatte. Herrje, dachte ich, jemand müsste all das zusammenfassen. Daraus ließe sich ein spannendes Buch machen.
Ich wartete darauf, dass das Buch erschien, und meine Frustration wuchs, als mein Sohn in die Schule kam und das Gleiche lernte wie ich: Theorien, die, wie ich wusste, seit langem heftig angezweifelt wurden. Da niemand anders bereit zu sein schien, das Buch zu schreiben, nahm ich mir schließlich vor, es selbst zu versuchen. Zudem wollte ich unbedingt mehr erfahren. Dieser Text ist das Ergebnis.
Mancherlei ist mein Buch allerdings nicht. Es ist kein systematischer, chronologischer Überblick über die kulturelle und soziale Entwicklung der westlichen Hemisphäre vor 1492. Solch ein Werk von ungeheurer zeitlicher und räumlicher Dimension kann nicht geschrieben werden, denn sobald sich die Autorin oder der Autor dem Ende näherte, hätte man bereits neue Erkenntnisse gewonnen, sodass der Anfang überholt wäre. Unter denen, die mich von dieser Sachlage überzeugten, waren genau die Wissenschaftler, die den größten Teil der letzten Jahrzehnte damit verbracht haben, die große Vielfalt präkolumbischer Gesellschaften zu untersuchen.
Auch ist dieses Buch keine vollständige Geistesgeschichte des nicht lange zurückliegenden Perspektivenwandels unter den Anthropologen, Archäologen, Ökologen, Geografen und Historikern, die sich mit den ersten Amerikanern beschäftigen. Ein derartiges Projekt wäre ebenfalls nicht zu bewältigen, denn die neuen Ideen verästeln sich immer noch weiter und können nicht von einem einzelnen Werk erfasst werden.
Vielmehr werden in dem vorliegenden Buch Themen erkundet, die, wie ich glaube, die drei Schwerpunkte der neuen Befunde ausmachen: die indianische Demografie (Teil I), die indianischen Ursprünge (Teil II) sowie die indianische Ökologie (Teil III). Da so viele unterschiedliche Gesellschaften diese Themen auf jeweils andere Art verhandeln, konnte meine Arbeit nicht allumfassend sein. Stattdessen habe ich meine Beispiele aus Kulturen gewählt, die am besten dokumentiert sind oder am meisten Aufmerksamkeit erregt haben oder mir schlicht besonders attraktiv erschienen.
Paradoxerweise wird in meinem Buch über das Leben vor Kolumbus nicht wenig Zeit darauf verwendet, das Leben nach Kolumbus zu behandeln. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens verfügten etliche amerikanische Kulturen über keine Schrift, weshalb die besten Informationen über sie zumeist aus den Aufzeichnungen der ersten Europäer stammen, die ihnen begegneten. Gewiss, Kolonialchroniken sind durch kulturelle Kurzsichtigkeit verzerrt, aber es handelt sich gleichwohl um Augenzeugenberichte über fremde Lebensweisen. Zweitens – genauso wichtig – enthüllte die Begegnung zwischen Europa und Amerika manches über beide Seiten. In vielen Fällen wurden durch den Stress des Kontakts Aspekte dieser Gesellschaften hervorgehoben, die man sonst nicht deutlich erkannt hätte. Der Zusammenprall der Wampanoag mit den Pilgern (das Thema von Kapitel 2) und der Inka mit der von Francisco Pizarro geführten spanischen Streitmacht (ein erheblicher Teil von Kapitel 3) zeigen einerseits, wie die Amerikaner von den Europäern wahrgenommen wurden, und andererseits, wie sie angesichts des Unbekannten reagierten.
In diesem Text benutze ich, wie Leser und Leserin bereits bemerkt haben dürften, zumeist den Begriff «Indianer» für die Ureinwohner Amerikas. Unzweifelhaft haben wir es mit einer verwirrenden und historisch unangemessenen Benennung zu tun. Die wohl am ehesten zutreffende Bezeichnung der ersten Bewohner Amerikas ist «Amerikaner». Ihr Gebrauch wäre jedoch noch verwirrender. Deshalb versuche ich, Menschen bei den Namen zu nennen, die sie sich selbst gegeben haben. Die überwältigende Mehrheit der indigenen Völker, denen ich sowohl in Nord- als auch in Südamerika begegnet bin, bezeichnet sich als Indianer (zur Nomenklatur siehe auch Anhang A, «Befrachtete Wörter»).
Mitte der achtziger Jahre reiste ich zu dem Dorf Hazelton am Oberlauf des Skeena in British Columbia. Viele seiner Bewohner gehören der Gitksan- (oder Gitxsan-)Nation an. Zur Zeit meines Besuches hatten die Gitksan gerade einen Prozess gegen die Regierungen von British Columbia und Kanada angestrengt. Die Provinz und der Staat sollten anerkennen, dass die Gitksan seit langem dort lebten, nie fortgezogen waren, ihr Land nie freiwillig aufgegeben hatten und damit weiterhin den Rechtstitel für rund 28500 Quadratkilometer der Region besaßen. Sie seien sehr gern bereit zu verhandeln, doch keineswegs bereit, auf Verhandlungen zu verzichten.
Beim Anflug konnte ich nachvollziehen, warum die Gitksan so eng mit dem Land verbunden sind. Die Maschine glitt vorbei an den prächtigen schneebedeckten Steilhängen der Rocher de Boule Mountains und näherte sich den beiden ineinander übergehenden bewaldeten Flusstälern. Dunst stieg vom Boden auf. Menschen fischten in den Flüssen nach Silberforellen und Lachsen, obwohl sie 265 Kilometer von der Küste entfernt waren.
Die Gitanmaax, eine Gruppe der Gitksan, haben ihr Hauptquartier in Hazelton, doch die meisten ihrer Angehörigen leben in einem Reservat knapp außerhalb der Ortschaft. Ich fuhr dorthin, und Neil Sterritt, der Vorsitzende des Gitanmaax-Rates, erklärte mir das Gerichtsverfahren. Der offene Mann mit der angenehmen Stimme hatte zunächst als Bergbauingenieur gearbeitet, war dann heimgekehrt und hatte die Ärmel aufgekrempelt, um sich für einen langwierigen juristischen Streit zu rüsten. Nach zahlreichen Prozessen und Berufungsverhandlungen entschied der Oberste Gerichtshof von Kanada 1997, dass British Columbia mit den Gitksan über den Status des Landes verhandeln müsse. 2005, zwei Jahrzehnte nach dem Beginn des Verfahrens, waren die Unterredungen immer noch im Gange.
Ein wenig später begleitete Sterritt mich nach ’Ksan, einem Museumspark mit einer Kunstschule, die man 1970 gegründet hatte. In dem Park standen mehrere nachgebaute Langhäuser, deren Fassaden mit den kraftvoll eleganten schwarzen und roten Bögen der Indianerkunst der Nordwestküste bedeckt waren. An der Kunstschule wurden ortsansässige Indianer dazu ausgebildet, traditionelle Designs in Siebdrucke umzuwandeln. Sterritt ließ mich im Hinterzimmer des Schulhauses zurück, wo ich mich umschauen sollte. Das Zimmer enthielt mehr, als er vielleicht gedacht hatte, denn ich fand rasch mehrere Aufbewahrungskästen mit einer Reihe bejahrter, schöner Masken. Daneben lag ein Stapel moderner Drucke, einige davon mit gleichartigen Entwürfen, und dann standen da Boxen mit alten und neuen Fotos, von denen viele herrliche Kunstwerke zeigten.
In der Kunst der Nordwestküste sind die Motive abgeflacht und verzerrt, als wären sie von drei auf zwei Dimensionen reduziert und dann wie Origami gefaltet worden. Auf den ersten Blick fiel es mir schwer, die Arbeiten zu interpretieren, aber bald schienen manche aus der Oberfläche hervorzuspringen. Sie hatten klare Linien, durch die der Raum in zugleich einfache und komplexe Formen geteilt wurde: in Objekte innerhalb von Objekten, in ihre eigenen Augen gestopfte Geschöpfe, in Menschen, die halb Tiere, und in Tiere, die halb Menschen waren – alles war Metamorphose und surreale Unruhe.
Einige der Objekte, die ich mir anschaute, verstand ich sofort, viele überhaupt nicht, und manche glaubte ich zu verstehen, was aber wohl nicht der Fall war – und andere verstehen vielleicht nicht einmal die Gitksan, ähnlich wie die meisten Europäer heutzutage den Effekt der byzantinischen Kunst auf den Geist der Menschen, die sie zur Zeit ihrer Erschaffung sahen, nicht wirklich begreifen können. Aber ich war entzückt über die kühnen klaren Linien und benommen von dem Gefühl, einen flüchtigen Blick auf eine lebensprühende Vergangenheit zu werfen, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte und die sich weiterhin auf die Gegenwart auswirkte, wie ich es nicht erwartet hätte. Ein oder zwei Stunden lang ging ich von einem Objekt zum anderen, und es drängte mich, immer mehr zu sehen. Durch dieses Buch hoffe ich die Aufregung, die ich damals verspürte und seitdem immer wieder empfunden habe, mit anderen zu teilen.
Anmerkung zu dieser Auflage
Hin und wieder bin ich von Lesern gefragt worden, ob ich etwas Grundsätzliches an 1491 ändern würde, wenn ich das Buch noch einmal schreiben könnte. Früher habe ich stets geantwortet, dass ich es nicht wisse. Die Frage schien zu theoretisch zu sein, denn niemand bot mir die Gelegenheit, Näheres herauszufinden. Diese Möglichkeit habe ich nun jedoch durch die Vorbereitung der aktualisierten und revidierten Auflage von 1491 erhalten. Nach der Erstveröffentlichung des Buches haben Forscher tatsächlich faszinierende Entdeckungen über die ersten fünfzehntausend Jahre der amerikanischen Geschichte gemacht. Gleichwohl passen die Ergebnisse sehr gut zu den neuen Ideen, auf die ich in meinem Text eingehe. Dessen entscheidende Thesen – dass Indianergesellschaften größer gewesen waren, als man früher vermutete (Teil I), dass sie älter und fortgeschrittener gewesen waren, als man lange annahm (Teil II), und dass sie einen größeren Einfluss auf die Umwelt ausgeübt hatten, als man ehemals dachte (Teil III) – entsprechen, wie ich meine, den Ansichten einer großen Mehrheit der Experten. Deshalb habe ich das Hauptgebäude von 1491 nicht umgebaut, jedoch viele seiner Zimmer renoviert. Das Buch hat seine unverkennbaren Eigenschaften behalten, aber es ist – wie ich hoffe – zur Unterhaltung neuer Leser zurechtgestutzt, poliert und aufgefrischt worden.
EinleitungHolmbergs Irrtum
1Ein Blick von oben
Im Departamento Beni
Das Flugzeug hob bei einer für Zentralbolivien überraschend kühlen Witterung ab und wandte sich nach Osten zur brasilianischen Grenze. Nach ein paar Minuten verschwanden die Straßen und Häuser, und die einzigen Spuren menschlicher Besiedlung waren die Rinder, die sich wie Streusel auf Eiscreme über die Savanne verteilten. Dann verschwanden auch sie. Mittlerweile hatten die Archäologen ihre Kameras hervorgeholt und knipsten munter drauflos.
Unter uns lag Beni, ein bolivianischer Verwaltungskreis, der ungefähr so groß ist wie Illinois und Indiana zusammen und fast genauso flach. Knapp die Hälfte des Jahres hindurch überziehen Regen und Schneeschmelze aus den Bergen im Süden und im Westen das Land mit einer unregelmäßigen, langsam vorwärtsdringenden Wasserschicht, die sich schließlich in die nördlichen Flüsse des Departamento – die oberen Nebenflüsse des Amazonas – ergießt. In den übrigen Monaten versiegt das Wasser, und die hellgrüne Weite verwandelt sich in eine Art Wüste. Diese seltsame, entlegene, oftmals feuchte Ebene hatte die Aufmerksamkeit der Forscher geweckt – und nicht nur, weil es eine der wenigen Gegenden der Erde war, in denen Menschen lebten, die vielleicht nie Westler mit Kameras gesehen hatten.[1]
Clark Erickson und William Balée, die Archäologen, saßen vorn. Erickson, der an der University of Pennsylvania tätig war, arbeitete mit einem bolivianischen Archäologen zusammen, der an jenem Tag anderswo weilte und dadurch einen Platz im Flugzeug für mich freigemacht hatte. Balée, von der Tulane University, ist eigentlich Anthropologe, doch da Wissenschaftler heute besser einschätzen können, wie Vergangenheit und Gegenwart aufeinander einwirken, hat sich der Unterschied zwischen Anthropologen und Archäologen verwischt. Die beiden Männer unterschieden sich in Körperbau, Temperament und wissenschaftlicher Neigung deutlich voneinander, doch pressten sie ihre Gesichter mit der gleichen Begeisterung an die Fenster.
Über die Landschaft unter uns waren zahllose Waldinseln verstreut, viele von ihnen nahezu perfekte Kreise – Anhäufungen von Grün in einem Meer aus Goldbartgras. Jede Insel ragte fast zwanzig Meter aus dem Überschwemmungsgebiet heraus, weshalb dort Bäume wachsen konnten, die dem Wasser sonst nicht widerstanden hätten. Die Wälder wurden von erhöhten schnurgeraden Bermen begrenzt, die teils fünf Kilometer lang waren. Nach Ericksons Meinung war die gesamte Landschaft – fast 78000 Quadratkilometer voller Waldinseln und Mounds, verbunden durch Dammwege – vor über tausend Jahren von einer technisch fortgeschrittenen vielköpfigen Bevölkerung angelegt worden. Balée, der mit Beni weniger vertraut war, tendierte ebenfalls zu dieser Ansicht, wollte sich aber noch nicht festlegen.
Erickson und Balée gehören zu einer Wissenschaftlergemeinde, die konventionelle Vorstellungen darüber, wie die westliche Hemisphäre vor Kolumbus ausgesehen habe, in letzter Zeit heftig anzweifelt. Als ich in den siebziger Jahren die Highschool besuchte, lehrte man uns, die Indianer seien vor etwa dreizehntausend Jahren über die Beringstraße nach Amerika gekommen; sie hätten vorwiegend in kleinen, isolierten Gruppen gelebt und so wenig Einfluss auf ihre Umwelt gehabt, dass die Kontinente sogar nach Jahrtausenden der Besiedlung hauptsächlich aus Wildnis bestanden hätten. Die gleichen Ideen werden in Schulen noch heute vermittelt. Der Standpunkt von Wissenschaftlern wie Erickson und Balée hingegen ließe sich dadurch charakterisieren, dass sie fast jeden Aspekt dieser Darstellung des Indianerlebens für falsch halten. Sie glauben nämlich, die Indianer hätten viel länger als bislang angenommen – und in weit größerer Zahl – hier gelebt. Auch hätten sie die Landschaft so erfolgreich nach ihren Vorstellungen geformt, dass Kolumbus 1492 den Fuß auf eine stark von der Menschheit geprägte Hemisphäre gesetzt habe.
Angesichts der gespannten Beziehungen zwischen weißen Gesellschaften und Urvölkern sind Untersuchungen indianischer Kultur und Geschichte zwangsläufig umstritten, doch die jüngere Forschung ist besonders kontrovers. So tun einige Wissenschaftler – zumeist solche der älteren Generation – die neuen Theorien als Hirngespinste ab, die von einer geradezu mutwilligen Fehlinterpretation der Daten und einer verdrehten politischen Korrektheit herrührten.[2] «Ich habe kein Anzeichen dafür entdeckt, dass je große Menschenmengen in Beni gelebt hätten», versicherte mir Betty J. Meggers von der Smithsonian Institution. «Gegenteilige Behauptungen sind reines Wunschdenken.»[3] Damit nicht genug, zwei von der Smithsonian geförderte Archäologen aus Argentinien haben ausgeführt, dass viele der größeren Mounds natürliche Ablagerungen der Flussauen seien; eine «kleine Anfangsbevölkerung» habe die übrigen Dammwege und erhöhten Felder in der Kürze eines Jahrzehnts bauen können.[4] Ähnliche Kritik gelte für viele der neuen wissenschaftlichen Theorien über die Indianer, meint Dean R. Snow von der Pennsylvania State University. Das Problem sei, dass «man das karge Material aus den ethnohistorischen Unterlagen so auslegen kann, wie man will», sagt er. «Es ist sehr leicht, sich etwas vorzumachen.»[5] Und manche erheben den Vorwurf, dass die Theorien den politischen Plänen derjenigen dienten, welche die europäische Kultur diskreditieren wollten, da die hohen Zahlen das Ausmaß der Verluste für die Ureinwohner aufblähen würden.
Dispute kommen auch deshalb auf, weil sich die neuen Theorien auf die ökologischen Schlachten der Gegenwart auswirken. Große Teile der Umweltschutzbewegung sind bewusst oder unbewusst durch das inspiriert, was der Geograf William Denevan den «Ursprünglichkeitsmythos»[6] nennt – durch den Glauben also, dass Amerika 1491 ein nahezu unberührtes, wenn nicht gar paradiesisches, «vom Menschen unbeeinträchtigtes» Gebiet gewesen sei, wie es im Wilderness Act von 1964 heißt, einem US-Gesetz, das zu den Gründungsdokumenten der globalen Umweltschutzbewegung zählt.[7] Grüne Aktivisten, schreibt der Historiker William Cronon von der University of Wisconsin, nähmen die Gesellschaft moralisch in die Pflicht, die Natur in diesen vermeintlichen Urzustand einer fernen Vergangenheit zurückzuversetzen.[8] Aber wenn die aktuellen Ansichten zutreffen und die Menschheit überall tiefgreifende Arbeit geleistet hat, was wird dann aus den Bemühungen, die Natur wiederherzustellen?
Beni ist ein typisches Beispiel. Laut Ericksons Ausführungen haben die Indianer, die dort vor Kolumbus lebten, nicht nur Straßen, Dammwege, Kanäle, Deiche, Stauseen, Mounds, erhöhte Agrarbereiche und vielleicht sogar Ballplätze gebaut, sondern auch im saisonal überfluteten Grasland Fische gefangen. Dabei seien nicht nur ein paar vereinzelte Ureinwohner mit Netzen ausgezogen, sondern es habe sich um ein breit aufgestelltes Unternehmen gehandelt, bei dem Hunderte oder Tausende von Menschen dichte zickzackförmige Systeme von irdenen Fischwehren oder Leitzäunen zwischen den Dammwegen angelegt hätten.[9] Die Savanne ist großenteils auf natürlichem Weg durch saisonale Überflutung entstanden, doch die Indianer pflegten und erweiterten das Grasland, indem sie regelmäßig gewaltige Flächen in Brand setzten. Über die Jahrhunderte hinweg wurde durch diese Brände ein kompliziertes Ökosystem mit pyrophilen – feuerangepassten – Pflanzenarten geschaffen. Die heutigen Bewohner von Beni legen immer noch Feuer, nun allerdings hauptsächlich, um in der Savanne Rinder grasen zu lassen. Als wir die Region überflogen, hatte die Trockenzeit gerade begonnen, doch kilometerlange Flammenlinien bewegten sich bereits voran. Rauch stieg in großen bebenden Säulen zum Himmel auf. Auf den verkohlten Flächen hinter den Feuern sahen wir die schwarzen Zacken der Bäume, darunter viele Arten, für deren Rettung Aktivisten in anderen Teilen von Amazonien kämpfen.
Nördlich von Beni liegt das Departamento Pando, das spärlich bevölkert und weitgehend bewaldet ist. Und nördlich von Pando befindet sich der ebenfalls dünn besiedelte brasilianische Bundesstaat Acre, in dem man jedoch den Wald überwiegend entfernt hat, um Rinderfarmen betreiben zu können. Nur die Paranussbäume sind noch übrig, da es verboten ist, sie zu fällen; trotzdem dürften sie aussterben, denn sie müssen durch eine Waldbienenart bestäubt werden, die auf dem neu geschaffenen Weideland nicht überleben kann. Damit die anderen Baumarten nicht nachwachsen können, sprühen Flugzeuge der Bewirtschafter Wolken afrikanischer Grassamen über das erschlossene Land; das zähe, dickhalmige Gras wird zu einem dichten, federnden Teppich, den Sämlinge nicht durchdringen können.
Ende der neunziger Jahre, als ich Beni zum ersten Mal besuchte, wusste kaum jemand, dass durch die allgemeine Rodung große Erdarbeiten freigelegt worden waren. Diese geometrischen Figuren bezeichnete Alceu Ranzi, ein Forscher an der Bundesuniversität von Acre, als «Geoglyphen». Bis heute sind über zweihundert von ihnen identifiziert worden; viele haben einen Durchmesser von hundertfünfzig Metern. Die Geoglyphen wurden geschaffen, indem man präzise Kreise, Quadrate und Rechtecke in den Amazonaslehm grub, und sie wirken aus der Luft nicht weniger beeindruckend als die erhöhten Felder und Dammwege, die Erickson und Balée mir in Beni zeigten. Allerdings wissen wir über die Geoglyphen von Acre noch weniger; der erste ihnen in einer Fachzeitschrift gewidmete Artikel erschien 2007, Ranzi war einer der Koautoren.[10] Fünf Jahre später hatten die Archäologen immer noch keine Antwort auf eine so grundlegende Frage wie die, wo die Geoglyphen-Bauer gelebt hatten, denn nichts an den Strukturen deutet auf menschliche Behausungen hin. Erickson, der ähnliche Erdarbeiten in Beni entdeckte, ist der Auffassung, dass vor Kolumbus eine rund 1500 Kilometer lange Schneise Westamazoniens von einer bislang unbekannten Mischung aus Kulturen besiedelt war, welche die Landschaft radikal umgestaltet hätten.
Die Zukunft von Beni ist ungewiss.[11] Die Region wird zunehmend interessant für Viehzüchter und den Sojabohnenanbau, ihre offenen Flächen und der relativ gute Boden sind begehrt. Holzfäller haben ein Auge auf Pando geworfen. Über eine neue Schnellstraße vom Pazifik aus gelangen immer mehr Unternehmen nach Acre. Unterdessen setzen sich Umweltschützer dafür ein, diese dünn bevölkerte Gegend so naturnah wie möglich zu belassen. Örtliche Indianergruppen stehen diesem Vorschlag misstrauisch gegenüber. Wenn Beni ein Schutzgebiet für das «Natürliche» werden solle, fragen sie, welche internationale Organisation werde ihnen dann auch in Zukunft gestatten, die Ebenen in Brand zu stecken? Würde irgendeine auswärtige Vereinigung Flächenbrände in Amazonien billigen? Stattdessen möchten die Indianer selbst die Kontrolle über das Land übernehmen. Naturschützer hingegen halten wenig von diesem Gedanken, denn manche Ureinwohnergruppen im Südwesten der USA haben sich dafür ausgesprochen, ihre Reservate zu Atommülllagern zu machen. Und dann sind da noch all die Feuer.
Holmbergs Irrtum
«Fassen Sie den Baum nicht an!», rief Balée.
Ich erstarrte. Beim Erklimmen eines niedrigen, bröckeligen Hügels hatte ich die Hand nach einem dürren, fast rebenartigen Baum mit gespreizten Blättern ausgestreckt, um mich daran festzuhalten. «Triplaris americana», sagte Balée, ein Experte für Forstbotanik. «Darauf müssen Sie aufpassen.» Im Rahmen einer ungewöhnlichen Symbiose, fuhr Balée fort, nehme der Baum Kolonien winziger roter Ameisen auf – ja, es falle ihm schwer, ohne sie zu überleben. Die Ameisen befänden sich in kleinen Tunneln knapp unterhalb der Borke, und als Gegenleistung für den Schutz griffen sie alles an, was den Baum berühre: Insekten, Vögel, unvorsichtige Schriftsteller. Die Wildheit ihrer Giftattacken habe Triplaris americana zu seinem örtlichen Spitznamen verholfen: Teufelsbaum.[12]
Durch eine verlassene Tierhöhle waren die Wurzeln des Teufelsbaums freigelegt. Balée kratzte etwas Erde mit einem Messer heraus und winkte mich, Erickson und meinen Sohn Newell heran, der uns begleitete. Die Vertiefung war voll von zerbrochenen Tonwaren. Wir erblickten Tellerränder und etwas, das wie der Fuß eines Teekessels aussah; es war geformt wie ein menschlicher Fuß und hatte sogar bemalte Nägel. Balée zog ein halbes Dutzend Keramikstücke hervor: Scherben von Töpfen und Tellern und eine angeschlagene zylindrische Stange, die vielleicht zu einer Topfstütze gehört hatte. Ein Achtel des Hügelvolumens bestehe aus solchen Fragmenten, sagte Balée. Man könne fast überall graben und Ähnliches finden. Wir kletterten also einen riesigen Haufen aus kaputtem Geschirr hinauf.
Der Haufen ist bekannt als Ibibate, mit achtzehn Metern einer der höchsten bewaldeten Mounds in Beni.[13] Erickson erklärte mir, dass die Keramikstücke wahrscheinlich den Zweck gehabt hätten, den schlammigen Boden zur Besiedlung und für die Landwirtschaft zu vergrößern und aufzulockern. Doch obwohl dies in technischer Hinsicht plausibel sei, würden die längst vergangenen Handlungen der Mound-Erbauer dadurch nicht weniger mysteriös. Die Hügel bedeckten eine so enorme Fläche, dass sie kaum aus Abfall entstanden sein dürften. Der Monte Testaccio, der Scherbenhügel südöstlich von Rom, habe als Müllkippe für die gesamte Kaiserstadt gedient. Der Ibibate sei größer als der Monte Testaccio und nur einer von Hunderten ähnlicher Hügel. Gewiss habe Beni nicht mehr Abfall erzeugt als Rom, sondern die Keramikstücke des Ibibate würden, wie Erickson meint, darauf hindeuten, dass ungezählte Menschen, darunter viele geschickte Handwerker, lange auf diesen Mounds gewohnt und währenddessen üppig geschmaust und getrunken hätten. Die Zahl der Töpfer, die benötigt wurden, um solche Geschirrmengen anzufertigen, die für die Arbeit erforderliche Zeit, die Anzahl der Menschen, die notwendig waren, um die vielen Töpfer mit Nahrung und Unterkunft zu versorgen, die Organisation der Zerstörungen und des Vergrabens im großen Rahmen – all das liefert Erickson Anhaltspunkte dafür, dass Beni vor tausend Jahren die Stätte einer hoch strukturierten Gesellschaft war, die durch archäologische Nachforschungen gerade erst ins Blickfeld rückt.
An jenem Tag begleiteten uns zwei Sirionó: Chiro Cuellar und sein Schwiegersohn Rafael. Die beiden Männer waren drahtig, dunkelhäutig und nahezu bartlos; als ich auf dem Pfad neben ihnen ging, bemerkte ich kleine Kerben an ihren Ohrläppchen. Rafael, fröhlich fast bis zur Wichtigtuerei, gab den Nachmittag hindurch pausenlos Kommentare ab; Chiro, eine lokale Autorität, rauchte vor Ort hergestellte «Marlboro»-Zigaretten und beobachtete unser Fortschreiten mit einer Miene belustigter Nachsicht. Die beiden wohnten in einem etwa anderthalb Kilometer entfernten Dörfchen am Ende einer langen, durchfurchten, unbefestigten Straße. Wir waren am Morgen dorthin gefahren und hatten im Schatten einer baufälligen Schule und mehrerer alter Missionsgebäude geparkt. Sie standen dicht nebeneinander nahe der Kuppe eines kleinen Hügels – eines weiteren alten Mounds. Während Newell und ich am Lastwagen gewartet hatten, waren Erickson und Balée in die Schule gegangen, um von Chiro und den anderen Mitgliedern des Dorfrats die Erlaubnis zum Umherstreifen zu erhalten. Zwei Sirionó-Kinder hatten bemerkt, dass wir herumstanden, und auf Newell und mich eingeredet, damit wir uns einen jungen Jaguar in einem Stall anschauten – und sie für dieses Vergnügen bezahlten. Nach ein paar Minuten waren Erickson und Balée mit den erforderlichen Genehmigungen zurückgekehrt – und zwei Aufpassern in Gestalt von Chiro und Rafael. Nun, während wir den Ibibate bestiegen, fiel Chiro auf, dass ich neben dem Teufelsbaum stand. Ohne eine Miene zu verziehen, riet er mir, auf den Baum zu klettern. Oben würde ich eine köstliche Dschungelfrucht vorfinden. «Sie wird mit nichts zu vergleichen sein, was Sie je erlebt haben», versprach er.
Vom Gipfel des Ibibate konnten wir die umliegende Savanne betrachten. In vielleicht vierhundert Meter Entfernung, jenseits einer Fläche aus gelbem hüfthohem Gras, stand eine gerade Baumreihe – ein alter erhöhter Dammweg, kommentierte Erickson. Davon abgesehen war die Landschaft so flach, dass wir kilometerweit in alle Richtungen blicken konnten – oder, besser gesagt, wir hätten kilometerweit blicken können, wäre die Luft in manchen Richtungen nicht verqualmt gewesen.
Später dachte ich über die Beziehung zwischen unseren Begleitern und dieser Gegend nach. Auf der Rückfahrt erkundigte ich mich bei Erickson und Balée, ob die Sirionó zeitgenössischen Italienern glichen, die zwischen den Monumenten des Römischen Reiches lebten.
Sie antworteten im Laufe des Abends, während wir bei unzeitig kaltem Regen zu unserem Quartier fuhren und dann dort aßen. In den siebziger Jahren, erklärten sie, hätten die meisten Experten meine Frage nach den Sirionó anders beantwortet als heutzutage. Der Unterschied lief auf das hinaus, was ich, etwas ungerecht, als Holmbergs Irrtum im Gedächtnis behalten habe.
Die Sirionó, obwohl nur eine von rund zwanzig Ureinwohnergruppen in Beni, sind bekannter als die anderen. Von 1940 bis 1942 hielt sich ein junger Doktorand namens Allan R. Holmberg bei ihnen auf; er veröffentlichte im Jahre 1950 seine Schilderung ihres Lebens, Nomads of the Long Bow. Der Titel bezieht sich auf die einen Meter achtzig langen Bögen, welche die Sirionó zur Jagd benutzten. Das Buch galt sehr bald als Klassiker; es hat noch heute Kultstatus und Einfluss. Gefiltert durch zahlreiche Fachartikel und durch die Massenmedien, wurde es zu einer der Hauptquellen für das Bild, das sich die Außenwelt von südamerikanischen Indianern macht.
Die Sirionó, berichtete Holmberg, gehörten «zu den kulturell rückständigsten Völkern der Welt». In Not lebend und Hunger leidend, besäßen sie keine Kleidung, keine Haustiere, keine Musikinstrumente (nicht einmal Rasseln und Trommeln), weder Kunst noch Design (außer Halsbändern aus Tierzähnen) und so gut wie keine Religion (ihre «Vorstellung vom Universum» sei «fast völlig unkristallisiert»). Erstaunlicherweise könnten sie nur bis drei zählen und kein Feuer machen (sie trügen es «als Fackel von Lager zu Lager»). Ihre kümmerlichen Pultdächer, gefertigt aus willkürlich aufgehäuften Palmwedeln, seien so unwirksam gegen Regen und Insekten, dass das typische Stammesmitglied «im Jahresverlauf manch eine schlaflose Nacht erduldet». Die Sirionó, die während der nassen, insektenverseuchten Nächte an dürftigen Lagerfeuern hockten, seien lebende Musterexemplare der primitiven Menschheit – die «Quintessenz» des «Menschen im unverfälschten Zustand der Natur».[14] Jahrtausendelang, dachte Holmberg, hätten sie nahezu ohne jeglichen Wandel in einer von ihrer Präsenz unberührten Landschaft existiert. Dann seien sie auf die europäische Gesellschaft gestoßen, und ihre Geschichte habe zum ersten Mal einen Erzählfluss erhalten.
Holmberg war ein sorgfältiger und teilnahmsvoller Forscher, dessen detaillierte Mitteilungen über das Leben der Sirionó noch heute wertvoll sind. Und er bewältigte in Bolivien tapfer Prüfungen, die viele andere veranlasst hätten, ihr Projekt aufzugeben. Während seiner Feldforschung fühlte er sich stets unwohl, litt gewöhnlich an Hunger und war oft krank. Durch eine Infektion in beiden Augen erblindet, schleppte er sich tagelang an der Hand eines Sirionó, der ihn führte, durch den Wald zu einer Klinik. Er erholte sich nie vollständig. Nach seiner Rückkehr wurde er Chef des Fachbereichs Anthropologie an der Cornell University und leitete deren vielgelobte Bemühungen zur Milderung der Armut in den Anden.[15]
Gleichwohl irrte er sich, was die Sirionó und Beni, wo sie lebten, anging – und zwar auf eine Weise, die lehrreich, wenn nicht gar beispielhaft ist.
Vor Kolumbus hätten weder das Volk noch das Land eine reale Geschichte gehabt, glaubte Holmberg. Wenn man diesen Gedanken – dass die indigenen Völker Amerikas bis 1492 unwandelbar durch die Jahrtausende geschwebt seien – so unverblümt ausdrückt, mag er albern erscheinen. Doch die Fehler einer Methode werden häufig erst dann augenscheinlich, wenn jemand auf sie hinweist. In diesem Fall dauerte es Jahrzehnte, sie zu korrigieren.
Die Instabilität der bolivianischen Regierung sowie ihre Anfälle antiamerikanischer und antieuropäischer Rhetorik sorgten dafür, dass wenige ausländische Anthropologen und Archäologen Holmberg nach Beni folgten. Von der Feindseligkeit der Regierung abgesehen, war die Region – in den siebziger und achtziger Jahren ein Zentrum des Kokainhandels – ohnehin gefährlich. Inzwischen ist der Drogenhandel zurückgegangen, doch man kann immer noch Start- und Landebahnen von Schmugglern an fernen Waldflecken entdecken. Das Wrack eines abgestürzten Drogenflugzeugs liegt nicht weit vom Flughafen in Trinidad, der größten Stadt des Departamento. Während der Drogenkriege wurde «Beni sogar nach bolivianischen Maßstäben vernachlässigt», erläutert Robert Langstroth, ein Geograf und Weidelandökologe aus Wisconsin, der die Feldforschung für seine Dissertation in Beni durchführte. «Es war die allertiefste Provinz.»[16] Nach und nach wagten sich einige wenige Wissenschaftler in die Region. Was sie ermittelten, verschaffte ihnen ein neues Verständnis von der Gegend und ihrer Bevölkerung.
Genau wie Holmberg vermutet hatte, gehörten die Sirionó zu den kulturell ärmsten Menschen der Erde. Dies lag jedoch nicht daran, dass sie unveränderte Überbleibsel aus der grauen Vorzeit der Menschheit gewesen wären, sondern daran, dass Pocken und Grippe ihre Dörfer in den 1920er Jahren dezimiert hatten.[17] Vor den Epidemien lebten mindestens dreitausend Sirionó in Ostbolivien, wahrscheinlich sogar viel mehr. Zur Zeit von Holmbergs Aufenthalt waren keine 150 übrig geblieben – ein Verlust von über fünfundneunzig Prozent in weniger als einer Generation.[18] Der Aderlass war so katastrophal, dass die Sirionó einen genetischen Flaschenhals durchliefen – dieser Umstand tritt ein, wenn eine Bevölkerung so klein wird, dass Individuen gezwungen sind, sich mit Verwandten zu paaren, was das Risiko für Erbkrankheiten erhöht. Die Auswirkungen des «Flaschenhalses» wurden 1982 beschrieben, als Allyn Stearman von der University of Central Florida sich als erste Anthropologin nach ihrem Kollegen Holmberg bei den Sirionó aufhielt. Sie entdeckte, dass die Wahrscheinlichkeit, mit Klumpfüßen geboren zu werden, bei ihnen dreißigmal höher war als bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Und fast sämtliche Sirionó hatten ungewöhnliche Kerben an den Ohrläppchen – die Merkmale, die mir an unseren beiden Begleitern aufgefallen waren.[19]
Während die Epidemien zuschlugen, musste sich die Gruppe, wie Stearman erfuhr, auch noch gegen weiße Viehzüchter zur Wehr setzen, die das Gebiet in ihren Besitz zu bringen versuchten. Das bolivianische Militär unterstützte den Angriff, indem es Jagd auf die Sirionó machte und sie in Gefangenenlagern festhielt. Diejenigen, die man aus der Haft entließ, wurden in die Knechtschaft auf Viehfarmen gezwungen. Die umherziehenden Menschen, denen sich Holmberg im Wald angeschlossen hatte, waren auf der Flucht vor ihren Ausbeutern gewesen. Holmberg hatte ein gewisses Risiko auf sich genommen, um ihnen zu helfen, aber nie völlig begriffen, dass es sich bei den Personen, die er für Überbleibsel aus der Altsteinzeit hielt, in Wirklichkeit um die verfolgten Überlebenden einer kurz zuvor vernichteten Kultur handelte. Es war, als wäre er auf Flüchtlinge aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager gestoßen und hätte den Schluss gezogen, sie seien Vertreter einer Kultur, in der alle schon immer barfüßig und unterernährt gewesen waren.
In Wahrheit sind die Sirionó keineswegs Relikte aus der Steinzeit, sondern wahrscheinlich vor relativ kurzer Zeit in Beni eingetroffen. Ihre Sprache gehört zur Tupí-Guaraní-Gruppe, einer der wichtigsten indianischen Sprachfamilien in Südamerika, die jedoch in Bolivien nicht verbreitet ist. Linguistische Indizien, die von Anthropologen in den siebziger Jahren ausgewertet wurden, lassen vermuten, dass sie erst im 17. Jahrhundert, etwa gleichzeitig mit den ersten spanischen Siedlern und Missionaren, aus dem Norden ankamen. Andere Hinweise sprechen dafür, dass sie ein paar Jahrhunderte eher aufgetaucht sein könnten, denn Tupí Guaraní sprechende Gruppen, darunter möglicherweise die Sirionó, griffen das Inkareich im frühen 16. Jahrhundert an. Niemand weiß, warum sich die Sirionó hier ansiedelten, doch einer der Gründe könnte schlicht darin bestanden haben, dass Beni damals dünn bevölkert war, denn die Gesellschaft der vorherigen Einwohner hatte sich gerade aufgelöst.[20]
Beim Flug über Ostbolivien in den frühen 1960er Jahren staunte der junge Geograf William Denevan darüber, dass die Landschaft (Seite 32) von den erhöhten Agrarflächen einer untergegangenen Gesellschaft bedeckt war. Unregelmäßig über diese Felder verteilt zogen sich an Burggräben erinnernde Vertiefungen (unten) hin, deren Zweck nach wie vor unklar ist. Im angrenzenden brasilianischen Bundesstaat Acre haben Archäologen mehrere hundert akkurat ausgeführte, geometrische «Geoglyphen» entdeckt (links unten) und schließen nicht mehr aus, dass es im westlichen Amazonien große, komplexe indianische Gesellschaften gab.
Nach Nomads of the Long Bow zu schließen, wusste Holmberg nichts von der früheren Zivilisation, welche die Dammwege, Mounds und Fischwehre gebaut hatte. Er erkannte nicht, dass die Sirionó durch eine Landschaft zogen, die von anderen gestaltet worden war. Ein paar europäische Beobachter vor Holmberg hatten sich über die Existenz der Erdarbeiten geäußert, und manche zweifelten daran, dass die Dammwege und Waldinseln menschlichen Ursprungs waren. All das weckte jedoch erst 1961 wissenschaftliche Aufmerksamkeit, als William Denevan nach Bolivien kam. Er war damals noch Doktorand, und die eigenartige Landschaft der Region, die ihm als angehendem Reporter in Peru bei einem früheren Besuch aufgefallen war, schien ein interessantes Thema für seine Dissertation zu sein. Nach seiner Ankunft erfuhr er, dass die Geologen von Erdölfirmen, die einzigen Wissenschaftler in der Gegend, der Meinung waren, in Beni wimmele es von den Relikten einer unbekannten Zivilisation.
Denevan überredete einen einheimischen Piloten, seine übliche Route nach Westen zu verlängern, und musterte Beni von oben. Er nahm genau das zur Kenntnis, was ich vier Jahrzehnte später sah: isolierte Waldhügel, lange Bermen, Kanäle, erhöhte Felder, kreisförmige, an Burggräben erinnernde Vertiefungen und seltsame zickzackförmige Kämme. «Ich schaue aus einem der DC-3-Fenster und drehe in dem kleinen Flugzeug durch», erzählte mir Denevan. «Ich wusste, dass diese Dinge nicht natürlicher Herkunft waren. In der Natur gibt es einfach keine derart geraden Linien.» Während Denevan mehr über die Gegend herausfand, wuchs sein Erstaunen. «Die Landschaft ist ganz und gar humanisiert», sagte er. «Für mich war es eindeutig das Aufregendste, was sich am Amazonas und in der Umgebung abspielte. Vielleicht ist es die wichtigste Sache in ganz Südamerika. Und trotzdem war all das [von Wissenschaftlern] fast unberührt.» Es ist immer noch fast unberührt, denn Archäologen sind weiterhin damit beschäftigt, die Erdarbeiten und Kanäle zu kartieren.[21]
Vor möglicherweise dreitausend Jahren schuf diese längst untergegangene Gesellschaft – Erickson meint, sie sei wahrscheinlich von den Vorfahren eines Arawak sprechenden Volkes, das sich heute als Mojo oder Bauré bezeichnet, begründet worden – eine der größten, seltsamsten und ökologisch reichhaltigsten künstlichen Umwelten auf dem Planeten.[22] Diese Menschen erbauten die Mounds, um sie für Unterkünfte und Bauernhöfe zu nutzen, konstruierten die Dammwege und Kanäle für Verkehr und Kommunikation, legten die Fischwehre an, um sich zu ernähren, und brannten die Savannen ab, um sie von unerwünschten Bäumen freizuhalten. Vor tausend Jahren befand sich ihre Kultur auf dem Höhepunkt. Ihre Dörfer und Städte waren geräumig, symmetrisch und wurden von Gräben und Palisaden geschützt. Laut Ericksons hypothetischer Rekonstruktion mögen nicht weniger als eine Million Menschen über die Dammwege Ostboliviens geschritten sein, in langen Baumwollgewändern und mit schweren Schmuckstücken, die an ihren Handgelenken und Hälsen baumelten.
Heute, Hunderte von Jahren nachdem diese Arawak-Zivilisation von der Bildfläche verschwand, wirkt der Wald auf dem Ibibate und darum herum wie das klassische Amazonasgebiet aus den Träumen der Naturschützer: Lianen von der Dicke eines Menschenarms, herunterhängende schwertartige Blätter, die über einen Meter achtzig lang sind, Paranussbäume mit glatten Stämmen, bauchige Blumen, die nach warmem Fleisch riechen. Was den Artenreichtum betrifft, so können sich die Waldinseln Boliviens laut Balée mit jeder Gegend in Südamerika messen. Das Gleiche gilt anscheinend für die Savanne von Beni mit ihren sehr verschiedenen Arten. Ökologisch betrachtet ist die Region eine Schatzkammer, die allerdings von Menschen entworfen und geschaffen wurde. Erickson hält die Landschaft von Beni für eines der größten Kunstwerke der Menschheit, für ein Meisterwerk, das bis vor kurzem so gut wie unbekannt war und sich in einem Gebiet befindet, von dem kaum jemand außerhalb Boliviens gehört hat.
«Bar der Menschen und ihrer Werke»
Beni war keine Anomalie. Rund fünf Jahrhunderte lang beherrschten Versionen von Holmbergs Irrtum – die Annahme, dass amerikanische Ureinwohner in einem unveränderten, geschichtslosen Zustand lebten – sämtliche wissenschaftlichen Arbeiten und griffen von dort auf Schulbücher, Hollywoodfilme, Zeitungsartikel, Umweltkampagnen, romantische Abenteuerbücher und Siebdruck-T-Shirts über. Sie existierten in vielfacher Gestalt und wurden sowohl von denen vertreten, die Indianer hassten, als auch von denen, die sie bewunderten. Durch Holmbergs Irrtum erklärte sich die Ansicht der Kolonisten, dass die meisten Indianer unheilbar bösartige Barbaren seien; demgegenüber stand das verträumte Klischee des Indianers als eines edlen Wilden. In beiden Bildern, dem positiven wie dem negativen, fehlte den Indianern das, was Sozialwissenschaftler als «Agency» bezeichnen. Sie waren keine eigenständigen Akteure, sondern passive Empfänger der glücklichen Umstände oder der Katastrophen, mit denen der Zufall sie bedachte.
Der edle Wilde geht zurück auf die erste gründliche Ethnografie der amerikanischen Völker: Bartolomé de Las Casas’ Apologética Historia Sumaria, die hauptsächlich in den 1530er Jahren geschrieben wurde.[23] Las Casas, ein Konquistador, der seine Taten bereute und Priester wurde, verbrachte die zweite Hälfte seines langen Lebens damit, der europäischen Grausamkeit in Amerika entgegenzutreten. Für ihn waren Indianer natürliche Geschöpfe, die, sanft wie Kühe, im «irdischen Paradies» lebten. In ihrer prälapsarischen Unschuld hätten sie seit Jahrtausenden still auf christliche Unterweisung gewartet. Las Casas’ Zeitgenosse, der italienische Kommentator Pietro Martire d’Anghiera, teilte diese Einschätzung. Indianer, schrieb er, «leben in der goldenen Welt, von der alte Autoren so häufig sprechen»; sie existierten «schlicht und unschuldig ohne Vollstreckung von Gesetzen».[24]
In unseren Tagen gründet der Glaube an die ureigene Einfachheit und Unschuld der Indianer vorwiegend auf der Annahme, dass sie keinen Einfluss auf die Umwelt ausgeübt hätten. Dieser Gedanke lässt sich mindestens bis zu Henry David Thoreau zurückverfolgen, der viel Zeit darauf verwandte, nach «indianischer Weisheit»[25] zu suchen, nach einer indigenen Denkweise, die Messungen und Kategorisierungen angeblich nicht einbezog, denn diese seien die Übel, welche den Menschen ermöglichten, die Natur zu verändern. Thoreaus Ideen sind weiterhin richtungweisend. Nach dem ersten Earth Day (Tag der Erde) im Jahr 1970 ließ eine Gruppe namens Keep America Beautiful, Inc. Plakate anbringen, die einen Schauspieler in Indianerkleidung zeigten. Er weinte leise um das verschmutzte Land.[26] Die Kampagne war enorm erfolgreich. Knapp ein Jahrzehnt lang erschien das Motiv überall auf der Welt. Obwohl die Indianer die Heldenrolle innehatten, beruhte die Anzeige ebenfalls auf Holmbergs Irrtum, denn sie beschrieb Indianer implizit als Menschen, die ihre Umwelt seit deren wildem Urzustand nie verändert hätten. Da Geschichte Wandel ist, waren sie Menschen ohne Geschichte.[27]
Las Casas’ antispanischer Standpunkt löste so heftige Angriffe aus, dass er seinen Testamentsvollstreckern auftrug, die Apologética Historia vierzig Jahre nach seinem Tod zu veröffentlichen; er starb 1566. Tatsächlich erschien eine vollständige Ausgabe des Buches erst im Jahre 1909. Wie die Verzögerung vermuten lässt, fanden Plädoyers für den edlen Wilden im 18. und 19. Jahrhundert wenig Anklang. Typisch war der US-Historiker George Bancroft, Doyen seiner Zunft, der 1834 behauptete, dass Nordamerika vor dem Eintreffen der Europäer «eine unproduktive Wüste» gewesen sei. «Seine einzigen Bewohner waren ein paar verstreute Stämme schwächlicher Barbaren, die weder über Handels- noch über politische Beziehungen verfügten.»[28] Wie Las Casas glaubte auch Bancroft, dass die Indianer in Gesellschaften ohne Wandel existiert hätten – wobei Bancroft diese Zeitlosigkeit jedoch nicht als Merkmal von Unschuld, sondern von Trägheit interpretierte.
In unterschiedlicher Form wurde Bancrofts Charakterisierung ins folgende Jahrhundert übertragen. 1934 mutmaßte Alfred L. Kroeber, einer der Begründer der amerikanischen Anthropologie, dass sich die Indianer im östlichen Nordamerika nicht hätten entwickeln können und daher keine Geschichte besäßen, weil ihr Leben aus Krieg bestanden habe, «der wahnsinnig, endlos, fortlaufend zermürbend war». Dem Zyklus des Konflikts zu entkommen sei «nahezu unmöglich» gewesen, meinte er. «Die Gruppe, die versuchte, ihre Werte vom Krieg auf den Frieden zu verlagern, war fast mit Sicherheit zum frühen Aussterben verurteilt.»[*] Kroeber räumte ein, dass die Indianer ihre Kämpfe hin und wieder unterbrochen hätten, um Feldfrüchte anzubauen, doch er betonte, dass Landwirtschaft «nicht grundlegend für das Leben im Osten, sondern etwas Zusätzliches war, in gewissem Sinne ein Luxus». Dadurch «blieben mindestens neunundneunzig Prozent des Landes, die hätten entwickelt werden können, unbestellt».[29]
Vier Jahrzehnte später beendete der doppelte Pulitzer-Preisträger Samuel Eliot Morison sein zweibändiges Werk European Discovery of America mit der lapidaren Aussage, dass die Indianer keine bleibenden Denkmäler oder Institutionen geschaffen hätten. Gefangen in einer unveränderlichen Wildnis, seien sie «Heiden» gewesen, die ein «kurzes und tierisches Leben ohne jegliche Hoffnung auf die Zukunft erwarteten».[30] Der britische Historiker Hugh Trevor-Roper, später Baron Dacre of Glanton, verkündete im Jahr 1965, die «Hauptfunktion» der Ureinwohner bestehe «in der Geschichte … darin …, der Gegenwart ein Bild jener Vergangenheit vor Augen zu führen, von der sie sich im Lauf der Geschichte befreit hat».[31]
Lehrbücher spiegelten die Überzeugungen der Wissenschaftler getreu wider. In einem Überblick über US-amerikanische Unterrichtswerke gelangte die Autorin Frances Fitzgerald zu dem Schluss, dass sich die Darstellung der Indianer zwischen den 1840er und 1940er Jahren «wenn überhaupt, dann entschieden in eine andere Richtung» bewegt habe. Frühere Autoren hätten die Indianer für wichtig, doch unzivilisiert gehalten, während sie in späteren Büchern in das starre Muster «faul, kindlich und brutal» gepresst worden seien. In einem bedeutenden Lehrbuch der 1940er Jahre habe man den Indianern nur «ein paar Absätze» gewidmet, «von denen der letzte die Überschrift ‹Die Indianer waren rückständig› trug».[32]
Denen, die in der Gegenwart leben, fällt es stets leicht, sich den Menschen der Vergangenheit überlegen zu fühlen.[33] Alfred W. Crosby, ein Historiker an der University of Texas, merkte an, viele der Forscher, die Holmbergs Irrtum akzeptierten, hätten in einer Epoche gelebt, in der es den Anschein gehabt habe, dass die Ereignisse von großen Persönlichkeiten europäischer Herkunft bestimmt wurden, und in der weiße Gesellschaften die Nichtweißen offenbar auf der ganzen Welt überwältigten. Das gesamte 19. und einen großen Teil des 20. Jahrhunderts hindurch war der Nationalismus im Aufstieg begriffen, und Historiker identifizierten die Geschichte nicht mit Kulturen, Religionen oder Lebensweisen, sondern mit Nationen. Doch dann lehrte der Zweite Weltkrieg den Westen, dass Nichtwestler – in diesem Fall die Japaner – zu einem raschen gesellschaftlichen Wandel fähig waren. Der zügige Zerfall der europäischen Kolonialreiche untermauerte diese Einsicht. Crosby verglich die Auswirkungen dieser Geschehnisse auf Sozialwissenschaftler mit denen, welche «die Entdeckung, dass die schwachen Flecke zwischen Sternen in der Milchstraße in Wirklichkeit ferne Galaxien sind», auf Astronomen gehabt habe.[34]
Unterdessen brachten neue Studienfächer und Technologien nie dagewesene Methoden zur Untersuchung der Vergangenheit hervor. Demografie, Klimatologie, Epidemiologie, Wirtschaftswissenschaft, Botanik und Palynologie (Pollenanalyse), Molekular- und Evolutionsbiologie, Radiokarbondatierung, die Entnahme von Eiskernproben, Satellitenfotografie und Bodenanalysen, die Mikrosatellitenanalyse in der Genetik und virtuelle 3-D-Durchflüge – eine Vielzahl neuer Perspektiven und Verfahren kam plötzlich in Gebrauch. Und damit erschien der Gedanke, dass sich die einzigen menschlichen Bewohner eines Drittels der Erdoberfläche seit Jahrtausenden kaum verändert hätten, wenig plausibel. Gewiss, manche Forscher greifen die neuen Befunde energisch als wilde Übertreibungen an: «Wir haben den alten Mythos [der unberührten Wildnis] lediglich durch einen neuen ersetzt», spottete etwa der Geograf Thomas Vale, «nämlich durch den Mythos der humanisierten Landschaft.»[35] Aber nach mehreren Jahrzehnten der Entdeckungen und Debatten bildet sich ein neues Bild Amerikas und seiner ursprünglichen Bewohner heraus.
In der Werbung preist man immer noch nomadische, ökologisch vorbildliche Indianer, die zu Pferde in den Great Plains von Nordamerika Büffel jagen, doch zur Zeit von Kolumbus hielt sich die große Mehrheit der alteingesessenen Amerikaner südlich des Rio Grande auf. Sie waren keine Nomaden, sondern erbauten und bevölkerten einige der größten und reichsten Städte der Welt. Keineswegs abhängig von der Großwildjagd, lebten die meisten Indianer auf Farmen. Andere ernährten sich von Fisch und Schalentieren. Was die Pferde anging, so kamen sie aus Europa; abgesehen von Lamas in den Anden gab es in der westlichen Hemisphäre keine Lasttiere. Mit anderen Worten, Amerika war unermesslich geschäftiger, mannigfaltiger und dichter bevölkert, als es sich die Forscher früher vorgestellt hatten.
Und älter war es auch.
Die andere neolithische Revolution
Einen großen Teil des letzten Jahrhunderts hindurch glaubten Archäologen, dass die Indianer vor ungefähr dreizehntausend Jahren, gegen Ende der letzten Eiszeit, über die Beringstraße nach Amerika gekommen wären. Da die Polareisplatten gewaltige Wassermengen gebunden hatten, waren die Meeresspiegel überall auf der Welt um etwa hundert Meter gefallen, wodurch die seichte Beringstraße eine breite Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska gebildet hatte. Nach dieser Theorie waren die sogenannten Paläoindianer einfach nur achtundachtzig Kilometer – die heutige Entfernung zwischen den beiden Kontinenten – gelaufen. C. Vance Haynes, ein Archäologe an der University of Arizona, vervollständigte diese Auffassung 1964, als er Indizien dafür fand, dass sich die beiden großen Gletscherplatten in Nordwestkanada genau zum richtigen Zeitpunkt – das heißt vor ungefähr dreizehntausend Jahren – voneinander getrennt und einen relativ warmen, eisfreien Korridor zwischen sich hinterlassen hätten. Durch diese Passage hätten Paläoindianer aus Alaska in die weniger lebensfeindlichen südlichen Regionen ziehen können, ohne das Packeis bewältigen zu müssen. Damals erstreckten sich die Eisschollen bis 3600 Kilometer südlich der Beringstraße und waren nahezu bar allen Lebens. Ohne Haynes’ eisfreien Korridor ist es kaum vorstellbar, wie Menschen nach Süden hätten gelangen können. Das Zusammentreffen der Landbrücke mit dem eisfreien Korridor habe sich in den vergangenen zwanzigtausend Jahren nur einmal ereignet und lediglich ein paar hundert Jahre gedauert. Und es habe sich knapp vor der Entstehung der damals ersten bekannten Kultur in Amerika, der Clovis-Kultur, abgespielt. Haynes’ Ausführungen ließen die Theorie so unanfechtbar wirken, dass sie rasch und reibungslos in die Lehrbücher einfloss. Ich wurde damit vertraut gemacht, als ich die Highschool besuchte, ebenso mein Sohn dreißig Jahre später.
1997 wurde die Theorie jäh umgeworfen. Einige ihrer inbrünstigsten Verfechter, darunter auch Haynes, gestanden öffentlich ein, dass eine archäologische Ausgrabung in Südchile zwingende Beweise für menschliche Besiedlung vor über zwölftausend Jahren erbracht habe.[36] Und da diese Menschen mehr als 11200 Kilometer südlich der Beringstraße – eine Entfernung, die zurückzulegen vermutlich sehr lange gedauert hätte – ansässig gewesen seien, dürften sie fast mit Sicherheit vor der Herausbildung des eisfreien Korridors eingetroffen sein, zudem ist die Existenz des Korridors durch neue Forschungen in Zweifel geraten. Da es so gut wie unmöglich erschien, die Gletscher ohne den Korridor zu überqueren, kamen einige Archäologen zu dem Schluss, dass die ersten Amerikaner vor zwanzigtausend Jahren, als das Packeis noch eine geringere Ausdehnung hatte, eingetroffen sein müssten. Oder vielleicht sogar noch früher, denn die chilenische Ausgrabung hatte überzeugende Artefakte zutage gebracht, die über dreißigtausend Jahre alt waren. Oder möglicherweise hatten die ersten Indianer Boote benutzt und die Landbrücke nicht benötigt. Oder vielleicht waren sie über Australien gereist, am Südpol vorbei. «Wir sind verwirrt», gestand mir der beratende Archäologe Stuart Fiedel. «Alles, was wir wissen, soll nun falsch sein», fügte er hinzu und übertrieb des Effektes halber ein wenig.
Ein Konsens hat sich nicht herausgebildet, doch eine wachsende Anzahl von Forschern glaubt, dass die Neue Welt von einer einzigen kleinen Schar besetzt wurde, welche die Beringstraße überquerte, in Alaska stecken blieb und sich dann in mehreren separaten Grüppchen, sehr wahrscheinlich mit Booten an der Pazifikküste entlang, ins übrige Amerika vorarbeitete. Über die Details ist man sich uneins; manche Wissenschaftler mutmaßen, dass Amerika vor Kolumbus nicht weniger als fünf Besiedlungswellen erlebt habe, wobei die erste bereits vor fünfzigtausend Jahren eingeleitet worden sei. Nach vielen anderen Auffassungen dagegen werden die heutigen Indianer eher als Nachzügler betrachtet.
Indianervertretern missfällt diese Argumentation. «Ich kann Ihnen gar nicht sagen, von wie vielen Weißen ich höre, dass die Indianer der ‹Wissenschaft› zufolge nur ein Haufen Eindringlinge gewesen seien», sagte mir Vine Deloria jun., Politikwissenschaftler an der University of Colorado in Boulder, in einem Gespräch. Der 2005 Verstorbene hatte zahlreiche Bücher verfasst, darunter Red Earth, White Lies, eine Kritik an der konventionellen Archäologie. Der allgemeine Tenor des Buches ist an seinem Register abzulesen; unter «Wissenschaft» findet man Einträge wie «Korruption und Betrug und», «indianische Erklärungen ignoriert von der», «Beweismangel für Theorien der», «Mythos der Objektivität der» und «Rassismus der».[37] Nach Delorias Einschätzung war es der Hauptzweck der Archäologie, die Schuld der Weißen zu verringern. Die Feststellung, dass die Indianer andere Menschen verdrängt hätten, füge sich elegant in diesen Plan ein. «Wenn wir bloß Diebe waren, die ihr Land von jemand anderem gestohlen haben», erläuterte Deloria, «dann können sie verkünden: ‹Tja, genau das waren wir auch. Sind wir nicht alle Einwanderer?›»
Die moralische Logik des «Sind wir nicht alle Einwanderer?»-Arguments, das Deloria anführt, ist schwer nachzuvollziehen. Damit scheint behauptet zu werden, dass ein Unrecht das andere aufhebe. Zudem deutet nichts darauf hin, dass das erste «Unrecht» überhaupt eines war, denn über die Kontakte zwischen den verschiedenen Wellen paläoindianischer Einwanderer ist nichts bekannt. In jedem Fall ist die Frage, ob die Mehrheit der heutigen amerikanischen Ureinwohner als Erste oder Zweite eintrafen, unerheblich für eine Beurteilung ihrer kulturellen Leistungen. In jedem denkbaren Szenario verließen sie Eurasien vor dem ersten Hauch der neolithischen Revolution.
Mit der neolithischen Revolution ist die Entstehung der Landwirtschaft gemeint – ein Ereignis, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann.[38] «Der Aufstieg des Menschen», schrieb der Historiker Ronald Wright, «zerfällt in zwei Perioden: alles vor der neolithischen Revolution und alles danach.» Sie begann vor ungefähr elftausend Jahren im Nahen Osten, in der westlichen Hälfte des Fruchtbaren Halbmonds, der einen Bogen zwischen dem südlichen Irak und Israel beschreibt und sich dabei in den Süden der Türkei erstreckt. Jäger-und-Sammler-Völker ließen sich dort dauerhaft in Dörfern nieder und lernten, die wilden Weizen- und Gerstearten der Gegend anzubauen und zu züchten. In den folgenden Jahrtausenden erschienen das Rad und Metallgerätschaften im selben Gebiet. Die Sumerer verbanden diese Erfindungen miteinander, fügten die Keilschrift hinzu und schufen im 3. Jahrtausend v. Chr. die erste große Hochkultur. Sämtliche europäischen und asiatischen Zivilisationen, so ungleichartig sie auch erscheinen mögen, stehen seither im Schatten von Sumer.[39] Den amerikanischen Ureinwohnern, die Asien lange vor dem Aufkommen der Landwirtschaft verlassen hatten, entging dieses Geschenk. «Sie mussten alles in Eigeninitiative nachholen», sagte Crosby. Bemerkenswerterweise gelang es ihnen.
Forscher wissen seit langem, dass sich eine zweite, unabhängige neolithische Revolution in Mesoamerika abspielte. Der genaue Zeitpunkt steht nicht fest – Archäologen verlegen ihn immer weiter zurück in die Vergangenheit –, doch man nimmt heute an, dass sie sich vor rund zehntausend Jahren ereignete, nicht lange nach der neolithischen Revolution im Nahen Osten. Im Jahre 2003 entdeckten Archäologen im ecuadorianischen Küstengebiet am Fuß der Anden jedoch Samen von Speisekürbissen, die älter sein könnten als sämtliche landwirtschaftlichen Überreste Mesoamerikas – was auf eine dritte neolithische Revolution hinweist. Sie führte, neben vielem anderen, wahrscheinlich zu den Kulturen in Beni. Die beiden amerikanischen neolithischen Revolutionen griffen langsamer um sich als die eurasische, möglicherweise weil die Indianer vielerorts nicht genug Zeit hatten, die erforderliche Bevölkerungsdichte aufzubauen, oder auch wegen der ungewöhnlichen Beschaffenheit der herausragenden indianischen Feldfrucht: des Maises.
Die Vorfahren von Weizen, Reis, Hirse und Gerste sehen aus wie ihre domestizierten Nachkommen; da sie sowohl essbar als auch höchst ertragreich sind, kann man sich leicht vorstellen, wie der Gedanke entstand, sie zu Speisezwecken anzubauen. Mais kann sich nicht ohne menschliche Hilfe fortpflanzen, weil seine Kerne vollständig von Hüllblättern umschlossen sind. Die Indianer müssen ihn aus einer anderen Art entwickelt haben. Es gibt jedoch keine Wildform, die dem Mais ähnelt. Sein engster genetischer Verwandter ist ein Berggras namens Teosinte, das völlig anders aussieht – beispielsweise sind seine «Kolben» kleiner als die Maiskölbchen, die in chinesischen Restaurants serviert werden. Niemand isst Teosinte, denn sie bringt zu wenig Getreide hervor, um die Ernte sinnvoll zu machen. Indem die Indianer den heutigen Mais aus dieser kaum verheißungsvollen Pflanze ableiteten, vollbrachten sie eine bemerkenswerte Leistung, weshalb Archäologen und Biologen sich jahrzehntelang über die Verfahrensweise stritten.[40] Zusammen mit Kürbissen, Bohnen und Avocados ermöglichte der Mais Mesoamerika eine ausgewogene und vermutlich gesündere Ernährung, als man sie im Nahen Osten oder in Asien kannte. Die Anden-Landwirtschaft, die auf Kartoffeln und Bohnen beruhte, sowie die des Amazonasgebiets, die sich auf Maniok (Cassava) stützte, übten einen beträchtlichen Einfluss aus, waren auf globaler Ebene jedoch nicht so bedeutend wie der Mais.
Etwa siebentausend Jahre vergingen zwischen dem Beginn der nahöstlichen neolithischen Revolution und der Gründung von Sumer. Die Indianer legten den gleichen Weg etwas rascher zurück, wenn die Daten auch zu lückenhaft sind, als dass präzise Aussagen möglich wären. Ein Ehrenplatz gebührt den Olmeken, welche die erste technisch fortgeschrittene Zivilisation der Hemisphäre schufen.[41] Sie erschienen um 1800 v. Chr. in der schmalen «Taille» von Mexiko und lebten in Städten und Ortschaften, die sich um Tempelhügel gruppierten. Dazwischen verstreut standen männliche Steinköpfe, etliche an die zwei Meter groß, mit einer helmartigen Kopfbedeckung, unablässig gerunzelter Stirn und recht afrikanischen Gesichtszügen, die Spekulationen darüber auslösten, ob Reisende aus Afrika die Kultur der Olmeken inspiriert haben mochten. Diese Gesellschaft war lediglich die erste von vielen, welche in dieser Epoche in Mesoamerika aufkamen. Die meisten propagierten Religionen, in deren Mittelpunkt Menschenopfer standen, was nach heutigen Maßstäben finster wirkt, doch ihre wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Errungenschaften waren umso glänzender. Sie erfanden ein Dutzend unterschiedliche Schriftsysteme, bauten weitreichende Handelsnetze auf, verfolgten die Planetenbahnen, schufen einen 365-Tage-Kalender – der exakter war als seine Pendants in Europa – und hielten ihre Geschichte in Faltbüchern aus Papier fest, das aus Feigenbaumborke gefertigt wurde.
Ihre wohl bedeutsamste intellektuelle Großtat war die Erfindung der Null. In seiner klassischen Darstellung Number. The Language of Science nannte der Mathematiker Tobias Dantzig die Entdeckung der Null «eine der größten individuellen Leistungen der menschlichen Rasse», einen «Wendepunkt» in Mathematik, Wissenschaft und Technik.[42] Zum ersten Mal war im Nahen Osten gegen 600 v. Chr. die Rede von der Null.[43] Wenn die Babylonier Zahlen addierten, ordneten sie diese untereinander an, wie es Schulkinder heutzutage lernen. Um zwischen ihren Entsprechungen zu 11 und 101 zu unterscheiden, setzten sie zwei Dreiecke zwischen die Ziffern: 1ΔΔ1 sozusagen (da die babylonische Mathematik nicht auf dem Dezimal-, sondern auf dem Sexagesimalsystem basierte, stimmt das Beispiel nur im Prinzip). Merkwürdigerweise benutzten sie das Symbol jedoch nicht, um ihre Versionen von 1, 10 und 100 auseinanderzuhalten. Auch konnten die Babylonier nicht mit null addieren oder subtrahieren, geschweige denn in das Reich der negativen Zahlen eindringen. Indische Mathematiker verwendeten die Null im heutigen Sinne – als Ziffer, nicht als Platzhalter – zum ersten Mal irgendwann in den Anfangsjahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. In Europa tauchte sie erst im 12. Jahrhundert auf, zusammen mit den hindu-arabischen Ziffern, die wir heutzutage benutzen. Dagegen findet man die älteste verzeichnete Null in Amerika bereits auf einer Maya-Schnitzerei des Jahres 357 n. Chr., möglicherweise vor der ersten Aufzeichnung in Sanskrit. Und es gibt Monumente aus der Zeit vor der Geburt Christi, deren Inschriften zwar keine Nullen enthalten, doch Daten eines Kalendersystems, das auf der Existenz der Null beruhte.
Bedeutet dies, dass die Maya fortgeschrittener waren als ihre Zeitgenossen beispielsweise in Europa? Sozialwissenschaftler schrecken vor dieser Frage zurück, und das aus gutem Grund. Olmeken, Maya und andere mesoamerikanische Gesellschaften waren Weltpioniere in Mathematik und Astronomie, aber sie setzten das Rad nicht ein. Erstaunlicherweise hatten sie es erfunden, benutzten es jedoch ausschließlich für Kinderspielzeug. Wer nach kultureller Überlegenheit sucht, kann sie in der Null finden; wer nach Versagen sucht, findet es in der ausgebliebenen Nutzung des Rades. Allerdings ist keine der beiden Argumentationen hilfreich. Wesentlich ist, dass die Indianer ihre neolithischen Revolutionen um 1000 n. Chr. ausgedehnt und ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Zivilisationen überall in der Hemisphäre geschaffen hatten.
Fünfhundert Jahre später, als Kolumbus in die Karibik segelte, prallten die Nachkommen der neolithischen Revolutionen der Welt aufeinander – mit überwältigenden Folgen für alle.
Eine Reiseführung
Der Leser stelle sich einen Moment lang eine unmögliche Reise vor: Er startet wie ich mit einem Flugzeug in Ostbolivien, doch im Jahre 1000 n. Chr. und zu einer Beobachtungsmission über den Rest der westlichen Hemisphäre. Was wäre unter ihm zu sehen? Vor fünfzig Jahren hätten die meisten Historiker eine schlichte Antwort parat gehabt: zwei Kontinente voller Wildnis, bevölkert von vereinzelten Gruppen, deren Lebensweise sich seit der Eiszeit kaum verändert hatte. Die einzigen Ausnahmen wären Mexiko und Peru gewesen, wo sich die Maya und die Vorfahren der Inka langsam den Ausläufern der Zivilisation näherten.
Mittlerweile hat sich unsere Einschätzung in fast jeder Hinsicht gewandelt. Man male sich aus, wie das Jahrtausend-Flugzeug zurück nach Westen schwebt, vom Tiefland Benis bis zu den Höhen der Anden. Am Beginn der Reise fällt der Blick auf die Dammwege und Kanäle, die wir noch heute sehen – mit dem Unterschied, dass sie nun (also damals) in gutem Zustand und voller Menschen sind (noch vor fünfzig Jahren waren die Erdarbeiten sogar den Anwohnern kaum bekannt). Nach ein paar hundert Kilometern steigt das Flugzeug zu den Bergen empor, und wieder hat sich das historische Bild geändert. Bis vor kurzem herrschte bei Wissenschaftlern die Meinung vor, dass über das Hochland im Jahre 1000 n. Chr. ein paar Dörfchen und ein oder zwei Städte mit solidem Mauerwerk verstreut gewesen seien. Aber jüngere archäologische Ermittlungen haben enthüllt, dass es in den Anden damals zwei Bergstaaten gegeben hatte, die beide größer gewesen waren als angenommen.
Der Beni nächstgelegene Staat umschloss den 178 Kilometer langen Titicacasee, der sich über die Grenze zwischen Peru und Bolivien erstreckt. Der Großteil dieser Region liegt mindestens viertausend Meter hoch. Die Sommer sind kurz, die Winter entsprechend lang. «Es ist ein kaltes, karges Land», schrieb der Forschungsreisende Victor von Hagen, «wo wenig Mais wächst». Ihm erschien es als das letzte Gebiet, in dem man die Entwicklung einer Kultur hätte erwarten können.[44]