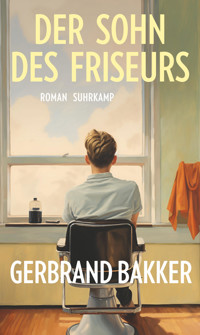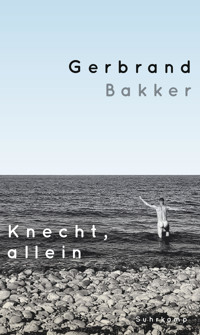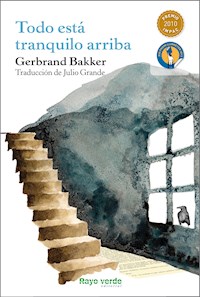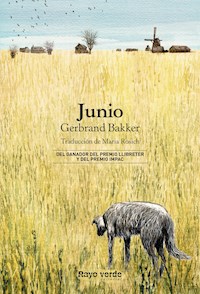8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es geht aufwärts mit der Welt. Endlich gibt es einen Tarifvertrag für die Strandesel von Blackpool. Nun warten wir noch auf kostenlose Physiotherapie für Störche und natürlich die Verteilung von Zeckenzangen an Schafe. Wenn wir all das haben, ist die Welt perfekt.« Gerbrand Bakker erzählt in "Komische Vögel" liebevoll, originell und witzig von allerlei Haus- und Nutztieren, von renitenten Wiederkäuern und anschmiegsamen Plagegeistern, von wundersamen Begegnungen und seltsamen Vorfällen und von Menschen, die im Umgang mit Tieren nicht immer die Überlegenen sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
»Es geht aufwärts mit der Welt. Endlich gibt es einen Tarifvertrag für die Strandesel von Blackpool. Nun warten wir noch auf kostenlose Physiotherapie für Störche mit verbogenen Schnäbeln (in den Niederlanden kommen pro Tag etwa fünfhundert Babys zur Welt) und natürlich die Verteilung von Zeckenzangen an Schafe. Wenn wir all das haben, ist die Welt perfekt.«
Gerbrand Bakker erzählt in Komische Vögel liebevoll, originell und witzig von allerlei Haus- und Nutztieren, von renitenten Wiederkäuern und anschmiegsamen Plagegeistern, von wundersamen Begegnungen und seltsamen Vorfällen und von Menschen, die im Umgang mit Tieren nicht immer die Überlegenen sind.
Gerbrand Bakker, 1962 in Wieringerwaard geboren, arbeitete nach dem Studium der niederländischen Sprach- und Literaturwissenschaft als Übersetzer von Filmuntertiteln und schloß eine Ausbildung zum Diplomgärtner ab. Sein Debütroman Oben ist es still (2008) wurde u.a. mit dem hochdotierten IMPAC Dublin Literary Award ausgezeichnet und in fast 20 Ländern veröffentlicht. Zuletzt erschienen die Romane Der Umweg (2012), Juni (2010) und Birnbäume blühen weiß
Gerbrand Bakker
Komische Vögel Tiertagebuch
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Die Originalausgabe erschien 2009 bei Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam,
unter dem Titel Ezel, schaap en tureluur. Dierendagboek.
Einige wenige Texte aus der niederländischen Ausgabe wurden nicht in
den vorliegenden Band aufgenommen, neue Texte sind hinzugekommen.
Umschlagfoto: Catherine Ledner
eBook Insel Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2012
© 2009 Gerbrand Bakker und Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Vertrieb durch den Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Umschlag: Michael Hagemann
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Komische Vögel
Der Sohn des Hüttenwirts
Jetzt weiß ich, wer du bist.
Einsames Schaf
das uns von weit oben
auf dem Bergpfad gehen sah
unbewegter Späher.
Abends hinktest du
deine gelben Augen tränten.
Und doch warst du edel, dort oben.
Edel und herzzerreißend schön.
Betsie, Trudie, Trijnie und Bert
März 1995
Am zweiten Tag habe ich ihnen Namen gegeben. Ich saß an dem großen hölzernen Eßtisch in unserem Ferienhauswohnzimmer in De Knipe und arbeitete – oder tat so, als ob. Ich hatte Aussicht über das flache Land. Wenn es nicht regnete oder neblig war, konnte ich in einiger Entfernung Langezwaag erkennen. Aber das Dorf war es nicht, was mich interessierte. Ich sah nur diese drolligen, dicken Wollknäuel, die mal munter, mal schwerfällig über das matschige Land stapften; erst vor ein paar Tagen hatte es getaut. Betsie hinkte. Beidseitig. Wenn sie sich von ihrem Ruheplatz (einem Durcheinander aus Holzabfall und zerbrochenen Asbestwellplatten) auf den Weg zum Silagehaufen machte, dauerte es mindestens zwanzig Wörter (ich war gerade dabei, Kramers Woordenboek zu einem Taschenwörterbuch auszudünnen), bis sie dort ankam. Die anderen fraßen dann schon, und sie versuchte sich zwischen sie zu drängen und zu zwängen, um mit dem Kopf in die Nähe des Futters zu kommen. Wenn sie im Nieselregen vorüberlahmte und der Wind noch stärker wurde, mußte ich mich abwenden. Der Anblick war zu schlimm.
Sobald die anderen mit Fressen fertig waren, trotteten sie zusammen fort, während Betsie noch lustlos weiterfraß. Ich konnte ihr ansehen, daß es ihr keinen Spaß mehr machte.
Trudie war ein durstiges Schaf. Sie war die einzige, die ihre Mahlzeit regelmäßig unterbrach, um zu einem Tümpel zu gehen und zu trinken. Sie trank lange und, wie ich sah, mit gierigen Schlucken. Deshalb habe ich sie Trudie genannt.
Trijnie war das Oberschaf. Sie hatte den kleinsten und schmalsten Kopf, und trotzdem war sie das Oberschaf. Sie demonstrierte ihre Macht besonders gern, indem sie auf den Silagehaufen kletterte und in dieser erhöhten Position große Happen Futter herauszerrte. Die anderen fanden das anscheinend normal. Sie wunderten sich nicht einmal, wenn Trijnie oben kackte und pinkelte. Es war, als gehöre sie dorthin. Sie und nur sie hatte das Recht, jeden Winter wieder auf der Silage zu stehen. Und stehenzubleiben.
Am dritten Tag fanden sie einen neuen Silagehaufen vor, mindestens einen Meter hoch. Trijnie kletterte flink auf das frische Futter und bekackte es sofort. Ich strich Wörter und blickte zwischendurch immer wieder auf. Ich wollte nichts verpassen. Um vier Minuten nach elf fiel Trijnie vom Haufen. Sie trat ungeschickt auf, schwankte einen Moment, schien sich noch fangen zu können, kullerte aber schließlich auf Betsie hinunter. Alle waren verblüfft. Zuerst schauten sie einander an, dann schauten alle Trijnie an. Trijnie blökte nicht, meckerte nicht, sondern drehte sich resolut um und stapfte ans andere Ende der Schafkoppel. Ich habe sie nicht mehr am Futterhaufen gesehen. Betsie ging von diesem Tag an noch lahmer als vorher.
Betsie war auch die einzige, die noch kein rotes Hinterteil hatte. Zu der kleinen neunköpfigen Schafherde gehörte ein Bock. Ein Bock mit Deckstempel unterm Bauch. Er hatte schon alle gehabt. Außer Betsie. Er war nicht nett, das sah ich gleich. Ein grantiges, launisches Schaf und ein Wichtigtuer. Einmal (ich glaube, es war am vierten Tag) ging ich zum Rauchen hinters Haus und von dort zu dem ausgetrockneten Graben, der das Grundstück von der Schafkoppel trennte. Der Bock (ich habe ihn Bert genannt, warum, weiß ich nicht genau) drehte sich um, starrte mich an und hörte erst auf zu starren, als ich meine Kippe austrat. Diese Sorte Schaf. Ein Schaf mit einem gewaltigen Dünkel. Deshalb hatte er natürlich Betsie noch nicht gedeckt, es wäre unter seinem Stand gewesen. Ein lahmes Schaf, nein, das deckt man einfach nicht.
Ganz anders ging es im Haus zu. Wenn ich den Kamin anzünden wollte, sagte V.: »Nein, erst eine Runde trainieren, jetzt sieht uns keiner.« Wenn er den Kamin anzünden wollte, sagte ich: »Bloß nicht, hier drin ist es zum Ersticken.« Wenn er ins Bett ging, blieb ich extra noch eine Weile auf. Wenn ich fünf Knoblauchzehen ins Essen tun wollte, sagte er: »Viel zu wenig, dann schmeckt es ja nach nichts.« Wenn er eine Prise scharfen Curry ins Essen tun wollte, lief ich demonstrativ niesend aus der Küche. Er las populäre Bücher über philosophische Themen und wüste brasilianische Pornographie. O Amor Natural hieß der Gedichtband. Pah, von wegen Liebe!
Aber dann kam der Sonntag abend, der Vorabend des zweitägigen Wettkampfs in der Thialf-Arena.[1] Bald würden grüppchenweise die Eislaufkumpel aus Amsterdam eintreffen und der Ruhe ein Ende bereiten. Es war der fünfte Tag. Trudie hatte wenig gegessen und hustete oft bellend. Sie trank dann ein bißchen Wasser aus dem Tümpel, wonach es ihr wieder etwas besserging. An diesem Tag hatte ich einmal ganz kurz Trijnie zu Gesicht bekommen. Es war klar und sonnig, und ich sah sie ziemlich weit entfernt, in Richtung Langezwaag, von dem Gras grasen, das noch gar nicht wuchs. Betsie hatte nach wie vor keinen roten Fleck auf ihrem breiten Hinterteil. Kramers Woordenboek war beim Buchstaben F aufgeschlagen, der Eintrag Fantasieblume stand kurz vor der Eliminierung. Eigentlich hatte ich schon beim K sein wollen.
Und da trudelten sie ein, das Ferienhaus verwandelte sich in ein Eisläuferlager, und der Herdentrieb wurde übermächtig. Als der erste sich setzte, setzten sich alle. Sobald sich einer einen Teller mit Essen holte, holten sich alle einen Teller mit Essen. Dann aßen alle Joghurt und Vla, und dann fingen alle an, ihre Schlittschuhe zu schleifen. Irgendwann sagte einer: »Also, ich geh jetzt schlafen.« Und was passierte? Genau, alle gingen schlafen!
Draußen war es stockdunkel, durch die beschlagene Scheibe war nichts zu erkennen (wenn einer dampfte, dampften alle), und ich konnte die Schafe, inzwischen so etwas wie Freundinnen, nur erahnen. Aber ich brauchte sie gar nicht zu sehen, um schafiges Verhalten beobachten zu können. Und an den nächsten beiden Tagen wurde es nur noch schlimmer. Auf einen Startschuß hin preschten sämtliche Eisschnelläufer los wie Lämmer, die zur Schlachtbank getrieben werden. Wie zahme Schafe drehten alle die gleichen Runden. Zugegeben, manche liefen schnellere Runden als andere, aber dann dachte ich an Betsie: Bewegte sie sich nicht auch langsamer als die übrigen? Und trotzdem kam sie ans Ziel. Manchmal legte jemand einen slapstickhaften Sturz hin, und dann dachte ich an Trijnie und mußte lächeln. Und wenn ein Mann gierig eine Flasche Isostar leerte, sah ich den Kopf von Trudie vor mir. Sobald einer seine Beinmuskeln dehnte, hoben alle ihre Fersen auf ein Mäuerchen. Alle tranken Kaffee, aßen Käsebrote und bewegten sich im Gänsemarsch durch die Wälder und Felder von Oranjewoud, nur nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad.
Dann kam Tag sieben, und plötzlich waren die Massen wieder fort (wenn einer abreist, reisen alle ab). Ich war ganz allein – ein schwarzes Schaf, ein räudiges Schaf, nein, eher ein verlorenes Schaf – und saß wie zuvor an dem großen hölzernen Eßtisch im Wohnzimmer. Es war still, und durch die kleinen Fensterscheiben fiel Sonnenlicht kariert ins Zimmer. Sehr viele zu streichende Wörter lagen vor mir, ich war immer noch nicht beim K angekommen. Ich schaute hinaus. Der Haufen Silage war bis zur matschigen Erde hinunter weggefressen. Nirgends war eins der weiblichen Schafe zu sehen. Bert lag dort, wo der Haufen gelegen hatte, und starrte mich mißmutig und beleidigt an. Er schien ein wenig kurzatmig zu sein, als wäre sein Deckgeschirr zu stramm angezogen. Ich muß weg, dachte ich, ich muß dringend weg.
Als ich mit Sack und Pack das Haus verließ, sah ich die Mutterschafe auf einem anderen Stück Land. Eins bewegte sich langsam in meine Richtung. Es ging lahm, ich erkannte Betsie sofort. Ich blieb stehen und wartete darauf, daß sie über den Damm kommen würde. Etwas an ihr war anders. Sie strahlte. Sie humpelte noch genauso wie sonst, und doch hatte sie einen irgendwie federnden Schritt. Einen selbstbewußten Gang. Während sie an mir vorbeiging, auf dem Weg zu dem weggefressenen Futterhaufen, blickte sie mich einen Moment an. Und so unglaublich es klingt: Sie lächelte. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich ein Schaf lächeln. Sie war auf dem Weg zum mürrischen Bert und wackelte triumphierend mit ihrem rotfleckigen Hinterteil.
Ach ja, dachte ich auf der Heimfahrt. Armer Bert. Wenn du eine deckst, mußt du alle decken.
Ein bißchen Lügen
Donnerstag, 25. März 2004
Ich schickte meinem kleinen Bruder eine E-Mail. Er solle sich einmal meine Website ansehen. Das tat er dann auch, zusammen mit seiner Frau und seinen beiden aufgeweckten Kindern. Und wie es in der Familie so ist: Sie fanden alles »sehr hübsch«, aber an einer Stelle hätte ich doch gelogen. Auf der Seite Biographie & Bücher hatten sie gelesen, mein Lieblingstier sei das Okapi.
»Ich dachte, die fiesen Stinkköter in Artis wären deine Lieblingstiere«, schrieb mein Bruder in seiner Antwortmail. »Die fandest du doch so niedlich.«
Damit liegt er nicht ganz falsch. Ich finde die Afrikanischen Wildhunde sehr niedlich, vor allem, wenn sie im Sand mit einer großen Plastikwanne spielen, bei über dreißig Grad Hitze. Außerdem mag ich ihren Geruch. Ein bißchen scharf und säuerlich; wer an ihrem Gehege vorbeigeht, zieht die Nase kraus, und dauernd hört man: »Boah, was stinken die!«
Aber daß man ein Tier liebt, macht es nicht automatisch zum Lieblingstier. Es gibt noch so viele andere Tiere, die ihre Vorzüge haben. Zum Beispiel das Okapi oder der Tapir. Haushunde. Kattas, Wasserschweine.
Aussterben vor der Kamera
Freitag, 26. März 2004
Der Beutelwolf oder Tasmanische Tiger (Thylacinus cynocephalus) war eine Art Quagga, nur in Hundeform. Von der Gestalt her ähnelte er dem Dingo, dem verwilderten Hund Australiens, war aber hellbraun und hatte dreizehn bis neunzehn schokoladefarbene Querstreifen auf dem Rücken. Ein typisch australisches Tier, denn das Weibchen besaß einen Beutel. Ursprünglich kam der Beutelwolf auch auf Neuguinea vor, wo er allerdings schon vor über dreitausend Jahren ausstarb. In Australien starb er ebenfalls aus, gegen den Dingo konnte er sich nicht behaupten. Seine letzte Zuflucht war die Insel Tasmanien. »War«, »besaß«, »ähnelte«. Der Beutelwolf ist nicht mehr.
Auf Tasmanien werden Schafe gehalten. Sie wurden eingeführt, gehören dort also gar nicht hin, genau wie Kaninchen und Schweine, alles Tiere ohne Beutel. Arglose Tiere, die sich leicht überrumpeln und fressen lassen. Der Beutelwolf verspeiste gern das eine oder andere Lämmlein, weshalb man auf seinen Kopf einen Preis aussetzte.
Ich kenne kein anderes Tier, das kurz vor seinem Aussterben gefilmt wurde. Aussterben geht entweder unbemerkt vor sich oder wird noch rechtzeitig registriert, worauf dann Rettungsmaßnahmen ergriffen werden. Nicht bei dem armen Beutelwolf. Das letzte Exemplar verstarb am 7. September 1936 im Zoo von Hobart, Tasmanien. Der Pfleger hatte vergessen, es vor der Mittagshitze einzuschließen. So erlag das Tier einem Hitzschlag. Der Beutelwolf war nachtaktiv.
Einmal habe ich eine Filmaufnahme von dem letzten Beutelwolf gesehen; sie war Teil eines Naturfilms, den ich untertiteln sollte. Schwarzweiß, staubige Sträucher, Gitter und Beton, Einsamkeit. Das Männchen wurde Benjamin genannt. Und man konnte einfach nichts mehr tun: Nur noch dieses eine Exemplar war übrig, nirgendwo mehr eine Partnerin zu finden. Es flitzte ständig hin und her, unruhig, gehetzt. Gereizt, das ist das richtige Wort. Als hätte das Tier geahnt, daß es vielleicht das letzte seiner Art war, und nicht verstanden, warum diese Männer in Anzügen rund um sein Gehege – die der Filmer extra zusammengetrommelt zu haben schien – es nicht in die Berge brachten und dort freiließen, damit es nach einem Weibchen suchen konnte, also wenigstens noch eine Chance hatte. Dieser Film war einer der schlimmsten, die ich je sehen mußte.
Rothunde schießen
Freitag, 2. April 2004
Zeitungen wollen gefüllt sein, jeden Tag. Aber wer für eine Zeitung schreibt, lebt für den Moment: Morgen ist, was heute war, schon wieder vergessen. Deshalb findet man als Leser manchmal keinen Follow-up-Bericht (um einen dieser englischen Jargon-Ausdrücke zu gebrauchen) über Ereignisse, die einen berühren. Leser haben ja genug Zeit, sich an gestern und vorgestern zu erinnern. Glücklicherweise hat meine Zeitung den Rothunden oder Asiatischen Wildhunden ausführliche Fortsetzungsberichte gewidmet. Vorige Woche wurde der Ausbruch des gesamten einundzwanzigköpfigen Rudels aus dem Safaripark Beekse Bergen gemeldet. Einige hatte man betäuben und einfangen können, einige waren noch verschwunden und einige abgeschossen worden. Punkt. Gestern (oder vorgestern) folgte ein zweiter Bericht mit etwas genaueren Zahlen, und heute, auf Seite 20, das vorläufige Fazit: acht Hunde am Leben, zwanzig erschossen und einer verschwunden (also müssen es insgesamt neunundzwanzig und nicht einundzwanzig Tiere gewesen sein). Alphaweibchen Vera lebt noch. Wolf (Nummer zwei in der Rangfolge) und Spot nicht mehr.
Der Redakteur verspricht uns auf jeden Fall noch einen Bericht. Ist Schiefohr jetzt auch tot? Diese Frage, aus dem Mund eines Mädchens, wird im Artikel nämlich nicht beantwortet. Und was wird aus dem einen einsam streunenden Rothund werden? Er oder sie hat schon eine Woche lang nichts mehr gefressen, sagt ein Mitarbeiter des Safariparks. Ich glaube, da kennt er seine Rothunde schlecht. Und ob das Tier gefressen hat. Fortsetzung folgt also.
Ein Zebra war gestorben
Freitag, 9. April 2004
Anders als der Tasmanische Tiger starb das Quagga aus, ohne daß sein Verschwinden von den Medien registriert wurde. Ein Zebra war gestorben, na und? Erst lange nach dem Tod der Stute im Jahr 1883 wurde ihren früheren Artis-Pflegern und dem Rest der Welt bewußt, daß sie das letzte Exemplar gewesen war. Das hing auch mit dem Namen der Art zusammen. Quagga ist ein lautmalerisches Wort, das den Schrei des Zebras wiedergibt (er erinnert ein wenig an Esel), und die Khoisan im südlichen Afrika nannten und nennen alle Zebraarten Quagga. In neuerer Zeit erhielt die ausgestorbene Form die wissenschaftliche Bezeichnung Equus quagga quagga.
Während der sechzehn Jahre, die das letzte Quagga in Amsterdam verbrachte, wurde der Rest der wilden Quaggas in Südafrika abgeschlachtet. Denn dort hatten sich Weiße angesiedelt, und die hatten Schafe, Ziegen und Rinder eingeführt, die Gras fressen wollten; dabei waren die lästigen Zebras im Weg. Außerdem reisten reiche Weiße in das Jägerparadies Südafrika. Sowohl die Kolonisten als auch die Ballertouristen schossen »Quaggas«, das heißt alle Arten von Zebras, und so wurde, ohne daß man sich darüber im klaren war, das eigentliche Quagga ausgerottet.
Vor etwa anderthalb Jahrzehnten haben DNS-Analysen ergeben, daß das Quagga eine Unterart des Steppenzebras (Equus quagga) war und sich von ihm eigentlich nur in der Fellfarbe und der Verteilung der Streifen unterschied, die beim Quagga auf Kopf und Hals beschränkt waren. In Südafrika wird gerade ein Rückzüchtungsversuch unternommen: Steppenzebras mit bräunlichem Fell und reduziertem Streifenmuster werden gekreuzt, um eine neue Linie mit zunehmender Braunfärbung und immer weniger Streifen hervorzubringen. Etienne (geboren am 14. Oktober 1998) sieht einem Quagga schon ziemlich ähnlich: elf Streifen.
Über Sterbehilfe und Zecken
Donnerstag, 27. Mai 2004
Wenn man morgens Zeitung liest, und das tue ich, kann es passieren, daß die ersten Überschriften und Sätze den noch schlaftrunkenen Kopf überfordern. Zum Beispiel heute morgen, als ich folgendes las: Die Anzahl der gemeldeten Sterbehilfefälle ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Ross äußerte sich besorgt über diese Entwicklung.
Was? dachte ich – ich hatte gerade einen Bissen Brot mit Himbeermarmelade und eine Doxycyclin-Tablette gegen Lyme-Borreliose im Mund –, will sie denn mehr Sterbehilfe? Weil sie glaubt, daß man den Kostenanstieg im Gesundheitswesen sonst nicht in den Griff bekommt? Nach der Hälfte des Artikels wurde mir klar, daß es um die Zahl der Meldungen und nicht um die Zahl der Fälle ging. War die Formulierung unglücklich gewählt, oder war ich einfach noch nicht wach genug?
Die Tablette habe ich natürlich nicht zufällig erwähnt. Das Medikament ist teuer, wird aber von der Krankenkasse bezahlt. Soviel Geld wegen einer Zecke. Genauer gesagt, einer dänischen Zecke. Die gehören zu den tückischen, die lebensgefährliche Krankheiten übertragen können. Ich habe der Zecke beim Sterben geholfen. Ich habe sie mit einer Pinzette platt- und hoffentlich totgedrückt, samt Kopf mit einer Drehbewegung aus meiner Kniekehle gezogen und an eine zufällig vorbeikommende Katze verfüttert.
Posthum hat sie Rache geübt. Weil man natürlich niemandem beim Sterben helfen kann, ohne daß er den Willen dazu geäußert hat. Sonst spricht man nicht von Sterbehilfe, sondern von Mord, oder zumindest Totschlag.
Schaf auf dem Rücken
Donnerstag, 5. August 2004
Die Zeitung hatte offenbar über Problemschafe in Yorkshire berichtet; ich mußte es überlesen haben. Es ging darum, daß Weideroste als Sperre nicht mehr ausreichten, weil die Schafe sich angeblich hinüberrollten. Heute ein Leserbrief von jemandem, der dieses Verhalten schon 1973 beobachtet haben will; für ihn war die Sache kalter Kaffee.
Ich versuche es mir vorzustellen: Schafe, die rollend einen Weiderost überqueren. Rollen sie kopfüber oder seitlich? Dabei weiß ich, daß ein Schaf, wenn es einmal auf dem Rücken gelandet ist, aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine kommt. Aber vielleicht gilt das nur für holländische Schafe. Vielleicht sind Yorkshire-Schafe anders gebaut.
Wenn nicht, funktioniert es wahrscheinlich so: Zehn Schafe rollen sich hintereinander auf den Rost, bleiben auf dem Rücken liegen, und der Rest der Herde zieht über die Bäuche der Liegenden auf die grünere Weide. Die zehn, die sich geopfert haben, sterben.
Soll ich nun einen Leserbrief schreiben oder die Sache auf sich beruhen lassen?
Pferd auf dem Rücken
Samstag, 7. August 2004
Fast immer, wenn man überlegt, ob man einen Leserbrief schreiben soll oder lieber nicht, erledigt sich die Sache dadurch, daß jemand anders es tut. Die Meldung über die rollenden Schafe wird von einem Leser aus Arnheim als moderne Legende abgetan. Es seien Pferde, die sich so verhielten. Und nicht in Yorkshire, sondern im New Forest, einem Nationalpark in Südengland. Und auch das sei Unsinn und frei erfunden, eine typische Sommerlochmeldung. Ziemlich verwirrend, dieser Brief.
Wie auch immer und überhaupt: Kein Säugetier kann sich rollend oder wälzend über einen Weiderost bewegen. (Außer Menschen, allerdings überquere ich Weideroste meistens aufrecht gehend.)
Ein Pferd
Freitag, 27. August 2004
Eines zumindest haben Reiter (ob Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder moderner Fünfkampf) allen Sportlern ohne Pferd voraus: das Pferd. Wenn man die 110 Meter Hürden vermasselt, ist man ungeheuer einsam und allein und traurig. Ich kenne dieses Gefühl: Einmal, in einem meiner besten Eisschnellaufjahre, war ich so gut in Form, daß die phantastischsten persönlichen Rekorde zu erwarten waren. Meinten die anderen. Tja, bei den Wettkämpfen brachte ich dann nichts anderes zustande als Stürze. Nächtelang war mir hundeelend zumute. Dieses Niveau erreichst du nie wieder, denkt man dann. Oder: Noch so eine Chance bekommst du nicht. Dabei war mein Niveau alles andere als großartig, trotzdem reagierte ich so heftig. Bei den Olympischen Spielen zu verlieren muß also schrecklich sein, wirklich grauenvoll.
Wenn man aber auf einem Pferderücken verliert, ist man wenigstens nicht allein. Schon das Klopfen auf den Pferde