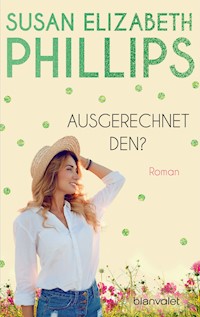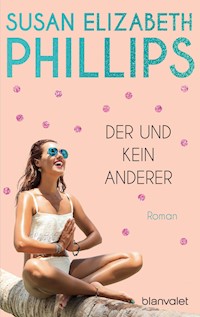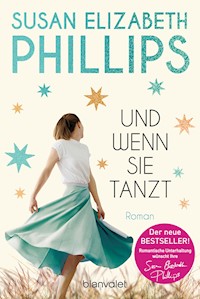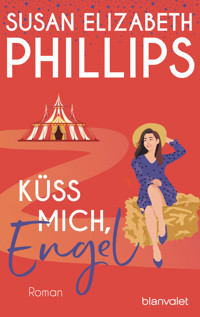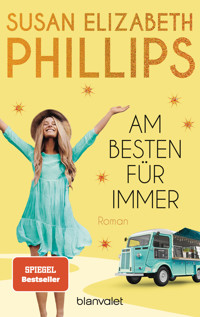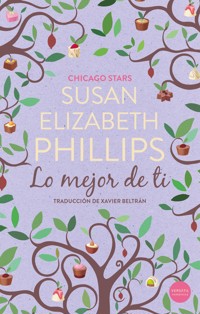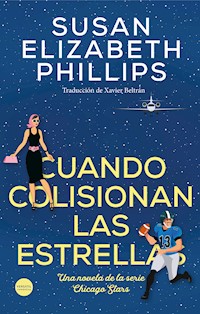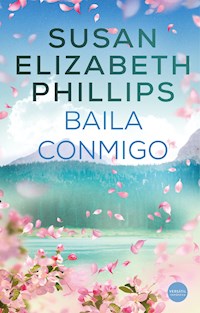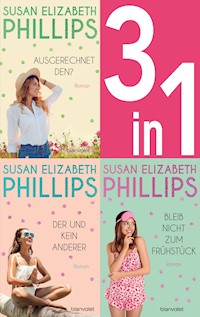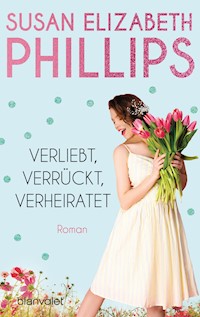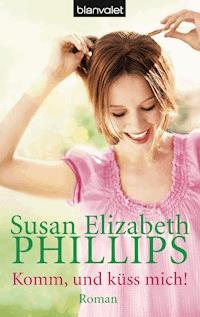
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wynette-Texas-Romane
- Sprache: Deutsch
Sie passen so gut zusammen wie Kaviar und Bier, wie Benzin und ein brennendes Streichholz. Und trotzdem verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander: die britische Lady Francesca Day und Dallie Beaudine, der amerikanische Sportler. Es wird eine heiße, stürmische – und kurze – Liebesbeziehung. Aber als sie einander wiederbegegnen, beginnt das aufregendste Abenteuer ihres Lebens …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Vor wenigen Monaten hat die junge Britin Francesca Day noch Champagner getrunken. Jetzt steht sie mitten in Texas allein auf einer staubigen Landstraße – mit nichts anderem bewaffnet außer einem Koffer voller Designerklamotten und ihrem guten Aussehen. In der Not hat eine Frau wenig Auswahl: Widerwillig nimmt sie das Angebot von Dallie Beaudine an, sie ein Stück des Weges mitzunehmen. Der Mann ist zwar ganz attraktiv, aber ein ungehobelter Amerikaner und treibt sie innerhalb der ersten fünf Minuten auf die Palme. Dallie Beaudine liebt genau drei Dinge in seinem Leben: den Golfsport, ein kühles Bier in der Kneipe und eine heiße Frau in seinen Armen. Hätte er gewusst, welcher Ärger ihn erwartet, er hätte niemals diese eiskalte britische Lady in ihrem hässlichen rosa Ballkleid aufgesammelt. Das hat man nun von seinem weichen Herzen: nichts als spitze Bemerkungen.
Sie passen so gut zusammen wie Kaviar und Bier, wie Benzin und ein brennendes Streichholz. Und trotzdem verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander. Es wird eine heiße, stürmische – und kurze – Liebesbeziehung. Danach ist für Francesca und Dallie nichts in ihrem Leben mehr so, wie es war. Bis sie einander Jahre später erneut begegnen. Noch immer brennt das Feuer, doch jetzt haben beide ein Geheimnis …
Autorin
Susan Elizabeth Phillips’ Romane erobern jedes Mal auf Anhieb die Bestsellerlisten in den USA und Deutschland. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in der Nähe von Chicago.
Inhaltsverzeichnis
Für meine Eltern
»Kommet her zu mir, ihr Heimatlosen, Sturmverwehten, kommt alle her …«
Emma Lazarus
Prolog
»So ein Zobel ist ganz schön lästig«, flüsterte Francesca Serritella Day kaum hörbar, als das Blitzlichtgewitter über sie hereinbrach. Sie vergrub ihr Gesicht noch tiefer im hochgeschlagenen Kragen ihres russischen Fellmantels. Wenn es doch wenigstens Tag wäre! Dann hätte sie sich hinter einer Sonnenbrille verstecken können …
»Diese Meinung dürfte wohl kaum jemand mit dir teilen, Darling«, erwiderte Prinz Stefan Marko Brancuzi. Energisch nahm er ihren Arm und bahnte sich einen Weg durch die Menge der Klatschreporter, die sich vor dem New Yorker »La Côte Basque« postiert hatte, um die prominenten Gäste zu fotografieren. Stefan Brancuzi war der regierende Fürst einer kleinen Balkanmonarchie, die dem überfüllten Monaco mehr und mehr den Rang als Steuerparadies der schwer gebeutelten Reichen abzulaufen drohte. Aber nicht der Prinz stand bei den Fotografen im Mittelpunkt des Interesses. Die schöne Engländerin an seiner Seite zog die Aufmerksamkeit auf sich – nicht nur hier, sondern auch bei einem großen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit.
Während Stefan sie zu einer wartenden Limousine führte, hob Francesca in einer hilflosen Geste ihre behandschuhte Hand, aber auch so konnte sie die Flut von Fragen, die sie überrollte, nicht eindämmen – Fragen nach ihrer Arbeit, ihrer Beziehung zu Stefan, sogar nach ihrer Freundschaft mit dem Star der beliebten Fernsehserie »China-Colt«. Als sie und Stefan endlich in den weichen Ledersitzen saßen und der Wagen sich in den Samstagnachmittagverkehr auf der 55. Straße der Eastside eingefädelt hatte, gab sie einen Stoßseufzer von sich. »Dieser ganze Rummel dreht sich nur um meinen Mantel. Dich bedrängt die Presse nicht so. Hätte ich bloß meinen alten Regenmantel angezogen, dann wären wir unbemerkt durchgeschlüpft!«
Stefan betrachtete sie amüsiert. Sie runzelte vorwurfsvoll die Stirn. »Und die Moral von der Geschichte …«
»Na?«
»Angesichts des Hungers in der Welt verdienen Frauen, die einen Zobel tragen, was sie bekommen!«
Er lachte. »Du wärst aufgefallen, ganz gleich, was du getragen hättest. Ich habe schon miterlebt, wie du in einem Jogginganzug den Verkehr zum Erliegen gebracht hast!«
»Ich kann nichts dafür«, entgegnete sie unwirsch, »es liegt mir im Blut: Das ist der Fluch der Serritellas.«
»Also wirklich, Francesca, ich habe noch nie eine Frau gekannt, der ihre eigene Schönheit so verhaßt war wie dir!«
Sie murmelte etwas, das er nicht verstand, und vergrub ihre Hände tief in den Manteltaschen, wie gewöhnlich völlig unberührt von jeglicher Anspielung auf ihre strahlende Schönheit. Nach einer längeren Pause brach sie das Schweigen. »Vom Tag meiner Geburt an hat mir mein Gesicht nichts als Ärger eingebracht.«
Gar nicht zu reden von deinem wunderbaren Körper, dachte Stefan, aber das behielt er für sich. Während Francesca geistesabwesend aus dem getönten Fenster hinaussah, musterte er verstohlen ihre bezaubernden Gesichtszüge, die schon so viele in ihren Bann geschlagen hatten. Er erinnerte sich an die Worte eines bekannten Modeschöpfers, der unter bewußter Vermeidung sämtlicher Vivien-Leigh-Klischees, die Francesca im Lauf der Jahre angehängt worden waren, über sie geschrieben hatte: »Das kastanienbraune Haar, das ovale Gesicht und die grünen Augen verleihen Francesca Day das Aussehen einer Märchenprinzessin, die ihre Nachmittage damit verbringt, vor ihrem Bilderbuchschloß Flachs zu Gold zu spinnen.«
In privater Runde hatte sich der Moderedakteur weniger schwärmerisch geäußert: »Ob Francesca Day manchmal auch ein dringendes menschliches Bedürfnis hat? Bei der kann ich’s mir kaum vorstellen …«
Stefan zeigte auf die seitlich eingebaute Bar aus Walnuß und Mahagoni. »Möchtest du einen Drink?«
»Nein, danke. Ich glaube, mehr Alkohol kann ich heute nicht vertragen.« Sie hatte schlecht geschlafen, und ihr britischer Akzent war stärker als sonst. Der Mantel war vorn aufgeschlagen, sie sah auf ihr Armani-Kleid hinunter. Das Kleid von Armani, der Pelz von Fendi … Schuhe von Mario Valentino. Sie schloß die Augen, erinnerte sich plötzlich an jenen heißen Herbstnachmittag damals in Texas. Sie hatte im Straßendreck gelegen, ein Paar schmutzige Jeans am Leib und fünfundzwanzig Cent in der Tasche. Damit hatte alles angefangen – daß sie völlig am Ende war.
Der Wagen bog in die Fifth Avenue ein, und ihre Erinnerungen trugen sie noch weiter zurück in die Jahre ihrer Kindheit in England. Damals hatte sie nicht einmal geahnt, daß Texas existierte. Was war sie bloß für ein verzogenes kleines Monster gewesen! Chloe, ihre Mutter, hatte sie nach Strich und Faden verwöhnt, sie von einem Schickeria-Treff zum nächsten, zu sämtlichen Partys quer durch Europa geschleppt. Schon als Kind war sie unbeschreiblich arrogant gewesen – felsenfest davon überzeugt, daß ihre Schönheit Tür und Tor öffnen und es überall rote Rosen für sie regnen würde. Die kleine Francesca – ein eitles, hilfloses Geschöpf, völlig unvorbereitet auf das, was das Leben für sie bereithielt.
Einundzwanzig war sie, im Jahr 1976, als sie buchstäblich im Straßenstaub lag, unverheiratet, allein und schwanger …
Jetzt war sie fast zweiunddreißig, und obwohl sie sich alle materiellen Wünsche erfüllen konnte, fühlte sie sich genauso allein wie damals an jenem heißen Herbsttag. Sie kniff die Augen zusammen, versuchte sich vorzustellen, wie wohl ihr Leben aussähe, wenn sie in England geblieben wäre. Doch Amerika hatte sie so grundlegend verändert, daß ihr der Versuch mißlang.
Sie lächelte unwillkürlich. Emma Lazarus hatte bei ihrem Gedicht von den »eingepferchten Massen, die nach Freiheit streben«, wohl kaum an ein eitles junges Ding aus England gedacht, das im Kaschmirpullover und mit einem Louis-Vuitton-Koffer amerikanischen Boden betrat. Aber die armen reichen kleinen Mädchen hatten auch ihre Träume, und der amerikanische Traum war auch für Francesca wahr geworden.
Stefan spürte, daß irgend etwas Francesca beschäftigte. Den ganzen Abend schon war sie ungewöhnlich still, gar nicht so wie sonst. Eigentlich wollte er ihr heute abend einen Heiratsantrag machen, aber offensichtlich mußte er damit noch ein bißchen warten. Sie war so ganz anders als andere Frauen seiner Bekanntschaft, ihre Reaktionen waren nie vorherzusehen. Er hegte den Verdacht, daß Dutzende anderer Männer, die sich vor ihm in Francesca verliebt hatten, vor demselben Problem gestanden hatten.
Das Gerücht lief um, Francescas erste wichtige Eroberung hätte sie im zarten Alter von neun Jahren gemacht, an Bord der Jacht Christina. Das Opfer sollte Aristoteles Onassis gewesen sein.
Gerüchte … es gab so viele um Francesca, die meisten konnten unmöglich zutreffen … oder vielleicht doch? Bei dem Lebensstil? Einmal hatte sie Stefan gegenüber so en passant erwähnt, daß Winston Churchill ihr Rommé beigebracht und Prinz Charles zu ihren Verehrern gezählt hätte. Kurz nachdem Stefan sie kennengelernt hatte, saßen sie einmal beim Champagner zusammen und tauschten Anekdoten über ihre Kindheit aus.
»Die meisten Babys werden in Liebe empfangen«, hatte sie ihm erzählt, »bei mir war es anders. Ich bin auf dem Laufsteg in Harrods’ Pelzsalon gezeugt worden.«
Die alte Welt
1
Als man Francesca zum ersten Mal ihrer Mutter, Chloe Serritella Day, in den Arm legte, brach diese in Tränen aus. Sie behauptete, die Schwestern in der Londoner Privatklinik hätten ihr Baby vertauscht. Jeder Schwachkopf müßte auf den ersten Blick erkennen, daß so ein häßliches kleines Geschöpf unmöglich aus ihrem makellosen Körper kommen konnte.
Da kein Ehemann zur Hand war, der die hysterische Chloe hätte trösten können, hatten die Schwestern ihre liebe Mühe mit ihr. Sie versicherten, daß die meisten Neugeborenen in den ersten Tagen alles andere als gut aussehen. Chloe verlangte von ihnen, das häßliche kleine Kuckucksei fortzuschaffen und ihr schleunigst ihr eigenes süßes Baby zu bringen. Dann schminkte sie sich und empfing ihre Besucher – das waren unter anderem ein französischer Filmstar, der britische Innenminister und Salvador Dalí. Sie bekamen eine tränenreiche Schilderung der entsetzlichen Tragödie zu hören, deren Opfer Chloe angeblich geworden war. Die Besucher, seit langem an die dramatischen Auftritte der schönen Chloe gewöhnt, streichelten ihr die Hand und versprachen, der Sache auf den Grund zu gehen. Dalí, in einem Anfall von Großherzigkeit, verkündete, er werde eine surrealistische Version des Kindes malen und sie ihm zur Taufe schenken. Glücklicherweise verlor er das Interesse an dem Projekt und schickte statt dessen ein Set vergoldeter Kelche.
Eine Woche ging dahin. An ihrem Entlassungstag kleidete sich Chloe in ein loses schwarzes Gewand von Balmain mit breitem Organdykragen und ebensolchen Manschetten. Danach führten die Schwestern sie zu einem Rollstuhl und legten ihr das verstoßene Kindlein in den Arm. Nun hatte sich dessen äußere Erscheinung in der Zwischenzeit nicht wesentlich verbessert, aber als Chloe das kleine Bündel in ihrem Arm sah, erlebte sie einen für sie typischen blitzschnellen Stimmungsumschwung. Sie schaute in das fleckige Gesicht und verkündete vor Gott und der Welt, auch in der dritten Generation sei die Schönheit der Serritellas gesichert. Niemand war so taktlos zu widersprechen, was sich später auch als gut herausstellte. Innerhalb von wenigen Monaten sollte sich Chloes Prophezeiung erfüllen.
Chloes Empfindlichkeit, was weibliche Schönheit betraf, wurzelte in ihrer eigenen Kindheit. Als kleines Mädchen war sie ein richtiger Pummel gewesen, mit einem unübersehbaren Speckring um die Taille und ein paar Pausbäckchen, die die Konturen ihrer feinen Gesichtszüge nicht zur Geltung kommen ließen. In den Augen der anderen galt sie zwar nicht als unförmig; aber rundlich, wie sie einmal war, fühlte sie sich durch und durch häßlich, besonders im Kontrast zu ihrer mondänen, modisch-eleganten Mutter, Nita Serritella. Sie war Italienerin von Geburt und eine der ganz Großen in der Welt der Haute Couture. Erst 1947, als Chloe schon zwölf war, sagten alle, sie sei schön.
Sie hatte mehr Zeit in Schweizer Internaten zugebracht, als für ein Kind gut war. Im Sommer 1947 verbrachte sie ein paar Ferientage zu Hause. Sie drückte sich möglichst unauffällig in dem eleganten Salon ihrer Mutter herum, der in der Rue de la Paix gelegen war. Voller Neid und Widerwillen beobachtete sie Nita, gertenschlank im schlichten schwarzen Kostüm mit übergroßem himbeerfarbenem Satinrevers, die sich mit einer elegant gekleideten Kundin unterhielt. Ihre Mutter trug das blauschwarze Haar kurz und gerade geschnitten. Es fiel ihr in einer großen Welle über die linke Hälfte ihres blassen Gesichts. Den überlangen Hals, der einem Gemälde von Modigliani nachempfunden schien, zierten mehrere Reihen ebenmäßiger schwarzer Perlen. Diese Perlenkette und noch eine Reihe anderer Schmuckstücke, die sie in einem kleinen Wandsafe im Schlafzimmer aufbewahrte, waren Geschenke ihrer Bewunderer – international erfolgreicher Männer, die mit dem größten Vergnügen einer Frau Juwelen zu Füßen legten, die sie sich ebensogut aus eigenem Vermögen hätte kaufen können. Einer davon war Chloes Vater, obwohl Nita behauptete, sich nicht zu entsinnen, wer es war. Und natürlich hatte sie keinen Augenblick an Heirat gedacht.
Die attraktive Blondine, der Nitas ganze Aufmerksamkeit galt, sprach spanisch. Gemessen an dem Interesse der Weltöffentlichkeit, das diese Stimme in jenem Sommer des Jahres 1947 auf sich zog, klang sie reichlich vulgär. Chloe verfolgte das Gespräch nur mit halbem Ohr, nebenbei sah sie den superschlanken Mannequins zu, die Nitas neueste Modelle vorführten. Warum war sie nicht so dünn und selbstbewußt wie diese Mannequins? Warum war sie nicht so wie ihre Mutter? Sie hatte doch die gleichen grünen Augen, das gleiche schwarze Haar. Wenn ich doch schön wäre! dachte Chloe. Dann würde die Mutter sie nicht mehr verabscheuen. Wohl an die hundertmal hatte sie sich geschworen, weniger zu essen, und genausooft hatte sie mangels Willenskraft resigniert. Neben Nitas überragendem Durchsetzungsvermögen fühlte sich Chloe wie ein schwankendes Rohr im Wind.
Die Blondine schaute plötzlich von einer Zeichnung auf und ließ die wäßrigen braunen Augen auf Chloe ruhen. In ihrem seltsam harten Spanisch sagte sie: »Die Kleine wird noch eine wahre Schönheit. Sie sieht Ihnen sehr ähnlich.«
Mit kaum verhohlener Geringschätzung sah Nita zu Chloe hinüber. »Ich sehe nicht die geringste Ähnlichkeit, Señora. Und solange sie nicht lernt, ihr Eßbesteck einmal wegzuschieben, wird es nichts mit der Schönheit!«
Nitas Kundin hob eine Hand, schwer beladen mit protzigen Ringen, und winkte Chloe heran. »Komm, querida, gib Evita einen Kuß!«
Chloe reagierte nicht spontan, sie dachte über das Gesagte nach. Dann erhob sie sich zögernd von ihrem Stuhl und durchquerte den Salon. Sie schämte sich ihrer strammen Waden, die unter dem Saum ihres Sommerkleides hervorsahen. Sie beugte sich über die Frau und drückte einen schüchternen, aber dankbaren Kuß auf die leicht parfümierte Wange der Evita Perón.
»Faschistenhexe!« zischte Nita Serritella, als die First Lady von Argentinien zur Tür hinaus war. Sie steckte sich die Zigarettenspitze zwischen die Lippen und riß sie sofort wieder aus dem Mund. Ein dunkelroter Abdruck blieb auf der Ebenholzspitze zurück. »Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich die anfasse! Jedes Kind weiß, daß Perón und Konsorten allen europäischen Nazis Unterschlupf gewähren.«
Die Erinnerung an die deutsche Besetzung von Paris war noch frisch. Nita verachtete alle Kollaborateure aus tiefstem Herzen. Trotzdem war sie natürlich pragmatisch genug, Eva Peróns Geld – egal wie schmutzig es sein mochte – nicht in die Avenue Montaigne fließen zu lassen, wo Dior residierte.
Nach diesem Vorfall sammelte Chloe Zeitungsausschnitte mit Fotos von Eva Perón und klebte sie in ein rotes Album. Immer wenn Nita sie fortan aufs schärfste kritisierte, tröstete sie sich mit dem Album und dachte daran, was Eva Perón prophezeit hatte.
In ihrem vierzehnten Lebensjahr verschwanden auf wunderbare Weise der Babyspeck und der starke Drang nach Süßigkeiten. Jetzt kam das legendäre Serritella-Gesicht zum Vorschein. Stundenlang betrachtete Chloe sich im Spiegel, entzückt von ihrem gertenschlanken Spiegelbild. Jetzt wird alles anders, dachte sie. In der Schule hatte sie sich immer als Außenseiterin gefühlt, jetzt gehörte sie plötzlich dazu. Es war ihr nicht bewußt, daß sie die anderen Mädchen eher durch das neugewonnene Selbstwertgefühl als durch die schlanke Taille anzog. Für Chloe war Schönheit mit Akzeptanz gleichzusetzen.
Nita schien sich über die Gewichtsabnahme zu freuen. Als Chloe in den Sommerferien in Paris war, brachte sie endlich den Mut auf, ihrer Mutter ein paar Kleiderentwürfe zu zeigen. Sie hoffte, eines Tages auch Modeschöpferin zu werden. Nita breitete die Blätter auf ihrem Arbeitstisch aus, zündete sich eine Zigarette an und sezierte jede einzelne Zeichnung mit dem kritischen Blick der Designerin.
»Diese Linie hier ist einfach lächerlich. Und hier stimmen die Proportionen nicht. Hier hast du alles durch zu viele Details verdorben. Hast du denn gar kein Auge dafür, Chloe?«
Chloe grapschte nach den Zeichnungen und versuchte sich nie wieder im Entwerfen.
In der Schule setzte Chloe alles daran, ihre Klassenkameradinnen zu übertrumpfen – in Aussehen, Intelligenz und Beliebtheit. Niemand sollte wissen, daß tief drinnen immer noch das linkische, dicke Mädchen steckte. Sie lernte, die nebensächlichsten Dinge zu dramatisieren, und entwickelte einen übertriebenen Hang zur Theatralik.
Mit sechzehn verlor sie ihre Unschuld an den Bruder einer Freundin in einem Aussichtsturm am Luzerner See. Es war ein unangenehmes Erlebnis, aber da sie Sex mit Schlanksein verband, wollte sie es so bald wie möglich mit einem erfahrenen Partner wiederholen.
Im Frühjahr 1953, Chloe war achtzehn, starb Nita ganz überraschend an einem Blinddarmdurchbruch. Schweigend, wie betäubt, durchlebte Chloe die Beerdigung ihrer Mutter, zu benommen, um zu begreifen, daß die Heftigkeit ihres Kummers nicht so sehr von der Tatsache herrührte, daß ihre Mutter tot war, als vielmehr von dem Gefühl, nie eine Mutter besessen zu haben. Aus Angst vor dem Alleinsein stolperte sie in das Bett eines wohlhabenden polnischen Grafen, der bedeutend älter war. Vorübergehend konnte er ihr Geborgenheit bieten. Sechs Monate später gelang es ihr mit seiner Hilfe, Nitas Salon für einen wahnsinnig hohen Betrag loszuschlagen.
Schließlich kehrte der Graf zu seiner Frau zurück, und Chloe machte sich daran, von ihrem Erbe zu leben. Jung, reich und unabhängig, zog sie schon bald die jungen Müßiggänger an, die sich wie goldene Fäden durch das Gewebe der internationalen High-Society schlangen. Sie sammelte die Männer, experimentierte mal hier, mal da und suchte doch nach der bedingungslosen Liebe, die ihre Mutter ihr nie gegeben hatte, nach dem Mann, der das unglückliche dicke Kind in ihr zum Schweigen bringen würde.
Jonathan »Black Jack« Day trat in ihr Leben. Sie begegneten sich am Roulettetisch eines Clubs am Berkely Square. Der Spitzname »Black Jack« war nicht auf sein Aussehen, sondern auf seine Spielleidenschaft gemünzt. Mit fünfundzwanzig hatte er bereits drei Hochleistungs-Sportwagen zu Schrott gefahren und noch weitaus mehr Frauenherzen gebrochen. Ein sündhaft schöner amerikanischer Playboy aus Chicago war er, die kastanienbraune Mähne hing ihm wild ins Gesicht. Und er hatte noch zwei weitere Pluspunkte aufzuweisen: einen verwegenen Schnurrbart und ein Handicap von sieben Toren im Polo. In vielerlei Hinsicht unterschied er sich nicht von den anderen vergnügungssüchtigen jungen Männern, mit denen Chloe sich umgab; er trank Gin, trug erstklassige Maßanzüge und suchte regelmäßig neue Jagdgründe. Doch den anderen Männern fehlte Jack Days leichtsinnige Ader, er konnte alles auf eine Karte setzen – selbst sein ererbtes Vermögen setzte er unbekümmert aufs Spiel, wenn das Rad sich drehte.
Chloe fühlte seinen Blick über den Tisch hinweg, während sie der kleinen Elfenbeinkugel zusah, wie sie von Rot auf Schwarz und wieder zurücksprang, um schließlich auf der schwarzen Siebzehn ruhen zu bleiben. Ihre Augen trafen sich. Er lächelte, wohl wissend, daß sie heute besonders gut aussah. Sie trug eine Kombination aus Satin und Tüll von Jacques Fath. Das Silbergrau des Materials brachte ihr dunkles Haar, ihre blasse Haut und ihre tiefgründigen grünen Augen sehr vorteilhaft zur Geltung. »Offenbar können Sie heute abend nur gewinnen«, sagte sie. »Haben Sie immer so viel Glück?«
»Nicht immer. Und Sie?«
»Ich?« Sie stieß einen ihrer langen dramatischen Seufzer aus. »Ich habe heute abend jedes Spiel verloren. Je suis misérable. Ich habe nur Pech.«
Er zog eine Zigarette aus einem Silberetui und taxierte sie ungeniert von Kopf bis Fuß. »Nein, jetzt haben Sie Glück. Sie haben mich doch getroffen, oder? Und ich bringe Sie heute nacht nach Hause.«
So viel Kühnheit faszinierte und erregte Chloe, unwillkürlich suchte sie Halt an der Tischkante. Seine glitzernden Augen brannten sich förmlich durch ihr Kleid und bis in die verborgensten Winkel ihres Inneren. Was war so Besonderes an diesem Mann? Sie wußte bloß eins: Nur eine absolut außergewöhnliche Frau könnte das Herz dieses ungemein selbstbewußten Mannes bezwingen. Und sollte sie diejenige sein, dann war es endlich aus und vorbei mit dem dicken Kind tief drinnen …
Trotzdem hielt Chloe sich zurück. In dem einen Jahr, das seit dem Tod ihrer Mutter verstrichen war, hatte sie gelernt, Männer genauer wahrzunehmen als sich selbst. Als die Kugel durch die Fächer des Rouletterades gekullert war, hatte sie es in seinen Augen gefährlich blitzen sehen. Sie vermutete, daß er nicht hochschätzen würde, was ihm zu leicht in den Schoß fiele. »Es tut mir leid«, entgegnete sie kühl, »aber ich habe schon etwas anderes vor.« Ehe er darauf antworten konnte, griff sie nach ihrem Abendtäschchen und war zur Tür hinaus.
Er rief am nächsten Tag an, aber sie ließ sich von ihrem Mädchen verleugnen. Eine Woche später traf sie ihn in einem anderen Kasino. Sie warf ihm einen schmachtenden Blick zu und verschwand durch die Hintertür, bevor er näherkommen konnte.
Einige Tage verstrichen, und alle ihre Gedanken kreisten um den schönen jungen Playboy aus Chicago. Wieder rief er an, wieder war sie nicht für ihn zu sprechen. Am selben Abend sah sie ihn im Theater und nickte ihm beiläufig zu, schenkte ihm ein äußerst flüchtiges Lächeln auf dem Weg zu ihrem Logenplatz.
Als er zum dritten Mal anrief, nahm sie das Gespräch entgegen, tat aber so, als könnte sie sich nicht an ihn erinnern. Er lachte amüsiert und sagte: »In einer halben Stunde komme ich dich holen, Chloe Serritella. Und wenn du nicht bereit bist, siehst du mich nie wieder …«
»In einer halben Stunde? Ich kann doch nicht …« Aber er hatte schon aufgelegt.
Die Hand zitterte ihr, als sie den Hörer auf die Gabel zurücklegte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie ein rotierendes Rouletterad, die Elfenbeinkugel hüpfte von Rot auf Schwarz, Schwarz auf Rot in diesem Spiel zu zweit. Zitternd vor Aufregung schlüpfte sie in ein weißes Wollkleid mit Ozelotbesatz. Dazu setzte sie ein Hütchen mit Tüllschleier auf. Und genau eine halbe Stunde später öffnete sie ihm die Tür.
Er führte sie zu einem rassigen roten Isotta Fraschini, den er in atemberaubendem Tempo kreuz und quer durch Knightsbridge steuerte, wozu er nur die Finger seiner rechten Hand benötigte. Verstohlen betrachtete sie ihn von der Seite, voller Bewunderung für die kastanienbraune Locke, die ihm so schön wild ins Gesicht fiel, und entzückt, daß sie es mit einem heißblütigen Amerikaner, nicht einem berechenbaren Europäer zu tun hatte.
Endlich hielt er vor einem ganz ausgefallenen Restaurant. Als sie beim Wein saßen, berührte er ihre Hand jedesmal, wenn sie nach ihrem Glas griff. Sie floß über vor heißem Verlangen. Unter dem durchdringenden Blick dieser ruhelosen Augen fühlte sie sich unbeschreiblich herrlich, ganz schlank auch im Inneren. Alles an ihm erregte ihre Sinne – sein Gang, der Klang seiner Stimme, selbst der Tabakgeruch, den er verströmte. Jack Day bedeutete für sie die Erfüllung, die endgültige Bestätigung, daß sie schön war.
Später küßte er sie im Schatten einer Platane, ganz lang und voller Hingabe. Er ließ seine Hände auf ihrem Rücken hinabgleiten, bis sie auf ihrem Po ruhten. »Ich will dich«, flüsterte er.
Es bereitete ihr physische Schmerzen, ihn abzuwehren, so heiß begehrte sie ihn. »Du bist zu schnell für mich, Jack. Ich brauche Zeit.«
Er lachte, kniff sie ins Kinn. Es schien ihm zu gefallen, wie gut sie mitspielte; gerade als ein älteres Paar aus dem Restaurant kam und herüberschaute, tätschelte er ihr den Busen. Auf der Rückfahrt unterhielt er sie mit amüsanten Anekdoten, von einem Wiedersehen sagte er nichts. Als er zwei Tage später wieder anrief, ließ Chloe sich von ihrem Mädchen verleugnen. Gleich darauf rannte sie tränenüberströmt auf ihr Zimmer. Trieb sie es vielleicht doch zu weit? Aber würde er nicht auf der Stelle das Interesse verlieren, wenn sie ihm entgegenkäme? Das nächste Mal traf sie ihn auf einer Vernissage, an seinem Arm hing ein Showgirl mit hennarotem Haar. Chloe nahm keine Notiz von ihm.
Am nächsten Nachmittag stand er vor ihrer Tür und lud sie zu einer Landpartie ein. Die Einladung zum Abendessen schlug sie aus, sie schützte eine andere Verabredung vor.
Und so spielte Chloe va banque, bis er ihr ganzes Denken beherrschte. Wenn er nicht bei ihr war, rief sie ihn in Gedanken herbei, sah ihn genau vor sich: die ruhelosen Bewegungen, die lässige Art, wie er sein Haar trug, den verwegenen Schnurrbart. Ihr Körper fieberte ihm entgegen, war zum Zerreißen gespannt, trotzdem wehrte sie seine sexuellen Avancen ab.
Er provozierte sie grausam, wenn er ihr Ohr mit tausend Küssen bedeckte und dabei flüsterte: »Für mich bist du keine richtige Frau.«
Im Gegenzug streichelte sie ihm den Nacken und konterte: »Für mich bist du nicht reich genug.«
Die Elfenbeinkugel rollte über das Rad; Rot, Schwarz, Rot – Chloe wußte, daß die Entscheidung bald fallen mußte.
»Heute nacht«, sagte Jack am Telefon. »Warte auf mich um Mitternacht!«
»Um Mitternacht? Sei doch nicht albern, Darling! Du bist unmöglich.«
»Entweder um Mitternacht oder nie, Chloe. Rien ne va plus!«
An diesem Abend schlüpfte sie in ein schwarzes Samtkostüm mit Kristallknöpfen, darunter trug sie eine champagnerfarbene Bluse aus Crépe de Chine. Als sie das dunkle Haar zu einer weichen Pagenfrisur kämmte, strahlte sie ihr Spiegelbild mit leuchtenden Augen an. Black Jack Day erschien im Frack. Pünktlich mit dem Glockenschlag stand er um Mitternacht vor ihrer Tür. Bei seinem Anblick schmolz sie dahin, alles in ihr schien zu zerfließen. Dieses Mal führte er sie nicht zu dem Isotta Fraschini, sondern zu einem Mercedes, an dessen Steuer ein Chauffeur saß. Er nannte Harrods als Ziel.
Sie lachte. »Ist es um Mitternacht nicht reichlich spät für einen Einkaufsbummel?«
Er sagte nichts, lächelte nur vor sich hin, als er sich in die Lederpolster sinken ließ. Nach einer Weile erzählte er ihr von einem Polopony, das er von Aga Khan kaufen wollte. Nicht lange, und der Mercedes hielt vor Harrods’ grüngoldener Markise. Chloe sah schwaches Licht hinter den Türen des verlassenen Kaufhauses brennen. »Harrods scheint nicht mehr offen zu haben, Jack, nicht einmal für dich.«
»Das werden wir ja sehen, Darling.« Der Chauffeur hielt ihnen die Tür auf, und Jack half ihr hinaus.
Zu ihrem nicht geringen Erstaunen erschien jetzt ein Portier in Livree hinter der Glastür von Harrods. Er blickte sich verstohlen um, dann öffnete er ihnen die Tür. »Willkommen bei Harrods, Mr. Day!«
Verblüfft blieb sie vor der offenen Tür stehen. Nicht einmal Black Jack Day konnte so mir nichts, dir nichts lange nach Ladenschluß und in Abwesenheit des Verkaufspersonals in das berühmteste Kaufhaus der Welt hineinschneien. Da sie sich nicht rührte, schob Jack sie energisch vor sich her. Kaum hatten sie das Kaufhaus betreten, verblüffte sie der Portier schon wieder: Er tippte sich an die Mütze, trat auf die Straße und schloß hinter ihnen ab. Sie konnte das alles kaum glauben und sah Jack fragend an.
»Fortuna war mir hold, seit ich dich kennengelernt habe, Kleines. Ich dachte mir, ein kleiner privater Einkaufsbummel würde dir Freude machen.«
»Aber es ist doch geschlossen. Ich sehe keine Verkäufer.«
»Na, um so besser!«
Sie drängte auf eine Erklärung, erfuhr aber nur so viel, daß er ein privates – und vermutlich illegales – Arrangement mit einigen von Harrods’ neueren und skrupelloseren Angestellten getroffen hatte.
»Aber arbeitet hier denn nachts niemand? Putzkolonnen? Nachtwächter?«
»Du stellst zu viele Fragen, Kleines. Was nützt mir Geld, wenn ich mir nichts dafür kaufen kann? Mal sehen, worauf du heute nacht Lust hast.« Er nahm ein gold- und silberfarbenes Tuch und legte es um ihren Samtkragen.
»Jack, das kann ich nicht annehmen!«
»Keine Sorge, Kleines! Der Laden wird reichlich entschädigt. Willst du mich mit deinen Skrupeln anöden, oder können wir uns jetzt ins Vergnügen stürzen?«
Chloe war völlig sprachlos. Es war kein Verkaufspersonal in Sichtweite, auch kein Nachtwächter. Stand dieses großartige Kaufhaus ihr wirklich zur freien Verfügung? Sie betrachtete das Tuch um ihren Hals und brach in lautes Staunen aus. Er zeigte ihr das Füllhorn von Luxusgütern. »Na los doch! Such dir aus, was dein Herz begehrt!«
Sie lachte ausgelassen. Schließlich holte sie sich eine straßbesetzte Handtasche aus der Dekoration und legte sie sich über die Schulter. »Sehr hübsch«, sagte sie.
Dann flog sie ihm um den Hals. »Du bist der alleraufregendste Mann von der ganzen Welt, Jack Day. Ich bete dich an.« Seine Hände tasteten sich von ihrer Taille abwärts, zogen zärtlich ihre Kurven nach. Er preßte sie an sich. »Und du bist die aufregendste Frau. Ich kann doch nicht zulassen, daß unsere Liebe an einem gewöhnlichen Ort Erfüllung findet, hm?«
Schwarz, Rot … Rot, Schwarz … Es blieb kein Raum für Mißverständnisse, der Beweis für seine Bereitschaft drückte hart gegen ihren Bauch. Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt. Les jeux sont faits. Bei Harrods. Nur Jack Day konnte das fertigbringen! Ihr schwindelte …
Er nahm ihr das Abendtäschchen von der Schulter, zog ihr die Samtjacke aus und breitete sie über eine Dekoration von Seidenschirmen mit Rosenholzgriffen. Dann legte er sein Jackett ab und legte es zu ihrer Jacke. Er stand vor ihr in weißem Plisseehemd, die Manschettenknöpfe aus schwarzem Marmor, die schlanke Taille in einem dunklen Kummerbund. »Wir holen sie uns später«, verkündete er, während er ihr das Tuch wieder um die Schultern legte. »Jetzt gehen wir erst mal auf Entdeckungsreise.«
Er führte sie in die berühmte Lebensmittelabteilung mit den wunderbaren Marmortheken und den herrlichen Deckengemälden. »Hunger?« fragte er und hielt eine silberne Pralinenschachtel hoch.
»Ja, nach dir«, hauchte sie matt.
Er hob den Deckel von der Schachtel, entnahm ihr eine dunkle Praline, biß ein kleines Loch hinein, bis der Kirschlikör herauströpfelte. Rasch drückte er ihr die Schokolade an die Lippen, zog sie raus und rein, daß ihr das köstliche schwere Naß in den Mund rann. Dann steckte er sie sich selbst in den Mund und beugte sich über sie für einen Kuß.
Als sie die Lippen öffnete, süß und klebrig vom Kirschlikör, schob er ihr die leere Pralinenkruste mit der Zunge hinein. Chloe nahm sie stöhnend in Empfang, sie fühlte sich wie das flüssige Innenleben der Praline …
Als er endlich von ihren Lippen abließ, wählte er eine Flasche Champagner aus, ließ den Korken knallen, setzte sie zuerst ihr, dann sich selbst an die Lippen. »Auf die außergewöhnlichste Frau in London!« sagte er. Er beugte sich über sie und leckte ihr den letzten Rest Schokolade aus den Mundwinkeln.
Sie schlenderten durch das Erdgeschoß, nahmen ein Paar Handschuhe, ein Bukett aus Seidenblumen, ein handbemaltes Schmuckkästchen und ließen alles für später liegen. Schließlich standen sie in der Parfümerie. Die wunderbarsten Düfte der Welt benebelten Chloes Sinne; ohne die Menschenmassen, die tagsüber diese Abteilung bevölkerten, konnten sie ihr Aroma ungestört entfalten.
Er ließ ihren Arm los und drehte sie zu sich herum. Langsam knöpfte er ihr die Bluse auf. Sie fand es erregend und zur gleichen Zeit auch peinlich … schließlich waren sie in einem Kaufhaus! »Jack, ich …«
»Stell dich nicht so an, Chloe!« sagte er. »Vertrau mir!«
Er schob den Satin ihrer Bluse behutsam zur Seite, bis der Spitzenansatz ihres BHs zu sehen war; ein Glücksschauer durchrieselte sie. Aus einer geöffneten Vitrine griff er nach einer zellophanverpackten Schachtel JOY und nahm die Flasche heraus.
»Lehn dich gegen die Theke!« sagte er. Seine Stimme war so weich wie die Seide ihrer Bluse. »Leg die Arme auf die Kante!«
Sie tat wie gebeten, der tiefe Blick aus seinen glänzenden Augen machte sie völlig schwach. Er zog den Glasstöpsel aus dem Flaschenhals und ließ ihn unter die Spitzen ihres BHs gleiten. Sie rang nach Luft, als er das kalte Glas über ihre Brustwarze fahren ließ.
»Na, ist das schön?« murmelte er mit kaum hörbarer, belegter Stimme.
Sie nickte nur, war unfähig zu sprechen. Er steckte den Stöpsel in die Flasche zurück, holte sich einen neuen aus einer anderen Flasche und schob ihn unter die andere Seite ihres BHs. Dieses Mal berührte das Glas die andere Brustwarze. Ein wohliger Schauer durchzuckte ihren ganzen Körper unter Jacks langsam kreisenden Bewegungen, und als ihre Erregung auf dem Siedepunkt angelangt war, verschwammen seine Gesichtszüge vor ihren Augen.
Er ließ den Stöpsel weiter hinunterfahren, seine Hand schlüpfte unter ihren Rock und bewegte sich an ihrem Strumpf hoch. »Nimm die Beine auseinander!« flüsterte er. Sie krallte sich an der Thekenkante fest und kam seiner Aufforderung nach. Jetzt ließ er das Glas über ihren Schenkel gleiten, über den oberen Rand des Strumpfs hinweg und auf die bloße Haut. In immer kleiner werdenden Kreisen näherte er sich ihrem Slip. Stöhnend spreizte sie die Beine noch ein wenig mehr.
Lachend zog er seine Hand unter ihrem Rock hervor. »Nein, Kleines. Es ist noch nicht soweit.«
Sie streiften durch das verlassen daliegende Kaufhaus, gingen von einer Abteilung zur anderen, sprachen kaum. Er streichelte ihr die Brüste, als er eine antike georgianische Brosche an den Kragen ihrer Bluse heftete, rieb ihren Po durch den Stoff ihres Rocks, während er ihr mit einer Bürste mit Silberfiligrangriff über das Haar strich. Sie probierte einen Gürtel aus Krokodilleder und sehr spitze Schuhe aus Ziegenleder an. In der Schmuckabteilung nahm er ihr das Perlenohrgehänge ab und ersetzte es durch goldene, mit unzähligen winzigen Diamanten besetzte Klipse. Ihre Bedenken fegte er lachend beiseite. »Das Glücksrad braucht sich nur einmal zu drehen, Kleines. Nur ein einziges Mal.«
Er entdeckte eine weiße Federboa. Sofort schob er Chloe gegen eine Marmorsäule und ließ ihr die Bluse von den Schultern gleiten. »Du siehst immer noch aus wie ein Schulmädchen«, erklärte er. Das seidige Gewebe fiel zu Boden, und sie stand vor ihm, von der Hüfte aufwärts nackt.
Ihre Brüste waren groß und voll, die flachen Brustwarzen waren hart vor Erregung. Er umschloß ihre Brüste mit den Händen. Sie fand Gefallen daran, sich ihm zu zeigen, und blieb regungslos stehen. Die Marmorsäule in ihrem Rücken spendete wohltuende Kühlung gegen die Hitze in ihrem Inneren. Er zwickte ihre Brustwarzen, sie stöhnte leise auf. Lachend nahm er die weiße Boa und legte sie ihr über die nackten Schultern. Dann ließ er die Federn auf ihrem Busen auf und ab gleiten.
»Jack …« Sie wollte auf der Stelle genommen werden. Sie wollte sich nur noch an der Säule hinabsinken lassen, ihre Beine ausbreiten und ihn in sich aufnehmen.
»Ich bin ganz wild auf JOY«, flüsterte er. Er schob die Boa ein wenig zur Seite, seine Lippen schlossen sich fest um ihre große Brustwarze. Dann begann er, intensiv zu saugen.
Sie brannte lichterloh, verzehrte sich vor Verlangen. »Bitte«, murmelte sie, »bitte, bitte, quäl mich nicht länger!«
Er zog sich von ihr zurück, schaute sie amüsiert an. »Warte noch ein bißchen, Kleines! Ich bin noch nicht fertig mit Spielen. Ich finde, wir sollten uns mal die Pelze ansehen …« Er unterdrückte ein Lächeln, wußte sehr wohl, wie es um sie stand. Er zupfte die Boa über ihrer Brust zurecht und berührte wie zufällig die Brustwarze mit seinem Fingernagel.
»Ich will mir keine Pelze ansehen«, sagte sie. »Ich will …«
Aber er führte sie zum Fahrstuhl und spielte mit den Knöpfen, als sei es sein Beruf.
Im Pelzsalon schien Jack sie völlig vergessen zu haben. Er schritt die Regale ab, prüfte die Mäntel und Stolen, die da ausgebreitet lagen, und entschied sich endlich für einen langen russischen Luchs. Die Fellhaare waren lang und dick, von silbrigem Weiß. Er betrachtete den Mantel eingehend, dann wandte er sich zu ihr um.
»Zieh den Rock aus!« Sie nestelte am Reißverschluß und glaubte schon, seine Hilfe zu benötigen. Aber dann rutschte der Rock, sie ließ den Unterrock folgen und stand vor ihm.
»Das Höschen. Zieh das Höschen für mich aus!«
Schwer atmend kam sie seinem Wunsch nach, behielt nur den Strapshalter und die Strümpfe an. Ohne weitere Anweisungen abzuwarten, zog sie sich die Boa von der Brust und warf sie auf den Boden. Sie bog die Schultern leicht zurück, damit er sich weiden konnte am Anblick ihrer vollen, wohlgeformten Brüste und an ihrem Venushügel, bedeckt von dunklem Haar und eingerahmt von den schwarzen Strapsen.
Er kam auf sie zu, streckte ihr den wunderbaren Pelz entgegen. Seine Augen glitzerten wie die Marmorknöpfe auf seinem weißen Hemd. »Um den richtigen Pelz zu wählen, mußt du ihn auf deiner Haut spüren … auf deinen Brüsten …« Seine Stimme war weich wie das Luchsfell, das er ihr um den bebenden Körper legte. »Auf deinen Brüsten … auf dem Bauch und auf dem Po und auf den Schenkeln …«
Sie schnappte nach dem Pelz und preßte ihn an sich.
»Bitte, bitte … Du quälst mich. Bitte, hör auf!«
Wieder zog er sich zurück, aber dieses Mal, um die Knöpfe seiner Hemdbrust zu lösen. Chloe sah zu, wie er sich auszog, das Herz schlug ihr bis zum Hals vor heißem Verlangen. Als er nackt vor ihr stand, nahm er ihr den Mantel ab und legte ihn auf ein Podest mitten im Raum. Dann kletterte er hinauf und zog sie mit sich.
Die Berührung mit seiner nackten Haut schürte ihre Erregung, daß es ihr den Atem verschlug. Er stellte sich hinter sie und streichelte ihre Brüste wie für ein unsichtbares Publikum. Er tastete über ihren Bauch und ihre Schenkel. Sie spürte den Penis hart gegen ihre Hüfte. Dann fuhr er mit der Hand zwischen ihre Beine, und Hitze wallte auf von seiner Berührung, der heiße Wunsch nach Erlösung von den Myriaden von Stromstößen, die durch ihren Körper jagten.
Er schubste sie auf den weichen, dicken Pelz, der ihre Schenkel streifte, als er sich zwischen ihren ausgebreiteten Knien niedersinken ließ. Und sie hielt sich für ihn bereit, mitten im Pelzsalon, auf einem Podest, das das Beste von Harrods zur Schau stellen sollte.
Er sah auf die Uhr. »Gleich müßte die Wachpatrouille vorbeikommen. Wie lange es wohl dauert, bis die uns hier finden?« Mit diesen Worten drang er in sie ein.
Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff. Sie stieß einen heiseren Schrei aus. »Mein Gott! Das hast du alles so geplant, ja?«
Er knetete ihre Brüste und stieß kräftig zu. »Natürlich.«
Das Feuer in ihrem Körper und die Angst, entdeckt zu werden, flossen zusammen zu einer gewaltigen Gefühlsexplosion. Der Orgasmus schlug über ihr zusammen. Sie biß Jack in die Schulter. »Du Bastard!«
Er lachte. Dann fand er seinen eigenen Höhepunkt und stöhnte laut.
Sie entkamen den Wachen nur knapp. Er warf sich selbst nur das Allernötigste über, bedeckte ihre Nacktheit rasch mit dem Luchsmantel und zerrte sie zur Treppe. Barfuß liefen sie die Stufen hinunter, er lachte laut und unbekümmert. Bevor sie das Kaufhaus verließen, schleuderte er ihr Höschen in eine offene Vitrine, zusammen mit seiner Visitenkarte.
Am nächsten Tag erhielt sie eine kurze Mitteilung von ihm. Seine Mutter sei krank, er müsse vorübergehend nach Chicago. Chloe wartete auf ihn, in einer Ansammlung gemischter Gefühle – Wut über das Risiko, dem sie sich beide ausgesetzt hatten, und eine nagende Angst, er könnte nicht zurückkommen. Vier Wochen verstrichen, dann fünf. Sie versuchte, ihn anzurufen. Die Verbindung war so schlecht, daß sie sich nicht verständlich machen konnte. Zwei Monate gingen vorbei. Jetzt war sie davon überzeugt, daß er sie nicht liebte. Er war ein Abenteurer, lüstern auf Sensationen. Er hatte das dicke Mädchen in ihr erkannt und wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben.
Zehn Wochen nach ihrer Eskapade tauchte er wieder auf, so plötzlich, wie er verschwunden war. »Hallo, Kleines!« sagte er. Er stand vor ihrer Tür, den Kaschmirmantel lässig über die Schulter gelegt. »Ich habe dich vermißt.«
Sie sank ihm in die Arme, schluchzte vor Freude über das Wiedersehen. »Jack … Jack, mein Liebling …«
Sanft fuhr er ihr mit dem Daumen über die Lippen, dann küßte er sie. Sie schlug ihn hart ins Gesicht. »Ich bin schwanger, du Bastard!«
Zu ihrer Überraschung willigte er sofort in die Hochzeit ein, und drei Tage später wurden sie im Landhaus von Freunden getraut. Als sie neben ihrem schönen Bräutigam vor dem improvisierten Gartenaltar stand, hielt sich Chloe für die glücklichste Frau der Welt. Black Jack Day hätte jede heiraten können, aber er hatte sie erwählt. Im Laufe der folgenden Wochen ignorierte sie hartnäckig das Gerücht, seine Familie in Chicago habe ihn enterbt. Sie träumte nur von ihrem Baby. Wie wunderbar, die ungeteilte Liebe zweier Menschen zu besitzen – von Ehemann und Kind!
Einen Monat später war Jack verschwunden, mit ihm auch zehntausend Pfund von einem von Chloes Bankkonten. Als er sechs Wochen später wieder aufkreuzte, schoß sie ihm in die Schulter. Nach einer kurzen Versöhnungsphase hatte Jack wieder einmal Glück im Spiel und war wieder auf und davon.
Am Valentinstag 1955 versagte Fortuna Black Jack Day für immer die Gefolgschaft. Eine regennasse Landstraße sollte
2
Ein früherer Liebhaber der jungen Witwe schickte ihr seinen Rolls-Royce, um sie nach der Entbindung von ihrer Tochter nach Hause bringen zu lassen. Als die junge Mutter es sich in den weichen Lederpolstern bequem gemacht hatte, betrachtete sie das winzige Flanellbündel in ihren Armen, das Baby, das sie auf so spektakuläre Weise in Harrods’ Pelzsalon empfangen hatte. Sie streichelte dem Kind über die Wange und flüsterte ganz leise: »Meine schöne kleine Francesca, du brauchst keinen Vater und keine Großmutter. Du brauchst nur mich … weil ich dir alles gebe, alles auf der Welt.«
Chloe setzte diesen Vorsatz in die Tat um, und für Black Jack Days Tochter gab es kein Entrinnen …
1961, als Francesca sechs Jahre alt war und Chloe sechsundzwanzig, ließen sich beide für die britische Ausgabe von Vogue ablichten. Auf der linken Seite war die immer wieder reproduzierte Karsh-Fotografie von Nita in einem Kleid aus ihrer Zigeunerkollektion, auf der rechten sah man Chloe und Francesca. Mutter und Tochter standen in einem Meer von zerknülltem Papier, dessen Weiß mit dem Schwarz ihrer Kleider kontrastierte: Und es war eine Studie in Kontrasten: das weiße Papier, ihre blasse weiße Haut und die schwarzen Samtumhänge mit fließenden Kapuzen. Die einzige echte Farbe lieferten vier intensive Grüntupfer – das waren die unvergeßlichen Serritella-Augen, die aus der Seite förmlich herauszuspringen schienen, schimmernd wie kostbare Smaragde.
Als sich die erste Aufregung über die Fotografie gelegt hatte, bemerkten die kritischeren Leser, daß der Glamour von Chloe vielleicht nicht ganz an das exotische Flair ihrer Mutter heranreichte. Doch selbst die härtesten Kritiker konnten keinen Makel an dem Kind feststellen. Sie wirkte wie die fleischgewordene Phantasiegestalt eines vollkommenen kleinen Mädchens. Auf dem ovalen Gesichtchen lagen seliges Lächeln und engelsgleiche, überirdische Schönheit. Nur der Fotograf, der die Bilder aufgenommen hatte, war anderer Ansicht. Er trug zwei kleine Narben davon, zwei weiße Striche auf dem Handrücken, wo die scharfen kleinen Vorderzähne ihm tief ins Fleisch gebissen hatten.
»Nein, nein, Kleines«, hatte Chloe das Kind am Nachmittag ermahnt, als sie den Fotografen gebissen hatte. »Wir dürfen diesen netten Mann doch nicht beißen.« Sie wedelte mit dem Zeigefinger, der in schimmerndem Ebenholzschwarz lackiert war.
Francesca funkelte ihre Mutter rebellisch an. Sie wollte nach Hause und mit ihrem neuen Puppentheater spielen. Nicht von einem häßlichen Mann fotografiert werden, der ihr dauernd sagte, sie solle nicht so wackeln. Sie stieß ihre Schuhspitze in die Haufen zerknüllten Papiers und schüttelte sich die kastanienbraunen Locken aus der schwarzen Samtkapuze. Mummy hatte ihr einen Besuch bei Madame Tussaud versprochen, wenn sie schön brav wäre, und Francesca liebte die Wachsfiguren über alles. Aber trotzdem war sie nicht absolut sicher, damit das große Los gezogen zu haben. Eigentlich gefiel ihr ja auch Saint-Tropez ganz gut.
Chloe suchte den Fotografen zu trösten, so gut es ging, dann wollte sie ihrer Tochter das Haar glattstreichen und fuhr mit einem lauten Aufschrei zurück. Francesca hatte sie genauso behandelt wie den Fotografen. »Böses Mädchen!« jammerte sie.
Francescas Augen füllten sich auf der Stelle mit Tränen, und sofort machte Chloe sich schwere Vorwürfe wegen ihrer heftigen Reaktion. Rasch drückte sie ihre Tochter an sich. »Ist ja gut«, zirpte sie. »Chloe ist ja gar nicht böse, Darling. Böse Mummy? Bekommst auch eine hübsche neue Puppe.«
Francesca schmiegte sich in die Arme ihrer liebenden Mutter und blinzelte den Fotografen durch den dichten Saum ihrer Wimpern an. Dann streckte sie ihm die Zunge heraus.
An diesem Nachmittag hatte Chloe zum ersten, aber beileibe nicht zum letzten Mal Francescas kleine scharfe Zähne zu spüren bekommen. Auch nachdem drei Kindermädchen gekündigt hatten, weigerte sich Chloe, offen zuzugeben, daß die Beißwut ihrer Tochter zum Problem geworden war. Francesca war eben nur sehr temperamentvoll, und Chloe hatte nicht die Absicht, sich den Zorn ihrer Tochter zuzuziehen. Also nahm sie von so einer Nebensächlichkeit keine Notiz. Francescas Terrorregime wäre von unbegrenzter Dauer geblieben, hätte nicht einmal ein fremdes Kind nach einem Streit um die Schaukel im Park zurückgebissen. Als Francesca entdeckte, daß diese Erfahrung schmerzlicher Natur war, gab sie das Beißen auf. Sie war ja nicht vorsätzlich grausam; sie wollte nur ihren Willen durchsetzen.
Kurz nach Francescas Geburt hatte Chloe ein Haus aus der Zeit Queen Annes erworben. Es lag in der Upper Grosvenor Street, nicht weit von der Botschaft der Vereinigten Staaten und am östlichen Rand des Hydeparks. Das viergeschossige Gebäude war nur etwas über neun Meter breit. In den dreißiger Jahren hatte Syrie Maugham, die Frau von Somerset Maugham, diese schmale Konstruktion restaurieren lassen. Sie war eine der höchstgefeierten Innenarchitektinnen ihrer Zeit. Eine Wendeltreppe verband das Erdgeschoß mit dem Wohnzimmer und schwang sich an einem Porträt von Chloe und Francesca vorbei, das von Cecil Beaton stammte. Korallenrote Säulen aus unechtem Marmor säumten den Eingang zum Wohnzimmer, in welchem sich französische und italienische Kunst mischten, aber auch Adam-Stühle neben einer Sammlung venezianischer Spiegel vorkamen. Auf der darüberliegenden Etage lag Francescas Schlafzimmer, das eingerichtet war wie ein Dornröschenschloß. Vor einer Kulisse von Spitzengardinen, verziert mit rosa Seidenrosetten, und einem Himmelbett, von dessen Blattgolddach dreißig Meter hauchdünner weißer Tüll herabhingen, herrschte Francesca als regierende Prinzessin, so weit ihr Auge reichte.
Hin und wieder hielt sie hof in ihrem Märchenzimmer. Dann schenkte sie gesüßten Tee aus einer Kanne aus Meißener Porzellan für die Tochter einer von Chloes Freundinnen ein. »Ich bin die Prinzessin Aurora«, verkündete sie einmal der Ehrenwerten Clara Millingford und warf ihre kastanienbraunen Locken zurück, die sie – zusammen mit ihrer Unbekümmertheit – von Black Jack Day geerbt hatte. »Du bist eine gute Frau aus dem Dorf, die mich besuchen kommt.«
Clara, die einzige Tochter von Vicomte Allsworth, beabsichtigte keineswegs, die gute Frau aus dem Dorf zu spielen, während Francesca Day von königlichem Geblüt war. Sie legte ihren Keks hin und rief: »Ich will Prinzessin Aurora sein!«
Diese Vorstellung belustigte Francesca derart, daß sie in ein silberhelles, leichtes Lachen ausbrach. »Sei nicht dumm, liebe Clara! Du hast doch so große Sommersprossen. Die sind zwar auch ganz hübsch, aber natürlich nicht für Prinzessin Aurora, die Allerschönste im Land. Ich bin Prinzessin Aurora, du kannst meinetwegen Königin sein.«
Francesca hielt diesen Kompromiß für ausgesprochen fair und war am Boden zerstört, als Clara – wie so viele andere kleine Mädchen zuvor – nicht wieder mit ihr spielen wollte. Sie war ehrlich verblüfft. Sie hatte sie doch mit allen ihren schönen Sachen spielen lassen. Und sie hatte ihnen doch erlaubt, in ihrem wunderschönen Zimmer zu spielen.
Chloe ignorierte alle Hinweise, ihr Kind würde furchtbar verzogen. Francesca war ihr Baby, ihr Engel, ihr vollkommenes kleines Mädchen. Sie stellte die liberalsten Privatlehrer ein, kaufte die neuesten Puppen, die neuesten Spiele, umsorgte sie wie eine Glucke, verzärtelte sie und ließ ihr in allem ihren Willen, solange es nicht gefährlich war. Unerwartete Todesfälle hatte es bereits zweimal in Chloes Leben gegeben, und der bloße Gedanke daran, daß ihrem heißgeliebten Kind etwas zustoßen könnte, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Francesca war der einzige ruhende Pol für sie, die einzige gefühlsmäßige Bindung, die sie in ihrem ziellosen Leben hatte eingehen können. Manchmal wälzte sie sich schlaflos im Bett herum, schweißgebadet; dann kamen ihr alle möglichen schrecklichen Gefahren in den Sinn, die das kleine Mädchen bedrohen könnten, das unglückseligerweise die sorglose Natur seines Vaters geerbt hatte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie Francesca in einen Swimmingpool springen und nicht wieder auftauchen; von einem Skilift abstürzen; sich die Muskeln beim Balletttraining zerreißen; ihr Gesicht durch einen Fahrradunfall entstellt. Es gelang ihr nicht, die schreckliche Angst abzuschütteln, irgend etwas könnte ihre Tochter heimsuchen, das außer ihrer Kontrolle lag. Daher wollte sie Francesca in Watte packen und auf einer rosaroten Wolke allem Unheil fernhalten.
»Nein!« kreischte sie, wenn Francesca hinter einer Taube herrannte. »Komm zurück! Renn nicht so!«
»Aber es macht mir Spaß!« protestierte Francesca. »Dann pfeift mir der Wind so schön in den Ohren.«
Chloe kniete nieder und streckte die Arme aus. »Vom Rennen zerzaust dein Haar, und dein Gesicht wird ganz rot. Wenn du nicht hübsch bist, mag dich keiner mehr.« Mit dieser schrecklichen Drohung drückte sie Francesca fest an sich, so wie andere Mütter ihren Kindern mit dem schwarzen Mann drohen.
Manchmal lehnte sich Francesca dagegen auf. Dann übte sie heimlich Radschlagen oder ließ sich von einem Ast schaukeln, wenn das Kindermädchen einmal nicht hinsah. Aber immer wurde sie dabei ertappt, und ihre vergnügungssüchtige Mutter, die ihr nie einen Wunsch abschlug, sie auch für außerordentlich ungezogenes Betragen nie zurechtwies, versetzte mit ihrer maßlosen Aufregung das arme Kind in Angst und Schrecken.
»Du könntest tot sein!« schrie sie in solchen Situationen und deutete auf einen Grasfleck auf Francescas gelbem Leinenrock oder auf Dreck in ihrem Gesicht. »Wie häßlich du aussiehst! Wie furchtbar! Keiner mag häßliche kleine Mädchen!« Und dann weinte Chloe so herzzerreißend, daß Francesca es mit der Angst zu tun bekam. Nach mehreren erschütternden Vorfällen dieser Art hatte Francesca ihre Lektion gelernt: Alles war im Leben erlaubt … solange man gut dabei aussah.
Die beiden konnten sich ein elegantes Bohemeleben leisten, teils von den Zinsen aus Chloes Erbschaft, teils von der Großzügigkeit einer ganzen Schar von Männern, die durch Chloes Leben zogen, so wie ihre Väter durch Nitas Leben gezogen waren. Chloes ausgesprochener Modesinn und ihre Extravaganzen festigten ihren Ruf als amüsante Gesellschafterin und höchst unterhaltsamer Gast in Kreisen der internationalen High-Society. Man konnte sich immer darauf verlassen, daß Chloes Anwesenheit einem noch so banalen Anlaß den richtigen Glanz verlieh. Es war Chloe, die es aufbrachte, daß man mindestens zwei Wochen im Februar auf dem Strand von Copacabana verleben mußte; es war Chloe, die in Deauville alle wieder in Schwung brachte, wenn man allgemein des Polospiels überdrüssig war. Sie organisierte raffinierte Schatzsuchen: Alle rasten dann in schnittigen Wagen durch die französische Landschaft, auf der Jagd nach glatzköpfigen Mönchen, ungeschliffenen Smaragden oder einer perfekt temperierten Flasche Cheval Blanc des Jahrgangs 1919. Und Chloe war es auch, die durchsetzte, daß man Weihnachten nicht mehr in Sankt Moritz, sondern in einem maurischen Dorf an der Algarve feierte, wo man sich stilvoll von wunderbar verdorbenen Rockstars unterhalten ließ und in rauhen Zügen Haschisch genoß.
Meistens brachte Chloe ihre Tochter mit, Kindermädchen und Privatlehrer im Schlepptau. Tagsüber hielten diese Aufpasser Francesca von den Erwachsenen fern, aber abends führte Chloe ihren Jet-set-Freunden das Kind gern vor, als ob es sich um einen Taschenspielertrick handelte.
»Hier ist sie, liebe Leute!« verkündete Chloe einmal, als sie Francesca auf das Achterdeck der Christina führte. Onassis’ Jacht lag in Trinidad vor Anker. Der geräumige Salon am Heck des Schiffes war mit einem grünen Baldachin überspannt; die Gäste erholten sich auf bequemen Sesseln am Rande einer Reproduktion des Minotaurus, die als Mosaik in den Teakholzboden eingelassen war. Das Mosaik hatte knapp eine Stunde zuvor als Tanzfläche gedient und würde später um drei Meter gesenkt und mit Wasser gefüllt werden. So konnte sich, wer Lust hatte, vor dem Zubettgehen mit einem Bad erfrischen.
»Komm her, meine hübsche kleine Prinzessin!« sagte Onassis und streckte ihr die Arme entgegen. »Gib Onkel Ari einen Kuß!«
Francesca rieb sich den Schlaf aus den Augen und tat ein paar Schritte auf ihn zu. Obwohl sie erst neun Jahre alt und um zwei Uhr morgens geweckt worden war, kam sie allmählich zu sich. Den ganzen Tag über hatte man sie den Dienstboten überlassen, jetzt nutzte sie willig die dargebotene Chance, die Aufmerksamkeit der Erwachsenen zu fesseln. Wenn sie besonders gut war, durfte sie am nächsten Tag vielleicht mit ihnen im Salon sitzen.
Onassis erschreckte sie mit seiner Hakennase und den Augen, die er selbst nachts hinter einer überdimensionalen Sonnenbrille verbarg, sie ließ sich aber widerspruchslos von ihm umarmen. Am Abend zuvor hatte er ihr ein hübsches Halsband in Form eines Seesterns geschenkt, jetzt wollte sie weitere Geschenke nicht etwa aufs Spiel setzen.
Als Francesca auf Onassis’ Schoß kletterte, warf sie Chloe einen Blick zu, die sich an ihren derzeitigen Liebhaber gekuschelt hatte. Es war Giancarlo Morandi, der italienische Formel-Eins-Fahrer. Francesca wußte alles über Liebhaber, denn Chloe hatte sie darüber aufgeklärt: Liebhaber waren faszinierende Männer, die sich der Frauen annahmen und ihnen das Gefühl gaben, schön zu sein. Francesca konnte es kaum erwarten, erwachsen zu werden und ihren eigenen Liebhaber zu haben. Aber nicht Giancarlo. Manchmal machte er sich mit anderen Frauen davon, dann weinte ihre Mummy. Lieber wollte Francesca einen Liebhaber, der ihr aus Büchern vorlas, mit ihr in den Zirkus ging und Pfeife rauchte, wie einige Männer, die mit ihren kleinen Mädchen im Hydepark am Serpentinenteich spazierengingen.
»Achtung, alle mal hersehen!« Chloe richtete sich auf und klatschte die Hände über dem Kopf zusammen. Francesca kannte diese Geste von den Flamencotänzerinnen in Torremolinos. »Meine schöne Tochter wird euch jetzt einmal demonstrieren, was für unglaubliche Banausen ihr seid.« Diese Ankündigung wurde mit Gelächter begrüßt; Francesca hörte, wie Onassis losprustete.
Chloe schmiegte sich wieder eng an Giancarlo, rieb ein Bein an seiner Wade, während sie den Kopf in Francescas Richtung hielt. »Hör gar nicht hin, meine Süße«, erklärte sie erhaben, »das ist ein nichtsnutziges Pack. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit ihnen abgebe.« Chloe deutete auf einen niedrigen Mahagonitisch. »Tu mal was für ihre Bildung, Francesca. Niemand außer deinem Onkel Ari kann hier das kleinste bißchen differenzieren.«
Francesca rutschte von Onassis’ Knie und ging auf den Tisch zu. Sie spürte die Augen aller auf sich gerichtet und zögerte den Moment absichtlich hinaus. Gemessenen Schritts und mit hocherhobenem Kopf näherte sie sich ihrem Ziel, wie eine kleine Prinzessin, die ihren Thron besteigt. Beim Anblick der sechs kleinen Goldrandschüsseln auf dem Tisch lächelte sie und warf das Haar zurück. Sie kniete sich vor dem Tisch auf den Teppich und betrachtete die Schüsseln eingehend.
Der Inhalt der Schüsseln hob sich schimmernd vom weißen Porzellan ab – da lagen sechs Haufen glitzernden nassen Kaviars in verschiedenen Schattierungen von Rot, Grau und Beige. Sie berührte die letzte Schüssel, die eine großzügige Portion perlenähnlicher roter Eier enthielt. »Lachsrogen«, sagte sie und schob sie beiseite. »Nicht der Rede wert. Echten Kaviar liefert nur der Stör aus dem Kaspischen Meer.«
Onassis klatschte. Ein Filmstar klatschte Beifall. Mit den nächsten beiden Schüsseln hielt Francesca sich nicht lange auf. »Seehasenrogen, damit brauchen wir uns nicht zu befassen.«
Ein Innenarchitekt beugte sich zu Chloe hinüber. »Hat sie dieses Wissen mit der Muttermilch eingesogen oder durch Osmose aufgenommen?« fragte er.
Chloe belohnte ihn mit einem lüsternen Seitenblick. »Mit der Muttermilch natürlich!«
»Aus dieser wunderbaren Quelle, cara?« Giancarlo ließ seine Hand spielerisch über Chloes offenherziges Dekollete gleiten.
»Dies hier ist Weißstör«, erklärte Francesca, der die Ablenkung von ihrer Person nicht gefiel. Erst recht nicht, nachdem sie den ganzen Tag mit der Gouvernante verbracht hatte. Die hatte die ganze Zeit vor sich hin geflucht, weil Francesca das Einmaleins nicht lernen wollte. Jetzt tippte diese mit dem Finger auf die Schale in der Mitte. »Die Eier vom Weißstör sind am größten.« Und auf die nächste Schale zeigend, dozierte sie: »Dies hier ist Sevruga. Er hat die gleiche Farbe, die Eier sind kleiner. Er ist fast so groß wie der vom Weißstör, ist aber mehr goldfarben.«
Sie hörte einen Chor von Gelächter, in den sich Beifall mischte, dann gratulierten alle Chloe zu ihrem klugen Kind. Zunächst lächelte Francesca glücklich über die Komplimente, dann aber war die Freude jäh verflogen. Sie bemerkte, daß alle nur Chloe ansahen, nicht sie. Wieso stand die Mutter im Mittelpunkt des Interesses, sie hatte das Kunststück doch nicht vollbracht? Nein, die Erwachsenen würden sie auch morgen nicht bei sich haben wollen. Wütend und frustriert sprang Francesca auf und fegte mit dem Arm über den Tisch, womit sie den Tisch vollständig abräumte und den schönen Teakfußboden mit Kaviar beschmierte.
»Francesca!« rief Chloe. »Was ist denn los, mein Liebling?«
Onassis machte eine finstere Miene und schimpfte leise auf griechisch, was in Francescas Ohren sehr bedrohlich klang. Sie schob die Unterlippe vor und überlegte, wie sie sich am besten aus der Affäre zöge. Ihre Trotzreaktionen sollten eigentlich nicht publik werden, und nie, nie, nie vor Chloes Freunden.
»Es tut mir leid, Mummy«, sagte sie, »es war keine Absicht!«
»Natürlich nicht, Kleines«, erwiderte Chloe, »das ist doch jedem hier klar.« Onassis’ düstere Miene wollte sich jedoch nicht wieder aufhellen, Francesca mußte schwereres Geschütz auffahren. Mit einem theatralischen Schrei stürzte sie sich in seinen Schoß. »Es tut mir so leid, Onkel Ari«, schluchzte sie, tränenüberströmt – diesen Trick beherrschte sie besonders gut! »Es war keine Absicht, ganz bestimmt nicht!« Die Tränen rannen ihr über die Wangen. Sie gab sich äußerste Mühe, dem Blick aus der übergroßen dunklen Brille nicht auszuweichen.
»Ich liebe dich, Onkel Ari«, seufzte sie, ihm das tränennasse Gesichtchen zuwendend – diese Geste hatte sie aus einem alten Shirley-Temple-Film abgeguckt. »Ich liebe dich, und ich wünschte, du wärst mein eigener Daddy.«
Onassis bemerkte glucksend, er könne nur hoffen, ihr nie am Verhandlungstisch gegenüberzusitzen.
Francesca wurde weggeschickt und kehrte in ihre Suite zurück. Auf dem Weg dorthin kam sie am Kinderzimmer vorbei, in dem tagsüber ihr Unterricht stattfand. Ihre Schulbank stand unmittelbar vor einem Wandbild Ludwig Bemelmans’, entstanden in seiner Pariser Periode. Immer wenn sie dieses Bild sah, war es ihr, als sei sie in eines von Bemelmans’ Kinderbüchern hineingeraten – natürlich besser gekleidet. Das Zimmer war für die beiden Kinder von Onassis entworfen worden, aber da sie nicht an Bord waren, hatte Francesca es für sich allein. Es war ja auch ganz nett, aber die Bar gefiel ihr noch besser. Da bekam sie nämlich eines Tages Ginger Ale in einem Champagnerglas serviert, komplett mit Papierschirmchen und Maraschinokirsche.
Wenn sie an der Theke saß, nippte sie immer nur kurz an ihrem Getränk, um möglichst lange etwas davon zu haben. Durch den Boden ihres Glases betrachtete sie eine erleuchtete Seelandschaft mit kleinen Schiffchen, die sich mit Magneten bewegen ließen. Die Fußstützen der Barhocker waren polierte Walzähne, die sie mit den Spitzen ihrer handgearbeiteten italienischen Sandaletten so eben erreichen konnte. Die Polster fühlten sich weich an unter ihren Schenkeln. Einmal war ihre Mutter in schrilles Gelächter ausgebrochen, weil Onkel Ari erwähnte, daß sie alle auf der Vorhaut eines Wals säßen. Francesca hatte mitgelacht und zu Onkel Ari gesagt, er wäre ganz schön dumm – er meine doch sicher »Vorbau eines Walls«?
Auf der Christina gab es neun Suiten, jede mit eigenen, reich ausgestatteten Wohn- und Schlafzimmerzonen und je einem rosa Marmorbad, das Chloes Meinung nach schon hart an der Grenze zum Kitsch lag. Die Suiten waren nach verschiedenen griechischen Inseln benannt, deren Konturen auf einem Goldblatt-Medaillon an den Türen zu sehen waren.
Sir Winston Churchill und seine Frau, häufige Gäste an Bord der Christina, hatten sich bereits in ihre Suite zurückgezogen. »Korfu« stand an der Tür. Francesca ging vorbei und suchte weiter nach ihrer Insel – Lesbos. Chloe hatte dazu lachend erklärt, mehrere Dutzend Männer wären wohl kaum damit einverstanden. Als Francesca den Grund wissen wollte, erwiderte Chloe, sie sei nicht alt genug, das zu verstehen.
Francesca haßte es, mit dieser Antwort abgespeist zu werden. Darum hatte sie das blaue Plastiketui mit dem Pessar ihrer Mutter versteckt. Chloe hatte nämlich einmal erwähnt, dies sei ihr kostbarster Besitz. Das wollte Francesca überhaupt nicht einleuchten. Sie hatte es auch nicht wieder herausgerückt, bis Giancarlo Morandi sie aus ihrem Unterricht herauszerrte – Chloe bemerkte nichts davon – und sie über Bord zu werfen drohte, den Haifischen zum Fraß, falls sie nicht sofort mit der Sprache rausrücke. Jetzt haßte Francesca Giancarlo und machte einen möglichst weiten Bogen um ihn.