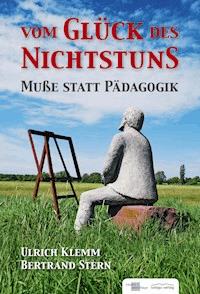Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Bildung wird heute ganzheitlich betrachtet: Sie umfasst nicht nur die formale Bildung in Schule, Hochschule und Ausbildung, sondern auch die vielen informellen und nonformalen Bildungsgelegenheiten im Lebensumfeld. Bildung findet an vielen Orten statt: in der Familie, im sozialen Umfeld, in den Bildungsinstitutionen, in der Kinder- und Jugendhilfe, in Museen und Bibliotheken, Sportvereinen, Gesundheitsinstitutionen und an vielen anderen Orten. Kommunen haben ihre Verantwortung in der Bildung erkannt und übernehmen immer häufiger – oft in Kooperation mit dem Land – eine steuernde und koordinierende Rolle. Sie gestalten vor Ort Bildungslandschaften mit dem Ziel, die Qualität und Quantität des Bildungsangebots in Gemeinden, Städten und Kreisen zu verbessern. Das Handbuch für kommunale Akteure aus Politik, Verwaltung und Bildungsinstitutionen greift die Erfahrung erfolgreicher Kommunen auf, die ihre örtlichen Bildungsangebote gezielt auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger abgestimmt haben. Es beschreibt, wie eine Kommune schrittweise ihre eigene Bildungslandschaft gestalten kann, und skizziert die Herausforderungen, mit denen Kommunen im Bereich der Bildung heute konfrontiert sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dorothea Minderop
Kommunen auf dem Wegzur Bildungslandschaft
Ein Handbuch für kommunale Akteure
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wir verwenden in dieser Publikation keine durchgängig geschlechtergerechte Sprache. Mit »Lehrern«, »Erzieherinnen«, »Akteuren« etc. sind immer Männer und Frauen gemeint.
© E-Book-Ausgabe 2014© 2014 Verlag Bertelsmann Stiftung, GüterslohVerantwortlich: Dr. Anja Langness, Heinz FrenzRedaktion: Dr. Thomas OrthmannLektorat: Heike HerrbergHerstellung: Christiane RaffelUmschlaggestaltung: Elisabeth MenkeUmschlagabbildung: Valeska AchenbachISBN 978-3-86793-577-7 (Print)ISBN 978-3-86793-640-8 (E-Book PDF)ISBN 978-3-86793-641-5 (E-Book EPUB)
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Inhalt
Bildung vor Ort – Herausforderungen annehmen
Teil A: Kommunale Bildungslandschaften gemeinsam gestalten
1Bildung vor Ort gestalten
1.1 Kommunale Bildungslandschaften: Ursprung und Idee
1.2 Erläuterungen der Wissenschaft
1.3 Positionen kommunaler Spitzenverbände und Organisationen
1.4 Positionen aus der Zivilgesellschaft
2Bildungslandschaften entwickeln
2.1 Den Prozess starten – den Mehrwert klären
2.2 Steuerungsstrukturen aufbauen – Arbeitsfähigkeit sichern
2.3 Vorhandene Daten nutzen – Handlungsfelder identifizieren
2.4 Bildungsmonitoring etablieren – Bildungsbericht erstellen
2.5 Verbündete suchen – Beteiligung sichern
2.6 Verbindlichkeit schaffen – Kooperationen aufbauen
3Schritt für Schritt zum gemeinsamen Handeln
3.1 Den Dialog suchen – Leitbild entwickeln
3.2 Ziele formulieren – Wirkungen fokussieren
3.3 Handlungsfelder festlegen und priorisieren
3.4 Maßnahmen planen – Verantwortung festlegen
3.5 Ziele überprüfen – Qualität sichern
Teil B: Was es schon gibt – abgucken erlaubt
Lernen vor Ort
StädteRegion Aachen: Übergangsmanagement Schule–Beruf–Studium
StädteRegion Aachen: Schulentwicklungsbegleitung
Stadt Freiburg: Freiburger Lupe
Stadt Freiburg: Partizipative Qualitätssicherung
Stadt Leipzig: Bildungspolitische Stunde im Stadtrat
Stadt Leipzig: Bildungsreport
Bildungsregion Ostwestfalen-Lippe
Servicestelle Bildungsregion OWL
Kreis Gütersloh: Bildungsberichterstattung
Kreis Herford: Entwicklung eines Zielsystems
Kreis Höxter: Lernwerkstätten zur MINT-Förderung
Kreis Paderborn: Bildungsbotschafter
Teil C: Aktuelle Herausforderungen in der Bildung vor Ort
Demographischer Wandel
Lebenslanges Lernen
Inklusion
Bildungsort Familie
Frühkindliche Bildung
Ganztagsbildung
Schulische Bildung
Weiterbildung
Die Autorin
Abstract
Bildung vor Ort – Herausforderungen annehmen
Dr. Anja Langness, Heinz Frenz, Dr. Kirsten Witte Bertelsmann Stiftung, Programm LebensWerte Kommune
Bildung ist die Schlüsselressource für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Für den einzelnen Menschen entscheidet sie über die Chance, selbstverantwortlich die eigene Lebensperspektive zu verwirklichen und aktiv unser demokratisches Gemeinwesen zu gestalten. Angesichts des demographischen Wandels kann es die Gesellschaft sich nicht leisten, ihre Talente und Ressourcen ungenutzt zu lassen (Bertelsmann Stiftung 2011). Doch in kaum einem anderen Land werden die Bildungschancen – und damit die Zukunftsperspektiven – so stark durch die soziale Herkunft bestimmt wie in Deutschland. Bund, Länder und Kommunen sind aufgefordert, gemeinsame Strategien für ein chancengerechtes Bildungswesen zu entwickeln.
Kommunen sind in erheblichem Maße für das Bildungsangebot vor Ort verantwortlich. Zugleich stehen sie vor immensen Herausforderungen, die eng mit der Bildung vor Ort verknüpft sind:
•Viele Kommunen haben schon heute mit den Folgen unzureichender Bildung zu kämpfen: mangelnde Integration, immer weniger Menschen, die am gesellschaftlichen Leben teilhaben, und Unternehmen, die Standorte verlassen, weil keine Bildungs- und Wissensstruktur vorhanden ist (vgl. Haugg 2012). Trotz einer historisch guten Einnahmesituation und niedriger Zinsen rutschen viele Städte und Gemeinden immer tiefer in eine Schuldenspirale. Es sind vor allem die ständig steigenden Sozialkosten, die den Kommunen diese Finanzaufwendungen aufbürden. Langfristig helfen hier nur Strategien, die solche Sozialkosten im Ansatz vermeiden. Kommunen sind daher gefordert, sich aktiv für bessere Bildung vor Ort einzusetzen.
•Der soziale Wandel und insbesondere die in den Kommunen nehmen zu: Ganze Stadtteile driften hinsichtlich Einkommen, Bildungsstand, Migrationshintergrund, Kinderzahl usw. auseinander (vgl. Strohmeier 2008; Seidel-Schulze, Dohnke und Häußermann 2012; Weiss 2011). Bezirke, in denen die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben, sind zugleich auch die kinderreichsten. In diesen Bezirken ist das Armutsrisiko am höchsten. Und auch hier ist kommunales Handeln gefragt: Kommunen müssen dieser Segregation entgegenwirken bzw. Strategien entwickeln, um die negativen Effekte sozialräumlicher Segregation deutlich zu reduzieren.Positive Effekte zeigen integrierte Stadtentwicklungskonzepte, innerhalb derer ressortübergreifende Handlungsstrategien entwickelt und umgesetzt werden. Orientiert an den einzelnen Sozialräumen werden Jugendhilfeplanung, Bildungsplanung, Wohnungsbau, Stadtteilerneuerung usw. aufeinander abgestimmt. Kommunen brauchen differenzierte und zielgruppenspezifische Maßnahmen, die Bildung für alle ermöglichen und so Chancengerechtigkeit herstellen. Das gelingt beispielsweise im Rahmen einer umfassenden Stadtteilarbeit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!