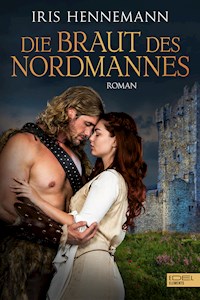Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Königin im Schatten
- Sprache: Deutsch
Herzogtum Sachsen 1069 n. Chr. Die junge Königin Bertha hasst ihr Leben. Sie wird gedemütigt und gemieden von ihrem lasterhaften Gemahl, König Heinrich IV. Heimtückisch plant er, sich mithilfe einer schäbigen Intrige von ihr zu trennen. Sie wird jedoch von dem sächsischen Adligen Arend gewarnt, den bald darauf das Schicksal zu ihrem Leibwächter bestimmt. Zwischen ihnen entflammt eine heimliche, gefährliche Liebe. Zu dieser Zeit ist Sachsen ein entfachter Glutkessel. Die stolzen Fürsten verabscheuen ihren König, der sie mit seiner brutalen Burgenbaupolitik im Harz aufs Schärfste provoziert. Als sich die erzürnten Sachsen gegen ihren König erheben und einen Krieg entfesseln, muss sich Arend entscheiden: Soll er an Berthas Seite bleiben oder seinen Eid brechen und das Schwert gegen seinen König erheben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Herzogtum Sachsen 1069 n. Chr. Die junge Königin Bertha hasst ihr Leben. Sie wird gedemütigt und gemieden von ihrem lasterhaften Gemahl, König Heinrich IV. Heimtückisch plant er, sich mithilfe einer schäbigen Intrige von ihr zu trennen. Sie wird jedoch von dem sächsischen Adligen Arend gewarnt, den bald darauf das Schicksal zu ihrem Leibwächter bestimmt. Zwischen ihnen entflammt eine heimliche, gefährliche Liebe. Zu dieser Zeit ist Sachsen ein entfachter Glutkessel. Die stolzen Fürsten verabscheuen ihren König, der sie mit seiner brutalen Burgenbaupolitik im Harz aufs Schärfste provoziert. Als sich die erzürnten Sachsen gegen ihren König erheben und einen Krieg entfesseln, muss sich Arend entscheiden: Soll er an Berthas Seite bleiben oder seinen Eid brechen und das Schwert gegen seinen König erheben?
Iris Hennemann
Königin im Schatten
Der Leibwächter
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Iris Hennemann
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Ashera Literaturagentur
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Lektorat: Susann Harring
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-245-1
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Dramatis Personae
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Glossar
Dramatis Personae
Liste der wichtigsten Personen (historische sind mit einem * gekennzeichnet)
Bertha von Turin*, Königin, Gemahlin von Heinrich IV.
Heinrich IV.*, König des Heiligen Römischen Reiches
Tilda, Dienerin von Bertha
Ada, Dienerin von Bertha
Imma, Dienerin von Bertha
Hedi, Kebsweib von Heinrich
Ortrun, Kebsweib von Heinrich
Trude, Kebsweib von Heinrich
Adelheid*, ältestes Kind von Bertha
Heinrich*, zweites Kind von Bertha
Agnes*, drittes Kind von Bertha
Benno, Leibwächter des Königs
Kuno, Leibwächter des Königs
Eilbrecht von Hadenstein, Vater von Arend
Giselher von Hadenstein, ältester Sohn von Eilbrecht
Suidger von Hadenstein, zweitältester Sohn von Eilbrecht
Arend von Hadenstein, drittältester Sohn von Eilbrecht, Leibwächter von Bertha
Sieghild, Weib von Arend
Giselher, ältesterSohn von Arend
Arwed, zweiter Sohn von Arend
Osmund, dritterSohn von Arend
Folkmar von Furtburg, Freund von Arend, Berthas Leibwächter
Simon, Knecht von Folkmar
Erkmar, Knecht von Arend
Agnes von Poitou*, Kaiserin; Mutter des Königs
Adelheid II. von Gandersheim*, Schwester des Königs, Äbtissin in Quedlinburg
Imula von Turin*, Tante von Bertha
Erzbischof Anno II. von Köln*
Erzbischof Adalbert I. von Bremen und Hamburg*
Erzbischof Siegfried I. von Mainz*
Bischof Benno II. von Osnabrück*, Baumeister
Bischof Friedrich von Münster*
Abt Hugo von Cluny*, Taufpate von Heinrich IV.
Egeno II. von Konradsburg*, Freund von Arend
Egeno I. von Konradsburg*, Großvater von Egeno II.
Gebhard von Süpplingenburg*, Graf im Harzgau
Lothar Udo II. von Stade*, Markgraf der Nordmark
Magnus Billung*, Sohn des Herzogs von Sachsen
Otto von Northeim*, Herzog von Bayern
Rudolf von Rheinfelden*, Herzog von Schwaben
Berthold I. von Zähringen*, Herzog von Kärnten
Welf IV.*, Schwiegersohn von Otto von Northeim
Kapitel 1
Goslar, März 1069 n. Chr.
Die Flamme am Ende des Dochtes kämpfte tapfer gegen die Finsternis des Gemachs an. Sie erleuchtete die unebenen Steinwände und die Tischplatte, auf der schimmernder Schmuck achtlos verteilt lag. Geheimnisvoll glühten die Rubine, Amethyste und Smaragde und flüsterten trügerisch von Sorglosigkeit und Glück.
Doch tiefe Schluchzer der jungen Königin Bertha ließen sie erzittern, sodass sie sich immer wieder zusammenzog, als würde sie sterben. Aber sie erwachte jedes Mal aufs Neue und fraß sich durch die Kerze, verwandelte das Wachs zu klarem Gold.
Vor Berthas Augen verschwamm die Flamme, wodurch das Licht einem Strahlenkranz glich. Bitternis bedrückte die Königin, kroch in ihre Kehle und wurde zu einem schweren Stein. Bertha hasste ihr Leben. Nur wenn sie allein war, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf. In Gesellschaft musste sie sie hinter dicken Mauern verbergen, durfte sich ihre Verletzlichkeit und Einsamkeit nicht anmerken lassen. Ja, sie war einsam – so einsam, dass ihr Herz allmählich verkümmerte.
Bertha war eine Gefangene ihres Standes, eine Gefangene des Königshofs … eine Königin im Schatten. Tränen zogen Spuren über ihre Wangen und hinterließen einen salzigen Geschmack auf ihren Lippen.
Lärm ertönte auf dem Gang vor ihrer Tür. Schritte und Gelächter. Doch die fröhlichen Stimmen bedrückten ihr Herz nur noch mehr. Ihr Gemahl, König Heinrich IV., begab sich mit seinen Kebsweibern in das gegenüberliegende Gemach, getrieben von der Begierde seiner Jugend, von der Ruchlosigkeit seines Charakters. Dies war fast jeden Abend so. Sein Handeln demütigte Bertha, obwohl es ihr aufgrund seiner Unberechenbarkeit ganz recht war, dass er nicht ihr Bett aufsuchte. Er hatte es noch nie getan.
Als sie vier und er fünf Jahre alt gewesen waren, hatte man sie miteinander verlobt. Sie war die Tochter des Grafen Otto von Savoyen und der Adelheid von Susa. Kaiser Heinrich III. hatte die Verlobung zwischen seinem Sohn und ihr eingefädelt, weil ihm diese Verbindung einen freien Weg über die Alpenpässe von Burgund nach Italien gesichert hatte. Somit war er nicht mehr auf die Wege über die Alpen angewiesen gewesen, die im Machtbereich seines jahrelangen Feindes Gottfried dem Bärtigen lagen. Seitdem hatte Bertha am Königshof gelebt und eine hervorragende Erziehung genossen. Doch was nützte dies? Heinrich mied sie, als ob sie die Krätze hätte. Schon als Kind hatte er sie nicht ausstehen können. Dabei war sie klug und hübsch. Weizenblonde Haare umrahmten ihr Gesicht mit den dunkelblauen großen Augen. Ihre Nase war klein, und die Lippen waren schön geschwungen. Bertha war sich sicher, dass er sie noch nie bewusst angeschaut hatte, sondern in ihr noch immer das zickige Mädchen sah, das ihn so oft als Rache für seine Hänseleien und Gemeinheiten gekratzt und einmal sogar gebissen hatte.
Nun waren er achtzehn und sie siebzehn Jahre alt, und am Hof tuschelte man bereits hinter vorgehaltener Hand, da sie noch immer kinderlos waren. Doch wie sollte sich dieses ändern? Sehr deutlich zeigte er ihr, dass er sie als Weib nicht wollte, und sie spürte, dass er nach einem Weg suchte, sie loszuwerden. Er ließ sogar ihre Tür unbewacht, als hoffte er, dass sich jemand in eindeutigen Absichten Zugang verschaffte, und er sie dann verstoßen konnte.
Der einzige Grund, aus dem er sie vor drei Jahren geheiratet hatte, war aus Respekt vor seinem verstorbenen Vater – und weil seine Ratgeber und seine Mutter ihn dazu gedrängt hatten.
Heinrich war zumeist wortkarg, brutal, ausschweifend, wetterwendisch, oft krank und dennoch zäh. Es ekelte sie an, dass er mit seinen Freunden nachts in den Dörfern umherstreunte und die Töchter und Weiber der Bauern schändete. Am Hof wurde dieses Treiben stets als böse Unterstellung der Sachsen abgetan. Doch Bertha hatte selbst gehört, wie Heinrich sich mit seinen Freunden darüber amüsiert hatte, dass er beinahe von einem wütenden Bauern erschlagen worden wäre, der dem König seine Tochter entrissen hatte. Heinrich sah es als ein reizvolles Spiel an und genoss seine Macht.
Nein, Respekt vor Frauen besaß er nicht. Vor allen Dingen war er enttäuscht von seiner Mutter, Kaiserin Agnes, die nach dem frühen Tod ihres Gemahls die Regentschaft für ihren damals fünfjährigen Sohn übernommen und aus politischen Gründen so viel des Königsgutes und auch Herzogtümer an Adlige verteilt hatte. Als Elfjähriger war er entführt worden, und er verübelte es ihr, dass sie – in seinen Augen – nichts dagegen unternommen hatte. Zudem hatte sie zum Schisma in Rom beigetragen, sodass Heinrich nun auch dort weniger Einfluss besaß. Nach seiner Schwertleite hatte sie sogleich den Schleier genommen und sich – um der schmierigen Politik zu entkommen – geradezu fluchtartig ins Kloster Fruttuaria nach Italien zurückgezogen. Er verkannte, dass es ihr gelungen war, ihm trotz allem die Herrschaft zu sichern.
Schon immer hatten sich die Mächtigen wie hungrige Wölfe um Heinrich gerissen, stets nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht. Dies alles hatte den jungen König zu einem verbitterten, tieftraurigen und misstrauischen Menschen werden lassen. Bertha war sich nie sicher, was er als Nächstes plante. Nur eines wusste sie sicher: Niemals würde er ihr Gemach betreten. Selbst in ihrer Hochzeitsnacht vor drei Jahren hatte er es nicht getan, sondern sich mit einem Kebsweib vergnügt. Damals hatte Bertha sterben wollen und sich in den Schlaf geweint. Doch sie war stark, kämpfte darum, jeden Tag in Würde zu verbringen.
Sie tauchte ihren Finger kurz in das flüssige Wachs. Scharfer Schmerz breitete sich bis zur Handwurzel aus. Dann erkaltete das Wachs, spannte sich gelbmilchig über ihre Fingerkuppe, und Bertha entfernte es vorsichtig.
Im gegenüberliegenden Gemach wurde laut gelacht. Heinrich war nur dann so ausgelassen, wenn er betrunken war.
Bertha warf das Gebilde wieder in die Kerze und sah zu, wie es von der Flamme angegriffen wurde, sich verformte und im heißen Wachs auflöste, so als hätte es nie bestanden. So wie ich. Wenn ich einmal tot bin, wird auch niemand wissen, dass ich existiert habe.
Die Geräusche in Heinrichs Gemach wurden eindeutiger.
Er benahm sich so gar nicht königlich. Aber es war ja auch kein Wunder, da er doch von seinem Berater, Erzbischof Adalbert I. von Bremen und Hamburg, so überaus eifrig ermuntert wurde, seine Jugend zu genießen. So triebhaft, wie Heinrich war, war es eigentlich erstaunlich, dass er Bertha nicht anrührte. Aber sie war sich sicher, dass dies Ausdruck seines Protestes gegen seine Mutter und einige Berater war.
Gegenüber ging es nun hoch her, und Bertha fühlte sich zutiefst gedemütigt. Vor ein paar Tagen hatte sie ihn gebeten, ihr einen anderen Schlafraum zuzuweisen, diesen Wunsch hatte er allerdings mit einem schäbigen Grinsen abgelehnt. Er genoss es, sie auf diese Weise zu verletzen, sie ihre Nichtigkeit spüren zu lassen.
Endlich wurde es stiller. Die Kebsweiber verbrachten zumeist die ganze Nacht bei ihm, falls es ihn nochmals nach ihnen gelüstete. Er schenkte ihren Gefühlen nicht mehr Achtung als einem Krug Wasser, den er leeren und auch zerschlagen konnte.
Bertha erhob sich vom Stuhl, nahm die Kerze mit sich und stellte diese auf einem schmalen Tisch ab. Dann legte sie sich ins kalte Bett, schlüpfte unter die Wolldecken und weichen Felle und pustete die Flamme aus.
Finsternis breitete sich im Gemach aus. Die schmalen Fenster waren mit Holzläden verschlossen und mit Vorhängen versehen, um vor der Kälte zu schützen. Lediglich unter dem schmalen Spalt der Eichentür schien Fackellicht aus dem Gang herein, anfangs spärlich, doch nachdem sich ihre Augen daran gewöhnt hatten, erschien es ihr zunehmend heller.
Die Königin war schon vor einigen Jahren zur Frau erblüht, doch wenn sich Heinrich ihr gegenüber weiterhin so abweisend verhielt, würde sie sterben wie ein kahler Strauch, nichts hinterlassend. Wie gern hätte sie ein Kind, dem sie Lieder vorsingen könnte, während es sich an sie schmiegte. Ein Kind von Heinrich … Auch wenn es gegen alle Vernunft war, empfand sie trotzdem Liebe für ihn und ersehnte sich seine Zuneigung.
Sie erschrak, als ihre knarrende Tür geöffnet wurde und Lichterschein wie ein hinterlistiger Feind eindrang. Dann erkannte sie Tilda, ihre ehemalige Amme, die sie damals zusammen mit zahlreichen anderen Dienern an den Kaiserhof begleitet hatte. Sie war ihre Vertraute, fast wie eine Mutter, ein Sonnenstrahl in Berthas finsterer Welt.
„Soll ich Euch ein wenig wärmen?“, erkundigte sich Tilda mit ihrer tiefen, melodischen Stimme. Der Schein des stinkenden Talklichts lag golden auf ihrem Schultertuch und dem langen Leinenhemd, das sich an ihren rundlichen Körper schmiegte.
Bertha setzte sich auf. „Gern, ich friere entsetzlich.“
„Das ist Eure Seele, die keine Wärme erfährt.“ Tilda stellte das Talklicht auf eine Truhe, legte ihr Wolltuch ab und huschte zu ihr unter die Decke. In ihrem dunklen Haar glitzerten vereinzelte silberne Strähnen.
Die kleine Frau streckte ihre rauen, warmen Füße aus und tastete nach Berthas. „Kind, die sind ja wie aus Eis.“ Vertraulich schob sie die Haare aus der Stirn ihrer Königin. „Ich habe mir schon gedacht, dass Ihr noch wach seid. Euer holder Gatte hat sich beim Mahl wieder äußerst schäbig benommen. Gott weiß, Ihr habt es wirklich nicht leicht.“
„Ja, aber Heinrich auch nicht … Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass sein Leben seit dem Tod seines Vaters unberechenbar ist. Wie hätte aus ihm ein einfühlender Mensch werden sollen? Schließlich wollten ihn die Fürsten als Fünfjährigen ermorden und haben ihn als Kind in Kaiserswerth entführt, um das Reich zu verwalten. Und wenige Jahre später haben die Erzbischöfe Anno von Köln und Adalbert von Bremen und Hamburg um ihn gerungen. Sie tun es bis heute. Ich hasse Adalberts Einfluss …“
„Ihr verteidigt Heinrich?“
„Nun, Adalbert erhebt nie den moralischen Zeigefinger, sondern hat Heinrich schon immer zu Suff, Spiel und Hurerei ermuntert, denn so konnte er ihn von den Reichsgeschäften ablenken und diese selbst führen. Selbst jetzt, da Heinrich der beständigen Machtspiele seiner bisherigen Berater überdrüssig ist, umgibt er sich zunehmend mit viel zu jungen Ratgebern niederer Geburt, und dies ruft die Empörung des Adels hervor. Aber Adalbert lässt dies geschehen und ermahnt ihn nicht.“
Tilda zog die Augenbrauen empor. „Nein, das tut Adalbert nicht und jetzt schon gar nicht, da er an Einfluss verloren hat. Er konkurriert mit den jungen Ministerialen, die für Heinrich verlässlicher sind, da deren eigenes Wohl mit dem des Königs verknüpft ist.“
„Das ist wahr, und Heinrich hasst es, dass er sich dennoch stets aufs Neue mit den kirchlichen und weltlichen Fürsten arrangieren muss“, bemerkte Bertha.
Die Frauen verstummten kurz, da laute Geräusche vor der Tür waren. Es war jedoch nur ein verfrühter Wachwechsel vor Heinrichs Gemach. Tilda lauschte noch kurz den Stimmen, die davon sprachen, dass Kuno, der bullige Leibwächter, unter heftigen Kopfschmerzen litt. Dann wandte sie sich wieder der Königin zu. „Doch noch hört Heinrich oft auf Adalbert, und dessen Rat ist momentan gefährlich, da er Euren Gemahl emsig beim Burgenbau im Harz unterstützt. Dabei sind die Sachsen ohnehin schon erbost, weil sich Heinrich zu oft in Goslar aufhält, anstatt von Pfalz zu Pfalz zu ziehen, wie es sich gehört. Für die Menschen hier ist unsere Hofhaltung bitter, denn ihnen selbst verbleibt oft nicht viel, nachdem wir versorgt sind. Ich kann deren Abneigung auf den Märkten deutlich spüren, und ich sehe dunkle Wolken am Horizont aufziehen, mein Herzchen, ganz dunkle. Aber ich halte für Euch meine Ohren auf. Nicht umsonst teile ich das Lager mit einigen bedeutenden Männern am Hof. Ich tue dies nur für Euch, um Euch Informationen zu beschaffen und Eure Stellung zu stärken. Ich habe die Hoffnung, dass Ihr eines Tages politische Entscheidungen treffen könnt.“ Tilda seufzte, doch dann lächelte sie entschuldigend. „Da bin ich eigentlich gekommen, um Euch aufzumuntern, und stattdessen reden wir mal wieder nur über Heinrich.“ Mütterlich drückte sie die junge Königin an sich. „Ach Bertha … Bertha, die Glänzende. Ich wünsche mir so sehr, dass Ihr noch richtig erstrahlen werdet wie die Sonne. Wer weiß…“ Sie gluckste. „Morgen früh geht Heinrich zur Jagd. Vielleicht rammt ihm ja ein Wildschwein die Hauer in den Leib.“
Betrübt verzog Bertha den Mund.
Mitleidig seufzte Tilda. „Ich weiß, Ihr ersehnt Euch seine Liebe und hofft, dass er seine Kebsweiber verstößt. Aber Ihr könnt von ihm nichts erwarten, denn seine Seele ist kalt wie ein Fisch. Hoffen wir auf den Eber, dann wäret Ihr frei für einen besseren Mann.“ Sie kicherte, küsste ihr die Stirn und kroch unter den Decken hervor. „Ich denke, Eure Füße sind jetzt warm genug. Morgen lege ich Euch mal wieder einen heißen Stein ans Fußende, bevor Ihr schlafen geht.“ Sie hängte sich schwungvoll das Tuch um die Schultern und nahm das stinkende Talglicht. „Bis morgen, meine süße Königin!“ Sie ging aus dem Gemach und ließ Bertha mit einer Flut von Gedanken und Gefühlen zurück.
„Schönen guten Morgen, Herrin! Schaut nur, wie herrlich die Sonne scheint!“, flötete Ada.
Müde blinzelte Bertha. Sie hätte gern ein wenig länger geschlafen, doch ihre beiden Dienerinnen Ada und Imma waren bereits wie fleißige, summende Bienen in ihr Gemach eingedrungen, hatten die Vorhänge und Holzläden eines der Fenster geöffnet und wirbelten im großen Raum umher.
Die Sonne schien als breiter Streifen durch das Fenster, viel zu grell, fast aufdringlich.
Widerwillig setzte sich die junge Königin auf, und die hübsche rothaarige Ada, die sich hier im Gemach von ihrem Kopftuch befreit hatte, kniete sich geschwind neben sie und streifte ihrer Herrin die Lammfellschuhe über.
Die andere Dienerin, Imma, war gerade dabei, hinter einem zurückgezogenen Vorhang die auf einem Tisch stehende Waschschüssel mit heißem Wasser zu füllen. In bizarren Kreiseln zog der Dampf der hohen hölzernen Decke des Raumes entgegen.
Berthas Blick wanderte kurz durch ihr Gemach. In den Ecken standen aufwendig verzierte Truhen, und vor den Fenstern befanden sich ein massiver Tisch, Stühle und Bänke. Auf dem Tisch wartete bereits eine Holzschüssel, die mit einem Brettchen zugedeckt war, damit sich der darin befindliche morgendliche Getreidebrei nicht zu rasch abkühlte. An den Wänden neben dem Bett und an den Außenmauern hingen große Teppiche und Felle, um den Raum wohnlicher zu gestalten und ein wenig vor der Kälte zu schützen. Dort standen auch der Webstuhl, das Gestell für die Brettchenweberei und der Korb mit Spinnwirteln, Flachs und Wollflies. Für diese Gegenstände hegte Bertha zwiespältige Gefühle. Zwar war sie äußerst fingerfertig, doch bei diesen Tätigkeiten kam bei ihr keine rechte Freude auf. Als edle Frau gehörten Handarbeiten zu ihren Aufgaben, aber sie schaute lieber aus dem Fenster und träumte von langen Ausritten und einsamen Spaziergängen. Oft wünschte sie sich, ein Mann zu sein, der nicht so vielen Zwängen unterlag. Sie fühlte sich zu mehr berufen als zu Handarbeiten und der Mitverwaltung des königlichen Haushalts. Ihr strebte der Sinn durchaus nach Politik, und manchmal war sie der festen Meinung, dass sie einige Dinge geschickter geregelt hätte als ihr Gemahl.
„Herrin, Ihr habt heute lange geschlafen, und Tilda meinte, wir sollten Euch in Ruhe lassen. Doch – der König ist bereits von der Jagd zurück, und er – verlangt nach Euch.“ Hektischen Fliegen gleich verließen die Worte den schmalen Mund der kleinen aschblonden Imma. Wie reife Beeren leuchteten ihre Wangen, und sie rieb sich die lange, dünne Nase.
„Wie?“ Bertha traute ihren Ohren nicht.
„Der König – Heinrich. Er will Euch sehen“, trällerte die magere Imma.
Sogleich wanderte Berthas ungläubiger Blick zur kessen rothaarigen Ada. „Es stimmt. Er möchte tatsächlich, dass Ihr erscheint. Ich glaube, Ihr sollt seine Jagdbeute bestaunen. Er ist draußen, umgeben von seinen Schranzen … Aber es sind auch zwei junge Kerle dabei, die ich bisher noch gar nicht hier am Hof gesehen habe. Sie sind sehr hübsch, und ich wüsste gar nicht, welchen von beiden ich zuerst küssen sollte.“ Schelmisch lächelte die Dienerin.
„Ada, zügle deine Zunge!“, ermahnte Bertha sie streng, die bei Adas Ausspruch errötet war. Dann zog sie ihre Stirn unverständig in Falten. „Aber Heinrich wollte doch noch nie, dass ich mir seine Jagdbeute anschaue.“
„Nun, ich glaube, er hat heute etwas ganz Besonderes erlegt. Vielleicht einen Erzbischof auf silbernem Tablett“, scherzte Ada, aber Bertha hörte gar nicht richtig zu.
In der Brust hüpfte ihr das Herz, und eine Flut von Gefühlen überwältigte sie. Er will mich sehen! Mich!
Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Doch sie durfte ihn nicht zu lange warten lassen, nicht dass er es sich wieder anders überlegte. Rasch schob sie sich ein paar Löffel des mit Honig und Zimt gesüßten Hirsebreis in den Mund, zog sich hinter den Vorhang zurück, wusch sich und ließ sich dann von den Dienerinnen beim Ankleiden helfen. Ada streifte ihrer Herrin weiße Strümpfe über, die unter den Knien mit Bändern gehalten wurden, dann folgten dunkelbraune Schuhe. Über das weiße Leinenunterhemd wurde ein rotes Untergewand gezogen, das bis zu den Fußknöcheln reichte und an den Ärmeln eng zugeschnitten war. Darüber zog Ada ein weites Kleid aus feinstem blauem Scharlach, das mit Perlen und Goldfäden bestickt war. Nun war die Königin prächtig gewandet, im Gegensatz zu ihren Dienerinnen, die braune und graue Kleider aus gröberen Stoffen trugen. Ada kämmte ihrer Herrin die langen Haare, riss ein paar verknotete Strähnen recht ruppig auseinander und flocht schließlich in zwei dicke lange Zöpfe blaue Seidenbänder ein.
„Fertig! Jetzt fehlt nur noch der Schmuck. Soll ich gleich den nehmen, den Ihr so lieblos auf den Tisch gelegt habt?“ Ada stellte sich vor ihre Königin und betrachtete sie, während Imma ihrer Herrin einen langen hellblauen Seidenschleier um das Haupt legte und mit Haarnadeln befestigte. Die fröhliche Ada zog eine Strähne an der Stirn ein wenig unter dem Schleier hervor.
„So sieht es schöner aus. Also, nehmen wir den Schmuck dort?“ Kaum hatte Bertha genickt, da hatte ihr die Dienerin schon den goldenen mit Amethysten besetzten Armreif übergestreift, die Kette mit den Rubinen umgehängt und den Smaragdring über den Finger gezogen.
„Sehr schön, wunderschön!“, urteilte Ada und wippte aufgeregt auf den Zehenspitzen. „Wenn er heute wieder nicht erkennt, wie schön Ihr seid, dann ist und bleibt er ein Narr!“
„Achte auf deine Worte!“, ermahnte die besonnene Imma und legte mahnend den Finger auf die schmalen Lippen.
Gleichgültig zuckte Ada die Achseln und schenkte ihr ein keckes Lächeln. „Wir sind hier unter uns, und wir haben uns schon viel schlimmere Dinge über unseren hohen Herrn erzählt – viel, viel schlimmere.“
Nur zaghaft lächelte Bertha. Prüfend blickte sie in einen polierten Silberspiegel, wagte gar nicht zu hoffen, dass Heinrich sie diesmal bewusst betrachten würde. Er besaß das Talent, selbst dann durch sie hindurchzuschauen, wenn sein Blick auf sie gerichtet war. Durch diese Missachtung empfand sie sich selbst als unscheinbar.
Ada legte ihr einen roten Wollmantel über die Schultern und verschloss diesen mit einer prachtvollen goldenen Fibel.
„Lasst uns gehen!“ Bertha holte tief Luft und schritt mit ihren getreuen Dienerinnen durch die Gänge im Wohngebäude, die Treppe hinunter, vorbei am Wintersaal zum Portal. Rechterhand vor dem Palas ragte die unter Heinrichs Großvater – Konrad II. – errichtete Liebfrauenkapelle empor. Sie war durch einen ummauerten Gang mit dem Palas verbunden, sodass das Königspaar ungesehen in das Gotteshaus gelangen konnte.
Vor dem Palas erstreckte sich ein freier Platz, der von den Wirtschaftsgebäuden, Werkstätten, Gäste- und Gesindehäusern umrahmt war. Die Ställe, Scheunen und Lager hingegen befanden sich auf der Rückseite der Pfalz. In südwestlicher Richtung erhob sich der Rammelsberg, der Goslarer „Silberberg“, in dem auch andere Erzarten unter schwierigsten Bedingungen gefördert wurden. Dieses Silber war bedeutend für Heinrich, brachte ihm Reichtum und Einfluss.
Der Front der erhöht gelegenen Pfalz gegenüber stand die dreischiffige Basilika St. Simon und St. Judas mit den angrenzenden Stiftsgebäuden, die Kaiser Heinrich III. mit teurem Blei aus dem Rammelsberg hatte decken lassen. Als sein Sohn elf Jahre alt gewesen war, hatte ein blutiges Gemetzel vor deren Altar wegen der Sitzordnung des Bischofs Hezilo von Hildesheim und des Abtes Widerad von Fulda stattgefunden. Für Heinrich war dies ein einschneidendes Erlebnis gewesen, wie sich Bertha erinnerte. Hezilo hatte vor dem Gottesdienst den Grafen Ekbert I. von Braunschweig mitsamt seinen Kriegern hinter dem Altar verborgen und diese während der Messe zu sich gerufen. Mit Knüppeln und Fäusten hatten sie auf die Männer des Abtes eingeschlagen, dem wiederum dessen eigene Streiter zu Hilfe gekommen waren. Als Heinrich den edlen Herren entsetzt befohlen hatte, mit den Kämpfen aufzuhören, hatte er nicht mehr Beachtung gefunden als eine Küchenschabe. Er hatte sich resigniert in die Pfalz zurückgezogen, und Otto von Northeim hatte schließlich durchgegriffen und weiteres Blutvergießen verhindert.
Die beiden achteckigen Türme der derzeit größten Kirche im Reich ragten hoch empor. Das Westwerk dieser bedeutenden Basilika war genau auf die Mitte des Kaiserhauses ausgerichtet. In diesem Gotteshaus war auch Heinrichs Schwester Mathilde von Schwaben bestattet, die vor neun Jahren gestorben war. Zudem beherbergte es das Herz von Kaiser Heinrich III., der sehr an Goslar gehangen hatte, während sein restlicher Leib in der Familiengrablege in Speyer ruhte. Das an der Basilika angrenzende Stift war eine wahre Bischofsschmiede, selbst Erzbischof Anno war dort einmal Propst gewesen.
Hier in Goslar stellten sich die kaiserliche und die kirchliche Macht in beeindruckender Weise dar, doch das Kaiserhaus hatte von der Lage her die eindeutig höhere Stellung, da es auf einem seichten Hügel thronte.
Bertha mochte diese Pfalz sehr, die von einer starken Befestigung und herrlichen Hügeln umgeben war. Im Sommer waren die sanften Erhebungen smaragdgrün bewaldet, doch nun ragten lediglich braungrüne Stämme mit kahlen Zweigen empor, einem verzauberten Dornenwald gleich. Zu Füßen der Pfalz befanden sich in nördlicher Richtung die Häuser der Stadtbewohner und Bergleute. Doch sie brachten ihnen keine Liebe entgegen, da der königliche Hof sie aussaugte wie eine Zecke.
Berthas Hände zitterten. Vor Aufregung ging ihr Atem schneller, und ihr wurde ein wenig schwindelig. Da war er: der König! Hochgewachsen, wie er war, überragte er fast alle anderen. Er hatte die breiten Schultern eines trainierten Kämpfers und eine schmale Taille. Gekleidet war er in eine dunkelgrüne knielange Tunika und hirschlederne Beinlinge. Das dunkelblonde Haar reichte ihm bis über die Ohren, und ein kurz gestutzter Bart zierte sein schmales Gesicht.
Er war umringt von Dienern, zahlreichen Jagdhelfern und einigen Beratern. Bertha erkannte sofort seine bärenstarken Bewacher Kuno und Benno, die windige Gestalt Regengar und viele andere Adlige und Ministeriale, die oft am Hof weilten, Heinrich umschmeichelten und sich eigene Vorteile versprachen. Doch wenigstens standen sie treu zu ihm.
Emsig unterhielt sich der König mit zwei ihr unbekannten jungen Männern. Der eine war fast einen Kopf kleiner als Heinrich, hellblond mit gleichfarbigem Bart und von muskulöser Statur. Dieser Schönling war wohl Mitte zwanzig und sich seiner Attraktivität ohne jeden Zweifel bewusst. Er lächelte breit und viel, und seine Gesten waren lebhaft und ausladend, ganz im Gegensatz zu dem anderen braunhaarigen Krieger, der vielleicht ein Jahr älter als der König war und diesen sogar noch um einiges überragte. Er war hübsch, hatte einen kurz gehaltenen Bart und wirkte zurückhaltend – und irgendwie düster. Er war es, der Bertha mit seinen auffallend blauen Augen als Erster entdeckte. Erstaunt musterte er sie, konnte den Blick kaum von ihr wenden. Doch dann wurde der junge Kerl sich dessen bewusst, errötete und schaute mit seltsam betrübter Miene fort.
Als Bertha schon fast bei ihnen war, nahm auch Heinrich sein Weib wahr und stieß den Blonden mit dem Ellenbogen an. Nun waren alle Augen auf Bertha gerichtet. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen, war von der ungewohnten Flut an Aufmerksamkeit überfordert.
„Guten Morgen, meine Liebe! Das Jagdglück war mir hold. Schau, was ich alles erlegt habe.“ Heinrich bot ihr einladend seine Hand dar, lächelte übertrieben, mied aber den Blickkontakt mit ihr.
Wer war dieser Kerl? Heinrich gewiss nicht, wohl eher ein Wechselbalg. Hatte eine Hexe in den finsteren Harzwäldern ihren Mann ausgetauscht? Nein, Erzbischof Adalbert hatte vehement bestritten, dass es so etwas gäbe und dies nur Aberglaube sei. Und dennoch …
Unsicher trat Bertha zu Heinrich, und der König ergriff fest ihre kalte Hand, führte sie zu den leblosen Tieren, die auf dem Gras liegend ausgestellt waren. Als Bertha sich seiner Berührung richtig bewusst wurde und sie genoss, war sie auch schon wieder vorüber, denn Heinrich hatte seine Hand zurückgezogen und wischte diese unbewusst an der Tunika ab.
Ganz sicher war dies ihr Heinrich! Seine Hände waren verdreckt von der Jagd, aber ihre Berührung hatte er als unrein empfunden! Warum spielte er etwas vor, was nicht da war?
Zu ihren Füßen lagen ein Hirsch, ein Bieber und ein Luchs. Alle Tiere wiesen Spuren von Pfeilschüssen auf, die Felle waren blutverschmiert. Bertha tat der Luchs irgendwie leid. Er sah so niedlich aus mit seinen bauschigen Ohren und dem gesprenkelten ockergrauen Fell. Was für ein herrliches Tier! Und auch den Tod des Hirsches bedauerte sie. Vor wenigen Stunden noch war er stolz durchs Unterholz gestreift, nun hing dem mächtigen Tier die Zunge schlaff aus dem Maul wie ein Stofflappen. Ein König, ermordet von einem König …
Bertha wollte ihren Gatten auf keinen Fall verprellen. So setzte sie ein anerkennendes Lächeln auf. „Eine gelungene Jagd.“
„Ja, nicht wahr? Über den Luchs freue ich mich ganz besonders. Dieses wilde Geschöpf ist überaus scheu, und man bekommt es fast nie zu Gesicht.“ Er sprach mit ihr, als wäre sie sein geachtetes Eheweib. Was sollte diese alberne Posse?
Dann wies er auf die beiden jungen Männer. „Schau, meine Liebe, ich habe unterwegs Bekannte getroffen. Dies ist Egeno II. von Konradsburg.“ Er wies auf den Blonden, der sich breit lächelnd verneigte und sie dabei äußerst interessiert, fast schon frech beäugte. „Und dies ist Arend von Hadenstein.“
Der große Düstere nickte ihr nur kurz zu und schaute dann unverzüglich fort. Aber als Bertha ihren Blick von ihm genommen hatte, sah sie aus den Augenwinkeln heraus, dass er sie verstohlen betrachtete.
Egeno trat einen Schritt näher an sie heran und schwellte die Brust. „Unser edler König Heinrich hat mir von Euren grandiosen Schießkünsten berichtet. Jetzt, da ich Euch sehe, bin ich noch überraschter. Ihr seid von vortrefflicher Zierlichkeit, und – verzeiht mir – ich kann kaum glauben, dass diese zarten Hände einen Bogen halten können. Wäre es unverschämt, Euch um eine Kostprobe Eurer Fähigkeiten zu bitten?“ Er grinste von einem Ohr bis zum anderen und stemmte die Fäuste in die Hüften. In seinen blauen Augen lag ein begieriges Funkeln.
Die Röte schoss ihr in die Wangen, und der Blonde fühlte sich geschmeichelt. Das Funkeln in seinen Augen nahm noch mehr zu.
Ein Schatten huschte über Heinrichs Gesicht. Doch Bertha war sich sicher, dass nicht ihre Verlegenheit der Grund war, sondern ihre Fertigkeiten im Umgang mit Pfeil und Bogen. Schon als Kind hatte er es gehasst, sie nur auf weite Distanzen schlagen zu können. Fragend schaute sie ihn an, auf seine Erlaubnis hoffend. Unverzüglich nickte er, lächelte sogar, wenn auch verkrampft. Wie passte das alles zusammen?
„Nun gut, wenn es gewünscht wird.“ Bertha rief Ada herbei und bat sie, ihren Bogen zu holen.
„Wie kommt es, Herrin, dass Ihr das Bogenschießen erlernt habt? Ihr seid eine wunderschöne Königin, anmutig, aber verzeiht … dennoch nur ein Weib.“ Egenos Stimme war heiter, von einer erquickenden Lebendigkeit, die ihn noch interessanter machte. Neben ihm wirkten der Dunkelhaarige und auch Heinrich geradezu steif und hölzern.
Bertha war verunsichert, erwartete, dass Heinrich einen derben Spruch herausschleuderte, doch als dieser ausblieb, räusperte sie sich: „Nun, meine Mutter, Adelheid von Susa, wurde von ihrem Vater sogar am Schwert ausgebildet. Da ich nicht in ihrer Obhut aufgewachsen bin, konnte sie mir leider nicht in vollem Umfang die gleiche Ausbildung angedeihen lassen. Aber sie gab mir einen wehrhaften Krieger mit, als ich an den Kaiserhof kam, der mir das Bogenschießen und den Umgang mit dem Dolch beibrachte. Bevor er mich im Schwertkampf unterweisen konnte, ist er leider schwer erkrankt und kurze Zeit später gestorben.“ Voller Wehmut erinnerte sie sich an den Tag, als ihr großer, starker Bewacher in die kalte Erde gelegt worden war.
Der Hauch eines intriganten Grinsens huschte über Heinrichs Gesicht, und Bertha stutzte. Hatte er etwas mit dem Tod ihres Getreuen zu tun gehabt? Sie wischte diesen Gedanken fort, so böse wollte sie ihn nicht sehen.
„Eine Frau in Waffen. Interessant …“, begann der Schönling erneut, wurde aber jäh von Heinrich unterbrochen.
„Hätte Gott dieses gewollt, dann hätte er den Frauen keine weichen Brüste geschenkt, sondern harte Muskeln so wie uns Männern, nicht wahr?“ Er lachte gehässig und betrachtete Bertha aus den Augenwinkeln heraus.
Der Blonde grinste höflich, während der Stille mit den hellblauen Augen ernst blieb und ein wenig zurücktrat.
„Ah, der Bogen!“ Egeno schaute an Bertha vorbei, fixierte Ada, die mit Bogen und Köcher angehastet kam, und zwinkerte Bertha dann aufmunternd zu. Unverzüglich errötete diese bis zum Haaransatz, was Egeno zu gefallen schien.
Bertha warf den Mantel über die Schultern zurück, nahm die Waffe entgegen und spannte unter den kritischen Augen der Männer den Bogen. Sie zog einen Pfeil aus dem Köcher, den Ada ihr hinhielt. „Was soll das Ziel sein?“
„Ich jedenfalls nicht“, scherzte Heinrich, und doch erkannte sie diesen drohenden, missgelaunten Unterton, den er ihr gegenüber so oft anschlug und der so gar nicht zu seiner freundlichen Miene passen wollte.
Suchend schaute sich Egeno um. „Dort, der schmale Pfosten neben dem Haus. Oder ist dieses Ziel zu klein und zu weit entfernt?“
„Ada?“
Die Dienerin verstand und scheuchte die Menschen fort, die im Weg standen.
„Schade, jetzt sinkt der Reiz, falls unsere Herrin ihr Ziel verfehlt“, sagte Egeno lachend und zuckte unbekümmert mit den Schultern. „Verzeiht, nur ein kleiner Scherz.“
Bertha stellte sich in Position, umfasste den Bogen, legte den Pfeil auf den angewinkelten Finger ihrer Linken, spannte mit Zeige- und Mittelfinger der Rechten kräftig die Sehne, und schon surrte der Pfeil über den Pfalzhof und grub sich in das Holz.
„Donnerwetter!“, rief Egeno begeistert aus und nickte ihr lobend zu. „Aber ich bin mir sicher, ein weiterer Schuss, sagen wir eine Handbreit darüber, gelingt Euch nicht.“
Bertha legte wieder an, und der nächste Pfeil traf die gewünschte Stelle.
„Und ein weiterer … eine Handbreit unterhalb?“, neckte Egeno.
Wieder traf ein Pfeil wie gefordert.
Egeno streichelte über seinen hellen Bart und schob anerkennend die Unterlippe vor. „Hervorragend! Wie Diana, die römische Göttin der Jagd. Ich bin begeistert! Mein huldvoller König, Ihr könnt Euch rühmen, solch ein Weib Euer Eigen zu nennen. Herrin, Eure kühnen Schießkünste werden mich heute Nacht im Traum noch begeistern.“
Heinrichs Lippen zuckten säuerlich, doch er versteckte es schnell unter einem Lächeln. „Bertha, veranlasse alles, wir werden heute Abend ein Fest feiern. Ich will Spielleute zur Unterhaltung und den Hirsch und den Bieber als Braten auf der Tafel. Meine beiden Freunde hier werden als unsere Gäste am Hof verweilen.“
Bertha wusste nicht, ob sie sich darüber freuen sollte. Dieser Egeno musterte sie weiterhin geradezu unverschämt, während der Schweigsame dies eher heimlich tat.
„Ein Fest? Wir befinden uns in der Fastenzeit, da ist es unziemlich zu feiern und erst recht, Fleisch zu verzehren“, warf sie ein.
Sie erntete ein kaltes Schulterzucken ihres Gemahls. „Nun, der Bieber gilt als Fisch, dies ist ohne Fehl. Und der Hirsch … Sei getrost, meine Liebe, ich werde Buße tun.“
„Nun gut, wie du wünschst.“ Noch immer schwirrten Bertha die Sinne, und sie fragte sich, was hier eigentlich vor sich ging.
Kapitel 2
„Das kannst du nicht tun!“ Arend lehnte sich über den schmalen, wackeligen Holztisch zu Egeno vor, der ihm gegenübersaß.
Ihnen war ein winziges Gästehaus in Holzständerbauweise auf dem Pfalzgelände zugewiesen worden.
„Warum denn nicht? Stell dir vor: Heinrich hatte zuerst dich im Sinn, da er meinte, dass sie deinen blauen Augen unmöglich widerstehen könne. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er dies vergessen kann, da du ja so verdammt fromm und ehrbar seist. Das hat er ja neulich selbst mitbekommen, als wir dich auf einen unserer Streifzüge in ein Dorf mitgenommen haben und du vor Schreck erstarrt bist. So werde nun also ich das schöne Sümmchen einstreichen, und es wird mir kolossale Freude bereiten, dem König zu dienen, indem ich sein Weib besteige“, sagte Egeno lachend, und in seinen Augen funkelte die Tücke.
Arend war entsetzt, konnte kaum glauben, was hier geplant wurde. Mit solch einer Bosheit hatte er nicht gerechnet, als Heinrich sie zur Jagd in den Wald eingeladen und am Fuße einer mächtigen Eiche Egeno unter vier Augen genaue Anweisungen erteilt hatte. Unter dem Tisch wippte er unruhig mit dem Fuß und ballte die Rechte zur Faust. Seine Seele war in Aufruhr. So derbe durfte der Königin nicht mitgespielt werden! Ständig sah er ihr Gesicht vor sich, ihre großen Augen, die im Sonnenlicht wie kostbare Saphire gefunkelt hatten, die dicken goldenen Flechten, die unter dem Seidentuch hervorgeschaut hatten. Unsicher wie ein kleines Mädchen hatte sie gewirkt und einen Moment später mit Pfeil und Bogen in der Hand so wehrhaft wie ein Mann – selbstsicher und anmutig.
„Ich werde es tun, ganz gewiss! Ich werde mir die Chance doch nicht entgehen lassen, dieses Weib zu verführen, wenn mein König dies von mir wünscht. Wer bin ich denn, dass ich es wage, meinen Herrn zu enttäuschen?“ Egeno griff nach dem Krug und goss sich dünnes Bier ein, die Lippen zu einem schmutzigen Grinsen verzogen.
„Dennoch – so kannst du nicht handeln. Es ist gegen das göttliche Gebot, gegen den Anstand, gegen die Ehre.“ In Arend erwachte Zorn bei der Vorstellung, dass dieser Wüstling ins Gemach der Königin eindrang und seine groben Hände sie berührten. Wie hatten sie nur jemals Freunde werden können, so unterschiedlich wie sie waren?
Egeno leerte seinen Becher in einem Zug und ließ ihn auf die Tischplatte donnern. „Ehre, Anstand … Selbst unter Bischöfen oder Erzbischöfen gibt es so etwas nicht. Es ist alles geheuchelt, diese gesamte verdammte Welt. Jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil und die Mehrung seiner eigenen Macht und Reichtümer bedacht. Die Wölfe reißen die Lämmer. So ist es schon immer gewesen, und so wird es immer sein, bis ans Ende aller Tage. Und wer diese Regeln nicht befolgt, den wird die Welt verschlingen. Gib also auf dich acht, mein allzu ehrenwerter Freund!“ Schwungvoll füllte er den Becher erneut, und ein wenig Bier landete daneben. „Heinrich will sich Bertha vom Hals schaffen, er erträgt es nicht länger, mit ihr verheiratet zu sein. Er sucht nach einem Ausweg, und diesen werde ich ihm bieten.“
„Somit hat er einen Grund, sich von ihr scheiden zu lassen, ohne dass jemand Einspruch erheben wird. Jeder wird in ihm den betrogenen König sehen. Aber hast du schon einmal einen Gedanken daran verschwendet, dass er dich vielleicht anschließend beseitigt, damit du niemandem die Wahrheit erzählen kannst?“
Egeno wischte sich eine blonde Strähne aus der Stirn. „Er kann tückisch sein, das ist mir durchaus bewusst, aber er wird es nicht tun. Mich verbindet bereits zu viel mit ihm, und er genießt die heimlichen Beutezüge mit mir. Es gibt schon eine Menge Geheimnisse, die ich hüte, und er weiß, dass auf mich Verlass ist. Gerade deswegen hat es mich gekränkt, dass er zuerst an dich gedacht hat. Ausgerechnet an dich … Du bist mir – das gebe ich nur ungern zu – an Kampfkunst weit überlegen, aber ansonsten bist du doch zum Kotzen ehrlich und ein ziemlicher Langweiler.“ Egeno beugte sich lachend über den Tisch und ließ seine Hand auf die Schulter von Arend klatschen. „Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich meine Zeit mit dir verbringe.“ Er leerte seinen Becher und zwinkerte. „Vielleicht, weil mir in deiner Anwesenheit stets vor Augen geführt wird, welch spannendes Leben ich im Gegensatz zu dir führe. Eventuell möchte ich auch einfach nur sehen, ob es mir gelingt, dich zu einem verdammten Sünder zu machen.“ Er lachte herausfordernd. „Ja … Ob das Feuer oder das Eis stärker ist …“
Aus irgendeinem Grund fühlte sich Arend für seinen Freund verantwortlich. „Du hast ein Weib und vier Kinder. Denkst du nicht, dass du ein wenig – besonnener werden solltest?“
Egeno brach in schallendes Gelächter aus. Als er sich beruhigt hatte, wurden seine Augen schmal, fast drohend. „Wie du weißt, ist nur bei den Weibern Ehebruch schändlich, nicht aber bei uns Männern. So, mein Lieber, genug gepredigt für heute! Lass uns spielen.“ Er kramte weiße Würfel aus Bein aus seiner Gürteltasche hervor und ließ diese über die unebene Tischplatte purzeln.
Dem hünenhaften Sachsen war so gar nicht nach Spielen zumute. Er war aufgewühlt, auf eine Art, die er noch nie zuvor empfunden hatte. Zaghaft musste er sich eingestehen, dass er sich in die Königin verliebt hatte. Seine Vernunft schrie ihm entgegen, dass dies nicht sein durfte und ohnehin keine Zukunft hatte. Niemals würde er sie rechtmäßig in seinen Armen halten dürfen … Nun ja, wenn sie vom König geschieden wäre, könnte er sie vor dem Kloster bewahren und heiraten. Nein. Welch schändlicher Gedanke!
Er trank ebenfalls von dem dünnen, mit Minze gewürzten Bier. „Wir sind Sachsen. Wir sollten eigentlich nicht hier am Hofe des Königs sein. Er ist ein Franke und handelt entgegen unserer Interessen. Überall im Harz lässt er als Zeichen der Unterdrückung Burgen von unseren Bauern in harter Fronarbeit errichten. Burgen werden an gefährlichen Grenzen erbaut, so wie die zu den Ungarn. Es ist eine Kriegserklärung an uns Sachsen. Ein König hat von Pfalz zu Pfalz zu ziehen und vom Sattel aus zu regieren. Doch Heinrich wird von Erzbischof Adalbert bestärkt, im Harz eine Art Residenz zu errichten, anstatt im Gebiet der Franken, wo er eigentlich hingehört. Unterstützt wird er dabei vom Schwaben Benno, dem ehemaligen Goslarer Domprobst und königlichen Vicedominus, der hier erschreckend geniale Fähigkeiten für den Burgenbau entfaltet. Um seinem Dank Ausdruck zu verleihen, hat Heinrich ihn bereits als Bischof von Osnabrück eingesetzt. Der König will sich hier behaupten, setzt als Zeichen der Unterdrückung schwäbische Ministerialen mit einer ständigen Besatzung in die Burgen ein. Du weißt, wie niederträchtig sich diese Ministerialen verhalten. Wie Heuschrecken fallen sie in die Dörfer ein, plündern und vergewaltigen, doch für die Klagen der Bauern und auch der Adligen bleiben Heinrichs Ohren verschlossen. Egeno, dieser König kann nicht ernsthaft dein Freund sein. Er benutzt dich für seine Zwecke.“
„Wenn es Zwecke sind, die mir zusagen, dann lass ich mich gern benutzen.“ Schelmisch zwinkerte Egeno ihm zu.
In Arend herrschten vollkommenes Unverständnis und der starke Wunsch, seinen Freund so lange zu schütteln, bis dessen Verstand wieder geordnet war. „Ist es dir vollkommen entgangen, wie der Zorn in unserem Volk und vor allem in den Adligen brodelt?“
Egeno grinste breit und hob die rechte Augenbraue. „Ach komm, du siehst alles schwärzer, als es ist, und deine Worte, mein Guter, sind hier am Hofe des Königs doch sehr gefährlich. Ich erkenne dich ja kaum wieder, so – entfacht.“ Mit schmalen Augen musterte er sein Gegenüber, und dieser kam sich fast ertappt vor.
„Gut, lass uns spielen“, lenkte Arend ein, doch seine Gedanken waren bei der Königin.
Am Abend fand das Fest im Wintersaal der Pfalz statt, der im Gegensatz zum oberen Sommersaal nur kleine Doppelfenster mit Rundbogen und Teilungssäulen besaß und dank der Warmluftheizung unter dem Fußboden angenehm temperiert war. Die Fenster waren mit Holzläden verschlossen, damit man dem bunten Treiben von draußen nicht ungehindert zuschauen oder gar einen Pfeil auf den König abschießen konnte.
Da es sich nur um eine kleine Feier handelte, hatte Bertha nicht allzu viele Bänke und Stühle aufstellen lassen. Zusammen mit dem Truchsess und dem Mundschenk hatte sie die Feier organisiert. Dieses beherrschte sie gut, verstand es auch, die Kosten geringer als erwartet zu halten. Anerkennung hatte sie von Heinrich dafür aber noch nie erhalten.
An den weiß getünchten Wänden steckten in schmiedeeisernen Halterungen Fackeln, welche die in ihrer Nähe ohnehin schon verrußten Wände noch mehr schwärzten. Kerzen brannten in großen Leuchtern, und in kleinen Feuerbecken züngelten Flammen, tauchten den großen Saal in goldenes Licht. Zahlreiche bunte Teppiche und Vorhänge hingen an den Wänden und verliehen dem Raum einen repräsentativen Charakter.
Heinrich hatte recht gute Laune. Er hatte sich mit Gold behängt und trug über seinem hellen Leinenhemd eine knielange blaue Tunika aus feinstem Wolltuch, die mit breiten Bordüren aus Seide und Goldfäden verbrämt war. Darunter schauten dunkelblaue Beinlinge hervor. Um seine Taille lag ein prächtiger, mit Gold beschlagener Gürtel. Er stand in der Nähe der Spielleute, die wegen der Fastenzeit lediglich dezente Musik erklingen ließen. Einer von ihnen zeigte Kunststückchen, wirbelte mehrere faustgroße Lederbälle durch die Luft und ließ anschließend kleine Gegenstände verschwinden. Ganz in der Nähe des Königs befanden sich seine drei Kebsweiber: Hedi, die stille, unterwürfige Blondine, die verführerische, üppige, braunhaarige Trude und die dunkelblonde, beneidenswert schöne, berechnende Ortrun. Letztere ließ Bertha oftmals spüren, dass sie in der Gunst des Königs stand, und bedachte sie zumeist mit einem Naserümpfen.
Bertha hatte ihren Platz eingenommen und wartete darauf, dass das Essen auf Tafeln hereingetragen wurde. Hoffentlich gefielen Heinrich die Speisen.
„Es ist eine Unverschämtheit, wie herablassend die dich anschaut. Aus dem Saal prügeln müsste man diese Metze!“, erboste sich ihre Tante Imula, die neben ihr saß. Fünfzigjährig war sie bereits zweimalige Witwe. Erst war sie das Weib von Otto von Schweinfurt gewesen, und nach dessen Tod hatte sie den Brunonen Ekbert I. von Braunschweig, den Markgrafen von Meißen, geheiratet. Ekbert war an Heinrichs Entführung in Kaiserswerth beteiligt gewesen. Als der junge König panisch vom Schiff, auf das er gelockt worden war, in die kalten Frühjahrsfluten des Rheins gesprungen war, war ihm der Brunone hinterhergehechtet und hatte ihn vor dem Ertrinken gerettet.
Imulas Ehe mit ihm war alles andere als glücklich gewesen, und Ekbert hatte ihr schließlich Ehebruch vorgeworfen. Doch zur Scheidung war es nicht mehr gekommen, da er vorher gestorben war. Ekberts Verwandte hatten Imula die Schuld an seinem Tod gegeben, sogar von Gift gesprochen, sie traktiert und von ihrem zehnjährigen Sohn Ekbert II. getrennt. So war sie schließlich verzweifelt zu ihrer Nichte an den Königshof geflüchtet.
Bertha beschloss, Ortrun, diesem Weib niederen Standes, keine Beachtung zu schenken, denn dies würde sie vermutlich am meisten ärgern. Sie war nicht mehr als all die anderen Huren, die sich hier im Saal eingefunden hatten, um am späten Abend einige der edlen Herren und Ministerialen zu ihren Schlafstätten zu begleiten. Bertha war davon angewidert. Ihrer Vorstellung eines königlichen Festes entsprach das überhaupt nicht, doch ihr junger Gemahl bestand darauf, und ohne Zweifel gefiel es auch den anderen lauten, ungehobelten Männern.
Stets in der Nähe des Königs hielten sich der kraftstrotzende Kuno und der starke, früh ergraute Benno auf. Die erfahrenen Krieger achteten auf seine Sicherheit und standen in der Nacht abwechselnd vor seiner Tür – also auch in der Nähe von Berthas Gemach. Doch sie war sich sicher, dass die beiden jeden, wirklich jeden Eindringling zu ihr vorlassen würden. Sie dienten dem König und waren diesem bedingungslos ergeben, nicht jedoch ihrer Königin. Insbesondere Kuno hatte für Bertha oft nur einen abwertenden Blick über.
Zu dieser Feier waren auch einige Gewächse geladen, die sich mit Vorliebe am Hof aufhielten und sich wie Maden durch den Speck fraßen, so wie seine Berater Regengar, die Grafen Adalbert von Schauenburg, Eberhard VI. von Nellenburg, der unermüdliche Baumeister Bischof Benno von Osnabrück und weitere Adlige und Ministerialen.
Die Erzbischöfe Adalbert und Anno waren heute nicht anwesend. Anno verweilte gerade nicht am Hof, und Adalbert wurde von einer fiebrigen Erkältung geplagt. Bertha war für seine Krankheit sogar ganz dankbar, denn er hätte Heinrich für diese Kebsweiber ohnehin nicht gescholten, vielleicht sogar noch ermutigt, sich ein weiteres zuzulegen.
Von einer seltsam kribbelnden Nervosität beherrscht, fuhr Bertha unruhig mit kalten Fingerspitzen über das glatte Holz der Armlehne. Dort hinten hatte sich Egeno II. von Konradsburg aufgebaut, lachte und erzählte unablässig. Er war voller Lebenslust, und die Huren und Weiber der Spielleute nahmen ihn wohlwollend, fast schmachtend in Augenschein. Neben ihm stand dieser schweigsame Kerl, groß, finster und ernst. Bertha erinnerte sich an seine schönen hellblauen Augen, aber nicht an seinen Namen.
Endlich wurde das Essen auf großen Tafeln hereingetragen und auf die massiven Böcke vor die Bänke und Stühle gestellt. Die kräftigen Männer schwitzten unter der Last der Speisen, aber auch vor Furcht, dass ihnen etwas herunterfiele und der König sie zwänge, dies vor aller Augen vom Boden zu essen.
Der Hirsch, der am frühen Morgen noch erhaben durch den Wald geschritten war, wurde nun, in Stücke gehackt und teils am Spieß gebraten, teils im Sud gekocht, den Gästen serviert. Als besondere Dekoration prangte sein mächtiges Geweih zwischen den Schüsseln. Zudem gab es den Bieber, aber auch Fische als Fastenspeise für diejenigen, die nach dem Mahl keine Buße tun wollten. Des Weiteren waren Suppen, Brot als Unterlage für das Fleisch und verschiedene, vor dem Winter eingelagerte Gemüse angerichtet. Wie es bei Festen üblich war, teilten sich mehrere Gäste einen Becher, um die Gefahr eines Giftanschlags zu verringern, und jeder aß mit seinem eigenen mitgebrachten Besteck.
Heinrich setzte sich neben seine Königin und strafte sie wie gewohnt mit Missachtung. Von der Aufmerksamkeit und der Höflichkeit, die er ihr am Morgen entgegengebracht hatte, war nichts verblieben. Alles hatte sich aufgelöst wie der Rauch der Fackeln. Zurück blieben nur Ruß und Schwärze.
Die zahlreichen Gäste saßen an verschiedenen Tafeln, und jeder musste sich von dem bedienen, was vor ihm aufgetragen worden war. Sich zu erheben und etwas von einer anderen Tafel zu nehmen war verpönt. Die Huren saßen weit hinten an einem gesonderten Tisch.
Bald darauf gingen Diener mit Waschschüsseln herum, damit sich die Gäste vor dem Mahl die Hände säubern konnten, und dann wurde geschmaust, erzählt und gelacht. Schon während des Speisens schaute Egeno immer wieder mit seinem gewinnenden Lächeln zu Bertha herüber. Trotz der Scham, mit der sie dies erfüllte, fühlte sie sich ohne jede Frage geschmeichelt. Wann war ihr schon jemals solch ein erwärmender Blick geschenkt worden?
„Wer ist dieser Mensch, der dich so unverhohlen in Augenschein nimmt?“, erkundigte sich ihre Tante, die sich weit zu ihr herübergelehnt hatte. Imulas graue Augen hatten sich verschmälert, und zahlreiche kleine Falten zeigten sich. Trotz ihres Alters war sie noch immer eine attraktive Frau.
„Irgendein Adliger, den Heinrich nach der Jagd angeschleppt hat.“
„Ach, was würde ich dafür geben, wenn mich mal wieder ein Mann so begehrlich anschaute …“ Gedankenverloren seufzte Imula. Dann besann sie sich räuspernd und raunte ihr zu: „Er sollte achtgeben, dass Heinrich dies nicht sieht.“
Verdrossen verzog Bertha die Mundwinkel. Wie sollte Heinrich dies denn bemerken? Er hatte mehr Interesse an dem kleinen Weberknecht, der sich von einem Krug abseilte und den Tod in seinen Fingern fand, als an ihr. Dabei war er ihr so nah … und gleichzeitig so weit entfernt, am anderen Ende seiner eigenen Welt.
Es wurde reichlich gegessen, und Met, Wein und Bier flossen in Strömen. Nach einiger Zeit wurden die Tafeln mit den Resten fortgetragen, die später an Arme verteilt werden würden.
Die Gäste fanden sich in kleinen Gruppen zusammen, vergnügten sich mit Würfelspiel oder führten rege, vom Trunk genährte Unterhaltungen. Die Musik wurde auf Heinrichs Wunsch hin temperamentvoller und lauter, hallte fröhlich durch den Saal und erfüllte jeden Winkel.
Der König stolzierte zu seinen Kebsweibern, tanzte mit ihnen, wirbelte sie ausgelassen wie ein derber Bauer umher. Seine frommen, manchmal fast asketischen Eltern würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie das sehen könnten. Diese hatten sogar bei ihrer eigenen Hochzeit keinerlei Musik zugelassen und die angereisten Spielleute des Hofes verwiesen.
Egeno, der sich auch bei den Musikern aufhielt, schaute fortwährend zu Bertha herüber, und dann – ihr stockte der Atem – kam er direkt zu ihr.
„Darf ich mich zu Euch setzen?“, fragte er, nachdem er sich tief verbeugt hatte.
Bertha hüstelte sich die belegte Stimme frei. „Ja, gern.“
Er schenkte ihr ein breites Lächeln, zog schwungvoll einen dreibeinigen Hocker heran und ließ sich darauf nieder. „Ich muss Euch ein Lob aussprechen, Ihr versteht es, ein Fest auszurichten. Doch warum, meine Herrin, zeigt Ihr nicht ein wenig mehr Freude? Es betrübt mich, Euch so überaus ernst und einsam zu sehen.“
„Ich bin die Königin und kein Spielweib“, entgegnete Bertha schnippischer, als sie es gewollt hatte.
„Ja, eine Königin, wahrlich, aber keine Nonne. Ihr seid eine edle Dame und dürft an den Vergnügungen teilhaben. Was heißt, dürft? Ist es nicht sogar Eure königliche Pflicht, Euer Volk mit Eurem Liebreiz zu beglücken?“, sprudelte er heraus.
„Meine Güte, dir trieft ja goldener Honig von den Lippen!“, sagte Imula lachend, aber mit stichelndem Unterton. „Du machst die Königin ganz verlegen. Und einsam ist sie ganz gewiss nicht, so befindet sie sich doch in meiner Gesellschaft.“
Egeno schenkte ihr ein Augenzwinkern. „Verzeih, einsam ist sie in deiner holden Gegenwart selbstverständlich nicht. Aber meinst du nicht, dass es deiner Nichte vergönnt sein sollte, ein wenig Spaß zu haben? Sie ist jung und sollte nicht dazu verdammt sein, ihr Leben in Tristesse zu verbringen, oder?“
Schmunzelnd nickte Imula, offenbar blieb auch sie von seinem Charme nicht unberührt. Dieser Mann kannte die Seelen der Frauen.
Kapitel 3
Arend hatte sich in eine dunklere Ecke des Saales verzogen und umklammerte mit schwieligen Händen vergrämt einen Weinbecher. Es brodelte in ihm, ganz gewaltig sogar. Er konnte es kaum ertragen, wie sich Egeno bei der Königin einschleimte und sie umgarnte. Nach anfänglicher Abwehr lachte sie nun und plauderte mit ihm. Es war offensichtlich, dass ihr seine Schmeicheleien gefielen. Kein Wunder, Arend wusste, dass dessen Komplimente hinunterglitten wie warmes Öl. Jede Frau, die er begehrt hatte, war bisher diesen trügerischen, geheuchelten Worten erlegen. Er hatte etwas an sich, dass seine Opfer jede Deckung fallen ließen, selbst wenn sie ahnten, dass er ein Schuft war und alles nur mit Gejammer, Herzschmerz und Unglück enden konnte.
Der König, der den sauren, mit Zimt und Nelken gewürzten Wein zügellos in sich hineinkippte, wandte sich hin und wieder Egeno zu, lauernd, ob es ihm gelänge, sein Weib um den Finger zu wickeln. Beim Anblick seines tückischen, zufriedenen Lächelns stieg in Arend beißende Übelkeit auf. Ihm war danach, aufzuspringen und diesen elenden Plan lauthals hinauszuschreien, doch dann hätte er sein Leben verwirkt. Folglich blieb er verdrießlich sitzen und schwieg.
Arend verfluchte jenen Abend, an dem Egeno ihn überredet hatte, an einem Streifzug mit dem schändlichen König teilzunehmen. So hatte Arend gesehen, zu welchen Untaten Heinrich fähig war. Er, König durch Gottes Gnaden, hatte sich aufgeführt wie ein wüster Schurke und war mit Egeno in ein Haus eingedrungen. Gemeinsam hatten sie eine junge Magd herausgezerrt, sie aufs Pferd gezogen und waren übermütig johlend mit ihr davongeritten. Arend, fest von einer nächtlichen Jagd ausgehend, hatte nicht geahnt, welcher Art die Beute sein sollte. Als die zürnenden Bauern mit eilig ergriffenen Hacken und Dreschflegeln aus dem Haus gestürmt waren, war Arend aus seiner Erstarrung erwacht und hatte schleunigst die Flucht ergriffen. Tags darauf hatte er missmutig Egeno gefragt, was aus dem armen Mädchen geworden sei, hatte jedoch nur ein schäbiges Lächeln geerntet. Schwarze Seelen.
Und nun sollte auch noch der Königin übel und äußerst niederträchtig mitgespielt werden? Erneut kroch Wut in ihm herauf, die zu unterdrücken ihm schwerfiel. Sein geringschätziger Blick streifte Heinrich. Solch ein Mensch hatte es nicht verdient, König zu sein. Er hatte keine Ehre, kein Mitgefühl, keine Reue, war nicht würdig, die Reichsinsignie der Heiligen Lanze – die einen Nagel des Kreuzes in sich barg – zu berühren. Arend spülte seinen aufgestauten Groll mit einem kräftigen Schluck Wein herunter. Wenn er ehrlich war, traf auch ihn ein Teil der Schuld, da er an jenem Abend Reißaus genommen hatte, anstatt der Magd zu helfen und sich gegen seinen König zu stellen. Dieses Fehlverhalten hatte sich tief in sein Herz gebrannt. Er fühlte sich schmutzig und feige. Nein, diesmal musste er es verhindern, denn vom Unrecht zu wissen und dieses geschehen zu lassen, bedeutete, selbst schuldig zu sein. Heimlich blickte er zur Königin hinüber. Er musste sie warnen.