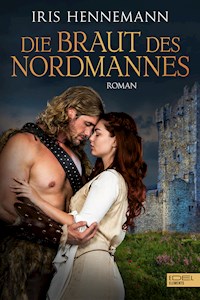Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Königin im Schatten
- Sprache: Deutsch
Speyer, 1076 n. Chr. Zusammen mit ihrem Gemahl, König Heinrich IV., wurde die junge Bertha von den Reichsfürsten nach Speyer verbannt, wo sie darauf warten sollen, dass der vom Papst Gregor VII. exkommunizierte König seine Krone verliert. Doch Heinrich will sich nicht geschlagen geben und zieht über die verschneiten Alpen zum verhassten Papst, um sich vom Bann zu befreien. Berthas sächsischer Leibwächter Arend, den sie heimlich liebt, begleitet sie über den vereisten Pass. Doch gleichzeitig verschwören sich im Reich die Sachsen mit zahlreichen anderen Feinden und bereiten den Sturz des Königs vor. Nach der Rückkehr aus Italien nimmt Heinrich IV. augenblicklich den Kampf mit den widerspenstigen Sachsen und deren Verbündeten auf, dringt verwüstend in deren Besitzungen ein und entzweit seine Gegner. Arend muss sich entscheiden, ob er Bertha beim wichtigen Kampf um ihre Krone unterstützt oder ob er für sein eigenes Volk kämpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Speyer, 1076 n. Chr. Zusammen mit ihrem Gemahl, König Heinrich IV., wurde die junge Bertha von den Reichsfürsten nach Speyer verbannt, wo sie darauf warten sollen, dass der vom Papst Gregor VII. exkommunizierte König seine Krone verliert. Doch Heinrich will sich nicht geschlagen geben und zieht über die verschneiten Alpen zum verhassten Papst, um sich vom Bann zu befreien. Berthas sächsischer Leibwächter Arend, den sie heimlich liebt, begleitet sie über den vereisten Pass. Doch gleichzeitig verschwören sich im Reich die Sachsen mit zahlreichen anderen Feinden und bereiten den Sturz des Königs vor. Nach der Rückkehr aus Italien nimmt Heinrich IV. augenblicklich den Kampf mit den widerspenstigen Sachsen und deren Verbündeten auf, dringt verwüstend in deren Besitzungen ein und entzweit seine Gegner. Arend muss sich entscheiden, ob er Bertha beim wichtigen Kampf um ihre Krone unterstützt oder ob er für sein eigenes Volk kämpft.
Iris Hennemann
Königin im Schatten
Kampf um die Krone
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Iris Hennemann
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Ashera Literaturagentur
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Lektorat: Susann Harring
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-247-5
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Glossar
Dramatis Personae
Liste der wichtigsten Personen (historische sind mit einem * gekennzeichnet)
Berthavon Turin*, Königin, Gemahlin von Heinrich IV.
Heinrich IV.*, König des Heiligen Römischen Reiches
Tilda, Dienerin von Bertha
Ada, Dienerin von Bertha
Imma, Dienerin von Bertha
Adelheid* älteste Tochter von Bertha und Heinrich
Agnes*, zweitälteste Tochter von Bertha und Heinrich
Konrad*, Sohn von Bertha und Heinrich
Benno, Leibwächter der Königin
Kuno, Leibwächter des Königs
Arnulf, Leibwächter des Königs
Eilbrecht von Hadenstein, Vater von Arend
Mathilde von Hadenstein, Mutter von Arend
Giselher von Hadenstein, ältester Sohn von Eilbrecht
Arend von Hadenstein, drittältester Sohn von Eilbrecht; Leibwächter von Bertha
Hilla, Magd auf der Burg Hadenstein
Sieghild, Weib von Arend
Giselher, ältesterSohn von Arend und Sieghild
Arwed, zweiter Sohn von Arend und Sieghild
Osmund, dritterSohn von Arend und Sieghild
Herwin, vierter Sohn von Arend und Sieghild
Hiltraut, Tochter von Arend und Sieghild
Erkmar, Knecht von Arend
Gebbo, Knecht von Arend
Egeno II. von Konradsburg*, Freund von Arend
Ulrich von Godesheim*, adliger Ritter
Erzbischof Liemar von Bremen und Hamburg*
Bischof Benno II. von Osnabrück*
Bischof Burchard II. von Halberstadt*
Lothar Udo II. von Stade*, Markgraf der Nordmark
Magnus Billung*, Herzog von Sachsen
Hermann Billung *, Oheim von Magnus Billung
Sophia von Ungarn*, Gemahlin von Magnus Billung
Otto von Northeim*, ehemaligerHerzog von Bayern
Rudolf von Rheinfelden*, Herzog von Schwaben und Gegenkönig
Berthold I. von Zähringen*, Herzog von Kärnten
Vratislaw II.*, Herzog von Böhmen
Adalbert II. von Ballenstedt*, Graf von Ballenstedt
Adelheid von Susa*, Mutter von Bertha
Amadeus II. von Savoyen*, Bruder von Bertha
Hugo von Cluny*, Taufpate von Heinrich IV.
Alberto Azzo II. von Este*, Markgraf
Gregor VII.*, Papst
Mathilde von Tuszien*, Markgräfin von Tuszien, Mutter von Bertha
Gottfried von Boullion*, Markgraf von Antwerpen
Wiprecht von Groitzsch*, sächsischer Adliger
Trude, Bauernmädchen
Kapitel 1
Speyer, Anfang November 1076
Noch zeigte sich das kräftige Blau des Firmaments, doch wilde Wolken zogen heran, teils zerrissen, teils in dramatischen Formationen emporgestapelt, hier weiß, an anderen Stellen bedrohlich düster und grau. Sie kamen schnell näher, hatten die wärmende Sonne bereits verschlungen und fraßen sich immer weiter gierig vorwärts. Fast wirkte es, als wollten sie mit ihrer Masse die Welt unter sich begraben.
Betrübt schaute Königin Bertha – gerade erst 25 Jahre alt – zum Himmel empor. Gewiss würde bald Regen einsetzen. Wind zerrte an ihrem weißen Seidenschleier, unter dem zwei dicke weizenblonde Flechten hervorschauten. Ihren schlanken Körper zierte ein knöchellanges Kleid aus feinem dunkelroten Scharlach, darüber hatte sie einen blauen Wollmantel gelegt, der mit einer kunstvollen Schließe zusammengehalten wurde, in der leuchtende Amethyste, Bergkristalle und Almandine gefasst waren.
Bertha war der grimmige Wind willkommen, der ihr deutlich verhieß, dass sie lebte, ihr ein Frösteln auf die Haut trieb und so manchen trüben Gedanken mit sich nahm.
„Mama, darf ich noch mal schießen?“, wollte die sechsjährige Adelheid wissen und zögerte, einen weiteren Pfeil aus dem Köcher zu ziehen.
Unschlüssig zupfte sich Bertha an ihrer Nase und zwinkerte ihrem Kind liebevoll zu. „So wie es aussieht, wird es bald regnen, und eigentlich ist es jetzt schon viel zu windig.“
Flehend blinzelte ihre Tochter sie an. „Ach bitte!“ Das „e“ zog sie besonders lang, und dies erweichte Bertha.
„Na gut, aber nur noch ein wenig, mein Liebling.“
Die hübsche Adelheid, die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war, strahlte, legte den kleinen Bogen an und verschoss den Pfeil. Er schlug genau in der Mitte der Strohscheibe ein, die nahe dem Pferdestall aufgebaut worden war.
„Unverkennbar besitzt sie Euer Talent“, lobte Ada, die kesse Dienerin, deren rotes Haar an einigen Stellen unter dem Kopftuch hervorquoll.
Neben ihr stand eine weitere Dienerin: Imma, dünn und bleich wie eh und je und immer zutiefst unglücklich dreinschauend. „Herrin, Ihr wisst doch, dass Euer Gemahl es nicht gern sieht, wenn Ihr Euren Töchtern das Bogenschießen beibringt“, erinnerte sie vorsichtig und schaute ängstlich umher, als ob sie befürchtete, dass der junge König bereits in der Nähe war.
Ada gluckste. „Es ärgert ihn doch nur, weil unsere Königin dies auf kurze Distanzen viel besser kann als er.“
Die beiden Frauen waren ungefähr im gleichen Alter wie ihre Herrin und vor zwanzig Jahren nach Berthas Verlobung mit ihr an den kaiserlichen Hof gekommen. Sie waren ihre Vertrauten, gaben ihr ein wenig Halt in diesen bewegten Zeiten und hüteten so manches ihrer Geheimnisse.
Die Königin ging zu ihrer dreijährigen Tochter Agnes, die ebenfalls schon einen kleinen Bogen besaß und fröhlich Pfeile ohne Spitzen kraftlos durch die Gegend schoss. Die meisten landeten direkt vor ihren Füßen. Bertha korrigierte die Haltung des Mädchens und trat mit einem Seufzen wieder zurück.
Wie sehr sie es hasste, in diesem Bischofspalast zu sein! Die Gebäude und das großzügige Gelände waren durchaus prächtig, fast königlich. Doch sie war nicht freiwillig hier … weder sie, noch der König oder der engste Kreis des Hofstaates. Niemals hätte Bertha es für möglich gehalten, dass ihr Gemahl so dramatisch an Macht verlieren könnte.
Noch im Oktober des vergangenen Jahres hatte er die aufsässigen Sachsen unterworfen, und deren Adlige hatten ihm die Füße küssen müssen. Anschließend hatte er sie – entgegen seiner Versprechungen – allesamt gefangen nehmen lassen. Auch Berthas sächsischen Leibwächter Arend …
Wie hatte Arend sie, seine geliebte Königin, nur jemals verlassen und die Seiten wechseln können? Heinrich hatte ihn hinrichten lassen wollen, doch einige königstreue Edle und auch Bertha hatten sich für seine Freilassung eingesetzt. Seitdem hatte sie ihn nicht mehr gesehen, sehnte sich aber mit jedem Tag mehr nach ihm.
„Du musst den Ellenbogen ein wenig höher nehmen, mein Schatz“, korrigierte Bertha die Haltung ihrer ältesten Tochter. „Ja, so ist es gut.“ Die Königin lächelte, doch ihre Gedanken schweiften wieder ab.
Nach dem Sieg über die Sachsen hatte sogar Papst Gregor VII. dem König gratuliert. Doch bald darauf war Heinrich der Inhalt des Dictatus papae des Heiligen Vaters von einem Spion zugetragen worden, worin dieser mehr oder weniger die Weltherrschaft für sich forderte. Zudem sollten die Bischöfe nur noch dessen Handlanger sein, und er wollte Untergebene vom Treueeid lösen, den diese dem König geleistet hatten. Ja, Gregor wollte erreichen, dass der Papst über dem König stand und diesen sogar absetzen konnte.
Die Empörung im Reich war maßlos gewesen. Am 24. Januar diesen Jahres hatten sich sechsundzwanzig Bischöfe in Worms unter dem Vorsitz des Erzbischofs Siegfried von Mainz zu einer Synode zusammengefunden. Der schlimmste Hetzer war dabei der exkommunizierte römische Kardinal Hugo Candidus gewesen. Dieser hatte dem Papst sogar Unzucht mit der Markgräfin Mathilde von Tuszien und deren Mutter Beatrix unterstellt. Zudem hatte sich der König empört, dass Gregor VII. ihm die erbliche Königswürde absprechen und ihn und das italienische Reich zu entzweien trachtete. Dies und die entschiedene Ablehnung des deutschen Episkopats hatten Heinrich dazu bewogen, Gregor, „den falschen Mönch“ – so hatte er ihn abfällig genannt –, in einem kühnen Brief aufzufordern, den apostolischen Stuhl freizumachen. Wie hatte er es formuliert? Ich, Heinrich, durch Gottes Gnade König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen: Steige herab, steige herab! Zwar war von den Herzögen nur der bucklige Gottfried IV. von Niederlothringen erschienen, allerdings hatte das Heinrichs Gefühl der Anerkennung und Überlegenheit keinen Abbruch getan. Doch dann war der Donnerschlag aus Rom erfolgt: Der Papst hatte Siegfried von Mainz und zahlreiche andere Bischöfe exkommuniziert, und anschließend – so etwas war bisher vollkommen undenkbar gewesen – auch den gesalbten König! Genauso schnell wie sich die Bischöfe und auch weltlichen Herren gegen den Papst gestellt hatten, hatten sie sich nun von ihrem Herrscher abgewandt, um ihren eigenen Hals zu retten. Als Heinrichs Feinde übermächtig geworden waren, war es im vergangenen Monat in Tribur zu Verhandlungen zwischen dem König und dessen Feinden gekommen, doch Heinrich hatte sich ruhmlos nach Speyer zurückziehen müssen. Diese Stadt war mit seiner Familie verbunden, da sein Großvater, Kaiser Konrad II., in dieser Gegend geboren worden war.
Hier sollte Heinrich nun darauf warten, dass der Papst am 2. Februar des nächsten Jahres nach Augsburg kam, um das Urteil über ihn zu sprechen. Seitdem war der König so verbittert wie nie zuvor in seinem bewegten Leben. Sein Vater und auch sein Großvater hatten noch nach ihrem Belieben Päpste ein- und abgesetzt, doch da seine Eltern Unterstützer der Kirchenreformen gewesen waren, hatten sie unbeabsichtigt an den Beinen des Königsthrons gesägt. Es erschütterte Heinrichs Weltbild, dass er nun abgesetzt werden sollte. Das widersprach dem Gedanken des sakralen Königtums zutiefst. Er konnte den Verrat, die Untreue und die Niederlage nicht hinnehmen. In ihm tobte ein grollender Sturm, und dieser ließ ihn keine Ruhe finden.
„Vorsicht, Schätzchen! Erschieß doch nicht den armen Mann!“, rief Bertha erschreckt aus.
Adelheid hatte nicht abwarten können, bis ein Knecht die Pfeile aus der Strohscheibe herausgezogen hatte. Entsetzt war dieser dem heransurrenden Pfeil mit einem beherzten Sprung ausgewichen, und seine vor Schreck erbleichten Wangen färbten sich nun rot vor Zorn – wenn er auch jedweden Protest herunterschluckte.
„Entschuldigung!“, rief die Königin ihm lächelnd zu, und das besänftigte den Mann.
Bertha wandte sich um, als sie Schritte hinter sich hörte. Ihre ehemalige Amme Tilda, eine kleine, rundliche Frau, näherte sich eilig.
„Ihr solltet in Euer Gemach kommen. Schaut Euch doch nur den finsteren Himmel an! Bald wird es zu regnen beginnen.“ Im Laufe der Jahre hatten sich immer mehr Falten ins Gesicht der tatkräftigen, resoluten Dienerin gegraben. Sie wurde alt.
Tilda hatte die Finger der linken Hand unauffällig gekreuzt, um ihrer Herrin zu verstehen zu geben, dass sie einen geheimen Brief für sie hatte.
„Wir wollten ohnehin gleich reingehen, ich möchte Adelheid im Lesen und Schreiben unterrichten.“ Ihr Blick glitt an Tilda vorbei, und sie zuckte leicht zusammen, als sie den König erblickte, der auf einem herrlichen Schimmel sitzend das Tor passierte und auf den Hof einritt.
Seine dunkelblonden schulterlangen Haare waren vom Ritt ein wenig wirr, und als er diese ordnen wollte, wirbelte der Wind sie sogleich wieder durcheinander. Jede seiner Bewegungen war elegant und drückte seine Herrschaftlichkeit aus. Der fast sechsundzwanzigjährige König war gut aussehend, auch wenn sein Kinn, das von einem kurz gestutzten Bart bedeckt wurde, ein wenig zu weich und seine gerade Nase etwas zu lang waren. Die Wangen des Königs wirkten eingefallen, der Ärger raubte ihm den Schlaf. So vertrieb er sich in seinem Gemach die langen Nächte mit seinen beiden Kebsweibern, der schönen Ortrun und der vollbusigen Gerlinde.
Doch nach außen hin bewahrte der König Würde. Er trug eine herrliche waidblaue Tunika, walnussbraune, mit glänzender Seide bestickte Beinlinge, passende Stiefel und einen roten Mantel, der auf der Innenseite mit kostbarem Feh gefüttert war. Den Mantel schmückte eine üppige goldene Schließe, die mit Edelsteinen und Perlen überladen war. Um seine schlanke Taille leuchtete ein juwelenbesetzter Gürtel. Bertha hatte den Eindruck, dass er sich, seit ihm von den Fürsten verboten worden war, sich mit seinen königlichen Abzeichen zu schmücken, besonders gern mit Gold behängte.
Vor ihm saß der zweijährige Konrad, der helle Sonnenstrahl in Heinrichs düster gewordener Welt. Der König verzog das Gesicht, als hätte er Essig getrunken, und seine dunkelblauen Augen funkelten verärgert, als er seine Gemahlin sah. Missmutig lenkte er das Pferd, dessen Zaumzeug prachtvoll mit Silber beschlagen war, zu ihr. Hinter ihm tauchten zwei berittene Leibwächter auf: Benno und Kuno. Letzterer war ein hässlicher stiernackiger Franke, dessen Nase mehrfach gebrochen war und der kaum noch einen Schneidezahn in seinem Schandmaul besaß. Es war Arend gewesen, der ihn bei mehreren deftigen Auseinandersetzungen derart zugerichtet hatte. Bertha war dieser Franke zuwider, der sie stets abfällig musterte. Zu dem ergrauten, aber nichtsdestotrotz muskelbepackten Benno hingegen hatte Bertha Vertrauen gefasst.
„Du weißt, dass ich es nicht gutheiße, wenn Adelheid und Agnes mit dem Bogen schießen! Sie sind Mädchen, werden niemals kämpfen und sollen lieber Dinge lernen, die sich für sie ziemen!“, grollte der König.
Sein Weib war anderer Meinung, doch sie wollte ihm vor den Untergebenen nicht widersprechen. „Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herr. Wo bist du mit Konrad gewesen? Ich fürchte mich immer, wenn ihr fort seid. Außerhalb der Stadt und selbst in Speyer treibt sich so viel übles Gesindel herum.“
Heinrich lenkte das Pferd näher an seine Gemahlin heran. „Nun, Gesindel sitzt auch auf Bischofsstühlen und hockt in prachtvollen Burgen!“, stieß er verbittert hervor.
Bertha sehnte sich die Tage herbei, in denen er unbeschwert gewesen war. Unbekümmert hingegen war er nie gewesen. Dies verboten ihm schon allein sein misstrauisches Wesen und sein turbulentes Leben, das ihn gelehrt hatte, dass der nächste Nackenschlag nicht lange auf sich warten ließ. Doch es gab drei Menschen, die sein verstocktes Herz ein wenig erwärmten: seine Kinder.
„Wo bist du mit Konrad gewesen?“, wiederholte sie ihre Frage.
„In den Wäldern, und anschließend habe ich ihm den wundervollen Dom gezeigt, den mein Großvater in Auftrag gegeben hat. Er hatte ihn vielleicht noch nicht als Herrschergrablege angedacht, doch solche ist es geworden. Auch sein Grab ist dort. Nun, Konrad, weißt du noch, was ich dir über den Dom erzählt habe?“
Der bald Dreijährige zog die Augenbrauen zusammen und fuhr mit seiner Zunge nachdenklich über die Lippen. Er kratzte sich kurz am Kopf. „Ähm, nach dreißig Jahren war es so weit, da …“
„… konnte er geweiht werden“, half ihm sein Vater.
„Da war Papa elf … Es fehlten noch …“ Hilfesuchend schaute er den Vater an.
„… die Treppentürme und die Obergeschosse“, ergänzte Heinrich.
„Papa sagte, dass seitdem fleißig weitergemacht wurde … aber gerade nicht. Aber wenn Papa alle besiegt hat, soll die Kirche noch viel größer werden“, plapperte er mit lebhafter Stimme.
Ein Schatten huschte über Heinrichs Gesicht, doch dann lächelte er seinen Sohn wieder an. „Und was habe ich noch gesagt?“
„Da liegt Großvater Heinrich. Und vom Opa die Mama liegt da auch.“
„Ja. Kaiserin Gisela. Dein Großvater ließ seine Mutter von Goslar hierherbringen. Und wo ist das Herz von Großvater?“
„Goslar.“
„Und wo genau in Goslar?“, wollte Heinrich wissen.
Konrad überlegte angestrengt, doch es fiel ihm nicht ein.
„In der Stiftskirche St. Simon und St. Judas.“
Der Kleine lächelte nur verlegen, aber dann kam ihm noch etwas in den Sinn, und er strahlte über das ganze Gesicht: „Die ist in Goslar bei den bösen Sachsen.“
„Ja, das ist wahr.“ Heinrichs Stimme klang geradezu zuversichtlich.
Berthas Augen wurden schmal, und sie neigte den Kopf ein wenig zur Seite. „Goslar? Hast du Pläne? Willst du mir davon berichten?“
„Nein, noch nicht …“
Zu gern hätte sie gewusst, was hinter seiner Stirn vor sich ging, aber sie musste ihre Neugier zügeln. War ihre Lage nicht eigentlich aussichtslos? Wenn er es bis zum Jahrestag seiner Exkommunikation, also bis zum 15. Februar, nicht schaffte, sich vom päpstlichen Bann zu lösen, würden die Fürsten des Reiches ihn gnadenlos absetzen und einen anderen zum König wählen. Und der Papst machte bisher keinerlei Anstalten, sich des Mannes, der ihn als ‚falschen Mönch’ betitelt und mit seinem richtigen Namen ‚Hildebrand’ benannt hatte, zu erbarmen.
Es freute Bertha, dass er nach einem Ausweg suchte, denn sie selbst konnte sich mit dem Gedanken, keine Königin mehr zu sein, ebenso wenig abfinden. Wo sollten sie dann hin? Was sollte aus ihnen werden?
Der König reichte den kleinen Konrad zu Tilda hinunter, die diesen freudig in ihre Arme schloss. Seinen Töchtern schenkte er ein Lächeln, wendete sein Pferd und ritt zum Stall, gefolgt von seinen Leibwächtern.
„Imma, Ada, kümmert euch um die Kinder! Ich gehe mit der Königin in ihr Gemach. Lasst euch ruhig Zeit“, wies Tilda die anderen Dienerinnen an.
Bertha verbot ihr nicht, so energisch zu reden, denn die ältere Frau war ihr Mutterersatz und in dunklen Stunden oft ihre Trösterin. Zusammen mit ihr ging sie über den Hof Richtung Palas.
Arnulf, der sowohl Bertha als auch den König bewachte, begab sich zu ihnen. Er war breitschultrig, Ende dreißig, hatte grüne tief liegende Augen, blondes kurzes Haar und einen Bart. Er war schweigsam und für Bertha nicht richtig zu ergründen. Sie traute ihm nicht ganz, denn sie vermutete, dass er dem König stets brav berichtete, was in ihrem Gemach vor sich ging. Manchmal stand auch der eitle Hado Wache. Diesen empfand sie als äußerst störend, zumal er gern sang und dabei kaum einen Ton traf.
Die Frauen betraten in Arnulfs Begleitung den prächtigen, mit zahlreichen Rundbogenfenstern versehenen Palas, schritten die Stufen empor und den Gang entlang. Der Leibwächter öffnete ihnen die Tür des Gemachs, das sich über dem Festsaal befand.
Neben zahlreichen Briefen lagen auf einem Tisch aus schwerer Eiche kostbare golddurchwirkte Garne, Nadeln aus geschnitztem Bein oder Kupfer und verschiedene feingewebte Leinenstoffe. Bertha schob das alles achtlos beiseite und streckte Tilda ihre Hand entgegen. „Gib ihn mir! Von wem ist er?“
Tilda raffte ihren Rock aus hellbrauner Wolle empor, im leinenen Unterkleid war eine geheime Tasche eingenäht. Daraus zog sie einen Brief hervor. „Er ist von Adelheid.“
Bertha war überrascht, eine Nachricht von ihrer Schwester zu erhalten, die mit dem Herzog Rudolf von Rheinfelden vermählt war. Das Herz der Königin begann aufgeregt zu pochen. „Von meiner Adelheid? Leider schreibt sie mir so selten. Aber das ist ja kein Wunder: Wegen ihres abscheulichen Gemahls muss sie es stets heimlich tun.“ Freudig nahm sie die Nachricht entgegen, brach das Siegel und setzte sich.
Meine liebe Schwester,
ich gehe ein großes Risiko ein, Dir folgende Zeilen zu schreiben. Sollten diese Rudolf in die Hände fallen, wird er mich totschlagen. Allerdings bist Du um Deinen Gemahl ja auch nicht zu beneiden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor sieben Jahren hörte, dass Heinrich Egeno II. von Konradsburg an den Hof geholt hatte, der Dich verführen sollte, damit er sich von Dir scheiden lassen konnte. Doch bist Du Gott sei Dank nicht darauf hereingefallen und hast sowohl Egeno als auch Heinrich mit einem Knüppel verhauen. Darüber kann ich heute noch herzlich lachen. Ach, meine Liebe, sei zufrieden, dass er Dich an schlechten Tagen höchstens mit Missachtung straft und Dich nicht wie einen Hund verprügelt.
Nun zum Grund meines Schreibens: Es bereitet mir große Sorgen, dass der Papst wahrscheinlich über Heinrich triumphieren wird. Ich möchte Dich eindringlich vor Rudolf warnen. Hat er schon beim Aufstand der Sachsen die Nähe dieses aufsässigen Volkes gesucht, so sieht er nun seine Chance gekommen, selbst nach der Krone zu greifen. Als Heinrich exkommuniziert wurde, war Rudolfs Freude grenzenlos. Zu jeder Untat, zu jedem Kompromiss, zu jedem Zugeständnis wird er bereit sein, um sein Ziel zu erreichen. Dem Papst wäre er ein getreuer Knecht, aber ich sehe Gefahr für die Stärke des Reichs, wenn das Königtum zahlreiche Rechte und an Macht verlöre. Nach außen hin werde ich stets zu Rudolf stehen, obwohl ich ihn verachte. Nimm Einfluss auf Heinrich, damit er weder Rudolf noch den Herzögen Berthold von Kärnten und Welf IV. von Bayern traut. Alle drei sind sich einig und wollen den Sturz des Königs. Und die Sachsen kommen schon wieder zu geheimen Unterredungen in unsere Burg. Sie schärfen unlängst ihre Waffen und sind bereit für den nächsten Schlag gegen Heinrich.
Du bist die Königin, und ich bete, dass dieses auch so bleiben möge und Dein kleiner Konrad irgendwann die Krone trägt. Sei gewarnt!
Deine Dich liebende Schwester Adelheid
Mit bebenden Händen legte Bertha den Brief beiseite. Ja, sie hatte bereits gewusst, dass Rudolf eine Gefahr war, doch dass Adelheid sie so eindringlich vor ihm warnte, bestürzte sie. Hoffnungslosigkeit fiel wie ein Rudel hungriger Wölfe über sie her. Tränen sammelten sich in ihren Augen und rannen ihr über die Wangen.
„So schlimme Neuigkeiten?“ Tilda befreite sich von ihrem Kopftuch und entblößte ihr hochgestecktes grau-braunes Haar. Seufzend erhob sie sich und drückte die Königin liebevoll an sich.
„Neuigkeiten sind es nicht unbedingt, aber wenn man die eigene Lage so unverblümt und klar vor Augen geführt bekommt, ist es durchaus erschreckend“, sagte Bertha leise, da sie nicht wollte, dass Arnulf etwas davon mitbekam.
„Ja, mein Herz, der Königshof ist wahrlich kein Ort der Freude und hat weitaus prächtigere Zeiten gesehen. Auch die Gesandten aus den fernen Ländern bleiben aus, da sie wissen, dass Heinrich wie ein Schiff in unruhigen Gewässern treibt und jeder noch versucht, Löcher in den hölzernen Rumpf zu schlagen, damit es schneller sinkt.“ Sie seufzte. „Weint nur, weint … Aber vor Euren Kindern dürft Ihr das nicht tun. Sie sollen sich nicht ängstigen und verstehen Eure unheilvolle Situation ohnehin noch nicht.“
Bertha wischte sich die Tränen fort. „Es nützt nichts zu jammern. Wir können hier nur tatenlos in Speyer hocken, während die Krähen bereits auf den Dächern hocken und darauf warten, dass sie sich an uns laben können.“ Bertha richtete sich in ihrem schweren Holzstuhl mit der kunstvoll gedrechselten Rückenlehne gerade auf.
„Jedoch hatte ich heute das Gefühl, dass Heinrich Pläne schmiedet. Wenn diese keine Torheiten sind, werde ich ihn dabei unterstützen, ganz gewiss!“
Mütterlich tätschelte Tilda ihr die Wange. „Brav so, meine Königin, so gefallt Ihr mir schon wesentlich besser. Wollt Ihr den Brief nochmals lesen, bevor ich ihn den Flammen übergebe?“
„Ja, natürlich“, meinte Bertha, nahm ihn zur Hand, und ihre Wut auf Herzog Rudolf wuchs ins Unermessliche. Niemals durfte dieser Mensch, der sich selbst für so überaus fromm hielt, aber nicht danach handelte, die Krone aufgesetzt bekommen. Niemals!
Kapitel 2
Burg Hadenstein im Harz, November 1076
„Nein, so ist das falsch! Du darfst die Waffe nicht verkrampft halten. Wie oft habe ich dir das schon gesagt?“ Strafend blickte Arend von Hadenstein auf seinen ältesten Sohn hinab, der mit einem Holzschwert auf einen von einem Balken hängenden Strohsack schlug.
Der Sachse befand sich mit seinen Kindern auf einem Übungsplatz zu Füßen der väterlichen Burg, wo Arend zahlreiche Hindernisse, Pfähle und Klötze hatte aufbauen lassen, mit deren Hilfe die Jungen ihre Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer trainieren sollten.
„Aber ich versuche es doch!“, protestierte der sechsjährige Giselher und schaute trotzig zum hünenhaften Vater herauf.
„Versuchen reicht nicht! Mach es endlich richtig!“, blaffte Arend, wischte sich eine Strähne seines braunen Haares aus der Stirn und rieb sich dann verärgert über seinen kurzen Bart. Stets aufs Neue versuchte er, dieses Gefühl zu unterdrücken, aber es brach dem Jungen gegenüber immer wieder aus ihm heraus. Mit den Jahren wurde immer deutlicher, dass dieser Knabe dort mit den dunkelblonden Haaren und den saphirblauen Augen der Bastard des Königs war. Als Arend Leibwächter der Königin gewesen war, hatte er in jener Nacht vor ihrer Tür gestanden, als Heinrich drei Jahre nach der Vermählung die Ehe vollziehen wollte und in Berthas Gemach eingedrungen war. Doch die Königin hatte sich seiner Gewalttätigkeiten tapfer erwehrt, und bald darauf hatte der junge Herrscher wutentbrannt die Pfalz verlassen. Später war er mit einem Bauernmädchen zurückgekehrt, das er entführt und geschändet und anschließend einem seiner Kriegsknechte zum Weib hatte geben wollen. Dies hatte Arend nicht ertragen und – seinen Adel und die Ehre seiner Familie vergessend –, dieses arme Geschöpf geheiratet. In Liebe zu ihr entflammt war er bis heute nicht, aber er achtete sie, denn sie war ein gutes, fleißiges Weib. Allerdings waren all seine Nachkommen – vier Söhne und eine Tochter – keine Adligen, denn der niedere Stand zählte. Und dies ließen ihn die Kinder seiner Brüder Giselher und Suidger, die er ebenfalls im Kampf unterrichtete, deutlich spüren.
Giselher und ihr gemeinsamer Vater Eilbrecht befanden sich nach der Unterwerfung der Sachsen nach wie vor in Gefangenschaft. Zwar war Arend ein ausgezeichneter Ritter, aber seiner Mutter keine große Hilfe beim Verwalten der Burg und der Güter. Dazu fehlte ihm jegliches Talent. So übte er sich lieber täglich in den Waffen und bildete die Kinder aus.
„Was steht ihr da und schaut durch die Gegend? Kämpft!“, schalt Arend die Kinder seines Bruders, doch dann schickte er ein gütiges Lächeln hinterher, wollte sie von seinem Tadel ein wenig ablenken. „Ihr stammt von der Burg Hadenstein, unsere Vorfahren haben bis zum bitteren Ende zusammen mit Widukind gegen den Franken Karl den Großen gekämpft. Wisst ihr, warum wir in unserer Familie die Schilde mit einem weißen Pferd auf blauem Grund bemalen?“
Hartwin, der zwölfjährige Sohn seines Bruders Giselher, warf seinen Kopf in den Nacken. „Natürlich weiß ich das, Oheim: weil Widukind seinen Schild mit einem Pferd bemalt hatte. Anfangs ist es ein schwarzer Hengst gewesen, doch als er sich zum Christentum bekehrte, war es ein weißer. Da wir uns mit Widukind verbunden fühlen, tragen wir ebenfalls ein weißes Pferd auf dem Schild. Ach ja, und ich weiß auch, dass die Farbe Blau für die Treue steht.“
Arend musste hart schlucken. Er hatte seinen Treueeid gegenüber Heinrich nach Jahren der Pein und Demütigung gebrochen, gegen ihn gekämpft und viele von dessen adligen Streitern und Kriegsknechten auf dem Schlachtfeld getötet.
Er räusperte sich. „Mein Vater hat mich zu unverbrüchlicher Treue erzogen. Doch bedenkt: Euer Gewissen sollte euer vordringlichster Ratgeber sein. Nun macht weiter. Haltet den Schild zur Abwehr erhoben, sollte die Schulter auch noch so schmerzen, denn er schützt euer Leben. Denkt beim Kampf an Finten und auch daran, dass man bei einem Schwert nicht nur die Schneide, sondern auch die Parierstange und den Griff einsetzen kann. Selbst der Schild kann eine Waffe sein, mit ihm könnt ihr zuschlagen.“
Obwohl Arend sie weiterhin beobachtete, ließ er zwischendurch immer wieder den Blick über die Landschaft gleiten, die Gefilde, in denen er aufgewachsen war. Die Burg thronte auf einem großen Felsen und bestand aus Stein und Holz mit einem herrlichen Blick ins Land. Sie war umgeben von Weiden, Wiesen und Äckern. Ein kleines Dorf befand sich am Fuße der Festung, und unweit davon plätscherte ein klarer Wasserlauf. Jeder Baum, jede schroffe Erhebung, jeder Hügel waren Arend vertraut.
„Nicht aufhören! Macht weiter, auch wenn die Muskeln zittern und brennen! Im Kampf lässt euch niemand Zeit, damit ihr euch erholen könnt! Wer schwach ist, stirbt!“ Unermüdlich hetzte er die Kinder, denn er hatte in den Schlachten selbst unerbittlich erfahren, wie sehr es darauf ankam, Kraft und Ausdauer zu besitzen, um nicht zu unterliegen.
Da er sich den Ruf eines unbezwingbaren Kämpfers erworben hatte, waren in letzter Zeit vermehrt Streiter zur Burg gekommen, um sich mit ihm zu messen, und er hatte die Herausforderungen stets angenommen und obsiegt. Dadurch hatte er gehofft, das zornige Feuer in ihm löschen zu können, doch noch immer züngelte dieses in ihm.
Der kalte Wind ließ die kahlen Äste der Bäume und Sträucher tanzen. Ein dicker schiefer Ast schaukelte hin und her und rieb mit einem Quietschen am Stamm. Die nur noch mäßig wärmende Sonne stand golden am Himmel und verlieh den übenden Kindern lange Schatten, die auf dem sandigen Platz einen wirren Reigen aufführten.
„Gut so. Weiter! Wie gesagt: Auch wenn eure Arme müde sind und immer schwerer werden, dürft ihr weder Schwert noch Schild sinken lassen! Sobald dieses geschieht, rammt euch euer Gegner seine Waffe in den Leib“, spornte Arend die Jungen an, die auf seine Anerkennung erpicht waren.
Sie alle besaßen die Kampfeskraft und Schnelligkeit seiner Familie – bis auf Heinrichs Spross, der stets ein wenig unwillig wirkte. Selbst Arends dreijähriger Sohn Osmund wirbelte unermüdlich mit dem Holzschwert umher. Allerdings entdeckte er alsbald eine freche Krähe, der er munter hinterherjagte und das Üben vergaß.
„Schau, Vater, da kommt wieder jemand, der gegen dich kämpfen will!“, rief Giselher aus.
Arend wandte sich um und blickte zu dem Weg hinüber, der in einiger Entfernung an ihnen vorbei zur Burg hinaufführte. Dabei rutschte seine Hand zum Schwertgriff. Vom Waldrand näherten sich fünf berittene Männer. Vier von ihnen waren gut gerüstet, und ihre Waffen und ihr Kettenzeug blinkten im Sonnenlicht. Der vorderste Reiter trug einen blauen Mantel, und sein blondes Haar war so hell, dass es beinahe silbrig leuchtete.
Arends Blick klebte an diesem Mann, der größer und kräftiger als seine Begleiter war. Unmittelbar zeigte sich ein ungläubiges Lächeln auf seinen Lippen. „Magnus“, stieß er leise hervor.
„Was hast du gesagt, Oheim?“, wollte Hartwin wissen.
„Ich sagte: Magnus! Der Reiter dort vorn ist Magnus Billung, der Herzog der Sachsen.“
Die Jungen ließen allesamt die Waffen sinken und versammelten sich erstaunt um Arend.
„Der Herzog? Er kommt zu uns?“, fragte Giselher staunend.
„Ich kann es selbst kaum glauben.“ Mit einem freudigen Lächeln eilte er den Reitern entgegen, doch als er Magnus’ finstere Miene erblickte, erstarb dieses augenblicklich.
Unmittelbar vor ihm hielt Magnus sein Pferd an. „So, du hast also deine Bälger ausgebildet, während wir anderen in Ketten lagen und in finstere Löcher gesperrt wurden!“, schnappte er. Er war ein auffallend schöner Mann, mit dickem blonden Haar und dichtem Bart, lebendigen hellgrauen Augen, einer geraden Nase und einem ausdrucksstarken Mund. In seinen Adern floss königliches Blut. Seine Mutter war Wulfhild, die Tochter des norwegischen Königs Olav II. Haraldsson, die mit dem sächsischen Herzog Ordulf verheiratet gewesen war. Beide waren bereits tot. Magnus musste nun einunddreißig Jahre alt sein und wirkte stärker und männlicher als jemals zuvor. Er hielt das böse Funkeln bei, aber nur mühsam, und dann platzte das Lachen aus ihm heraus. Mit einem Satz sprang er vom Pferd, ging mit großen Schritten auf Arend zu, umarmte ihn kraftvoll und klopfte ihm dabei freundschaftlich auf den Rücken. Der Herzog, der nur etwas kleiner als Arend war, packte ihn bei den Schultern und schob ihn auf Armlänge von sich. „Lass dich anschauen! Du wirkst erholt und hast noch weiter an Muskeln zugelegt, ja?“
„Ich übe viel. Doch ich muss feststellen, dass dir die Gefangenschaft diesmal nicht schlecht bekommen ist, du siehst blendend aus“, bemerkte Arend.
Ein dunkler Schatten huschte über Magnus’ Gesicht. „Es war nicht annähernd so wie vor fünf Jahren, als ich in der Harzburg in den Kerker geworfen wurde und mich der König so erbärmlich behandelt hat. Dort erging es mir erst besser, als du für mich ein Wort eingelegt hast. Das werde ich dir nie vergessen! Aber …“ Seine Augen blitzten für einen Moment gefährlich auf. „Ich vergesse auch nicht, dass du nicht den geringsten Versuch unternommen hast, mich zu befreien. Damals hast du ja noch fast fanatisch an deinem dämlichen Treueeid dem König gegenüber festgehalten. Mein Aufpasser des vergangenen Jahres war hingegen freundlich zu mir. Davon werde ich später berichten. Doch nun möchte ich wissen, welche von diesen Jungen deine Sprösslinge sind.“ Er schob sich an Arend vorbei und betrachtete die Kinder, die ihn mit großen, bewundernden Augen anstarrten. Den stolzen Magnus umgab eine herrschaftliche Aura, der sich selbst die Knaben nicht entziehen konnten.
Also stellte Arend ihm den dreijährigen Osmund, den vierjährigen Herwin und den fünfjährigen Arwed vor, und der Herzog hatte für jeden von ihnen nette Worte. Als allerdings der sechsjährige Giselher an der Reihe war, betrachtete der Herzog diesen schweigend mit emporgezogenen Augenbrauen, auch er erkannte den König in dem Jungen. Zudem besaß er Kenntnis, wer ihn einst gezeugt hatte.
„Jene hier sind die Söhne meines Bruders Giselher: der zwölfjährige Hartwin und der zehnjährige Ortulf. Und das sind die Jungen von Suidger, der in der Schlacht bei Homburg an der Unstrut gefallen ist. Sein Weib hat die Mädchen mitgenommen und sich auf ihr Witwengut zurückgezogen. Die ältesten beiden Söhne, Dankmar, er ist jetzt zehn, und den ein Jahr jüngeren Erhard, hat sie bei uns in der Burg gelassen, damit ich sie ausbilde.“
„Fast alle Kinder besitzen diese unverwechselbaren leuchtend blauen Augen, die eurer Familie so eigen sind“, ließ sich Magnus vernehmen. „Hübsche Kinder“, fügte er hinzu und wurde für einen Moment betrübt. „Ich bin zwar glücklich über meine kleine Tochter, aber ich wünschte, ich hätte auch einen Sohn, einen Erben.“ Er lachte bitter. „Vielleicht hält mich der König deshalb so oft und so lange gefangen – um zu verhindern, dass ich einen kleinen Herzog zeugen kann. Schon insgesamt drei Jahre meines Lebens hat Heinrich mir gestohlen.“ Er seufzte, doch dann straffte er die Schultern und lächelte. Nochmals schlug Magnus Arend auf den Rücken und grinste ihn breit an. „Du wirst mir doch bestimmt für ein, zwei Tage deine Gastfreundschaft gewähren, ehe ich mich auf den Weg zur Lüneburg begebe, oder?“
„Selbstverständlich. Dich zu beherbergen ist mir eine Ehre! Schnell, Kinder! Eilt in die Burg, sagt eurer Großmutter, dass ein Festmahl vorbereitet und eine würdige Schlafstätte für den Herzog hergerichtet werden soll. Lauft!“ Kaum hatte Arend dies ausgesprochen, stoben die Jungen davon. Der kleine Osmund stolperte dabei über seine eigenen Füße, fiel der Länge nach hin, und Giselher riss ihn empor und zog ihn an der Hand hinter sich her.
Er wandte sich zu seinen Begleitern um. „Ich danke euch für das Geleit! Nun bin ich bei Freunden, und ihr könnt zurück nach Hause reiten.“
Obwohl die Reiter Franken waren, schienen sie ihn zu mögen, wünschten ihm viel Glück, wendeten die Reittiere und zogen davon.
Langsam ging Arend mit seinem Gast, der sein Pferd neben sich herführte, zur Burg.
„Ach, Arend, uns verbindet so viel! Wir haben den jeweils anderen schon oft im Leid gesehen. Auch wenn wir uns in feindlichen Lagern gegenüberstanden, so hatte ich dennoch stets freundschaftliche Gefühle für dich. Ich kann mich noch immer gut daran erinnern, wie die Thüringer dich den Sachsen zum Geschenk gemacht haben, nachdem du freiwillig zu ihnen gegangen bist, um für Bertha, die sich in der belagerten Burg Volkenroda befand, die Freiheit zu erbitten. Adalbert II. von Ballenstedt hat dich im tiefsten Winter fast erfrieren lassen, und wenig später wurdest du uns übergeben, vom Fieberwahn ergriffen. Im Bauernhaus, wo wir dich ein wenig aufpäppelten, war doch diese hübsche Bauerntochter … Sie war ganz vernarrt in dich, war ständig um dich herum“, neckte der Herzog ihn.
Ja, Arend erinnerte sich an das wissbegierige Mädchen, das so gern die Welt erklärt bekommen hätte und mit einem Trottel verheiratet werden sollte. Er hatte ihre Haltung bewundert und sogar seine Tochter nach ihr benannt: Hiltraut.
Er schoss einen Stein fort, der auf dem Weg gelegen hatte. Im hohen Bogen flog er davon und purzelte dann noch ein Stück über die Wiese weiter. „Sag, wie ist es dir in deiner Gefangenschaft wirklich ergangen?“
„Anfangs war es hart, doch als ich bei meinem endgültigen Bewacher angelangt war, hat dieser mich recht anständig behandelt. Er hat mir sogar ein einigermaßen bequemes Quartier herrichten lassen. Und“, er lächelte schelmisch, „damit ich seinen Töchtern nicht zu nahe komme, hat er mir eine hübsche Hure ins Bett gelegt. Zudem hat er mich mit Informationen versorgt, mich stets auf dem Laufenden gehalten, was im Reich geschieht. Er ist kein so großer Freund des Königs, wie Heinrich es sich erhofft hatte, als er mich in dessen Obhut gegeben hat. Jedoch war dies immer noch eine Gefangenschaft. Ich konnte über ein Jahr lang nicht zu Weib, Kind und meinem Volk.“ Sein Blick wurde hart wie Granit. „Jeden Tag habe ich den König dafür verflucht, dass er das uns gegebene Wort gebrochen hat, denn er hatte uns nach unserer Unterwerfung die Freiheit zugesagt. Ein falscher, durchtriebener Hund ist er! Ich wünsche ihm, dass er seine Krone verliert … Allerdings lodert mein Hass nicht nur auf ihn, sondern auch auf Otto von Northeim, meinen einstigen Verbündeten.“ Er ballte seine Hand zur Faust, und es war ihm deutlich anzusehen, dass er seinen Zorn nur mühsam zügelte. „Aber dazu später … nach dem Essen.“
Sie gingen den gewundenen Weg hinauf zur Burg und kamen zur Zugbrücke, die über einen tiefen Graben führte. Dahinter befand sich ein mit hohen Palisaden und Wachtürmen versehener Wall.
Vor dem wehrhaften Tor, das zur Vorburg führte, blieb der Herzog stehen. „Wie hat deine Mutter die Anwesenheit deines Weibes und der Kinder aufgenommen? Sie sind keine Adligen.“
Arend zog die dunklen Augenbrauen empor und fuhr sich mit der Hand verlegen über seinen Bart. Wie sollte er dem Herzog in kurzen Worten schildern, wie seine Familie auf seine Ehefrau reagiert hatte? „Nun … meine Mutter behandelt mein Weib wie eine Magd. Sie kann es nur schwer ertragen, dass Sieghild bei den Mahlzeiten bei uns im Saal ist und in meinem Bett schläft. Wir wohnen nicht bei ihnen im Turm, sondern in einem kleinen Nebenhaus. Immerhin erkennt sie deren Fleiß an und auch, dass Siegi die Kinder liebevoll umsorgt. Meine Mutter bemüht sich, meine Sprösslinge zu mögen, und hegt die Hoffnung, dass sie später einmal den Aufstieg zu Ministerialen oder durch Tapferkeit im Kampf zu Rittern schaffen. Als sie erfuhr, wer wahrscheinlich der Vater von Giselher ist, kühlten sich ihre Gefühle zu ihm jedoch deutlich ab.“
Nachdenklich nickte Magnus. „Das glaube ich gern. Durch deine Ehe mit Sieghild hast du wirklich viele Menschen brüskiert und die Ehre deiner Familie beschmutzt. Jetzt, da du weißt, welche Konsequenzen dies für dich hat, interessiert mich: Würdest du es wieder tun?“
„Ohne zu zögern!“, stieß Arend fast zu trotzig hervor. „Niemals werde ich vergessen, wie Sieghild als Sechzehnjährige zitternd vor den geifernden Kriegsknechten stand.“
„Liebst du sie?“
„Nein, und dies bedaure ich, denn sie hat es verdient.“
Magnus presste die Lippen zusammen, dann entgegnete er: „Auf eine gewisse Weise bewundere ich dich … obwohl du ein hoffnungsloser Narr bist.“
Sie gingen in die Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden, Werkstätten, Speichern, Ställen, Scheunen und Unterkünften der Mägde und Knechte hinein. Es herrschte große Aufregung. Ein quiekendes Schwein wurde für das Festmahl aus dem Stall gezerrt. Es trat und zappelte, als ahnte es, dass es bald gebraten und mit einem Apfel im Maul auf einer Tafel landen würde.
Als Arend und sein Gast entdeckt wurden, verharrten die Menschen, beäugten neugierig Magnus, die Frauen verzückt, die Männer beeindruckt. Tief verbeugten sie sich vor dem stattlichen Herzog.
Auf einen Wink von Arend hin eilte ein Stalljunge herbei und nahm dem hohen Besucher das Pferd ab.
Über eine weitere Zugbrücke, die über einen in den Fels gehauenen Graben führte, gelangten sie in die Hauptburg. Mächtig erhob sich ein steinerner Wohnturm in den Himmel, außerdem befanden sich hier ein hölzerner Palas, die Küche, ein kleines Badehaus, eine Kapelle, zwei Wohnhäuser und kleinere Wirtschaftsgebäude. In freudiger Erwartung hatte sich bereits die Familie auf dem Hof versammelt. Höflich verneigte sie sich vor dem Gast.
„Du bist schon einige Jahre nicht mehr in unserer Burg gewesen, daher stelle ich dir am besten meine Familie vor“, sagte Arend und begann mit seiner Mutter, der mittlerweile fünfzigjährigen schlanken Frau, unter deren Schleier grau-braunes Haar hervorschaute. Arend musste schmunzeln, da selbst die Augen seiner schwer zu beeindruckenden Mutter beim Betrachten des Herzogs voller Wohlgefallen leuchteten.
„Meine Mutter Mathilde müsstest du noch kennen …“
„Selbstverständlich. Ihre Schönheit hat auf all ihre Kinder abgefärbt – außer auf dich“, neckte Magnus und stieß Arend leicht mit dem Ellenbogen an.
Abermals verneigte sich seine Mutter. „Werter Herzog, wir fühlen uns überaus geehrt, Euch auf unserer Burg begrüßen zu dürfen. Ich werde versuchen, Euren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.“
Erfreut lächelte der Besucher ihr zu. „Das werde ich zu schätzen wissen.“
„Das ist Wigburg, das Weib meines Bruders Giselher.“ Arend stutzte, als die kleine, blonde Frau errötete und den Gast verschämt anlächelte.
„Auch ich heiße Euch willkommen.“ Ihre Stimme bebte leicht, und sie musste mehrmals schlucken. „Das hier sind meine Kinder: Hartwin, Ortulf, Gisberga und die kleine Herlinde.“
Der Herzog bedachte jedes der Kinder mit einem Lächeln, auch Suidgers Söhne.
Arend ging weiter. „Hier haben wir meine jüngsten Schwestern, die noch in der Burg leben. Helgard ist siebzehn und Gerhild ist fünfzehn. Meine Mutter schmiedet schon seit Jahren Pläne, mit wem sie verheiratet werden sollen. Bisher war ihr aber noch niemand gut genug.“
Die Mädchen trugen ihr langes brünettes Haar offen, und im Sonnenlicht glänzte es golden. Ihre Wangen glühten, und sie wagten es kaum, dem Herzog in die Augen zu schauen. Ungewohnt schüchtern waren sie und spielten mit ihren Fingern nervös an ihren Kleidern herum.
„Nun, ich hoffe, dass eure zukünftigen Gatten einmal euren Liebreiz zu schätzen wissen“, schmeichelte der Herzog, und die Gesichter der Mädchen färbten sich bis zu den Schläfen.
„Danke, Herr!“, würgte Helgard heraus, während Gerhild nicht einen einzigen Ton herausbrachte.
So kannte Arend seine Schwestern gar nicht, denn sonst waren sie nie auf den Mund gefallen. Er räusperte sich. „Und dies ist Sieghild, mein Weib.“
Sieghild machte einen Knicks vor dem Herzog, dabei rutschten ihr breite Strähnen ihres rotbraunen Haares über die Schulter, die unter dem Kopftuch hervorschauten. Sie hatte hohe Wangenknochen, sinnliche Lippen, ein rundliches Kinn, nur ihre kurze Nase erschien ein wenig zu breit. Sie lächelte freundlich, doch ihr Blick streifte den Herzog nur kurz und wenig beeindruckt und richtete sich dann verliebt auf ihren Gemahl. Ihre Zuneigung zu Arend war in all den Jahren nicht verblasst.
„Entzückend“, ließ sich der Herzog vernehmen und zwinkerte Arend zu, da ihm dessen Weib gefiel.
„Und diese Kinder hier sind die meinigen.“
„Du hast mir die Jungen vor der Burg ja schon vorgestellt. Es sind recht viele Kinder, Arend. Gönnst deinem Weib wohl keine Ruhe, was? Und wer ist das?“ Magnus wies auf Arends eineinhalbjähriges Töchterchen, das Sieghild auf dem Arm trug.
„Das ist Hiltraut.“
„Hiltraut …“, wiederholte Magnus verwundert, er wusste, dass das Bauernmädchen so geheißen hatte. Lächelnd schüttelte er den Kopf. „Du bist noch jung, Arend – wie alt genau? Vier Jahre jünger als ich? Ich denke mal, das werden noch nicht deine letzten Kinder sein. Das ist wirklich beneidenswert, dazu sind sie noch hübsch, gesund und putzmunter.“ Ein Anflug von Traurigkeit huschte über Magnus’ Gesicht. Wahrscheinlich hätte er selbst bereits so viele Kinder, wenn der Krieg ihn nicht von seiner Familie ferngehalten hätte.
Mathilde, Arends Mutter, trat näher an den Herzog heran. „Ich hätte Euch gern meine gesamte Familie vorgestellt, aber ich habe Verluste zu beklagen: So ist meine zweitälteste Tochter im Kindbett gestorben, und Herwin und Suidger sind im Kampf gefallen.“
Ihr vorwurfsvoller Blick streifte Arend, dem sie insgeheim die Schuld am Tod seiner Brüder gab, da er der beste Kämpfer der Familie war und es nicht geschafft hatte, sie zu beschützen. Ihre Augen röteten sich. „Und mein Gemahl und mein ältester Sohn Giselher befinden sich in Gefangenschaft. Gott weiß, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Das Leben ist hart, mein Herr, findet Ihr nicht auch?“
„Ja, aber dennoch liegt es an uns, niemals die Zuversicht, unsere Stärke und unseren Stolz zu verlieren.“
Seufzend nickte sie. „Das ist wahr. Doch, Herzog, eines muss ich Euch unbedingt fragen: Wisst Ihr etwas über den Verbleib von Eilbrecht und Giselher?“
Sein Blick richtete sich ernst auf Arend, doch dann schenkte er dessen Mutter ein ermutigendes Lächeln. „So wie ich hörte, sind sie wohlauf.“
Mathilde legte erleichtert die Hände auf ihre Brust. „Gott sei Dank!“
Sie begaben sich in den Palas. Im Festsaal befanden sich zahlreiche Tische, Stühle und Bänke, und an den Wänden hingen gewebte Teppiche, Felle und ein stattliches Hirschgeweih. Der Ehrengast nahm zwischen Arend und Mathilde Platz, und die anderen Familienmitglieder gesellten sich hinzu, jedoch saß Sieghild mit ihren Kindern an einem gesonderten Tisch nahe der Tür. Magnus bemerkte dies mit einem Stirnrunzeln.
Als kleine Stärkung wurden Brot, Eier, Käse, Bier und Wein hereingetragen, am Abend würde das Festmahl folgen. Jedoch kam Magnus kaum dazu zu essen, da ihm die Jungen allerlei Fragen zu den Schlachten und auch zu seinen Gefangenschaften stellten. Er erzählte äußerst lebhaft und wetterte dabei oft über den König. Als eine Magd Bier über seine Hand verschüttete, schaute er verärgert auf, doch dann weiteten sich seine Augen, und er starrte das schöne Geschöpf entflammt an.
„Verzeiht, mein Herr!“, entschuldigte sich das Mädchen und tupfte mit ihrer Schürze behutsam seine Hand ab.
„Schon gut … kann ja mal passieren“, meinte er und konnte die Augen nicht von ihr abwenden.
Sie errötete und senkte das Haupt.
Als sie weiterging, folgte er ihr mit seinem Blick, der verzückt über ihren wohlgeformten Körper glitt. Er war verzaubert von ihr.
„Ich fragte, wie lange Ihr zu bleiben gedenkt, mein Herr? Ich möchte, dass es Euch an nichts fehlt“, wiederholte Mathilde gnädig, der Magnus’ Verhalten natürlich nicht entgangen war.
„Wie? Oh, verzeih. Ich war gerade in Gedanken. Nicht sehr lange, ein oder zwei Tage.“
„Sicherlich wollt Ihr so schnell wie möglich zurück zu Weib und Kind“, ließ sich Mathilde mahnend vernehmen.
„In der Tat, ich war lange von ihnen getrennt.“
„Soso“, ließ Mathilde verlauten und nahm wenig erfreut zur Kenntnis, dass ihre Magd dem Herzog einen sehnsuchtsvollen Blick zuwarf. Daraufhin scheuchte Mathilde sie hinaus und lehnte sich ein wenig vor. „Herzog, was kann ich Euch Gutes tun, damit Ihr unsere Gastfreundschaft als angenehm in Erinnerung behaltet?“
Magnus biss von seinem Brot ab, kaute genüsslich, ließ sich mit der Antwort Zeit. Den Rest des Bissens spülte er mit einem großen Schluck Bier herunter und schaute Arends Mutter verschmitzt an.
„Nun, da gibt es schon einiges: Ich hätte gern ein Bad, ein bequemes Bett, und wenn du mir die hübsche blonde Magd dazulegen würdest, wäre ich deiner Familie außerordentlich zu Dank verpflichtet.“
Schweigen.
Arend verschluckte sich beinahe an seinem Stück Käse. Er machte sich auf seinem Stuhl ein wenig kleiner, widmete sich ausgiebig einem gekochten Ei, dessen Schale sich kaum lösen wollte, und lugte unter seinen Stirnhaaren hervor. Seine Schwestern und seine Schwägerin Wigburg schauten wenig erfreut, sein Weib Sieghild lächelte verständnisvoll, die älteren Jungen kicherten dämlich, und die Jüngeren begriffen es nicht.
Arends Mutter hingegen war sprachlos und konnte auf diese forsche Bitte nicht unverzüglich antworten. Sie blinzelte ein paarmal ungläubig, fasste sich an den Hals und zwang sich zu einem Lächeln das etwas verzerrt ausfiel.
„Mein lieber Herzog …“, begann sie krächzend, hüstelte sich die Stimme frei und fuhr dann fort. „Es mag Höfe und Burgen geben, wo die Mägde vor den Nachstellungen der Herren nicht sicher sind … Doch wir sehen sie als wertvolle Gehilfinnen an und nicht als Objekt männlicher Begierde.“
Abermals Schweigen.
Einige im Saal fürchteten offenkundig den Zorn des Herzogs, doch Magnus lächelte versöhnlich. „Nun, dies ist sehr lobenswert, aber ich glaube, die Magd wäre nicht abgeneigt. Frage sie! Sie soll mich während des Festmahls bedienen, und wenn ich ihr zuwider bin, werde ich meine Bitte unverzüglich zurückziehen.“
Arend konnte geradezu sehen, wie seine Mutter mit sich rang. Sie wollte das Mädchen schützen, andererseits war es ihr Herzog, der diesen Wunsch an sie richtete. Ihr Gesicht, das meist hart und unbewegt war, zeigte ein vielfältiges Mienenspiel. Es gelang ihr nicht, eine unbeeindruckte Fassade aufrechtzuerhalten. Schließlich atmete sie stoßartig aus, setzte sich aufrecht hin und richtete ihren gestrengen Blick auf ihren Sohn. „Geh und sprich mit Hilla!“
Arend, der endlich sein Ei vollständig von der Schale befreit hatte, ließ es fast auf den Tisch fallen. „Ich? Sollte dies nicht lieber ein Weib tun?“
„Nein! Du gehst! Jetzt!“, forderte Mathilde, und ihr Sohn kam sich nicht wie ein wehrhafter Krieger vor, sondern wie der kleine Junge, den seine Mutter so oft gescholten hatte.
Sein flüchtiger Blick streifte Magnus, der sich in seinem Stuhl zurückgelehnt hatte, die Arme lässig von den Lehnen baumeln ließ und dies alles recht amüsiert beobachtete. Schwer seufzend, als müsste er jemandem eine Todesnachricht überbringen, legte Arend das Ei auf den Tisch, nahm einen großen Schluck vom mit Minze gewürzten Bier, schob den Stuhl zurück und ging hinaus.
Auf dem Hof hielt er nach der Magd Ausschau und entdeckte sie auf dem Weg zum Brunnen. Während er sich ihr näherte, rieb er sich verlegen den Bart.
„Herr?“, sprach sie ihn an, als er schließlich stumm vor ihr stand.
Er musterte sie zum ersten Mal ausgiebig. Magnus hatte recht, sie war eine Schönheit, und selbst in diesen abgetragenen Kleidern wirkte sie überaus graziös. Warum war ihm das nie zuvor aufgefallen?
„Ich muss mit dir reden.“
„Ja, Herr.“ Mit großen Augen schaute sie zu ihm herauf. Sie reichte ihm gerade bis zur Brust. Wie sollte er nur beginnen? Lieber hätte er sich jetzt auf einem Schlachtfeld Feinden entgegengeworfen, als hier zu stehen. Reden war ohnehin nicht seine Stärke.
„Heute beim Festessen wirst du vornehmlich den Herzog am Tisch bedienen. Schaue, ob er dir gefällt. Es würde ihn erfreuen, wenn du heute Nacht bei ihm liegen würdest.“ So, jetzt war es heraus! Doch seine Anspannung wich nicht.
Ihre Augen begannen zu strahlen, und ihr Mund wollte immerzu lächeln, doch sie bemühte sich, ihre Freude zu verbergen, und Empörung vorzutäuschen.
„Aber, Herr, ich habe noch nie bei einem Manne gelegen! Er ist der Herzog der Sachsen, von überaus schönem Antlitz und wohlgestaltet, doch … Was wird man über mich denken? Die anderen Mägde und Knechte werden mich hänseln, schlecht über mich reden. Und was wird aus mir, wenn ich ein Kind empfange?“
Arend wischte sich die Haare aus der Stirn. Zog er nicht bereits den Bastard des Königs groß? Dann würde er eben auch noch den Bastard des Herzogs in seine Obhut nehmen. So hätte er dann einen Stall voll mit unadligen Kindern. „Mach dir darüber keine Gedanken. Du stehst unter meinem Schutz. Egal, was wird, ich werde für dich sorgen.“
Unruhig flog Hillas Blick umher, sie schien alles zu bedenken, dann verzog sich ihr Mund zu einem beglückten Lächeln. Doch sie unterdrückte es hastig.
„Ja, mein Herr, ich werde ihn mir genau betrachten und Euch dann zunicken, wenn ich dazu bereit bin.“
Arend schenkte ihr ein wissendes Lächeln, da sie sich ihrer Entscheidung offenkundig bereits sicher war, und sie errötete bis zu den Haarspitzen.
„Gut, dann gib mir ein Zeichen. Magnus wird ein Bad nehmen, sorge dafür, dass dieses nach dem Festmahl bereit ist.“
„Soll ich ihm dabei behilflich sein?“, fragte sie betont unschuldig.
„Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihm dieses gefallen würde“, ließ sich Arend vernehmen und wandte sich ab. Als er zum Palas zurückging, überfiel ihn Wehmut. Hilla, die unfreie Magd, wollte sich ein kleines Stück vom Glück stehlen. Für den Rest ihres Lebens würde sie sich an den Herzog erinnern. Doch mehr als Träume würden ihr nicht von ihm verbleiben.
Als er eintrat, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Er nickte dem Herzog nur zu, setzte sich wieder an seinen Platz und aß endlich sein Ei.
Zufrieden grinste Magnus und nahm noch einen Schluck Bier, dann überkam ihn großer Ernst. „Nun muss ich mit dir reden, Arend, dringend. Geht bitte alle hinaus!“, ließ er schließlich recht streng verlauten.
Verwundert blickten ihn die anderen an und kamen der Aufforderung nach.
„Mathilde, bleibe! Es betrifft auch dich. Setz dich hin und höre zu“, sagte er zu Arends Mutter.
Diese stutzte, verharrte im Schritt und nahm schließlich in einiger Entfernung zu ihnen Platz. Unter dem Tisch scharrte sie unruhig mit den Füßen.
Arend schenkte Bier nach, nahm einen großen Schluck aus dem silbernen Becher und war gespannt, was nun folgen würde.
„Bist du gut informiert, was im Reich seit unserer Unterwerfung vor sich geht?“, wollte der Herzog wissen und schaute ihn prüfend an.
„Einige Dinge habe ich von Händlern und Besuchern aufgeschnappt, doch ich wollte von all den Falschheiten, den Ränken und von Heinrich erst einmal nichts mehr hören, zu all dem Abstand gewinnen“, gestand Arend.
Der Herzog schüttelte missbilligend den Kopf. „Das war ein Fehler, Arend! Du bist ein sächsischer Adliger, und alles, was in diesem Reich vor sich geht, betrifft auch dich. Du kannst dich nicht einfach wie ein Huhn in den Stall zurückziehen, wenn der Fuchs draußen herumstreift.“ Er schob sich eine Strähne seines hellen Haares hinter das Ohr. „So muss ich dir nun tatsächlich erzählen, was im letzten Jahr vorgefallen ist?“
„Mehr oder weniger“, gestand Arend und trank aus seinem Becher. Eigentlich wollte er dies gar nicht hören.
„Nun gut …“ Magnus nahm ebenfalls einen großen Schluck und schaute dabei über den Rand des vergoldeten Bechers hinweg Mathilde an. Dann stellte er das Gefäß ab, stützte die Ellenbogen auf den Tisch, atmete schwer aus und ließ die Unterarme auf den Tisch sinken. „Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Es ist so viel geschehen …“ Er räusperte sich. „Ich werde mit Otto von Northeim beginnen, diesem Verräter … Wie du selbst weißt, standen sich vor gut einem Jahr die Sachsen und das Heer des Königs gegenüber. Meine Mannen und ich gingen fest davon aus, Heinrich in einer Schlacht an diesem Tag zu Fall zu bringen oder selbst zu sterben.“
„Doch Heinrich hat Verhandlungen gewünscht, und Otto ist darauf eingegangen“, warf Arend ein. „Und dann ist die vollkommen unverständliche Unterwerfung ausgehandelt worden.“
Magnus lächelte bitter. „Nein, unverständlich war sie eigentlich nicht, schließlich hatte Heinrich mit Intrigen und Versprechungen unser Volk gespalten. Wie dem auch sei, ich glaubte Otto, dass er dieses befürwortete, weil er sich ernsthaft um das Wohl unseres Volkes sorgte. Heinrich gab uns sein Wort, dass er uns nach der Unterwerfung als freie Männer gehen lassen würde.“
Arends Mundwinkel zuckten grimmig. „Allerdings brach Heinrich sein Wort …“
„Dieser verdammte Hundesohn! Wir wurden in Gefangenschaft genommen und im ganzen Reich verteilt. Friedrich von Goseck, der Pfalzgraf von Sachsen, soll sogar bis ins entfernte Pavia verschleppt worden sein. Mich gab der König zu einem schwäbischen Adligen, der, wie ich dir schon berichtete, mich recht gut behandelte. Otto von Northeim und Bischof Burchard II. von Halberstadt wurden anfangs in die Harzburg und anschließend zu Rupert von Bamberg gebracht, der Ende November vergangenen Jahres zum Bischof geweiht wurde. Und siehe da, wer war Weihnachten schon wieder in Freiheit und sogar an Heinrichs Hof in Goslar?“ Magnus schaute Arend an, als sei das tatsächlich ein Rätsel.
„Otto“, sprach Arend aus.
„Otto!“ Magnus schlug erbost auf die Tischplatte. „In der Hölle schmoren soll er!“ Voller Wut schüttelte er den Kopf. „Zwar hat er zwei Söhne, Kuno und Siegfried, als Geiseln stellen müssen, doch soll er sich am Hof ziemlich frei bewegt haben. Bischof Burchard hat ja keine Söhne – wenn man die Bastarde außen vor lässt –, daher musste er zwei seiner Burgen an Heinrich abtreten. Sowohl Otto als auch Burchard wurden begnadigt, und – man staune – Otto wurde sogar ein Ratgeber des Königs!“
„Davon habe ich gehört, konnte es aber nicht glauben. Zumal er mich lange Zeit mit Missachtung gestraft hat, da ich den Eid, den ich dem König geleistet hatte, nicht brechen wollte.“
Magnus füllte sich seinen Becher auf und stürzte das Bier herunter. „Ich glaube, es ging ihm niemals wirklich um die Sache der Sachsen. Nein, Otto geht es nur um Otto, um Machtgewinn und die Mehrung seines Eigentums. Mein Oheim, Hermann Billung, war ihm gegenüber schon immer misstrauisch, doch ich habe mich von Otto blenden lassen. Vor fast sieben Jahren haben wir hier in dieser Burg zusammengesessen und Pläne gegen Heinrich geschmiedet. Ich hegte für Otto freundschaftliche Gefühle, wollte in ihm einen edlen Sachsen sehen.“ Er schob den vergoldeten Becher von sich. „Wie dem auch sei, als Heinrich nach Weihnachten die Pfalz verließ, um den Goslarer Kanoniker Hildolf nach dem Tod von Anno von Köln als neuen Erzbischof einzusetzen und sich danach zu weiteren Versammlungen begab, wurde Otto sogar sein Stellvertreter in Sachsen, hatte den Auftrag, die Schäden an der Harzburg zu beheben. Er war dem König ja so verdammt treu. Heinrich hat Otto vor Jahren das Herzogtum Bayern entzogen und stattdessen Welf IV. eingesetzt. Anscheinend hat Otto die Hoffnung, dieses Herzogtum wiederzuerlangen, aufgegeben und will nun herzogliche Rechte in Sachsen. Doch der Herzog von Sachsen bin immer noch ich! Ich ärgere mich, dass ich nicht früher auf meinen Oheim gehört habe, der mich immerzu vor Otto gewarnt hat.“ In Gedanken versunken rieb Magnus mit seinem Daumen über den Rand des Bechers.
„Ärgere dich nicht. Wir alle – meine Brüder, mein Vater, Graf Gebhard von Süpplingenburg, der bei der Schlacht bei Homburg an der Unstrut gefallen ist, Graf Lothar Udo von Stade, ich und viele andere mehr – haben an Ottos Ehre geglaubt.“
Magnus’ Blick schnellte empor. „Dennoch, ich kann es mir nicht verzeihen!“ Sein Mund verzog sich zu einem schadenfrohen Grinsen. „Als Heinrich der Bannstrahl des Papstes traf, war dies wie ein Fingerzeig Gottes. Unruhe erfasste das Reich, und in uns Sachsen erwuchs große Hoffnung. Manch ein Fürst überdachte die Treue zum König, hielt diese nicht mehr für gerechtfertigt, und einige ließen daraufhin ihre sächsischen Gefangenen frei. Mein Oheim hatte das Glück, von Bischof Hermann von Metz nach Hause geschickt zu werden. Als er wieder nach Sachsen kam, erfuhr er, dass Otto nun Handlanger des Königs war. Sogleich rief mein empörter Oheim ein Heer zusammen, marschierte auf einige königliche Burgen zu und forderte von Otto, sich wieder gegen den König zu stellen oder sich wenigstens dafür einzusetzen, dass alle Sachsen ihre Freiheit wiedererlangen. Da Otto fürchten musste, dass Hermann dessen Güter verwüstete, sagte er Letzteres zu.“ Magnus schenkte sich Bier nach, nahm einen Schluck und behielt diesen lange im Mund. Schließlich ließ er ihn die Kehle hinunterrinnen. „Heinrich musste davon erfahren haben, denn er wies die Hüter der Gefangenen an, sie strenger zu behandeln und gut auf sie aufzupassen. Bischof Burchard II. von Halberstadt ließ er vom Hof schaffen, angeblich sollte auch er nach Italien gebracht werden, doch ihm gelang die Flucht – wie auch anderen. Ich weiß nicht, ob Otto sich tatsächlich beim König für die Sachsen einsetzte oder ob die geglückten Fluchten Heinrich zum Umdenken bewegten, doch der König ließ bald weitere Sachsen frei, gegen Zahlung eines unverschämt hohen Lösegeldes. Einige musste ihm den Schwur leisten, andere feindlich gesinnte Sachsen mit allen Mitteln zu bekämpfen. Mich hingegen hielt er noch länger in Haft. Mittlerweile sind, soweit ich weiß, nur noch Friedrich von Goseck, dein Bruder Giselher und dein Vater Eilbrecht in Gefangenschaft …“ Sein Blick richtete sich auf Arends Mutter, die sich besorgt vorlehnte und ihn mit großen Augen anstarrte.
„Warum sind mein Gemahl und Giselher noch nicht frei?“, wollte sie wissen. „Ich verstehe das nicht. Andere Sachsen haben wesentlich heftiger gegen den König gewütet als die beiden.“
„Dazu komme ich später.“ Magnus sah bedrückt aus. „Im Juni gab es Unruhen in Sachsen, und Otto empfahl dem König, sich an die einst in Gerstungen geschlossenen Abmachungen zu halten: also die Burgen zu schleifen, die Rechte und die Freiheit der Sachsen zu achten, nicht so oft in Goslar zu verweilen, und er fügte sogar hinzu, dass er alle Sachsen freilassen sollte, damit es nicht erneut zum Krieg käme. Doch Heinrich missachtete seinen Rat. Ich nehme an, dass der König keinen Wert auf seine Worte legte, verletzte Otto zutiefst. Jedoch überdachte der König seine Lage, da schon einige Sachsen der Gefangenschaft entkommen waren. Denn ehe er gar keinen Vorteil mehr besäße, ließ er viele der Sachsen nach Mainz bringen, wo über das Lösegeld für ihre Freilassung verhandelt werden sollte.“ Schadenfroh grinste er. „Als es zwischen den Mannen des Mainzer und des Bamberger Bischofs zu Raufereien kam und daraufhin Flammen in der Stadt emporschlugen, konnten weitere seiner Vögelchen entfliehen. Gern hätte ich Heinrichs Gesicht gesehen! Erzürnt rief er ein Heer zusammen und wollte über Böhmen in die Mark Meißen eindringen, dort wüten und weiter bis nach Sachsen ziehen. Er hatte auch Otto befohlen, ein Heer zu sammeln, um gegen die Brüder Wilhelm und Dietrich von Brehna vorzugehen, die Güter des Königs in Sachsen verwüstet hatten. Heinrich zog also zur Mark Meißen, doch er musste den Kriegszug abbrechen, weil Otto ihm plötzlich die Unterstützung verweigerte. Ich glaube, Otto hat dies aus verletztem Stolz getan, weil Heinrich seine Vorschläge nicht wertschätzte, ihm zeigte, dass er nur ein schäbiger Sachse ist. Zwischenzeitlich, da Heinrichs Position durch die Exkommunikation geschwächt ist, hat der König als ein versöhnliches Zeichen einen von Ottos Söhnen freigelassen. Hast du etwas darüber erfahren, was im Oktober in Tribur vor sich gegangen ist?“
Der Gefragte schüttelte den Kopf.