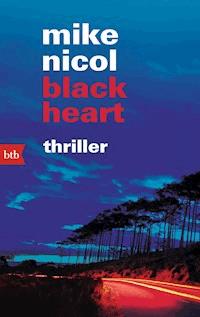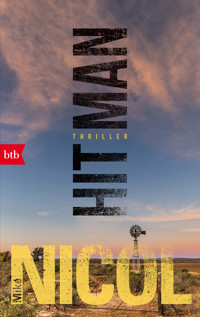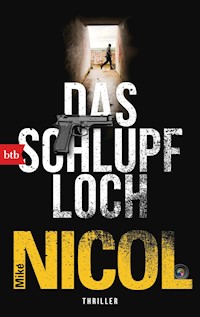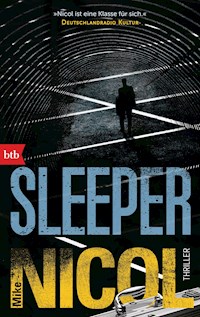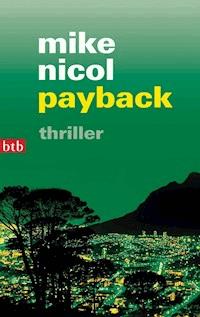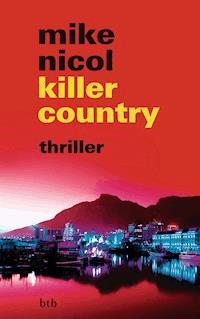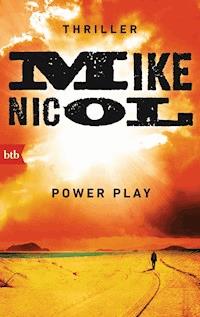8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kapstadt-Serie
- Sprache: Deutsch
Die coolsten Gangster, die fiesesten Ordnungshüter, Südafrika im Rausch.
Bring Linda Nchaba nach Südafrika zurück! So lautet der Auftrag an Agentin Vicki Kahn, die sich um die Sicherheit des Staates kümmern soll. Dass Linda nicht nur Expertin in Sachen Kindesentführung, sondern auch ein Topmodel mit besten Verbindungen zum Sohn des südafrikanischen Präsidenten ist, macht die Sache nicht einfacher. Auch, als Vicki beobachten muss, wie Linda am Amsterdamer Flughafen außer Gefecht gesetzt wird. Und sie ihre wichtigste Kontaktperson in Berlin tot auf dem Küchenfußboden findet. Kopfschuss. Vickis Instinkt sagt ihr: Such das Weite! Aber leider ist auch ihr eigener Geliebter in den Fall verwoben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Bring Linda Nchaba nach Südafrika zurück! So lautet der Auftrag an Agentin Vicki Kahn, die sich um die Sicherheit des Staates kümmern soll. Dass Linda nicht nur Expertin in Sachen Kindesentführung, sondern auch ein Topmodel mit besten Verbindungen zum Sohn des südafrikanischen Präsidenten ist, macht die Sache nicht einfacher. Auch, als Vicki beobachten muss, wie Linda am Amsterdamer Flughafen außer Gefecht gesetzt wird. Und sie ihre wichtigste Kontaktperson in Berlin tot auf dem Küchenfußboden findet. Kopfschuss. Vickis Instinkt sagt ihr: Such das Weite! Aber leider ist auch ihr eigener Geliebter in den Fall verwickelt …
Zum Autor
MIKE NICOL lebt als Autor, Journalist und Herausgeber in Kapstadt, wo er geboren wurde, und unterrichtet kreatives Schreiben. Er ist der preisgekrönte Autor international gefeierter Romane, Gedichtbände und Sachbücher, zuletzt einer autorisierten Biografie über Nelson Mandela, mit einem Vorwort von Kofi Annan. Vor einigen Jahren begann er sich intensiv für die südafrikanische Kriminalliteratur einzusetzen und beschloss, selbst Thriller zu schreiben: Die Romane seiner Rache-Trilogie waren Bestseller und standen auf der KrimiZeit-Bestenliste.
MIKE NICOL BEI BTB
Payback. Thriller
Killer Country. Thriller
Black Heart. Thriller
Bad Cop. Thriller
MIKE NICOL
Korrupt
THRILLER
Aus dem südafrikanischen Englisch von Mechthild Barth
Für Kate, eines TagesFür Tamzon und Anthony, jetzt
1 Ein notwendiger Mord
Eins
Sie trafen sich auf dem Parkdeck der Tampontürme. Wie befohlen. Draußen im Freien. Am späten schwülen Nachmittag. Die City von Kapstadt schwitzte unter ihnen. Selbst der Berg gab eine flirrende Backofenhitze von sich.
Drei Männer im Parkhaus des westlichen Turms, oberes Deck, dritte Bucht. Sie wussten: heute, Sonntag, achtzehn Uhr dreißig. Der Wagen ein Honda Civic. Schlüssel auf der Sonnenblende. Waffen im Kofferraum. Sie wussten, um welche Zielperson es ging. Auch, dass sie Strandklamotten tragen sollten – T-Shirts, Shorts, nichts Auffälliges. Sie kannten den Aufenthaltsort der Zielperson.
All das war jedem von ihnen am Vormittag telefonisch mitgeteilt worden. Ebenso wie die Anweisung, sich den anderen nicht vorzustellen. Keine Namen, keine Folgen. Und das Auto danach wieder zurückzubringen. Schlüssel auf die Sonnenblende. Waffen in den Kofferraum. Jeder getrennt nach Hause.
Joey Curtains traf als Erster ein. Joey Curtains war vorsichtig. Vorsicht erhielt dich am Leben.
Er ließ sich von einem Freund unten auf der Straße absetzen. Schlenderte durch den Gebäudekomplex und dann hinter die Wohnhäuser, um sich vom Berg aus zu nähern, falls jemand auf der Lauer lag. Entdeckte einen schattigen Platz, der ihm erlaubte, alles zu überblicken. Der Wagen stand bereits da. Noch ein paar andere Autos parkten auf demselben Deck. In den Stunden, die er dort verbrachte, kamen und gingen die Bewohner der Türme, ohne dass einer von ihnen Joey Curtains bemerkte. Leute mit Strandtüchern unter den Arm geklemmt, mit Squashschlägern, Sporttaschen, Einkaufstüten. Ein ganz gewöhnlicher Sonntagnachmittag.
Joey Curtains brauchte eine Stunde, bevor er einen weiteren Beobachter entdeckte. Fünf Stockwerke über ihm an einem offenen Fenster. Jemand mit einem Fernglas. Er war sich nicht sicher, ob Mann oder Frau. Die Überwachung jedenfalls schien professionell zu sein.
Allerdings vermutete er, dass ihn der Beobachter auf seinem Posten noch nicht erfasst hatte.
Joey Curtains grinste. »Tja, Bru«, murmelte er vor sich hin. »Augen geradeaus.«
Um Viertel nach sechs tauchte ein kleiner Mann auf, gekleidet wie befohlen. Ging sofort zum Wagen hoch, kontrollierte, ob die Schlüssel da waren, schaute in den Kofferraum. Trat zur Brüstung, blieb dort rauchend stehen und sah auf die Stadt hinunter. Ein älterer Mann, untersetzt, vielleicht Anfang fünfzig, möglicherweise ein Kriegsveteran.
Ein paar Minuten später zeigte sich ein weiterer Mann auf der Treppe. Mit flottem, federndem Schritt. Etwa so groß wie Joey, hochgewachsen und mit einer ähnlichen Drahtigkeit. Im selben Alter, Ende zwanzig. Der Kerl sah so aus, als könnte er problemlos eine lange Strecke laufend zurücklegen. Auch Joey Curtains konnte problemlos eine lange Strecke laufend zurücklegen. Dieser Mann war ebenfalls gekleidet wie befohlen, auf dem Kopf eine Baseballkappe.
Die beiden Männer begrüßten sich. Stellten sich neben das Auto und warteten. Joey Curtains ließ es fünf nach halb sechs werden. Beobachtete den Beobachter am Fenster, wie er mit dem Fernglas die Gegend absuchte. Wahrscheinlich begann er sich Sorgen zu machen, ernsthafte Sorgen. Auch die Männer am Auto wurden jetzt nervös. Der Kleine warf einen Blick auf seine Handyuhr. Sie beschlossen: Fahren wir.
Joey Curtains kam aus seinem Versteck geschlendert.
»Kameraden«, sagte er auf Xhosa. Durchlief das ganze »Wie-geht’s-alles-klar«-Spiel. Wechselte ins Englische. »Tut mir leid, dass ich mich verspätet hab, Brüder. Die sonntägliche Bummeligkeit. Ihr kennt das.« Er klopfte anerkennend auf den Wagen. »Schickes Auto. Auch ziemlich schnell, was? Zuverlässig. Nicht wie diese Golfs, die sie uns meistens geben. Zumindest stimmt diesmal das Handwerkszeug.« Die beiden Männer knurrten. Es hatte klare Anweisungen gegeben: nur über den Auftrag reden. Keine Namen.
Joey Curtains’ Blick wanderte von dem einen zum anderen. »Wo sind die Eisen?«
Der Ältere holte eine Tasche aus dem Kofferraum. Sagte auf Xhosa, es sei höchste Zeit. Erklärte, dass er fahren würde.
»He, Champ«, protestierte Joey Curtains. »Englisch oder Afrikaans. Bitte, Mann.«
Der Fahrer meinte: »Du hast dich verspätet, mein Freund. Schon mal von Disziplin gehört?«
Joey Curtains erwiderte: »Afrikanische Zeit, Bru. Was sind da schon ein paar Minuten?«
Der andere Mann riss einen Witz auf Xhosa über Coloureds, die immer nur Bockmist laberten. Nannte sie Bushies. Joey Curtains ignorierte die Beleidigung. Lachte mit, als ob er den Scherz auch lustig finden würde.
Bushie also? Die sollten lieber froh sein, einen Bushie dabeizuhaben. Offenbar der Einzige mit Hirn weit und breit.
Er öffnete die hintere Tür auf der linken Seite. Ehe er einstieg, schaute er zu dem Beobachter hinüber und winkte ihm demonstrativ zu. Die Person am Fenster wich ruckartig zurück und verschwand aus seinem Blickfeld.
Der Fahrer hatte das Zwischenspiel bemerkt. Wollte wissen: »Wer war das?«
»Jemand, der sicherstellt, dass wir den Job machen, Champ«, erwiderte Joey Curtains. »Man muss die Augen immer offen halten. Checken, ob man verfolgt wird. Ihr kennt doch sicher diesen Spruch, mos? ›Der Mann, der nach hinten schaut, entdeckt die Geister.‹ Altes chinesisches Sprichwort. Hab ich von einem Chinesen. Eines Tages haben ihn die Schlitzaugen dann ins Herz geschossen, weil er in die falsche Richtung geguckt hat.« Joey Curtains lachte laut auf. »Manchmal kann man nur verlieren.«
Die beiden anderen lachten nicht. Der Fahrer fluchte stattdessen leise in seiner Sprache. Der Federnde wandte sich halb zu Joey Curtains um und meinte: »Es reicht jetzt, Bruder.«
Joey Curtains zuckte mit den Achseln. Machte es sich auf dem Rücksitz bequem, wo er sich den Schweiß vom Gesicht wischte. »Die Klimaanlage, bitte, Mann. Dreh sie auf.«
Die Männer sahen ihn an.
»Was? He, was ist?«
Der Mann mit dem federnden Schritt fuhr mit zwei Fingern über die Lippen.
»Ag, Brüder …« Joey Curtains ließ es auf sich beruhen. Dachte: Von all den Profikillern, mit denen er hätte zusammenarbeiten können, musste er gerade diese beiden bierernsten Darkies erwischen. Humorlos wie trocken Brot. Es versprach, eine echte Spaßfahrt zu werden.
Sie verließen die Disa Towers und fuhren die Derry hinunter auf die Mill Street.
Joey Curtains sagte: »Etwas mehr Luft, Mann. Kommt schon, dreht die Anlage hoch. Sonst schmoren wir hier drinnen.« An der Ampel zur Hatfield zog er den Reißverschluss der Waffentasche auf. Stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Hübsch. Sehr hübsch. Revolver also. Taurus. Hübscher kleiner Kurzläufiger. Nennt man auch den Richter.« Er holte einen der Revolver heraus. »Da will jemand offenbar ganz sichergehen, dass es keine Ladehemmung gibt. Ohne Schalldämpfer machen die einen Höllenlärm.« Er ließ die Trommel rotieren. »Wahrscheinlich wollen sie das – ein Riesenchaos. Mit dem kurzen Lauf muss man schön nah ran.« Er streckte dem Mann mit dem federnden Schritt, der schräg vor ihm saß, die Waffe hin. Der Fahrer wurde augenblicklich wütend.
»Was machst du da? Was soll das? Das kann jeder sehen. Die bleiben in der Tasche. Nein, nein, nein.« Bei jedem Wort schlug er auf das Steuerrad ein. Wechselte zu Xhosa und ließ eine empörte Tirade los, über die der andere Mann laut lachen musste. Dennoch nahm er den Revolver.
»Wir sollten sie lieber kontrollieren«, sagte Joey. »Manchmal werden sie aus Spaß mit Platzpatronen geladen. Da kenn ich mich aus. Ist einem Chommie von mir passiert. Er hatte einen Auftrag, und zwar in einem Haus. Er schießt zweimal – peng, peng –, und die Zielperson starrt ihn weiterhin an. Zu Tode erschrocken. Nässt sich ein vor Angst. Sitzt aber noch immer in seinem gemütlichen Sessel in seinem gemütlichen Wohnzimmer und starrt meinen Chommie an. Er muss noch zwei Mal schießen, dann hat er den Auftrag endlich erledigt. Aber hey, Mann, der fünfte Schuss ist wieder eine Platzpatrone. Eine Sechsertrommel, sie haben fünf reingetan, und davon funktionieren bloß zwei. Als mein Chommie zurückkommt, spuckt er Gift und Galle. Er kann gar nicht mehr sprechen, nur noch zischen vor Wut. Die anderen lachen und meinen, er soll das nicht so ernst nehmen, wär eben ein Scherz gewesen. Bei einem Job wie diesem braucht man manchmal Spaß. Mein Chommie findet das aber kein bisschen lustig. Er verpasst diesem Waffenmeister einen Faustschlag. Direkt in die Fresse. Der Oke braucht danach zwei Klammern für seinen Kiefer. Ist echt wahr. Wirklich. Ganz ehrlich. Deshalb check ich jetzt auch jedes Mal vorher, ob alles in Ordnung ist. Man sollte nichts dem Zufall überlassen und niemandem vertrauen. Wisst ihr, was ich meine?«
»Schwachsinn«, sagte der mit dem federnden Schritt. »Das ist Schwachsinn.«
»Eine wahre Geschichte, Bruder. Eine wahre Geschichte«, entgegnete Joey Curtains. Er bemerkte, wie ihn der Fahrer durch den Rückspiegel finster anfunkelte.
»Es reicht.« Die Augen des Fahrers geweitet vor Wut. »Wir sollen nicht reden.«
»Gut, Boss. Okay, Boss.« Joey Curtains zog einen Umschlag aus der Tasche, in dem sich drei Farbfotos von der Zielperson befanden. »Hab mich schon gefragt, wie wir die Zielperson erkennen.« Er betrachtete die Aufnahmen. »Mr. Schnuckelig. Keiner, den man so schnell übersieht.« Er klopfte dem Federnden auf die Schulter. »Schau dir den lieber mal genauer an, Champ. Willst ja nicht den Falschen erwischen. Wenn das in deine Akte kommt, wirst du nämlich nie befördert.«
Während der Mann mit dem federnden Schritt die Bilder betrachtete, kontrollierte Joey Curtains seine Waffe. Alles so, wie es sein sollte – die Fünfertrommel gefüllt mit den echten Dingern. Hohlspitzgeschosse. Er legte den Revolver in die Tasche zurück. Die Zeit: achtzehn Uhr fünfzig. Der Gottesdienst musste inzwischen begonnen haben.
Der Fahrer bog von der Orange Street in die Queen Victoria ein und fand einen Parkplatz direkt vor dem Französischen Konsulat.
Joey Curtains sah sich um. Ein hübscher Fleck, dieser Teil der Stadt. Erinnerte ihn an seine Kindheit. Er war öfter mit seiner Großmutter hergekommen, um sonntags im Company’s Garden zu spielen. Die Fische mit Brotresten füttern. Den Eichhörnchen Erdnüsse zuwerfen. Sie waren immer mit dem Zug gefahren, dann die Adderley Street hochgelaufen und hatten dabei die Slave Lodge mit der Hand berührt, wie seine Großmutter das wollte. Warum machen wir das, Oma? Weil hier schlimme Dinge passiert sind, Joey. Vergiss das nie. Ja, hier sind schlimme Dinge passiert.
»He, Kameraden«, sagte Joey Curtains und schob die Erinnerungen beiseite. »Wie wär’s mit etwas Musik?«
Der Mann mit dem federnden Schritt drückte an den Knöpfen des Radios herum und erwischte Cape Talk’s Golden Oldies. Aretha Franklins Say a Little Prayer erfüllte den Wagen.
»Jedes Mal, wenn man am Sonntag da reinschaltet, spielen sie das«, sagte Joey Curtains. »Als ob der DJ scharf auf Aretha wäre. Muss echt alt sein, wenn er sich so weit zurückerinnern kann.«
»Ruhe«, erklärte der Fahrer. Er holte sein Handy heraus und tippte eine SMS.
Joey Curtains lehnte sich zurück. Aretha wurde zu Petula Clark und dann zu Roberta Flack mit The First Time Ever … Joey nahm erneut eines der Bilder zur Hand und beugte sich vor, um damit zwischen den beiden Männern hin und her zu wedeln. Sagte: »Champs, das erste Mal, als ich dieses Gesicht gesehen hab …«
Der Federnde schnaubte empört.
Der Fahrer fragte: »Wo bleibt dein Respekt?«
Joey Curtains war sich nicht sicher, ob er damit Roberta oder den Mann auf dem Foto meinte.
»Schöner Song. Sehr gefühlvoll.«
Zwei
Kaiser Vula setzte sich in der siebten Bank von hinten direkt an den linken Rand. Er mochte die St.-George-Kathedrale. Er mochte es, wie die abendliche Sonne durch die Buntglasscheiben fiel. Wie die Orgel eine von Bach inspirierte Melodie spielte. Wie die Leute in die Abendmesse kamen – einige im Sonntagsstaat, andere so, als wären sie mit ihren Flip-Flops und T-Shirts direkt vom Strand hierhergelaufen. Alle hatten die Köpfe gesenkt und suchten still einen Platz. Einige Kinder tuschelten miteinander, während sich die Typen in den langen Roben vorne um die Kerzen kümmerten und die Sachen für die Kommunion auf die weißen Spitzen stellten.
Kaiser Vula erhob sich von seinen Knien. Die Anglikaner hatten einen Fimmel, was das Hinknien betraf, wobei die Kissen dafür ebenso hart wie der Boden waren. Hatte mit Buße oder so zu tun. Keine Lektion, die er für sich und sein Leben übernehmen wollte. Es war etwas aus dem Mittelalter, auf das die Whiteys noch jetzt in der modernen Welt scharf zu sein schienen, soweit er sich aus seinen Tagen als Chorknabe erinnern konnte.
Er setzte sich. Musste nach hinten fassen, um die Pistole zurechtzurücken, die ihm in die Hüfte drückte. Eine kleine Neun-Millimeter-Ruger. Eine Handfeuerwaffe, sieben plus eins, gebläuter Stahl. Zehn Zentimeter langer Lauf und ein Griff, der ganz in seiner Faust verschwand. Wenn er sie hielt, bedeckte Kaiser Vulas Zeigefinger beinahe den Abzugbügel. Kaiser Vula war ein großer Mann. Ein großer Mann, der die kleine Waffe mochte. Wenn man jemandem eine Ladung aus dieser Ruger verpasste, konnte man sich entspannen. Da drohte einem niemand mehr mit einem »Ich komme wieder«.
Kaiser Vula legte seine großen Hände in den Schoß. Heiße Hände, die Handflächen ein wenig feucht. Der Abend war für ein Jackett eigentlich zu warm. Aber was konnte man machen? Wollte schließlich die Besucher des Gottesdienstes nicht durch den Anblick eines Schießeisens beunruhigen, ganz gleich, wie hübsch dieses Schießeisen auch sein mochte. Also ein Jackett. Er blies in seine Hände. Spürte die kurze Kühle des Atemzugs.
Oh Mann, dieser klebrig heiße Februar.
Ein weiterer Grund, warum Kaiser Vula die Kathedrale mochte, war seine Erinnerung an jene Studentenjahre, als man sich mit der Polizei in den Straßen der Stadt noch Scharmützel geliefert und sich dann in der Kirche vor den Boere versteckt hatte. Als man zwischen den Kirchenbänken lag und kaum zu atmen wagte. Die Augen nass durch das Tränengas. Aufregende Zeiten, diese Tage des Kampfes.
Er drehte den Kopf. Rechts von ihm, auf der anderen Seite des Gangs, saß drei Reihen vor ihm der Oberst mit seiner Familie. Frau, zwei Söhne, eine Tochter, die Kinder sittsam zwischen Mom und Dad. Noch kleine Kinder, wahrscheinlich im Alter zwischen drei und zehn. Wohlerzogen. Privatschulen. Eine perfekte Familie.
Wie seine eigene. Es gab tatsächlich viele Ähnlichkeiten: den militärischen Rang – bloß dass er Major war –, den sichtbaren Wohlstand, Frau, drei Kinder, wobei er nur einen Sohn hatte. Den Hang zum Golfen am Mittwochnachmittag. Die Vorliebe für Whisky. Teuren Single Malt. Beim Gedanken daran konnte Kaiser Vula die Sanftheit eines Islay in seinem Rachen spüren und glaubte sogar den Geruch wahrzunehmen – vollmundig und torfig.
Er wandte den Kopf, um das Verlangen nach dem Whisky abzuschütteln. Sah wieder zu der Familie hinüber, die elegant und doch lässig für die Kirche gekleidet war, so wie das auch die seine gewesen wäre. Der Oberst in einem oben offen stehenden weißen Hemd, die zwei Jungen in blauen Poloshirts. Mutter und Tochter in Kleidern. Ein hübsches Bild. Teure Klamotten. Kein Woolworth. Irgendetwas Designermäßiges.
Was typisch für den Oberst war: Marken interessierten ihn nicht. Er gab sich bescheiden, keine Protzerei, nichts Auffallendes. Das Gleiche bei seiner Frau. Ungewöhnlich, fand Kaiser Vula. Wenn man einen Oberst normalerweise ohne Uniform antraf, dann tendierte dieser meist zu Klischeehaftem: schwere Uhren, Goldketten, Labelmode. Die dazugehörigen Frauen auch. Meistens junge Frauen. Nicht wie bei Oberst Abel Kolingba und seiner Familie. Mrs. Kolingba war Mitte vierzig. Eine gut aussehende Frau, die viel Gymnastik machte und joggen ging. Um schlank und fit zu bleiben. Sie hieß Cynthia. Ein intellektueller Typ, wie er sich aus der Akte erinnerte. Abschluss an mehreren französischen Unis. Beschäftigte sich mit Astronomie, was sie in den letzten Jahren allerdings weniger getan hatte. Hielt trotzdem den Kontakt zu anderen Astronomen. Zudem sprachbegabt. Sie beherrschte nicht nur ihre eigene Sprache, Sango, sondern auch Französisch, Englisch und Deutsch. Es war sicher keine leichte Situation für eine solche Frau.
Wenn man die Familie betrachtete, konnte man vermuten, es sei die Familie einer Führungskraft, die vielleicht durch Black Economic Empowerment gefördert worden war, einen teuren SUV fuhr und in einer Gated Community auf der Halbinsel wohnte. Die Frau gerne in Lesezirkeln, gemeinsamer Urlaub in Sun City. Wenn man die Akte des Oberst studierte, stellte man dann fest, dass man mit dieser Einschätzung gar nicht falschlag – außer was die Führungskraft betraf. Stattdessen konnte man dort lesen, dass Oberst Kolingba einen Putsch plante. Um sein Land dem gewalttätigen Chaos zu entreißen, von dem es beherrscht wurde.
Kaiser Vula kannte die Akte des Oberst genau. Er hatte keine eigene Meinung zu diesem Mann. Keine Meinung zu dessen politischer Einstellung. Kaiser Vula tat nur das, was ihm aufgetragen wurde. Wie es sich für einen treuen Soldaten gehörte. Für einen guten Major. Wobei Kaiser Vula nie in einer Uniform zu sehen war.
In der Reihe hinter den Kolingbas standen zwei Sicherheitsleute. Mit Steroiden aufgepumpte Kerle in schwarzen Anzügen, die wahrscheinlich vor Hitze kaum zu atmen vermochten. Ihre Achseln schweißtriefend. Der Schweiß rann vermutlich auch ihren Rücken hinunter. Diese Anzüge waren das Letzte. Kaiser Vula wusste Bescheid. Er hatte selbst einmal so einen Posten gehabt. Vor zwanzig Jahren, als alle nach Hause gekommen waren, um den neuen Staat zu feiern. Er sah sich nach dem anderen Bodyguard um, der im hinteren Teil der Kirche stand. Draußen auf dem Bürgersteig gab es zwei weitere. Alle miteinander verkabelt. Der Oberst war vorsichtig. Aus gutem Grund.
In Kaiser Vulas Hosentasche vibrierte das Handy. Eine SMS. Er musste sie nicht lesen. Er wusste, was darin stand: läuft wie geplant.
Ausgezeichnet.
Genau rechtzeitig.
Gut.
Der Bischof trat lächelnd in einem violetten Messgewand aus der Sakristei. Hob die Hände, signalisierte der Gemeinde, dass sie aufstehen solle. Ein kurzes Gebet um Gottes Gnade, dann das erste Kirchenlied. Eines, an das sich Kaiser Vula noch dunkel erinnerte.
Seht, die Sonne, wie sie
über uns zu thronen scheint,
doch am Tagesende unter jene Weltenkugel sinkt,
auf der wir alle wandern.
Sie, die wir voll Trost und Freude sehen,
wird nun bald verschwunden sein,
um uns alle zurückzulassen, in dunkler Nacht.
Der Major sang bis zum Ende der zweiten Strophe mit, klappte dann das Gotteslob zusammen, erhob sich und verließ die Kirchenbank. Ein Mann ihm gegenüber, lauthals singend, sah ihn an. Ein desinteressierter Ausdruck, auf den Kaiser Vula nicht weiter reagierte. Er nickte eher in Richtung Altar, als dass er sich verbeugte, um dann mit gesenktem Blick und herabhängenden Schultern den Mittelgang entlangzueilen. Spürte, wie ihn die Muskelprotze beobachteten. Schaute nicht zu ihnen hinüber, sondern trat in der abendlichen Hitze ins Freie, wo er in der Tasche kramte und sein Handy herauszog. Er wusste, dass ihn die Bodyguards auf den Stufen zur Kathedrale misstrauisch musterten. Eine wunderbare Möglichkeit für Finten, diese Handys. Blieb neben den Männern stehen und sprach deutlich und beunruhigt in den Apparat. »Ich komme sofort. Wir sehen uns im Krankenhaus.« Dann eilte er die Wale Street entlang davon.
Bis zu seinem Auto, das einen Block entfernt auf der anderen Seite der Straße stand. Der Eingang der Kathedrale war von hier aus durch die Palmen mehr oder weniger gut zu erkennen. Kaiser Vula zog sein Jackett aus und legte es auf den Rücksitz des Golfs. Schlug die Tür zu, öffnete die auf der Fahrerseite und blickte dann zur Kirche hinüber. Zwischen den Bäumen sah er die zwei Sicherheitsmänner, dahinter Leute, die den Company’s Garden verließen, sowie an der Ecke zur Wale Street den trägen, sonntäglichen Verkehr vorbei an der Slave Lodge. Alles wie immer.
Die Sonne brannte nicht mehr auf die hohen Gebäude. Der Berg hinter der Stadt lag bereits im Schatten. Überall kehrte allmählich Ruhe ein. Die Touristen saßen in den Cafés auf den Bürgersteigen, es breitete sich am Ende eines heißen Tages Entspannung aus. Man genoss die abendliche Dämmerung. Draußen am westlichen Rand der Stadt strahlte die Sonne noch ein letztes Mal auf und schien dann tatsächlich langsam im Meer zu versinken.
Drei
Kaiser Vula setzte sich hinter das Lenkrad und zog die Hose an den Stellen hoch, wo sie über seinen Knien spannte. Er atmete den Geruch des neuen Autos ein: Politur, Leder, Sauberkeit, die angenehm warm in seine Nase stieg. Er nahm die Ruger aus dem Gürtel und legte sie ins Handschuhfach. Schob das Handy in die Freisprechanlage. Unter dem Sitz holte er ein kleines Bushnell-Fernglas hervor, das man eigentlich zum Beobachten von Vögeln verwendete. Richtete es auf die beiden Bodyguards und stellte es scharf. Sie lehnten rauchend an der Mauer der Kathedrale und schauten den Passanten hinterher, die in Richtung Bahnhof liefen. Gelangweilt. Wie Vula das als Bodyguard auch gewesen war. Diese unglaubliche Ödnis. Und gleichzeitig die Notwendigkeit, ständig in höchster Alarmbereitschaft zu sein. Alles zu sehen. Zu reagieren, wenn etwas Ungewöhnliches geschah. Zu erkennen, dass etwas nicht stimmte.
Alles stimmte. Alles war so, wie es sein sollte. Auf dem Parkplatz neben der Kirche stand der schwarze Fortuner des Oberst. Dunkle Scheiben, gepanzerte Türen. Der Fahrer an seinem Platz. Die Begleitfahrzeuge für die Bodyguards in der Queen Victoria Street: zwei Audi A4. Kein Geiz bei der Ausstattung. Inzwischen hatten sie sicher bereits platte Reifen, jeweils die linken vorderen neben dem Bürgersteig.
Jetzt gab es nichts mehr zu tun, als abzuwarten.
Er wartete also ab. Eine Viertelstunde. Zwanzig Minuten. In der Kathedrale sangen sie wahrscheinlich aus voller Kehle das zweite Lied. Kaiser Vula richtete das Fernglas auf das Eingangsportal. Die Bodyguards hatten sich inzwischen etwas von dem Gebäude entfernt. Einer der beiden sprach in sein Handy, der andere las die Notizen auf dem Anschlagbrett neben der Krypta. Ach ja, diese Langweile.
Kaiser Vulas Handy vibrierte. Auf dem Display war der Name Marc zu lesen. Marc, der Deckname von Kaiser Vula für Nandi, die herrliche Nandi.
Er schnalzte mit der Zunge und legte das Fernglas beiseite.
»Liebling«, begrüßte sie ihn. »Wann kommst du? Wir sind hier bereits beim Chillen.«
Er stellte sich die Szene vor. Ihre schicke Wohnung, der Balkon mit Blick über die Waterfront. Über die ganze Tafelbergbucht. An solchen Abenden schauten die Schönen und Reichen von dort oben auf ein glasiges Meer, die weiße Sichel des Strandes, auf Lichter, die im Dunst der Dämmerung zu leuchten begannen. Typisch Kapstädter Lifestyle. Glamourös, schick, so wie er ihnen beiden entsprach.
Er konnte Stimmen hören. Lachen. Das ausgelassene Lachen guter Zeiten. Musik. Adele. Adele war momentan Nandis Soundtrack.
»Was trägst du?«, fragte er.
Sie lachte. »Chanel. Das Kleid, das wir in Paris gekauft haben.«
Ihre Stimme. Der Akzent einer guten Schule, nicht der leiseste Hinweis auf die Townships.
»Darunter.«
»Kaisy, Liebling …« Gab sich überrascht. Verspielt. Eine Pause.
Er stellte sich ihre Lippen vor. Pinker Lippenstift, seidig weich. Malte sich aus, wie sie sich von den Gästen abwandte und nach einem Plätzchen suchte, wo sie ungestört sprechen konnte. Wo? Auf dem Balkon? Zu den Hochhäusern der Innenstadt hinüberschauend? Lächelnd?
»Was meinst du? Darunter?«
»Sag es mir.«
»Kaisy!«
»Sag es mir.«
»Also gut.« Sie zog die Worte in die Länge, um ihn aufzureizen.
»Sag es mir.« Er sprach mit harter Stimme. »Hast du einen BH an?«
»Nein, keinen BH, Bru«, erwiderte sie. »Nicht bei dem Kleid. Braucht es nicht. Das weißt du doch.«
»Berühr deine Brustwarzen.«
»Ah, Liebling. Das ist doch deine Aufgabe.«
»Mach es. Mach sie hart.« Er sah sie in dem Kleid vor sich, der dünne Stoff, ihre harten Brustwarzen, die sich dagegenrieben. Sie hatte lange Brustwarzen. Brustwarzen, um die man seine Zunge wickeln konnte. »Und? Sind sie jetzt hart?«
»Sie sind brave Mädchen.«
Kaiser Vula rutschte auf seinem Sitz hin und her und versuchte, den Schritt seiner Hose weiter zu bekommen.
»Lass deine Hand nach unten wandern«, sagte er.
»Schon dabei«, erwiderte sie.
»Jetzt sag mir, was du darunter trägst.«
»Einen Tanga.«
»Welchen?«
»Den du mir gekauft hast. Den schwarzen.«
»Zieh ihn aus.«
Pause.
»Zieh ihn aus.«
Ein geflüstertes »Ich kann nicht, Babe. Nicht hier. Ich bin auf dem Balkon«.
»Zieh ihn aus.«
Wieder eine Pause. Er hörte sie atmen.
»Warte. Ich mach’s.«
Er stellte sich vor, wie die Seide ihre Schenkel hinabglitt und herunterfiel. Ein Stück Stoff um ihre hohen Absätze. Sie würde heraussteigen müssen.
»Heb ihn auf.« Sie würde in die Hocke gehen müssen, denn das Kleid war zu kurz, als dass sie sich hätte herabbeugen können. »Hast du ihn?«
»Ich hab ihn in der Hand.«
»Ist er warm?«
»Ja.«
»Riech daran.«
Sie sog die Luft ein.
»Wie riecht er?«
»Nach mir.«
»Wonach genau?«
»Seife. Creme. Kräuter.«
»Und?«
»Nach mir.«
»Und?«
»Nach Moschus.«
»Wirf ihn über die Brüstung.«
»Ich …«
»Wirf ihn.« Er wartete und zählte innerlich bis drei. »Hast du es gemacht?«
»Ich hab ihn hinuntergeworfen.«
»Wer hat dich gesehen?«
»Niemand.«
»Was machen die anderen?«
»Trinken. Reden.«
»Berühr dich.«
Er hörte, wie sie die Luft anhielt.
»Ja.«
»Ich muss los«, sagte er plötzlich. »Ich bin bald da.« Kaiser Vula legte auf und lehnte sich zurück. Schwitzend in der feuchtwarmen Luft. Schloss die Augen. Sah Nandi, die herrliche Nandi, in ihrem kurzen Kleid vor sich, ohne Tanga auf dem Balkon. Atmete aus – kein Seufzer, sondern nur ein langes Ausatmen.
Diese Frau.
Kaiser Vula schenkte seine Aufmerksamkeit wieder der Straße, dem Grüppchen von Menschen, die sich auf den Stufen der Kathedrale zu versammeln begannen. Der Gottesdienst musste zu Ende sein. Er sah durch das Fernglas. Sah die Familie des Oberst herauskommen und dem Bischof die Hand schütteln. Cynthia Kolingba und die zwei Söhne zuerst, dann der Oberst und seine Tochter. Hinter ihnen die Sicherheitsleute. Die Muskelpakete auf dem Bürgersteig drängten durch die Menge, um die Familie in Richtung Parkplatz zu geleiten. Der Fahrer des Fortuner hatte bereits die Türen des Wagens geöffnet und wahrscheinlich den Motor angelassen.
Kaiser Vula drehte auch den Zündschlüssel seines Autos herum, wobei er das Fernglas weiterhin auf die herausströmenden Gottesdienstbesucher gerichtet hielt.
An der Ampel bei der Queen Victoria Street hielt ein weißer Honda Civic. Zwei Männer stiegen auf der linken Seite aus. Junge Männer in T-Shirts, Surfshorts, Turnschuhen. Einer ging um die Kühlerhaube herum, der andere lief hinten um den Wagen. Dann eilten beide mit großen Schritten über die Straße. Ein geschmeidiger Sprung auf den Bürgersteig, vier, fünf Schritte das Trottoir entlang. Die Männer fassten hinter sich, unter ihre T-Shirts und zogen Revolver hervor. Legten an. Schossen.
Kaiser Vula zählte drei Schüsse, eine Pause und dann weitere zwei. Sah, wie der Oberst zu Boden ging, die Tochter ebenfalls. Sah, wie die Mutter und die Jungen von den Sicherheitsleuten niedergerissen wurden. Sah, wie einer der Attentäter mitten im Gesicht getroffen wurde und zusammenbrach. Der andere rannte zum Civic zurück.
Kaiser Vula lenkte sein Auto in die Burg Street und fuhr langsam um den Greenmarket Square. Er war drei Blocks weit gelangt, als er die Sirenen hörte. Die Polizisten waren diesmal offenbar schnell vor Ort. Fast zu schnell.
Nun ja. In Kürze würde er erfahren, wie es genau gelaufen war.
Vier
Mart Velaze saß auf einer Bank an der Government Avenue und lieferte seinen Bericht ab. Hörte die Stimme sagen: »Warten Sie, Häuptling, warten Sie eine Minute. Okay?« Dann: »Jetzt bin ich da. Ich höre.« In jener Minute blickte Mart Velaze zu dem Berg hinter den weißen Türmen der Kapstädter Synagoge hinauf, über ein Liebespaar hinweg, das auf dem Rasen vor ihm aufeinanderlag. Zu seiner Linken warfen Kinder den Fischen in den Teichen alte Brotstücke zu. Eine Mutter nahm trotz des dämmrigen Lichts ein Video mit ihrem Handy auf, während der Vater gelangweilt daneben stand und so wirkte, als würde er lieber Fußball gucken. Niemand kümmerte sich um das Heulen der Sirenen in der Nähe.
Die Stimme sagte: »Erzählen Sie, Häuptling. Was gibt es? Berichten Sie.«
»Es ist passiert«, erklärte Mart Velaze.
Schweigen. Das machte die Stimme gerne. Nachdenklich schweigen. Mart Velaze hatte sich längst daran gewöhnt, da er schon seit ewigen Zeiten der Abteilung der Stimme angehörte. Im letzten Jahr hatte es ein wildes Kesseltreiben gegeben, Untersuchungen, eingehende Befragungen, Nachforschungen und offizielle Warnungen. »Springen Sie mir nicht ab, Häuptling. Dann wird Ihnen auch nichts passieren.« Er war ihrem Rat gefolgt. Hatte Ruhe bewahrt, sich unangreifbar gemacht. Trotz ihrer vielen gemeinsamen Abenteuer wusste er rein gar nichts von ihr. Nicht einmal, wem sie Rückmeldung erstattete. »Alles inoffiziell, Häuptling. Dunkle Geheimoperationen, dunkel, dunkel, dunkel«, hatte sie ihm bei seiner Einstellung erklärt. »Als wären wir nicht bereits dunkel genug.« Hatte über ihren eigenen Witz laut gelacht. Ihre Stimme war stets ein wenig heiser und ruhig.
Ihrem Tonfall nach zu urteilen stellte sich Mart Velaze inzwischen eine schlanke Frau in taillierten Kostümen und weißen Blusen vor. Einer Silberkette um den Hals. Unverheiratet. Selbstständig, unabhängig, allein in einem Büro, das überall sein konnte, und mit Agenten beschäftigt, die sie nie persönlich traf. Ein einsamer Job. Nur umgeben von ihren gesicherten Telefonen und mit einer Internetverbindung.
»Haben Sie Bilder?«
»Wie sie sich treffen. Und von der Operation.«
»Gut. Hat man den Auftrag erfüllt?«
»Sieht so aus. Die kleine Tochter hat es dabei auch erwischt.«
»Das ist schlimm. Nicht gut.«
Schweigen.
Mart Velaze schaute der jungen Familie hinterher, die den Park verließ, einander an den Händen haltend. Zusammen nach Hause.
»Hören Sie, Häuptling. Noch ein paar Dinge. Zum einen gibt es Gerede, Gerüchte … Sie wissen, was ich so aufgeschnappt habe. Es geht um eine rastlose Gruppe, vor allem Kommunisten, die offenbar etwas unartig sind. Und zwar in der Hinsicht, was die Amis ›wetwork‹ nennen. Kennen Sie diesen Ausdruck?«
Mart Velaze schwindelte und behauptete, er habe ihn noch nie gehört.
»Sie können ihn googeln und werden feststellen, dass er ›Auftragsmord‹ bedeutet. Genau das, was dem armen Oberst passiert ist. Nur ist für diese Rastlosen in dem Fall die Zielperson der Präsident.«
»Ernsthaft?«
»Ernsthaft. Aber, Häuptling – Finger weg. Das dient rein zur Information. Ausschließlich. Kapiert? Sie verstehen mich? Wenn so etwas tatsächlich geschehen sollte, wenn Sie auch nur die kleinste Andeutung hören, mischen Sie sich auf keinen Fall ein. Das geht uns nichts an. Einer von denen, die etwas damit zu tun haben könnten, ist ein gewisser Henry Davidson. Einer der Unseren, einer der alten Garde. Wie bei dem Attentat auf den Oberst sind wir bloße Beobachter. Sonst nichts. Verstanden, Häuptling? Bloße Beobachter. Wir halten uns da ganz und gar raus.«
Mart Velaze antwortete, er habe sie verstanden.
»Gut. Dann zu Punkt zwei«, erwiderte sie. »Es scheint mir eine gute Idee zu sein, der Frau des Oberst ein wenig zu helfen. Ihr zu zeigen, dass wir eine Demokratie haben. Ich mag es nicht, wenn man Flüchtlinge einfach so nach dem Kirchgang abknallt. Leisten Sie ihr etwas Unterstützung in dieser schweren Zeit. Können Sie das tun?«
Mart Velaze antwortete, dass er das könne.
»Ausgezeichnet, Häuptling. Das wäre alles für den Moment. Mögen die Vorfahren mit Ihnen sein.«
Mart Velaze legte auf. Das Liebespaar hatte sich inzwischen voneinander gelöst. Die beiden packten die Reste ihres Picknicks ein. In der abendlichen Dämmerung war der Tafelberg nun ganz und gar in Dunkelheit getaucht.
Fünf
Drei Tage später, Mittwoch, 23 Uhr 30: Vicki Kahn flog mit der KLM 598 von Kapstadt nach Schiphol, Amsterdam. In Kapstadt hatten während der ganzen letzten Tage mindestens dreißig Grad geherrscht, weshalb sie froh war über einen kurzen Klimawechsel. Sie hatte für die Rennen in Kenilworth am Samstag bei einer Sechserwette zweitausend gesetzt und erwartete einen satten Gewinn. Vicki Kahn hatte ihr Leben wieder im Griff.
Während des Flugs hörte sie Melissa Etheridges 4th Street Feeling auf ihrem iPad. Ließ dazu ihre Gedanken schweifen. Vor allem der Song darüber, wie man die ganze Nacht hindurch rockt und rollt, veranlasste sie, über ihr eigenes Liebesleben nachzudenken. Sie sah Fish Pescado vor sich, den Surfertypen, der sie regelmäßig zum Rocken brachte. Allein der Gedanke an ihn brachte sie zum Lächeln.
Irgendwann mitten in der Nacht, irgendwo über dem Äquator, wurde ihr dann schlagartig bewusst: Sie war in einem Auftrag unterwegs. Ihr erster Überseeauftrag. Und zwar in geheimer Mission.
»Das ist unser Geschäft, Vicki.« Seine Worte.
Seine Worte über diesen speziellen Auftrag.
Am Donnerstag traf Vicki um 10 Uhr 10 in Schiphol ein. Das Flugzeug landete an Gate E17. Als sie ausstieg, war ihr seltsam zumute. Irgendwie übel. Vielleicht lag es am Flug oder am Essen. Oder an beidem. Sie lief das Flughafengebäude E hinunter bis zur Passkontrolle in Gebäude B.
Der Grenzbeamte fragte sie nach ihrem Beruf, und sie erklärte ihm, dass sie Firmenjuristin sei und sich mit Kollegen in Berlin treffe. Er stempelte schweigend ihr Schengen-Visum ab und musterte sie einen Moment lang mit ausdrucksloser Miene. Vicki erwiderte den Blick, nahm dann ihren Pass und strich sich das Haar zurück. Die Übelkeit ließ nicht nach.
Die Sicherheitsschranke passierte sie problemlos. Lief durch die Einkaufspassage bis zu Bubbles, diesem Lokal für Fisch, Meeresfrüchte und Wein an der Mündung von Terminal C und B. Die Übelkeit war weiterhin ihr Begleiter.
»Sie sind nicht dort, um Austern zu essen, hören Sie? Auch keinen französischen Weißen, Vicki. Verstanden?« Wieder ihr Boss. Das wäre jetzt ohnehin das Letzte gewesen, was sie getan hätte.
Ihr Boss war Henry Davidson. Wie er es geschafft hatte, die Veränderungen in den letzten Jahren zu überstehen, war ihr schleierhaft. Dieser weiße Tyrannosaurus aus dem verhassten alten Regime. Er musste wichtige Leute in der Hand haben. Wenn man über ihn nachforschte, stellte man fest, dass er vom Büro für Staatssicherheit einfach zum reformierten Nachrichtendienst gewechselt war, der inzwischen State Security Agency hieß. Zugegebenermaßen nahm er keinen der höchsten Ränge ein, aber er hatte weiterhin seinen Fuß in der Tür. Dieser Henry mit Perücke und Blazer. Mit einer braunen Perücke. Vicki hatte Fotos von Henry Davidson gesehen, wie er die Blazer noch mit Halstuch trug. Inzwischen bevorzugte er Krawatten in dunklen grünen bis blauen Schattierungen. Manchmal gestreift, meistens einfarbig. Am Freitag trug er immer seine alte blau-gelb gestreifte Privatschulkrawatte der Rondeboschs Boys High School. Das Netzwerk. Die Verbindungen. Das Syndikat. Die Bande. Die Sache mit Kapstadt war: Es gab Banden in jeder Gesellschaftsschicht, wobei sich die Banden der Eliten seit Apartheidszeiten kaum verändert hatten. Ihre Mitglieder besuchten die gleichen Schulen, arbeiteten in den gleichen Branchen, gingen in die gleichen Pubs und Clubs, nur dass ihre Haut eine Schattierung dunkler geworden war. Es gab Gerüchte, dass Henry, der Kommunist, früher während der gefährlichen Jahre als Maulwurf fungiert habe. Dass er noch immer der Sache verschrieben sei. Er und seine übrig gebliebenen Kameraden sangen jetzt die Internationale in ihren technisch perfekt ausgerüsteten Küchen: »Auf zum letzten Gefecht!« Die Vorstellung brachte sie zum Lächeln.
Vicki kaufte eine Flasche Wasser von einem Imbiss Bubbles gegenüber, trank einen Schluck und merkte, dass die Übelkeit nachließ. Doch jetzt fühlten sich auf einmal ihre Brüste empfindlich an.
In der Nähe standen ein paar Ledersofas, die einen guten Überblick über einen Teil des Flughafens boten. Ein Ort, wo sich die Leute, die Stunden im Transit verbrachten, ausruhen konnten. Sehr umsichtig von den Holländern. Setzen Sie sich dort hin und warten Sie, lauteten Vickis Anweisungen. Die Flugzeuge durch die großen Glasscheiben beobachten. Warten. Keine schlechte Art, den Vormittag zu verbringen. Das tat sie. Während sie weiterhin Melissa lauschte, wie diese hundert Meilen von Kansas City entfernt war.
An diesem Vormittag lag alles voller Schnee. Nur die Vorfelder und die Start- und Landebahnen hatte man freigeräumt. Die glatte Fläche glitzerte im schwachen Sonnenlicht. Laut der Durchsage des Piloten herrschten dort draußen minus sechs Grad. Seine ironische Art, die Passagiere hier willkommen zu heißen. Der Himmel war hellblau und diesig. Vicki konnte sich keinen einzigen Grund vorstellen, warum man an so einem Ort leben wollte.
Sechs
Eine halbe Stunde vor dem Treffen hörte Vicki auf, die Flugzeuge zu beobachten. Sie sah noch einer Boeing 737 der Air France hinterher und wechselte dann zu einer Couch, die Richtung Flughafenhalle gerichtet war. Sie wollte ihre Kontaktperson kommen sehen und vermeiden, dass jemand ihr plötzlich mit der Frage »Sind Sie Vicki Kahn?« auf die Schulter klopfte.
Um die Zeit totzuschlagen, schloss sie Wetten mit sich selbst über die Leute in ihrer Umgebung ab. Fünf zu zwei auf eine Frau mit rasiertem Kopf, die einen Kofferkuli schob. Sie würde es nicht sein. War sie auch nicht. Vicki holte sich den Gewinn bei ihrem imaginären Wettbüro ab. Zwei zu eins auf eine groß gewachsene klassische Schönheit mit einer Schultertasche, einem eleganten Mantel und einem schicken Kurzhaarschnitt. Die Augen der Frau streiften sie, und sie dachte: Oh, du hast verloren, Vics. Doch Miss Kurzhaar ging weiter.
Vicki wusste nur, dass sie eine Frau treffen sollte. Eine beunruhigte Frau. Das hatte man ihr am Tag zuvor in windstiller Hitze bei einem Mittagessen oben im Café auf dem Tafelberg mitgeteilt. Nur ihr und ihrem Chef – nachdem sie per Seilbahn zusammen mit zahlreichen Touristen nach oben gefahren waren, eine Weile auf die Stadt hinuntergeblickt hatten und dann über den steinigen Boden zu dem Café gelaufen waren. Zuerst hatten sie den Blick auf den Strand von Camps Bay bewundert. »Zum Glück bin ich nicht dort unten«, hatte Henry Davidson erklärt. »Ich will meine Haut nicht noch mehr verbrennen. Das kann ich mir nicht leisten mit all den Hautkrebsflecken, die ich jedes Jahr bekomme. Weiße Haut ist ein Todesurteil. Sie können sich glücklich schätzen, Vicki.« Er hatte ihren Arm berührt. Vicki war etwas zurückgewichen, einen halben Schritt nach links – beinahe unmerklich, aber dennoch eindeutig. Es war ihm aufgefallen.
Am Büfett hatten sie sich Pasteten, Pommes frites und ein Glas Weißwein geholt. Hatten sich an einem Tisch am Fenster niedergelassen. Henry Davidson, ganz der Gentleman, ließ die Dame zuerst Platz nehmen. Steckte sich die Papierserviette in den Hemdkragen, so dass sie wie eine kleine Flagge auf der Brust aussah. Meinte »Bon, bon« und verputzte dann seine Pastete. Vicki unterdrückte ein Lächeln. Versuchte, das Gespräch auf die Schießerei vor dem Dom zu lenken, da sie noch nichts weiter darüber hatte in Erfahrung bringen können. Aber er wollte nicht anbeißen. »Nicht unser Spielfeld«, winkte er ab. »Denn sie haben noch nicht viele Beweise, wie Alice beim Anblick des weißen Kaninchens meinte.« Henry Davidson kannte immer ein passendes Zitat aus Alice. In diesem Fall plauderte er einfach über das Gerede im Büro weiter, sonst nichts.
Vicki hörte nur mit halbem Ohr zu. Keine schlechte Pastete, dachte sie, für eine Touristenfalle. Spülte das letzte Stück mit einem großen Schluck Wein hinunter. Auch die Pommes waren zumindest in frischem Öl frittiert. Nicht gerade Haute Cuisine, aber hoch oben auf dem Berg mit einem solchen Ausblick über die Stadt an einem derart klaren Tag, die Bucht voller Frachtschiffe – wen interessierte das schon? Man genoss einen wunderbaren Urlaub an einem exotischen Ort. Die Pastete leistete das, was sie leisten sollte: Sie füllte den Gästen die Mägen.
Irgendwann während des Essens sagte ihr Chef: »Ich möchte, dass Sie morgen jemanden auf dem Flughafen Schiphol treffen.« Als ob er sie bitten würde, sich mit einem Bekannten in einem Restaurant an der Waterfront zu verabreden und nicht dafür erst um die halbe Welt fliegen zu müssen. »Die Person hat etwas für uns auf einem USB-Stick. Könnte sich als sehr nützlich erweisen.«
»Diese Person? Am Flughafen Schiphol?«
Woraufhin er antwortete: »Das ist unser Geschäft, Vicki. Manchmal kann das unbequem sein. Aber wir müssen schnell handeln. Wenn Ihnen das nicht zusagt, sollten Sie wieder zur normalen Juristerei zurückkehren.«
Die normale Juristerei war in diesem Fall fast eine Beschimpfung.
Langweilige Firmenfusionen. Verträge. Gerichtsverfahren. Steuerauseinandersetzungen. Schutz des geistigen Eigentums.
»Die kenne ich schon«, erwiderte Vicki. »Deshalb bin ich hier. Aus diesem Grund habe ich gewechselt.« Gewechselt zur State Security. Auch wenn Jura keine Vorbedingung gewesen wäre. Man musste sich ziemlich intensiv ausbilden lassen: Waffenkunde, Schießübungen, unbewaffneter Nahkampf, Überwachungstechniken, Anti-Überwachungsmaßnahmen. Eine seltsame Ausbildung für die Stelle eines Analysten. Aber nicht uninteressant. Eines freute sie: Ihre alte Verletzung hatte sich während des Trainings kein einziges Mal gemeldet. Niemand hätte vermutet, dass sie vor gar nicht so langer Zeit eine Kugel in den Bauch bekommen hatte.
Zu ihrem Chef sagte sie: »Diese Person – hat sie auch einen Namen?«
»Diese Person ist eine Frau«, entgegnete Henry Davidson. »Linda Nchaba, um ihr einen Namen zu geben. Ein Model. Ein paar Hintergrunddetails, Handynummer und E-Mail-Adresse sind bei unseren Akten. Viel ist es nicht. Sie trat vor ein paar Stunden telefonisch mit uns in Kontakt wegen einer Bande Menschenhändler. Vor allem Kinder. Vielleicht hat sie selbst damit zu tun, vielleicht nicht. Die Hawks in der Voliere glauben es jedenfalls, was auch immer das bedeuten mag. Jedenfalls scheint sie jetzt ihr Gewissen zu entdecken, und das kann für uns nur von Vorteil sein – nicht wahr?« Er erwartete offenbar keine Antwort, schob sich aber ein Stück Pastete genießerisch in den Mund.
»Sie wird Sie fragen, ob Sie es sind, die sie treffen soll, und sich dann vorstellen. Fliegen Sie einfach hin. Reden Sie mit ihr im Transitbereich. Vermitteln Sie ihr, wie nett wir sind und dass wir ihr helfen können. Nehmen Sie den USB-Stick an sich, aber in Wirklichkeit ist es die Frau, die wir wollen. Wir müssen sie nach Hause bringen. Das ist das Wichtigste, Vicki. Das Wichtigste. Natürlich leichter gesagt als getan, vor allem, da sie Angst zu haben scheint. Ich würde sogar sagen, sie schlottert vor Angst. Meine Erfahrung bei solchen Angelegenheiten sagt mir, dass man nie zu sehr drängen sollte. Zuerst einmal Vertrauen gewinnen. Sie kennen die Tipps, wie man einen Affen fängt. Reden Sie mit ihr, vereinbaren Sie ein weiteres Treffen, geben Sie ihr ein paar Tage Zeit, um nachzudenken. Treffen Sie Linda Nchaba dort, wo sie will: in Paris, Frankfurt, Zürich, Berlin. Sagen Sie ihr, dass Sie sich am nächsten Tag bei ihr melden werden.«
Er hob den Kopf, um sie anzusehen. Lächelte. »Und dann noch etwas Persönliches. Ich dachte mir, Sie könnten doch nach Ihrem Rendezvous mit der geplagten Linda einen kurzen Abstecher nach Deutschland machen, während Sie auf die Antwort der Frau warten. Treffen Sie sich mit einem älteren Herrn in Berlin. Bedauerlicherweise kein echter Gentleman. Er hört auf den Namen Detlef Schroeder. Ein langjähriger Bekannter, der nun an Leberkrebs leidet. Wahrlich traurig.« Henry Davidson sah zu den Zwölf Aposteln hinüber und schürzte die Lippen so, wie er das immer nach einer wichtigen Erklärung tat. »Schreckliche Sache, dieser Krebs. Eine richtige Pest.« Widmete seine Aufmerksamkeit wieder Vicki, die bemerkte, dass seine Perücke ein wenig verrutscht war. »Reden Sie also mit Detlef, und dann kontaktieren Sie erneut Linda. Überzeugen Sie sie davon, nach Hause zu kommen, um hier unter unsere Fittiche genommen zu werden.« Er tupfte sich mit der Papierserviette die Mundwinkel ab. »Netter kleiner Auftrag, finden Sie nicht? Durch Europa jetten. Eine Stippvisite in der ehemaligen Agentenhochburg. Hübsche Abwechslung zu Ihrem üblichen Alltag. Einige Ihrer Kollegen werden neidisch sein. ›Ab mit ihrem Kopf, brüllte die Königin.‹«
Vicki achtete nicht auf das Alice-Zitat. »Warum soll ich ihn treffen?«
Henry Davidson legte den Finger auf die Lippen. »Pst, es geht um ein Geheimnis. Ein Familiengeheimnis.« Saß daraufhin wichtigtuerisch wie der Märzhase da. Mehr wollte er offenbar nicht verraten.
Ein Familiengeheimnis. Das einzige Mitglied aus ihrer Familie, das jemals einen Fuß nach Europa gesetzt hatte, war ihre Tante gewesen. Erstochen von einem Auftragsmörder in der Pariser Metro in jenen Tagen des Kampfes. Es hieß, dass sie auch in Berlin gewesen war und dort von Almosen gelebt hatte. Im Dienste der Befreiungsbewegung hatte sie fast alle Metropolen bereist. Er konnte also nur ihre Tante meinen. Typisch Henry Davidson, einem einen Köder vor die Nase zu halten. Als ob er eine perverse Lust bei so etwas verspürte.
Vicki richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt im Flughafen Schiphol.
Die nächste schwarze Frau, die am Restaurant Bubbles vorbeikam, hatte kurze Dreadlocks und wirkte ausgesprochen niedlich. Nie im Leben, dachte Vicki. Die nicht. Sie setzte hoch und gewann. Dasselbe bei den nächsten drei Frauen, die vorbeischlenderten und dann entweder zur Toilette oder anderswohin verschwanden. Schon bald verschluckt vom ruhelosen Treiben des Transitbereichs.
Pünktlich auf die Minute erschien eine langbeinige Frau mit Zöpfchen, Skinnyjeans, Stiefeln, Rollkragenpulli und einem Mantel mit falschem Pelz an Kragen und Ärmeln. Unter dem offenen Mantel zeigte sich eine schlanke Figur mit einer schmalen Taille. Garantiert aus Südafrika. In Schiphol keine Seltenheit. Vicki beschloss, drei zu eins zu wetten, dass es sich um Linda Nchaba handelte. Hörte ihren inneren Buchmacher sagen: Komm schon, Süße, wo ist dein Geld? Sie überlegte es sich noch einmal anders und entschied sich für zwei zu eins. Und gewann.
Sieben
Die Frau kam auf sie zu und fragte, ob sie diejenige sei, die sie war.
»Die bin ich«, antwortete Vicki Kahn. Mehr nicht, denn sie wollte erst einmal abwarten, was die Frau als Nächstes sagen würde.
»Ich bin Linda Nchaba«, erklärte Linda Nchaba, hielt ihr aber nicht die Hand hin.
Sie setzte sich neben Vicki, wühlte in ihrer Ledertasche und zeigte ihr den silbernen USB-Stick. Sie reichte ihn nicht weiter, sondern hielt ihn fest in ihrer rechten Faust.
Vickis Blick wanderte von der Faust der Frau zu ihrem Gesicht. Linda hatte eine wunderbare Haut. Eine teure Haut. Eine Haut, die gesund und jugendlich schimmerte. Nach einem guten Leben aussah. Eine Haut, die Beauty-Behandlungen und nächtliche Pflegecremes von teuren Markenprodukten kannte. Vicki dachte: Wahrscheinlich benutzen wir die gleiche Lotion. Sie hätte sie fragen können: Welche Feuchtigkeitscreme verwenden Sie? Die beiden Frauen hätten ein Girlie-Gespräch über Balsam und Lippenstift führen können. Vielleicht eine Möglichkeit, um sich dem eigentlichen Grund ihres Treffens zu nähern – dem USB-Stick und der Sache mit Linda Nchabas Rückkehr nach Hause. Eine Möglichkeit, sie zum Entspannen zu bringen. Denn eindeutig war Linda Nchaba alles andere als entspannt.
Wenn sie die Frau so betrachtete, ihre Figur, ihre Haltung, konnte Vicki sie sich sehr gut auf dem Laufsteg vorstellen. In der Akte stand in dieser Hinsicht allerdings nicht viel. Wenn das der legale Weg für sie war, an Geld zu gelangen, dann durfte das nicht gerade wenig sein. Allerdings kein Grund, um sich nicht noch nebenbei etwas dazuzuverdienen.
Die Frau saß da, den Stick krampfhaft mit ihren Fingern umschließend. Saß unsicher da, während ihre Augen hin und her schossen, nur nicht zu Vicki. Vicki beobachtete sie in ihrer Nervosität und wartete. Sie machte ihr kein Gesprächsangebot. Die Frau war offensichtlich tief verängstigt. Fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, sah sich in der Halle um, wo Leute in alle möglichen Richtungen eilten.
Vicki nutzte den Moment, um sich ebenfalls umzusehen. Niemand befand sich in ihrer Nähe, der so aussah, als würde er ausschließlich in ihrer Nähe sein wollen. Doch an einem Ort wie diesem konnte man leicht unbemerkt auf einem der Sofas sitzen oder auch im Bubbles an einem Tisch, dort Austern essen, einen Weißwein dazu schlürfen und gleichzeitig Linda Nchabas Nemesis sein.
»Bitte«, sagte Linda. Und kam nicht weiter.
Vicki Kahn beugte sich vor, wodurch erneut ihre Brüste schmerzten. Sie fragte mit sanfter Stimme: »Möchten Sie mir den USB-Stick geben?«
Linda Nchaba ging auf den Vorschlag nicht ein.
»Vielleicht sollte ich all das gar nicht tun«, murmelte sie.
»Sie sind aber hier«, entgegnete Vicki. »Und ich bin hier. Sie wollten uns etwas mitteilen. Uns etwas geben.« Sie sah sich um. »Hier ist ein guter Ort für all das.«
Linda Nchaba schüttelte den Kopf. »Es gibt dafür keine guten Orte. Sie kennen ihn nicht. Ich dachte, er weiß nicht, dass ich hier bin.«
»Er? Wer ist er?«
Die Frau runzelte die Stirn. »Ein Mann ganz weit oben. Aber Sie haben mich gefunden. Seine Leute haben mich gefunden.«
»Was meinen Sie damit? Sie gefunden?« Vicki war verwirrt. »Wer sind seine Leute?«
»Gestern haben sie mich auf meinem Handy angerufen. Sagten, dass sie wüssten, ich würde wegen eines Modelauftrags nach Paris fliegen.« Ihr Gesicht wirkte verkrampft, in ihren Augen standen Tränen. »Auf meinem Handy, dessen Nummer nur meine Großmutter kannte. Und sie geht seitdem nicht mehr ans Telefon.«
Vicki konzentrierte sich auf die Augen von Linda Nchaba. Das Gesicht des Models schien vor Trauer und Verzweiflung in sich zusammenzufallen. Doch dann zeigte sich, ehe sie in Tränen ausbrach, auf einmal eine wilde Entschlossenheit, und es gelang ihr, sich zu beherrschen. Vicki wusste, dass es einer ziemlichen Willensstärke bedurfte, um so etwas zu schaffen. Linda wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und holte mehrmals tief Luft.
»Wir haben die Möglichkeit, Ihnen Schutz zu gewähren«, sagte Vicki.
»Ach, nicht wegen mir«, murmelte die Frau und winkte ab. Keine Ringe an ihren Fingern. »Es geht um die Kinder. Junge Mädchen. Für sie wäre es besser.«
»Warum?«, fragte Vicki. »Was geschieht mit ihnen?«
Linda Nchaba sah sie nicht an, sondern starrte nur auf die Leute, die in Richtung der Flugsteige vorübergingen. Lachte gequält. »Sie werden beschützt.«
»Ach ja?«, erwiderte Vicki. »Von wem? Und vor wem?«
»Für wen. Für wichtige Männer.«
Vicki schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, worüber wir gerade reden. Warum muss man sie vor sich selbst beschützen? Das ergibt keinen Sinn.« Linda Nchaba schwieg. »Hören Sie«, fuhr Vicki fort und schluckte, als unerwartet eine Welle der Übelkeit in ihr aufstieg. »Ich bin weit geflogen, um Sie zu treffen. Ich bin hier, um Informationen von Ihnen zu bekommen. Wichtige Informationen. Sie können sie mir anvertrauen, bei mir sind sie sicher. Man wird Sie beschützen. Niemand wird erfahren, dass wir uns getroffen haben. Niemand wird wissen, dass wir miteinander geredet haben. Wir sind hier im Transitbereich von Schiphol. Ich weiß nicht, woher Sie gekommen sind, und ich wusste auch nicht, wo Sie hinwollen, bevor Sie es mir gesagt haben. Um dieses Treffen haben Sie gebeten. Und einige Etagen über mir, in den leitenden Rängen, hat jemand erklärt, okay, finden wir heraus, was Linda Nchaba weiß. Jemand dort hält Sie für wichtig. Deshalb bin ich heute hier bei Ihnen.«
Jetzt sah Linda Nchaba sie an. Vicki erwiderte ihren Blick. Sie sah die Angst in Lindas Gesicht, ihre bebenden Nasenflügel, ihre aufeinandergepressten Lippen, die Furcht in ihren dunklen Augen. Am liebsten hätte sie die Hand der Frau berührt. Tat es aber nicht. Hielt ihre Hände stattdessen verschränkt in ihrem Schoß. Sie rutschte etwas auf ihrem Platz hin und her, um die Spannung abzubauen und die Beine übereinanderzuschlagen.
»Am Telefon meiner Großmutter meldete sich ein Mann.«
»Wie bitte? Was sagen Sie da?«
»Am Telefon meiner Großmutter meldete sich ein Mann. Er meinte, ich solle heimkommen. Ich konnte meine Gogo, meine Großmutter, im Hintergrund weinen hören.«
»Sie sagten, sie hätte gar nicht abgehoben.«
»Hat sie auch nicht. Das hat der Mann getan.«
»Wie oft … Wie oft haben Sie dort angerufen?«
»Fünfmal.«
»Und Sie konnten Ihre Großmutter weinen hören? Sind Sie sicher?«
»Ja. Das war sie. Das war ihre Stimme. Sie rief mir zu, dass ich wegbleiben soll.« Linda Nchaba schlug die Hände vor das Gesicht. Zitterte am ganzen Körper.
Vicki hakte nicht weiter nach. Sie hatte erneut das Bedürfnis, die Frau zu trösten, sie zu berühren, ihr den Arm um die bebenden Schultern zu legen. Aber sie hielt sich zurück. »Linda! Linda, hören Sie mir zu.«
Die Frau stöhnte auf. »Sie haben meine Gogo.«
»Wir können sie finden, Linda«, versicherte Vicki. »Wir haben Leute, die das tun können. Gute Leute. Sie werden sie finden.«
Wieder beobachtete Vicki, wie sich Linda sammelte. Sie bewunderte die Art, wie sie die Schluchzer und das Beben zu unterdrücken vermochte. Wie sie nicht in Tränen ausbrach. Als ob sie viel Übung darin hätte.
»Das werden sie nicht«, entgegnete Linda. »Sie kennen diese Sorte Männer nicht. Sie kennen den Mann nicht, der sie anführt. Diese Männer haben mir gesagt, dass sie meine Großmutter umbringen, wenn ich nicht zurückkomme.«
»Aber Sie sind nicht zurückgekehrt. Sie sind hier. Und jetzt bin ich auch hier, weil Sie das so wollten. Sie wollten uns Informationen geben. Sie sind nicht zu ihnen zurückgegangen.«
Vicki drehte sich leicht zur Seite, um Linda Nchaba von vorne betrachten zu können. Linda wandte sich ihr zu, das Gesicht nun völlig ausdruckslos. »Als ich wegging, als ich floh, in der Nacht meinte meine Großmutter zu mir, dass ich nicht zurückkommen soll. Nie zurückkommen. Sie hat mir das Versprechen abgenommen fortzubleiben. Nie zurückzukehren. Absolut nie. Selbst wenn …« Sie richtete den Blick in die Ferne.
Vicki wartete.
»Selbst wenn man sie holt. Das hat sie gesagt. ›Kehr niemals zurück, mein Kind, selbst wenn sie mich holen.‹«
»Verstehe«, murmelte Vicki.
»Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt, so etwas gesagt zu bekommen? ›Selbst wenn sie mich holen. Kehr niemals zurück, mein Kind.‹« Ihre Augen bohrten sich in die von Vicki. Vicki sah sie an. Erkannte die Verzweiflung. »Jetzt werden sie meine Großmutter umbringen. Wegen mir. Damit muss ich für immer leben. Dass sie meinetwegen umgebracht wurde.«
»Sie ist noch am Leben«, gab Vicki zu bedenken. »Sie sagten doch, dass Sie Ihre Großmutter am Telefon hören konnten.« Während des Gesprächs dachte Vicki immer wieder, wie wenig sie durch ihre Tätigkeit als Anwältin zu so etwas befähigt war. Auch das Geheimdiensttraining hatte sie nicht darauf vorbereitet. Wie verhielt sie sich in einer solchen Situation? Wenn einem der Busen wehtat und man das Gefühl hatte, sich jeden Moment übergeben zu müssen. Und wenn im Kopf die Stimme von Henry Davidson sagte: »Bringen Sie den USB-Stick an sich. Den Stick, die Frau. Sie wollte das. Sie hat Kinder auf dem Gewissen. Vergessen Sie das nicht. Deshalb haben wir das Ganze arrangiert. Um an die Info zu kommen. Und sie dann nach Hause zu bringen.«
Linda Nchaba erklärte: »Solange ich anrufe, bringen sie meine Gogo nicht um.«
»Linda«, sagte Vicki, »weshalb bin ich hier?«
Die Frau öffnete ihre Faust und zeigte den USB-Stick.
»Was wollen Sie von uns?«
»Dass diese Männer aufhören. Dass er aufhört.«
»Wer? Wer soll aufhören? Nennen Sie mir einen Namen.«
Das Handy in Linda Nchabas Tasche klingelte. Der Klingelton: kreischende Hagedaschs. Ihr Kaah-Kaah-Kaah seltsam schrill in dieser Umgebung, auf dem Flughafen Schiphol, bei zwei Frauen auf einer Ledercouch. Das eindringliche Rufen der Vögel, wie sie über einem hinwegflogen. Hätte ein Lachen bewirken können. Wenn einem danach gewesen wäre.
Linda wühlte in ihrer Handtasche herum und holte das Handy heraus.
»Eine SMS«, sagte sie. Klickte die Nachricht an. Stieß einen leisen Schrei aus, während sie las. Hob den Kopf, sah sich panisch um, von rechts nach links, links nach rechts. »Wo? Wo sind sie?« Sie stand auf. Trat einen Schritt von der Couch fort. »Sie können nicht …« Sie wandte sich an Vicki.
»Sie können was nicht?«
Linda Nchaba hielt ihr das Handy hin. Vicki nahm es und las die SMS. »Wir sehen dich, Sisi.«
»Verstehen Sie jetzt? Verstehen Sie, was ich meine?« Linda Nchaba nahm das Handy wieder an sich. Setzte sich. »Sie wissen Bescheid. Er weiß Bescheid.«
»Sie wollen Ihnen Angst einjagen«, entgegnete Vicki. »Sie machen das auf gut Glück. Sie versuchen es. Einfach so. Aber sie wissen nicht, wo Sie sind.«
Wieder gab das Handy diesen Kaah-Laut von sich. Ein einziges Wort auf dem Display: »Schiphol.«
»Doch, sie wissen es«, erwiderte Linda Nchaba. Hielt Vicki das Handy hin, damit sie die Nachricht lesen konnte.
»Dann verfolgen Sie Ihr Handy«, meinte Vicki. »Sie haben einen Peilsender oder so etwas. Sonst nichts. Mehr wissen sie nicht.« Allerdings eine schlaue Taktik, wer auch immer dahinterstecken mochte. Verunsicherte Linda Nchaba zutiefst. Musste von irgendjemandem vor Ort sein. Was bedeutete, dass der Transitbereich nicht so geschützt war, wie sie angenommen hatte. Ehe sie noch etwas hinzufügen konnte, kreischten die Hagedaschs erneut.
Linda Nchaba machte die SMS auf und keuchte. Reichte Vicki das Handy: »Die Frau, mit der du redest, heißt Vicki Kahn.«
»Treffer«, sagte Vicki. Sie überlegte. Wenn sie ihren Namen kannten, war jemand zu Hause in der Voliere verwickelt. Es hieß nicht zwangsläufig, dass sie hier auf dem Flughafen beobachtet wurde. Es bedeutete etwas Schlimmeres. Jemand ganz in ihrer Nähe ließ sie nicht aus den Augen. Überwachte vermutlich ihr Handy. Aber warum? Für wen? Die verdammte Regel von Henry, nur mit dem Nötigsten herauszurücken. Ihr nicht alles zu erzählen. Es sei denn, auch Henry wusste nicht alles.
Außerdem waren sie gut, diese Leute, die Linda Nchaba verfolgten. Drei Nachrichten zu schicken, das war fies. Wirklich fies, denn es heizte die Paranoia an und versetzte Linda Nchaba in einen Zustand größter Angst. Ihre Augen wanderten durch das Flughafengebäude, von dahin nach dorthin, entdeckten aber niemand Auffälligen. Vicki konzentrierte sich währenddessen auf die Frau mit der schönen Haut. Und überlegte, wie sie an den Stick kommen konnte.
Linda Nchaba schnappte sich ihr Handy und stand auf. »Das hier war ein Fehler.«
»Der Stick«, sagte Vicki. »Geben Sie mir den Stick. Nennen Sie mir einen Namen. Oder mehrere. Sagen Sie mir, was darauf ist.«
»Es tut mir leid«, erwiderte Linda. »Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Er hat meine Großmutter. Er wird sie umbringen.« Sie wandte sich zum Gehen.
Vicki rief ihr hinterher: »Hier, nehmen Sie das.« Streckte ihr ihre Visitenkarte entgegen.
Linda Nchaba blieb stehen, kehrte um, nahm die Visitenkarte.
»Rufen Sie mich an«, bat Vicki. »Aber besorgen Sie sich zunächst eine neue SIM-Karte. Okay? Und schalten Sie Ihr Handy jetzt erst mal aus. Nehmen Sie auch den Akku heraus.«
Linda Nchaba runzelte die Stirn. Murmelte etwas, was Vicki nicht verstand. Vielleicht wollte sie ihr sogar den USB-Stick geben? Vicki brach den Blickkontakt ab und schaute stattdessen auffordernd auf Lindas Hand, ehe sie ihr wieder ins Gesicht sah. Linda zögerte.
»Sie müssen ihn mir geben.«
»Nein. Nein, ich kann nicht. Er … Er … Sie haben keine Ahnung, wozu er fähig ist.«
»Der Kinder wegen.« Ein letzter Versuch. Vicki beobachtete, wie Lindas Gesicht sich einen Moment lang gequält verzerrte. Sie rutschte auf ihrem Sitz hin und her, als Linda Nchaba ihre schon ausgestreckte Hand zur Seite schlug und davonging. Vicki lief ihr nicht hinterher. Sie blieb sitzen und wartete, ob jemand der Frau folgte. Doch niemand tat es. An der Theke von Bubbles blieb Linda stehen und sprach einen Augenblick lang mit der Bedienung dort. Dann ging sie weiter. Sie eilte den C-Korridor entlang, bis Vicki sie nicht mehr sehen konnte.
Mist, dachte Vicki. Und jetzt? Sollte sie im Büro anrufen und ihrem Boss erklären, dass die Frau zwar aufgetaucht war, aber nichts Sinnvolles von sich gegeben hatte? Dass sie den Stick nicht herausrücken wollte. Blazer-Henry würde wütend schnauben und seine Perücke hin und her schieben. Verdammt. Sie konnte sich vorstellen, was er sagen würde. »Sie haben sie gehen lassen. Sie hatte den USB-Stick für Sie dabei, und Sie haben sie gehen lassen. Warum um Himmels willen, Vicki – warum?«
Eine Frage, auf die Vicki keine Antwort wusste. Höchstens dass sie kein Aufsehen erregen wollte, falls man sie doch beobachtete. Wie schnell sich die Paranoia übertrug. Da war niemand, der sie beobachtete, dachte sie und schnitt eine Grimasse, weil ihre Brust so schmerzte. Sie verfolgten Linda Nchaba über einen Peilsender. Und jagten ihr damit Angst ein.
Aber sie war gescheitert. Ihr erster Auftrag im Ausland, und sie hatte versagt. Hatte keine Informationen erhalten. Hatte die Frau nicht darauf vorbereitet, mit nach Hause zu kommen. Es würde ihr nicht gelingen, sie nach Südafrika zurückzubringen.
Was für ein Desaster.
Acht