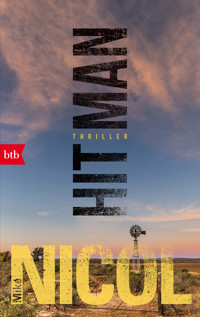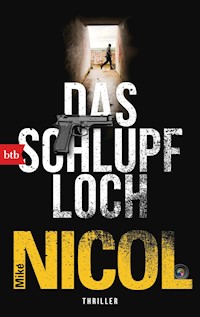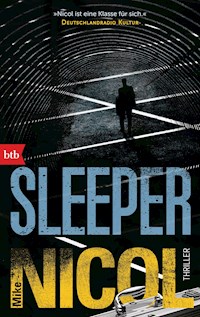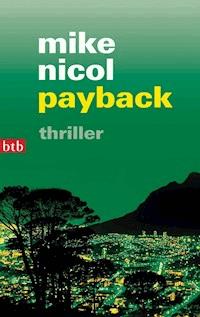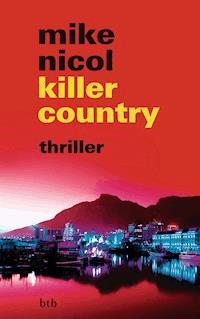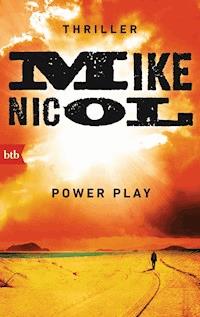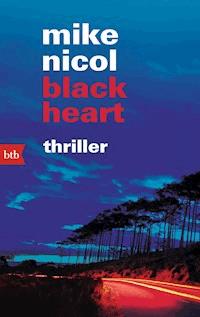
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Rache-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein typischer Kapstadt-Winter. Nicht viel los. Aber mit ausreichend Arbeit für Mace Bishop und Pylon Buso, die gegen Geld ihren Sicherheitsservice für Ausländer anbieten. Während sich Bishop um seine depressive Tochter kümmert, beschützt Buso einen deutschen Waffenspezialisten, dem ein paar osteuropäische Gangster auf den Fersen sind. Und ein Pärchen aus den USA, das in den lokalen Spielkasino-Markt investieren will. Aber dann wird die Frau entführt, und ein Reporter interessiert sich etwas zu sehr für die Balkan-Beziehungen des Waffenspezialisten. Plötzlich kommt Bewegung in das beschauliche Kapstadt-Dasein. Und im Hintergrund zieht die skrupellose Anwältin Sheemina February geschickt die Fäden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ein typischer Kapstadt-Winter. Nicht viel los. Aber mit ausreichend Arbeit für Mace Bishop und Pylon Buso, die gegen Geld ihren Sicherheitsservice für Ausländer anbieten. Während sich Bishop um seine depressive Tochter kümmert, beschützt Buso einen deutschen Waffenspezialisten, dem ein paar osteuropäische Gangster auf den Fersen sind. Und ein Pärchen aus den USA, das in den lokalen Spielkasino-Markt investieren will. Aber dann wird die Frau entführt, und ein Reporter interessiert sich etwas zu sehr für die Balkan-Beziehungen des Waffenspezialisten. Plötzlich kommt Bewegung in das beschauliche Kapstadt-Dasein. Und im Hintergrund zieht die skrupellose Anwältin Sheemina February geschickt die Fäden …
MIKE NICOL lebt als Autor, Journalist und Herausgeber in Kapstadt, wo er geboren wurde, und unterrichtet an der dortigen Universität. Er ist der preisgekrönte Autor international gefeierter Romane, Gedichtbände und Sachbücher, zuletzt einer autorisierten Biografie über Nelson Mandela. Seine Rache-Trilogie wird parallel in Südafrika und England veröffentlicht. 1997 verbrachte er ein Jahr als Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms in Deutschland, 2002 hatte er eine Gastprofessur an der Universität Essen inne.
DIE RACHE-TRILOGIE BEI btbpayback.thrillerkiller country-thrillerblack heart.thriller
mike nicol
black heart
thriller
Aus dem südafrikanischen Englisch von Mechthild Barth
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »black heart« bei Umuzi/Random House Struik, Kapstadt und Old Street Publishing, LondonEin Glossar zu fremdsprachigen Begriffen findet sich im Anhang.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2014
Copyright © 2011 by Mike Nicol
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Published by Arrangement with Mike Nicol
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: Getty Image/Allen Baxter
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
UB · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-12155-6V002
www.btb-verlag.de
Mittwoch, 27. Juli
Schemenhafte Aufnahmen einer Überwachungskamera, schwarz-weiß. Ein Mann – recht groß, Anorak, Strickmütze, den Kopf gesenkt – läuft einen Gang entlang auf die Kamera zu. Es ist ein luxuriöser Korridor: Wände und Boden aus Marmorfliesen, drei große Fotografien von Stränden auf der rechten Seite. Links zwei Türen. Auf jeder die Apartmentnummer in Schwarz mit Schablone aufgemalt, fast die ganze Tür ausfüllend: 7, 8. Cooler Touch. Der Mann bleibt vor Nummer acht stehen, wendet der Kamera seinen Rücken zu. Sein Kopf ist nach vorne gebeugt, als würde er auf Geräusche in der Wohnung achten. Dem Zucken seiner Schultern nach ist er jedoch mit seinen Händen beschäftigt. Vierzig Sekunden vergehen. Die Tür springt auf. Der Mann rollt seine Strickmütze herunter, die zu einer Sturmhaube vor seinem Gesicht wird. Blickt zur Überwachungskamera hoch.
»Nette Geste«, sagte die Frau, die sich das Videomaterial auf ihrem Laptop ansah. Sie redete laut, obwohl sie allein war. Lächelte. Drückte mit einer behandschuhten Hand auf die Tastatur. Sah ihr eigenes Spiegelbild im Bildschirm: ihre hohen Wangenknochen, ihre nachgezeichneten Augenbrauen, die pflaumenfarbenen vollen Lippen. Ihr Latte-Gesicht über dem des Mannes mit der Sturmhaube. Sie schürzte die Lippen zu einem Kuss. Mmmh.
Er war gut, der Mann mit der Sturmhaube. Nur ein oder zwei weitere Leute, die sie kannte, wären in der Lage gewesen, das so schnell zu machen wie er. Sie lächelte. Hob die behandschuhte Hand, um sein Gesicht zu berühren. »Mace Bishop«, sagte sie. »Willkommen in meiner Welt.«
Sie drückte auf Wiedergabe. Der Mann war jetzt in der Wohnung. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten den leeren Gang, beide Türen waren geschlossen. Nach einer Minute schaltete sich der automatische Timer des Korridors ein, und die Lichter gingen aus. Sie wartete. Drei Minuten später gingen die Lichter wieder an. Nun war der Mann zu sehen, wie er die Wohnungstür schloss, ohne Eile, den Rücken der Kamera zugewandt. Lief den Gang entlang, am Lift vorbei zum Treppenhaus, fasste nach oben, um sich die Sturmhaube abzuziehen, und trat aus dem Sichtfeld der Kamera.
Er hatte sich genauso verhalten, wie es zu erwarten gewesen war. Hatte nicht widerstehen können, ihren Schlupfwinkel auszuspionieren.
Sie warf die DVD mit dem Videomaterial aus, die ihr die Sicherheitsfirma für den Apartmentblock als kleine Gefälligkeit überlassen hatte. Hatte den Leuten erklärt, dass es sich um einen Freund handelte, der ihr einen Streich spielen wollte.
»Toller Freund, muss schon sagen, toller Streich«, hatte der Boss der Sicherheitsfirma gemeint und sich keine große Mühe gegeben, seinen Blick von ihrem Dekolletee abzuwenden. »Sie kennen offenbar Leute mit interessanten Fähigkeiten, Miss February.«
»Da haben Sie recht«, hatte sie erwidert und war in ihrem langen Mantel hinausstolziert, wobei ihr die schwarzen Haare über den Kragen gefallen waren.
Sheemina February schob eine weitere DVD ein. Bilder ihres eigenen Überwachungssystems. Der vermummte Mann war in ihrer Wohnung zu sehen, aufgenommen von einer Infrarotkamera, die Farben gedämpfte Schwarz- und Blautöne. Die Sturmhaube dunkelblau, der Anorak schwarz, der Mann in Handschuhen, Jeans und Turnschuhen. Unauffällig. Regungslos lauschend.
Keine Pistole.
Was bedeutete, dass er nicht davon ausgegangen war, sie zu Hause anzutreffen. Er sondierte das Terrain. Vorsichtiger Mace. Berechenbarer Mace. Neugieriger Mace. Wie sie es vorausgesehen hatte. Ihn anlocken, um dann den Todesschuss abzugeben. Es war beinahe zu einfach.
Der Mann auf dem Bildschirm trat mit einer Taschenlampe in ihr weitläufiges Wohnzimmer. Strich mit den Fingern über die Rückenlehne ihres weißen Sofas, lief über die weißen Flokatiteppiche zu ihrem Schreibtisch, öffnete Schubladen, wühlte in ihren Papieren. Ging weiter. Ließ den Lichtstrahl zu hastig über die Bilder an den Wänden gleiten, um sie wahrzunehmen. Hielt aber an der kleinen Vitrine mit messerscharfen Rasierklingen inne, die über ihrem Schreibtisch angebracht war.
Klingen, die einmal berühmte Männer rasiert hatten. Klingen, die sie aufgetrieben und für die sie viel bezahlt hatte. Eine Klinge hatte Cecil Rhodes gehört. Eine andere einem Mörder namens Joe Silver. Hatte seinen Namen eingraviert. Ein Historiker vermutete, dass es sich bei diesem Mann um Jack the Ripper handelte. Das gefiel ihr – der posthume Ruhm des Goldgräber-Zuhälters und Schiebers Joe Silver.
Jede der sechs Klingen ihrer Sammlung besaß eine Geschichte. Allerdings gab es jetzt nur noch fünf. Die fehlende Klinge, die ihres Großvaters, war dazu benutzt worden, um den Hals von Mace Bishops Frau durchzutrennen. Zuvor – ein Vierteljahrhundert zuvor – hatte ihr Großvater die Klinge benutzt, um sich damit die Pulsadern aufzuschneiden. Lieber sterben als aus seinem Haus geworfen werden. In gewisser Weise, glaubte Sheemina, war dieser spezielle Schlitzer ein Instrument der Geschichte – eine Manifestation des Schicksals. Schade, ein solches Familienerbstück zu verlieren, aber das ließ sich nicht vermeiden. Die Rasierklinge lag vermutlich in irgendeiner Kiste mit Beweisen und wartete auf einen Obduktionsbericht. Keine Sorge. Es gab sicher Möglichkeiten, die Klinge wieder zurückzubekommen.
Sie richtete den Blick erneut auf Mace Bishop. Wie er auf den leeren Fleck ihrer Halsdurchtrenner-Sammlung starrte. Wie ihm klar wurde, dass die Klinge, mit der seine Frau umgebracht worden war, einmal als Ornament an ihrer Wand gehangen hatte. Welche Gefühle löste das wohl in ihm aus? Zorn? Ließ es ihn rot sehen? Was dachte er, dieser Mann? Mace Bishop in ihrer weißen Festung, umgeben von ihren Dingen. Dieser Mann, der sie töten wollte. Getrieben von Rache. Hatte er auch nur die leiseste Ahnung, warum sie ihm wehtun wollte? Warum sie ihn in den Ruin zu treiben gedachte? Plante, sein Leben zu zerstören? Das würde er bald. Wenn sie ihr Ziel erreicht hatte, würde er wissen, warum.
Sie beobachtete ihn, wie sie das schon oft getan hatte, seit er bei ihr eingebrochen war. Beobachtete, wie er ihr Wohnzimmer verließ, ihr Schlafzimmer betrat. Das war der Moment, der sie angespannt werden ließ, aufgeregt. Der ihr Herz zum Rasen brachte. Der ein Kribbeln durch die Finger ihrer zerschmetterten Hand jagte. Die Hand, die er mit einem Holzhammer zertrümmert hatte. Damals.
Sie schlug die Beine übereinander.
Da war er, in ihrem Schlafzimmer. Der Lichtstrahl wanderte über ihr Bett. Über das Nachttischchen mit dem Digitalwecker. 04:20. Über das Telefon auf der Ladestation, das Foto in einem Silberrahmen. Das einzige Foto in der ganzen Wohnung. Es zeigte Mace Bishop in seiner Speedo nach einer Schwimmsession im Pool des Sportstudios. Eine von mehreren Aufnahmen, die sie heimlich von ihm gemacht hatte. Sie hatte das Foto dort in der Hoffnung platziert, dass es ihm den letzten Verstand rauben würde.
Aber er schaute gar nicht genau hin, sondern ließ den Strahl zu ihren Einbauschränken weiterwandern. Das Licht brach sich in ihrem Spiegel und löschte für einen Moment das Bild der Kamera. Dann sah sie ihn wieder, wie er die Türen zu ihren Kleidern, Hosen und Jacken öffnete. Wie er einen Blick auf die Schuhregale im unteren Teil des Schranks warf. Er strich über eines ihrer Abendkleider. Sie stellte sich vor, wie sie es trug. Wie seine Hand über ihren Rücken glitt. Manchmal dachte sie so an ihn: seine Hände fest auf ihren Brüsten, fest auf ihren Pobacken, sie entschlossen an sich ziehend. Sie schüttelte den Kopf, um das Bild zu verscheuchen. Vor Erregung leicht erhitzt.
Da war der Mann, den sie töten wollte, und er hatte die Hände in ihrer Unterwäsche. Zog einen ihrer Tangaslips hervor. Satin, rot. Hielt ihn hoch, zerknüllte ihn in seiner Faust. Er warf ihn wieder in die Schublade. Setzte sich auf den Rand des Bettes, hüpfte auf und ab, als ob er testen wollte, wie bequem es war. Fiel auf die Kissen zurück, ließ die Hand unter sie gleiten, fand ihr seidenweiches schwarzes Negligee. Hielt es hoch. Sein Lichtstrahl glitt von dem Kleidungsstück zur Fotografie auf ihrem Nachttischchen. Schade, dass sie seine Miene nicht erkennen konnte.
Er ließ das Negligee fallen und nahm das Foto, um es sich genauer anzusehen. Richtete die Taschenlampe auf das Glas. Starrte sich selbst an – diesen kraftvollen, triefendnassen Körper, diese knappe Badehose. Stellte das Foto vorsichtig auf den Nachttisch zurück. Sprang rasch vom Bett auf, schloss die Schubladen im Schrank, machte die Türen wieder zu. Stopfte das Negligee in die Tasche seines Anoraks und verließ eilig ihre Wohnung. Der Bildschirm wurde dunkel. Die Kamera schaltete sich aus.
Sheemina February holte einen Weißwein aus dem Kühlschrank. Nahm sich Zeit, ihn zu entkorken. Dachte darüber nach, wie es sie erregte, dass er ihre Unterwäsche genommen hatte. Es hatte etwas Heimliches. Aufregendes. Etwas Lustvolles.
Sex und Tod.
Sie schenkte sich ein Glas ein. De Grendel Sauvignon Blanc. Probierte. Ließ den Wein einen Moment lang in ihrem Mund, ehe sie ihn schluckte. Dann machte sie es sich bequem. Die Sache war die: Warum hatte er so auf das Foto reagiert, als ob es kaum etwas bedeutete? Sie hatte einen Wutausbruch erwartet, zerschmettertes Glas, ein herausgerissenes Bild. Deshalb hatte sie es dort aufgestellt. Stattdessen wurde er zu Mr Ice. Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und spielte die Aufnahmen noch einmal ab.
Nachdem sie etwa bei der Hälfte angekommen war, klingelte ihr Handy.
»Mart«, sagte sie, als sie abhob.
»Wollte mich nur melden«, erwiderte Mart Velaze. Im Hintergrund hörte man Musik und Stimmen. Mart, der Behördenmann. Geheimdienst. Er hatte sie eines Tages überraschend angerufen, um sie zu informieren, dass ein gewisser Deal noch besser abgelaufen war, als sie das erwartet hatte. Ein Deal, bei dem es um Mace Bishop gegangen war. Mart, der in den letzten Tagen die Dinge auf geradezu vollkommene Weise erledigt hatte, der effiziente Mart, der sich um ihre Angelegenheiten kümmerte. Der Mann mit dem strahlend weißen Lächeln. Wobei man nie wusste, ob das Lächeln freundlich oder tödlich gemeint war. Der einzige Schwarze, dem Sheemina February begegnet war, der nie versucht hatte, sie auszutricksen. Was sie stutzig machte. Warum nicht? »Ich halte die Augen offen«, fügte er hinzu.
»Nicht nötig.«
»Gehört zum Service.«
»Nicht in diesem Fall.« Sie bedeutete ihm, es gut sein zu lassen, und bemühte sich um einen leichten Tonfall. »Wo sind Sie?«
»Nicht weit weg. In einem Café dem Strand gegenüber. Ich könnte vorbeikommen.«
»Besser nicht.«
»Falls was schiefläuft.«
»Es wird nichts schieflaufen.«
»In einer solchen Situation weiß man das nicht.«
»Man weiß das nie, Mart. Aber Sie können schon mal mit dem Zinken beginnen.«
»Er wird aufpassen. In der Todeszone.«
»Denken Sie etwa, ich nicht?«
Sheemina February wartete auf eine Antwort. Hörte die Musik im Hintergrund. Tina Turner mit der einzigen Tina Turner, die noch gespielt wurde: Simply the Best.
»Ich rufe Sie dann also an«, sagte sie. »Wie wir das vereinbart haben.«
»Okay«, erwiderte er. »Hauptsache, Sie sind die Erste. Geben Sie ihm keine Chance.«
»Ich bin ein großes Mädchen, Mart. Ich habe seit langem darauf gewartet. Jetzt werde ich die Nerven bestimmt nicht verlieren.«
Pause, in der Tina Turner zu Wort kam.
»Bis dann.«
Mart sagte: »In Ordnung.«
Sie legte auf. Brauchbarer Bursche, dieser Mart.
Er hatte ihr die Waffe besorgt. Der .38er Smith & Wesson neben ihrem Laptop. Der Revolver, der in den nächsten sechs, sieben oder acht Stunden immer in ihrer Reichweite sein würde – wie lange es auch dauern mochte, bis Mace Bishop auftauchte.
Sheemina February nahm den Wein mit auf den Balkon hinaus. Blickte über den Ozean – ein glasig wirkendes Meer, das donnernd gegen die Felsen unter ihr schlug. Die Sonne war fast untergegangen und ihre Wärme verschwunden. Morgen, wenn sie wieder aufging, würde alles anders sein.
Zwischen dann und jetzt musste sie nur noch auf ihn warten. Auf Mace Bishop. Warten machte ihr nichts aus, darin war sie geübt.
Dienstag, 12. Juli
1
Niemand wusste, wo er war.
Er hatte aufgepasst.
Er befand sich in einer Pension in Berlin – Knesebeckstraße, Seitenstraße des Kurfürstendamms – und hatte sich unter falschem Namen angemeldet. Als J. Richter. In einem dieser Familienhotels.
Die Pension Savigny betrat man durch eine unauffällige Tür und ging dann eine Treppe hinauf. Kein Lift.
Der Besitzer entschuldigte sich für das Zimmer. Hätte Herr Richter rechtzeitig angerufen, um zu reservieren, hätte er ihm ein besseres Zimmer anbieten können. Im Sommer sei das Hotel immer ausgebucht. Es wäre auch diesmal voll gewesen, wenn es nicht eine Absage gegeben hätte. Herr Richter habe also großes Glück gehabt.
Das Zimmer war lang und schmal. Über der Stadt donnerte es, gezackte Blitze tauchten die Häuser in ein weißes Licht. Er schloss die Vorhänge, schlüpfte aus seinen Schuhen und legte sich aufs Bett.
Er war auf der Flucht. Dumm gelaufen. Nur zwei Tage mehr, und er wäre untergetaucht gewesen. Wieder unterhalb des Radars. Was hatte ihn verraten? Der Tod seiner Mutter. Natürlich. Er hätte vorsichtiger sein müssen, hätte sich denken können, dass sie das erfahren würden. Eigentlich war er doch immer vorsichtig.
Alias J. Richter rieb sich die Augen. Er brauchte Schlaf. Es hatte keinen Sinn, sich zu überlegen, was er falsch gemacht hatte. Jetzt war es egal: Sie hatten ihn gefunden, und er war auf der Flucht. Schlimmstenfalls eine Unannehmlichkeit, die nach einem neuen Plan verlangte. Morgen würde ihm sicher etwas einfallen. Die Zeit war auf seiner Seite.
Er spürte die Schläfrigkeit hinter seinen Lidern. Auf der Flucht zu sein, hatte ihn noch nie am Schlafen gehindert. Damals nicht und heute auch nicht. Er schloss die Augen. Voll angezogen döste er ein.
Vierzehn Stunden zuvor war der Mann mit dem falschen Namen bei der Rückkehr von seiner morgendlichen Joggingrunde an der Haustür zum Wohnblock seiner Mutter überfallen worden. Zwei Männer hatten versucht, ihn in einen weißen Audi zu zerren. Ein Nachbar mit Besen in der Hand war ihm zu Hilfe geeilt und hatte mit dem Besen auf die Kerle eingedroschen. Die Männer gaben auf und brausten davon. Zu Richters Überraschung hatten sie ihn nicht mit Waffen bedroht. Sonst waren die Albaner nie so höflich.
»Verbrecher«, sagte sein Nachbar. »Wahrscheinlich Russen. Die wollen dann Lösegeld. Irgendwas. Und wenn es nur ein paar Hundert Euro sind.« Er bot einen Tee an. Meinte, sie sollten die Polizei rufen.
Der Mann mit dem falschen Namen erklärte, das sei nicht nötig. Er würde später zur Polizei gehen und den Vorfall melden. Jetzt musste er sich erst einmal beruhigen. Wieder zu Atem kommen. Sich darum kümmern, dass seine Hände zu zittern aufhörten.
»Am besten trinken Sie einen Tee mit drei Stück Zucker«, sagte sein Nachbar. »Und einen Schnaps.«
Oben stellte Richter fest, dass man die Wohnung durchwühlt hatte. Zuerst wanderte er inmitten des zurückgelassenen Chaos herum, tatsächlich atemlos vor Schreck über den Angriff und zudem von der Stunde Joggen. Beherrsch dich, dachte er. Bleib wachsam. Fokussiert. Denk nach. Sie wollen doch, dass du fliehst.
Er hatte nicht vor, blindlings davonzustürzen. Das nächste Mal würden sie brutaler vorgehen.
Die Vormittagsstunden vergingen. Minute um Minute. Manchmal beobachtete er, wie der Sekundenzeiger der Standuhr seine Runden drehte. Ein leises Tick, Tick, Tick. Jede Viertelstunde schlug die Uhr. Er saß da und wartete. Versuchte zu lesen. Holte das Buch neben seinem Bett, machte es sich auf dem Ohrensessel seiner Mutter bequem. Fand die Seite, bei der er es zugeklappt hatte. Kapitel 31. »Er wusste, dass er träumte und nicht aufhören konnte.« Las bis zum Ende des Kapitels weiter. »Ed zog sich um und klebte seinen Ersatzschlüssel an die Tür. Ein Licht ließ er brennen.« Was in der Zwischenzeit passiert war, wusste er nicht. Seine Augen glitten über die Wörter, als würden sie keine Geschichte erzählen. Er legte das Buch beiseite. Irgendwie musste er sich betätigen.
Richter setzte sich ans Klavier. Seine Finger lagen flach auf den Tasten. Der deformierte kleine Finger seiner linken Hand war zu kurz, um das Elfenbein zu berühren, aber er hatte gelernt, das auszugleichen. Er konnte eine Jazzmelodie spielen, und fast niemandem fiel etwas auf. Er begann mit Gershwin. Summertime. Es war schon lange her, seit er das zum letzten Mal gespielt hatte. Zu lange. Er traf die Noten nicht richtig, und die Läufe wirkten ungreifbar, als würden sie ihn verspotten. Immer wieder spielte er die Melodie, bis er schließlich den Klavierdeckel zuknallte. Saß da und starrte das verschwommene Spiegelbild seines Körpers im lackierten Holz an. Eine halbe Stunde lang bewegte er sich nicht. Irgendwann erhob er sich, ging zum Fenster und sah auf die Straße hinaus. Der Wagen stand noch da. Den Nachmittag über schaute er regelmäßig nach.
Der weiße Audi parkte etwa hundert Meter entfernt in Richtung Fluss und rührte sich den ganzen Tag nicht von der Stelle.
Sie wollten, dass er handelte. Dass er in Panik geriet und davonlief. Das würde ihren Job einfacher machen, dann konnten sie ihn auf der Straße abfangen. Und ihn verschwinden lassen.
An einem gewöhnlichen Donnerstag in Frankfurt an der Oder.
Er beobachtete die Straße: Fußgänger, Rentner mit ihren Einkaufswägelchen, Jungen auf Skateboards, Mädchen mit dünnen Kleidchen und Handys. Verkehr. Ein Lieferwagen lud Gemüse, Obst und Kartons voller Milch vor einem Supermarkt aus. Städtische Arbeiter reparierten eine Wasserleitung. In dem kleinen Café gegenüber füllten sich zur Mittagszeit die Tische auf dem Bürgersteig. Um sechzehn Uhr dreißig schloss der Pächter sein Lokal.
Er überlegte, ob er jemanden anrufen sollte. Das Festnetz war bestimmt angezapft. Sein Handy auch. Aber es gab noch das Handy seiner Mutter. Ein altes Modell, sozusagen ein Ziegelstein. Für jeden Anruf musste man einzeln zahlen. Niemand würde das erwarten. Wenn er sich kurz hielt, würden sie es vielleicht gar nicht mitbekommen.
Er hoffte, dass die Karte aufgeladen war.
Er wählte. Auf Englisch sagte er: »Schnell. Sie haben mich gefunden. Ich werde später Hilfe brauchen.« Dann legte er auf. Schaltete das Handy wieder aus.
Er bezweifelte, dass die Männer im Audi das Gebäude abscannten, doch man konnte nie wissen. Viel war dafür nicht nötig. Falls sie den Anruf bemerkt hatten, wussten sie auch, wem er gegolten hatte. Keine schöne Vorstellung. Vielleicht war es ein Fehler gewesen. Aber er musste anrufen. Er musste reden, und wenn es nur ein paar Worte waren.
Und er musste sich beruhigen. Lief durch die Wohnung und berührte alle möglichen Gegenstände. Die Kerzenständer aus Messing. Die Reiseuhr. Die Art-déco-Figürchen. Kleine Büsten von Komponisten. Die Pfeifen seines Vaters auf einem Ständer. Die Kissen, die seine Mutter bestickt hatte. Die Familienfotos in Silberrahmen auf einem Silbertablett mit Griffen aus Elfenbein. Sein Vater im Alter von fünfundzwanzig oder sechsundzwanzig, in den Armen mehrere Fische. Seine Mutter etwa im gleichen Alter in einer Krankenschwesternuniform. Die junge Familie in den sechziger Jahren am Strand, als er und seine Schwester noch Kinder waren. Der Tag seines Abiturs.
Er schenkte sich einen Wodka ein. Wünschte sich, seine Mutter hätte Whisky gehabt. Zwang sich dazu, sich hinzusetzen und den Alkohol langsam zu trinken.
Die lange Helligkeit im Juli war ein Nachteil. Aber der Mann namens Richter saß es aus. Mit Anbruch der Dämmerung schaltete er für die beiden Männer im Audi die Lichter in der Wohnung ein. Stellte sicher, dass sie seinen Schatten vor den Fenstern sehen konnten.
Ehe es ganz dunkel war und eine Viertelstunde bevor der Zug ging, verließ er die Wohnung. Blieb unter der Tür stehen und warf einen letzten Blick aufs Wohnzimmer. Ein gefühlvoller Moment. Dann zog er hastig die Tür ins Schloss. Sperrte ab.
Er verließ den Block durch eine Hintertür, die in einen Park führte. Dort auf dem Rasen tummelten sich nur einige Grüppchen von Teenagern. Sie tranken Bier. Rauchten. Hörten dröhnender Rap-Musik zu. Drei Straßen vor dem Bahnhof kam er heraus. Es waren stille Straßen, durch die ein Mann unbemerkt hasten konnte. Er nahm den letzten Zug nach Berlin, so einfach ging das, und vom Telefon des Zuges aus reservierte er das Hotelzimmer. Hörte, wie der Mann an der Rezeption murrte: »Das ist aber spät für eine Reservierung.«
»Tut mir leid. Können Sie mir helfen?«
Tadelndes Zungenschnalzen. »Ja, gut. Wir haben noch ein Zimmer. Ein Einzelzimmer.«
»Mehr brauche ich nicht.«
Der Mann namens Richter stieg am Bahnhof Zoo aus, sperrte seinen Koffer in ein Schließfach und lief den Kurfürstendamm entlang, während das Gewitter donnernd näherkam. Kein Grund anzunehmen, dass irgendwer wusste, wo er sich befand.
Früh am nächsten Morgen ging er joggen. Die Knesebeckstraße entlang bis zum Ku’damm, dann den leichten Anstieg zum Halensee hinauf. Er lief schwerelos dahin, wenn er auch in der heißen, schwülen Morgensonne schwitzte. Das Gewitter hatte der Stadt keine Erleichterung verschafft. Am See beobachtete er die Schwimmer, bleiche Körper in braunem Wasser. Begriff nicht, was ihnen daran gefiel. Die meisten nackt. Ältere Menschen, von denen er nicht sagen konnte, wer Mann und wer Frau war.
Inzwischen hatten sich die Kerle in dem Audi sicher an die Verfolgung gemacht. Sie mussten herausgefunden haben, dass er den Zug nach Berlin bestiegen hatte, und waren nun wahrscheinlich hier, um die Flughäfen zu beobachten. Und die Bahnhöfe. Hauptbahnhof, Zoo. Richter beschloss, einen Bus und kleine Bummelzüge in eine andere Großstadt zu nehmen. Vielleicht nach Leipzig. Dort konnte er ein Auto mieten. Immer unterwegs sein. Es war das Beste, nicht stillzustehen. Vielleicht sollte er nach Wien fahren, den Flughafen dort überwachten sie bestimmt nicht. Von da konnte er nach Dubai fliegen. Von dort nach Johannesburg. Ja gut, wie der Hotelbesitzer gesagt hatte. Warum nicht? Am Mittwoch wäre er dann bereits zu Hause in Kapstadt. Ein anderer Mann.
Lächelnd überließ Richter die Schwimmer im Halensee ihrem Schicksal, joggte leichtfüßig zurück zur Kreuzung und rannte den breiten Bürgersteig entlang. Es kribbelte ihn weiterzukommen.
In der Pension duschte er, zog sich ein Polohemd, braune Chinohosen, Mokassins und keine Socken an. Steckte die Sonnenbrille in den Ausschnitt seines Hemds. Ein Mann, der geschäftlich in der Stadt zu tun hatte. Vielleicht in der Tourismusbranche arbeitete. Oder mit Sportaccessoires handelte. Ein bescheidener Mann, der originelle Pensionen mehr schätzte als große Hotels. Ein Mann, der im Frühstücksraum entspannt wirkte, wo er die hohen Stuckdecken und die Aufnahmen des alten Berlin an den Wänden bewunderte.
Auf Englisch riet er einem jungen amerikanischen Paar, eine Sauffahrt auf der Spree zu machen. Die zwei sahen wie Kinder aus, höchstens Anfang zwanzig. »Vor gar nicht langer Zeit patroullierten dort noch bewaffnete Boote«, erklärte er den beiden. »Jetzt ist das eine Touristenattraktion. Die Zeiten ändern sich.«
Das Paar lachte. Der jungenhafte Mann sagte: »Super. Vielen Dank, Mann.« Die Kindfrau zeigte ihre blitzend weißen Zähne.
Das Paar verabschiedete sich.
Richter lächelte. Was war super? Dass sich die Zeiten änderten? Die Grenzschutzboote? Der Ausflug? Vielleicht machte das George-Bush-Land die beiden so eigenartig.
Der Hotelbesitzer kam an seinen Tisch und schenkte noch einmal Kaffee nach. Fragte, ob der Herr das Zimmer für eine weitere Nacht zu buchen wünsche.
Richter meinte: Leider nein. Ein schönes Hotel – wies mit einer ausladenden Geste durch den Raum –, aber er befinde sich auf dem Weg nach Hamburg. Um das Wochenende dort mit der Familie zu verbringen. Mit der Brut seiner Schwester.
Ja gut, sagte der Besitzer, dann würde er die Rechnung fertig machen.
Eine Stunde später schlenderte der Mann mit dem Alias Richter die Knesebeckstraße entlang, Richtung Bahnhof Zoo. Ein Mann, der scheinbar viel Zeit hatte. Er behielt die Straße vor sich im Visier. Warf immer wieder einen Blick durch die Schaufensterscheiben, überprüfte die Leute hinter sich. Blieb plötzlich stehen, um in seiner Tasche nach etwas zu suchen, während er die Straße beobachtete. Zehn Schritte weiter machte er es wieder so. Und an der Eisenbahnbrücke. Man musste so vorsichtig wie möglich sein.
Was in dieser Hitze nicht so recht ging. Nicht, wenn man bereits nach fünfzig Metern Laufen in Schweiß ausbrach. Die Hitze ließ alles verschwimmen. Machte einen unaufmerksam. Es passierten schneller Fehler. Er nahm wohl besser einen Bus, um die Risiken zu verringern. Aber zuerst musste er zu seinem Koffer im Bahnhofsschließfach. Zu seinem Laptop. Zu den Dateien.
An der Ecke zur Kantstraße entriss ihm ein Mann plötzlich seine Reisetasche und warf sie auf die Rückbank eines weißen Audi. Stieß ihn hinterher. Richter landete der Länge nach auf den Sitzen. Der andere schob sich hinter ihm ins Auto. Presste eine Pistole in seine Nieren.
Langsam fuhr der Wagen los. Ein Fußgänger rannte neben ihnen her. Schlug gegen die Fensterscheibe, brüllte: »Halt! Halt!«
»Polizei!«, rief der Fahrer. Der Mann draußen blieb abrupt stehen und sah zu, wie sich das Auto in den Verkehr einordnete.
»Wir fahren irgendwohin, wo wir in Ruhe reden können«, erklärte der Mann auf der Hinterbank auf Albanisch. »Und kein Herr Richter mehr. Verstanden?« Zwickte Richter in die Wange. »Wie nennen Sie sich denn gerade? Max Roland, oder? Wir haben viel zu besprechen, meinen Sie nicht, Max?«
»Tricky Max«, sagte der Fahrer und grinste ihn durch den Rückspiegel an. Fasste nach hinten, um seine linke Hand zu erwischen. Spielte damit. »Na, da haben wir’s ja, Max.« Reckte Max Rolands kleinen Finger in die Höhe. »Nur ein Knöchel. Daran sollen wir Sie erkennen.« Er hielt ein Foto hoch. »Falls Sie sich verkleiden. Aber dafür haben Sie sich offenbar viel zu sicher gefühlt.« Er warf die Aufnahme auf den Beifahrersitz. »Seien Sie nicht so enttäuscht, Max. Freuen Sie sich lieber, dass wir Sie erwischt haben, sonst hätten Sie echte Probleme mit den Jungs aus Den Haag bekommen.«
»Für immer weggesperrt«, meinte der Mann neben ihm. »Das wäre ein verdammt langweiliges Leben geworden.«
Die beiden Männer lachten.
Max Roland schluckte. Am liebsten hätte er sich übergeben.
Samstag, 23. Juli
2
»Mr Oosthuizen«, sagte die Stimme. »Ich glaube, Sie brauchen meine Hilfe.«
Magnus Oosthuizen warf einen Blick auf sein Handydisplay: Nummer unterdrückt.
»Wer spricht da?«, fragte er.
»Für den Moment ist es egal, wer ich bin«, erklärte die Stimme.
Eine weibliche Stimme, klar und direkt. Leichter Akzent auf den Vokalen, was sie zu voll, zu betont klingen ließ. Kapstadt. Wahrscheinlich coloured, vermutete er. Eine dieser gebildeten Frauen, die sich krampfhaft darum bemühten, die nasale Eintönigkeit ihrer Sippe hinter sich zu lassen.
»Wichtig ist, dass ich über Ihr Waffensystem Bescheid weiß und dass Sie da eine väterliche Hand brauchen. Oder sollte ich sagen, eine mütterliche? Im Ernst. Wie haben Sie es so lange ohne Hilfe mit der Regierung geschafft? Aber Ihnen ist ja sicher klar, dass es nicht mehr weitergeht.«
»Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind«, sagte Oosthuizen. »Ich lege jetzt auf.«
»Wenn ich Sie wäre«, meinte die Anruferin, »wäre ich zumindest neugierig. Ich würde wissen wollen, wer diese geheimnisvolle Person ist, die meine Handynummer hat. Und woher sie von dem Waffensystem weiß. Woher sie weiß, dass ich früher einmal das Vertrauen der richtigen Regierungsleute besessen habe. Und ich würde wissen wollen, was sie mit der Formulierung meint, dass ›es nicht mehr weitergeht‹. Bei so viel Geld, das auf dem Spiel steht, wäre ich nervös. Ich würde zwar ein kleines Theater machen und mich aufregen, aber ich würde diese unerwartete Unterhaltung nicht … sagen wir mal … ergebnislos abbrechen.«
Magnus Oosthuizen schloss die Augen. Massierte sich das Nasenbein. Ihm lief ein kalter Schauder über den Rücken, und er drehte die Heizung höher. Diese feuchten Kapstadt-Winter krochen einem in die Knochen.
»Wer sind Sie?«
»Eines sollten Sie gleich über mich wissen, Mr Oosthuizen. Ich wiederhole mich nicht gerne.«
Oosthuizen stand von der Couch auf und stellte sich ans Fenster, blickte in den Garten hinaus. Ein langer heller Rasen, umrahmt von Lavendelbüschen. Am anderen Ende der Gärtner, der gerade Laub aus dem Pool fischte. Er sah so aus, als könnte er genauso gut eine Gondel durch venezianische Kanäle steuern. John, der Malawier. Die Bewegung hatte er sich wahrscheinlich in seiner Kindheit am See angewöhnt. Oosthuizen machte sich mit Vorliebe über seine Untergebenen lustig.
»Soll ich Ihnen behilflich sein, Mr Oosthuizen? Soll ich einige dieser nagenden Fragen für Sie beantworten?«
Nagend. Offenbar wirklich eine Frau, die sich nach oben gearbeitet hatte.
»Ja«, sagte er. »Von mir aus.« Er ließ sich wieder nieder. Chin-Chin, sein Chihuahua in einem karierten Jäckchen, kratzte mit der Pfote an seinem Hosenbein, um hochgehoben zu werden. Sah ihn aus riesigen Augen an. Wimmerte. »Ag, nein, Kleiner«, flüsterte er dem Hund zu und schob ihn weg. Chin-Chin kam zurück und schnappte nach seinen Fingern.
»Lassen Sie mich als Erstes einmal den Namen Mo Siq nennen.«
»Was soll mit ihm sein?«
Der Hund japste schrill und aufdringlich. Oosthuizen beugte sich herab, um ihn hochzuheben und auf seinen Schoß zu setzen.
»Ist das ein Chihuahua?«, wollte die Frau wissen.
»Ja.«
»Schreckliche Hunde«, meinte sie. »Typisch nördlicher Vorort.«
»Mrs«, sagte Oosthuizen, »ich …«
»Ms. Wir kommen später noch zu meinem Namen. Jetzt zu Mo Siq. Spitzenmann der Regierung bei Waffengeschäften, ehe er einem Attentat zum Opfer fiel. Davor Ihr Berater. Der Ihnen Vorschläge unterbreitete. Aufpasste. Als Insider tätig war. Keine Ahnung, wie es Ihnen gelungen ist, in den letzten Jahren ohne ihn zurechtzukommen, aber ich gratuliere noch im Nachhinein, Mr Oosthuizen. Sie haben das Schlangennest überlebt. Das war sicher schwer. Und verlangte geschicktes Jonglieren. Vielleicht sind Sie ja ein Jongleur. Bisher irgendwelche Fragen?«
»Woher haben Sie meine Nummer?«
Die Frau lachte. Ein leichtes, sanftes Lachen. »Das war kein Problem. Sie befindet sich auf Mos Laptop. Lassen Sie es mich so formulieren: Mos Laptop war eines der Dinge, die ich nach seinem Tod geerbt habe.«
»Sie haben es gestohlen.«
»Geerbt, Mr Oosthuizen. Sie sind sich offenbar bestimmter Verhältnisse nicht bewusst. Also …« Sie hielt inne, und er hörte, wie Flüssigkeit in ein Glas gegossen wurde. »Prost, Mr Oosthuizen …« Er hörte sie einen Schluck trinken. »Nichts geht über einen guten Sauvignon Blanc.« Noch ein Schluck. Oosthuizen warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Wein um elf Uhr vierzig an einem Dienstagvormittag. »Also, Mr Oosthuizen, was Sie von mir wissen wollen sollten …« Ihre Stimme wurde nun geschmeidiger, öliger. »… ist, was ich weiß und was Sie nicht wissen.«
»Hören Sie, Ms …«
»Nein, jetzt hören Sie mir zu, Mr Oosthuizen. Es wird sich für Sie lohnen. Ich weiß, dass die Europäer ein Budget auf einem Unterkonto als Teil ihrer Ausschreibung für das Waffensystem haben.«
»Das ist kein Geheimnis.«
»Mit Unterkonto meine ich Gelder, die nicht zimperlich erworben wurden. Bestechungsgelder. Ohne Gegenleistungen in Form von Edelstahl. Auch keine Aluminiumhütten. Keine Kondomfabriken. Geld in den Hosentaschen der Regierungsleute. Ich meine Konten auf den Caymans. Oder auf den Kanalinseln. Island, Barbados – wo auch immer sie ihre Hosentaschen haben. Die Art von Hosentaschen, die Sie nicht füllen können, Mr Oosthuizen. Weshalb Sie mich brauchen.«
»Und was können Sie tun?«, schnaubte Oosthuizen verächtlich und wand sich, um den Hund von seinem Gemächt zu schieben. Chin-Chin beschwerte sich lautstark.
»Eine ganze Menge«, erwiderte die Stimme. »Glauben Sie mir. Zum Beispiel Ihren Wissenschaftler Max Roland am Leben halten. Ihn gegen einen anderen austauschen. Ihnen sogar helfen, ihn nach Hause zu bekommen.«
»Wo sind Sie?«, fragte Oosthuizen.
»In der gleichen Stadt wie Sie. Wie wäre es mit einem Drink heute Nachmittag? An der Waterfront? Im Den Anker? Wir haben viel zu besprechen. Kommen Sie vorbei.«
»Wie soll ich Sie erkennen? Ich weiß nicht einmal Ihren Namen.«
»Sie werden mich nicht erkennen. Und meinen Namen wissen Sie tatsächlich nicht. Das ist natürlich alles sehr geheimnisvoll, aber so bin ich nun mal, Mr Oosthuizen. Das ist mein Stil. Sagen wir siebzehn Uhr? Ich bin die Blondine mit der Rose. Keine Sorge, ich erkenne Sie.«
3
Sheemina February legte auf.
Mr Magnus Oosthuizen. Einer jener Menschen, die alles überlebten. Wie sie selbst. Wie sie war auch er jemand, der das System zu nutzen verstand. Allerdings hatte er keine Ahnung, dass ihn das System bald in die Mangel nehmen würde. Und den attraktiven Max Roland obendrein. Den Frauenschwarm.
Sie legte das Telefon beiseite und trat mit ihrem Glas Wein auf den Balkon hinaus. Legte ihre steife linke Hand auf das Chromgeländer. Blickte über das Meer, das vom letzten Sturm noch immer aufgepeitscht war, von braunem Schaum durchzogen, und gegen die Felsen drei Stockwerke unter ihr schlug. Sie hätte die unterste, tiefste Wohnung auch kaufen können. Hatte diese an einem ruhigen Tag mit einem leisen Plätschern besichtigt. Bezaubernd. Verführerisch. So nahe neben dem Meer zu sein. Der Balkon dort gab einem das Gefühl, auf einem Boot zu sein. Aber sie kannte das Meer bei Kapstadt, wusste, wie es ansteigen und mit welcher Wucht es zerstören konnte. Noch war nichts passiert, doch höchstwahrscheinlich würde es das eines Tages tun.
Sie trank einen Schluck Wein. Behielt ihn einen Moment lang im Mund, um den Geschmack voll auszukosten.
Das Traurige an der Sache war, dass sie ihr Nest verlassen musste. Ihre weiße Festung, diese Felsenhöhle. Eine luxuriöse Höhle in einem Kliff voll teurer anderer Höhlen, die Filmstars, reichen Geschäftsleuten, Kartelltussen und erfolgreichen Models mit zu viel Geld, das sie viel zu schnell verdient hatten, gehörten.
Aber damit ihr Plan aufging, musste sie die Wohnung verlassen und untertauchen. Wie die Schwarze Witwe, die sich versteckte und auf ihr Opfer wartete. Auf ihr Opfer Mace Bishop.
Sie liebte die Wohnung seit vielen Jahren. Gestattete niemandem, sie zu betreten. Nicht einmal ihren jeweiligen Liebhabern. Sie betrachtete sie als Festung und als Zufluchtsort. All das hatte sich jedoch verändert, seit sie zu einem Spinnennetz geworden war.
Sie drehte sich zum Wohnzimmer hin. Zu den weißen Sofas zwischen den weißen Flokatiteppichen auf dem Eschenparkett. Auf den meisten Oberflächen standen weiße Votivkerzen, die sie abends anzündete. Ein weiß getünchter Esstisch und ebensolche Stühle. Ihr Nest. Ihr großes Reich aus Weiß.
Sie hingegen trug Schwarz: Stiefel, Hose, Rollkragenpulli. Einen schwarzen Lederhandschuh an ihrer gequälten Hand, wenn sie ausging. Ein langer schwarzer Mantel gegen die Kälte. Manchmal ein Paschmina-Schal, der lose herabhing. Um des Flairs willen. Für ihre Eleganz. Schwarz, um das Eisblau ihrer Augen zu verstärken. Schwarz in dieser hellen, weißen Welt. Außer ihren kurzen blonden Haaren. Doch die waren nur vorübergehend blond, eine Art Verkleidung. Weder ihre Farbe noch ihr Stil. Nur eine Zwischenlösung. Wenn sich die Zeiten wieder geändert hatten, würde sie zu ihrem schwarzen Bob zurückkehren.
Sie trank einen weiteren Schluck Wein. Was für ein Wunder das Leben doch war.
Sheemina February lächelte ihrem Spiegelbild in den Scheiben des Panoramafensters zu. Strich sich ihre blonden Haare aus dem Gesicht. Manchmal spielte einem das Leben in die Hände … in die Hand. Magnus Oosthuizen und Max Roland waren Topkandidaten für die Dienste von Mace Bishop. Wie praktisch. Und das zu einer Zeit, in der Mr Bishop vor Trauer kaum aufrecht stehen konnte, vor Trauer um seine hinreißende Frau Oumou. Und zugleich langsam seine Tochter verlor. Den armen Mann hätte es zu keinem ungeeigneteren Moment treffen können. Vorausgesetzt, es gelang ihr, ihm das Ganze zuzuschieben – was ihr sicher gelingen würde. Magnus Oosthuizen würde formbar sein wie Ton. Wie der Ton, den die entzückende Oumou für ihre kleinen, niedlichen Töpfereien verwendet hatte.
»Du bist eine perfekte Vermittlerin, Sheemina«, sagte sie laut. »Du solltest Provision verlangen.«
Sie ging in die Wohnung zurück und schloss die Schiebetür. Auf ihrem Laptop waren Bilder zu sehen, die Mart Velaze von Max Roland geschossen hatte. Fotos von einem nackten Max Roland. Der Hintergrund war weiß gefliest. Die Hände hielt Max Roland über den Kopf, die Handgelenke waren mit Plastikriemen an einen Duschkopf gefesselt. Die Haltung brachte seinen Körperbau wunderbar zur Geltung: die Linien seiner Arme, seiner Brust, seines flachen Bauchs, seiner kräftigen Oberschenkel. Allerdings waren seine Waden zu dünn. Ein reizender Körper, dessen Waden verbessert werden konnten. Ein Läufer, wie man ihr gesagt hatte. Manchmal hatten Läufer überraschend schmale Waden. Auch Schwimmer. Mace Bishop etwa. Für einen Langstreckenschwimmer hatte er schmale Waden. Je länger sie den Körper von Max Roland betrachtete, desto stärker erinnerte er sie an Mace Bishop. Vielleicht lag daran seine Anziehungskraft.
Sie beugte sich näher über den Laptop.
Eine Serie von vier Fotografien, die innerhalb einiger Stunden gemacht worden waren. Auf dem ersten Bild steckte noch Kraft in Max Rolands Körper. Sein Gesicht spiegelte Resignation wider, die Füße standen fest auf dem Boden. Auf dem zweiten: Sein rechtes Knie war angewinkelt, um eine Stütze an der Wand zu finden. Etwas begann in seinem Gesicht – eine Anspannung um die Augen, ein leichtes Öffnen der Lippen. Das nächste Bild zeigte, wie er sich mit einer Hand an den Duschkopf klammerte, als ob er versuchte, sich aufrecht zu halten. Der Mund stand leicht offen. Sie vermutete, dass er keuchte. Sheemina February zoomte auf seine Nasenlöcher, die sich mehr und mehr weiteten. Seine Lippen waren außerdem trocken. Auf dem dritten Bild konnte sie seine Zungenspitze sehen. Und seine Augen wirkten jetzt wild – schwarze kleine Pupillen, die nach links starrten. Auf dem vierten Foto war er nass, die blonden Haare klebten auf seiner Kopfhaut, Tropfen hingen in seinen Brusthaaren. Die Augen geschlossen, der Mund offen. Man hatte das Wasser aufgedreht, um ihn wiederzubeleben, doch es hatte nichts genutzt. Er baumelte an dem Duschkopf, sein ganzes Gewicht zerrte an seinen Handgelenken, sein Körper wölbte sich nach vorne. Seine Füße unter ihm zuckten. Er musste große Schmerzen haben. Sheemina February nahm an, dass es maximal vierundzwanzig Stunden gedauert hatte, um ihn in diese Verfassung zu bringen. Wahrscheinlich mit Hilfe von etwas, was man auf den Bildern nicht sah. Ein paar Schläge mit einem Elektroschocker wirkten oft wahre Wunder.
Sie stellte sich Mace Bishop in diesem Zustand vor. In dieser Position?
Sie zoomte auf Max Rolands Genitalien. Bild eins: Hier war der Hodensack noch fest und der Penis zurückgezogen. Erinnerte sie an eine Muräne. Nummer zwei dann: Der Sack war eingefallen, das Glied durch die Haltung nach vorne gedrückt. Auf dem dritten Bild: herabhängend, dünn und nutzlos. Schließlich wie eine verschrumpelte Frucht, die zu lange am Baum gehangen hatte – violett angelaufen, von Wespen und Fliegen zerstochen.
Sheemina February schloss die Datei und öffnete das Dokument mit den Informationen über Max Roland. Eine Stunde lang las sie darin und war so absorbiert davon, dass sie sogar vergaß, sich Wein nachzuschenken.
Danach machte sie sich zu Mittag einen Salat und trank noch ein Glas Sauvignon Blanc. Max Roland und Magnus Oosthuizen würden zweifellos perfekte Klienten für Mace Bishop sein. Wie seltsam die Welt doch funktionierte. Und wie angenehm es manchmal sein konnte.
Sie holte die Fotografie von Mace Bishop aus ihrer Handtasche, die sie dort in einer Plastikhülle aufbewahrte. Mace in einer schwarzen Speedo, wie er gerade dabei war, in den Pool zu springen, in dem er dreimal die Woche seine Bahnen zog. Wo sie hinging, um ihn zu beobachten, wenn sie das Bedürfnis danach verspürte. Um ihn zu beobachten, ohne dass er etwas merkte. So wie auch das Foto heimlich entstanden war. Er hatte insgesamt eine gute Figur. Vielleicht schon ein wenig zu kräftig um die Taille, aber ansonsten fit. Sie hielt das Bild mit den Fingern ihrer rechten Hand hoch.
Um sechzehn Uhr fünfzehn verließ Sheemina February ihre Wohnung. Durch eine Fernbedienung aktivierte sie vom marmorgefliesten Flur aus die Alarmanlage. Fuhr mit dem Lift zwei Etagen hinauf und lief dann die Treppe zur Dachgarage hoch. Drei Autos in den Buchten für Besucher. Außerdem der Mercedes ihres Nachbarn und der BMW der Witwe unter ihr. Daneben ihr großer BMWX5. Der Wind zerrte an ihrem Mantel, und die Kälte der Seeluft ließ sie zittern. Mit der behandschuhten Hand zog sie den Mantel fester um sich. Atmete tief ein, nahm den kräftigen Geruch des Meeres in sich auf.
Fünfundzwanzig Minuten später setzte sich Sheemina February an einen Restauranttisch, der sich der Eingangstür gegenüber befand. Auf die Tischdecke legte sie eine Rosenknospe. Sie hatte noch viel Zeit. Bestimmt würde auch Magnus Oosthuizen frühzeitig eintreffen. Er war diese Sorte Mensch. Vorsichtig. Misstrauisch.
24. Juli
4
Mace Bishop saß, mit einem leeren Kaffeebecher in der Hand, auf der Dachterrasse seines Hauses und starrte auf die Stadt hinaus. Kapstadt an einem kalten Nachmittag, die Dämmerung brach herein, die Luft roch nach Regen. Im Radio der Solid Gold Sunday.
Er dachte daran, wie es vor sieben oder acht Wochen gewesen war. Wie es gewesen war, ehe Oumou ermordet wurde. Ihre wunderbare Gegenwart. Ihre Ruhe. Ihre Stille. Ihre Berührungen. Wie ihre Tochter Christa mit den Armen um beide Eltern für ein Foto posiert hatte. Ehe Oumou unten in ihrer Töpferwerkstatt mit einem Messer getötet wurde. Ehe das Blut, das ganze Blut aus ihrem Körper lief. Ehe ihr Körper schwer in seinen Armen lag, an einem Sonntag wie diesem jetzt. Nur dass sie zuvor miteinander gelacht hatten. Glückliche Zeiten damals.
Momentan war er allein. Christa war bei ihrer Freundin Pumla. Besser dort als zu Hause. Musik von früher im Radio. Gerade lief ein Rolling-Stones-Song mit einer Zeile über schwarz gestrichene Autos.
Mace schleuderte den Becher gegen die Mauer. Einer von Oumous Bechern. Das Gefäß explodierte, Scherben flogen ihm entgegen.
Er hätte geweint, wenn es ihm möglich gewesen wäre.
Die Sache mit der Trauer, dachte Mace, war der Schmerz. Man wurde den Schmerz nicht los. Schwer und pochend blieb er in der Brust. Jede wache Sekunde lang. Ein wenig Erleichterung bot der Schlaf, mit einem doppelten Whisky und ein, zwei, drei Ambiens. Dann sah er das Blut nicht mehr, das aus ihr herauspulsiert war.
Oder nicht verharren. Arbeiten. Schwimmen. Diese langen Strecken, Bahn für Bahn durch den weißen Pool ohne einen Gedanken, ohne den Schmerz. Nur die mechanische Bewegung, Arm um Arm, der hochkam, heraus- und wieder untertauchte, während Luftblasen an ihm entlangströmten. Bis seine Arme nicht mehr konnten. Seine Lunge war gut, zuerst wurden seine Arme langsamer. Es ging so weit, dass er es kaum mehr die Sprossenleiter nach oben schaffte. Keine Kraft mehr, um sich festzuhalten.
Dann das Beben. Die Muskelkrämpfe. Mehr ein Zittern als ein Beben. Eine heiße Dusche half. Danach zog er sich langsam an – und abgelenkt fiel ihm plötzlich das Blut ein. Hatte keinen Grund, nach Hause zu fahren.
Außer dass Christa dort war. Wenn sie denn dort war. Meistens schien sie in der Schule zu sein oder bei Pumla, irgendwo, nur nicht zu Hause. Und wenn sie da war, sperrte sie sich mit ihrem iPod hinter ihren Büchern in ihrem Zimmer ein. Sie und Mace umschlichen sich wie Gespenster. Der Mord an Oumou schob sie unaufhörlich auseinander.
An diesem Morgen war er stundenlang geschwommen, bis seine Arme nicht mehr konnten. Zurück im Haus, lief er ziellos durch die Zimmer. Christa übernachtete woanders. Er hatte sich ein paar Filme angeschaut. Hatte in Oumous Atelier mit der großen sauberen Stelle auf dem Boden gesessen und die Dinge angestarrt, die sie in den Regalen gelagert hatte. Die Teller, Schalen und Vasen, die nie mehr gebrannt werden würden.
Hier saß er fast jeden Tag. Saß da, sah sich um, sehnte sich nach ihr.
Erinnerte sich daran, wie er die Treppe heruntergekommen war und zuerst das Blut gesehen hatte. Dann Oumous Füße. Dann ihren Körper, die Rasierklinge in ihrem Rücken, ihr Kleid blutdurchtränkt, die Schnitte in ihren Händen, Armen, ihrem Hals. Ihr Gesicht ihm zugewandt. Ihre Augen verloren ihr Licht.
Nach einigen weiteren Filmen war er schließlich mit einem Becher Kaffee auf die Dachterrasse gegangen. Der Berg hinter ihm, graue Klippen im Nebel. Kapstadt unter ihm feucht und schimmernd. Ein kaltes Licht über dem Meer.
Er dachte an Christa. Wie es war, der Vater einer Tochter zu sein, die keine Mutter mehr hatte. Hätte es noch schwieriger sein können? Ihr Leid, das sie nicht artikulierte. Außer durch ihr quälendes Verlangen, dass er ihr Schießen beibrachte.
»Wenn ich das tue«, hatte Mace gesagt, »darf es dir aber auch nichts ausmachen, wenn du jemanden tötest.«
»Ich lerne einfach, wie man gerade zielt.«
»Nein, das geht nicht.«
»Ich werde niemanden erschießen.« Sie hatte ihm den Rücken zugewandt und stand am Fenster, um auf die Stadt hinunterzustarren. Mace hatte seine Hände auf ihre Schultern gelegt, aber sie hatte sie abgeschüttelt. »Ich muss mich schützen können.«
Die unausgesprochene Kritik: weil du es nicht kannst. Sonst wäre meine Mutter nicht tot.
Mace hatte gefragt: »Bist du bereit, einen Menschen zu töten?«
Sie hatte sich abrupt zu ihm umgedreht. »Ja.«
»Selbst wenn er keine Waffe hat?«
»Wenn mich ein Mann bedroht – ja.«
»Das Gesetz verbietet das.«
»Papa«, hatte Christa erwidert. »Meine Maman wurde ermordet.«
Eine weitere unausgesprochene Kritik: Wozu ist das Gesetz schon nutze?
Gute Frage, dachte Mace. Offensichtliche Antwort. Er hatte zugestimmt, also gut, er würde es ihr beibringen.
Kein Danke. Keine Umarmung. Kein Versöhnungskuss. Nur: »Wann?«
»Nicht dieses Wochenende«, hatte er erklärt.
»Siehst du. Das sagst du immer.«
»Ich habe eine Firma, die laufen muss, C. Kunden. Ich darf nicht einfach abhauen, wenn’s mir gerade passt. Pylon kann auch nicht alles alleine machen.«
»Ich bin deine Tochter«, hatte sie erwidert. Hatte sich wieder ihren iPod ins Ohr gestöpselt, ihr Buch genommen. Sie hatte sich geweigert, ihn anzusehen, ihm zu antworten, und hatte sich abgewandt, als er sich ihr gegenüber gesetzt und sie angefleht – ja, angefleht – hatte, nicht so zu sein.
Das war Freitagabend gewesen.
Mace wusste nicht, dass sie sich später geritzt hatte. Einen seiner Rasierköpfe mit den drei Klingen genommen, ihn mit Daumen und Zeigefinger festgehalten und leicht über die Innenseite ihrer Schenkel geführt hatte – etwa zwei Zentimeter lang und weit genug oben, dass es unter ihrem Slip nicht zu sehen war. Ein brennender Schmerz. Ließ sie scharf Atem holen, sich auf die Zähne beißen, ihre freie Hand zur Faust ballen. Doch während dieses langen Augenblicks, in dem die Klinge ins Fleisch schnitt, spürte sie allein den Schmerz.
Länger als beim ersten Mal. Die alten Wunden waren verkrustet, die Krusten abgefallen und noch blasse Striche zurückgeblieben. Drei parallele Linien. Das neue Blut unten wurde zu einem Tropfen, der ihren Schenkel hinablief. Sie tupfte die Wunde mit Toilettenpapier ab und ließ den Schnitt dann in Ruhe, bis das Blut gerann.
Am Samstagvormittag war Treasure gekommen, um Christa abzuholen. Die schwangere Treasure mit ihrer Tochter Pumla. Pylon hatte seine Frau und seine Stieftochter zu ihnen gefahren. Er hatte sich nicht eingemischt – Treasure schon. Als Christa ihrem Vater zum Abschied keinen Kuss gab, war Treasure aus dem Wagen gestiegen, schwerfällig zu Mace gegangen und hatte ihn beiseitegenommen.
»Reiß dich zusammen, okay? Sie leidet, Mace. Überlass momentan Pylon das Geschäftliche und verbring Zeit mit ihr. Fahr mit ihr weg, wie du es angedroht hast. Sie muss das abschließen können. Fahrt nach Malitia, zeig ihr, wo ihre Mutter aufgewachsen ist. Verstreut Oumous Asche. Gib dem Mädchen etwas. Ein paar Gefühle. Erinnerungen. Du bist völlig verschlossen. Du hältst es für männlich, dich zusammenzureißen, aber das stimmt nicht. Es tut ihr nicht gut. Sie findet dich kalt, sie glaubt, dass dir alles egal ist. Sie will dich weinen sehen, Mace. Sei wie sie – so verzweifelt, dass ihr fast das Herz bricht.«
»Bin ich«, sagte Mace.
»Hab ich bisher nicht bemerkt.«
Sie stieg wieder ein. Mace, die Hände in den Hosentaschen, stand da und sah sie an: die glückliche Familie und seine Tochter. Pylon zuckte mitfühlend mit den Schultern, ließ den Motor an und fuhr im Rückwärtsgang auf die Straße. Nur Treasure winkte Mace zu, als sie davonbrausten.
Mace blickte zum Berg hinauf. Über dem Gipfel blaue Flecken, die sich hinter der Wolkendecke zeigten. Er musste etwas tun – schwimmen oder den Berg besteigen. Vielleicht gab es da oben einen Kretin, der Leute überfiel und freundlich genug war, es auch bei ihm zu versuchen. Dann könnte er sich abreagieren. Zum Beispiel dem Arschloch mit einem Stein das Hirn herausschlagen.
Die Leere des Hauses, als er wieder hineinging, jagte ihm einen kalten Schauder über den Rücken. Eine greifbare Kälte. Und Stille. Still wie unter Glas – man konnte nach draußen sehen, aber nichts hören.
Cat2 rieb sich an seinen Beinen und gab ihr typisches Wimmern von sich. Als Kätzchen war sie an die Wand eines Raveclubs genagelt worden. Mace streichelte sie und spürte dabei die Narbe an ihrem Nacken, wo man den Nagel hindurchgetrieben hatte. Hob sie hoch. Sagte: »Das ist Scheiße, Cat2. Verdammte Riesenscheiße.« Cat2 öffnete ihr Maul und gab einen lautlosen, rosa Seufzer von sich.
Er fütterte sie mit geräucherten Sardinen, nahm seinen Sportsack und ging zu seinem Alfa Spider hinaus. Lange und anstrengend schwimmen war das Beste. Allerdings sprang der Spider nicht an. Grundsätzlich ein tolles Auto, wenn es nicht angefangen hätte, Sperenzchen zu machen. War unzuverlässig geworden. Launenhaft. Aber es war auch schon alt, fünfunddreißig, sechsunddreißig Jahre.
Ihm blieb nichts anderes übrig, als Oumous Kombi zu nehmen. Er hatte ihn seit ihrem Tod ein- oder zweimal benutzt. Wollte ihn eigentlich verkaufen, brachte es aber nicht über sich, eine Anzeige zu schalten. Wenn dieser Wagen in der Garage nicht mehr da wäre, würde ihre Abwesenheit noch schlimmer sein. Noch eine Lücke, ein weiterer Hinweis auf das Loch in seinem Leben.
Das Auto roch nach ihr. Nach Ton und Parfum. Selbst Wochen später. Es transportierte Erinnerungen an sie. Trockene Tonbrösel im Kofferraum, im Handschuhfach Haarspangen und Sonnenbrille und unter dem Vordersitz ein Paar Segeltuchschuhe, das er entdeckt hatte, als er dort seine Pistole unterbringen wollte. Oumou. Er hatte eine Hand in die Sitztasche gesteckt und einige ihrer Haare gefunden, lang, schwarz. Ihre langen, seidig schwarzen Haare, mit denen sie über seine Brust gestrichen hatte. Wenn sie auf ihm gesessen hatte, die Brüste durch den Schleier aus Haaren drückend, mit denen sie ihn so gestreichelt hatte, bis er sie zu sich herabgezogen und seine Lippen auf ihre gepresst hatte. Sie küsste, sich in ihr verlor.
Er riss sich von der Erinnerung los. Stocherte mit dem Schlüssel im Zündschloss herum, ließ den Wagen an. Der Motor heulte lauter auf, als das nötig gewesen wäre.
Das restliche Wochenende über schaute Mace Filme, schlief und ging wieder schwimmen, um das Blut von seinem Bewusstsein fernzuhalten. Die Sache war die: Er hätte mit Christa zum Schießplatz im Steinbruch fahren können. Er hätte etwas für sie tun können.
Stattdessen hockte er vor dem Flachbildfernseher. Spiel mir das Lied vom Tod, mehrere Folgen von Deadwood, Der Texaner.
Schlief. Schwamm. Sah sich schließlich am Sonntagnachmittag, Cat2 auf seinem Schoß, Spiel mir das Lied vom Tod immer und immer wieder an. Die ersten sechs Minuten mit den drei Schützen am Bahnhof. Das rhythmische Quietschen der Windmühle, das Surren einer Fliege. Der Typ auf der Bank, der die Fliege in seinem Gewehrlauf fing. Das Gewehr an seine Wange hielt und lächelte, als er das wütende Surren hörte. Bis das Pfeifen eines Zuges die Stille durchbrach. Das Donnern der Zugkolben und Räder, die sich über die Prärie näherten. Die Gangster, die ihre Waffen kontrollierten und auf den Bahnsteig hinausgingen, während der Zug einfuhr. Ein Mann stieg aus. Nicht ihr Mann. Die Kerle entspannten sich und wandten sich zum Gehen, als der Zug weiterfuhr. Dann die Mundharmonika – der klare Ruf der Mundharmonika –, und die Männer drehten sich zu der Bronson-Figur um. Mundharmonika.
Der lange Klagelaut jagte Mace einen Schauder über den Rücken. Aufregend. Die Art von Erkennungsmelodie, wie man sie brauchte.
Mundharmonika ließ sich Zeit. Er war nicht in Eile. Schließlich baumelte das Instrument wieder an der Schnur um seinen Hals.
»Wo ist Frank?«
»Frank hatte keine Zeit.«
Mundharmonikas Blick. Seine Augen, die zu den drei am Geländer festgebundenen Pferden wanderten. »Habt ihr’n Pferd für mich?«
»Wenn ich mich hier so umsehe, dann sind nur drei da. Sollten wir denn tatsächlich eins vergessen haben?«, sagte der Fliegenfänger. Die anderen lachten.
Mundharmonika schüttelte langsam und kaum merklich seinen Kopf. »Ihr habt zwei zu viel.« Diese tonlose Nüchternheit: »Ihr habt zwei zu viel.«
Mace liebte das. Legendär. Der winzige Moment, ehe die Schießerei beginnt, und nach den Kugeln hörte man nur das Knarzen der Windmühlenflügel, die sich drehten. Dann richtete sich Mundharmonika langsam auf.
Fünf Mal sah sich Mace diese sechs Minuten an. Schließlich hatte er sich in Oumous Atelier gesetzt und war bald nach oben gegangen. Hatte Solid Gold Sunday eingeschaltet, Kaffee gekocht. Ihn mit nach draußen genommen. Saß in düsterem Selbstmitleid da, während die Stones Paint it Black sangen. Schleuderte den Becher gegen die Mauer. Ihn erfüllte eine überwältigende Traurigkeit.
Er rief Christa an.
Ihr widerwilliges »Papa«.
»Was machst du?«
»Nichts. Einen Film anschauen.«
»Ah ja. Welchen?«
»Scream 3.«
»Schon wieder?«
»Der ist cool.«
Er konnte hören, wie cool die Schreie im Hintergrund klangen. Was fanden Teenager nur an diesen Slasherfilmen?
»Du bist die ganze Zeit über nicht draußen gewesen?«
»Es hat geregnet.«
»Nicht ständig.«
»Aber meistens.«
Schweigen. Mace hielt das Handy fester.
»Hast du deine Hausaufgaben erledigt?«
Sie seufzte.
»Hast du sie erledigt?«
»Schon am Freitagabend, Papa. Du hast es doch selbst gesehen.«
»Wollte nur sichergehen.«
»Das musst du nicht.«
»Ich weiß, C.« Am liebsten hätte er gesagt: »Du fehlst mir hier.« Aber er tat es nicht.
Wenn er es getan hätte, wäre ihre Antwort gewesen: »Warum? Wir machen doch nichts zusammen.«
Und darauf hätte er keine Antwort gewusst.
Stattdessen fragte er: »Ist Pylon schon weg?«
Christa erwiderte: »Ich glaub, ja. Warte kurz.« Dann: »Gerade eben.«
»Wir gabeln ein paar Klienten am Flughafen auf«, erklärte Mace. »Sollte um acht vorbei sein. Dann hole ich dich.«
»Kann ich nicht hierbleiben?«
»Morgen ist Schule.«
»Ich kann doch mit Pumla hinfahren.«
»Nein, finde ich nicht, C.«
»Warum nicht?«
»Ich will das nicht. Wir müssen jetzt zusammenhalten.«
Pause. Lange genug, um Mace nervös werden zu lassen. Aber er hielt sich zurück.
Dann: »Pylon hat eine Haarschneidemaschine. Eine elektrische. Pumla kann mir den Kopf scheren.«
Mace runzelte die Stirn. »Wozu?«
»Für Maman. So machen das Leute, wenn sie trauern. Traditionell.«
»Traditionell?«
»Pumla sagt, dass man das so macht.«
Mace dachte: mein Gott. Erwiderte: »Nein, C. Wir machen das nicht so.«
Wieder Schweigen. Er konnte sich ihren schmollenden Mund vorstellen.
Dann: »Bring mir das Schießen bei.«
Das fand er gut nachvollziehbar. »Nächsten Samstag.«
»Versprochen?«
»Natürlich.«
»Versprochen?«
»Versprochen, C.«
»Ich leg jetzt auf«, sagte sie.
Mace nickte. Er brachte kein Wort heraus, um sich zu verabschieden, ehe die Leitung tot war.
Langsam legte er sein Handy zur Seite und überließ sich seinem Selbstmitleid. Mitten darin der Gedanke an Sheemina February. Als ob sie in ihrem langen schwarzen Mantel und den schwarzen Handschuhen neben ihm stehen und ihm eine rote Rosenknospe entgegenhalten würde. Das Lächeln auf ihren Lippen enthüllte ihre perfekten Zähne. Ihre Augen eisblau. Er holte das Foto heraus, das die deutsche Touristin geschossen hatte: er und Christa auf dem Berg bei der Seilbahnstation, nicht lange nach dem Mord an Oumou. Trotz der Trauer ein gutes Bild. Wäre da nicht im Hintergrund die Gestalt von Sheemina February gewesen, die sie beide beobachtete.
5
Am ersten Morgen glaubte Max Roland, Gott habe ihn gerufen. Er erwachte von einer Stimme. Eindringlich. Sie kam durch die Lautsprecher. Füllte sein Hotelzimmer aus. Gott mit Verstärker. Eine Stimme, in die nach einer Weile andere einstimmten.
Max Roland lag auf einem schmalen Bett, bedeckt von einem Laken. Seine Arme schmerzten. Die Striemen um seine Handgelenke waren rotblau. Ansonsten ging es ihm nicht schlecht. Die Qualen waren vorbei.
Nur war da jetzt Gott.
Er setzte sich auf und stöhnte, als er seine schmerzenden Armmuskeln spürte. Fiel wieder zurück in die Polster.
Durch die offenen Fenster drang Licht. Die Sonne ging auf, und die Hitze wirkte bereits drückend.
Nicht Gott, sondern die Mullahs riefen die Gläubigen zum Gebet. Er lauschte. Fragte sich, warum sie Lautsprecher brauchten. Warum ihre Stimmen allein nicht mehr ausreichten.
Hinter den Hügeln in der Ferne konnte Max Roland einen blutroten Sonnenaufgang sehen. Er erwartete jeden Moment, dass der Himmel aufreißen und Gottes Mund erscheinen würde. So käme das Ende der Welt. Feuer am Morgen, eine Stimme im Himmel. Zornig. Nach Gehorsam verlangend. Nach Ehrerbietung.
Er gewöhnte sich rasch an den morgendlichen Chor. Man konnte zwar nicht weiterschlafen, aber danach ruhte die Stadt. Ein Innehalten zwischen Gebeten und Verkehr.
Er las. Einen Thriller, den er am Flughafen gekauft hatte. Bald würde er mit dem Buch fertig sein. Dann würde er von Neuem anfangen müssen.
Jeden Morgen vor dem Frühstück joggte Max Roland in den Suk, der noch still und geschlossen war. Lief zur Großen Moschee hinauf. Zuerst hatten ihn die kleinen Gassen verwirrt, aber schon bald kannte er sie. Genoss diese Zeit in der betenden Stadt, ehe die Sonne die Hitze entfachte. Jeden Morgen lief sein Bewusstsein weiter aus dem Raum mit den weißen Fliesen und den geduldigen, ausdauernden Männern davon.
Jetzt, am fünften Abend, rief er Magnus Oosthuizen vom Hoteltelefon an der Rezeption an. Was hier als Rezeption galt. Eine Theke mit einem Anmeldebuch, dahinter ein träger junger Mann. Andere Männer, die Qat kauten, lagen auf Kissen im Raum verteilt. Manchmal redeten sie miteinander. Meistens kauten sie jedoch langsam und konzentriert. Schauten Kriegsszenen im Fernsehen an, der Ton abgedreht. Stattdessen lauschten sie einem Popsänger, der aus einem tragbaren Radio über die Qualen der Liebe klagte.
»Max«, sagte Magnus Oosthuizen. »Oh, mein Gott.«
»Das dachte ich mir auch«, erwiderte Max Roland. »Am ersten Morgen habe ich genau das auch gedacht.« Er erzählte ihm von den Stimmen Gottes.
Oosthuizen meinte: »Wo steckst du?«
»In Sanaa«, sagte Max Roland. »Im Jemen.«
»Im Jemen. Wie zum Teufel bist du da hingekommen?«
»Natürlich mit dem Flugzeug.«
»Ich dachte … Ich dachte, man hätte dich erwischt.«
»Ja, hatte man auch. Ich bin entwischt. Sie haben nicht aufgepasst. Diese Albaner halten sich für superclever, aber sie machen auch Fehler. Also konnte ich abhauen.«
»Mit Geld für ein Flugticket?«
»Mit meinem Koffer – ja.«
Max Roland hörte, wie es in der Leitung raschelte und knackte. Eine der typischen Pausen von Magnus Oosthuizen. Er wartete.
»Einfach so?«
»Ich hab’s doch schon erklärt. Sie sind dumm.«
»Vielleicht haben sie dich absichtlich laufen lassen«, erwiderte Oosthuizen. »Vielleicht sind sie dir gefolgt.«
»Ba!« Max Roland zupfte einige frische Blätter von den Qatzweigen und schob sie sich in den Mund. Kaute. »Deshalb bin ich ja im Jemen. Um sicherzustellen, dass sie das nicht tun. Das ist der letzte Ort auf Erden, wo sie mich vermuten würden.«
»Ich schicke jemanden«, meinte Oosthuizen. Max Roland lächelte vor sich hin, als er hörte, wie sich die Stimme am anderen Ende der Leitung senkte und ruhiger wurde. »Geht es dir gut?«
»Oh ja«, sagte Max Roland. »Mir gefällt es hier ausgezeichnet.«
»Und man ist dir nicht gefolgt.«
»Nein. Nein. Aber allmählich wär’s Zeit weiterzuziehen.«
»Gib mir einen Tag«, erwiderte Oosthuizen. »Ich melde mich bei dir. Auf dieser Leitung.«
»Klar«, meinte Max Roland. Er schmeckte den bitteren Qat. »Fünf Tage sind zu lang an einem Ort.«
»Ich bringe dich nach Hause«, versicherte Oosthuizen. »Glaub mir, wir müssen schnell handeln.«
»Ruf mich nachmittags an. Da bin ich im Garten. Da lese ich immer im Garten.«
Magnus Oosthuizen sagte nichts. Max Roland fügte hinzu: »Ich werde nervös.«
»Isst du gerade was?«, wollte Oosthuizen wissen. »Wie viel Uhr ist es bei dir?«
Max Roland warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Runzelte die Stirn. Sagte: »Zwanzig nach elf.«
»Isst du zu Abend?«
»Nein. Blätter. Qat«, meinte Max Roland. »Das macht hier jeder von mittags bis nachts, um das Tempo der Stadt herunterzufahren. Eine wundervolle Angewohnheit. Wir haben alle grüne Zähne.« Er lachte.
»Bleib dort. Im Hotel«, sagte Magnus Oosthuizen. »Ich rufe dich morgen Nachmittag an.«
»Unbedingt«, erwiderte Max Roland. Er lächelte dem trägen jungen Mann zu. Legte das Telefon auf die Ladestation zurück und nahm seine Qatzweige in den Garten hinaus.