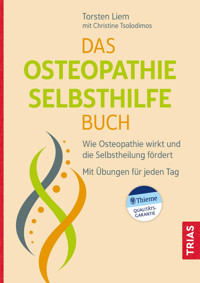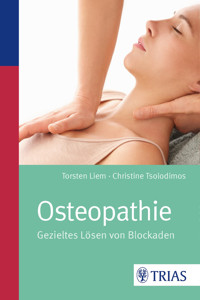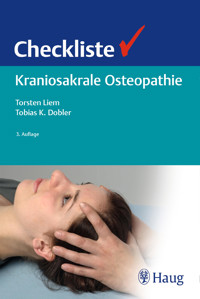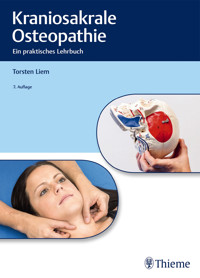
119,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk stellt umfassend die Grundlagen der kraniosakralen Osteopathie aus mechanischer und vitalistischer Sicht dar. Es liefert eine Vielzahl an Techniken zur direkten Umsetzung.
Verfeinern Sie Ihre palpatorischen Fähigkeiten: Der Schwerpunkt liegt auf der Anatomie der Schädelstrukturen und den häufigsten Techniken zu einzelnen Schädelknochen. Ein umfangreiches Bildmaterial erläutert Schritt für Schritt das Vorgehen. Behandlungsreaktionen können exakter beurteilt, homöodynamische Kräfte in den Geweben nachvollzogen und therapeutisch genutzt werden.
Neu
- Neue Behandlungsansätze für das autonome Nervensystem, neue Studien
- Stark überarbeitete und neu verfasste Kapitel zu den Halsfaszien und zur Verbesserung der Zirkulation
- Neues Kapitel zur palpatorischen Annäherung an Hirnstrukturen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1473
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kraniosakrale Osteopathie
Ein praktisches Lehrbuch
Torsten Liem, Christiane Vahle-Hinz, Ralf Vogt
7., überarbeitete und erweiterte Auflage
640 Abbildungen
Der Autor
Torsten Liem, D.O., Osteopath GOsC (GB). Gründung der Osteopathie Schule Deutschland (OSD), Leitung einer osteopathischen Lehrklinik und Entwicklung verschiedener osteopathischer M.Sc.-Programme, u.a. die ersten akademischen Lehrprogramme in Deutschland für Osteopathie und Kinderosteopathie. Registriert im General Osteopathic Council (England) und Mitglied der American Academy of Osteopathy (AAO). Darüber hinaus ist er ausgebildet in Psychotherapie, NLP und Hypnose sowie in Akupunktur, u.a. im Hospital für traditionelle chinesische Medizin, Beijing. Verfasser der Praxis der Kraniosakralen Osteopathie, Herausgeber der Morphodynamik in der Osteopathie und Autor der DVD-Lehrreihe „Rhythmic Balanced Interchange I–V“, Koautor der Werke Checkliste Kraniosakrale Osteopathie, Osteopathie – Die sanfte Lösung von Blockaden, Koherausgeber der Werke Osteopathische Behandlung von Kindern, Leitfaden Osteopathie und Leitfaden viszerale Osteopathie sowie von vielen weiteren Werken. Mitbegründer und ehemaliger Redakteur der Zeitschrift Osteopathische Medizin, Mitglied im Advisory Board des International Journal of Osteopathic Medicine. Vorstand der Europäischen und Deutschen Gesellschaft für Kinderosteopathie.
Mit Hingabe widmet er sich der Verwirklichung osteopathischer Prinzipien in der Praxis und ihrer Verknüpfung mit Prinzipien klassischer chinesischer Medizin, des Yoga sowie psychologischen und energetischen Gesichtspunkten.
Widmung
Für Noak und Sybille
Danksagungen
Besonderer Dank an Chryssa Dardamissis für ihre Mühe und kreativen Einfälle bei der Verwirklichung der Grafiken dieses Buches sowie an Helge Schenk, Friedhelm Kaiser und Karsten Franke für die Realisierung der Fotografien.
Und vielen Dank auch an John E. Upledger D.O., F.A.A.O., Philip Greenman D.O., F.A.A.O., Dr. Louis Philippe Dombard, Dr. Richard Kriebel, Dr. Patrick Coughlin und den verstorbenen Dr. Ernest W. Retzlaff für die Erlaubnis, einige ihrer Fotos veröffentlichen zu dürfen, sowie an Viola Frymann D.O., F.A.A.O., F.C.A., Dr. Zanakis und Dr. Greitz für die Genehmigung, einige Grafiken ihrer Forschung zu publizieren. Besonderer Dank gebührt Dr. André Farasyn D.O., Thomas Glonek Ph.D., Prof. Dr. Yuri Moskalenko, Kenneth E. Nelson, D.O., Nicette Sergueef, D.O. für ihre Unterstützung bei der Darstellung der hypothetischen kranialosteopathischen Modelle in dieser Auflage.
Danken möchte ich insbesondere meinen Lehrern im großen Gebiet der kranialen Osteopathie:
Alan R. Becker D.O., F.A.A.O., F.C.A., für seine Freundschaft und Heranführung an eine zuhörende, offene Palpation,
Viola Frymann D.O., F.A.A.O., F.C.A., der „Grande Dame“ der kranialen Osteopathie, für ihre feinfühligen wissenden Hände und ihre Erfahrung, die sie mir zuteilwerden ließ,
Leopold Busquet D.O., für die vielerlei Erleuchtungen der biomechanischen Zusammenhänge im kraniosakralen System,
Marc Wyvekens D.O., für seinen sehr fundierten anregenden Unterricht in den Grundlagen der kraniosakralen Osteopathie, der weit über das hinausgeht, was man sonst darunter versteht,
Patrick van den Heede D.O., der mich mit seiner Genialität und Intuition, die ich kurze Zeit erleben durfte, nicht nur immer wieder erstaunte, sondern auch sehr inspirierte,
Robert Fulford D.O., F.A.A.O., F.C.A., für seine Weisheit und Wärme, die jede seiner Berührungen begleitete.
Sehe ich Anne Wales D.O., F.A.A.O., F.C.A., in meinen Erinnerungen, sehe ich dem Altwerden als Osteopath sehr gelassen entgegen (dabei bin ich ja noch recht jung). Nicht nur, dass sie auch in den letzten Jahren noch jeden Zuhörer mit ihrer geistigen Auffassung in Bann zog. Es ist so wohltuend, einen Menschen zu sehen, den durch seine Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Hingabe im Leben, im hohen Alter eine scheinbar zeitlose Jugend, Schönheit und einzigartige Ausstrahlung umgibt.
Jim Jealous D.O., F.A.A.O., für seine Vermittlung der Stille und Liebe in Verbindung mit den Rhythmizitäten des Organismus und seine weitreichenden Einblicke in die Selbstheilungskräfte und die Weisheit des Körpers, die weit über die Gewebestrukturen hinausreichen; seine Betrachtungsweisen haben großen Einfluss auf mich ausgeübt.
Richard Feely D.O., F.A.A.O., F.C.A., für die Erläuterungen der neurologischen Aspekte der kraniosakralen Osteopathie,
Herb Miller D.O., F.A.A.O., F.C.A., der mir durch seine Präsenz und einfühlsamen Hände Vertrauen in meine eigenen Hände schenkte,
Thomas Schooley D.O., F.A.A.O., F.C.A., der mir an zwei Nachmittagen in privater Runde viel vom ursprünglichen Geist der Osteopathie näherbrachte,
John Upledger D.O., F.A.A.O., für seine Kreativität und Inspiration, die ich durch die Begegnung mit ihm erfuhr,
Prof. Frank Willard Ph.D., dessen brillante Vorlesungen der anatomisch-physiologischen Zusammenhänge mich zutiefst beeindruckten,
Harold I. Magoun jr. D.O., F.A.A.O., F.C.A., für die Erfahrung, von ihm behandelt worden zu sein.
Sehr inspiriert bin ich von dem Unterricht von Jean Pierre Barral D.O., M.R.O. Nicht nur von seiner einzigartigen Erfahrung, die jede seiner Ausführungen wortlos begleitet, sondern besonders die ungezwungene Art, wie er mich und andere unterstützt, meiner Palpation zu vertrauen und Spaß daran zu haben. In der Tat würde ich ihm fast alles glauben, selbst wenn er mir erzählte, er würde die Farbe der Unterwäsche durch die Kleidung palpieren.
Franz Buzet M.R.E.O., M.S.B.O., verdanke ich sehr, sehr viel. Es ist ein so gutes Gefühl, wenn jemand an einen glaubt.
Ich danke Beatrice Macazaga, die mich vor so vielen Jahren als Freundin und als unfreiwilliger Mutterersatz zur Heilkunde inspirierte.
Fred L. Mitchell jr. D.O., F.A.A.O., F.C.A., ist für mich ein wunderbares Beispiel für einen Lehrer, der gleichzeitig einfühlsam, klar, anschaulich, bescheiden und kompetent ist, sodass er selbst die scheinbar blödeste Frage mit der immer gleichen Anteilnahme und Aufmerksamkeit beantwortet.
Über den Kontakt zu Renzo Molinari D.O., M.R.O., bin ich besonders dankbar. Nicht nur über die großartige Unterstützung seinerseits, sondern weil ich mir keinen kompetenteren, engagierteren und einfühlsameren Präsidenten der European School Of Osteopathy vorstellen könnte.
Artho Wittemann ist mir Begleiter, Therapeut und Freund. Ich danke ihm besonders, mich dabei zu unterstützen, in Berührung mit zahlreichen Facetten meiner selbst zu kommen. Ich bin immer wieder selbst überrascht, welche Seelen in meiner Brust gleichzeitig oder abwechselnd agieren.
Wenn ich jemals der Ansicht war, Osteopathie hätte etwas mit Kraft zu tun, dann hat mich Lawrence H. Jones D.O., F.A.A.O., vom Gegenteil überzeugt. Es war für mich beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit und Anmut, ähnlich der eines Tänzers, Dr. Jones – selbst im hohen Alter – mich berührte, bewegte und behandelte.
Auch John Wernham D.O. möchte ich danken. Er hat mir im Unterricht in persönlicher Runde und in Behandlungen viel über die klassische Osteopathie und die Erfahrungen mit Littlejohn vermittelt.
Paul Chauffour D.O. und Eric Prat D.O. danke ich für ihre Freundschaft und die sehr inspirierende Unterweisung in das Konzept der osteopathischen mechanischen Vernetzung.
Des Weiteren gilt mein Dank auch Philip E. Greenman D.O., F.A.A.O., Robert C. Ward D.O., F.A.A.O., und den vielen anderen Lehrern, die mir Verständnis für die übrigen Bereiche der Osteopathie vermittelten.
Ganz besonders möchte ich auch meinen Freunden Alain Abehsera D.O. M.D., Alan R. Becker D.O., F.A.A.O., F.C.A. (†), Cristian Ciranna-Raab D.O., Bruno Chickly M.D., D.O. (Hon.), Celine Siewert, Christof Plothe D.O., Jenny Parkinson, John Glover D.O., F.A.A.O., Prof. John McPartland D.O., Michel Puylaert D.O., Prof. Dr. Paul Klein D.O., Peter Sommerfeld D.O., Steve Paulus D.O., Uwe Senger D.O., Walter McKone D.O., Zachary Commeaux D.O., F.A.A.O., u.a. für die vielen Stunden des osteopathischen Austauschs, der interessanten und inspirierenden Gespräche, des Verrückt-sein-Dürfens und des Sich-hinterfragen-Lassens danken. Wenn ich meine Augen schließe, dann sind es die Nähe, Offenheit, das gegenseitige „Caring“ und das Vertrauen zu meinen Freunden, die mich wie in einer osteopathischen Familie zu Hause fühlen und wachsen lassen.
Allen meinen Patienten. Jeder von ihnen stellt für mich eine Herausforderung, eine Begegnung und Wachstum dar.
Für die Erlaubnis, ausgewählte Zitate veröffentlichen zu dürfen, bedanke ich mich bei der American Academy of Osteopathy (AAO), bei Dr. Harold I. Magoun jr., Dr. Donald L. Becker, Dr. Anne L. Wales, Dr. Robert C. Fulford, Ronald R. McCatty, beim Droemer Knaur Verlag, Diederichs Verlag, Verlag Hinder und Deelmann, Insel Verlag, Klett-Cotta Verlag, Quintessenz Verlag, Rowohlt Verlag, Scherz Verlag sowie beim Journal of Neurosurgery. Insbesondere möchte ich mich auch bei Stephen J. Noone, Executive Director der AAO, für seine freundliche Unterstützung bedanken. Ganz besonders möchte ich mich beim Georg Thieme Verlag bedanken.
Geleitworte
Torstens Wunsch, ein Geleitwort zu seinem Buch zu schreiben, ehrt mich. Ich bin beeindruckt, wie detailliert und ausführlich er die Materie beschreibt, wie er die Ordnungsprinzipien erfasst, die dem Erlernen der Wissenschaft der Osteopathie zugrunde liegen, und besonders, wie er die Grundprinzipien beschreibt, auf denen die Osteopathie ruht.
Er greift die Idee auf, dass der menschliche Körper auf ein korrektes Funktionieren angelegt ist und dass es nicht die Aufgabe des Therapeuten ist, den Körper zu reparieren. Die Rolle des Arztes besteht darin, den Körper zu ermutigen und darin zu unterstützen, dass er das tut, von dem der Körper selbst weiß, wie er es am besten erreicht, auf welche Art er funktionieren muss und wie er dadurch eine stabile Gesundheit zurückerhält.
Torsten versteht außerdem die grundlegende Wahrheit der Palpation („man fühlt nicht mit den Fingern, sondern mit dem Gehirn über die Finger oder den Teil des Körpers, den der Therapeut benutzt, um Kontakt mit dem Körper des Patienten herzustellen“). Ich bin überzeugt, dass dieses Buch ein Basistext für alle künftigen Studenten der Wissenschaft der Osteopathie sein wird, sobald es im Druck erscheint und den Lesern zugänglich sein wird.
Alan R. Becker D.O., F.A.A.O., F.C.A., ehem. Präsident der American Academy of Osteopathy (AAO)
Glücklicherweise hat Torsten Liem die 3. erweiterte Auflage des Buches über Kraniosakrale Osteopathie fertiggestellt. Es ist wichtig, das Wissen über den menschlichen Kopf allen Osteopathen bekannt zu machen.
Da das gelenkige endoskelettale System des menschlichen Körpers fundamental für die Lebensaktionen im Ganzen ist, birgt die Osteopathie Nützliches für jeden Teil. Es ist erst 60 Jahre her, seit W. G. Sutherland D.O., D. Sc. (Hon.) begann, Osteopathie im kranialen Bereich zu unterrichten. Jetzt werden seine Lehren durch das vorliegende Buch weitergeführt.
Sutherland lehrte, dass das Ziel einer osteopathischen Behandlung ist, einen effizienteren Austausch zwischen allen Flüssigkeiten des Körpers über alle Grenzflächen zu erreichen. Diese Sichtweise beinhaltet die posturale Mechanik ebenso wie den mikroskopischen Bereich.
Anne L. Wales D.O., Herausgeberin der Teachings in the Science of Osteopathy von W. G. Sutherland sowie Contributions of Thought, the Collected Writings of W. G. Sutherland
Vor über einem Jahrhundert suchten A. T. Still und W. G. Sutherland eine ganzheitliche Behandlungsweise. Dem Autor ist es wichtig zu betonen, dass nur aufgrund ihrer Hingabe und ihrer Forschung, ihrer Arbeit und Erfahrung, weitergeführt durch eine Vielzahl weiterer Osteopathen, und aus Idealismus dieses Buch entstehen konnte.
Welche gesundheitsfördernden individuellen Heilmethoden auch immer angewendet werden, unsere Gesundheit und die unserer Kinder lassen sich dennoch langfristig nur aus einem mitfühlenden Verständnis evolutionärer Dynamiken des Menschen und der Menschheit heraus und in Einklang mit unserem Lebensraum und unserer Umwelt verwirklichen.
Vorwort zur 7. Auflage
Die vorliegende Auflage umfasst Reflexionen und Erneuerungen zur Annäherung an die Schädelsphäre aus fast 8 Jahren Praxis, in denen ich mehrfach meine klinischen Annäherungen an die Schädelsphäre verändert habe. So viel Zeit ist seit der letzten veränderten Auflage vergangen. Deshalb nahm die Überarbeitung der vorliegenden 7. Auflage auch über ein Jahr in Anspruch. Alle Kapitel wurden überarbeitet, zum Teil neu abgefasst und/oder stark erweitert.
Wissenschaftliche Diskurse beispielsweise zur Physiologie des Liquor cerebrospinalis (LCS), zu intrakranialen Lymphgefäßen, zu duralen Verbindungen, zu Suturen liefern neue Erkenntnisse und klinische Implikationen. Die Studienlage zu spezifischen Bereichen der kranialen Osteopathie wurde aktualisiert. Dies führte zu zahlreichen neuen Behandlungsmöglichkeiten.
Beispielsweise gibt es neue Erkenntnisse zum Zusammenhang von Kraniosynostosen und Schädelasymmetrien. Studien zu den Schädelknochen haben zu neuen intraossalen und suturalen Behandlungszugängen geführt wie rhythmische Mobilisierung, Low Thrust. Des Weiteren sind neue Erkenntnisse zu klinischen Bezügen in allen Kapiteln eingefügt, z.B. Hinweise auf die antientzündliche Wirkung des linken N. vagus.
Das Konzept „Intention, Energie, Fokus, Resonanz“ wird vorgestellt sowie palpatorische Übungen ergänzt und erweitert. Die Diagnostikprinzipien umfassen außerdem Gestiken des Patienten wie Atmungs- und Geburtsgestiken.
Eine überarbeitete Differenzierung der Behandlungsschritte, ein Abschnitt zu manuellen Regressionsansätzen sowie neue Behandlungsansätze für das autonome Nervensystem und viele weitere Modifikationen finden sich in den Behandlungsprinzipien.
Das Kapitel zu den Halsfaszien wurde völlig überarbeitet. Es umfasst beispielsweise eine neue Differenzierung der Halsfaszien, klinische Bezüge zur Hyaluronsäure und eine Vielzahl weiterer Behandlungstechniken.
Insbesondere die Kapitel zur Behandlung duraler Strukturen (kranial und spinal) sind neu geschrieben worden. Hier werden u.a. Ansätze zur spezifischen Behandlung der Falx cerebri und des Tentorium cerebelli, zur Behandlung der Dura mater spinalis in Bezug zu den subokzipitalen Muskeln, zum Lig. nuchae, zu den Ligg. interspinalia durae matris, zu den Ligg. flava, zum Lig. denticulatum, zum Lig. longitudinale posterius und zu den meningovertebralen Ligamenten, den Duralscheiden der Spinalnerven, der Vaskularisation, der venösen Drainage und zur Innervation der Dura mater spinalis vorgestellt.
Neue osteopathische Zugänge zu Liquorpulsationen und zur Drainage des LCS sowie des Gehirns werden anhand aktueller Forschung diskutiert.
Das Kapitel zur Verbesserung der arteriellen, venösen und lymphatischen Zirkulation des Schädels wurde vollständig überarbeitet und stark erweitert. Es enthält zusätzlich zu den bestehenden weitere Behandlungszugänge für Arterien (A. basilaris, A. occipitalis, Trigonum caroticum, Zerebralarterien), für Venen (V. jugularis interna, V. jugularis externa, V. jugularis anterior, V. facialis, V. ophthalmica superior, V. ophthalmica inferior, Plexus venosus vertebralis, Vv. emissariae), für Zisternen und für lymphathische Strukturen des Gehirns.
Zu guter Letzt wurde außerdem ein umfangreiches Kapitel zur palpatorischen Annäherung an Hirnstrukturen erstellt. Dieses Kapitel beinhaltet, neben palpatorischen Zugängen und Behandlungsmodalitäten für Hirnanteile, ebenso eine Übersicht zur Topografie, Funktion und Störung der jeweiligen Hirnstruktur, spezifische Behandlungszugänge für endokrine Organe der Schädelsphäre sowie viele weitere Hinweise, beispielsweise zum Yakovlevian torque, eine Verziehung des Gehirns nach vorn-links.
Die Zeit ändert alles. Erlauben wir uns, unsere Sichtweisen den Herausforderungen der Zeit anzupassen und unsere Behandlungsansätze, zum Wohle des Patienten, ggf. zu relativieren und neu zu erfahren. Dieses Buch kann Sie dabei begleiten.
Hamburg, im Juli 2018
Torsten Liem
Vorwort zur 4. Auflage
Während der Arbeit an der 4. Auflage habe ich viele Stunden damit verbracht, über die Bedeutung der persönlichen Entwicklung im Heilungsprozess nachzudenken. Auch beschäftigte ich mich mit der Weiterentwicklung einer phänomenologisch orientierten Beschreibung osteopathischer Palpationserfahrungen sowie mit der niemals endenden Aufarbeitung der osteopathischen und medizinischen Literatur zum Thema. Noch zu erwähnen ist der stets anregende Austausch mit vielen Kollegen und Freunden. Deshalb nahm auch die Vorbereitung zur 4. Auflage schließlich so viel Zeit in Anspruch wie die Erstellung der gesamten 1. Auflage.
Sie mögen vielleicht fragen, warum sich so viel Mühe machen und einen Klassiker fast neu schreiben. Die Antwort ist einfach: Alles, was lebt, fließt und verändert sich, und die Osteopathie lebt auch! Aus diesem lebendigen Fließen heraus ist dieses Buch geschrieben.
Das vorliegende Buch wurde vollständig überarbeitet. Zahlreiche neue Erkenntnisse wurden in jedes Kapitel integriert, überholte Ansichten revidiert, bisherige Vorgehensweisen relativiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt. So wird eine umfassendere Sicht der kranialen Arbeit ermöglicht. Der Umfang der 4. Auflage hat sich dabei deutlich erweitert.
So wurde etwa die Darstellung der hypothetischen Modelle vollständig überarbeitet und vertieft, eine Vielzahl neuerer Forschungen integriert, die Bedeutung des Tensegrity in der kranialen Osteopathie erklärt und die geschichtliche Entwicklung kranialer Ansätze dargestellt. Auch habe ich Begrifflichkeiten präzisiert, neue vitalistische Konzepte eingefügt und die Suturenkonfigurationen grundlegend überarbeitet. Das Sakrumkapitel wurde umfassend redigiert und Erkenntnisse der Ossifikationsmodi integriert. Schließlich wurde auch die Schulung des Palpationsempfindens deutlich ergänzt, Diagnostik- und Behandlungskonzepte neu bearbeitet und stark erweitert, ein großer Teil der Techniken umgeschrieben und erweitert und ein neues Kapitel zur Behandlungssequenz und zu Behandlungsreaktionen sowie ein neues Glossar eingefügt.
Aus Platzgründen mussten das Kapitel „Entwicklung des Schädels“ und das Kapitel „Palpation – die Kunst des Fühlens“ weichen. Diese werden in überarbeiteter Form in einer anderen Veröffentlichung erscheinen.
Dieses Buch wird die praktische Arbeit in wesentlichen Aspekten bereichern:
Behandlungsreaktionen können besser beurteilt werden.
Die kraniale Untersuchung des Patienten kann deutlich differenzierter ausgeführt werden.
Der Prozess des bewussten palpatorischen Zuhörens wird nachvollziehbarer.
Die therapeutische Synchronisation mit den homöodynamischen Kräften in den Geweben wird anschaulicher.
Kenntnisse der Wachstumsphasen und Ossifikationsmodi von Knochen verdeutlichen bestimmte Zeitfenster in der Behandlung.
Das genauere Verständnis der Suturen ermöglicht ein adäquateres therapeutisches Vorgehen.
Die Umsetzung der vielfältigen neuen Kenntnisse über Wechselbeziehungen unterstützt das Entstehen neuer palpatorisch-therapeutischer Vorgehensweisen usw.
Das Kapitel über Hypothesen und Untersuchungen zur primären Respiration lädt zur Diskussion ein: Die Entstehung und der Entstehungsort der sog. primär respiratorischen (kraniosakralen) Rhythmen ist gegenwärtig noch ebenso umstritten wie ihre Übertragung im Kranium und im übrigen Körper sowie ihre klinische Bedeutung. Die Hypothesen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen physiologischen Modellen (z.B. Traube-Hering-Mayer-Oszillationen, hirnphysiologische Modelle), biomechanischen Überlegungen aus dem Muskelskelettsystem heraus, populärphysikalischen Erklärungsmodellen, embryologischen (nicht selten relativ unreflektierten) Erklärungsversuchen, Naturmystik und prärationalen magisch-ideologisch-religiösen Betrachtungen. Vieles ist denkbar, weniges gesichert. Das führt zu weitreichenden Vermutungen und bietet auch Raum für extrem spekulative Heilslehren.
Dort, wo man sich physiologischen Fragen zu stellen hätte, findet nicht selten eine Argumentation im Sinne einer Art kranialer Offenbarungslehre statt, während auf der anderen Seite anatomische, physiologische oder embryologische Termini missbraucht werden, um eher religiösen Sichtweisen einen quasi physiologischen Anstrich zu verleihen. Dabei stellen erkenntnistheoretische Fragen, z.B. ob die moderne medizinische Vorgehensweise im Sinne einer exakten Wissenschaft, dem Menschlichen tatsächlich gerecht wird, eine für die Osteopathie zweifelsohne wichtige Fragestellung mit vielen noch zu erarbeitenden Implikationen dar.
Osteopathie ist die Kunst bedeutungsvoller Berührung im therapeutischen Kontext. Die Ausweitung osteopathischer Prinzipien auf den Schädel reicht bis zu Still zurück. Dieser drängte bereits zu Lebzeiten seine herausragende Studentin Charlotte Weaver D.O., eben dies zu tun. Seitdem wurde Weavers und Sutherlands Arbeit von unzähligen Osteopathen fortgeführt. So vertiefte Arbuckle das Konzept der reziproken Spannungsmembran, spezifizierten Frymann und Carreiro die osteopathische Behandlung von Kindern und wurde ein Großteil der von Sutherland in seinen späteren Lebensjahren entwickelten zunehmend vitalistisch orientierten osteopathischen Ansätzen und Begrifflichkeiten, von Becker, Handy, Fulford, Schooley, Chila, Jealous, Blackman, van den Heede, Abehsera u.a. weiterentwickelt.
In den vitalistischen Ansätzen wird versucht, die im Organismus wirkenden homöodynamischen Kräfte palpatorisch zu erfassen und sich mit ihnen zu synchronisieren. Dies umfasst auch die Wahrnehmung der wechselseitigen Dynamik zwischen den subjektiven und objektiven Faktoren vom Selbst/Organismus und seiner Umgebung.
Über die palpatorische Wahrnehmung von Normalität bzw. homöodynamischen Kräften versucht der Osteopath, sich der Ganzheit des Patienten anzunähern. Die erste und wichtigste Grundlage für den Osteopathen ist die sensorische Erfahrung von Normalität bzw. von Gesundheit im Gewebe. Das ist immer auch eine tiefe subjektive Erfahrung, die nach Sutherland besonders in einem Zustand innerer Stille erfahrbar wird.
Ein umfassendes Gewebeverständnis entsteht durch Kenntnis der Gewebe selbst und ihrer Beziehungen zu umgebenden Strukturen, durch das Erlernen der Gewebesprache und der Gewebedifferenzierung sowie durch die Fähigkeit, diese Befunde in einen Gesamtkontext zu stellen.
Ich habe hier versucht, diese für eine erfolgreiche osteopathische Behandlung so fundamentalen Grundlagen für die kraniale Sphäre umfassend und auf hohem didaktischem Niveau darzustellen. Auch die Ausreifung der Einflussnahmen auf jede Art von Gewebe ist unabdingbar. Jedoch sind technische Betrachtungsweisen notwendigerweise auf ein Minimum der unmittelbar erfahrenen Phänomene gegründet. Deshalb sollte es vermieden werden, das Heilungspotenzial durch eine Überfokussierung auf technische Ausführungen zu begrenzen. Ebenso bedeutsam ist die Intention, mit dem Patienten „zu sein“, statt etwas mit ihm oder dem Gewebe „zu tun“ und dem Patienten zu ermöglichen, sich wieder mit einer ihm inhärenten Gesundheit zu verbinden.
Aber: Übernehmen Sie nichts in diesem Buch, nur weil es hier geschrieben steht oder weil andere es sagen. Hören Sie auf Ihre eigenen Zweifel und Fragen, die beim Lesen und bei der Arbeit auftreten, und versuchen Sie diese zu klären. Fühlen Sie sich dazu eingeladen, jedes Diagnostik- und Behandlungsprinzip, jede Technik so zu adaptieren, wie es Ihnen stimmig erscheint. Lassen Sie sich von Ihrem Verantwortungsgefühl Ihrem Patienten gegenüber leiten.
Bleiben Sie gleichzeitig offen für eine veränderte Sicht der Dinge. Auch das, was Sie heute für falsch halten, kann Ihnen zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise richtig erscheinen. Unsere Ansichten von Gesundheit und auch von der Osteopathie sind einem ständigen Wandel unterworfen, der eng mit der gesellschaftlichen Vorstellung von Gesundheit und Krankheit verbunden ist. Deshalb ist dieses Buch auch nicht mehr und nicht weniger als eine Momentaufnahme der kranialen Osteopathie. Welche zeitlosen Wahrheiten dabei zwischen den Zeilen zu lesen sein sollten, bleibt Ihrer Intuition überlassen.
Diese 4. Auflage wurde nicht nur mit einer angemessenen wissenschaftlichen Strenge geschrieben. Sie basiert ferner auf den Grundannahmen von Sutherland und einer Vielzahl weiterer Pioniere sowie auf persönlichen Erfahrungen.
Stills Vision und Intuition einer neuen Medizin ist auch heute erst in ihren Ansätzen verwirklicht, und wir alle sind aufgefordert, daran mitzuwirken und uns von der Tiefe seiner Lehre inspirieren zu lassen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude und Inspiration für Herz, Hand und Kopf beim Lesen und Ihren Patienten eine bedeutungsvolle und heilende Berührung.
Hamburg, im Mai 2005
Torsten Liem
Einleitung
Osteopathie ist für mich eine Kunst, die gleichermaßen die Hände, den Verstand und das Herz miteinbezieht. Insbesondere von Alan Becker, der das Privileg hat, in einem der ersten Kurse von William Garner Sutherland in die kraniale Osteopathie eingewiesen worden zu sein, habe ich gelernt, dass das Wichtigste ist, mit sanfter Aufmerksamkeit zu warten, bis das Gewebe zu sprechen beginnt, zuzuhören, es geschehen zu lassen und einfach da zu sein. Es geht nicht darum, etwas zu machen, sondern im Gegenteil, sich auf das Gewebe und den Patienten einzustimmen und seine ihm eigene Geschichte verstehen zu lernen.
Im Laufe meiner Ausbildungen, oder vielleicht sollte ich besser sagen Einweihungen, wurde ich nicht nur in fluide und energetische Palpationen sowie in die Erspürung embryologischer Bewegungsimpulse eingewiesen, sondern auch der Blick hinter die Strukturen wurde geöffnet – der Blick für das Herz oder den Punkt der Stille des Klienten und das Erspüren der individuellen potenziellen Quelle seiner Gesundheit. Unter Palpation verstanden die alten Lehrer und Meister mehr ein Einstimmen in das, was Sutherland den „Atem des Lebens“ nannte. Dies ist eine äußerst bewusste, sehr sanfte und respektvolle Annäherung an die Ganzheit des Patienten. Die „alten Lehrer“ palpierten nicht nur mit den Händen, sondern öffneten all ihre Sinne, ihren Verstand und ihr Herz, um wahrzunehmen, wie die universelle Atmung des Kosmos ihren Widerhall und individuellen Ausdruck im Klienten und jeder anderen Existenzform findet, um den einzigartigen Geschichten der Gewebe zu lauschen und um feinste Gewebebewegungen, Rhythmizitäten und Spannungen zu erspüren. Alan Becker spazierte z.B. manchen Abend durch die Wälder, um in der Dunkelheit die Schwingungen der Farben der Blütenblätter zu palpieren.
Der therapeutische Impuls besteht eher im Einstimmen auf diese Rhythmen und Energien, die sich in den anatomischen Strukturen und darüber hinaus offenbarten, als in einer rein mechanisch ausgeführten Technik. Der Therapeut tritt in seiner Annäherung an den Patienten so weit zurück und wird so rezeptiv, dass es ihm möglich wird, zu dem mesenchymalen Urmeer, dem Potenzial und dem SINN zu folgen. Hier kann sich der Organismus in einem unmittelbaren Erleben neu orientieren und vom Fulcrum der Krankheit zum Fulcrum der Gesundheit hinüberbewegen.
Viele kraniosakrale Lehrer nehmen heutzutage diese Entdeckungen für sich in Anspruch. Es ist dennoch fair anzumerken, dass dies für Sutherland, besonders in seinen späteren Lebensjahren, und für seine Studenten tägliche Praxis war. Allerdings wurde diese Herangehensweise nur einem kleinen Kreis von Schülern zugänglich gemacht. Als ich Anne Wales, die dieses Jahr das gesegnete Alter von 92 Jahren erreichte, fragte, was das Besondere eines Osteopathen sei, antwortete sie mir ▶ [1]: „Als Osteopath untersuchst du den Körper des Patienten durch deine Hände. Du studierst die Anatomie, damit du verstehen kannst, wie der Körper arbeitet und was das Problem ist, das den Patienten zu dir führt. Du möchtest die Problematik verstehen, bevor du irgendeine Art von Behandlung verordnest. Du möchtest verstehen, was seine Beschwerden sind, die Geschichte seiner Beschwerden, und dann möchtest du herausfinden, worin das Problem hinter seinen Beschwerden besteht.“
In diesem Sinne ist das Buch konzipiert. Es bringt die nötigen embryologischen und anatomischen Grundlagen, die für den Therapeuten die unabdingbare Landkarte für seine Annäherung an den Patienten darstellen. Der gesunde Mensch, das gesunde lebendige Gewebe und die Physiologie sind unsere Wegweiser, um den Patienten in seiner Selbstheilung zu unterstützen. Heutzutage findet die Anwendung kraniosakraler Techniken weit über die Grenzen der Osteopathie hinaus Verbreitung und ergänzt das Handwerkszeug vieler anderer Therapeuten und Therapieansätze. Vielleicht kann das Buch dazu beitragen, Fragen zu klären, Grundlagen, neue Einblicke und Impulse zu vermitteln sowie als Nachschlagewerk zu dienen, damit diese Therapieform erfolgreich in die Praxis integriert werden kann.
Es werden die bisherigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im großen Feld der kraniosakralen Osteopathie dargestellt, auch in der Hoffnung, dass der eine oder andere Anregungen findet, mitzuwirken an der Klärung der noch vielen offenen Fragen. Und vielleicht wird auch etwas vom ursprünglichen Geist und von der Hingabe der alten weisen Lehrer zwischen den Zeilen zu lesen sein. Alle diese Lehrer legten Wert darauf, dass die kraniosakrale Osteopathie nur mithilfe eines fundiert ausgebildeten Lehrers und nicht nur durch ein Buch zu erlernen sei.
Außerdem ist es das Anliegen des Buches, Neugierde zu wecken, sich auf einen Weg zu machen, dessen Ende noch längst nicht erreicht ist, und Vertrauen in die eigenen Hände und Wahrnehmungen zu gewinnen. Im letzten Drittel des Buches werden dem Leser außer Diagnose- und Behandlungsprinzipien kraniale Techniken nähergebracht. Dr. Still, der Begründer der Osteopathie, vermied es meist, seinen Schülern Techniken zu vermitteln, und legte mehr Wert darauf, dass sie die Prinzipien der Organisation des Körpers verstanden. Dr. Sutherland hatte seinen Studenten in seinem ersten zweiwöchigen Kurs ganze drei Techniken gezeigt. Die Techniken sind wie reife Früchte, die dem Therapeuten in die Hände fallen, je mehr er die Fähigkeit der Visualisierung der beteiligten Strukturen und ihre Wechselwirkung meistert, die Diagnose- und Behandlungsprinzipien verinnerlicht und ein Feingefühl in seinen Händen erworben hat. Dann wird er auch in der Lage sein, eigene Techniken zu entwickeln und diese an den jeweiligen Patienten anzupassen. Dazu gehört neben der Bewusstheit für die individuellen Körperenergien auch eine liebevolle Zuwendung zum Patienten.
Ein Lehrer meines Lehrers pflegte nach einem Vortrag stets zu sagen, dass er überzeugt sei, 50% seines Vortrages seien richtig, aber er wüsste leider nicht, welche 50% dies seien. In diesem Sinne wünsche ich jedem Leser viel Freude beim Lesen.
Hamburg, im Frühjahr 1997
Torsten Liem
Verwendete Literatur
[1] Persönliche Mitteilung: Anne Wales, 1996. Zitatveröffentlichung mit Genehmigung von Dr. Wales.
Inhaltsverzeichnis
Kraniosakrale Osteopathie
Ein praktisches Lehrbuch
Der Autor
Widmung
Danksagungen
Geleitworte
Vorwort zur 7. Auflage
Vorwort zur 4. Auflage
Einleitung
Verwendete Literatur
1 Grundlagen der Osteopathie im kranialen Bereich
1.1 Geschichte der kraniosakralen Osteopathie
1.1.1 Beginn der Osteopathie
1.1.2 Grundlagen der Osteopathie
1.2 Prinzipien der Osteopathie
1.2.1 Der Körper ist eine Einheit – als dynamische Interaktion von Körper, Geist, Seele
1.2.2 Der Organismus verfügt über eigene selbstregulative und heilende Kräfte
1.2.3 Struktur und Funktion beeinflussen sich wechselseitig
1.2.4 Die osteopathische Behandlung integriert alle vorher genannten Punkte
1.2.5 Salutogenese und Osteopathie
1.3 Beginn kranialer Ansätze in der Osteopathie
1.3.1 Kraniale Ansätze in der Chiropraktik
1.3.2 Sutherlands Odyssee
1.3.3 Weitere Entwicklung der Osteopathie im kranialen Bereich
1.3.4 Grundlagen der Osteopathie im kranialen Bereich
1.3.5 Primäre Respiration
1.4 Verwendete Literatur
1.5 Weitere Literatur
2 Primär respiratorischer Mechanismus (PRM)
2.1 Inhärente, eigenständige Motilität von Gehirn und Rückenmark
2.2 Fluktuation der zerebrospinalen Flüssigkeit
2.3 Mobilität der intrakranialen und intraspinalen Membranen
2.4 Intrasuturale und intraossale Mobilität der kranialen Knochen
2.5 Unwillkürliche Mobilität des Os sacrum zwischen den Ossa ilii
2.6 Rhythmus des PRM
2.7 Frequenzen des PRM-Rhythmus
2.8 Verwendete Literatur
2.9 Weitere Literatur
3 Rhythmus und Schädel: Messungen, Hypothesen und Studien
3.1 Messungen des kraniosakralen Rhythmus
3.1.1 Frühe Forschungen
3.2 Erklärungsansätze für den Rhythmus des PRM
3.2.1 Rhythmische Bewegung der Ventrikel
3.2.2 Rhythmische Bewegung des Gehirns
3.2.3 Embryologische Bewegungsimpulse
3.2.4 Einfluss des PRM auf die Lungenatmung
3.2.5 Druckausgleichsmodell nach Upledger
3.2.6 Atemrhythmus, Herzrhythmus, vasomotorische Wellen
3.2.7 Muskuläre Einflüsse
3.2.8 Rhythmus als Funktion des neuromuskulären Systems
3.2.9 Lymphpumpe
3.2.10 Gewebe-Druck-Modell (Tissue-Pressure-Modell) nach Norton
3.2.11 Entrainment-Modell nach McPartland und Mein
3.2.12 Lokale Venomotion nach Farasyn und Vanderschueren
3.2.13 Physiologische Basis von CRI und PRM nach Moskalenko, Frymann, Kravchenko und Weinstein
3.2.14 Tensegrity-Modell
3.2.15 Primäre Respiration nach Crisera
3.2.16 Traube-Hering-Mayer-Oszillation (THM-Oszillation) und der kraniale rhythmische Impuls (CRI) nach Nelson, Glonek, Sergueff
3.2.17 Zervikale sympathische Nervenstimulation vermindert den zerebralen Blutfluss
3.2.18 Rhythmus von außerhalb führt zu Resonanzen im Organismus
3.2.19 Retikulärer Rhythmus und CRI
3.2.20 Fazit
3.3 Wissenschaftliche Untersuchungen zum Einfluss kranial-somatischer Dysfunktionen auf die kindliche Entwicklung
3.3.1 Fazit
3.4 Untersuchungen zur Wirkung kraniosakraler Techniken
3.4.1 Fazit
3.5 Palpations-Reliabilitäts-Studien
3.5.1 Fazit
3.6 Verwendete Literatur
3.7 Weitere Literatur
4 Der Schädel
4.1 Deskriptive Anatomie des Kopfskeletts
4.1.1 Calvaria/Schädeldach, Desmokranium
4.1.2 Basis cranii/Schädelbasis, Chondrokranium
4.1.3 Platte Knochen des Schädeldaches
4.1.4 Gesichtsschädel, Viszerokranium
4.2 Verwendete Literatur
4.3 Weitere Literatur
5 Anatomie, Ossifikation und Verbindungen der einzelnen Schädelknochen, des Os sacrum und des Os coccygis
5.1 Os occipitale/Hinterhauptbein
5.1.1 Begrenzung
5.1.2 Anteile
5.1.3 Pars basilaris
5.1.4 Partes laterales (condylares)
5.1.5 Squama occipitalis
5.1.6 Morphologie des Os occipitale nach Rohen
5.1.7 Ossifikation
5.1.8 Muskuläre Verbindungen
5.1.9 Ligamentäre und membranöse Verbindungen
5.1.10 Fasziale Verbindungen
5.1.11 Intra- und extrakraniale Membranen
5.1.12 Beziehungen zu Hirnnerven und Zerebrum
5.1.13 Gefäßverbindungen
5.2 Os sphenoidale/Keilbein
5.2.1 Begrenzung
5.2.2 Anteile
5.2.3 Korpus
5.2.4 Ala minor
5.2.5 Ala major
5.2.6 Proc. pterygoideus
5.2.7 Morphologie des Os sphenoidale nach Rohen
5.2.8 Ossifikation
5.2.9 Hauptwachstumsphasen des Os sphenoidale, postnatal
5.2.10 Muskuläre Verbindungen
5.2.11 Ligamentäre Verbindungen
5.2.12 Fasziale Verbindungen
5.2.13 Intrakraniale Membranen
5.2.14 Beziehungen zu Hirnnerven und Zerebrum
5.2.15 Verbindungen zum endokrinen System
5.2.16 Gefäßverbindungen
5.3 Os ethmoidale/Siebbein
5.3.1 Begrenzung
5.3.2 Anteile
5.3.3 Lamina cribrosa
5.3.4 Lamina perpendicularis
5.3.5 Labyrinthus ethmoidalis
5.3.6 Morphologie Os ethmoidale
5.3.7 Ossifikation
5.3.8 Intrakraniale Membranen
5.3.9 Beziehungen zu Hirnnerven
5.3.10 Gefäßverbindungen
5.4 Vomer/Pflugscharbein
5.4.1 Begrenzung
5.4.2 Anteile
5.4.3 Ossifikation
5.5 Os frontale/Stirnbein
5.5.1 Begrenzung
5.5.2 Anteile
5.5.3 Facies externa
5.5.4 Facies interna
5.5.5 Sinus frontalis/Stirnhöhle
5.5.6 Morphologie des Os frontale
5.5.7 Ossifikation
5.5.8 Muskuläre Verbindungen
5.5.9 Fasziale Verbindungen
5.5.10 Intrakraniale Membranen
5.5.11 Beziehungen zu Hirnnerven und Zerebrum
5.5.12 Gefäßverbindungen
5.6 Os temporale/Schläfenbein
5.6.1 Begrenzung
5.6.2 Anteile
5.6.3 Pars squamosa
5.6.4 Pars mastoidea
5.6.5 Pars petrosa
5.6.6 Pars tympanica
5.6.7 Ränder
5.6.8 Morphologie des Os temporale nach Rohen
5.6.9 Ossifikation
5.6.10 Muskuläre Verbindungen
5.6.11 Ligamentäre Verbindungen
5.6.12 Fasziale Verbindungen
5.6.13 Intrakraniale Membranen
5.6.14 Beziehungen zu Hirnnerven und Zerebrum
5.6.15 Gefäßverbindungen
5.7 Os parietale/Scheitelbein
5.7.1 Begrenzung
5.7.2 Anteile
5.7.3 Facies externa
5.7.4 Facies interna
5.7.5 Ränder
5.7.6 Winkel
5.7.7 Morphologie des Os parietale und des Schädeldaches nach Rohen
5.7.8 Ossifikation
5.7.9 Muskuläre Verbindungen
5.7.10 Fasziale Verbindungen
5.7.11 Intrakraniale Membranen
5.7.12 Beziehungen zu Hirnnerven und Zerebrum
5.7.13 Gefäßverbindungen
5.8 Maxilla/Oberkiefer
5.8.1 Begrenzung
5.8.2 Anteile
5.8.3 Korpus
5.8.4 Proc. frontalis
5.8.5 Proc. zygomaticus
5.8.6 Proc. palatinus
5.8.7 Proc. alveolaris
5.8.8 Morphologie der Maxilla nach Rohen
5.8.9 Ossifikation
5.8.10 Muskuläre Verbindungen
5.8.11 Fasziale Verbindungen
5.8.12 Beziehungen zu Hirnnerven
5.8.13 Gefäßverbindungen
5.9 Os palatinum/Gaumenbein
5.9.1 Begrenzung
5.9.2 Anteile
5.9.3 Lamina horizontalis
5.9.4 Lamina perpendicularis
5.9.5 Ossifikation
5.9.6 Muskuläre Verbindungen
5.9.7 Fasziale Verbindungen
5.9.8 Beziehungen zu Hirnnerven
5.9.9 Gefäßverbindungen
5.10 Os zygomaticum/Jochbein
5.10.1 Begrenzung
5.10.2 Anteile
5.10.3 Flächen
5.10.4 Winkel
5.10.5 Ränder
5.10.6 Morphologie des Os zygomaticum nach Rohen
5.10.7 Ossifikation
5.10.8 Muskuläre Verbindungen
5.10.9 Fasziale Verbindungen
5.10.10 Beziehungen zu Hirnnerven
5.11 Mandibula/Unterkiefer
5.11.1 Begrenzung
5.11.2 Anteile
5.11.3 Korpus
5.11.4 Ramus mandibulae
5.11.5 Morphologie der Mandibula nach Rohen
5.11.6 Ossifikation
5.11.7 Muskuläre Verbindungen
5.11.8 Ligamentäre Verbindungen
5.11.9 Fasziale Verbindungen
5.11.10 Beziehungen zu Hirnnerven
5.11.11 Gefäßverbindungen
5.11.12 Beziehungen zu Weichteilen
5.12 Os nasale/Nasenbein
5.12.1 Begrenzung
5.12.2 Anteile
5.12.3 Ossifikation
5.13 Os lacrimale/Tränenbein
5.13.1 Begrenzung
5.13.2 Anteile
5.13.3 Ossifikation
5.14 Concha nasalis inferior
5.14.1 Verbindungen
5.14.2 Anteile
5.14.3 Ossifikation
5.15 Os hyoideum/Zungenbein
5.15.1 Anteile
5.15.2 Ossifikation
5.15.3 Muskuläre Verbindungen
5.15.4 Ligamentäre Verbindungen
5.15.5 Fasziale Verbindungen
5.15.6 Beziehungen zum Endokrinum
5.16 Os sacrum/Kreuzbein
5.16.1 Begrenzung
5.16.2 Anteile
5.16.3 Oberseite
5.16.4 Unterseite
5.16.5 Facies pelvina
5.16.6 Facies dorsalis
5.16.7 Pars lateralis
5.16.8 Ossifikation
5.16.9 Muskuläre Verbindungen
5.16.10 Ligamentäre Verbindungen
5.16.11 Intraspinale Verbindungen
5.16.12 Nervale Verbindungen
5.16.13 Gefäßverbindungen
5.16.14 Beziehungen zu Weichteilen
5.17 Os coccygis/Steißbein
5.17.1 Ossifikation
5.17.2 Muskuläre Verbindungen
5.17.3 Ligamentäre Verbindungen
5.17.4 Nervale Verbindungen
5.17.5 Beziehungen zu Weichteilen
5.18 Verwendete Literatur
5.19 Weitere Literatur
6 Suturen
6.1 Aufbau, Form und Dysfunktion der Suturen
6.1.1 Aufbau der Suturen
6.1.2 Suturen und Nerven
6.1.3 Funktion der Suturen
6.1.4 Dysfunktion der Suturen
6.1.5 Synchondrosen, Syndesmosen und Formen der Suturen
6.2 Übung zur Palpation der Suturen
6.2.1 Bregma
6.2.2 Sutura coronalis
6.2.3 Sutura sagittalis, Vertex, Lambda
6.2.4 Asterion
6.2.5 Sutura lambdoidea
6.2.6 Sutura occipitomastoidea
6.2.7 Sutura parietomastoidea
6.2.8 Sutura squamosa
6.2.9 Sutura sphenosquamosa
6.2.10 Sutura frontozygomatica
6.2.11 Sutura sphenofrontalis
6.2.12 Sutura sphenoparietalis
6.2.13 Pterion
6.2.14 Art. temporomandibularis
6.2.15 Sutura temporozygomatica
6.2.16 Sutura zygomaticomaxillaris
6.2.17 Sutura frontonasalis, Sutura frontomaxillaris, Sutura frontolacrimalis
6.2.18 Sutura internasalis, Sutura nasomaxillaris
6.2.19 Sutura lacrimomaxillaris
6.2.20 Sutura intermaxillaris
6.2.21 Sutura metopica
6.2.22 Sutura palatina transversa
6.2.23 Sutura palatina mediana der Maxilla und des Os palatinum
6.3 Suturale Verbindungen der Schädelknochen
6.3.1 Os occipitale
6.3.2 Os sphenoidale
6.3.3 Os ethmoidale
6.3.4 Vomer
6.3.5 Os frontale
6.3.6 Os temporale
6.3.7 Os parietale
6.3.8 Maxilla
6.3.9 Os palatinum
6.3.10 Os zygomaticum
6.3.11 Mandibula
6.3.12 Os nasale
6.4 Verwendete Literatur
6.5 Weitere Literatur
7 Hirn- und Rückenmarkshäute
7.1 Wachstumsdynamiken der Dura nach Blechschmidt
7.2 Intrakraniales Membransystem
7.3 Pia mater (weiche Hirnhaut)
7.3.1 Arachnoidea (Spinngewebehaut)
7.3.2 Dura mater (harte Hirnhaut)
7.3.3 Horizontales und vertikales Duralsystem
7.4 Extrakraniales Membransystem
7.4.1 Pia mater spinalis
7.4.2 Arachnoidea spinalis
7.4.3 Dura mater spinalis
7.5 Gefäßversorgung der Meningen
7.5.1 Intrakranial
7.5.2 Intraspinal
7.6 Innervation der Meningen
7.6.1 Intrakranial
7.6.2 Intraspinal
7.7 Aufgaben des Duralmembransystems
7.8 Reziproke Spannungsmembran
7.8.1 Sutherland-Fulcrum
7.8.2 Fünfzackiger Durastern
7.9 Offene Fragestellungen
7.10 Verwendete Literatur
7.11 Weitere Literatur
8 Vaskularisation und Lymphabflüsse des Schädels
8.1 Arterielles System
8.1.1 A. carotis externa
8.1.2 A. carotis interna
8.1.3 A. vertebralis
8.1.4 A. basilaris
8.1.5 Circulus arteriosus cerebri Willisii
8.1.6 Arterien des Großhirns
8.1.7 Arterien des Kleinhirns
8.1.8 Arterien der Meningen
8.2 Venöses System
8.2.1 Sinus venosi durales
8.2.2 Median gelegene venöse Blutleiter
8.2.3 Lateral gelegene venöse Blutleiter
8.2.4 Venöse Verbindungen
8.2.5 Venöse Thermoregulation
8.2.6 Schmerzempfindung der Sinus durales und der Hirnvenen
8.3 Lymphatisches System
8.3.1 Funktion des Lymphsystems
8.3.2 Faktoren für Stauungen des Lymphsystems
8.3.3 Lymphgefäße im Gehirn
8.3.4 Lymphabflusswege des Kopfes und Halses
8.4 Primo-Gefäßsystem
8.5 Verwendete Literatur
8.6 Weitere Literatur
9 Anatomie und Physiologie der Hirnventrikel und des Liquor cerebrospinalis
9.1 Liquorräume
9.1.1 Innere Liquorräume (Ventrikel), intrakranial
9.1.2 Äußere Liquorräume, intrakranial
9.1.3 Äußere Liquorräume der Wirbelsäule
9.2 Physiologie des Liquor cerebrospinalis
9.2.1 Zusammensetzung und pH-Wert
9.2.2 Liquorproduktion
9.2.3 Rückresorption des Liquor cerebrospinalis
9.2.4 Interstitielle Flüssigkeit (ISF) und glymphatisches System
9.2.5 Regulation und funktionelle Einheit
9.2.6 Perivaskuläre Drainagefunktion
9.3 Liquorzirkulation
9.3.1 Liquorpulsationen als Resultat venöser Einflüsse
9.3.2 Liquorpulsationen als Resultat venöser und arterieller Einflüsse
9.3.3 Liquorpulsationen als Resultat arterieller Einflüsse
9.3.4 Kardiovaskuläre, respiratorische und vasomotorische Einflüsse auf die Liquorpulsation
9.3.5 Ursprünge der Liquorpulsationen in thalamischen Nuklei und im Kleinhirn
9.3.6 Verlauf des Liquorflusses
9.3.7 Weitere Einflüsse auf die Hydrodynamik des Liquor cerebrospinalis
9.4 Hormonelle Einflüsse
9.5 Vegetative Einflüsse
9.6 Liquor und Lymphflüssigkeit
9.7 Glymphatisches System: Austausch zwischen Liquor cerebrospinalis und interstitieller Flüssigkeit
9.8 Wechselbeziehung zwischen LCS und der interstitiellen Flüssigkeit (ISF)
9.9 Schlaf und Liquor cerebrospinalis
9.10 Immunprivileg des ZNS
9.11 Blut-Hirn-Schranke mit speziellem Fokus auf die Perizyten
9.12 Liquor und Spinalnerv
9.13 Periphere LCS-Ausstrombahn als Erklärung für Berührungs- bzw. Schmerzüberempfindlichkeit?
9.14 Pathologische Störungen des Liquor cerebrospinalis
9.15 Aufgaben des Liquor cerebrospinalis
9.16 Fazit
9.17 Verwendete Literatur
9.18 Weitere Literatur
10 Biomechanische und entwicklungsdynamische Betrachtungen zur Schädelknochenmobilität/-flexibilität
10.1 Faktoren der Schädelknochenmobilität
10.1.1 Biegsamkeit bzw. Flexibilität jedes einzelnen Knochens
10.1.2 Mobilität in den Suturen
10.1.3 Beweglichkeit der Dura
10.1.4 Außerkraniale Spannungsverhältnisse der Faszien, Sehnen und Bänder
10.2 Analogie des Schädels zur Wirbelsäule
10.2.1 Offene Fragen
10.3 Biomechanische Betrachtungen zur Schädelknochenmobilität/-flexibilität (inklusive weiterer Körperanteile)
10.3.1 Inspiratorische Phase
10.3.2 Exspiratorische Phase
10.3.3 Beziehungen der Schädelknochen zueinander
10.3.4 Hirnhemisphären
10.3.5 Reziproke Spannungsmembran
10.3.6 Adaptation der in den Medianen gelegenen Schädelknochen
10.3.7 Adaptation der paarigen Schädelknochen
10.3.8 Adaptation der Gesichtsknochen
10.3.9 Adaptation des Os sacrum und Os coccygis
10.3.10 Bewegung weiterer Körperstrukturen
10.4 Entwicklungsdynamische Betrachtungen zur Schädelknochenmobilität/-flexibilität
10.4.1 Os occipitale
10.4.2 Os sphenoidale
10.4.3 Os ethmoidale
10.4.4 Vomer
10.4.5 Os temporale
10.4.6 Os frontale
10.4.7 Os parietale
10.4.8 Maxilla
10.4.9 Os palatinum
10.4.10 Os zygomaticum
10.4.11 Os lacrimale
10.4.12 Mandibula
10.5 Weitere Betrachtungen
10.6 Verwendete Literatur
10.7 Weitere Literatur
11 Praxis der Palpation
11.1 Methodik der Palpation
11.2 Die Praxis des Palpierens
11.2.1 Günstige Bedingungen schaffen
11.2.2 Vorbereitung des Therapeuten
11.2.3 Vorbereitung des Patienten
11.2.4 Arbeitshaltung
11.2.5 Position der Finger
11.2.6 Kontaktaufnahme
11.2.7 Fokus der Aufmerksamkeit im Brustbereich
11.2.8 Intention, Energie, Fokus, Resonanz
11.2.9 Interpretation des Wahrgenommenen
11.2.10 Hinweis
11.2.11 Einige Tipps für den Anfang
11.2.12 Übungen zur Schulung des Palpationsempfindens
11.3 Verwendete Literatur
11.4 Weitere Literatur
12 Diagnoseprinzipien
12.1 Anamnese
12.1.1 Erblich bedingte oder epigenetisch übertragene Einflüsse
12.1.2 Einflüsse während der Schwangerschaft
12.1.3 Anzahl und Verlauf der vorherigen Schwangerschaften
12.1.4 Geburtsvorgang
12.1.5 Dauer der Geburt
12.1.6 Begebenheiten bei der Geburt
12.1.7 Erscheinung und Verhalten des Neugeborenen
12.1.8 Funktionsstörungen
12.1.9 Entwicklung des Kindes
12.1.10 Schwere Krankheiten in der Kindheit
12.1.11 Schwere Erkrankungen im Erwachsenenalter
12.1.12 Störungen am Schädel
12.1.13 Traumata
12.1.14 Symptom- und Schmerzcharakter sowie deren Lokalisation
12.1.15 Status praesens/Erhebung der momentanen Symptome
12.1.16 Aktivitäten des Patienten
12.1.17 Psychischer Status, soziales Umfeld, Familienanamnese
12.1.18 Bisher durchgeführte Therapien
12.1.19 Umstände, die eine Krankheit aufrechterhalten
12.2 Inspektion
12.2.1 Gestik
12.2.2 Schädelform
12.2.3 Schädelform im kranialen Modell
12.3 Palpation
12.3.1 Palpation bioenergetischer Felder
12.3.2 Hörtest nach Barral
12.3.3 Thermische Diagnose nach Barral
12.3.4 Palpation der Form (nach Magoun)
12.3.5 Palpatorische Befunde an der Sutur nach Pick
12.3.6 Abnorme Empfindungen und Schmerz in der Region der Sutur nach Pick
12.3.7 Palpation einzelner Strukturmerkmale
12.3.8 Palpation der Gewebedichte
12.3.9 Palpation der Gewebeelastizität
12.3.10 Lokaler Druckschmerz
12.3.11 Palpation inhärenter rhythmischer adaptiver Spannungsvariation
12.3.12 Palpation der Beweglichkeit
12.3.13 Ungerichtete Palpation inhärenter Faszienspannungen
12.3.14 Palpatorische Differenzialdiagnostik I – Unterscheidung der Ebene der Dysfunktion
12.3.15 Palpatorische Differenzialdiagnostik II – Befundung von Wechselwirkungen und Prioritäten
12.3.16 Diagnostik der Dura
12.3.17 Palpation der Fluidabewegungen
12.3.18 Erspüren der räumlichen Organisation
12.4 Verwendete Literatur
12.5 Weitere Literatur
13 Behandlungsprinzipien
13.1 Zu beachtende Faktoren bei der Behandlung
13.1.1 Allgemeine Hinweise
13.1.2 Kontraindikationen
13.2 Behandlungsschritte und Fulcrum
13.3 Manuelle Regression, Erinnern
13.4 Aufmerksamkeit in der Palpation
13.4.1 Fokus der Aufmerksamkeit
13.4.2 Verlagerung der Aufmerksamkeit
13.5 Bedeutung der Stille in der Behandlung
13.6 Spezielle Behandlungsprinzipien
13.7 Haltung
13.8 Ansatz der Balanced Tension
13.9 Point of Balanced Membranous Tension (PBMT)
13.9.1 Bedeutung der Ligamente/Membranen
13.9.2 Einstellen eines PBMT
13.9.3 Einstellen eines lokalen, regionalen und globalen Point of Balanced Tension (PBT)
13.10 Dynamic Balanced Tension (DBT)
13.11 Balanced Fluid Tension (BFT) nach Jealous
13.12 Balanced Electrodynamic Tension (BET)
13.13 Weitere Methoden zum Erreichen einer Balanced Tension
13.13.1 Kontraindikationen
13.14 Übertreibung (Exaggeration)
13.14.1 Biomechanischer Ansatz
13.14.2 Schematische Darstellung der Technik
13.14.3 Vitalistischer Ansatz
13.15 Direkte Technik
13.15.1 Indikationen
13.15.2 Kontraindikationen
13.15.3 Schematische Darstellung der Technik
13.15.4 Vitalistischer Ansatz
13.16 Auseinanderziehen (Disengagement)
13.16.1 Indikation
13.16.2 Biomechanischer Ansatz
13.16.3 Vitalistische Ansätze
13.16.4 Spontanes Disengagement
13.17 Kompression/Dekompression
13.17.1 Biomechanischer Ansatz
13.17.2 Vitalistische Ansätze
13.18 Entgegengesetzte physiologische Bewegung
13.18.1 Vitalistischer Ansatz
13.19 Intraossale Behandlung
13.20 Recoil-Techniken
13.21 Low Thrust
13.22 Viele-Hände-Technik (Multiple Hand Technique)
13.23 Unterstützung der Selbstheilungskräfte
13.23.1 Unterstützung durch Fluidimpulse
13.23.2 Unterstützung durch die pulmonale Atmung
13.23.3 Unterstützung durch das myofasziale System
13.24 Ausgleich des autonomen Nervensystems
13.24.1 Osteopathische herzfokussierte Palpation
13.24.2 Osteopathischer „Felt Sense“
13.24.3 Schmetterlingsumarmung
13.24.4 Neutraler Zustand des Patienten nach Jealous
13.25 Weitere Behandlungsansätze
13.25.1 Komplexe Wellenformen nach Abehsera
13.25.2 Behandlung der Felder nicht physikalischer Energie
13.25.3 Erspüren der Gesundheit des Patienten I
13.25.4 Erspüren der Gesundheit des Patienten II
13.26 Zusätzliche Behandlungshinweise
13.27 Verwendete Literatur
13.28 Weitere Literatur
14 Behandlungssequenz und Behandlungsreaktionen
14.1 Sequenz der Behandlung
14.2 Behandlungsreaktionen
14.2.1 Behandlungskomplikationen
14.2.2 Mögliche Ursachen für Behandlungskomplikationen
14.2.3 Deutliche Besserung oder Auflösung der Beschwerden
14.2.4 Beschwerdefreies oder beschwerdeärmeres Intervall
14.2.5 Passagere Verschlimmerung
14.2.6 Passagere Verschlimmerung ohne Besserung
14.2.7 Passagere Verschlimmerung und Regressionsphänomene mit Besserung
14.2.8 Distanzreaktion
14.2.9 Sofortige Beschwerdefreiheit
14.2.10 Sofortige Beschwerdefreiheit mit unmittelbarer Rückkehr der Symptomatik
14.2.11 Spätreaktion
14.2.12 Merkmale eines Prozesses in Richtung Gesundheit
14.2.13 Dauer und Häufigkeit der Behandlungen
14.2.14 Reharmonisierende Griffe
14.3 Verwendete Literatur
15 Allgemeine Kopf- und Sakrumpalpation
15.1 Kopfpalpation
15.1.1 Schädeldachhaltung nach Sutherland
15.1.2 Okzipitosphenoidale Palpation nach Becker
15.1.3 Okzipitosphenoidale Palpation nach Upledger
15.1.4 Sphenookzipitale Palpation nach Magoun
15.1.5 Frontookzipitale Palpation nach Sutherland
15.2 Kopf- und Sakrumpalpation
15.2.1 Gleichzeitige Palpation am Schädel und am Sakrum
15.3 Sakrumpalpation
15.3.1 Palpation am Os sacrum
15.4 Weitere Literatur
16 Anatomie und Behandlung transversaler Diaphragmen
16.1 Funktion der Faszien
16.1.1 Beeinflussung der Fließeigenschaft von Hyaluronsäure im Bereich der Faszien durch manuelle Techniken
16.1.2 Feder- und Stoßdämpfermodell
16.1.3 Fasziale Organisation
16.2 Funktionelle Dreiecke
16.2.1 Diaphragmale Begrenzung
16.2.2 Unteres funktionelles Dreieck
16.2.3 Mittleres funktionelles Dreieck
16.2.4 Oberes funktionelles Dreieck
16.3 Anatomie der Diaphragmen
16.3.1 Beckendiaphragma
16.3.2 Thorakolumbales Diaphragma (Zwerchfell)
16.3.3 Zervikothorakales Diaphragma
16.3.4 Halsfaszien
16.3.5 Zentrale Sehne
16.3.6 Kopffaszien
16.3.7 Os hyoideum
16.3.8 Kraniozervikales Diaphragma (Atlantookzipitalgelenk)
16.3.9 Weitere transversal verlaufende Strukturen
16.4 Behandlung der Diaphragmen
16.4.1 Behandlungsprinzipien
16.4.2 Unwinding-Technik
16.4.3 Faszientechnik nach Becker
16.4.4 Technik für die Beckendiaphragmen
16.4.5 Technik für das thorakolumbale Diaphragma
16.4.6 Alternative Technik für das thorakolumbale Diaphragma und die unteren Rippen
16.4.7 Technik für das zervikothorakale Diaphragma I
16.4.8 Technik für das zervikothorakale Diaphragma II
16.4.9 Alternative: Recoil-Technik für den oberen Thoraxbereich
16.5 Techniken für die Halsfaszien
16.5.1 Befunderhebung im Bereich der Halsfaszien
16.5.2 Allgemeine Technik für die Halsfaszien
16.5.3 Technik zur Spannungslösung des Platysmas
16.5.4 Technik zur Spannungslösung des Platysmas, Variante
16.5.5 Spannungslösung der Galea aponeurotica
16.5.6 Testung der supra- und retrohyoidalen Muskulatur
16.5.7 Technik zur Spannungslösung der suprahyoidalen Muskulatur
16.5.8 Technik zur Spannungslösung der Lamina superficialis nach Buset
16.5.9 Technik für die Lösung der Lamina media (praetrachealis) und der viszeralen Loge
16.5.10 Technik zur Spannungslösung der interpterygoidalen Aponeurose
16.5.11 Technik zur Spannungslösung der Lamina thyropericardia
16.5.12 Technik zur Spannungslösung des vaskulären Kompartments
16.5.13 Technik für die Lösung der vorderen Halsmuskulatur und der viszeralen Loge gegenüber der Lamina praevertebralis nach Buset
16.5.14 Technik für die Lösung der anterioren Anteile der Lamina profunda (Lamina praetrachealis)
16.5.15 Technik für die prävertebralen Muskeln (M. rectus capitis anterior, M. longus capitis, M. longus colli)
16.6 Techniken für das Os hyoideum
16.6.1 Grundpositionen
16.6.2 Strukturelle Manipulation
16.6.3 Funktionelle Ausführung
16.6.4 Biomechanische Ausführung: indirekte und direkte Technik
16.6.5 Suprahyoidale Muskulatur
16.6.6 M. mylohyoideus
16.6.7 M. digastricus (Venter anterior)
16.6.8 M. digastricus (Venter posterior)
16.6.9 M. stylohyoideus/Lig. stylohyoideum
16.6.10 Technik für den M. omohyoideus
16.6.11 Os hyoideum – Skapula
16.6.12 Os hyoideum – Cartilago thyroidea
16.6.13 Os hyoideum – Sternum (Herz)
16.7 Techniken für das Atlantookzipitalgelenk
16.7.1 Technik für das Atlantookzipitalgelenk
16.7.2 Alternative Technik I
16.7.3 Alternative Technik II
16.7.4 Fahrstuhltechnik
16.8 Allgemeine Technik zum Ausgleich der Schädel-, Thorax-, Bauch- und Beckenaktivität
16.8.1 Ausgleich der Schädel-, Thorax-, Bauch- und Beckenaktivität
16.9 Technik zur Harmonisierung des Beckenbodens, des Zwerchfells und des intrakranialen Diaphragmas
16.9.1 Test für das intrakraniale Diaphragma
16.9.2 Technik für das intrakraniale Diaphragma
16.9.3 Beckenbodentest
16.9.4 Beckenbodentechnik
16.10 Verwendete Literatur
16.11 Weitere Literatur
17 Anatomie und Behandlung der Sakralgelenke
17.1 Anatomie und Dysfunktion
17.1.1 Iliosakralgelenk
17.1.2 Dysfunktionen am Sakrum
17.1.3 Okzipitosakraler Einfluss
17.1.4 Sakrookzipitaler Einfluss
17.1.5 Sakrum-Becken-Beziehung
17.1.6 Zentrale Faszienkette des Körpers
17.1.7 Sakrum-Thorax-Beziehung
17.1.8 Intraossale Dysfunktion
17.1.9 Muskuläre Dysfunktionen
17.1.10 Beziehung zwischen Sakrum und Organen
17.1.11 Neurologische Beziehungen
17.1.12 Vaskuläre Verbindungen
17.1.13 Weitere Einflüsse
17.1.14 Kompressionen
17.2 Behandlung des lumbosakralen Gelenks
17.2.1 Dekompression des lumbosakralen Übergangs
17.2.2 Alternative Technik für die L5/S1-Dekompression I
17.2.3 Alternative Technik für die L5/S1-Dekompression II (nach Frymann)
17.2.4 Alternative Technik für die L5/S1-Dekompression III
17.2.5 Alternative Technik für die L5/S1-Dekompression IV
17.3 Testung und Behandlung des iliosakralen Gelenks
17.3.1 Testung der Iliosakralgelenke
17.3.2 Befreiung des Iliosakralgelenks
17.3.3 Alternative Technik für die Befreiung des Iliosakralgelenks
17.4 Behandlung des sakrokokzygealen Gelenks
17.4.1 Befreiung des sakrokokzygealen Gelenks
17.5 Verwendete Literatur
17.6 Weitere Literatur
18 Techniken zur Verbesserung der Zirkulation
18.1 Behandlung der Arterien
18.1.1 Einleitung
18.1.2 Übersicht der Arterien im Gehirn
18.1.3 Allgemeiner Behandlungsansatz
18.1.4 Technik für die A. carotis communis in Anlehnung an Barral, modifiziert
18.1.5 Technik für die A. carotis interna in Anlehnung an Barral, modifiziert
18.1.6 Technik für die A. carotis externa in Anlehnung an Barral
18.1.7 Technik für die A. vertebralis nach Barral
18.1.8 Technik für die A. basilaris
18.1.9 Technik für die A. occipitalis
18.1.10 Technik für das Trigonum caroticum
18.1.11 Technik für die A. cerebri anterior
18.1.12 Technik für die A. cerebri media
18.1.13 Technik für die A. cerebri posterior
18.2 Behandlung des Venensystems
18.2.1 Einleitung
18.2.2 Allgemeiner Behandlungsansatz
18.2.3 Technik für die V. jugularis interna
18.2.4 Technik für die V. jugularis externa
18.2.5 Technik für die V. jugularis anterior
18.2.6 Technik für die V. facialis
18.2.7 Technik für die V. ophthalmica superior
18.2.8 Technik für die V. ophthalmica inferior
18.2.9 Technik für die V. occipitalis
18.2.10 Technik für den Plexus venosus vertebralis
18.2.11 Technik für den Plexus basilaris und Sinus marginalis
18.3 Sinus-venosus-Techniken
18.3.1 Allgemeiner Behandlungsansatz
18.3.2 Technik für den Confluens sinuum nach Frymann
18.3.3 Technik für den Sinus occipitalis
18.3.4 Technik für den Sinus transversus und Sinus rectus nach Frymann
18.3.5 Technik für den Sinus sagittalis superior nach Frymann
18.3.6 Technik für den Sinus sigmoideus
18.3.7 Technik für den Sinus petrosus inferior
18.3.8 Technik für den Sinus petrosus superior
18.3.9 Technik für den Sinus cavernosus
18.4 Techniken für die Vv. emissariae in Anlehnung an J.P. Barral
18.5 Behandlung des Lymphsystems
18.5.1 Lymphgefäße im Gehirn und allgemeiner Behandlungsansatz
18.5.2 Durale Techniken, Sinus-venosus-Techniken, Drainage zervikaler Lymphknoten, Nackentechniken, LCS-Pulsationen
18.5.3 Spannungslösung im zervikothorakalen Diaphragma
18.5.4 Recoil-Technik am oberen zervikothorakalen Übergang
18.5.5 Lösen faszialer Spannungen
18.5.6 Lösen von Zwerchfellspannungen (= primäre lymphatische Pumpe)
18.5.7 Verbesserung des Lymphabflusses in inneren Organen
18.5.8 Lymphatische Pumpe im Brustbereich
18.5.9 Lymphatische Pumpe im Bauchbereich
18.5.10 Lymphatische Pumpe der Füße
18.5.11 Drainage der tiefen zervikalen Lymphgefäße
18.5.12 Pumptechnik am Kranium nach Bjornaes
18.5.13 Technik zur Lymphflussverbesserung im Kopfbereich
18.5.14 Selbsthilfetechnik zur Anregung des Lymphflusses
18.6 Ansatz zur Behandlung von Primo-Gefäßen im Kopf-Nacken-Bereich
18.7 Verwendete Literatur
18.8 Weitere Literatur
19 Funktionsstörungen der Schädelbasis
19.1 Mögliche Ursachen für Störungen an der Schädelbasis
19.1.1 Schädeltraumata
19.1.2 Hypertone Spannungen der Nackenmuskeln
19.1.3 Intrakraniale Spannungen der Dura
19.1.4 Suturale Restriktion der Schädelknochen
19.1.5 Unfälle und Stürze auf das Os sacrum oder Os coccygis
19.1.6 Viszerale Dysfunktion
19.1.7 Muskuloskelettale Dysfunktion
19.2 Dysfunktionen der Synchondrosis sphenoocipitalis (SSB)
19.2.1 Übersicht
19.2.2 Flexionsdysfunktion
19.2.3 Extensionsdysfunktion
19.2.4 Torsionsdysfunktion
19.2.5 Lateralflexion-Rotation (LFR)
19.2.6 Superior Vertical Strain
19.2.7 Inferior Vertical Strain
19.2.8 Lateral Strain
19.2.9 Kompression der SSB
19.3 Übersicht der Dysfunktionen der SSB
19.4 Mögliche Folgen von SSB-Dysfunktionen
19.5 Quadranteneinteilung
19.6 Fasziale und muskuläre Einflüsse bei SSB-Dysfunktionen
19.6.1 Flexionsdysfunktion
19.6.2 Extensionsdysfunktion
19.6.3 Torsion (z.B. rechts)
19.6.4 Lateralflexion-Rotation (LFR)
19.6.5 Superior Vertical Strain, Os sphenoidale in Flexion
19.6.6 Inferior Vertical Strain, Os sphenoidale in Extension
19.7 Tabellen zu Flexion, Torsion und Lateralflexion-Rotation der SSB
19.8 Verwendete Literatur
19.9 Weitere Literatur
20 Palpation und Behandlung der Synchondrosis sphenooccipitalis (SSB)
20.1 Palpation der Inspirations- und Exspirationsphase
20.2 Bewegungstestung der SSB
20.3 Korrektur der SSB-Dysfunktion
20.3.1 Beschreibung der Palpationserfahrungen auf Höhe der SSB
20.3.2 Klassische Behandlungsprinzipien für die Region der SSB
20.4 Wiederholte Testung
20.5 Unterstützung der Selbstheilungskräfte
20.6 Weitere Hinweise
20.6.1 Palpation und Behandlung der SSB
20.6.2 Schädeldachhaltung
20.6.3 Okzipitosphenoidale Schädelhaltung
20.6.4 Sphenookzipitale Schädelhaltung
20.6.5 Frontookzipitale Schädelhaltung
20.7 Verwendete Literatur
20.8 Weitere Literatur
21 Behandlung der Suturen
21.1 V-Spread-Technik
21.1.1 Lokalisierung der exakten Fingerposition
21.1.2 Testung einer Sutur
21.1.3 Befreiung der Sutur
21.1.4 Weiterführende Techniken
21.2 Auseinanderziehen, rhythmische Mobilisierung, Low Thrust, Recoil, Balancing
21.2.1 Übersicht
21.2.2 Bregma
21.2.3 Lambda
21.2.4 Pterion
21.2.5 Asterion
21.2.6 Sutura coronalis (links)
21.2.7 Sutura sagittalis
21.2.8 Sutura lambdoidea (rechts)
21.2.9 Sutura occipitomastoidea (rechts)
21.2.10 Synchondrosis petrooccipitalis (Sutura petrooccipitalis) und Sutura petrojugularis (rechts)
21.2.11 Sutura parietomastoidea (links)
21.2.12 Sutura parietosquamosa (links)
21.2.13 Sutura sphenosquamosa – Pivot-Technik
21.2.14 Synchondrosis sphenopetrosa
21.2.15 Sutura temporozygomatica, sphenosquamosa, parietosquamosa (links)
21.2.16 Allgemeine Lösung der Suturen der Maxilla und der Ossa zygomaticum, nasale, frontale und ethmoidale (links)
21.3 Verwendete Literatur
21.4 Weitere Literatur
22 Behandlung der kraniosakralen Dura
22.1 Allgemeine Vorgehensweise
22.2 Behandlung der intrakranialen Dura
22.2.1 Übersicht
22.2.2 Os-frontale-Spread-Technik
22.2.3 Os-frontale-Hebetechnik
22.2.4 Alternative Handhaltung für die Hebetechnik des Os frontale I
22.2.5 Alternative Haltetechnik für die Hebetechnik des Os frontale II, frontookzipitale Schädelhaltung
22.2.6 Os-parietale-Spread-Technik
22.2.7 Os-parietale-Hebetechnik
22.2.8 SSB-Kompression
22.2.9 SSB-Dekompression
22.2.10 Innenrotation des Os temporale
22.2.11 Ohrzugtechnik
22.2.12 Kombination der anteroposterioren und transversalen Entspannung
22.2.13 Spezifische Testung und Behandlung der Falx cerebri und Falx cerebelli
22.2.14 Spezifische Testung und Behandlung des Tentorium cerebelli
22.3 Behandlung der extrakranialen Dura
22.3.1 Duralschlauchzug
22.3.2 Duralschlauchzug von kranial
22.3.3 Duralschlauchzug von kaudal
22.3.4 Behandlung der Duralmembran über den N. ischiadicus nach Barral
22.3.5 Behandlung der Duralmembran über den Plexus brachialis nach Barral, modifiziert
22.3.6 Duralröhrenschaukel nach Sutherland
22.3.7 Alternative Technik
22.3.8 Dynamic Balanced Tension (DBT) der Dura mater spinalis
22.3.9 Lig. craniale durae matris spinalis
22.3.10 Dura mater spinalis und subokzipitale Muskeln
22.3.11 Dura mater spinalis und Lig. nuchae
22.3.12 Dura mater spinalis und Ligg. interspinalia durae matris
22.3.13 Dura mater spinalis und Ligg. flava
22.3.14 Dura mater spinalis und Lig. denticulatum
22.3.15 Lig. longitudinale posterius und meningovertebrale Ligamente
22.3.16 Duralscheiden der Spinalnerven
22.3.17 Behandlung der Vaskularisation
22.3.18 Venöse Drainage der hochzervikalen Region nach Barral, leicht modifiziert
22.3.19 Behandlung der Innervation der Dura mater spinalis
22.4 Verwendete Literatur
22.5 Weitere Literatur
23 Fluider Körper
23.1 Palpation
23.2 Eine kurze Zeitreise der Elritze („Timetour Of The Minnow“) in die fluide Entstehungsdynamik des Bulbus oculi
23.3 Osteopathische Zugänge zur Drainage des LCS und des Gehirns
23.3.1 Sinus-venosus-Technik nach Frymann und Liem
23.3.2 Ausgleich des autonomen Nervensystems
23.3.3 CV-4-Techniken
23.3.4 Spezifische Behandlung der Falx cerebri/cerebelli und des Tentorium cerebelli
23.3.5 Pumptechnik am Kranium nach Bjornaes
23.3.6 Techniken für das Atlantookzipitalgelenk
23.3.7 Lymphatische Drainagetechniken
23.3.8 Allgemeine Drainage der Nase
23.3.9 Drainagetechnik für den N. olfactorius
23.3.10 Ohrzugtechnik
23.3.11 Drainagetechnik für den N. opticus
23.3.12 Drainagetechnik für den N. vestibulocochlearis
23.3.13 Drainage der Hirnnerven IX, X, XI
23.3.14 Drainage der oberen Zervikalnerven und -scheiden
23.4 Fluktuation des Liquor cerebrospinalis
23.5 Palpatorische Annäherung
23.5.1 Palpatorischer Zugang zu LCS-Dynamiken
23.5.2 Longitudinale Fluktuation nach Jealous
23.6 Stillpunktinduktion
23.6.1 Stillpunktinduktion an den Füßen
23.6.2 Stillpunktinduktion am Os sacrum
23.7 Fluktuationstechniken
23.8 Longitudinale Fluktuation
23.8.1 Kompression des 4. Ventrikels (CV-4-Technik)
23.8.2 Erweiterung des 4. Ventrikels (EV-4-Technik)
23.8.3 Ignition-System und Kompression des 3. Ventrikels (CV-3-Technik)
23.8.4 Kompression des 3. Ventrikels (CV-3-Technik)
23.8.5 Kompression der Seitenventrikel
23.8.6 Beruhigung des PRM-Rhythmus
23.8.7 Beruhigung über die Rotationstechnik der Ossa temporalia
23.8.8 Beruhigung über das Os sacrum
23.8.9 Beschleunigung des PRM-Rhythmus
23.8.10 Beschleunigung über die Rotationstechnik der Ossa temporalia
23.8.11 Beschleunigung über das Os sacrum
23.8.12 Wiederbelebungstechnik, Vater-Tom-Technik
23.9 Transversale Fluktuation
23.9.1 Wirkung und Indikationen
23.9.2 Pussy-Foot-Technik
23.9.3 Dynamisierende Pussy-Foot-Technik
23.9.4 Beruhigende Pussy-Foot-Technik
23.9.5 Alternative Technik für die laterale Fluktuation
23.9.6 Kombination longitudinaler und transversaler Fluktuationsinduktion
23.10 Schräge Fluktuationstechnik
23.10.1 Wirkung und Indikationen
23.10.2 Anteroposteriore Rotationstechnik der Ossa temporalia (Finger-im-Ohr-Technik)
23.10.3 Selbstbehandlung
23.11 Palpatorische Annäherung an die Zisternen
23.11.1 Palpatorische Annäherung an die Cisterna ambiens
23.11.2 Palpatorische Annäherung an die Cisterna chiasmatica
23.11.3 Palpatorische Annäherung an die Cisterna cerebellomedullaris
23.11.4 Palpatorische Annäherung an die Cisterna pontomedullaris
23.12 Verwendete Literatur
23.13 Weitere Literatur
24 Palpatorische Annäherung an Hirnstrukturen
24.1 Schädel und Gehirnentwicklung
24.1.1 Gehirnasymmetrie
24.1.2 Allgemeine Annäherung an Hirnregionen
24.2 Zerebrum und Cortex cerebri
24.2.1 Übersicht und Lage
24.2.2 Funktion
24.2.3 Palpatorische Annäherung an die Region der Großhirnhemisphären
24.3 Lobus frontalis
24.3.1 Lage
24.3.2 Funktion
24.3.3 Störungen
24.3.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Lobus frontalis
24.4 Lobus temporalis
24.4.1 Lage
24.4.2 Funktion
24.4.3 Störungen
24.4.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Lobus temporalis
24.5 Lobus parietalis
24.5.1 Lage
24.5.2 Funktion
24.5.3 Störungen
24.5.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Lobus parietalis
24.6 Lobus occipitalis
24.6.1 Lage
24.6.2 Funktion
24.6.3 Störungen
24.6.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Lobus occipitalis
24.7 Primäre und sekundäre motorische Zentren
24.7.1 Primärer motorischer Kortex (M1)
24.7.2 Supplementär motorischer Kortex
24.7.3 Prämotorischer Kortex
24.7.4 Frontales Augenfeld (Area 8)
24.7.5 Präfrontaler Kortex
24.7.6 Posteriorer parietaler Kortex
24.7.7 Palpatorische Annäherung an die Region des prämotorischen und primären motorischen Kortex (M1)
24.8 Primäre und sekundäre somatosensorische Zentren
24.8.1 Primärer somatosensorischer Kortex
24.8.2 Sekundärer somatosensorischer Kortex
24.8.3 Palpatorische Annäherung an die Region des primären und sekundären somatosensorischen Kortex (M1)
24.9 Broca- und Wernicke-Region
24.9.1 Lage und Funktion
24.9.2 Störungen
24.9.3 Palpatorische Annäherung an die Broca- und Wernicke-Region
24.10 Sulcus lateralis
24.10.1 Lage und Funktion
24.10.2 Palpatorische Annäherung an die Region des Sulcus lateralis
24.11 Sulcus centralis
24.11.1 Lage und Funktion
24.11.2 Palpatorische Annäherung an die Region des Sulcus centralis
24.12 Sulci parietooccipitalis und calcarinus
24.12.1 Lage und Funktion
24.12.2 Palpatorische Annäherung an die Region des Sulcus parietooccipitalis
24.12.3 Palpatorische Annäherung an die Region des Sulcus calcarinus
24.13 Insula
24.13.1 Lage
24.13.2 Funktion
24.13.3 Störungen
24.13.4 Palpatorische Annäherung an die Region der Insula
24.14 Klaustrum
24.14.1 Lage
24.14.2 Funktion
24.14.3 Palpatorische Annäherung an die Region des Klaustrums
24.15 Corpora mamillaria
24.15.1 Lage
24.15.2 Funktion
24.15.3 Palpatorische Annäherung an die Region der Corpora mamillaria
24.16 Kommissurenbahnen
24.16.1 Lage
24.16.2 Palpatorische Annäherung an die Region der Commissura anterior
24.17 Assoziationsbahnen
24.18 Projektionsbahnen
24.19 Capsula interna und Corona radiata
24.19.1 Lage
24.19.2 Funktion
24.19.3 Störungen
24.19.4 Behandlung der Capsula interna und der Corona radiata nach Chikly
24.20 Corpus callosum
24.20.1 Lage
24.20.2 Funktion
24.20.3 Störungen
24.20.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Corpus callosum
24.21 Indusium griseum
24.21.1 Lage
24.21.2 Störungen
24.21.3 Palpatorische Annäherung an die Region des Indusium griseum
24.22 Gyrus dentatus
24.22.1 Lage und Funktion
24.22.2 Störungen
24.23 Basalganglien des Großhirns
24.23.1 Lage
24.23.2 Funktion
24.23.3 Störungen
24.24 Striatum
24.24.1 Lage
24.24.2 Funktion
24.24.3 Störungen
24.25 Nucleus caudatus
24.25.1 Lage
24.25.2 Funktion
24.25.3 Störungen
24.25.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Nucleus caudatus
24.26 Putamen
24.26.1 Lage
24.26.2 Funktion
24.26.3 Störungen
24.26.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Putamens
24.27 Pallidum
24.27.1 Lage
24.27.2 Funktion
24.27.3 Störungen
24.27.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Pallidums
24.28 Nucleus accumbens
24.28.1 Lage
24.28.2 Funktion
24.28.3 Störungen
24.28.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Nucleus accumbens
24.29 Nucleus subthalamicus
24.29.1 Lage
24.29.2 Funktion
24.29.3 Störungen
24.29.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Nucleus subthalamicus
24.30 Substantia nigra
24.30.1 Lage
24.30.2 Funktion
24.30.3 Störungen
24.31 Nucleus ruber
24.31.1 Lage
24.31.2 Funktion
24.31.3 Störungen
24.32 Limbisches System – Übersicht
24.32.1 Lage
24.32.2 Funktion
24.32.3 Bestandteile
24.32.4 Störungen
24.33 Gyrus cinguli
24.33.1 Lage
24.33.2 Funktion
24.33.3 Störungen
24.33.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Gyrus cinguli
24.34 Hippocampus
24.34.1 Lage
24.34.2 Funktion
24.34.3 Störungen
24.34.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Hippocampus
24.35 Amygdala
24.35.1 Lage
24.35.2 Funktion
24.35.3 Störungen
24.35.4 Palpatorische Annäherung an die Region der Amygdala
24.36 Fornix
24.36.1 Lage
24.36.2 Funktion des Fornix
24.36.3 Störungen
24.36.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Hippocampus und der Fornix
24.37 Septum pellucidum und Nuclei septales
24.37.1 Lage
24.37.2 Funktion
24.37.3 Störungen
24.37.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Septum pellucidum und der Nuclei septales
24.38 Dienzephalon
24.38.1 Lage
24.38.2 Bestandteile
24.39 Epiphyse (Zirbeldrüse, Glandula pinealis)
24.39.1 Lage
24.39.2 Funktion
24.39.3 Arterielle Versorgung und Innervation
24.39.4 Störungen
24.39.5 Palpatorische Annäherung an die Region der Epiphyse
24.39.6 Behandlungsmethodik
24.40 Thalamus
24.40.1 Lage
24.40.2 Funktion
24.40.3 Störungen
24.40.4 Thalamuskerne
24.40.5 Palpatorische Annäherung an die Region des Thalamus
24.41 Hypothalamus
24.41.1 Lage
24.41.2 Funktion
24.41.3 Störungen
24.41.4 Hypothalamuskerne
24.41.5 Palpatorische Annäherung an die Region des Hypothalamus
24.42 Hypophyse
24.42.1 Lage
24.42.2 Funktion
24.42.3 Arterielle Versorgung, venöse Drainage und Innervation
24.42.4 Störungen
24.42.5 Palpatorische Annäherung an die Region der Hypophyse
24.42.6 Harmonisierung von Neuro- und Adenohypophyse
24.42.7 Behandlungsmethodik
24.43 Mesenzephalon
24.43.1 Lage
24.43.2 Funktion
24.43.3 Störungen
24.43.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Mesenzephalons
24.44 Striae longitudinales medialis und lateralis
24.45 Locus coeruleus
24.45.1 Lage
24.45.2 Funktion
24.45.3 Störungen
24.45.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Locus coeruleus
24.46 Decussatio pyramidum
24.46.1 Lage
24.46.2 Funktion
24.46.3 Schädigung
24.47 Zerebellum
24.47.1 Lage
24.47.2 Funktion
24.47.3 Störungen
24.47.4 Behandlung des Zerebellums nach Bruno Chikly
24.47.5 Palpatorische Annäherung an die Region der Nuclei fastigii, globosus, emboliformis, dentatus
24.48 Hirnstamm
24.48.1 Lage
24.48.2 Bestandteile
24.48.3 Störungen des Hirnstamms
24.48.4 Palpatorische Annäherung an die Region des Hirnstamms
24.49 Gefäße des Gehirns
24.50 Verwendete Literatur
Teil II Anhang
25 Einige Indikationen für Osteopathie im kraniosakralen Bereich
25.1 Akute fieberhafte Infektionen
25.2 Apoplex
25.3 Asthma bronchiale
25.4 Bissanomalien und Störungen des Kiefergelenks, kraniomandibuläre Dysfunktion (CMD)
25.5 Depressionen
25.6 Hypophysäre Störungen
25.7 Hyperaktivität des Kindes/Lernstörungen
25.8 Kinder und Neugeborene
25.9 Migräne und Kopfschmerzen
25.10 Chronische Mittelohrentzündungen
25.11 Psychosomatische Leiden und viszerale Funktionsstörungen
25.12 Pylorospasmus bei Kleinkindern
25.13 Schleudertrauma
25.14 Chronische Schmerzen
25.15 Chronische Sinusitis
25.16 Skoliosen
25.17 Störungen des N. vagus
25.18 Störungen des Sehapparates
25.18.1 Glaukom
25.18.2 Katarakt
25.18.3 Kurzsichtigkeit
25.18.4 Latenter Strabismus, Heterophorie
25.18.5 Nystagmus
25.18.6 Weitsichtigkeit
25.19 Tinnitus und Schwerhörigkeit
25.20 Tortikollis
25.21 Verstauchungen, Verrenkungen und Frakturen
25.22 Zerebrale ischämische Anfälle
25.23 Weitere Indikationen
25.24 Verwendete Literatur
25.25 Weitere Literatur
26 Tabellen zur segmentalen Integration
27 Hirnnerven
28 Entwicklung und Verknöcherung der kranialen und sakralen Knochen
29 Osteopathie Schule Deutschland (OSD)
30 Glossar
30.1 Verwendete Literatur
30.2 Weitere Literatur
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum