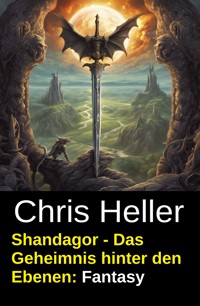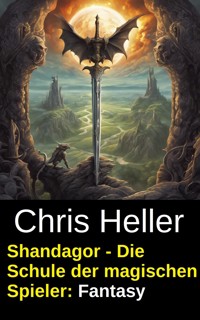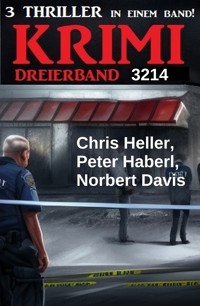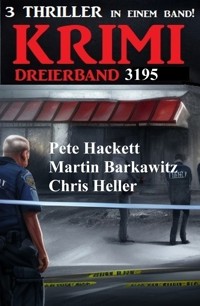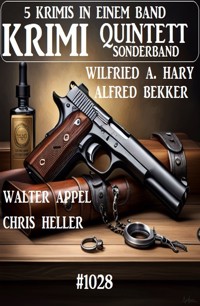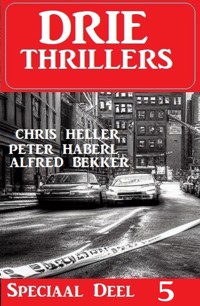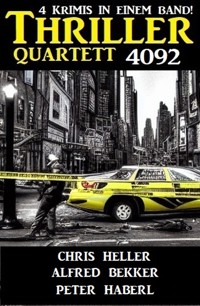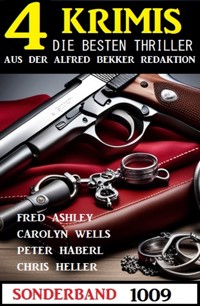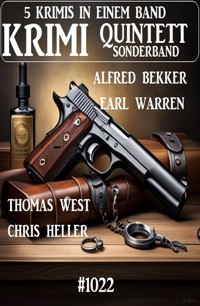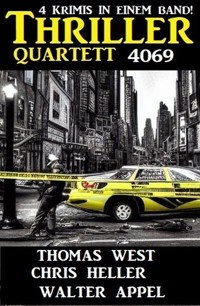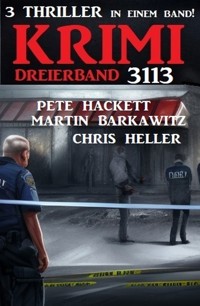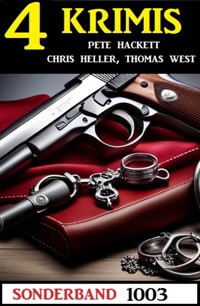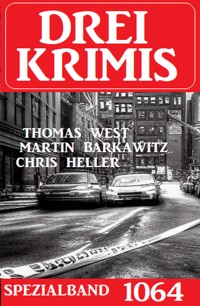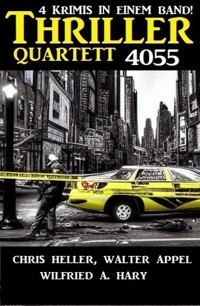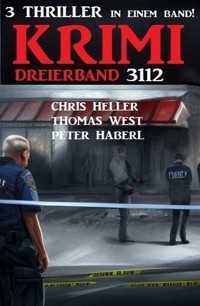
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
von Thomas West, Chris Heller, Peter Haberl (399XE) Dieses Buch enthält folgende Romane Thomas West: Rächer ohne Namen (Thomas West) Thomas West: Gangster Rapper (Thomas West) Kommissar Jörgensen im Fadenkreuz der Rächerin (Chris Heller/Peter Haberl) "In SoHo hatten wir schon lange keinen Mord mehr", brummte Milo und gähnte. Genau wie ich war er direkt aus den Federn und ohne Kaffee und dergleichen aus seiner Wohnung gehastet, nachdem die Zentrale uns geweckt hatte. Wir stiegen aus. "Gut möglich." Auch ich war um diese Zeit noch nicht besonders gesprächig. "Ich führ' kein Tagebuch über sowas." Wir drängten uns durch die Menge. "FBI! Machen Sie bitte Platz!", rief ich barsch. "Mensch, Leute - habt ihr nichts vor morgen? Geht doch endlich in die Kiste!" Auch Milo bemühte sich nicht besonders auffällig um Freundlichkeit. "Es gibt Schöneres zu sehen, als sowas hier!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West, Chris Heller, Peter Haberl
Krimi Dreierband 3112
Inhaltsverzeichnis
Krimi Dreierband 3112
Copyright
Thomas West: Rächer ohne Namen
Thomas West: Gangster Rapper
Kommissar Jörgensen im Fadenkreuz der Rächerin
Krimi Dreierband 3112
Thomas West, Chris Heller, Peter Haberl
von Thomas West, Chris Heller, Peter Haberl
(399XE)
Dieses Buch enthält folgende Romane
Thomas West: Rächer ohne Namen (Thomas West)
Thomas West: Gangster Rapper (Thomas West)
Kommissar Jörgensen im Fadenkreuz der Rächerin (Chris Heller/Peter Haberl)
"In SoHo hatten wir schon lange keinen Mord mehr", brummte Milo und gähnte. Genau wie ich war er direkt aus den Federn und ohne Kaffee und dergleichen aus seiner Wohnung gehastet, nachdem die Zentrale uns geweckt hatte.
Wir stiegen aus. "Gut möglich." Auch ich war um diese Zeit noch nicht besonders gesprächig. "Ich führ' kein Tagebuch über sowas."
Wir drängten uns durch die Menge. "FBI! Machen Sie bitte Platz!", rief ich barsch.
"Mensch, Leute - habt ihr nichts vor morgen? Geht doch endlich in die Kiste!" Auch Milo bemühte sich nicht besonders auffällig um Freundlichkeit. "Es gibt Schöneres zu sehen, als sowas hier!"
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Thomas West: Rächer ohne Namen
11. Juni 1979
Irgend jemand zündete ein paar Kerzen an und schaltete das Licht hinter der Theke aus. Talita ging zum Plattenspieler und legte Meat Loaf auf. Und Jane huschte mit Marty in eines der Nebenzimmer.
Nervös drehte Marc DaCol die Bierdose zwischen den Fingern. Natürlich wollten sie, dass er sich endlich verpisste! Die meisten waren ja schon gegangen. Fast der ganze Abschlussjahrgang. Nur die acht vom harten Kern noch nicht. Die Bacon-Clique. Und eben er.
Er hatte einen Kloß im Hals, er rutschte nervös auf der Matratze hin und her, er zündete eine Zigarette nach der anderen an und eine ängstliche Stimme in ihm jammerte: "Jetzt geh, Marc, die wollen dich hier nicht..."
Die andere Stimme in ihm aber - die trotzige, wütende Stimme - beharrte darauf: "Du bleibst!"
Sie hatten ihn nicht auf ihre Parties eingeladen, sie hatten seine Einladungen ausgeschlagen, sie hatten ihn aus dem Basketballteam herausgeekelt, sie hatten ihn drei Jahre lang spüren lassen, dass sie ihn für einen Streber hielten, sie hatten ihn wie Luft behandelt. Je offener er sich um die Aufnahme in ihre Clique bemüht hatte, desto krasser hatten sie ihn weggedrückt.
Jesus, Maria! Wie gut er das kannte! Von klein auf kannte! Ich sagen, hieß für ihn: Von jemandem reden, den keiner wollte.
Heute aber konnten sie ihn nicht einfach nach Hause schicken. Fast drei Jahre lang hatte er um ihre Anerkennung gebuhlt. In einem Monat die letzte Prüfung, und dann war Schicht.
Und heute stieg das inoffizielle Abschlussfest, eine Fete des gesamten College-Jahrgangs. Auch wenn es im Haus von Wangs Eltern stattfand und Furyo Wang der beste Freund von Lester Bacon war. Die Bacon-Clique hatte also eine Art Hausrecht.
Trotzdem sollte ihn der Teufel ihn holen, wenn er hier nicht als letzter ging. Oder wenigstens als vorletzter.
Er versuchte so cool wie möglich in die Runde zu grinsen. Furyo und Lester an der Theke wichen seinem Blick aus und sahen sich mit hochgezogenen Brauen an.
Wang, du Schwein - du warst es vor allem, der Stimmung gegen mich gemacht hat...
Der lange Wash, der sich ihm gegenüber auf einer Matratze lümmelte, zuckte mit dem rechten Mundwinkel. Seine großen Augen fixierten ihn verächtlich.
Noah, Tom und Talita schüttelten sich auf der Tanzfläche und schienen ihn nicht zu beachten. Doch er spürte ihre Gedanken mit jeder Faser seines Körpers. Wie Moskitos surrten sie böse durch die stickige Luft: Hau endlich ab, DaCol!
Er hatte gelernt, Worte zu verstehen, die in den Köpfen der Leute rumorten und den Ausgang mieden. Jedenfalls glaubte er immer genau zu wissen, was man über ihn dachte. Und noch nie hatte er jemanden in Verdacht gehabt, etwas Gutes über ihn zu denken.
Zwischen Meat Loafs Songs hörte er Gekicher aus dem Nebenzimmer.
Was machen die da drin?
Irgendwann holte sich Talita eine Cola von der Theke und kam zu ihm. Er atmete auf. Auch wenn er wusste, dass sie es aus reiner Höflichkeit tat. Sie hielt einfach keine Spannung aus.
Talita ließ sich neben ihm auf der Matratze nieder. "Na, Marc? Was machst du denn nach dem College?"
"Erst... erst... erst mal zur Army." Wenn er aufgeregt war, blieben ihm die Worte manchmal im Hals stecken.
Ihr ungläubiger Blick entging ihm nicht. Die Frage, die sie unterdrückte, las er in den grünen Augen des blonden Mädchens: Nehmen die so kleine Männer wie dich?
"Und danach?", wollte sie wissen.
Süße Frau. Interessiert sie sich wirklich für mich?
Die Platte war zu Ende. Stöhnen aus dem Nebenzimmer - Janes Stimme.
Sonnenklar, was die da machen!
Sein Mund wurde trocken.
Jesus Maria! Die lässt sich ficken...
"M... mal sehen", sagte er, "wahrscheinlich studieren." Er sah wie Wash seinen langen schwarzen Körper von der Matratze schob und ins Nebenzimmer zu Marty und Jane verschwand.
"Und was?" Er hasste diese verkrampften Interviews. Aber weit mehr hasste er es, allein zu sitzen und nicht beachtet zu werden.
"Chemie." Er sah wie Lester und Furyo sich über die Theke beugten. Beide hielten Strohhalme an ihr rechtes Nasenloch und drückten das linke mit den Daumen zu. Stimmten die Gerüchte also doch, die er gehört hatte: In der Bacon-Clique wurde nicht nur Shit geraucht, sondern auch Koks geschnupft.
"Und wo?" Talitas Stimme klang angestrengt. Aus dem Nebenzimmer wieder Gekicher. Und ein kehliger Seufzer. Wash.
Dann stimmt das andere also auch. Sexorgien - Jesus Maria!
"Wahrscheinlich in Boston." Nun drängten sich auch Noah und Tom an die Theke der Hausbar heran und beugten sich über das Glastellerchen mit dem weißen Pulver.
Der illegale Teil der Fete hatte begonnen. Die berüchtigten wilden Nachtstunden der Bacon-Clique. Sie hatten vor seiner Hartnäckigkeit resigniert. Also gehörte er jetzt dazu! Wenigstens für ein paar Stunden.
"Und was machst du nach dem College?" Ein Schrei im Nebenzimmer. Wash.
Jesus! Mein Schwanz pocht!
Talita zuckte müde mit den Schultern. "Erst mal muss ich die letzte Prüfung bestehen."
Er wusste, dass sie in fast allen naturwissenschaftlichen Fächern auf der Kippe stand. Dafür hatte sie auf ihrer ersten Ausstellung gleich zwei Bilder verkauft. Vor drei Wochen, drüben in Manhattan.
Sie berührte ihn am Arm. Ein heißer Strom durchzuckte ihn. "Komm, wir tanzen." Er schwebte geradezu auf den freigeräumten Teppich vor den Lautsprecherboxen.
Verkrampft bewegte er sich zu den Rhythmen von Meat Loaf. Talita lächelte ihn ermutigend an.
Du tust ihr leid. Verflucht, du tust ihr leid! Das ist alles!
Der Gedanke bohrte sich schmerzhaft in seine Brust. Er schob ihn weg.
Seine Bewegungen wurden lockerer, er versuchte Talitas Lächeln zu erwidern. An der Theke beobachtete er Lester und die anderen. Sie tuschelten und grinsten hämisch.
Im Türrahmen erschienen nacheinander Marty und Wash. Marty verschwitzt und wankend. Wash knöpfte den Schlitz seiner Jeans zu und strahlte zufrieden. Von Jane keine Spur.
Die beiden Jungen stelzten zur Theke und zogen sich einen Streifen in die Nase. Noah verschwand im Nebenzimmer. Bald darauf schrie Jane lustvoll.
Jesus! Das ist ja absolut irre! Die lässt sich von allen durchbumsen...!
Er schluckte. Seine Knie wurden weich. Das Atmen fiel ihm schwer. Talita schien von all dem keine Notiz zu nehmen.
Ob sie auch...?
Er führte einen aussichtslosen Kampf gegen seine Hemmungen. Immer näher tänzelte er an sie heran. Plötzlich war der schwarze Wash hinter ihr. Seine kräftigen Arme legten sich um ihren Hals und zogen das Mädchen rückwärts auf die Matratze neben der Stereoanlage.
Du verfluchter Scheißkerl! Ich hasse dich! Ich hasse dich...
Seine Tanzbewegungen wurden linkischer. Die spöttischen Blicke von der Theke saugten sich an seinen steifen Gliedern fest. Die Schamröte stieg ihm ins Gesicht.
Ich hasse euch! Jesus Maria - wie ich euch hasse!
Unschlüssig blieb er stehen. Noah und Marty erschienen im Türrahmen des Nebenzimmers. Grinsend schlenderten sie auf die improvisierte Tanzfläche. Lester und Furyo rutschten von ihren Barhockern. Sie hatten es eilig zu Jane zu kommen.
"Komm her, DaCol." Der blonde Tom Ockham winkte ihn zur Theke. "Wenn du schon hier bist, dann nimmt dir was Gutes zur Brust."
Warum geht er nicht zur ihr? Traut er sich nicht?
Zögernd näherte sich der Theke und ließ sich zeigen, wie man das weiße Pulver inhaliert. Tom beobachtete ihn. Mit dem typischen geringschätzigen Zug um seine dicken Lippen. "Und?", grinste er. "Tut's gut?"
Es war wie ein kalter Guss nach der Sauna. Als würde ein verstopftes Loch in seinem Hirn aufgesprengt. Alle Unsicherheit fiel von ihm ab.
Tom grinste ihn an. Wash und Talita grinsten von der Matratze aus zu ihm hoch. Die beiden Burschen vor den Boxen grinsten ihn an. Er hielt es für ein Zeichen seiner Aufnahme in die Clique. Sie grinsten ihn an, statt die Augen zu verdrehen. Eine von ihnen hatte mit ihm getanzt. Einer von ihnen hatte ihm Koks gegeben. Und jetzt...
Lester kam mit nacktem Oberkörper aus dem Nebenzimmer.
....jetzt zu Jane...
Mit vier, fünf raschen Schritten war er im Nebenzimmer. Flackerndes Kerzenlicht. Zwei Körper im Halbdunkeln. Auf dem Bett. Stöhnen und Seufzen. Wie gebannt starrte er auf die Szene. Irgendwann sah er Furyos Hintern von Janes nacktem Körper gleiten. Es war dunkel im Zimmer, aber nicht so dunkel, dass er ihre weiblichen Rundungen nicht sah.
Jesus Maria!
Er zog seine Hose aus und warf sich auf sie. Sie riss erschrocken die Augen auf. "Hey, Kleiner - spinnst du?!"
Wut packte ihn. Er drückte sie in das Kissen. Sie versuchte sich aufzubäumen und schrie. "Lass mich, du geiler Stotterzwerg!" Sie kreischte.
Jemand packte ihn von hinten an den Haaren und riss seinen Kopf hoch. Ein eiserner Griff schloss sich um seine Haare und zerrte ihn aus dem Bett. Lester und Wash standen über ihm. "Bist du wahnsinnig geworden, DaCol?!"
Der Hass trieb ihm die Tränen in die Augen. Er zog die Beine an und trat zu. Lester ging schreiend in die Knie. Sofort war Wash auf ihm - der baumlange Kerl presste ihn mit seinen hundertachtzig Pfund aufs Parkett.
Du Scheißkerl, du verfluchter! Ich bring dich um!
Er verbiss sich in der Schulter des schwarzen Riesen, er rammte ihm die Knie zwischen die Beine, bis Wash sich aufstöhnend von ihm wälzte. An der Tür die erschrockenen Gesichter der anderen.
Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich bring' euch um!
Er riss ein kleines Fernsehgerät aus dem Regal und schleuderte es auf Jane, die schreiend im Bett saß. Er griff nach einem gusseisernen Kerzenständer und ging auf die Gestalten an der Tür los. Er merkte nicht, wie er brüllte, er sah nicht die brennende Kerze auf den Boden fallen, er spürte nichts mehr von Hemmung und Angst. Nur noch Hass, nur noch Hass...
Er schlug besinnungslos um sich - die Stereoanlage, die Schrankbar, Regale, Fenster, Terrassentür, Aquarium - alles ging zu Bruch. Er schrie und schlug und schrie und schlug.
Die anderen fünf wichen ihm aus. Talita und Tom flohen über die Terrasse in den Garten. Marty, Noah und der nackte Furyo verschanzten sich hinter der Theke.
Das schlitzäugige Gesicht des Halbchinesen verlor von Minute zu Minute mehr von seinem panischen Ausdruck. Bis es einer wutverzerrten Maske glich. "Hör endlich auf, du verdammter Idiot!"
Er begann mit Flaschen nach ihm zu werfen, mit Barhockern, mit schweren Korkenziehern. Ein Sektkübel traf ihn hart am Schädel. Er ging zu Boden. Furyo warf sich auf ihn.
Das wirst du bereuen, du Schwein... Jesus Maria! Das wirst du bereuen...
Zu sechst bändigten sie ihn schließlich. Furyo hätte ihn sicher erwürgt, wenn die anderen ihn nicht von ihm heruntergerissen hätten.
Als er endlich aus seinem Tobsuchtsanfall erwachte, sah er alles wie durch einen Schleier: Die Polizisten, die ihm Handschellen anlegten, die Sanitäter, die sich um Jane und Wash kümmerten, die Nachbarn, die kopfschüttelnd an der zerbrochenen Terrassentür standen, Lester Bacon, der mit einem Feuerlöscher aus dem qualmenden Nebenzimmer kam.
Auch die folgenden Tage und Wochen erschienen ihm später immer wie ein Schwarzweiß-Film, über den jemand Kaffee ausgeleert hatte: Die Tage in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses, die eisige Miene des Collegedirektors, die Faustschläge und das Gebrüll seines Vaters, die Gerichtsverhandlung, Furyo Wang, der im Zeugenstand mit ausgestrecktem Zeigefinger auf ihn deutete, die Urteilsverkündung - verschwommene, dunkle Bilder, die nichts mit ihm zu tun hatten.
Eines aber blieb - deutlich und zu jeder Zeit gegenwärtig: Der Hass. Je älter er wurde, desto fordernder pochte diese wilde Glut irgendwo in seinem Hirn gegen das Tor der Selbstbeherrschung, hinter das er sie eingeschlossen hatte. Dieser Hass machte Marc DaCol zu einer Zeitbombe. Jahr für Jahr tickte sie vor sich hin. Bis der Tag kommen würde, an dem sie explodierte. Und der kam...
*
Donnerstag, 3. April 1997 bis Mittwoch, 9. April 1997
Es war einer von diesen nasskalten Apriltagen, an denen man am liebsten im Bett bleiben würde, um bei einem guten Buch auf den Frühling zu warten.
Doch der schien noch so weit entfernt zu sein wie meine Beförderung zum FBI-Direktor. Und auf irgend etwas zu warten kam sowieso nicht in Frage: Seit Wochen ermittelten wir in Chinatown. Action war angesagt, und harte Arbeit.
Die kriminellen Organisationen des Viertels breiteten sich aus wie gefräßige Moloche. Bis nach Little Italy hinein. Ein Artikel in der New York Times hatte den Bürgermeister alarmiert. Darin hatte sich ein Redakteur besorgt über die Zukunft des italienischen Viertels geäußert. Wann werden wir den Namen Little Italy aus unserem Stadtplan streichen müssen?
Blödsinn. Die Cosa Nostra würde schon dafür sorgen, dass die Schlitzaugen ihr ureigenes Revier nicht schluckten. Uns interessierten andere Dinge, als städtische Traditionen. Frauenhandel, Menschenschmuggel, dunkle Bank- und Immobiliengeschäfte und vor allem der expandierende Drogenhandel - das hatte unser District Office auf den Plan gerufen.
Und uns lagen Hinweise vor, dass die japanische Yakuza mit den ansässigen chinesischen Bruderschaften zusammenarbeitete.
Die Schaltzentralen dieser kriminellen Zusammenarbeit schienen keineswegs nur in Chinatown zu liegen. Die ganz großen Häuptlinge saßen irgendwo in Hongkong, auf Nippon und in Singapur.
Seit vier Wochen zogen wir eine gründlich vorbereitete Operation gegen den asiatischen Mob in unserem schönen Stadtteil durch. In enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Japan und Singapur. Und es sah an diesem Morgen ganz so aus, als würde unsere Mühe sich bald auszahlen.
Der Regen trommelte auf Dach und Windschutzscheibe unseres Dienstwagens. Man konnte keine fünfzig Meter fahren, ohne eine Wasserfontäne auf den Bürgersteig zu schleudern. Die wenigen Fußgänger drückten sich mit hochgeschlagenen Kragen dicht an den Hauswänden entlang.
"Ein Scheißwetter", knurrte Milo. "Hast du einen Regenschirm dabei?"
"Damit ich mich mit dem Sturm um das Ding streite? Nein, danke." Ich deutete mit dem Kopf zum Fenster heraus. Eine Frau im Ausgang eines Hauses hatte gerade ihren Schirm geöffnet. Nun trat sie auf die Straße, und prompt riss ihr eine Windböe den Schirm nach oben.
Wir erreichten die inoffizielle Grenze zwischen Little Italy und China Town. Milo bog in die Canal Street ein. Wie immer - zähfließender, streckenweise stehender Verkehr. Milo nahm die nächstbeste Gelegenheit wahr, um am Straßenrand zu parken. "Okay, Partner. Mikro klar?"
Ich schlug die linke Seite meines Regenmantels auf und deutete auf den Kugelschreiber in der Brusttasche meines Hemdes. Das Design täuschte - man konnte mit dem Gerät nichts schreiben. Dafür war es ein empfindliches Mikrophon mit einem leistungsstarken Sender.
Milo nickte zufrieden und klappte das Handschuhfach auf. Hier war der Empfänger installiert. Mein Partner würde jedes Wort mithören, das in meiner unmittelbaren Umgebung gesprochen wurde. "Und das zweite?"
Ich zog ein Feuerzeug heraus und hielt es hoch.
"Roger", brummte Milo. "Dann mal los." Er angelte mir die Fototasche vom Rücksitz. "Und bring mir einen Burger mit, wenn du zurückkommst."
"Okay." Ich stieg aus, hängte die Fototasche um und schlug meinen Mantelkragen hoch. Hinein in die Baxter Street. Ein harmloser Tourist, der das Abenteuer Manhattan bei Regen erleben wollte.
Schon von weitem sah ich das Taxi. Wir hatten es zu einem Haus mit einigen Arztpraxen bestellt. Bei dem Wetter wäre ich bis auf die Knochen nass gewesen, wenn ich die vereinbarte Bar zu Fuß hätte erreichen wollen.
"Mosco Street", sagte ich, während ich mich auf der Rückbank ausbreitete. "Ein ziemliches Scheißwetter habt ihr hier im Big Apple."
Er fuhr los. Unterwegs hielt er mir einen Vortrag über die Jahreszeiten, in denen vernünftige Touristen New York City zu besuchen hätten: Im Frühsommer und im Herbst. Ich begriff, was er mir eigentlich sagen wollte: Nur Idioten kommen im April nach Manhattan.
Er hielt an der angegebenen Adresse. Etwa fünf Minuten von der verabredeten Bar entfernt. Der Fahrer nannte einen viel zu hohen Preis. Brav, wie ein Tourist aus der Provinz bezahlte ich. Das obligatorische Trinkgeld überließ ich ihm nur widerwillig.
Die Kneipe lag an der Bayard Street, Ecke Mulberry Street, gegenüber des Columbus Parks. Trotz des Regens waren die engen Bürgersteige vollgestopft mit Menschen und Warenauslagen. Die Händler hatten ihre Stände mit Plastikfolien oder Sonnenschirmen überdacht. Wie meistens glich diese Gegend auch heute einem einzigen großen Straßenmarkt.
Vorbei an Gemüse- und Fischläden, an Friseursalons und Restaurants bahnte ich mir im Gänsemarsch den Weg durch Menschenleiber, Warenstände, Fahrräder und den gnadenlosen Regen.
Hinter beschlagenen und fettbespritzten Schaufenstern hingen frischgebratene Enten. Aus offenen Türen drangen die unterschiedlichsten Gerüche an meine Nase: Bratendüfte, Gerüche von Obst und Gemüse, salziges Aroma von Fisch und Meeresfrüchten, süßlich-mehliger Mief der Bäckereien, stechender Gestank von Reinigungsmitteln, und natürlich die allgegenwärtigen Auspuffdämpfe.
Die meisten dieser Geschäftsleute hier zahlten Schutzgelder an die chinesische Bruderschaft, in deren Revier ihr Laden lag. Es gab drei oder vier mafiaartige Organisationen, die sich das Viertel untereinander aufteilten. Das wussten wir von unseren V-Leuten.
Wenn man die Händler, Ladeninhaber und Gastwirte allerdings danach fragte, erntete man weiter nichts als Schulterzucken und erstauntes Lächeln. Sie taten sie so, als wüssten sie nicht, wovon man überhaupt sprach.
So war das mit dem organisierten Verbrechen. Racketeering an allen Ecken und Enden. Aber wie sollte man dem Mob beikommen, wenn seine Opfer nicht auspackten?
Little Peking hieß die Kneipe. Ein langgezogener Schlauch in grauem Vinyl-Dekor. Aber sie wirkte aufgeräumt und sauber. Anders als ähnliche Bars in Little Italy oder in einschlägigen Vierteln der East Side. Obwohl es noch nicht einmal halbzehn war, saß ein gutes Dutzend Männer an den Tischen. Einige auch an der Theke.
Die Gespräche verstummten für einen Augenblick, als ich eintrat. Neugierige Blicke musterten mich misstrauisch. Abgesehen von Touristen verirrte sich wohl kaum mal ein weißer Dämon hierher.
Weiße Dämonen - so wurden wir weißen Manhatties in dieser exklusiven Asiaten-Gesellschaft oft genannt. Oder schlicht Barbaren. Schmeichelhaft fand ich keinen der beiden Spitznamen.
Jedenfalls half meine Fototasche den Gästen des Little Peking mich in eine Schublade zu stecken. Sie wandten sich ab, und das Gemurmel setzte wieder ein. Aus den Augenwinkeln sah ich unseren Mann an der Theke sitzen.
Ich nahm an einem Tisch am Fenster Platz und hängte meinen nassen Mantel über eine Stuhllehne. Geräuschvoll öffnete ich meine Tasche und breitete einen Stadtplan aus.
Der Wirt tänzelte heran. Japaner, Chinese oder Koreaner - wer will diese kleinen, freundlichen Asiaten auseinanderhalten. Er stellte mir eine Kanne Tee auf den Tisch. Ich hatte Lust auf ein zweites Frühstück und orderte eine kleine Portion Dumplings. Die chinesischen Maultaschen waren hier ausgesprochen günstig. Wie überhaupt das Essen in dieser Gegend.
Ich sah mich um. Fast alles Männer. Nur an einem Tisch ein Paar. An den Fotoapparaten und den neuen Regenjacken erkannte man die japanischen Touristen.
Unser Mann nippte an einem Bier. Sammy Nee. Klein, stämmig, schwarze Lederjacke, knapp vierzig Jahre alt. Nicht ein einziges Mal kreuzten sich unsere Blicke.
Er rauchte nicht. Das konnte aber nur jemandem auffallen, der wusste, dass er Kettenraucher war. Ich wusste es. Hätte er geraucht, hätte ich mich ohne Gefahr zu ihm setzen können. Das war das vereinbarte Zeichen. Nee fühlte sich also beobachtet.
In aller Ruhe widmete ich mich meinem Frühstück, ließ mir vom Wirt auf der Karte den Weg zur Confuzius Plaza zeigen, und zündete mir dann eine Zigarette an. Das war das Zeichen, auf das Nee gewartet hatte.
Er stand auf und ging zur Toilette.
Ich wartete ein paar Minuten und folgte ihm dann. Er stand vor dem Waschbecken und wusch sich die Hände. Kaum stand ich am Pissoir, öffnete sich die Tür: Ein für einen Asiaten ziemlich großer, bulliger Kerl kam herein. Tief schwarzes Haar, im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden, Sonnenbrille, vernarbte rechte Wange, höchstens dreißig Jahre alt. Er verschwand in einer der WC-Kabinen.
Ich drehte mich um und sah, wie Sammy den Zeigefinger auf die Lippen legte. Er trocknete seine Hände an einem Papierhandtuch ab. Sorgfältig knüllte er es zusammen und ließ es in den Abfallkorb neben dem Waschbecken fallen. Ich spülte und ging zum Waschbecken. Während ich mich an ihm vorbei zum Wasserhahn drängte, ließ ich das Feuerzeug in die Außentasche seiner schwarzen Lederjacke fallen. Er zeigte mit seinen Augen auf den Abfallkorb und verließ die Toilette.
Um das Rascheln des Papiers zu übertönen, drehte ich den Wasserhahn auf. Ein Griff, und Nees feuchtes Papierhandtuch verschwand in meiner Hosentasche.
Während ich mich am Waschbecken zu schaffen machte, verließ auch der vernarbte Typ mit der Sonnenbrille wieder das stille Örtchen.
Eine Viertelstunde später zahlte ich und ging. Der nächste Imbiss lag nicht weit entfernt von der Kneipe. Ich besorgte meinem Partner den Burger und bestellte über Handy ein Taxi.
"Das ging ja flott", begrüßte mich Milo und nahm mir den Burger ab. "Alles klar?"
"Das werden wir gleich sehen." Ich kramte das feuchte Papierknäuel aus meiner Hosentasche. Ein Streichholzbriefchen war darin eingewickelt. Mit der erhofften Nachricht: Das Geschäft läuft an. Am 4. um 20.00 Uhr Treffen mit Tiger. Identität noch unbekannt.
"Das ist morgen Abend", dachte ich laut. "Sammy wirkte ziemlich misstrauisch." Ich erzählte Milo von dem Narbentyp mit der Sonnenbrille. "Wahrscheinlich überwachen sie jeden einzelnen seiner Schritte."
Samuel Nee war japanischer Polizeioffizier. Er hatte eine chinesische Mutter und einen japanischen Vater. Und war im Big Apple groß geworden. Nur ein übergelaufener Mobchef wäre eine glücklichere Kombination für den Einsatz in Chinatown gewesen.
Sammys Dienststelle in Tokio hatte ihn im Rahmen der amerikanisch-japanischen Kooperation gegen die Yakuza und die Alligator-Bruderschaft nach New York abkommandiert. Als Undercover Agent. Über das Hauptquartier in Washington hatte unser Chef die Kontakte nach Tokio geknüpft.
Die Kollegen in Japan hatten mindestens so großes Interesse an einem wirkungsvollen Schlag gegen die kriminellen Organisationen wie wir hier in New York City. Die Polizei in Singapur wollte zwar über die Ermittlungen informiert werden, hatte aber abgewunken, als es darum ging einen Spezialisten chinesischer Abstammung zur Verfügung zu stellen.
"Jedenfalls scheint einer der Mobster-Bosse angebissen zu haben", brummte Milo. " Tiger - hast du den Spitznamen schon mal gehört?"
Ich schüttelte den Kopf. Wir hatten eine Immobilie in der Lafayette Street präpariert. Ein Riesenhaus von der Art, auf die unsere Kundschaft von der Yakuza und der Alligator-Bruderschaft scharf war: Edelbordell, Spielhalle, Büroräume. Im Grundbuchamt war das Gebäude auf eine Firma eingetragen worden, die nur auf zwei Strategiepapieren in Tokio und der Federal Plaza existierte. Firmeninhaber: Sen Wu Do - Sammys Tarnnamen.
"Dann lass uns zurück in die Federal Plaza fahren. Der Abend morgen ist entscheidend." Wie meistens vor den kniffligen Phasen eines Einsatzes spürte ich eine leise Erregung. Jagdfieber nennen manche Kollegen dieses Gefühl. "Wir sollten ihn gründlich vorbereiten, damit uns Sammy nicht in der Höhle des Löwen verlorengeht."
*
Von den großen Fenstern des Labors aus konnte man die beiden Träger der Brooklyn Bridge sehen. Dahinter die Skyline Manhattans. Undeutlich heute - dunkle graue Wolken waberten um die Spitzen der Hochhaustürme und es regnete in Strömen.
Marc DaCol wandte sich vom Fenster ab und schlurfte zu der Tischgruppe in der Raummitte. Dieser Ausblick auf Manhattan - jedesmal, wenn er aus dem Fenster im zehnten Stock des Brooklyner Firmengebäudes blickte, spürte er, wie sehr er diese Stadt hasste. New York City hatte ihm nichts als Scherereien gebracht. Dabei hatte er fast sein ganzes Leben hier verbracht. Die einzigen halbwegs angenehmen Erinnerungen verband er mit Boston, Massachusetts. Dort hatte er Chemie studiert. Und seinen Doktor gemacht.
Er verfluchte den Tag an dem er sich vor acht Jahren entschlossen hatte nach Brooklyn zurückzukehren. Was heißt entschlossen - seine Frau hatte ihn überredet. Seine ehemalige Frau. Letztes Jahr hatte sie ihn verlassen. Und presste ihn seitdem aus, wie einen Schwamm.
Die Digitalanzeige des Analysegeräts blinkte. Der kleine, schwarzhaarige Mann zog eine Lesebrille aus der Brusttasche seines weißen Mantels und holte sich die Tastatur des PCs heran. Die Werte mussten in die Tabelle eingegeben werden. Öder Job. Seit Monaten machte er nichts anderes.
Sein Blick wanderte über die einzelnen Anzeigen: Eiweiß, Fett, Gewürze, Konservierungsstoffe, Farbstoffe - alles im Normbereich.
Ein Marienkäfer krabbelte über den Monitor. DaCol verscheuchte ihn mit einer unwilligen Handbewegung. Er hasste diese roten Biester mit den lächerlichen schwarzen Punkten. Er hasste fast alle Insekten. Außer Spinnen.
Auf der anderen Seite des großräumigen Labors scharrte ein Stuhl. Dann harte, kurze Schritte - Stöckelschuhe. Norma Seller, seine Kollegin, tauchte hinter den Aufbauten der Laborelektronik auf. "Wie sieht's aus, Marc?"
Sie stellte sich neben ihn, und DaCol machte einen kleinen Schritt zu Seite. Die Frau war einen halben Kopf größer als er.
Er zuckte mit den Schultern und setzte ein gelangweiltes Gesicht auf. "Alles wie es sein soll." Es kostete ihn Mühe, die höfliche Fassade aufrecht zu erhalten. Aus den Augenwinkeln nahm er die hohen Absätze ihrer roten Lackschuhe wahr. Er war überzeugt davon, dass sie ganz bewusst solche maßlos hohen Schuhe trug. Einzig und allein um ihn zu kränken.
Sie mussten in den letzten Wochen verstärkt Stichproben der Fleischkonserven analysieren, die ihre Firma herstellte. In Osteuropa war eine verdorbene Konserve aufgetaucht. Mit dem gefürchteten Clostridium Botulinum, einem Bakterium, das das gefährlichste Lebensmittelgift der Welt produziert: Das Botulinumtoxin.
Der Firma war es gelungen, die Sache zu vertuschen. Mit viel Schmiergeldern an die osteuropäischen Gesundheitsbehörden. Das Forschungsprojekt, mit dem man solchen ruinösen Pannen vorbeugen wollte, hatte die Geschäftsleitung Norma anvertraut. Nicht ihm, Dr. Marc DaCol.
Sie forschte im Giftlabor des Kellers über Fäulnisbakterien und das Botulinumgift. Sie entwickelte neue Konservierungsmethoden für Fleischkonserven. Nicht er, der Ältere. Nicht er, der promovierte Lebensmittelchemiker.
Dafür hasste er Curd Miller, seinen Chef und diesen ganzen Scheißladen. Dafür hasste er Norma. Und dafür, dass sie ihn auf der Weihnachtsfeier vor vier Monaten abgewiesen hatte. Und mit Miller ins Bett gegangen war.
"Okay, Marc - ich schau noch mal im Keller vorbei." Norma lächelte gekünstelt. "Ich muss doch ein Auge auf meine Botulinum-Kulturen werfen. Und dann bin ich beim Mittagessen." Sie trippelte zur Tür.
"Gu..., guten Appetit." Die Wut krampfte ihm den Magen zusammen.
Hoffentlich erstickst du an deinem Fraß - du blöde Schlampe...
Sie ließ keine Gelegenheit aus, ihm gegenüber ihre Kulturen zu erwähnen. Keine Gelegenheit, um ihm zu demonstrieren, wen der Chef für den Kompetenteren hielt.
DaCol ging nicht zum Mittagessen. Seit Wochen nicht. Seit ihm der Chef eine schriftliche Abmahnung wegen Alkohol im Dienst auf den Schreibtisch gelegt hatte. Die zweite. Und ohne ein Wort darüber zu verlieren. DaCol hatte sich vorgenommen, den Übereifrigen zu mimen. Der sogar seine Mittagspause mit Reagenzgläsern und Analysegerät verbringt.
Eine vierte Kündigung innerhalb von acht Jahren konnte er sich nicht leisten. Die Jobs in seiner Branche waren dünn gesät.
DaCol öffnete seine Aktentasche und holte einen von drei Äpfeln heraus. Er aß ihn hastig und mit zitternden Händen. Es war ein großer, mehliger Apfel - einer von der Sorte, die er nicht mochte. Aber es war genau die Sorte, die sich am besten mit Whisky präparieren ließ.
Mindestens zehn Apfelsorten hatte er durchprobieren. Von dieser Sorte hier nahm jeder Apfel fast einen ganzen Whisky auf. Jeden Morgen spritzte er den Schnaps mit einer Kanüle in das Obst hinein. Sein Tagesproviant. Vom Labor aus stürzte er dann Abend für Abend in eine Bar, zwei Straßen weiter.
Wieder fiel sein Blick auf den Marienkäfer. Diesmal krabbelte er über die Armlehne seines Bürosessels.
Wie zum Teufel kommt so ein Mistvieh ins Labor...?
Er zog die Zeitung aus seiner Tasche, rollte sie zusammen und holte zum Schlag aus. Das Telefon. DaCol ließ den Arm sinken. Er starrte den dudelnden Apparat auf seinem Schreibtisch an.
Miller? Will er überprüfen, ob ich im Labor bin?
Hastig nahm er ab. "Dr. DaCol?" Die Chefsekretärin war am Apparat. "Mr. Miller möchte Sie dringend sprechen. Ab Montag ist er in Urlaub und hat nur noch heute ein wenig Zeit. Er erwartet Sie in fünf Minuten in seinem Büro."
"Ich... ich komme." Er legte auf. Seine Hände waren plötzlich feucht.
Jesus Maria! Was will der Kerl von mir...?
Mit weichen Knien verließ er das Labor. Die Chefsekretärin sah ihn nicht einmal an, als er das Vorzimmer durchquerte. Sie meldete ihn telefonisch beim Chef und machte eine auffordernde Kopfbewegung zu der rotgepolsterten Tür des Chefbüros. DaCol trat zögernd ein.
"Gu... gu... guten Tag, Mr. Miller."
Verfluchte Stotterei...
Curd Miller wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Vor ihm lag ein Hängeordner. DaCol konnte den Namen auf der Akte lesen - seinen Name.
"Machen wir es kurz, Dr. DaCol - Sie sind fristlos entlassen."
DaCols Unterkiefer klappte herunter. Er sackte in sich zusammen. "Ent... entlassen?"
"Trotz zwei schriftlicher Abmahnungen haben Sie weiterhin Alkohol im Labor...."
"Kei... kei... keinen Tropfen hab' ich getrunken!", unterbrach DaCol. "Ich schwör's!"
"Ich weiß." Miller fixierte den Chemiker mit kaltem Blick. "Getrunken haben Sie das Zeug nicht. Aber ich habe die Apfelreste aus dem Abfalleimer des Labors untersuchen lassen."
DaCol senkte den Blick. Ein wildes Gedankenchaos tobte durch sein Hirn.
Norma - du Miststück...
"Die schriftliche Kündigung wird Ihnen heute noch durch unseren Anwalt zugestellt." Die eisige Stimme seines Chefs schien von weit her zu kommen. "Morgen räumen Sie Ihren Arbeitsplatz und nehmen Ihren Resturlaub. Das war's dann, Dr. DaCol."
Er wankte zurück ins Labor. Minutenlang hockte er regungslos in seinem Sessel. Das Chaos in seinem Hirn ballte sich zu einer wabernden Glut zusammen - Hass.
Norma, du Miststück... du hast ihm das mit den Äpfeln gesteckt... du gottverdammtes Miststück...
Er fischte einen weiteren Apfel aus seiner Tasche und verschlang ihn gierig. Vor ihm krabbelte etwas Kleines, Rotes an der Kante des Schreibtischs entlang. Der Marienkäfer.
Norma Seller... du Miststück... du Miststück...
Er stieß sich ab und wirbelte auf seinem Drehstuhl herum. Mit einem Wutschrei schleuderte er den Apfelrest durch das ganze Labor gegen den Monitor auf Normas Schreibtisch.
"Ich hasse dich!"
Er sprang auf, stürzte zu einem der Schränke und riss eine Glastür auf. Mit einem kleinen Glasdöschen kehrt er zu seinem Schreibtisch zurück. Ein Handbewegung, und der Marienkäfer zappelte in dem Glas.
DaCol knallte den Deckel auf die Dose und nahm eine kleine, braune Flasche aus dem Regal neben dem Arbeitstisch. Ein Totenkopf auf dem Etikett. Und die Buchstaben HCL.
Du Miststück... ich bring dich um...
Aus schmalen Augen betrachtete er das Insekt im Glas. Der Käfer lag auf dem Rücken und strampelte mit den Beinen. DaCol nahm den Deckel ab.
Jesus Maria - ich bring dich um...
Mit der Linken hielt er das Glasdöschen ins Licht. Mit der Rechten träufelte er die Salzsäure auf den kleinen Käfer. Nach dem ersten Tropfen strampelte das Insekt noch heftiger. Nach dem zweiten schien es zu erstarren, nach dem dritten begann es sich aufzulösen...
*
Hai Chen Yong ließ die Arme sinken und entspannte seinen drahtigen Körper. Mit maskenhafter Miene musterte er seinen Gegner. Der jüngere Mann mit dem blauen Gürtel lag vor ihm auf der Matte und rang nach Luft. Hai Chen Yong hatte ihn mit der Fußkante am Brustbein erwischt.
Der Mann rappelte sich auf. Keine seiner Bewegung entging Hai. Nicht die fahrige Geste, mit der er eine Strähne seines schwarzen Haares aus der Stirn wischte, nicht der flüchtige Blick auf die Zuschauer seitlich der Matte, nicht die Hast, mit der er ruckartig die Knie anwinkelte. Auch nicht das leichte Straucheln, als er aufsprang.
Die Kiefermuskulatur des jungen, kräftigen Mannes pulsierte, während er seinen weißen Kampfanzug ordnete. Hai erfasste instinktiv, was in dem Mann vorging - er schämte sich. Er wollte den Kampf unter keinen Umständen verlieren. Sein nächster Angriff würde heftiger sein. Und unvorsichtiger.
Auch Hai Chen Yong ordnete das Oberteil seines Anzuges. Die weite Jacke war auseinandergerutscht. Mit seinem schwarzen Gurt band er sie wieder zusammen.
Aus den Augenwinkeln sah er die Bewegung des Vorhangs am Eingang zur Halle. Ein Mann tauchte auf. Blauer Anzug, rote Krawatte. Hai wusste sofort, dass er ihn kannte. Und er wusste, dass dieser Tag noch eine Überraschung für ihn bereithielt. Doch er wischte den Eindruck beiseite. Eines nach dem anderen. Jetzt musste er sich auf den Kampf konzentrieren.
Einer der ebenfalls in Karateanzügen steckenden Männer am Mattenrand stand auf und gab das Zeichen. Es war der Kampfrichter. Die beiden Kämpfer nahmen die Grundstellung ein - Beine leicht gegrätscht, Knie ein wenig gebeugt, Füße etwa schulterbreit auseinander, die Hände locker in Hüfthöhe. Hai Chen Yong neigte den Kopf. Sein Gegner deutete die vorgeschriebene Verbeugung an.
Fast gleichzeitig gingen sie in Angriffsstellung - rechtes Bein nach hinten, Gewicht verlagern, Arme leicht angewinkelt vor den Körper. Hai atmete konzentriert. Seine gesamte Muskulatur war vollkommen entspannt. Und bereit sich zu einem harten Panzer zusammenzuziehen, um den nächsten Angriff zu parieren. Oder alle Kraft auf den Bruchteil einer Sekunde zu konzentrieren, um selbst zuzuschlagen.
Wie erwartet griff der Jünger zuerst an. Fast übergangslos wirbelte sein Fußballen auf Hais Kopf zu. "Kiai!"
Blitzartig duckte Hai sich unter dem Fußstoß weg. Mit der Linken schlug er von hinten gegen die Wade des Angreifers und verstärkte so dessen Angriffsschwung. "Kiai!"
Sein Gegner strauchelte, drehte sich einmal um seine Achse und und fing sich wieder. Sofort setzte Hai mit einem Fauststoß gegen den Solar Plexus des Angreifers nach. Der parierte reflexartig, riss seinen Unterarm hoch und ließ Hais Faust über seinen Kopf ins Leere stoßen.
Von diesem Augenblick an war der Kampf für die Zuschauer kaum noch nachzuvollziehen. Nur die geübtesten Augen konnten die einzelnen Bewegungen differenzieren. Fäuste schnellten vor und zurück, Handkanten zischten und Füße wirbelten durch die Luft - zwei Körper und ihre Glieder zuckten auf und ab, stießen hin und her, blitzschnell und in genau festgelegten Bewegungsabläufen - ein rasender Tanz.
Dazwischen die mit der Atemluft herausgepressten Schreie, wenn die Kämpfer die Wucht ihrer Stöße und Schläge auf den Bruchteil einer Sekunde zu konzentrieren versuchten.
Natürlich verlangte die Regel, die Angriffe Millimeter vor dem Körper des Gegners zu stoppen. Auch das gehörte zur Kunst des Kampfsportes.
Das Ende war unspektakulär. Ein Gong ertönte vom Mattenrand, der Kampfrichter lief auf die Matte und erklärte Hai Chen Yong zum Sieger.
Während der folgenden Kämpfe hatte Hai Zeit, sich den Mann in dem blauen Anzug näher zu betrachten. Es war Tschui Peh, der Sekretär des Doktors. Wenn der Doktor seinen engsten Vertrauten schickte, hatte das in der Regel einen gewichtigen Grund.
Das letzte Mal, als Tschui Peh auftauchte, war Hai Chen Yong anschließend für mehrere Wochen nach Japan gereist. Verhandlungen mit der Yakuza.
Das war vor einem knappen Jahr gewesen. Damals hatte der Sekretär des Doktors ihn im Foyer eines Bordells abgepasst.
Der Doktor - die Öffentlichkeit des Inselstaates kannte ihn unter dem Namen Lao Fu - besaß eines der renommiertesten Hotels in Singapur City. Außerdem gehörte ihm der Vorstandssessel einer großen, japanischen Computerfirma. Und nach Hais letzten Informationen hatte er auch ein gewichtiges Wort in der Singapur International Bank mitzureden.
Vermutlich spielte sein Name noch bei einem Dutzend anderer Firmen eine Rolle. Seine wichtigste berufliche Tätigkeit aber war der Öffentlichkeit unbekannt - der Doktor war der Führer der in der ganzen Welt verbreiteten Alligator-Bruderschaft.
Nach dem letzten Kampf ging Hai über die Matte auf den Ausgang der Halle zu. Tschui Peh grüßte ihn mit einem Nicken. Hai deutete eine Verneigung an und blieb bei ihm stehen.
Sie tauschten ein paar höfliche Floskeln aus - wie die Geschäfte stünden, was Frau und Kinder machten und dergleichen. Erst als der letzte Karateka die kleine Halle verlassen hatte, kam Tschui Peh zur Sache. "Der Doktor würde sich über Ihren Besuch freuen. Leider hat er nur zwischen 21.00 und 23.00 Uhr ein wenig Zeit."
Hai deutete wieder eine Verneigung an. "Das passt mir sehr gut."
Das war's auch schon. Hai verschwand in der Dusche. Anschließend ließ er sich in das Büro der Immobilienfirma fahren, in der er Kompagnon war. Ein Posten, den ihm der Doktor vor drei Jahren verschafft hatte.
Es war kurz nach zwanzig Uhr. Er hatte nicht einmal eine Stunde Zeit, die geplanten Termine dieses Abends neu zu organisieren.
Von einem Chauffeur der Firma ließ er sich in der Abenddämmerung an den Stadtrand zur Villa des Doktors fahren. Kaum hielt der Mercedes auf dem parkähnlichen Vorplatz des Hauses, öffnete sich die Flügeltür des Haupteingangs. Zwei Diener in weißem Livree eilten die vier Stufen der Vortreppe herab. Einer zog die Wagentür auf, der andere geleitete Hai ins Innere des Hauses.
Er eilte ihm voraus durch die Eingangshalle und einen weiträumigen Salon. Die Glasfront zum Garten stand offen. Auf der Terrasse saß ein etwa siebzigjähriger Mann - weißes Haar, dünn und einen halben Kopf kleiner als Hai. Der Doktor. Er rauchte eine Zigarillo.
Ihm gegenüber an einem Tisch mit Kerzenleuchter und Sektkübel seine Frau. Hai verneigte sich. Die Frau - sie war nicht älter als vierzig - erwiderte den Gruß, nahm ihren Sektkelch und verschwand im Haus.
Mit einer knappen Handbewegung wies der Doktor auf ihren freien Platz. Hai setzte sich auf schwarzen Rattanstuhl. Die Wärme der Frau stieg aus dem Sitzkissen in sein Gesäß.
"Schlechte Zeiten", begann der weißhaarige Mann. "Nicht viele, auf die man sich verlassen kann." Er unterbrach sich und musterte seinen Gast. Hai neigte leicht den Kopf, um seine Ergebenheit zum Ausdruck zu bringen.
"Es wird immer schlimmer mit den Menschen", fuhr der Doktor fort. "Jeder denkt nur noch an sich." Wieder der prüfende Blick, wieder nickte Hai.
"Wir haben viel Geld in den Vereinigten Staaten investiert." Der Alte zog an seiner Zigarillo. "Nicht alle Brüder danken es uns. In New York City pflegen manche ihre eigenen Geschäfte zu machen. Das betrübt mich sehr. Und unsere japanischen Partner auch."
Aus dem Halbdunkel des Hauses betrat einer der Diener die Terrasse. Er stellte einen Sektkelch vor Hai auf den Tisch und schenkte ihm ein. Geräuschlos entfernte er sich wieder.
"Es gibt Elemente in Manhattan, die keine Dankbarkeit mehr kennen." Der Alte hob sein Glas. Hai nahm ebenfalls seinen Sektkelch und prostete ihm zu. Sie tranken.
"Keine Dankbarkeit, Hai Chen Yong, keine Dankbarkeit." Er stellte sein Glas ab. "Ich mach' mir Sorgen."
Der Alte wandte sich dem Garten zu. Seine kleinen Schlitzaugen blickten in eine undefinierbare Ferne, und sein Mund nahm einen bitteren Zug an, als er weitersprach. "Ein Nobody hat sich in Manhattan zum Führer aufgeschwungen. Er zieht die uns ergebenen Männer auf seine Seite. Und wenn sie sich weigern, ruiniert er sie. Tiger lässt er sich nennen."
Der Doktor stieß ein verächtliches Lachen aus. "Manche sprechen schon von einer neuen Bruderschaft - den Tigerköpfen." Er schüttelte fassungslos den Kopf. "Hast du von ihm gehört?"
Hai Chen Yong verneinte. Dass sein Gegenüber den Namen des Mannes nicht nannte, war in ihren Kreisen ein Todesurteil. Erst wird der Name gestrichen und dann der Mann.
"Sein Großvater arbeitete schon für uns", fuhr der Alte fort. "Sein Vater hat eine Japanerin geheiratet und die Toyota-Vertretung in Brooklyn geleitet."
Der Alte sog vergeblich an seiner Zigarillo - sie war ausgegangen. Hai stand auf und gab ihm Feuer. "Das dumme Tigerchen hat den Drogenmarkt in Chinatown zu fünfzig Prozent übernommen. Wir sehen schon seit Monaten keinen Dollar mehr davon. Das ist erst der Anfang. Vor zwei Wochen hörte ich von einem unserer Leute in Peking, dass die Tigerköpfe die Preise für illegale Einwanderer um zehntausend Dollar erhöht hat. Für die Söhne reicher Familien aus Hongkong nehmen sie sogar zwanzigtausend Dollar mehr. Auch das fließt einzig und allein in die Tasche des Treulosen."
Er verstummte. Seine Stimme hatte einen anklagenden Unterton bekommen. Es gelang ihm seine Erregung zu kaschieren. Hai Chen Yong spürte sie trotzdem.
Der Doktor wandte sich seinem Gast zu und sah ihm voll in die Augen. Hai wusste, dass er jetzt zur Sache kommen würde. "Du bist nicht nur klug, Hai Chen Yong, du bist mutig und stark. Du warst es, der damals in Jakarta nicht davor zurückschreckte den Polizeipräfekten zu töten, als er nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollte. Und dir haben wir die Kontakte nach Tokio zu verdanken. Ohne dein Verhandlungsgeschick würde die Yakuza noch heute gegen uns kämpfen."
Sein Blick hielt Hais Augen fest. Ein entschlossener Zug lag auf seinem Gesicht - kraftvoll, fast jugendlich wirkte der Alte plötzlich. Hai wusste, dass dieser Mann noch lange nicht am Ende war. Die Energie, mit der es ihm gelungen war, sich die Spitze der Alligator-Bruderschaft zu erkämpfen, der scharfe Verstand und der eiskalte Machtwille, mit denen er eine Organisation leitete, die in der ganzen Welt operierte - nichts davon hatte sich verbraucht, nichts davon war alt geworden.
Der Doktor beugte sich weit über den Tisch zu Hai. "Ich will, dass du nach Manhattan fliegst und den Tiger tötest", flüsterte er.
Hai verneigte sich langsam. Der Alte lehnte sich zufrieden zurück. "Komm erst wieder, wenn die Geschäfte in New York wieder fest in unser Hand sind. Und wer immer sich dir dabei in den Weg stellt - Treulosigkeit verdient kein Erbarmen."
Er atmete geräuschvoll aus. "Einen Getreuen haben wir noch in Manhattan. Timothy Diao Sun. Halt dich an ihn. Offiziell führt er ein renommiertes Restaurant in Chinatown. Die Pagode - von dort aus wirst du operieren können.
Der Doktor nahm sein Glas. "Tschui Peh ist gerade dabei, umfangreiche Dateien über die Verhältnisse in Manhattan zu erstellen - Namen, Immobilien, Bilanzen, Geschäfte, und so weiter. Er wird dir die CD in den nächsten Tagen vorbeibringen. Viel Glück." Sie stießen an und tranken.
Noch eine knappe Viertelstunde blieb Hai bei dem Alten. Der begann übergangslos zu plaudern. Fragte nach Hais Familie und nach seiner Firma, wollte seine Meinung zur Wirtschaftslage im ostasiatischen Raum wissen und erzählte ein paar Interna aus Regierungskreisen, zu denen er beste Kontakte pflegte.
Irgendwann stand er auf. Die Audienz war beendet. "Man lebt nicht ewig, Hai Chen Yong", sagte er zum Abschied. "Auch ich nicht. Aber unsere Bruderschaft wird noch leben, wenn unsere Kindeskinder Geschäfte rund um den Erdball machen. Irgendwann in den nächsten Jahren wird sie eine neue Führung brauchen..."
Hais Herz schlug bis zum Hals. Er wusste, dass der Doktor große Stücke auf ihn hielt. Insgeheim hatte er schon lange darauf gewartet, endlich in die Führungsriege aufzusteigen. Er verneigte sich.
Der Alte griff in die Innentasche seines Jacketts und zog eine eine Hülle mit mehreren Scheckkarten heraus. "Du wirst mit allem ausgestattet sein, was du brauchst." Er reichte ihm die Karten. "Ich habe die Konten gestern einrichten lassen. Sie stehen dir solange zur Verfügung, wie deine Arbeit es erfordern wird."
Hai hielt den Atem an - der Doktor hatte nicht einmal mit der Möglichkeit gerechnet, dass er den Auftrag ablehnen könnte!
"Wenn du aus den Staaten zurückkehrst", sagte der Alte, "erfolgreich zurückkehrst - dann wartet ein Platz unter den Ältesten auf dich. Sie alle vertrauen dir. Ihre guten Wünschen begleiten dich auf deiner Mission."
Auf der Rückbank des Daimlers fuhr Hai Chen Yong zurück in die nächtliche Stadt. Der unerwartete Auftrag wühlte ihn auf. Und natürlich die Perspektive, in die Spitze der Bruderschaftshierarchie vorzudringen.
Später lag er schlaflos auf seinem Bett. Neben ihm in der Dunkelheit die tiefen Atemzüge einer Frau. Er hatte sie für diese Nacht gekauft.
Eine endlose Kolonne unkontrollierbarer Gedanken schleppte sich durch seine Hirnwindungen. Leise Beklommenheit hatte sich in die Erregung über den bevorstehenden Auftrag gemischt.
Er durfte einen Fehler machen. Wenn du erfolgreich zurückkehrst... Nicht den kleinsten Fehler durfte er sich erlauben.
Er konnte gar nicht anders als erfolgreich zurückkehren. Zurückkehren und an den Schalthebeln der Macht Platz nehmen. Wenn aber irgend etwas schiefging, würden sie seinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Die Regeln waren gnadenlos, aber berechenbar. Hai Chen Yong wäre nicht der erste, der sich den Strick nehmen müsste.
*
Der vierte April war ein Freitag - das Wochenende stand vor der Tür. Von unserem Helikopter aus wirkte die Autoflut, die sich nach allen Richtungen aus Manhattan herauswälzte buchstäblich wie ein Knäuel bunter Blechschlangen.
Nicht nur die Pendler waren an diesem Nachmittag unterwegs, um in ihre Vororte zurückzukehren. Tausende von Manhatties hatten sich in ihre Wagen gesetzt und quälten sich zu ihren Wochenendhäusern nach Long Island, New Jersey oder im Hudson Tal. In diese drei Hauptrichtungen schoben sich auch die dicksten und langsamsten der Blechschlangen.
Milo ließ die Maschine auf den nördlichen Randbezirk Chinatowns herabsinken. Hier, an der Canal Street, hatten wir die Einsatzzentrale improvisiert.
Unter uns tauchte das Flachdach eines sechsstöckigen Hotels auf. Auch auf der Canal Street krochen die Fahrzeuge in beide Richtungen Stoßstange an Stoßstange dahin. Kein Wunder, denn diese Verbindungsstraße zwischen Brooklyn und dem Holland Tunnel nach New Jersey war selbst unter der Woche ständig verstopft.
Wir landeten auf dem Hoteldach. Unsere Zentrale hatte das gesamte obere Stockwerk für den Einsatz angemietet.
Über das Treppenhaus gelangten wir in eine Zimmerflucht. Stimmengewirr, es roch nach Kaffee, einige Türen standen auf. "Ist ja fast wie in der Federal Plaza", staunte Milo.
Clive musste uns gehört haben. "Hallo Kollegen, hier bin ich!", tönte seine Stimme aus einem der Zimmer. Clive Caravaggio leitete den Einsatz. Wir fanden ihn zusammen mit seinem Partner Medina vor einer Batterie elektronischer Geräte sitzen: Monitoren, Computer, Tuner, Sende- und Empfangsgeräte. Sie tranken Kaffee.
"Wir haben schon Tassen für euch bereitgestellt." Orry - er trug Kopfhörer - deutete auf einen kleinen Beistelltisch vor dem Gestell mit den Gerätschaften. Zwei Tassen standen darauf und die Kaffeemaschine. In der Glaskanne dampfte die begehrte schwarze Brühe.
"Das nenne ich Kollegialität!" Milo schenkte uns Kaffee ein.
"Und? Habt ihr ihn?", wandte ich mich an Clive.
Er nickte und verschob einen Regler am Tuner, und ich konnte die akustischen Signale hören - der Peilsender in Sammys Feuerzeug funktionierte.
"Nee sitzt im Little Peking", erklärte Clive. "Den übertragenen Geräuschen nach isst er gerade eine Suppe."
"Wahrscheinlich eine Fischsuppe", kommentierte Orry und stellte die Lautstärke noch höher ein. "Die soll dort besonders gut sein." Deutlich hörten wir das Klappern des Löffels und schlürfende Geräusche.
Milo schüttelte den Kopf. "Man kann sich ja nichts erlauben als Under Cover Agent. Was mach' ich denn, wenn ich auf dem Topf sitze oder eine Frau mit ins Bett nehme?"
"Nicht furzen beziehungsweise unter die Matratze schieben", sagte Orry trocken.
"In drei Stunden, also gegen neunzehn Uhr wird Nee abgeholt." Clive stand auf und ging zu dem Stadtplan, der an der Wand neben der Tür befestigt war. "Dann wird es ernst. Wir dürfen seine Spur unter keinen Umständen verlieren."
Er deutete auf eine paar Stecknadel mit gelben Köpfen, die aus dem Stadtplan ragten. "Wir haben sechs Teams rund um Chinatown verteilt. Jedes Fahrzeug ist mit einem Empfänger ausgestattet. Unsere Jungs werden sich immer in zwei bis drei Straßen Entfernung parallel zur Fahrtroute von Nees Chauffeur bewegen. Die Signale, die sie empfangen, gehen bei uns ein."
Er klopfte zärtlich auf einen Zwanzig-Zoll-Monitor. "Und unser Rechner wird immer den aktuellen Standort unseres Mannes ausrechnen."
Das war der Pferdefuß an der ganzen Aktion. Sammy hatte keinen Schimmer, wo der ominöse Tiger ihn treffen wollte. Wir mussten also unter allen Umständen so nah wie möglich an ihm dran bleiben. Mindestens vier Meilen. Weiter reichte sein Peilsender nicht. Jedenfalls nicht in der Innenstadt.
"Na, dann kann ja nichts schiefgehen", brummte Milo und goss sich noch einen Kaffee ein.
"Und wir spielen Feuerwehr, wenn ich den Chef richtig verstanden habe", sagte ich.
"Genau." Clive zog einen Teleskopstab auseinander und zeigte auf den Columbus Park. "Ihr fahrt nachher zum Park. Sobald Nee unterwegs zum Treffpunkt ist, sagen wir euch Bescheid."
Er ging zum Telefon und wählte eine Nummer. "Caravaggio. Schickt doch mal jemanden von der Technik zu Jesse und Milos Dienstwagen, ein grauer Mercury - er soll den Empfänger überprüfen. Danke."
"Ihr habt's gehört - wir haben den neuen Mercury für euch präpariert. Unter den Sitzen liegen eine Heckler & Koch und ein Schnellfeuergewehr. Für alle Fälle."
"Ihr scheint ja mit dem Schlimmsten zu rechnen", wunderte ich mich.
"Eigentlich nicht", Clive zuckte mit den Schultern. "Aber Sammy hat in seinem letzten Bericht darauf hingewiesen, dass dieser Tiger nach seiner Einschätzung vor nichts zurückschreckt. Er ist es, der mit allem rechnet."
Milo und ich sahen uns an. Mir fiel ein, wie vorsichtig Sammy gestern bei unserem Treffen gewesen war. Er kannte die asiatische Mentalität am besten. Und er hatte sich in Tokio jahrelang mit der Yakuza geschlagen. Sein Misstrauen musste also begründet sein.
"Ganz schön mutig, sich trotzdem in die Höhle des Löwen zu wagen", sagte ich.
"Noch mal das Einsatzziel." Clive lenkte unsere Gedanken wieder von den unerfreulichen Phantasien über ein mögliches Scheitern der Aktion ab. "Minimalziel: Identität dieses Tigers klären. Maximalziel: Mitschnitt von Material, das für eine Anklage reicht." Er setzte eine skeptische Miene auf. "Aber ich glaube kaum, dass sich dieser Typ zu einer Plauderei über Menschenschmuggel und Drogenhandel hinreißen lassen wird."
Wir wussten, dass es in Chinatown eine Organisation gab, die Chinesen aus der ganzen Welt dabei half illegal in die Vereinigten Staaten einzuwandern. Meistens junge Männer. Deren Familien zahlten horrende Preise für diesen Menschenschmuggel. Nach unseren Informationen lag das Honorar pro Kopf zur Zeit bei etwa zwanzig- bis dreißigtausend Dollar.
"Dann mal los, Partner." Ich trank meinen Kaffee aus. Milo und ich verließen die Einsatzzentrale.
"Hals- und Beinbruch!", rief Orry uns hinterher.
"Ganz so schlimm wird's wohl nicht werden", antwortete Milo.
Er täuschte sich.
*
"Ich habe keine Chance in diesem gottverdammten Land! Drei Jahre lang habe ich mich auf einer Universität herumgedrückt..." Die weinerliche Stimme schwankte zwischen Wut und Selbstmitleid. Sie überschlug sich fast.
Jane McAustin lüftete ihre Kopfhörer und schnitt eine angewiderte Grimasse. Der Toningenieur auf der anderen Seite der Glasscheibe grinste breit. Maxwell, der Chefredakteur, neben ihm verzog mal wieder keine Miene.
"Mathematik habe ich studiert, jawohl!", kreischte die Stimme in Janes Kopfhörer. "Und was mach' ich heute?! Buletten braten bei Burger King! Weil dieser Schweinestaat mir keine Chance..."
Jane gab dem Toningenieur ein Zeichen. Ihr Kopf schnellte zum Mikro. "Jetzt mach aber mal halblang, Larry!", rief sie. Ihre tiefe, rauchige Stimme klang wie die einer kettenrauchenden Bardame. "Ich kann dein Gelaber nicht mehr hören! Jeder hat eine Chance in unserem Land! Jeder!"
"Aber nicht, wenn er schwarz oder schwul oder ein Puertoricaner ist wie ich!", brüllte der Anrufer.
"Du suhlst dich in deinem Selbstmitleid wie eine Sau im Morast!", giftete Jane. "Ich kann's nicht mehr hören und unsere Zuhörer auch nicht! Alle sind schuld - die Regierung, deine Hautfarbe, die Umstände, deine Frau! Alle - nur du nicht! Das kauft dir keiner ab, Larry, verdammt noch mal! Hör endlich auf zu plärren! Wer aufsteht und sein Leben in die Hand nimmt, kommt nach oben! Und wer das nicht tut, muss untergehen! Das sind die Regeln - du kennst sie!"
"Du blöde Votze! Du hast gut reden! Hockst fett auf deinem Arsch, sabbelst den Äther voll und kassierst das dicke Geld!"
"Larry, du bist ein Idiot!", bellte Jane. Ihre ordinäre Stimme stand in einem seltsamen Kontrast zu ihrem schmalen, sommersprossigen Gesicht - das schöne Gesicht eines Mädchens. Jeder, der sie zum ersten Mal sah, schätzte die Siebenunddreißigjährige zehn Jahre jünger ein. Nur der zwischen Härte und Trauer schwankende Ausdruck ihrer schwarzen Augen verriet, dass sie älter sein musste.
"Ich bin schließlich auch nicht in diesem gottverdammten Radiostudio zur Welt gekommen! Was glaubst du denn, wo ich herkomme, he? Meine Mutter war Indianerin - was glaubst du wie freundlich sie mich in der Schule behandelt haben!? Ich hing jahrelang an der Nadel, verdammt! Ich hab' mich von jedem Scheißkerl ficken lassen, nur um was zu fressen zu haben in dieser Zeit! Ich hab' das Studium hingeschmissen, genau wie du! Ich hab' Taxi gefahren und Buletten gebraten, genau wie du!"
Der Redakteur machte eine beschwichtigende Handbewegung. Jane übersah es einfach und brüllte weiter ins Mikrophon. "Aber irgendwann hab' ich kapiert, dass nur einer für mein Leben verantwortlich ist - ich, ich, ich! Kapierst du das, du Heulsuse!?"
"Leck' mich am Arsch!", schrie der Anrufer. Dann klickte es in der Leitung. Er hatte aufgelegt.
"Das, Freunde, war Larry aus Pittsburgh. Nach den Siebzehn-Uhr-Nachrichten geht es weiter in unserer Sendung Talk mit Jane. Ruft an, Freunde, wenn ihr euch traut! Und jetzt ein Titel aus der neuen Scheibe von Meat Loaf....!"
Sie setzte die Kopfhörer ab und strich sich eine Strähne ihres drahtigen, blauschwarzen Lockenhaares aus der Stirn. Der Toningenieur fuhr die Musik an. Der Redakteur stand auf und kam zu ihr ins Studio. "Hey, Jane", sagte er vorwurfsvoll. "Du gehst mal wieder an die Schmerzgrenze mit deinem Exhibitionismus."
Sie zündete sich eine Zigarette an und warf den Kopf in den Nacken. "Such dir eine andere Moderatorin, wenn dir nicht passt, was ich hier bringe, Maxwell. Was glaubst, wie viele Sender sich die Finger nach mir lecken?"
Er schlich davon. Jane schnitt ihm eine Grimasse hinterher und zwinkerte dem Toningenieur zu.
Nach den Nachrichten ging es weiter. Die Anrufer standen Schlange in der Leitung. Wie immer, wenn Janes Life-Sendung ausgestrahlt wurde. Maxwell filterte diejenigen heraus, die nur ihre Weisheit zum Thema loswerden wollten - die Situation der Sozialhilfeempfänger nach dem neuen Wohlfahrtsgesetz. Oder die, die nur allgemein auf den Präsidenten schimpfen wollten, der das Gesetz im vergangenen Jahr unterschrieben hatte. Der Chefredakteur stellte vor allem die Anrufer zu Jane durch, die sich ausheulen wollten. Oder die, die sich mit Jane streiten wollten.
Die Sendung lief seit zwei Jahren. Und sie war der Publikumserfolg schlechthin.
Nach den Sechs-Uhr-Nachrichten endlich Feierabend. Jane war geschafft. Sie setzte sich in ihren schwarzen Ford Mustang und quälte sich durch die Rushhour. Wie jeden Abend schwor sie sich, ab morgen ganz bestimmt mit der Metro zum Studio zu fahren.
Über die Manhattan Bridge erreichte sie nach einer geschlagenen Stunde endlich Brooklyn. Ihr Haus lag am Rande des Botanical Gardens. Eine kleine Villa im Stil des Neoklassizismus. Dorische Säulen, die das Vordach mit dem Balkon trugen, ein Springbrunnen im Vorgarten, Stuckskulpuren entlang der Einfahrt und ähnlichen Schnickschnack.
Erst vor wenigen Jahren erst war sie nach Brooklyn zurückgekehrt. Zuvor hatte sie sich in den übelsten Gegenden Manhattans durchgeschlagen. Mit Edelprostitution, als Nacktmodel und später, nach der Entziehungskur, als Taxifahrerin und zuletzt als Bedienung bei McDonalds.
Bis vor sieben Jahren ihr Glückstag kam - ein Radioproduzent entdeckte sie. Sie hatte ihn im Taxi zu seinem Sender gefahren. Er engagierte sie hinter dem Steuer weg. Zunächst als Moderatorin für eine Musiksendung.
Vor zwei Jahren dann kam der Erfolg - Talk mit Jane war sofort eingeschlagen wie eine Bombe. Und mit dem Erfolg kam das Geld.
Inzwischen hatte sie schon Angebote von diversen Fernsehsendern auf dem Tisch liegen.
Sie fuhr den Wagen in die Garage und betrat von dort aus ihr Haus. Seit einem halben Jahr lebte sie allein. Sie hatte ihren Mann einfach vor die Tür gesetzt. Nichts fand sie verabscheuungswürdiger, als langweilige Menschen.
Sie drückte den Wiedergabeknopf des Anrufbeantworters und ging in die Küche. Während sie sich am Kühlschrank einen Pfirsichsaft einschenkte, hörte sie die Anrufe ab.
"Hi, Jane schade, dass du nicht da bist." Jane eilte zum Telefontischchen im Salon. Atemlos lauschte sie. Wie gut sie die Stimme kannte! Es zehn Jahre her sein, dass sie den Mann, dem sie gehörte, zuletzt gesehen hat."
"Es wäre mir lieber gewesen, du hättest meine Stimme in Natura gehört. Nach so vielen Jahren wieder. Nun eben auf Band."
Jane war Tom Ockham zuletzt in der Bronx begegnet. In einer Jazzkneipe, wo sie mit einem Freier ein Konzert besuchte. Tom schrieb damals Musikkritiken für die Daily News. Sie hatte ihren Freier stehen lassen, und war mit Tom ins Bett gegangen. Mit ihrer großen Jugendliebe. Ein paar Monate später war er zur Washington Post gegangen. Seitdem hatte sie nie wieder von ihm gehört.
"Ich bin zur Zeit in New York. Wohne im Plaza. Hier meine Nummer..." Hastig griff Jane nach Notizblock und Stift, um die Nummer mitzuschreiben. Sie registrierte das Zittern ihrer Hände und schüttelte über sich selbst den Kopf.
"Stell dir vor, wen ich getroffen habe - Talita. Wir haben eine Idee: Wir wollen ein spontanes Klassentreffen vom Zaun brechen. Ruf mich an, ja?"
Jane hörte den Stimmen der anderen Anrufer nicht mehr zu. Tom hatte angerufen! Er hatte ihr damals den Laufpass gegeben. Gott! Wie lange war das her?! Im letzten Collegejahr oder so. Aus Verzweiflung war sie damals fast mit der ganzen Klasse ins Bett gegangen. Aus Verzweiflung, und um ihn eifersüchtig zu machen...
Traurige Bilder stiegen aus ihrer Erinnerung hoch. Sie schüttelte sie ab. Und nun war Tom in der Stadt. Im Plaza. Und rief sie an.
Sie nahm den Hörer ab und wählte die Nummer des Hotels an der 5th Avenue. Ihre Hände wurden feucht, während das Freizeichen ertönte. Und dann seine Stimme: "Ockham?"
"Hallo, Tom." Sie sprach heiser, fast krächzend.
"Mensch, Jane!" Er schien sich ehrlich zu freuen. "Wie schön dich zu hören!"
Seine Stimme klang immer noch so sanft wie früher. Wer ihn nicht näher kannte, machte den Fehler ihn für einen Softy zu halten. Jane kannte ihn sehr gut. Und wusste, wie sehr diese sanfte Stimme täuschte - Tom war ein Granitkopf.
Er plauderte drauf los. Janes Befangenheit verlor sich. "Was hältst du von dem Klassentreffen, Jane? Wir haben schon fast alle angerufen."
"Was ich davon halte? Blöde Frage!", rief sie ins Telefon. "Superbe! Oder wie sagt man heute? Geile Idee!" Sie lachte aufgekratzt. "Aber ich komm nur unter einer Bedingung!"
"Jetzt bin ich aber gespannt!"
"Dass ihr DaCol nicht einladet!" Sie lachte ihr rauchiges, lautes Lachen.
Ockham blieb still. Er schien Janes Bemerkung nicht besonders witzig zu finden. "Himmel, Jane McAustin! Du hast ja noch den gleichen rabenschwarzen Humor wie früher."
"Aber sonst hat sich viel geändert bei mir." Fast übergangslos wurde sie ernst. "Ich hab' tatsächlich eine Bedingung. Ich will dich vorher allein sehen."
"Das wäre schön, Jane. Bloß müssen wir uns dann beeilen, denn das Treffen soll Anfang nächster Woche stattfinden."
"Heute ist Freitag, du Umstandskrämer! Wer hindert uns daran, heute oder morgen Abend miteinander essen zu gehen?"
*
Sein Blick wanderte über den Schreibtisch - bis auf den Computer war er leer. Er drehte sich langsam um und betrachtete das Labor - die Geräte auf dem großen Arbeitstisch in der Mitte des Raumes, die Arbeitsflächen an der Längsseite, Reagenzgläser, Mikroskope, Instrumente, die Regale mit den Flaschen und Kanistern, der Aktenschrank, Norma Sellers Schreibtisch, die Tür.
Die große Wanduhr über der Tür zeigte kurz vor sieben. Am Nachmittag hatte er seine Unterlagen aus der Verwaltung geholt und hatte dann bis nach sechs in seiner Stammbar gewartet. Solange, bis er sicher sein konnte, Norma nicht mehr zu begegnen, wenn er ins Labor ging, um seinen Schreibtisch leer zu räumen.
Er schob seinen Unterkiefer vor und stieß ein bitteres Lachen aus.
Das war's dann...
Mit einer müden Geste zog er sein grünes Jackett von der Lehne des Drehsessels und zog es an. Er bückte sich nach seiner prallgefüllten Tasche und schlurfte auf die Tür zu.
Jesus Maria, das war's...
An der Tür blieb er stehen, als wäre ihm noch etwas Wichtiges eingefallen, das er vergessen hatte. Langsam drehte er sich um und warf einen Blick zum Fenster. Mit schweren Schritten ging er zurück. Vor dem Fenster blieb er stehen und schaute hinaus. Die Träger der Brooklyn Bridge, die Skyline Manhattans, die dunklen Wolken über der Stadt.
Scheißstadt...
Er wandte sich ab und verließ endgültig den Platz, an dem er in den letzten beiden Jahren fast täglich gearbeitet hatte.
Im Aufzug drückte er nicht auf Erdgeschoss, sondern auf Untergeschoss. Er war noch nicht fertig hier. Noch lange nicht.
Im Keller ging er zielstrebig auf eine breite, blaue Metalltür zu. Er sah sich kurz um und kramte dann eine Codekarte aus der Hosentasche. Er hatte sie schon vor Monaten gestohlen. Kurz nachdem Norma von der Firmenleitung den Forschungsauftrag erhalten hatte. Seitdem grübelte er über Sabotagepläne nach.
Der Verlust der Karte hatte eine Menge Wirbel gemacht damals. Aber auf ihn war kein Verdacht gefallen. Jedenfalls hatte niemand etwas Entsprechendes von sich gegeben.
Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen. Vorsichtig schloss er sie hinter sich und tastete im Dunkeln nach dem Lichtschalter. Grelles Neonlicht flammte auf und tauchte einen großen, blaugekachelten Raum in kaltes Licht. Das Giftlabor.
DaCols Augen strichen über Regale, Schränke und Arbeitsflächen - alles vollgestopft mit Laborgerät: Dutzende von Reagenzglasständern, zwei, drei binokulare Forschungsmikroskope, einige Bunsenbrenner, Messzylinder, Pipettiergeräte, Zentrifugen und zwei Wasserstrahlpumpen.
In der Mitte des Raumes die Galerie mit den elektronischen Geräten. An der Stirnseite der große Autoklav. Und daneben das, was DaCol suchte. Der Thermoschrank mit den Kulturen.
Er durchquerte den Raum und öffnete den Schrank. Die einzelnen Bakterienkulturen waren sorgfältig ausgezeichnet und nummeriert. Links unten verschiedene Fäulnis- und Eitererreger, darüber einige Kulturen mit Schimmelpilzen. Und ganz oben etwa zehn Einschübe, deren Etiketten das Totenkopfsymbol trugen und die Aufschrift: Clostridium Botulinum. Und daneben das Datum, an dem die Kultur angelegt wurde.
DaCol zog die älteste Kultur heraus. Diese Bakterien hatten sich schon am meisten vermehrt und die größte Menge Botulinum Gift produziert. Er entfernte das Etikett und legte den luftdicht verschlossenen Kasten von der Größe einer Videokassette vorsichtig in seine Tasche.
Ein Blick auf den Thermoschrank - die Lücke zwischen den Kästen fiel auf. Er schob die Kulturen zusammen und schloss so die Lücke.
Es war Wochenende. Niemand würde sich groß um die Kulturen kümmern. Niemandem würde der Verlust in den nächsten Tagen auffallen.
Eine Viertelstunde später hastete er durch den feuchtkalten Abend auf seine Bar zu. Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen.
Die Bar war voll. Workaholics aus den Firmen in dieser Gegend, die trotz bevorstehendem Wochenende bis nach sechs gearbeitet hatten. Männer, die nicht nach Hause wollten, weil dort eine keifende Frau wartete. Oder Männer, die sich schlicht und einfach volllaufen lassen wollten. Es war kaum noch ein Thekenplatz zu bekommen.
DaCol bestellte einen doppelten Whisky. Das Wissen um das Giftbakterium in seiner Tasche erregte ihn. Das gefährlichste Gift der Welt, in seiner Tasche...
Er sah sich unter den trinkenden, lachenden und plaudernden Männern um.
Wenn ihr wüsstet, was ich in meiner Tasche habe... Jesus Maria! Ich könnte euch alle umbringen damit...
Er überlegte. Wie viele Bakterien mochten wohl in dieser Kultur schon leben? Hunderttausende? Millionen? Und wie viel Gift hatten sie schon produziert? Ein Hundertstel Milligramm? Ein Zehntel Milligramm? Oder mehr?
Er bestellt noch einen Doppelten und zündete sich eine Zigarette an.
Der Fall jenes jungen Pfadfinders fiel ihm ein, den er während des Studiums von seinem Professor gehört hatte. Der Junge war mit einer Jugendgruppe unterwegs gewesen. Am Lagerfeuer hatte er eine Bohnenkonserve aufgemacht. Der Inhalt schwappte über, der Junge leckte sich die Finger ab - und fiel tot um. Botulinumtoxin.
...Norma, du wirst noch deine Freude an deinen süßen, kleinen Clostridien haben...
Der Wirt sah ihn verwundert an. DaCol merkte, dass er grinste. Und vor sich hin murmelte. Er wandte der Theke den Rücken zu.
...wenn das kräftige Gift deine Nerven packt...
Die Symptome der Vergiftung kannte er nur aus der Literatur. Doppelsehen, Schluckbeschwerden, Atemlähmung. Je nachdem, wie viel man erwischte. Ein Gramm reichte aus, um Hunderttausende zu töten. Hundert Milligramm für zehntausend, zehn Milligramm für tausend...
Blicke trafen ihn aus dem Halbdunkeln der Bar. Er hatte mit den Fingern gerechnet und wieder gemurmelt dabei. DaCol drehte sich zur Theke und bestellte noch einen Doppelten.
...ein Milligramm für hundert, ein hundertstel Milligramm für einen Menschen.
...der Pfadfinder hat sicher ein Milligramm erwischt....
Sein Atem ging schneller, seine Gesichtszüge entspannten sich mehr und mehr, eine fast fiebrige Erregung ergriff ihn. Er machte sich klar, dass seine private Laborausstattung nicht ganz ausreichen würde, um den Erreger fachgerecht zu isolieren und in eine Form zu bringen, mit der man töten konnte.
...töten, Norma, töten...
Die Schwierigkeit an den Botulinum Bakterien war natürlich, dass sie sich nur vermehrten und Gift produzierten, wenn sie absolut ohne Sauerstoff leben konnten. Tief in der Erde. Oder eben in Konserven.
...oder in so einem hübschen und luftdicht verschlossenen Kästchen, wie ich es in meiner Tasche habe...
Er würde vielleicht ein paar hundert Dollar investieren müssen. Warum nicht? Er trank seinen Whisky aus und winkte mit der Brieftasche.
Jetzt mussten die Bakterien erst einmal in einen Elektroherd, damit sie sich weiter vermehrten und Gift produzierten. Und morgen würde er sich schon etwas einfallen lassen.
...jedenfalls wirst du die nächste Woche nicht überleben, Norma, du Schlampe...
Der Wirt beäugte ihn misstrauisch, während DaCol das Geld aus seiner Brieftasche kramte. Er zahlte, presste die Tasche an sich und verließ mit nach vorn gerecktem Kinn die Bar.
Er spürte die Blicke der Männer in seinem Nacken.
...wenn ihr wüsstet, was ich in meiner Tasche habe... Jesus Maria... wenn ihr wüsstet, wer ich bin...
*
Der Tee schmeckte nach Abwaschwasser. Sammy Nee hätte wetten können, dass der Wirt des Little Peking ihm ganz bewusst diese Brühe servierte.
Er war zwar kein weißer Dämon. Aber ein Mischling. Das war für die Chinesen fast noch schlimmer. Die japanischen Züge in seinem Gesicht waren für Kenner nicht zu übersehen. Und Chinesen musste man schon als Kenner bezeichnen.
Aber Sammy hatte in seinem Leben schon viele schräge Blicke eingesteckt. Und Schlimmeres. Ein breites Kreuz war ihm im Laufe der Jahre gewachsen. Die beste Voraussetzung für eine Laufbahn als Polizist.
Er sah auf die Uhr: Kurz vor sieben. Die Leute, die ihn zum Tiger bringen würden, mussten jeden Moment auftauchen. Aus der zerknautschten Zigarettenschachtel vor ihm auf der Theke fischte er die letzte Zigarette. Mist...
Er holte das Feuerzeug aus der Brusttasche seines schwarzen Polohemdes und zündete sie an. Seine Lederjacke lag neben ihm auf einem freien Barhocker. Er durchsuchte sie nach Kleingeld und schwang seine stämmige Gestalt vom Hocker, um zum Zigarettenautomaten zu gehen.
In dem Moment erschien ein Mann im Eingang der Kneipe. Ein Mann, den er kannte - Pferdeschwanz, Sonnenbrille, vernarbtes Gesicht, tadelloser Dreiteiler, dunkelblau. Er hatte den Typen schon gestern in Verdacht gehabt zu den Leuten des Tigers zu gehören. Gut, dass er bei dem Treffen mit Jesse so vorsichtig gewesen war.
Scheinbar gleichgültig schlenderte Sammy zum Zigarettenautomat. Mit einer Schachtel Zigaretten in der Hand kehrte er zur Theke zurück. Der Wirt schien ihm auf einmal unruhiger als zuvor zu sein. Seine Bemühungen, den Neuankömmling an der Tür nicht zu beachten, waren einfach zu verkrampft. Sammy wäre jede Wette eingegangen, dass Narbengesicht mehr war, als nur irgendein Gast. Vermutlich kassierte er hier Schutzgeld für den Tiger.
Der junge Mann mit der Sonnenbrille kam langsam auf Sammy zu. Der trank in aller Seelenruhe seinen Tee aus. " Sen Wu Do?"
Sammy nickte und zog einen Zehndollarschein aus seiner Brieftasche.
"Ich soll Sie zu einem Geschäftspartner bringen." Der Mann sprach Chinesisch. Nichts Besonderes hier in einer geschlossenen Gesellschaft wie Chinatown, wo sogar die Straßenschilder mit chinesischen Schriftzeichen versehen sind.
"Worum geht's?" Auch Sammy verlegte sich auf Chinesisch.
Die Mine des anderen blieb regungslos. Sammy hätte gern die Augen hinter der lächerlichen Sonnenbrille gesehen. "Um das Haus in der Lafayette Street."
Sammy schob die Dollarnote unter das Teeglas und riss die frische Zigaretten-Packung auf. "Ach, richtig." An der Glut seiner Kippe entzündete er die nächste Zigarette. "Dann wollen wir mal gehen." Er zog sich seine schwarze Lederjacke an, ließ das Feuerzeug in seine Hemdtasche fallen und klemmte die schwarze College-Mappe unter den Arm. Die Grundrisse des Gebäudes befanden sich darin.
Der Wirt beäugte ihn erschrocken, als er hinter Mr. Sonnenbrille auf den Ausgang zusteuerte. Sammy gönnte dem Mann ein freundliches Nicken. Abwaschwasser hin, Abwaschwasser her.
Der schwarze Honda Accord stand auf der anderen Seite der Bayard Street. Der Wagen stach Sammy sofort ins Auge. Auf der Rückbank ein junger Chinese mit Sonnenbrille, vor dem Steuer ein junger Chinese mit Sonnenbrille. Alle beide korrekt gekleidet - blauer, beziehungsweise grauer Anzug.
Hinter dem Narbengesicht her überquerte er die Straße. Der Mann öffnete die Beifahrertür. Sammy hasste es in einem Auto auf dem Beifahrersitz Platz nehmen zu müssen, wenn im Font Männer saßen, die er nicht kannte. Noch dazu Männer, die bei grauschwarz verhangenem Himmel Sonnenbrillen trugen.
"Ich sitz' lieber hinten. Vorn' wird mir immer schlecht." Ohne die Reaktion des anderen abzuwarten, öffnete er die hintere Tür und stieg ein. Der Mann neben ihm, hinter dem Beifahrersitz, verzog keine Miene.
Schweigend ließ sich Narbengesicht auf den Beifahrersitz fallen. Sammy überlegte, ob es nicht besser gewesen wäre, den Vertrauensseligen zu spielen. Und damit auch den Vertrauenswürdigen.
"Quatsch", sagte er sich, "warum soll ich weniger misstrauisch sein als die Tiger." Der Wagen fuhr an.
"Wohin?", fragte Sammy auf Chinesisch.
"Lassen Sie sich überraschen", antwortete sein Nebensitzer auf Chinesisch.