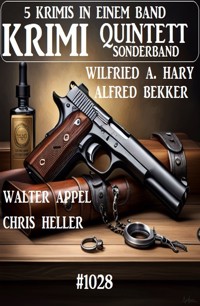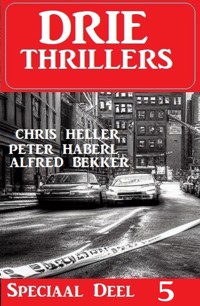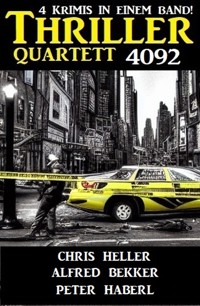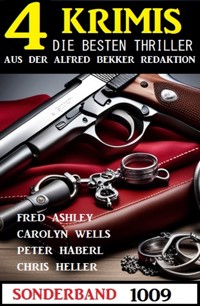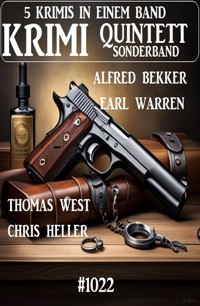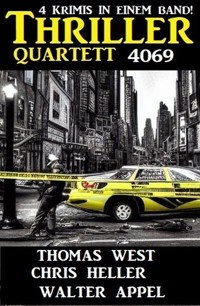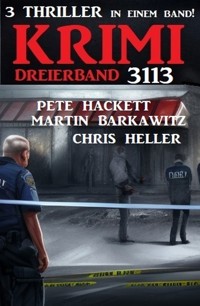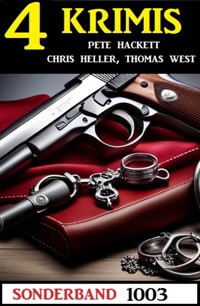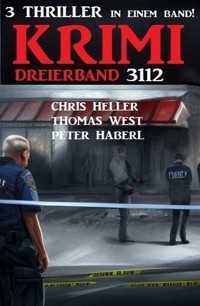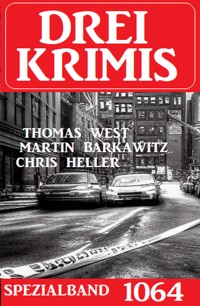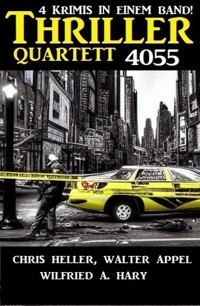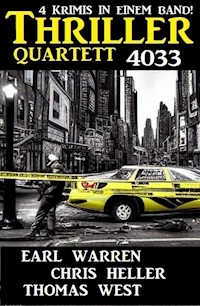von Walter Appel & Chris Heller
Der Hamburger Privatdetektiv Aldo Burmester hätte es sich
niemals vorstellen können, dass er mal einen Auftrag annimmt, der
ihn in den brasilianischen Dschungel führt. Aber da es gerade der
Schöne Udo von der Reeperbahn auf ihn abgesehen hat, ist es
vielleicht gar nicht so schlecht, möglichst weit weg von Hamburg
und St. Pauli zu sein. Und nun ist er dort, in Brasilien, um mit
Jaqueline Grieger ihren Vater Professor Dr. Norbert Grieger zu
finden, der seit Wochen vermisst wird.
Dort erwarten den Detektiv nicht nur die Gefahren des
Dschungels, ein skrupelloser Großgrundbesitzer will Aldos
Nachforschungen verhindern und setzt Killer auf ihn und Jaqueline
an …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
Aldo Burmester ist eine ERfindung von Alfred Bekker
Chris Heller ist ein Pseudonym von Alfred Bekker
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1.
Hamburg 1991…
Aldo Burmester, der bekannte Hamburger Privatdetektiv, parkte
seinen Wagen in der Nähe von Planten un Blomen, dem Parkgelände
neben dem Kongresszentrum. Aldo nahm die Zigarette aus dem Mund,
warf sie auf den Boden, um sie auszutreten. Dann atmete er tief
durch.
Aldo Burmester war hier, um etwas zu joggen.
Eigentlich hielt er nicht so viel von der Fitnesswelle. Aber
andererseits musste er sich für seinen Job etwas in Form halten.
Und davon abgesehen, gab es unangenehmere Orte als Planten un
Bloemen.
Er öffnete den Kofferraum und zog die Laufschuhe an.
Er überlegte noch, ob er die Automatik mitnehmen sollte, die
er normalerweise in einem Schulterholster bei sich trug.
Unter der Trainingsjacke fiel das eigentlich nicht weiter
auf.
Aber erstens konnte man beim Laufen auf so ein zusätzliches
Gewicht auch gut und gerne verzichten. Sein Handy nahm er
schließlich auch nicht mit. Die knochengroßen Funktelefone waren
nur bedingt transportabel. Jedenfalls lief man besser, ohne so ein
Equipment.
Er entschied sich schließlich, die Waffe im Wagen zu
lassen.
Es war zwar eigentlich besser, auf Nummer sicher zu gehen,
aber man musste es in dieser Hinsicht ja auch nicht
übertreiben.
Die Pistole blieb also im Wagen.
Aldo Burmester machte sich dann daran, seinen Lauf zu
beginnen.
Allerdings ging er zunächst mal ganz gemächlich bis zur
eigentlichen Parkanlage. Und danach erst verfiel er in einen
leichten Dauerlauf.
Die Entscheidung mit der Pistole, sollte er noch
bereuen.
*
Aldo Burmester hatte seinen Lauf absolviert und war gelinde
gesagt nach einiger Zeit etwas ausgepowert.
Da hörte er einen lauten Schrei.
“Hilfe!”, rief jemand. “Warum hilft mir denn keiner?"
Es war eine Frauenstimme.
Und sie kam aus einem Bereich, der durch einige dichte Büsche
verdeckt wurde.
Zu dumm, dass ich die Automatik nicht dabei habe!, dachte Aldo
Burmester. Andererseits war das für ihn kein Grund, seine Hilfe zu
verweigern. Ohne lange zu überlegen, lief er dorthin, von wo er die
Rufe gehört hatte.
Eine junge Frau lag auf dem Boden.
Sie hatte langes, dunkles Haar und trug einen fast hautengen
Trainingsanzug. Offenbar hatte sie auch Sport im Park betrieben.
Dachte Aldo zumindest.
Er sollte sich in dieser Hinsicht noch sehr irren.
Aldo lief zu ihr.
“Was ist los?", fragte er.
“Ich bin überfallen worden!”
“Sind Sie verletzt."
“Ich glaube nicht.”
“Wer hat Sie überfallen?"
“Es ging so schnell…. Es ging alles so verdammt
schnell…”
“Aber Sie müssen doch etwas - oder besser gesagt - jemanden
gesehen haben!”
Aldo ließ den Blick schweifen.
Und dann sah er plötzlich von mehreren Seiten ein paar in
Leder gekleidete Typen auf sich zukommen.
Die junge Frau war plötzlich wieder putzmunter.
“Verzieh dich, Katja”, sagte einer der in Leder Gekleideten,
der einen Kampfhund an der Leine führte, der schon bedenklich die
Zähne fletschte.
Die Automatik wäre jetzt wirklich hilfreich, dachte Aldo
Burmester. Aber diese falsche Entscheidung ließ sich jetzt nicht
mehr rückgängig machen.
Katja, die gerade noch ein angebliches Überfallopfer gewesen
war, stand auf und machte das, was ihr Chef ihr gesagt hatte. Sie
verzog sich.
Aldo wusste genau, was das für Typen waren, die sich da
versammelt hatten. Der Privatdetektiv hatte vor einiger Zeit ein
paar Ermittlungen im Rotlichtmilieu durchgeführt. Es war um eine
verschwundene junge Frau gegangen, deren Schicksal Aldo hatte
aufklären sollen. Das war zumindest der Auftrag gewesen, den ihm
die Eltern der jungen Frau gegeben hatten. Sie war in einem Bordell
gelandet und Aldo hatte dafür gesorgt, dass sie jetzt wieder zu
Hause in Blankenese war und sich auf das Abitur vorbereitete,
anstatt Freier auf der Reeperbahn zu bedienen.
Diese Herren dort hatten allerdings geschäftlich gesehen etwas
dagegen gehabt. Nur hatten sie zunächst nichts gegen Burmester
unternehmen können.
Doch jetzt sollte das wohl nachgeholt werden.
Auf grobe Art.
Das Ganze sah so aus, als wollte Aldo Burmester eine Abreibung
verpassen.
Vielleicht auch mehr.
Katja stand etwas abseits, sah mich an, dann zu dem Typ mit
dem Kampfhund.
Das war der schöne Udo.
Eigentlich Udo Laskowski, ein Lude von der Reeperbahn.
Mit ihm war nicht gut Kirschen essen, wenn man ihm in die
Queere kam und offenbar hatte er jetzt beschlossen, dass Aldo
Burmester mal gezeigt werden musste, wo der Hammer hing.
Vielleicht auch mehr.
Der Kampfhund riss schon an der Leine.
“Ganz ruhig, Wotan”, sagte der schöne Udo. “Du kriegst ja dein
Futter gleich. Ob dir der Scheißkerl schmecken wird, musst du mal
sehen. Ich hoffe nicht, dass du wieder das Kotzen kriegst, wie nach
dem Italiener, dem du das Bein zerfetzt hast.”
Aldo Burmester schätzte seine Chancen ab. Die anderen Schläger
verteilten sich. Unter den Lederjacken sah er Waffen. Pistolen,
Schlagringe, Messer, Totschläger….
Aldo begriff, dass er wohl keine Chance hatte, den Kerlen zu
entkommen.
Er überlegte, was er tun konnte.
Das Ergebnis war ernüchternd.
“Das hat mir nicht gefallen, was du getan hast", sagte der
Schöne Udo. “Und weißt du, ich habe nichts persönlich gegen dich,
Burmester, aber wenn ich dir das durchgehen lasse, dann hört auf
der Reeperbahn keine Sau mehr auf mich. Deswegen muss ich dir jetzt
leider wehtun, Burmester. Vielleicht auch dich umbringen… Zum
Schweigen bringen, um die Ecke bringen, in Beton versenken… Du
kannst dir aussuchen, wie wir die Sache nennen sollen.”
“Hör mal, du hast doch nicht im Ernst vor, mich…”, begann
Aldo.
Aber jetzt riss Wotan, der Kampfhund, wieder an seiner Leine
und Aldos letzte Zweifel, dass der Schöne Udo tatsächlich zu allem
entschlossen war und bereit sein würde, über jede nur erdenkliche
Grenze hinauszugehen, waren im Nu verflogen.
Nein, da gab es wohl nur eine einzige Alternative.
Er musste um sein Leben kämpfen.
So gut es ging zumindest.
Der Schöne Udo ging in die Hocke und tätschelte dem geifernden
Wotan den Kopf und den Rücken. “Weißt du, man kann immer schlecht
abschätzen, wie so ein Hund reagiert. Manchmal beißt er jemanden
nur ins Bein. Aber eigentlich ist er darauf trainiert, die Kehle
eines Menschen durchzubeißen und zu töten. So schnell, und sicher,
wie kaum eine Kugel das vermag.”
“Was du nicht sagst…”
“Wie gesagt, das kann man schlecht vorhersagen. Und ich weiß
nicht, Burmester, ob du dich mit Hunden auskennt…."
“Ich glaube, ich mag keine Hunde.”
“Und du hattest auch nie einen, wie ich annehme.”
“Das ist richtig.”
“Manchmal reißen die sich einfach los. So mir nichts dir
nichts. Man denkt, man hat sie an der Leine und schwupp sind sie
weg und machen irgendeinen Unsinn. Da kann ich dann auch nichts
dafür…"
“Und du denkst, dass du damit vor Gericht durchkommst, Schöner
Udo?”
Der Schöne Udo lachte.
Und seine Begleiter lachten auch.
Ihr widerliches breites Grinsen konnte einem den Atem stocken
lassen.
Das waren brutale Kerle, denen ein Menschenleben ziemlich
unwichtig war.
Burmester hatte sie ja bei seinen Ermittlungen kennengelernt.
Er hatte einen von ihnen verprügelt.
Der grinste jetzt besonders breit.
Ein Grinsen, das wohl seine ganze Genugtuung darüber
ausdrückte, dass sich das Blatt nun gewendet hatte und er auf der
Gewinnerseite stand, wie er glaubte.
“Gericht? Wovon träumst du denn, Burmester?”, gab der Schöne
Udo zurück. "Weißt du, das einzige Gericht, das auf St. Pauli
akzeptiert wird, ist mein Richterspruch. Und ich bin auch
gleichzeitig der Henker, wenn es sein muss, verstehst du? Ja, mein
guter Wotan, ich weiß, du bist hungrig und brauchst was zwischen
die Zähne…”
“Vielleicht sollten wir nochmal reden", sagte Burmester.
“Reden? Worüber denn? Dass du mir eine Tussi geklaut hast, die
jetzt für mich anschaffen könnte? Dass das ein herber Verlust für
mich ist? Dass sich die Konkurrenz jetzt über mich kaputtlacht und
mich nicht mehr Ernst nimmt? Sollen wir darüber reden, Burmester?
Wenn du nicht so ein Blödmann wärst, dann würdest du das selber
wissen.”
“Hörmal…”
“Oder du willst einfach nur Zeit gewinnen? Aber damit ist
jetzt Schluss!”
Und dann ließ er Wotan einfach los.
Der Hund kam auf Aldo Burmester zugestürmt.
Aldo fixierte ihn mit seinem Blick.
Er hatte eine Chance.
Genau eine.
Als der Hund ihn erreichte, trat er zu.
Und er traf.
Ganz genau traf er.
Mit voller Wucht erwischte Burmester den Kopf der
Bestie.
Im nächsten Moment war das Tier ausgeknockt. Ein klassischer
K.O. war das. Die Wucht des Trittes war so stark, dass sich Wotan
noch in der Luft drehte und dann wie ein nasser Sack auf den Boden
fiel.
Dann rührte er sich nicht mehr.
“Wotan!”, schrie der Schöne Udo.
Dieser brutale Kerl mochte mit niemandem Mitleid haben. Und
vermutlich hätte er in aller Seelenruhe zugesehen, wie Wotan den
Privatdetektiv mit den Zähnen zerfetzte. Aber jetzt litt er mit
Wotan mit. Er schien also doch zur Empathie fähig zu sein.
Wer hätte das gedacht!, ging es Aldo durch den Kopf.
Auch die anderen Schläger waren beeindruckt. Sie schienen
etwas unschlüssig darüber zu sein, wie sie reagieren sollten.
Ihre Blicke gingen zu ihrem Boss hin.
“Reißt ihn in Stücke für das, was er meinem Wotan angetan
hat!"
“Echt jetzt, Chef?”, meinte einer.
"Meinst du, ich sag sowas zum Spaß!”, brüllte der Schöne Udo
jetzt. Und dabei wurde er puterrot. Sein Hals schwoll an und die
dicke Ader dort trat auf eine Weise hervor, die nicht wirklich
gesund wirkte.
“Soll ich die Kanone nehmen?”, fragte einer der
Schläger.
“Nein, er soll leiden!”, sagte der Schöne Udo.
“Schon kapiert, Chef!”
Dann griff der erste der Typen Aldo an. Mit dem Schlagring und
einem Totschläger.
Aldo schaltete ihn mit einem Faustschlag aus, nachdem er dem
Schlag des Typen geschickt ausgewichen war.
Dann kam der Zweite. Der hatte ein Messer.
Aldo wich dem Stoß aus, stach ihm mit den Fingern in die Augen
und riss ihm dann die Pistole aus dem Gürtel.
Mit der schoss er dann dem dritten Schläger ins Bein.
Dann richtete er die Waffe auf den Schönen Udo.
“Und jetzt bist du dran, du Scheißkerl!”, sagte Burmester.
“Das vergesse ich dir nie - das, was du mit meinem Wotan
gemacht hast."
“Der Hund kann nichts dafür, aber ich würde ihm ungern noch
einmal begegnen”, sagte Aldo.
Er richtete die Waffe auf den ausgeknockten Hund und drückte
ab.
Der Hundekörper zuckte noch einmal.
Das war es dann.
“Lauf mir nie wieder über den Weg, Schöner Udo”, sagte Aldo
dann. “Sonst geht es dir wie deinem Kampfhund!”
“Wotan!”
Tränen rannen jetzt über die Wangen des schönen Udo.
Dann griff er unter die Jacke und riss einen Revolver
hervor.
Aldo feuerte und traf den Schönen Udo am Oberkörper. Der Lude
wurde zurückgerissen, taumelte und ging dann zu Boden.
Burmester ging zu ihm hin und kickte ihm die Waffe fort, die
ihm aus der Hand gefallen war.
“Ruf einen Arzt!”, ächzte der Schöne Udo.
“Ich rufe die Polizei, die Arsch”, sagte Aldo.
“Du bist ein Mörder, Burmester!”
“Ach!”
“Du hast meinen Hund ermordet!”
“Besser ich ihn als er mich.”
“Du bist ein Schwein, Burmester. Jemand, der einen Hund so
behandelt, ist überhaupt kein Mensch! Du hast kein Gefühl,
Burmester!”
“Schon klar”, sagte Burmester.
*
Aldo ging zu seinem Wagen. In diesem Augenblick hatte er einen
Wunsch für die Zukunft. Irgendwann, dachte er, sollten Handys so
klein sein, dass man sie beim Joggen tragen kann. Er nahm sein
Handy aus dem Handschuhfach seines Mercedes und rief die Polizei.
In diesem Fall erstmal seinen Freund Kommissar Sven Dankwers von
der Mordkommission.
*
“Du hast jetzt ein Problem”, sagte Kommissar Dankwers später,
als sie zusammen in Dankwers’ Büro im Polizeipräsidium saßen.
“Weil ich einen Hund erschossen habe?"
“Nein. Weil du dir deinen Feind gemacht hast."
“Ich hoffe, der Schöne Udo ist erstmal für eine Weile aus dem
Verkehr gezogen.”
“Seine Schussverletzung wird heilen, Aldo. Und wie lange er in
den Bau wandert, wird ein Gericht entscheiden. Aber das ist nicht
das Problem."
“Dann erklär es mir.”
"Der Schöne Udo ist nur ein kleines Rädchen in einer größeren
Organisation. Und diese Leute mögen so etwas nicht. "Sie mögen es
nicht, wenn jemand einen ihrer Leute anpisst und genau das hast du
getan, Aldo.”
Aldo Burmester atmete tief durch.
“Ich weiß, Sven.”
“Die werden dich jetzt auf ihrer Liste haben, Aldo.”
"Was sind das für Leute?"
“Wir wissen es nicht genau. Aber es wäre nicht schlecht, wenn
du vielleicht eine Weile Urlaub machst.”
“Ich soll einfach verschwinden?”
“Ich sag nur, was gut für dich wäre, Aldo. Nicht, was du tun
sollst.”
“Ich verstehe schon.”
*
Als er später zu seinem Büro zurückkehrte, begrüßte ihn seine
Assistentin Jana Marschmann. “Du warst ja ziemlich lange weg,
Aldo.”
“Ich weiß.”
“Da war ein Anruf für dich.”
“So?”
“Ich dachte, du wolltest nur etwas joggen.”
"Ich habe ein paar Männer verprügelt, einen angeschossen und
einen Hund getötet, der mich zerfleischen wollte.”
“Klingt nach einem ereignisreichen Vormittag.”
“So kann man es auch ausdrücken.” In knappen Worten fasste er
zusammen, was er sich zugetragen hatte. “Und was war das für ein
Anruf?”, fragte er dann.
“Wegen einem Auftrag.”
“Was für ein Auftrag?"
“Ich habe es nicht ganz verstanden. Du sollst irgendwas in
Brasilien erledigen. Das muss noch abgeklärt werden…"
"Brasilien?"
“Genauer gesagt: Amazonien.”
“Ist vielleicht gar nicht so schlecht", meinte er. Er dachte
daran, was Kommissar Dankwars gesagt hatte. Dass Burmester jetzt am
besten irgendwo anders und weit weg sein sollte.
Brasilien war wohl weit genug weg.
Der Auftrag kam vielleicht gerade passend!
*
Professor Dr. Norbert Grieger hörte das Kläffen des
Rottweilers und die portugiesischen Worte seiner Verfolger. Er
rannte den Dschungelpfad entlang. Es war dunkel unter dem Laubdach
der Urwaldriesen am Japurá, einem linken Nebenfluss des
Amazonas.
Grieger rannte um sein Leben. Er wusste, sie würden ihn töten,
wenn sie ihn einholten. Der Professor war nicht mehr der Jüngste.
Er keuchte. In Strömen lief ihm der Schweiß herunter. Sein Herz
hämmerte schmerzhaft gegen die Rippen. In seiner Seite stach
es.
Bitte, lass mich durchhalten, Gott!, dachte Grieger. Ich muss
das Dorf der Jacarare-Indios erreichen. Dort bin ich in Sicherheit.
Aber es waren noch vier Kilometer bis dorthin.
Die Verfolger holten auf. Für sie war die Jagd ein Vergnügen,
und mit dem Rottweiler, der die Fährte witterte, konnte der Gejagte
sie nicht abschütteln. Grieger geriet vom Pfad ab. Er lief durchs
Unterholz, wobei zähe Ranken nach seinen Füßen griffen und ihn
hemmten, immer in der Hoffnung, doch noch einen Ausweg zu finden.
Wenn er nur den Hund hätte abschießen können. Doch ein
Taschenmesser war seine einzige Waffe.
»Lass den Hund los!«, hörte der Professor seine Verfolger
schreien.
Der Rottweiler brach durchs Dickicht und raste heran. Der
abgehetzte Mann zog sein Taschenmesser, das gegen einen
ausgewachsenen, vierzig Kilo schweren Rottweiler eine höchst
unzureichende Waffe war. Professor Grieger schluchzte vor Angst und
Verzweiflung.
Er sah den Rottweiler in der Dunkelheit erst im letzten
Moment. Kaum ein Lichtschimmer vom gestirnten Himmel, an dem der
Vollmond wie eine strahlende Silbermünze prangte, fiel durch das
Laubdach der Urwaldriesen.
Viel zu langsam hob Grieger das aufgeklappte Taschenmesser.
Der Ansturm des Rottweilers warf ihn nieder. Das Taschenmesser flog
weg, ohne dass es den Rottweiler auch nur geritzt hätte. Professor
Grieger erwartete, die Kehle durchgebissen zu bekommen. Zwar
schützte er sie mit dem Arm. Doch der Rottweiler konnte mit seinem
mächtigen Gebiss den Unterarm des fünfzigjährigen, drahtigen
Gelehrten knacken wie einen morschen Ast.
Schweißgebadet und völlig verkrampft vor Angst lag der
Professor am Boden. Der Rottweiler stand knurrend über ihm. Er
kläffte, um den Verfolgern zu melden, dass er sein Opfer gestellt
hatte. Grieger wagte nicht, sich zu rühren.
Er hörte durch das Hecheln des Hundes, dessen Geifer auf ihn
niedertropfte, die Schritte und dann die keuchenden Atemzüge seiner
Verfolger. Sie waren zu viert. Als sie Grieger erreichten,
leuchtete einer ihm mit der grellen Stablampe ins Gesicht.
»Verdammter Indianerfreund«, knirschte er.
Der Gelehrte brachte keinen Laut heraus. Eine zweite Stablampe
wurde eingeschaltet. Dadurch sah Grieger den Sprecher, einen
spitzbärtigen Brasilianer portugiesischer Abstammung. Der Bart und
die dunklen, stechenden Augen in dem hageren Gesicht, die
verkniffene Miene und der grimmig verzogene Mund gaben ihm etwas
Mephistophelisches. Der Häscher hatte einen Lederhut auf dem Kopf
und trug einen goldenen Ring im linken Ohr. Sein Hemd stand über
der schweißbedeckten Brust offen. Ein Medaillon glänzte darauf. Er
trug einen patronengespickten Gürtel und eine billige
Quarzuhr.
In der Rechten, und das war das Ausschlaggebende, hielt er
einen schweren, langläufigen, vernickelten Magnum-Revolver. An
dieser Hand waren der Ringfinger und der Mittelfinger verstümmelt,
was den Canganceiro jedoch nicht am Schießen hinderte.
Sekundenlang hörte Professor Grieger nur die nächtlichen
Tierstimmen im Dschungel am Rio Japurá. Dann zuckte eine ellenlange
Stichflamme aus der Revolvermündung, die bis dahin dunkel wie der
Tunnel des Todes gegähnt hatte. Der Deutsche spürte einen
fürchterlichen Schlag an den Kopf. Sein Bewusstsein zerbarst in
tausend Fragmente.
Grieger war auf der Stelle tot. Jaulend wich der Rottweiler
von der Leiche mit dem kleinen Einschuss an der Stirn und dem
fehlenden Hinterkopf. Das Krachen des Schusses erzeugte einen
Höllenlärm im Dschungel. Affen und Vögel schrien. In der Nähe
befindliche Tapire grunzten und flohen. Gürteltiere entfernten sich
raschelnd.
Allmählich legte sich der Lärm. Die vier Mörder zündeten sich
Zigaretten an und ließen eine Taschenflasche mit scharfem Rum
kreisen. Der Mann, der geschossen hatte, erschlug klatschend einen
Moskito an seinem Hals und fluchte.
»Was fangen wir mit dem Toten an?«, fragte einer seiner
Komplizen.
Der Todesschütze war der Anführer des Killer-Quartetts.
»Wir schleifen ihn ins Gebüsch und lassen ihn liegen«,
bestimmte er. »Zum Fraß für die Tiere des Dschungels und als
Warnung für die Jacarares. Der Deutsche wird sich nicht mehr für
ihre Belange einsetzen.«
»Ich habe in der Nähe einen Termitenhaufen gesehen. Lasst uns
die Leiche auf den Ameisenhaufen werfen! Dann finden die Jacarares
seine blank genagten Gebeine, was ihnen zu denken geben
wird.«
»Gute Idee, Miguel«, sagte der Todesschütze zu dem Sprecher.
»Aber zuerst schaut nach, was er in seinen Taschen hat. Seine Uhr
gehört mir. Schließlich habe ich ihn erschossen.«
Die Mörder leerten die Taschen des Toten. Miguel fluchte, weil
das Hemd blutig war.
»Das kriege ich nicht mehr heraus. Seine Schuhe sind mir zu
groß. Sapristi, was hat dieser Hurensohn für eine Schuhgröße. Die
Latschen kann er behalten. Sie passen keinem normalen
Menschen.«
»Was ist mit seinem Ring?«, fragte der Todesschütze.
»Ein billiges, wertloses Ding«, sagte der Mestize Miguel, der
über dem Toten kniete.
Keiner wollte den Ring. Der Rest der kargen Beute war schnell
verteilt. Dann schleiften zwei Männer die Leiche zu dem mehr als
mannshohen Termitenhaufen. Sie brachten sie nicht ganz dorthin,
bloß in die Nähe. Die großen, gefräßigen Ameisen wären ihnen sonst
unter die Kleider gekrochen und hätten sie übel gebissen. Doch die
Nähe des Ameisenhaufens genügte.
Bald war die Leiche von schwarzen, bis zu drei Zentimeter
großen Ameisen bedeckt. Die Mörder verließen den Tatort, den
Rottweiler am Stachelhalsband an der Leine. Es herrschte wieder
Ruhe im Dschungel. Nur eine Blutpfütze auf dem Pfad sowie Hirn- und
Knochensplitter und zertrampelte Spuren blieben dort von der
Tragödie, die das Leben des zurzeit wohl engagiertesten Verfechters
der Rechte der Amazonasindios gekostet hatte.
2.
„Jana, bitte ruf beim Flughafen an. Buch mir einen Flug nach
Manaus Nach Möglichkeit ohne Zwischenstopp.“ Aldo Burmester stand
im Türrahmen, der zu der Tür gehörte, die in sein Büro führte, das
sich in einer Traumetage in der Beenckstraße an dem westlichen Ende
des Wilhelmburger Inselparks befand.
„Erstens, mein Lieber, einen Flug nach Manaus wirst du ohne
Zwischenstopp nicht bekommen. Du wirst in Zürich zwischenlanden und
von dort nach Sao Paulo fliege. Dort steigst du in den nächsten
Flieger, der dich nach Manaus bringt“, erklärte ihm seine
Sekretärin schnippisch.
Dass Jana Marschmann sich bereits informiert hat, erstaunte
ihn nicht im Geringsten, denn sie wusste von seinem neuen Auftrag,
der ihn nicht gerade um die Ecke führte.
„Dann nehme ich an, dass meine kluge Sekretärin diesen Flug
bereits für mich gebucht hat“, meinte er dazu.
Jana drehte sich mit dem Schreibtischsessel etwas zur Seite.
Dann lehnte sie sich nach hinten, verschränkte die Arme vor ihrer
Brust und schlug ihre langen schlanken Beine grazil übereinander,
die – und nicht nur die – Aldo mit Genuss bewunderte, denn seine
Sekretärin war eine Schönheit. Ihre Figur – ein Meisterwerk der
Natur!
Jana schmollte immer noch.
„Nein, die kluge Sekretärin wollte nicht übereifrig sein, denn
sie ist immer noch der festen Meinung, dass sie ihren Chef
begleiten sollte – und das aus vielerlei Gründen, wie sie es ihm
vor einer Stunde bereits klarzumachen versucht hat.“
„Und der Chef hat ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass es
dort viel zu gefährlich für so eine hübsche Person wie sie ist, und
außerdem wird sie hier benötigt. Die Stellung halten, wie man so
schön sagt.“
Jana schnaubte verächtlich.
„Gefährlich, so ein Quatsch! Außerdem weiß ich mich zu wehren
…“
„So, so, das Fräulein weiß sich zu wehren.“ Aldo Burmester
lachte spöttisch auf. „Im dichten Urwald, wo es giftige Schlangen
und anderes Getier gibt, das dir gefährlich werden kann.“
„Ach, dir etwa nicht?!“, konterte sie bissig.
Doch Aldo ließ sich nicht beirren.
„Auch der Amazonas ist gefährlich. Fleischfressende Fische
…“
„Du meinst Piranhas. Die beißen nur, wenn sie Blut riechen.
Ist wie bei Haien“, belehrte Jana ihren Chef.
„… und plötzlich auftauchende große Reptilien, die dich unter
Wasser ziehen und verspeisen.“
„Das sind Kaimane, eine Unterart der Alligatoren. Tja, und du
solltest dich vor den winzigen Candirus in Acht nehmen. Den nennt
man auch Vampirfisch. Und weißt du warum? Ich werde es dir sagen.
Die saugen nämlich Blut von anderen Fischen. Doch am liebsten
stürzen die sich auf das beste Stück des Mannes. Höllische
Schmerzen sind dir gewiss“, grinste sie. Aber dann wurde sie wieder
schlagartig ernst. „Aldo, das sind doch alles nur fadenscheinige
Ausreden von dir. Du weißt genau, dass ich dir bei deinem neuen
Fall eine Hilfe und kein Klotz am Bein sein will.“
Burmeister stöhnte genervt auf.
„Jana, diesen Disput hatten wir bereits des Öfteren. Also
kennst du meine Antwort.“ Der Privatdetektiv war nicht gewillt
nachzugeben. Besonders nicht in diesem Fall. „Außerdem bezahlt der
Klient für diese Aktion nur für eine ermittelnde Person. Und das
ist meine Wenigkeit. - Also nein!“
Jana starrte ihn wütend an, doch das kannte Aldo schon von
ihr. Sie würde sich nach einer gewissen Zeit schon wieder
einkriegen. Wie sonst auch immer.
„Rufst du bitte an und buchst für mich den Flug nach Manaus?“,
fragte Aldo Burmeister.
Jana brummte etwas vor sich hin, als sie sich wieder an ihren
Schreibtisch zurückdrehte.
Aldo Burmester ging zurück in sein Büro und von dort aus in
sein Apartment, das sich an dem Büro anschloss, um schon mal mit
dem Packen anzufangen ...
3.
Aldo Burmester hatte einen vierundzwanzigstündigen Flug hinter
sich. In Hamburg hatte er sich in den Flieger gesetzt, ist in
Zürich und Sao Paulo zwischengelandet. Eine Maschine der
brasilianischen Fluggesellschaft VARIG hatte Aldo dann von Sao
Paulo nach Manaus befördert. Die Hauptstadt des brasilianischen
Bundesstaats Amazonien, in den halb Europa hineingepasst hätte,
hatte 2,02 Millionen Einwohner, moderne Hochhäuser und
Geschäftsbauten, die in neuerer Zeit errichtet worden waren, und
eine Menge Prunk- und Protzbauten aus der Zeit des
Kautschukbooms.
Das irrwitzigste Gebäude war das Teatro Amazonas, die überaus
prachtvolle Oper aus einer Zeit, in der die Kautschukbarone sich
alles kaufen und leisten konnten. Sogar Spitzentenöre. Caruso hatte
hier gesungen, wie Aldo Burmester in seinem durchgeschwitzten
Tropenanzug einer Gedenktafel im Foyer entnahm.
Aldo wandelte zwischen den Marmorsäulen und wartete auf die
junge Frau, die er hier treffen sollte.
Sie hieß Jaqueline Grieger und war die Tochter des seit
einigen Wochen vermissten Völkerkundlers und Indianerforschers
Professor Dr. Norbert Grieger. Der Professor war eine weltweit
bekannte Kapazität gewesen. Sein Verschwinden hatte bohrende Fragen
aufgeworfen. Die Wissenschaftliche Fakultät der Universität
Hamburg, für die er gearbeitet hatte, wenn auch nicht
ausschließlich, wollte sie aufgeklärt wissen.
Deshalb hatte der Rektor der Universität Aldo Burmester
angeheuert. Aldo war sofort nach Brasilien geflogen, genauer gesagt
nach Amazonien. Professor Griegers einzige Tochter, die noch
studierte und in die Fußstapfen ihres Vaters treten wollte, war
schon in Amazonien.
Aldo überlegte gerade, ob er sich ins Café des Opernhauses
setzen sollte, als ein hagerer Mestize hinter einer Säule hervor-
und auf ihn zutrat.
»Wie spät ist es Senhor?«, fragte der ziemlich zerlumpt
gekleidete Mann auf Portugiesisch, wovon Aldo nur ein paar Brocken
verstand. Das Tippen aufs Handgelenk, das keine Uhr aufwies, und
die fragende Miene verrieten jedoch, was er wissen wollte.
»Gleich später«, antwortete Aldo und war wohlweislich auf der
Hut.
Der Mestize zog blitzschnell ein Messer unterm Hemd hervor und
stach zu. Aldo blockte den Stich ab, konnte jedoch keinen
Hebelgriff ansetzen. Sein Gegner war drahtig und schnell. Er riss
sich los. Abermals griff er an. Die Mitglieder einer
Besichtigungsgruppe, die mit Führer das neoklassizistische
Opernhaus besuchte, stutzten. Einige schrien auf.
Aldo erhielt eine Schramme am Arm. Er hatte seine Automatic am
Bahnhof im Koffer im Schließfach, weil er sich nicht abschleppen
wollte. Mit einem Mordanschlag hatte der Privatdetektiv nicht
gerechnet. Das rächte sich jetzt.
Sein Gegner, schnell auf den Beinen, versuchte alles, um Aldo
zu erstechen. Er täuschte an, wechselte die Klinge mehrmals rasch
von der Rechten in die Linke und stand Aldo gegenüber, der sich
voll konzentrierte.
Wieder zischte das Messer vor. Aldo drehte im letzten Moment
den Oberkörper. Die Klinge zerfetzte sein Hemd. Der athletische
Privatdetektiv traf den Messerstecher mit dem Ellbogen am Kinn,
dass es nur so krachte. Der Mestize taumelte zurück und fing sich
einen Handkantenschlag von Aldo Burmester ein.
Er verlor das Messer, ging zu Boden, rollte sich über die
Marmorfliesen und sprang katzenhaft schnell wieder auf die Beine.
Er flitzte davon. Ihn zu verfolgen war zwecklos. Aldo presste das
Taschentuch gegen die Schramme am Arm.
Der Führer der Besuchergruppe näherte sich ihm. Als er
feststellte, dass er einen Deutschen vor sich hatte, fragte er Aldo
in verständlichen Deutsch, was der Angriff des Messerstechers auf
ihn zu bedeuten hätte.
»Woher soll ich das wissen?«, fragte der Privatdetektiv. »Das
müssen Sie schon den Messerhelden fragen.«
»Das dürfte kaum möglich sein. Soll ich die Polizei
verständigen?«
»Wozu?«, erwiderte Aldo. »Der Bursche ist weg. Die Schramme
stört mich nicht weiter. Das reicht.«
Der Fremdenführer wünschte Aldo noch einen guten Aufenthalt in
Manaus und bat ihn, seine üble Erfahrung nicht zu verallgemeinern.
Aldo wartete weiter auf Jaqueline Grieger. Ungeduldig schaute er
auf die Uhr. Ein wenig pünktlicher hätte sie schon sein können,
nachdem sie ihn am Flughafen extra hatte ausrufen lassen und ihn
telefonisch zu dem Treffen bestellt hatte.
Oder war es eine Falle gewesen? Befand Frau Grieger sich
vielleicht selbst in Schwierigkeiten? Aldo war drauf und dran, sich
ein Taxi zu nehmen, zum Bahnhof zu fahren und sein Gepäck und das
Schießeisen zu holen. Da sprach ihn ein Wärter der Amazonas-Oper
an. Er trug eine Operettenuniform, mit der er ohne weiteres auf die
Bühne gekonnt hätte. Er steckte Aldo einen Zettel zu.
»Ich werde bedroht und kann Sie nicht im Teatro treffen«, las
Aldo. Die Schrift sah ganz so aus wie von Frauenhand. »Kommen Sie
ganz schnell zur Anaconda-Bar am Fluss, Rua dos Trefes 14. Ich
warte auf Sie. J. G. -P. S.: Seien Sie vorsichtig!«
Die Nachricht hätte ich haben sollen, bevor der Mestize an mir
das Tranchieren üben wollte, dachte Aldo. J. G. waren die Initialen
von Jaqueline Grieger.
»Senhorita Grieger?«, fragte er den Wärter. »Deutsche?«
Der Wärter nickte eifrig. Aldo gab ihm ein Trinkgeld, verließ
die Oper, die jetzt ziemlich sinnlos am Zusammenfluss von Amazonas
und Rio Negro stand, und nahm sich ein Taxi. Er sah nicht mehr, wie
der uniformierte Wärter hinter ihm her grinste und nach dem
Trinkgeld des Gringos sowie einem ganzen Bündel Cruzeironoten
tastete, die er aus anderer Quelle in seiner Tasche trug.
Der Wärter fuhr sich vielsagend mit dem Daumen über die Kehle.
Er hatte eine Halsabschneidernatur. Ihn kümmerte nicht im
Geringsten, dass er den Deutschen in den sicheren Tod geschickt
hatte. Am Amazonas waren Menschenleben billig, und wer fragte nach
einem Fremden?
4.
Es war heiß und schwül jetzt im Juni, die Luftfeuchtigkeit
hoch. Dazu kam noch der Smog, den Manaus wie jede Großstadt hatte.
Von Katalysator und Abgasentgiftung für Autos genau wie die
Industrie, hielten die Brasilianer nicht viel. Umweltschutz wurde
hier klein geschrieben, zum Schaden des rücksichtslos ausgebeuteten
Regenwaldes.
Greenpeace und andere Organisationen, die das ändern wollten,
steckten hier noch in den Kinderschuhen.
Aldo nahm sich ein Taxi und fuhr durchs menschenwimmelnde
Manaus. Die Hauptverkehrsader war noch immer der Fluss, oder waren
vielmehr die Flüsse, nämlich der riesige Amazonas mit seinen
zahlreichen Nebenflüssen. Von Edelhölzern über Kautschuk bis hin zu
den Bodenschätzen, die schwer beladene Frachter aufnahmen, wurden
Tag für Tag Tausende Tonnen auf dem breit und majestätisch
dahinströmenden Amazonas verschifft.
Mit 6.815 Kilometer Gesamtlänge, davon 4.300 schiffbar, und
einem Einzugsbereich von sieben Millionen Quadratkilometern waren
der Amazonas und seine über zweihundert Nebenflüsse die Wasseradern
der Grünen Hölle, in die sich die Zivilisation mit all ihren
Schattenseiten gnadenlos vorfraß. Vertreibung und Völkermord an den
Indiostämmen von Amazonien, Zerstörung des für das Weltklima immens
wichtigen Regenwaldes und rücksichtslose Ausbeutung der
Bodenschätze grassierten hier.
Wer sich dagegen auflehnte, riskierte sein Leben. Soviel
wusste Aldo Burmester schon von der Allgemeinbildung her. Und auch,
dass Professor Grieger Anstoß erregt hatte.
Die »Anaconda-Bar« stand in einem schmuddeligen Stadtteil in
der Nähe des Flusshafens. Die Bar war nicht nur am, sondern auf
Pfählen im Wasser erbaut. Auf ihrer Veranda lungerten finster
aussehende Nichtstuer und zwei Dirnen herum. Außer regelmäßiger
Arbeit und häufigem Waschen schreckte sie nichts im Leben.
Der Taxifahrer kassierte den Lohn für die Fahrt nach Cruzeiros
und war nicht bereit, auf Aldo zu warten, der auf einem Steg zu der
Bar gehen musste. Der Fahrer, ein Schwarzer, konnte sich mit Aldo
verbal schlecht verständigen. Er fuhr sich daher mit dem Daumen
über die Kehle und schaute erst auf Aldo und dann fragend zur Bar.
Wollen Sie wirklich in dieses Mörderloch?, hieß das. Aldo zuckte
die Achseln und ging los.
Schweigen empfing ihn, als er die Bar betrat. Die
Herumlungerer auf der Veranda hatten ihn finster gemustert.
In der Bar drehte sich ein Flügelventilator und verteilte die
heiße Luft. Eine Treppe führte in ein Halbgeschoss hoch. Hinter der
Bar standen Flaschen, hauptsächlich mit Zuckerrohrschnaps, auf den
Regalen.
Der Barkeeper hatte das Hemd bis zum Nabel offen. Es zeigte
einen behaarten Schmerbauch. Mehrere Frauen, die keine Damen waren,
befanden sich in der Bar – Prostituierte in allen
Farbschattierungen, leicht bekleidet, lasziv und verlockend für
jeden, der einige Schnäpse intus hatte und Geschlechtskrankheiten
nicht fürchtete.
Die männlichen Barbesucher, etwa zwanzig in dem mit
Leichtholzmöbeln ausgestatteten Raum, sahen wenig
vertrauenerweckend aus. Sie waren durch die Bank jung, was in
Brasilien, wo 53 Prozent der Bevölkerung unter zwanzig waren, als
normal gelten musste.
Aldo spürte die Spannung in der Bar, über deren Tresen eine
sechs Meter lange ausgestopfte Anakonda hing. Sie war in Windungen
aufgehängt, sonst hätte sie nicht da hingepasst. Aus dem Rachen der
Anakonda ragte ein zur Hälfte verschlungenes, ebenfalls
ausgestopftes Wildschwein.
Ohne Erklärung stellte der Barkeeper Aldo Burmester ein Glas
mit einer wasserhellen Flüssigkeit hin. Der Privatdetektiv in der
leichten Tropenkleidung nippte daran und spuckte die Brühe wie ein
Wasserspeier über den Tresen.
»Condeno – verdammt!« Fluchen konnte Aldo immerhin in der
Landessprache. »Das ist wohl das Zeug, mit dem hier auch die Autos
fahren?«
Fünfundachtzig Prozent der in Brasilien produzierten Autos
waren mit Alkoholmotoren ausgerüstet. Daher die Bemerkung.
Äthanol-Alkohol, aus Zuckerrohr gewonnen, war angesichts der hohen
Ölpreise bei einer jährlichen Inflationsrate von circa fünf Prozent
für Brasilien günstiger. Dafür brauchten keine Devisen aufgewendet
zu werden. Beim Tanken lag das Äthanol um ein Drittel billiger als
Benzin. Importunabhängig war man damit auch noch.
Die Bargäste, Männer wie Frauen, lachten. Eine Mulattin
amüsierte sich so, dass es sie schüttelte und ihr die üppige Brüste
fast aus dem Kleid hüpften. Aldo grinste und verzog keine Miene,
obwohl sein Rachen brannte, als ob er verätzt worden sei.
Ein herkulischer Mestize saß dicht neben Aldo an der Bar. Er
griff nach der Flasche, aus der der Keeper den Drink für Aldo
eingeschenkt hatte, und setzte sie an.
Der Privatdetektiv schaute gespannt zu, was jetzt passieren
würde. Doch nur der Adamsapfel des Mestizen hüpfte, als er trank.
Sein Gaumen und seine Innereien schienen aus Messing zu
bestehen.
»A suada saúde – prosit!«, sagte Aldo.
Der Mestize nickte ihm zu, grinste und zeigte dabei im
Gegensatz zu seinem muskelstrotzenden Körperbau völlig vergammelte
schwarze Zahnstummel. Vielleicht hatte er sie von dem Zeug, das er
trank.
Er schaute auf Aldo, sagte Verschiedenes, was der
Privatdetektiv nicht verstand, und fuhr sich mit dem Daumen über
die Kehle. Das war offensichtlich.
Aldo schaute sich nach einem Fluchtweg um. Doch sämtliche
Ausgänge waren versperrt. Überall standen Bargäste und schauten ihn
an wie der Schlachter den Ochsen.
Der Mestize auf dem Barhocker deutete auf das ausgestopfte
Wildschwein im Rachen der Anakonda und dann auf Aldo. Was er dazu
sagte, erweckte wieder die allgemeine Heiterkeit. Aldo konnte sich
denken, was gemeint war.
Ihm sollte es in der »Anaconda-Bar« gehen wie jenem
Wildschwein. Aldo Burmester behielt die Fassung. Er regte sich
überhaupt selten auf, hatte nur selten Angst. Weniger gefährlich
wurde die Situation davon nicht. Also galt es, kühlen Kopf zu
bewahren.
»Ich suche Senhorita Jaqueline Grieger«, radebrechte er.
Die Bargäste rückten näher. Sie waren entschlossen, Aldo
auseinanderzunehmen. Man erwartete ihn in Amazonien. Cool deutete
Aldo auf die Flasche mit dem gut Achtzigprozentigen.
»Kann ich noch einen Drink haben?«
Der Mestize mit dem schwellenden Bizeps, offensichtlich eine
angesehene Persönlichkeit hier, nickte. Er wollte den Spaß haben,
Aldo nochmals Schnaps speien zu sehen.
Aldo Burmester schenkte sich ein Glas ein, zog seine
Zigaretten hervor und bot dem überraschten Mestizen und dem
Barkeeper eine an. Beide nahmen die Zigaretten, würden deshalb
jedoch nicht geneigt sein, den Deutsche zu verschonen. Aldo hängte
sich selber eine Zigarette in den Mundwinkel und zückte sein
Feuerzeug.
»A suada saúde«, sagte er nochmals, wohlerzogen, wie er war,
und schüttete dem Mestizen mit einer blitzschnellen Bewegung aus
dem Handgelenk den Schnaps in die Augen.
Der Mann brüllte auf wie ein Stier im Schlachthof, den der
Bolzen verkehrt erwischt hatte. Aldo verpasste dem Barkeeper einen
Kinnhaken, zerschlug die Schnapsflasche an der Bar und zündete die
Lache mit seinem Feuerzeug an. Sofort schlug eine Flamme
hoch.
Das geschah blitzschnell. Der Mestize war aufgesprungen und
schlug nach Aldo, konnte ihn jedoch nur verschwommen sehen. Aldo
wich aus und verpasste dem Amazonier eins auf die Leber. Wie
erwartet, hatte sie unter dem achtzigprozentigen Schnaps und
anderen Drinks dieser Sorte gelitten.
Der Mann knickte zusammen. Aldo wich aus, als gleich sechs
Mann sich auf ihn stürzten. Sie behinderten sich gegenseitig. Der
Privatdetektiv ergriff einen Barhocker und schwang ihn im
Halbkreis, um sich Luft zu verschaffen. Das gelang erst
einmal.
Der von Aldo geblendete und angeknockte Mestize lief ins
Feuer. Seine Hosenbeine fingen zu brennen an. Mit flambierten Waden
wetzte der Bursche davon, dass es im wahrsten Wortsinn nur so
qualmte.
Aldo flankte über den Tresen, als er Messer, Schlagringe und
sogar zwei Pistolen sah, mit denen die hiesige Mafia ihm an den
Kragen wollte.
Der Barkeeper holte eine abgesägte Schrotflinte unter dem
Tresen hervor. Aldo entriss dem Keeper die Shotgun und pflanzte ihm
die Faust in den Magen.
Der Privatdetektiv glaubte es kaum. Fast bis zum Ellbogen
verschwand sein Arm in der Wampe. Der Keeper setzte sich hin. Aldo
drohte den andrängenden Ganoven – die Weiber hielten sich wie meist
bei solchen Gelegenheiten im Hintergrund – mit der Shotgun. Weil er
kein Massenmörder werden wollte, schoss er jedoch nicht, sondern
fegte mit dem Kolben Flaschen von den Regalen.
Klirrend zerbrachen sie. Aldo hielt sich nicht damit auf, sein
Feuerzeug zu zücken, sondern schoss in die Schnapslache. Das
Mündungsfeuer entzündete den Hochprozentigen, wie Aldo Burmester es
wollte. Eine Stichflamme loderte auf.
Aldo sprang zurück, um nicht angesengt zu werden. Der Keeper
sprang auf. Es brannte lichterloh in der Bar.
Aldo spuckte die Zigarette aus, die er noch immer unangezündet
im Mund hatte, feuerte den zweiten Flintenlauf ab und schlug sich
mit dem Kolben in Richtung Tür durch. Die Flammen loderten. Rauch
vernebelte die Sicht. Aldo sah eine auf sich gerichtete Pistole,
duckte sich und schlug die Hand mit der Waffe zur Seite.
Der Schuss ging direkt neben seinem Ohr los und sprengte ihm
fast das Trommelfell. Aldo rammte dem Schützen, einem
stoppelbärtigen, hageren Weißen im ehemals weißen Hemd, den
Flintenkolben in den Leib und stieg über den Zusammenbrechenden
hinweg.
Ein Gegner sprang ihm ins Genick und hängte sich auf seinen
Rücken. Ein anderer attackierte ihn mit dem Messer und schrammte
ihn an der Seite. Aldo richtete sich auf. Ohne dass er es wollte,
geriet der auf seinem Rücken Hockende mit dem Kopf in den Flügel
des Ventilators.
Der zog ihm einen ungewollten, sehr tiefen Scheitel. Mit
klaffender Kopfwunde, aufbrüllend, fiel der Bursche zu Boden. Aldo
schlug und boxte sich mit etlichen Gegnern herum. Eine Massenpanik
hatte eingesetzt. Die Frauen flohen kreischend. Aus dem
Halbgeschoss oben, wo es heiß wurde, rannten drei halb- oder ganz
nackte Paare, die sich dort oben einem seit Anbeginn der Menschheit
beliebten Zeitvertreib hingegeben hatten.
Die Angreifer gerieten sich gegenseitig in die Quere. Rauch,
Flammen und Hitze nützten Aldo zusätzlich. Das Feuer fraß sich in
den Holzboden und griff auf die Leichtholzmöbel über. Die Hitze
wurde rasch immer größer.
Der Rauch drang in die Lungen. Qualm und Flammen ließen die
Augen tränen, die Menschen husten. Die Hitze drang bis ins
Knochenmark.
Nichts wie raus, dachte Aldo. Er schlug sich zum Fenster
durch. Zwei Ganoven kamen ihm in die Quere. Den einen hebelte Aldo
mit einem Judowurf aus dem Fenster, dass er draußen über die
Plattform rollte und ins Wasser bei den Pfählen klatschte, auf
denen die Hütte stand. Den Machetenhieb des zweiten Angreifers
blockte Aldo mit der Flinte ab.
Die Machete trennte glatt den Kolben ab. Aldos Uppercut warf
den Gegner zurück in die Flammen, aus denen er wieder auftauchte
und das Weite suchte.
Aldo stieg aus dem Fenster auf die Plattform neben der
Holzhütte. Rauch quoll aus der Bar, und Flammen züngelten hervor.
Drinnen konnte es keiner mehr aushalten.
Tote hatte es keine gegeben, doch mehrere Brandverletzte.
Schnapsflaschen explodierten in der Hütte wie Geschosse und gaben
dem Brand neue Nahrung.
Aldo Burmester sah sich einem guten Dutzend Angreifern
gegenüber, die von zwei Seiten auf ihn eindrangen. Diesmal sah er
die einzige Rettung darin, übers Geländer zu hechten, hinab in den
Fluss. Der Privatdetektiv schwamm zu der Mole, auf der das Taxi ihn
abgesetzt hatte.
Hinter ihm platschte der Mann im Wasser, den er aus dem
Fenster und von der Plattform geworfen hatte. Jetzt geschah etwas,
das Aldo nie in seinem Leben vergessen würde.
Das Wasser bewegte sich. Zähnestarrende Rachen klappten auf.
Der Brasilianer schrie, als die Kaimane, die unter den Pfahlbauten
auf fressbare Abfälle lauerten, über ihn herfielen. Aldo hatte
Glück, dass nicht er das Opfer war.
Er konnte dem Mann nicht helfen. Vielmehr musste er das eigene
Leben retten. Aldo Burmester kraulte wie noch niemals zuvor in
seinem Leben und erreichte die Mole. Aldo stieg eine Eisenleiter
hoch und rannte die Mole entlang, verfolgt von einer Traube
aufgebrachter Freunde des von den Kaimanen Zerrissenen.
Hinter Aldo krachten Schüsse. Freunde des Kaimanenopfers
feuerten auf die Reptile, um sie von ihrer Beute wegzubringen, was
jedoch nicht gelang. Die Hütte mit der »Anaconda-Bar« brannte
lichterloh. Rauch stieg in den Himmel.
Aldo floh von der Mole weg, als ihm ein Mob, von den Rufen der
Verfolger alarmiert, den Weg versperrte. Der Fremde wäre gelyncht
worden. Da Aldo die Landessprache nicht beherrschte, konnte er sich
nicht mal mit Worten verteidigen. Er rannte über schwankende Stege
und Bohlen durch das Gewirr der Pfahlbauten, lief teils auch über
feste Gevierte, auf denen mehrere Hütten standen.
»Assassino!«, kreischte es hinter ihm. »Mörder!«
Die Polizei war weit und breit nicht in Sicht und griff in
diesem Viertel auch selten ein. Aldo keuchte bereits. Der Rauch,
den er eingeatmet hatte, verminderte seine Ausdauer.
Er wäre bald wieder gestellt worden, und diesmal wäre ihm
keine Flucht gelungen. Keuchend lehnte sich der Privatdetektiv in
den durchnässten, schmutzigen Kleidern an eine Hüttenwand. Da
packte eine Hand ihn am Arm.
Aldo wirbelte herum. Doch er sah nur ein junges Mädchen, kaum
älter als siebzehn, mit dunkler Haut neben sich. Sie trug ein
buntbedrucktes Kleid und winkte ihm, ihr in die Hütte zu folgen.
Aldo hörte die Verfolger schon ganz in der Nähe.
Er zögerte nicht. Die Schöne deutete auf einen Wandschirm,
hinter dem Aldo sich verbarg. Möbel gab es kaum in dem Raum. Als
Schlafstätte und Ruhegelegenheit dienten Hängematten, die jetzt
zusammengerollt in der Ecke lagen.
Die Schöne ging an die Tür. Die Verfolger erschienen. Von dem
folgenden Frage- und Antwortspiel verstand Aldo den Wortlaut nicht.
Der Sinn war jedoch leicht zu erraten. Er sah die Caboza, einen
Indio- und Negermischling, im grellfarbigen Kleid an der Tür
stehen. Sie gab sich erstaunt und verneinte, jemand gesehen zu
haben. Sie deutete vielmehr in die andere Richtung. Auch dort
schrien Verfolger.
»Der, den ihr sucht, ist sicher da drüben«, sagte die
Caboza.
Aldo erschrak, als er daran dachte, dass er bei der Hütte
zweifellos noch nasse Spuren und Wassertropfen hinterlassen hatte.
Wenn die Verfolger genau nachschauten, konnte die Caboza sie nicht
täuschen.
Doch das geschah nicht. Die aufgeputschte Meute glaubte dem
Mädchen. Zwei Männer schauten flüchtig in die Hütte, deren Eingang
die Caboza freigab, und verschwanden gleich wieder. Die Verfolger
entfernten sich.
Aldo atmete auf. Zumindest vorerst war er gerettet. Doch so
schnell konnte er die Hütte nicht verlassen. Zweifellos suchten ihn
die Bewohner des Elendsviertels, die ihm nicht alle so freundlich
gesonnen waren wie das siebzehn- oder achtzehnjährige
Mischlingsmädchen. Der Privatdetektiv kam hinterm Wandschirm
hervor. Die Caboza schloss den Vorhang an der Hüttentür.
Sich in den Hüften wiegend, näherte sie sich Aldo Burmester.
Eine Tropenblüte leuchtete in dem schwarzen Haar der Schönen vom
Amazonas. Mit heller Stimme sprach sie mit Aldo, der jedoch kaum
ein Wort verstand.
»Sinha«, sagte die Schöne und deutete auf sich.
Aldo nannte seinen Namen. Sinha lachte silberhell. Sie
bedeutete Aldo, sich zu waschen, und holte eine geflickte,
ausgeblichene Jeanshose und ein Hemd aus einer Truhe. Wasser zum
Waschen befand sich in einer Schüssel auf einem Ständer, auch Seife
und Handtuch. Fließendes Wasser gab es hier nur im Fluss und den
Abwasserkanälen.
Aldo, schmutzig, zerzaust, angesengt und blutbefleckt, hatte
Skrupel, sich vor Sinha zu entkleiden. Sie drehte sich um. Aldo
reinigte sich und zog Sandalen und Hose an. Sinha befestigte eine
Mullbinde mit Klebestreifen an seiner Seite. Aldo zog sie an sich
und küsste sie.
Das war seine Art, Sinha für ihre Hilfe zu danken. Unterhalten
konnten sie sich nicht. Aldo erfuhr nicht, ob Sinha mit ihm Mitleid
gehabt hatte, weil er von einem lynchwütigen Mob verfolgt wurde,
oder ob sie die Verbrecher kannte und hasste, die hinter ihm her
waren. Wichtig war, dass sie ihm geholfen hatte.
Sinha wärmte für Aldo Feiojada auf, Eintopf aus schwarzen
Bohnen mit wenig Schweinefleisch darin. An Farofa, geröstetem
Maniokmehl, bestand dafür kein Mangel. Es war ein Armeleuteessen,
das Aldo jedoch in Sinhas Gesellschaft erstklassig schmeckte. Dazu
bot sie ihm Fruchtsaft an und holte eine halbe Flasche Caipirinha
herbei, Zuckerrohrschnaps mit Zitronensaft.
Sinha lachte und flirtete mit dem Privatdetektiv. Sie stellte
das alte Radio laut und tanzte zu seinen Klängen. Die Caboza war
auf ihre Art ein Naturkind, in der Gegenwart lebend, ohne Falsch
und Berechnung. Sie folgte ihren Gefühlen. Ihre Denkweise war
völlig anders als die einer Nordamerikanerin oder Europäerin. Sie
war eine tropische Blüte des Amazonas, eine junge, doch reife
Frucht, die Aldo in den Schoß fiel.
Sinhas Reiz und natürlicher Sex-Appeal bezauberten ihn. Die
beiden tauschten immer verlangendere Zärtlichkeiten aus und
entkleideten sich. Sinha spannte eine Hängematte und forderte Aldo
mit Gesten auf, sich mit ihr hineinzulegen.
Der Privatdetektiv traute der wackligen Geschichte nicht
recht. Er wurde jedoch eines Besseren belehrt. Die Caboza erwies
sich als Expertin für die Liebe in der Hängematte, die
schaukelnderweise ihre besonderen Reize hatte. Nachdem Aldo erst
mal eingesehen hatte, dass die Schnüre der Hängematte nicht reißen
würden, genoss er den Sex in der Schwebe.
Vor Einbruch der Dunkelheit, besser noch spät in der Nacht,
konnte er sich nicht aus dem Viertel schleichen. Bis dahin galt es,
die Zeit zu verbringen. Sinha erwies sich als äußerst erfinderisch,
was das betraf.
5.
Sinha wohnte nicht allein in der Hütte. Aldo hörte die Stimmen
einer alten Frau, die eines Mannes, dessen Alter er schwer schätzen
konnte – er konnte zwanzig, aber auch fünfzig sein – und die dreier
Kinder. Es kam jedoch niemand in Sinhas Raum. Gerade diese Armen,
die auf engem Raum zusammengepfercht lebten, respektierten die
Intimsphäre des anderen, wo immer es möglich war.
In der Hängematte schmiegte sich Sinha an den Privatdetektiv,
seine Wärme und Nähe suchend. Leise spielte das Radio, das Sinhas
größter Schatz war. Aldo wusste, was dieses Mädchen für ihn
riskierte. Denn wenn der Mob, der Aldo verfolgt hatte, herausbekam,
dass sie ihn aufgenommen hatte und versteckte, war ihr Leben keinen
Cruzeiro mehr wert.
Aldo fürchtete, dass die Caboza von den anderen
Hüttenbewohnern verraten werden könnte. Sinha schien deswegen keine
Angst zu haben. Um drei Uhr morgens, nach einem Cafezinho, einer
kleinen Tasse süßen schwarzen Kaffees, führte sie Aldo aus der
Hütte zu einem schmalen Boot an einem Steg.
Aldo wollte rudern. Doch Sinha erledigte das lieber selbst und
erwies sich als geschickt und kräftig dabei. Ihre Vitalität war
erstaunlich. Sie ruderte durch das Gewirr der Pfahlbauten und
setzte Aldo an der Avenida am Hafen ab.
Aldo fragte sie, indem er darauf deutete, was sie haben
wollte: seine Uhr oder Geld. Sinha schüttelte lächelnd den Kopf.
Sie küsste Aldo, der sie umarmte und ihren Kuss leidenschaftlich
erwiderte. Der Privatdetektiv begriff: Das Mädchen war arm, aber
stolz.
Sie wollte keine Bezahlung für die Hilfe. Hätte Aldo sie ihr
aufgedrängt, hätte er sie beleidigt. An der Avenida verabschiedeten
sie sich. Sinha stieg ins Boot hinunter und ruderte davon.
Sie verschwand hinter dem dickbäuchigen Rumpf eines Frachters.
Mit größter Wahrscheinlichkeit würde der Privatdetektiv sie nicht
wiedersehen. Aldo war seltsam berührt. Selten zuvor in seinem Leben
hatte ihm jemand so selbstlos geholfen und ihm so viel geschenkt
wie dieses Mädchen.
Aldo konnte es Sinha nicht vergelten. Er würde das, was er von
ihr empfangen hatte, an andere weitergeben. Dankbar schlenderte er
in die Stadt. Es galt, ein Quartier zu suchen. Später musste Aldo
sich sein Gepäck vom Bahnhof holen und nach Jaqueline Grieger
suchen. Wenn sie sich in Manaus aufhielt, würde Aldo Burmester sie
finden.
Er fuhr mit dem Taxi zur Hauptpost, nahm sich eine
Dauergesprächszelle und rief der Reihe nach die größeren Hotels an.
Der Privatdetektiv hatte bald Erfolg.
Im »Novo Mundo« in der Praya Flamenco hatte Jaqueline sich
unter ihrem richtigen Namen eingetragen. Aldo ließ sich in ihr
Zimmer durchstellen und nannte seinen Namen.
»Wo stecken Sie denn?«, fragte ihn eine melodische, aber
ungnädige Stimme. »Ich habe Sie schon gestern erwartet.«
»Haben Sie mir einen Boten an den Flughafen geschickt, um mich
zum Teatro Amazonas zu bestellen?«
»Sie meinen diese seltsame Oper? Wie kommen Sie darauf? Ich
habe eine Nachricht für Sie am VARIG-Schalter zwei hinterlegt, wo
Sie hätten hinkommen müssen. Die Nachricht wurde auch abgeholt
...«
»Aber nicht von mir«, sagte Aldo. »Doch darüber wollen wir
persönlich in Ihrem Hotel sprechen. Ich kann mein Fernbleiben mit
guten Gründen entschuldigen.«
»Das hoffe ich«, entgegnete Jacqueline Grieger.
Ihrem Benehmen am Telefon nach zu urteilen, schien sie recht
arrogant zu sein. Aldo verließ die Hauptpost, geriet in einen
Regenschauer, der auf Manaus herunterstürzte, als ob sämtliche
Schleusen des Himmels geborsten seien, und flüchtete in ein Taxi.
Er fuhr zum Hauptbahnhof, wo er sein Gepäck aus dem Schließfach
holte.
Die Automatic und Munition befanden sich in einem
strahlensicheren Behälter. So waren sie bei den Gepäckkontrollen
nicht entdeckt worden. In einer Ecke, wo er unbeobachtet war,
schnallte sich Aldo die Schulterhalfter mit der Automatic um.
Zufrieden atmete er auf. Jetzt fühlte er sich schon um einiges
besser. Das Hotel »Novo Mundo« lag im Stadtkern. Aldo wandte sich
an der Rezeption an eine hübsche, mehrsprachige Angestellte, die
bei Miss Grieger nachfragte und ihn anmeldete.
»Vierter Stock, Zimmer 98«, sagte sie.
Aldo fuhr mit dem Lift hoch, den ein uniformierter schwarzer
Page bediente, und klopfte an die Zimmertür.
»Herein!«, ertönte eine Stimme.
Aldo zog die Automatic, stieß die Tür auf und sprang in das
Zimmer. Mit einem Blick erfasste er die Szene. Eine Blondine – es
musste Jaqueline Grieger sein – lag bäuchlings auf dem Bett. Ein
stiernackiger Weißer kniete auf ihrem Rücken und war dabei, ihre
Hände zu fesseln.
Ein Mulatte, ein baumlanger Kerl mit gleich mehreren
Voodoo-Amuletten um den Hals, und ein spilleriger kleiner Bursche
mit einer Schalldämpferpistole lauerten links und rechts von der
Tür. Der Mulatte schwang den Totschläger, der pfeifend durch die
Luft zischte.
Der Schläger verlor das Gleichgewicht. Aldo schoss nur, wenn
es sich nicht vermeiden ließ. Er trat dem Kleinen gegen die
Pistolenhand und verpasste dem Mulatten mit dem Pistolengriff einen
Schlag ins Genick. Der Mulatte küsste den Teppich.
Der Kleine, ein Weißer, gerade einssechzig groß, also ein
echter Giftzwerg, feuerte in die Decke. Der Schuss knallte nicht
lauter als das Zerplatzen einer Papiertüte.
Der kleine Ganove schaute in die Mündung von Aldos Automatic.
Gleichzeitig hielt Aldo Burmester auch den Mann in Schach, der
Jaqueline Grieger niederzwang. Mit einem Fußtritt schloss der
Privatdetektiv die Tür des geräumigen, modern und teuer
eingerichteten Zimmers.
»Da wären wir alle versammelt«, sagte er. »Lasst eure Waffen
fallen und stellt euch da an die Wand! Rápido!«
Die drei Halunken gehorchten. Der Mulatte hatte sich wieder
erhoben. Er rieb sich das Genick und schaute Aldo Burmester scheu
an.
Senhor Stiernacken fragte in verständlichen Deutsch: »Kannst
du durch geschlossene Türen sehen? Wie hast du die Falle
erkannt?«
»Nur ein Schwachkopf würde auf die verstellte Stimme eures
Komplizen hereinfallen und sie für die Jaqueline Griegers halten«,
antwortete der Privatdetektiv. »Ihr vergaßt, dass ich mit Frau
Grieger telefoniert habe, ihre Stimme also kenne. – Sind Sie okay,
Frau Grieger?«
Die Blondine mit dem Superbusen hatte sich aufgerichtet. Sie
bewegte sich, drückte den Rücken durch und rollte die
Schultern.
»Ich glaube schon, Herr Burmester. Sie sind gerade rechtzeitig
eingetroffen. Diese Burschen sind vor ein paar Minuten bei mir
eingedrungen. Sie haben das Zimmer durchsucht und mich mit dem Tod
bedroht, wenn ich auch nur einen Ton von mir geben würde.«
Die Ganoven waren nach Aldos Telefonat mit Jaqueline Grieger
eingedrungen. Als die Angestellte von der Rezeption anrief, hatten
sie sich auf die Lauer gelegt. Dass eine Durchsuchung des
Hotelzimmers und von Jaqueline Griegers Gepäck begonnen worden war,
war Aldo nicht entgangen.
Die Unordnung im Zimmer und die geöffneten Gepäckstücke, aus
denen der Inhalt gerissen und wahllos verstreut worden war, ließ
keinen anderen Schluss zu.
Aldo ließ die drei sich mit dem Gesicht zur Wand stellen, mit
den Händen abstützen und nach alter Polizeimanier die Füße
zurücksetzen. Aus der Haltung, schräg an die Wand gelehnt, waren
sie zu keiner schnellen Aktion imstande.
Der Privatdetektiv durchsuchte das Trio. Er fand keine
Ausweispapiere bei den Burschen, dafür bei einem ein Messer in
einer an der linken Wade befestigten Scheide, bei einem zweiten
eine kleinkalibrige Pistole. Diese Waffen wie die übrigen auf den
Teppich zu werfen, hatten die zwei »vergessen«. Aldo holte das
nach.
»Wer schickt euch?«, fragte er das Verbrechertrio.
Er erhielt keine Antwort.
Dafür sagte Jaqueline Grieger: »Natürlich die gleichen Leute,
die für den Tod meines Vaters verantwortlich sind. Wir sind hier
ins offene Messer gelaufen, ein Zeichen, wie mächtig die
Organisation ist, gegen die wir uns stellen. Dabei sind wir noch
nicht einmal am Rio Japurá, wo mein Vater verschwand, also vor
Ort.«
»Ob eine Organisation oder einzelne, wird sich herausstellen«,
erwiderte Aldo. »Genauso, ob Ihr Vater noch lebt oder tot ist, Frau
Grieger.«
Die Augen der schönen Studentin füllten sich mit Tränen.
»Ich weiß, dass er tot ist, sonst hätte er sich längst
gemeldet oder mir wenigstens ein Lebenszeichen zukommen lassen«,
schluchzte Jaqueline.
»Vielleicht wird er gefangen gehalten und daran gehindert«,
sagte Aldo.
»Nein, er ist tot. Ich weiß es. Ich spüre es. Aber ich werde
sein Werk weiterführen und mit Ihrer Hilfe das schaffen, was ihm
nicht vergönnt war, Herr Burmester.«
Jaqueline Grieger sprach mit einem geradezu heiligem Ernst.
Aldo widersprach ihr nicht.
6.
Die drei von Aldo Burmester überwältigten Ganoven verrieten
ihre Auftraggeber nicht. Um das verbrecherische Trio loszuwerden,
rief Aldo kurzerhand die Polizei an. Zwei Agenten kamen, die den
drei Halunken kurzerhand die stählerne Acht anlegten. Hier
gebrauchte man sie noch munter. Aldo Burmester und Jaqueline
Grieger wiesen sich als Touristen aus Deutschland aus. Aldo gab an,
er hätte seine Bekannte, Frau Grieger, besuchen wollen und die drei
Verbrecher bei ihr überrascht.
Jaqueline bestätigte diese Version. Das Verbrechertrio sagte
das, was ausgekochte Halunken bei der Verhaftung des Öfteren zu
äußern pflegten, nämlich nichts.
Aldo wurde wegen seiner Pistole gefragt. Er log, sie in Manaus
in einem Waffengeschäft gekauft zu haben. Da in der Provinz
Amazonien jedermann eine Waffe tragen durfte, konnten die
Polizisten dagegen nichts einwenden.
Wegen des Brands und der Schlägerei in der »Anaconda-Bar«
schwieg Aldo wohlweislich. Er hatte keine Lust, solange die
Ermittlungen dauerten, in einer Zelle zu schmoren und am Ende noch
als unerwünschter Ausländer abgeschoben zu werden.
Der Brand in dem Viertel am Fluss musste gelöscht worden sein.
Wegen der Holz- und Leichtbauweise sowie Suff und Leichtsinns der
Bewohner brannte es dort öfter mal. Diejenigen Halunken, die
Brandwunden davongetragen hätten, mussten sich das selbst
zuschreiben. Aldo sah keinen Grund, sie zu bemitleiden. Sie hatten
mit ihm auch keine Gnade gekannt.
Die Polizisten zogen mit den drei Verhafteten ab, die sich
strikt weigerten, auch nur ihre Namen zu nennen. Die Kriminalisten
konnten die Story, dass es sich um einen Fall von Hotelraub
handelte, jedenfalls nicht widerlegen.
Als er mit Jaqueline allein war, schenkte sich Aldo einen
Drink aus der Zimmerbar ein und steckte sich eine Zigarette
an.
»Muss das denn unbedingt sein?«, fragte Jacqueline Grieger.
»Ich bin überzeugte Nichtraucherin. Alkohol ist mir zuwider.
Fruchtsäfte und die vegetarische Lebensweise hingegen mag ich. Sage
mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist.«
Aldo sah ein Opfer der supergesunden Ernährungswelle und
Nichtraucherkampagne vor sich. Er blies den Rauch gegen die
Decke.
»Wer lange raucht, der wird auch alt. Ich bin kein Vegetarier,
sonst hätte ich schon längst ins Gras gebissen. Außerdem macht
vegetarisches Essen dick.«
»Nie im Leben!«
»Doch. Sehen Sie sich nur mal die Kühe auf der Weide an. Sie
sind alle kugelrund.«
»Sie ... Sie ...« Banause, hatte Jaqueline, die in einer
dünnen Bluse und hautengen Hotpants steckte, sagen wollen. Doch das
unterließ sie lieber. Stattdessen riss sie das Fenster auf und
fauchte: »Alkohol- und nikotinsüchtiger Macho!«
»Okay«, sagte Aldo und: »Jedem das Seine.«
Er kam gleich zur Sache und berichtete Jaqueline Grieger in
gereinigter Form, wie er schon am Tag seiner Ankunft zweimal in die
Falle gelockt worden war. Die Massenkeilerei in der »Anaconda-Bar«
handelte er mit drei Sätzen ab. Aus der heißblütigen jungen Sinha,
die ihn gerettet hatte, machte er eine ehrwürdige Matrone, die im
Geschlechtlichen längst jenseits von Gut und Böse war und ihm nur
aus Gnade und Barmherzigkeit geholfen hatte. Den Sexsport in der
Hängematte unterschlug er ganz.
Jaqueline Grieger war seit drei Wochen in Amazonien und hatte
am Rio Japurá nach ihrem verschollenen Vater gesucht. Die Blondine
war mutig und clever. Sie beherrschte die Landessprache perfekt, da
sie sich wie ihr Vater besonders für die Völkerkunde und Ökologie
Südamerikas interessierte.
Jaqueline war in Japurá, wie die Bezirkshauptstadt am
gleichnamigen Fluss hieß, mit ihren Nachforschungen gescheitert.
Auf sich allein gestellt, vermochte sie die Mauer des Schweigens
nicht zu durchdringen, die das Verschwinden ihres Vaters umgab. Sie
war dann nach Igacipu geflogen, dem Dschungelnest, das ihr Vater in
seinen Briefen an sie ein paar Mal erwähnt hatte. Dort hatten sich
ihre Ermittlungen keineswegs besser angelassen. Sie war bedroht und
sogar einmal von vier Männern in den Dschungel verschleppt
worden.
»Sie wollten mich vergewaltigen, um mir die Neugierde ein für
allemal auszutreiben«, schilderte die Zweiundzwanzigjährige. »Ich
konnte mich losreißen. Einen Vergewaltiger trat ich dorthin, wo man
die Zuchtbullen zu kastrieren pflegt, fuhr einem anderen mit den
Fingernägeln in die Augen und rannte in den Dschungel. So kam ich
noch einmal davon. Das Erlebnis reichte mir. Ich flog nach Manaus
zurück. Der FUNAI-Kommissar Carrincho sorgte dafür, dass ein
Buschpilot mich an Bord nahm. Carrincho war froh, mich loszuwerden.
Von Manaus telegrafierte ich an die Universität, einen
erstklassigen Mann herzuschicken, um mich bei meinen
Nachforschungen zu unterstützen.«
Die Universität hatte den Wunsch sofort erfüllt. Aldo fuhr
sich übers Genick.
»Ich bin Privatdetektiv und werde Aldo Burmester genannt.
Vielleicht haben Sie schon mal was von mir gehört.«
»Nein«, antwortete Jaqueline mit schöner Offenheit. »Sollte
ich das?«
»Kommt drauf an, was Sie üblicherweise in der Zeitung lesen
oder welche Meldungen Sie in den Medien verfolgen. Ich bin nicht
versessen auf Publicity. Im Gegenteil.«
Jaqueline musterte ihn skeptisch. Sie schien nicht ganz
überzeugt von Aldo Burmester zu sein.
»Wie eine Ein-Mann-Armee, die ich brauchte, um mit der
Großgrundbesitzer-Bande und den Mördern meines Vaters aufzuräumen,
sehen Sie nicht aus.«
»Wollen Sie Rambo haben?«, fragte Aldo.
»Ich brauche jemand, auf den ich mich unbedingt verlassen
kann, der mutig und unbestechlich ist, hart durchgreift und der
sich durch eine ganze Verbrechermeute bis zu deren Boss
durchschlagen kann.«
»Also einen Supermann. Ich bin an sich Detektiv. Aber wir
können es ja mal versuchen. Wenn Sie unbedingt wollen, überziehe
ich meinen Nacken mit Leder. Soll ich mir auch noch einen Helm mit
Kuhhörnern dran aufsetzen wie die alten Wikinger?«
»Sie machen sich über mich lustig.«
»Das sieht nur so aus. In Wirklichkeit bin ich ein sehr
ernsthafter Mensch. Ich verberge es bloß. Jetzt brauche ich Fakten.
Was haben Sie am Rio Japurá herausfinden können, und was vermuten
Sie, weshalb Ihr Vater, wie Sie mit Überzeugung sagen, ermordet
wurde?«
»Weil er sich gegen die gewaltsame Vertreibung eines ganzen
Indianerstamms stellte«, antwortete Jaqueline. »Gegen Massenmord,
Rechtsbrüche, Diebstahl riesiger Ländereien, verbrecherische
Brandrodung des Dschungels, der riesige Teile der grünen Hölle in
eine grüne Wüste verwandelt und eine Klimakatastrophe
apokalyptischen Ausmaßes fördert, die schon wie ein Menetekel
deutlich an der Wand steht. Gegen Diebstahl gewaltiger
Bodenschätze, nämlich Erzarten bis hin zum Uran. Gegen den
Pflanzen- und Artenmord am Amazonas. Gegen die schandbare,
rechtlose Behandlung der Indios und auch der kleinen Siedler durch
die Großgrundbesitzer und Industriellen wie Luis Jesus Bandeira,
den ungekrönten König am Rio Japurá. Gegen die unheilige Allianz
von Politikern, Großgrundbesitzern und der Kirche, nämlich
bestimmter Sekten, die den Indios das Letzte nehmen und die ihnen
weniger Rechte zugestehen als einem Stück Vieh. Das Vieh nämlich
hat seinen Wert. Es wird gehegt und gepflegt. Die Indios aber sind
Freiwild. – Anfang dieses Jahrhunderts gab es noch um die zwei
Millionen Indios in Brasilien. Jetzt sind es nur noch achtzig- bis
höchstens hunderttausend. Und sie sterben, sterben und sterben. Der
so genannte Indianerschutzdienst SPI war nachweislich an der
systematischen Ausrottung der Indios beteiligt. Da war der Bock zum
Gärtner. gemacht worden. 1967 erfolgten Enthüllungen, die die SPI
auffliegen ließen. Die grausamen Details ihrer Verbrechen will ich
mir sparen. Die FUNAI, die Nachfolgeorganisation der SPI, ist nicht
viel besser.«
Die Worte waren aus Jaqueline Grieger hervorgeströmt und
-gebrochen wie Wasser unter gewaltigem Druck durch einen
geborstenen Staudamm.
Aldo Burmester hatte sich einen Namen gemerkt.
»Wer ist Luis Jesus Bandeira?«
Jaqueline seufzte.
»Vielleicht ist er ganz in Ordnung«, sagte sie bitter. »Er ist
bloß ein paar hundert Jahre zu spät geboren. Er würde noch in das
Zeitalter des Feudalismus gehören, als die regierenden Fürsten über
Leben und Tod ihrer Untertanen entschieden. Als sie sich nehmen
konnten, was immer sie wollten. Sie brauchten bloß stark genug dazu
zu sein. Kein Gesetz hinderte sie. Sie waren das Gesetz. – So einer
ist Bandeira.«
7.
Luis Jesus Bandeira schaute vom Balkon des Haupthauses seiner
riesigen Fazenda. Der König vom Rio Japurá war um die Fünfzig und
schlank, hart und elastisch wie eine Toledaner Degenklinge. Über
mittelgroß, mit buschigen grauen Schläfen, Hakennase und
Falkenaugen war er ein gut aussehender, Achtung gebietender Mann.
Absolute Autorität und ein Hauch von Grausamkeit umgaben Bandeira,
dessen Wort sich im weiten Umkreis alles unterzuordnen hatte.
Der Maßanzug und das Seidenhemd unterstrichen seine gepflegte
Erscheinung. Bandeira blickte über die gewaltigen Rinderherden auf
seiner Fazenda, zu der mehrere Dutzend Gebäude, Swimmingpools und
Tennisplätze genauso gehörten wie die Reitställe samt der
Reithalle, der Privatflughafen und die Hangars mit sechs Maschinen,
Hubschrauber, ein umfangreicher Fuhrpark, Werkstätten und
Arsenale.
Dono Luis, wie er genannt wurde, Dono Jesus wäre eine
Lästerung gewesen, hatte noch mehr Fazendas am Amazonas. Ihm
gehörten riesige Landflächen, Bergwerke, Viehherden und Fabriken.
Leute, die ihn gut kannten, nannten ihn Avido, den Gierigen.
Er verschlang immer mehr, um seinen Reichtum, seine Macht und
seinen Einfluss zu vergrößern. Bandeira hatte längst mehr
angehäuft, als er in hundert Leben verbrauchen konnte. Als Erben
hatte er nur eine Tochter, Alja. Doch er kannte keine Hemmungen und
keine Vernunft, was die Vergrößerung seines Besitzes betraf.
Er war das Haupt der Fronde der Großgrundbesitzer, Berater des
Gouverneurs von Amazonien, und er gehörte in Brasilia, der
Hauptstadt, zum Senado Federal.
Bandeira stand, so konnte man es nennen, einer
Interessengemeinschaft vor, die Amazonien rücksichtslos ausbeutete.
Er hatte den derzeitigen Gouverneur von Amazonien gemacht. Mit dem
Wahlslogan »Wir brauchen keinen Regenwald, was wir brauchen, sind
Industrie und Weideflächen« hatte dieser den Wahlkampf geführt und
gewonnen.
Mit Stimmenkauf und massiver Bedrohung und Bestechung der
Pistoleros von Luis Jesus Bandeira war das gelungen.
Dono Luis sah eine zweimotorige Cessna landen. Sie kam vom
unteren Rio Japurá, der durch den Zusammenfluss mehrerer in den
Anden entspringender Ströme gebildet wurde und ein riesiges
Regenwaldgebiet entwässerte. Dono Luis ging ins Haus, das allen
erdenklichen Luxus aufwies.
Er erachtete ihn für sich als selbstverständlich. Bandeira
wusste, dass es noch einige Minuten dauern würde, bis der mit der
Cessna Eintreffende vor ihm stand.
Er ging zu der Reithalle, wo seine Tochter Alja auf einem
Vollblütler das Dressurreiten übte.
Alja war 23 und eine schwarzhaarige, glutäugige Schönheit. Sie
trug ein golden und silbern besticktes Reitkostüm, einen flachen,
runden Hut und goldene Ohrringe.
Alja saß auf dem grauen Hengst mit dem blank geputzten, reich
verzierten Sattel- und Zaumzeug wie eine Amazone. Dono Luis
lächelte ein wenig unter seinem dünn ausrasierten Schnurrbart, als
er Alja betrachtete. Sie war der einzige Mensch auf der Welt, der
ihm etwas bedeutete.